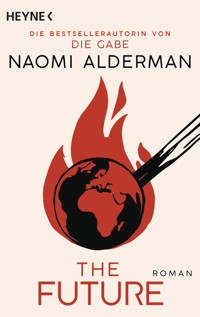9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Naomi Aldermans großer feministischer Roman jetzt in der brandneuen Filmausgabe
Es sind scheinbar gewöhnliche Alltagsszenen: ein nigerianisches Mädchen am Pool. Die Tochter einer Londoner Gangsterfamilie. Eine US-amerikanische Politikerin. Doch sie alle verbindet ein Geheimnis: Von heute auf morgen haben Frauen weltweit »die Gabe« – sie können mit ihren Händen starke elektrische Stromstöße aussenden, andere damit schwer verletzen und sogar töten. Ein Ereignis, das die Machtverhältnisse und das Zusammenleben aller Menschen unaufhaltsam, unwiderbringlich und auf schmerzvolle Weise verändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Es sind scheinbar ganz normale Frauen: eine junge Nigerianerin, die Tochter eines Londoner Gangsterbosses, eine US-amerikanische Politikerin, ein Waisenmädchen. Doch sie alle verbindet, dass sie und viele andere Frauen von heute auf morgen die „Gabe“ besitzen: Sie können mit ihren Händen Stromstöße aussenden, ihre Mitmenschen damit verletzten, ja sogar töten. Plötzlich werden Jungen von Mädchen belästigt, plötzlich sind es die Männer, die in dunklen Gassen Angst haben müssen, vergewaltigt zu werden, plötzlich sind die Frauen das stärkere Geschlecht.
Dies ist die Geschichte von Allie, Roxy, Jocelyn und Tunde, die aus verschiedenen Kulturen kommen und die Zeit des Umbruchs von Anfang an miterleben, mitgestalten und dokumentieren. Keiner von ihnen weiß, woher die Gabe kommt, doch ihnen ist klar, dass sie die Welt für immer verändern wird. Eine Veränderung, die als Chance beginnt und in einer Katastrophe zu enden droht.
Mutig, packend und erschreckend relevant – mit ihrem preisgekrönten Buch Die Gabe hat Naomi Alderman den großen gesellschaftskritischen Roman des 21. Jahrhunderts geschrieben.
Das Buch
Naomi Alderman ist in London aufgewachsen und studierte in Oxford und an der University of East Anglia. Sie stellt bei BBC Radio 4 „Science Stories“ vor und ist Professorin für Kreatives Schreiben an der Bath Spa University. Als Autorin wurde sie bereits mehrfach mit Preisen für junge Autoren ausgezeichnet. Für Die Gabe wurde ihr der renommierten Baileys Women‘s Prize for Fiction verliehen. Naomi Alderman lebt in London.
Mehr über Naomi Alderman und ihren Roman erfahren Sie auf:
www.diezukunft.de
NAOMI ALDERMAN
DIE GABE
ROMAN
Aus dem Englischen übersetzt
von SabineThiele
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der englischen Originalausgabe
THE POWER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibel-Zitate:
[>>] Die Bibel, Einheitsübersetzung, Altes und Neues Testament, Herder Verlag, 2009, S. 277.
[>>] zitiert nach: ebda., S. 265, Rut 1:16.
Deutsche Erstausgabe 04/2018
Redaktion: Martina Vogl
Copyright © 2016 by Naomi Alderman
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestatung: Das Illustrat GbR
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-21985-7V004
www.diezukunft.de
Dieses Werk ist Fiktion. Namen, Personen, Orte und Ereignisse entstammen entweder der Fantasie der Autorin oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen, ob lebend oder tot, oder mit tatsächlichen Ereignissen oder Orten ist zufällig.
Für Margaret und Graeme,
die mir Wunder gezeigt haben
Das Volk kam zu Samuel und sagte: Gib uns einen König, auf dass er uns anführe.
Samuel sagte: Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird: Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über (Abteilungen von) Tausend und zu Führern über (Abteilungen von) Fünfzig machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben. Ihr selber werdet seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien, aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten.
Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte: Nein, ein König soll über uns herrschen. Auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen, er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk sagte, und trug es dem Herrn vor. Und der Herr sagte zu Samuel: Hör auf ihre Stimme und setz ihnen einen König ein!
1 Samuel 8, 11–22
The Men Writer’s Association
New Bevand Square
27. Oktober
Liebe Naomi,
das verdammte Buch ist fertig. Ich schicke es dir, inklusive aller Fragmente und Zeichnungen, in der Hoffnung, Rat von dir zu erhalten oder zumindest endlich das Echo zu hören, wenn ich diesen Stein von Buch in den Brunnen werfe.
Als Erstes wirst du mich fragen, wovon es handelt. »Nicht noch ein Band mit trockener Geschichte«, habe ich versprochen. Nach vier Büchern habe ich erkannt, dass man keinem Leser zumuten kann, sich durch Berge von Belegen zu graben; niemand legt Wert auf die technischen Einzelheiten, wie man Funde datiert und Schichten vergleicht. Ich habe schon oft gesehen, wie der Blick meines Publikums leer wurde, wenn ich meine Forschungen näher erläutert habe. Das hier stellt daher eine Art Hybrid dar, das hoffentlich auch auf etwas durchschnittlichere Leser ansprechend wirkt. Nicht ganz Geschichte, aber auch kein Roman. Vielleicht könnte man es eine Art »Buch zum Ereignis« oder erzählende Dokumentation nennen, die glaubwürdigste Art des Berichts, wie sich Archäologen einig sind. Ich habe einige Illustrationen archäologischer Funde beigefügt, die hoffentlich sinnvoll sind, auch wenn ich mir sicher bin, dass viele Leser sie überblättern werden.
Ich muss dir ein paar Fragen stellen: Ist es sehr schockierend? Zu schwer zu akzeptieren, dass so etwas je passieren konnte, egal, wie weit es in der Vergangenheit zurückliegt? Kann ich irgendetwas tun, um es plausibler erscheinen zu lassen? Du weißt ja, was man sagt: dass »Wahrheit« und der »Anschein von Wahrheit« Gegensätze sind.
Ich habe einiges verstörendes Material zu Mother Eve eingebaut … doch wir wissen ja alle, wie so etwas läuft! Sicherlich wird sich niemand zu sehr darüber aufregen … Heutzutage behauptet ja jeder von sich, Atheist zu sein. Und die ganzen »Wunder« lassen sich ja tatsächlich erklären.
Oje, jetzt bin ich aber wirklich still. Ich will dich nicht beeinflussen, lies es einfach, und sag mir dann, was du davon hältst. Ich hoffe, mit deinem Buch geht es gut voran. Ich kann es kaum erwarten, es zu lesen, wenn es fertig ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mein Manuskript nimmst.
Alles Liebe,
Neil
Nonesuch House
Lakevik
Teuerster Neil,
wow, Wahnsinn! Ich habe bereits ein wenig hineingelesen und kann es gar nicht erwarten, mich voll und ganz darauf zu stürzen. Wie ich sehe, hast du einige Szenen mit männlichen Soldaten, männlichen Polizisten und »Jungsbanden« eingebaut, wie du es angekündigt hattest, du frecher Kerl! Dir muss ich ja nicht sagen, wie sehr mir so etwas gefällt. Du erinnerst dich sicherlich. Ich bin wirklich völlig gebannt.
Mich fasziniert, was du aus den Voraussetzungen gemacht hast. Eine willkommene Abwechslung zu meinem eigenen Buch, wenn ich ehrlich sein soll. Selim sagt, wenn das kein Meisterwerk wird, wird er mich für eine Frau verlassen, die tatsächlich schreiben kann. Ich glaube nicht, dass er weiß, wie sehr mich diese beiläufigen Bemerkungen verletzen.
Egal! Ich freue mich auf dein Buch! Ich glaube, dass mir diese »von Männern regierte Welt« gefallen könnte. Ganz sicher ist es eine freundlichere, rücksichtsvollere und – darf ich das so sagen? – sinnlichere Welt als unsere.
Bald mehr, mein Lieber!
Naomi
NEIL ADAM ARMON
DIE GABE
EIN HISTORISCHER ROMAN
Die Kraft zeigt sich immer in derselben Form, der eines Baumes. Von den Wurzeln bis zu den Wipfeln, mit einem starken Stamm, von dem das Ästegewirr abzweigt und sich zu immer dünneren, tastenden Fingern verjüngt. Die Form der Kraft ist der Umriss eines lebenden Wesens, das nach außen drängt, seine zarten Ranken immer noch ein wenig weiter wachsen lässt.
Wie Flüsse, die zum Meer fließen – Rinnsale werden zu Bächen, Bäche zu Flüssen, Flüsse zu Fluten, die unaufhaltsam voranstürzen und mit aller Macht in die Weiten eines Ozeans sich ergießen.
Wie ein Blitz, der vom Himmel zur Erde niederfährt. Der verästelte Riss im Himmel brennt sich auf der Erde in Fleisch ein. Auch in einem Acrylglasblock breitet sich dieses Muster aus, wenn er von Strom getroffen wird. Wir schicken Elektrizität durch geregelte Schaltkreise und Schalter, doch sie will die Form eines lebenden Wesens annehmen, eines Farnkrautes, eines nackten Zweiges. Der Blitz schlägt in der Mitte ein, das Licht strebt nach außen.
Diese Form wächst in uns allen, unser innerer Baum aus Nerven und Blutgefäßen, inklusive Stamm und aller Äste. Die Signale werden von unseren Fingerspitzen über die Wirbelsäule ins Gehirn geleitet. Wir sind elektrisch. Die Gabe, diese einzigartige Kraft, lebt in uns, wie sie es auch in der Natur tut. Meine Kinder, alles, was hier geschieht, befindet sich im Einklang mit dem Gesetz der Natur.
Macht bewegt sich auf dieselbe Weise unter den Menschen; so ist es einfach. Menschen bilden Dörfer, aus Dörfern werden Städte, aus Städten werden Metropolen, aus Metropolen Staaten. Befehle werden vom Zentrum an die Außenposten weitergegeben, Ergebnisse von den Außenposten ins Zentrum. Es wird beständig kommuniziert. Meere können nicht ohne Rinnsale überleben, kein Baumstamm ohne Knospen, das über allem thronende Gehirn nicht ohne die Nervenenden. Wie oben, so auch unten. Wie an den äußeren Grenzen, so im Herzen direkt.
Daraus folgt, dass es zwei Arten gibt, auf die sich die Natur und der Gebrauch von menschlicher Macht ändern können. Zum einen könnte ein Erlass vom Palast ausgehen, ein Befehl an die Menschen: »So sei es.« Doch die andere Möglichkeit ist viel sicherer, viel unausweichlicher. Abertausende von Lichtpunkten senden eine neue Botschaft aus. Wenn sich die Menschen verändern, kann der Palast nicht standhalten. Denn so steht es geschrieben: »Der Blitz ruht in ihrer Hand, und sie befiehlt ihm einzuschlagen.«
Das Buch Eve, 13–17
Noch zehn Jahre
Roxy
Die Männer sperren Roxy währenddessen in einen Schrank. Sie wissen jedoch nicht, dass ihre Mum sie schon oft darin eingeschlossen hat, wenn sie unartig gewesen war. Nur für ein paar Minuten, bis sie sich beruhigt hat. Dennoch hat sie insgesamt bisher einige Stunden darin verbracht und in dieser Zeit die Schrauben des Schlosses mit ihrem Fingernagel oder einer Büroklammer gelockert. Sie hätte das Schloss daher jederzeit abmontieren können. Doch dann hätte ihre Mum einen Riegel an der Außenseite angebracht. Es reicht ihr, in der Dunkelheit zu sitzen und zu wissen, dass sie sich befreien könnte, wenn sie unbedingt wollte. Dieses Wissen ist genauso gut wie tatsächliche Freiheit.
Deshalb denken die Einbrecher, sie hätten sie ordentlich weggesperrt. Doch sie befreit sich und sieht daher alles mit an.
Die Männer kommen um halb zehn Uhr abends. Roxy hätte bei ihren Cousins sein sollen; seit Wochen war es vereinbart gewesen, doch sie hatte ihrer Mutter vorgeworfen, nicht die richtigen Strumpfhosen von Primark mitgebracht zu haben, weshalb ihre Mum den Abend kurzerhand abgeblasen hatte. Als ob es Roxy so wichtig gewesen wäre, zu ihren blöden Cousins zu gehen.
Als die Typen die Tür eintreten und sie sehen, wie sie auf dem Sofa neben ihrer Mum schmollt, ruft einer: »Verdammt, das Mädchen ist hier.« Sie sind zu zweit, ein Mann ist größer und hat ein rattenhaft schmales Gesicht, der andere ist kleiner, mit einem breiten Kiefer. Sie hat die beiden noch nie gesehen.
Der Kleinere packt ihre Mum an der Kehle, der Größere verfolgt Roxy, die rasch aufgesprungen war, durch die Küche. Sie hat es fast durch die Hintertür geschafft, als er sich in ihren Oberschenkel krallt. Sie fällt nach vorne, und er packt ihre Hüfte. Sie tritt wild um sich und brüllt »Hau ab, lass mich los!«, und als er ihr eine Hand über den Mund legt, beißt sie ihn so fest, dass sie Blut schmeckt. Er flucht, lässt sie jedoch nicht los und trägt sie trotz ihres Widerstandes durchs Wohnzimmer. Der Kleinere hat ihre Mum gegen den Kamin gedrängt. Roxy spürt, wie etwas sich in ihr aufbaut, auch wenn sie nicht weiß, was es ist. Ein Gefühl in ihren Fingerspitzen, ein Prickeln in ihren Daumen.
Sie beginnt zu schreien. Ihre Mum ruft immer wieder: »Tut ja meiner Roxy nichts, wehe, ihr tut ihr etwas, ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr es zu tun habt, das wird euch noch leidtun, ihr werdet euch wünschen, ihr wärt nie geboren. Ihr Vater ist Bernie Monke, verdammt noch mal.«
Der Kleinere lacht. »Zufällig haben wir eine Nachricht für ihren Dad!«
Der Größere schiebt Roxy so schnell in den Schrank unter der Treppe, dass diese kaum weiß, wie ihr geschieht, bis es dunkel um sie wird und sie den süßlich-dumpfen Geruch des Staubsaugers wahrnimmt. Ihre Mum beginnt zu schreien.
Roxys Atem geht schnell. Sie hat furchtbare Angst, aber sie muss unbedingt zurück zu ihrer Mum. Mit dem Fingernagel dreht sie an einer der Schrauben am Türschloss. Ein, zwei, drei Umdrehungen, dann ist es geschafft. Ein Funke blitzt zwischen der Metallschraube und ihrer Hand auf. Statische Aufladung. Sie fühlt sich seltsam. Als könnte sie mit geschlossenen Augen sehen. Ein, zwei, drei Umdrehungen, auch die untere Schraube ist gelöst. Ihre Mum sagt flehend: »Bitte, bitte nicht. Wieso tut ihr das? Sie ist doch noch ein Kind. Sie ist nur ein Kind, um Himmels willen.«
Einer der Männer lacht. »Wie ein Kind hat sie für mich nicht ausgesehen.«
Ihre Mum kreischt auf, es klingt wie Metall, das zerquetscht wird.
Roxy versucht zu erraten, wo sich die Männer befinden. Einer ist bei ihrer Mum. Der andere … ist irgendwo links von ihr. Sie will sich leise aus dem Schrank schleichen, dem Größeren in die Kniekehlen treten, dann auf seinen Kopf. Danach heißt es zwei gegen einen. Wenn sie bewaffnet sind, haben sie es bisher nicht gesagt. Roxy hat schon früher gekämpft. Die Leute sagen Sachen über sie. Ihre Mum. Und ihren Dad.
Eins. Zwei. Drei. Ihre Mum schreit wieder. Roxy zieht das Schloss von der Tür und schlägt diese mit aller Kraft auf.
Sie hat Glück und erwischt den großen Mann von hinten. Er stolpert, fällt nach vorne, sie packt rasch seinen rechten Fuß, und der Angreifer stürzt schwer auf den Teppich. Ein Knacken, Blut schießt aus seiner Nase.
Der Kleinere drückt ihrer Mum ein Messer an den Hals. Die silberne Klinge zwinkert ihr lächelnd zu.
Die Augen ihrer Mutter weiten sich. »Lauf, Roxy«, sagt sie leise, doch Roxy hört es, als spräche die Stimme in ihrem Kopf. »Lauf. Lauf!«
In der Schule drückt sich Roxy nicht vor Prügeleien. Wenn man das tut, werden sie einem bis in alle Ewigkeit nachrufen: »Deine Mum ist eine Schlampe und dein Dad ein Gangster. Passt nur auf, sonst beklaut euch Roxy noch.« Man muss auf sie einprügeln, bis sie um Gnade winseln. Unter gar keinen Umständen läuft man weg.
Etwas geschieht. Das Blut hämmert in ihren Ohren. Ein kribbelndes Gefühl breitet sich über ihre Schultern aus, ihren Rücken, entlang des Schlüsselbeins. Es signalisiert ihr: Du kannst es. Du bist stark.
Sie springt über den ausgestreckt daliegenden Mann, der stöhnend sein Gesicht betastet. Sie wird ihre Mum aus dem Haus bringen. Sie müssen es nur bis auf die Straße schaffen. Da draußen sind sie sicher, es ist ja schließlich noch hell. Sie werden ihren Dad auftreiben, und er wird sich um alles kümmern. Nur ein paar Schritte. Sie schaffen das.
Der Kleinere tritt Roxys Mum hart in den Bauch. Sie krümmt sich vor Schmerzen, sinkt auf die Knie. Er bedroht Roxy mit dem Messer.
Der Große stöhnt: »Tony, vergiss nicht – nicht das Mädchen!«
Der Kleinere tritt seinem Kumpan ins Gesicht, und noch einmal, und noch einmal.
»Sag nicht. Meinen verdammten. Namen!«
Der Große verstummt. Sein Gesicht ist blutüberströmt. Roxy weiß, dass sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Ihre Mutter schreit wieder: »Lauf weg! Lauf!« Roxy fühlt sich, als seien ihre Arme von Nadelstichen übersät. Wie nadelfeine Stiche aus Licht zieht es über ihr Rückgrat zu ihrem Schlüsselbein, von ihrer Kehle zu ihren Ellbogen, Handgelenken, Fingerspitzen. Ein Gefühl, als ob sie unter ihrer Haut glitzert.
Er streckt eine Hand nach ihr aus, das Messer fest in der anderen. Sie macht sich bereit, ihn zu treten oder zu stoßen, doch eine innere Stimme sagt ihr überraschenderweise, sie solle sein Handgelenk packen. Sie gehorcht und befreit irgendetwas tief in ihrer Brust, als ob sie das schon immer gekonnt hätte. Er versucht hektisch, sich von ihr loszureißen, doch zu spät.
Der Blitz ruht in ihrer Hand, und sie befiehlt ihm einzuschlagen.
Etwas knistert und knackt, es riecht ein wenig nach Gewitter und verbranntem Haar. Unter ihrer Zunge schmeckt sie Bitterorange. Der kleinere Mann liegt plötzlich auf dem Boden und wimmert, ein hohes, summendes Geräusch. Seine Hand ballt sich zur Faust und öffnet sich wieder. Eine lange rote Narbe zieht sich vom Handgelenk den Arm hinauf. Sie ist sogar unter der dichten blonden Behaarung gut zu sehen: Scharlachrot schlängelt sie sich wie Farnkraut nach oben, komplett mit Blättern, Ranken, Knospen und Zweigen. Ihre Mutter verfolgt alles schockstarr, mit weit aufgerissenem Mund. Tränen laufen ihr über die Wangen.
Roxy zerrt am Arm ihrer Mum, doch diese bewegt sich zu langsam. Immer wieder sagt sie: »Lauf weg! Lauf!« Roxy hat keine Ahnung, was sie da gerade getan hat, aber sie weiß, dass man, wenn man jemand Stärkeren zu Boden gebracht hat, sofort die Beine in die Hand nimmt. Doch ihre Mum ist zu langsam. Bevor Roxy sie hochziehen kann, sagt der kleinere Mann: »O nein, das wirst du nicht.«
Unsicher rappelt er sich auf und hinkt zur Tür. Eine Hand hängt leblos herab, die andere hält immer noch das Messer umklammert. Roxy erinnert sich an das Gefühl, als sie es getan hat – was auch immer das war. Sie zieht ihre Mum hinter sich.
»Was hast du denn da, Mädchen?«, fragt der Mann. Tony. Sie wird sich den Namen merken und ihn ihrem Dad sagen. »Eine Batterie?«
»Aus dem Weg«, sagt Roxy scharf. »Oder willst du es noch mal spüren?«
Tony tritt ein paar Schritte zurück. Mustert ihre Arme. Überprüft, ob sie etwas hinter dem Rücken versteckt. »Du hast es fallen gelassen, nicht wahr, Kleine?«
Sie erinnert sich an das Gefühl. Wie sich etwas in ihr befreit hat, die Explosion nach außen.
Sie tritt auf Tony zu. Er weicht nicht zurück. Sie macht noch einen Schritt. Er blickt auf seine leblose Hand, deren Finger noch zucken. Er schüttelt den Kopf. »Du hast gar keine Waffe.«
Mit dem Messer in der Hand bewegt er sich auf sie zu. Sie streckt den Arm aus, berührt den Rücken seiner Messerhand. Will es noch einmal freisetzen.
Nichts geschieht.
Er lacht. Hält das Messer mit den Zähnen fest und packt mit einer Hand ihre beiden Handgelenke.
Sie versucht es erneut. Nichts. Er zwingt sie auf die Knie.
»Bitte«, fleht ihre Mum leise. »Bitte nicht.«
Dann bekommt sie einen Schlag auf den Hinterkopf und wird ohnmächtig.
Als sie erwacht, steht die Welt auf dem Kopf. Sie sieht den Kamin, seine Holzumrandung, ihr Gesicht wird dagegen gedrückt. Ihr Kopf schmerzt, und ihr Mund ist im Teppich vergraben. Sie schmeckt Blut. Etwas tropft. Sie schließt die Augen, öffnet sie wieder und erkennt, dass weit mehr als ein paar Minuten vergangen sein müssen. Die Straße vor dem Fenster ist unbelebt, das Haus selbst kalt. Und zur Seite gedreht. Sie macht eine Bestandsaufnahme ihres Körpers. Ihre Beine liegen auf einem Stuhl, sie hängt mit Kopf und Oberkörper nach unten und wird in den Teppich und den Kamin gezwängt. Sie versucht, sich aufzurichten, doch das kostet zu viel Kraft, weshalb sie ihre Beine mit schlängelnden Bewegungen auf den Boden manövriert. Es tut weh, aber wenigstens muss sie sich nicht mehr verrenken.
Die Erinnerung kehrt in Bildblitzen zurück. Der Schmerz, die Quelle des Schmerzes, dieses Etwas, das sie getan hat. Dann ihre Mum. Sie richtet sich langsam auf, ihre Hände kleben. Und irgendetwas tropft immer noch. Der Teppich ist durchweicht, ein roter Fleck zieht sich um den Kamin. Da ist ihre Mum, ihr Kopf hängt über der Sofalehne. Auf ihrer Brust liegt ein Stück Papier, auf dem mit Filzstift eine Primel gezeichnet ist.
Roxy ist vierzehn. Sie ist eine der Jüngsten und eine der Ersten.
Tunde
Tunde zieht seine Bahnen im Pool, wobei er mehr Wasser verspritzt, als er eigentlich müsste, damit Enuma sieht, wie er versucht, nicht zu zeigen, dass er bemerkt werden möchte. Sie blättert durch eine Ausgabe von Today’s Woman. Jedes Mal, wenn er aufsieht, zuckt ihr Blick zurück zu der Zeitschrift, und sie tut so, als wäre sie völlig von einem Artikel über Toke Makinwa und ihrer überraschenden Winterhochzeit gefesselt, die auf ihrem YouTube-Kanal ausgestrahlt worden war. Doch er weiß, dass Enuma ihn beobachtet. Er glaubt, dass sie weiß, dass er es weiß. Ein aufregendes Spiel.
Tunde ist einundzwanzig und endlich den Jahren entwachsen, in denen alles an ihm entweder zu lang oder zu kurz war, in die falsche Richtung zeigte und unbeholfen wirkte. Enuma ist vier Jahre jünger als er, aber viel mehr Frau, als er Mann ist, sittsam, aber nicht abweisend. Auch nicht zu schüchtern, wie ihr Gang verrät oder das Lächeln, das über ihr Gesicht zuckt, wenn sie einen Witz vor den anderen versteht. Ursprünglich kommt sie aus Ibadan und ist in Lagos zu Besuch; sie ist die Cousine eines Freundes eines Typen, den Tunde aus seinem Fotojournalismuskurs am College kennt. Sie sind eine ganze Gruppe, die den Sommer über miteinander herumhängt. Tunde war sie schon an ihrem ersten Tag in der Stadt aufgefallen; ihr in sich gekehrtes Lächeln, ihre Witze, die er zuerst gar nicht als solche erkannte. Der Schwung ihrer Hüften, und wie sich das T-Shirt an ihren Oberkörper schmiegt, o ja. Es war gar nicht so einfach, Zeit allein mit Enuma zu verbringen, und Tunde will die Gelegenheit nutzen.
Enuma hatte einmal gesagt, dass es ihr am Strand nicht gefiel: zu viel Sand, zu viel Wind. Swimmingpools mochte sie lieber. Tunde wartete einen, zwei, drei Tage, bis er einen Ausflug vorschlug – sie könnten alle hinunter zum Akodo Beach fahren, dort den Tag verbringen und picknicken. Enuma sagte sofort, sie wolle nicht mitkommen. Tunde gab vor, es nicht zu bemerken. Am Abend vor dem Ausflug klagte er über einen verdorbenen Magen. Es ist gefährlich, mit Bauchproblemen schwimmen zu gehen – das kalte Wasser könnte einem einen Schock versetzen. Bleib doch besser daheim, Tunde. Aber dann verpasse ich ja den Ausflug ans Meer. Tunde, du solltest nicht im Meer schwimmen. Enuma bleibt auch hier, sie kann einen Arzt rufen, falls du einen benötigst.
Eines der Mädchen sagte: »Aber ihr werdet ja dann ganz allein hier in diesem Haus sein.«
Tunde verfluchte sie im Stillen. »Meine Cousinen kommen später noch«, antwortete er rasch.
Keiner fragte nach, um welche Cousinen es sich handelte. Es war einer dieser heißen und faulen Sommer, in dem die Menschen ein und aus gingen in dem großen Haus ums Eck vom Ikoyi Club.
Enuma hatte keine Einwände, was Tunde erfreut zur Kenntnis nahm. Sie streichelte auch nicht den Rücken ihrer Freundin und bat sie, nicht mit zum Strand zu fahren. Sie sagte nichts, als er eine halbe Stunde nachdem das letzte Auto abgefahren war, aufstand, sich streckte und verkündete, dass er sich sehr viel besser fühlte. Sie beobachtete ihn, wie er von dem kurzen Sprungbrett in den Pool sprang, und wieder blitzte ihr ganz eigenes Lächeln auf.
Er macht eine astreine Drehung unter Wasser, seine Füße durchbrechen kaum die Oberfläche. Er fragt sich, ob sie ihm dabei zugesehen hat, doch sie ist weg. Er sieht sich um und erblickt ihre schlanken Beine und nackten Füße, die sich dem Pool nähern. Offensichtlich war sie in der Küche und hat sich etwas zu trinken geholt.
»Hallo«, sagt er neckend. »Hey, Dienstmädchen, bring mir doch mal die Cola.«
Sie dreht sich um und lächelt mit großen, leuchtenden Augen. Sie sieht sich suchend um und deutet dann mit dem Finger auf ihre Brust, als wolle sie sagen: Wer? Ich?
Gott, er ist so scharf auf sie. Er weiß allerdings nicht genau, was er tun soll. Vor ihr gab es nur zwei andere Mädchen, und keine von ihnen war seine offizielle Freundin. Auf dem College ziehen sie ihn auf, dass er mit seinem Studium verheiratet sei, weil er immer Single ist. Das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Doch er wartet auf die Frau, die er wirklich haben will. Die das gewisse Etwas hat.
Er legt die Handflächen auf die feuchten Kacheln, stemmt sich aus dem Wasser und setzt sich in einer geschmeidigen Bewegung auf den Rand, die seine Muskeln am Oberkörper hervorragend zur Geltung kommen lässt. Er hat ein gutes Gefühl. Das hier wird etwas.
Sie sitzt auf einer Liege. Als er auf sie zukommt, schiebt sie einen Finger unter die Lasche, als wolle sie die Dose öffnen.
»O nein«, sagt er, immer noch lächelnd. »Du weißt doch, dass so etwas nichts für jemanden wie dich ist.«
Sie presst die Coladose an den Bauch, sie muss kalt an ihrer Haut sein. Unterwürfig antwortet sie: »Ich möchte doch nur mal probieren.« Dabei beißt sie sich auf die Unterlippe.
Das macht sie doch bestimmt mit Absicht. So muss es sein. Er ist aufgeregt. Es passiert tatsächlich.
Er ragt hoch über ihr auf. »Gib sie mir.«
Sie hält die Dose in der Hand und rollt sie über ihren Hals, als wolle sie sich abkühlen. Sie schüttelt den Kopf. Dann stürzt er sich auf sie.
Spielerisch ringen sie miteinander. Er achtet darauf, sanft mit ihr umzugehen, und ist sich sicher, dass es ihr genauso viel Spaß macht. Sie hält die Dose hoch über den Kopf, er schiebt ihren Arm ein wenig nach hinten, sodass sie nach Luft schnappt und den Rücken durchdrückt. Er will nach der Coladose greifen, und sie lacht tief und weich. Ein großartiges Lachen.
»Aha, du versuchst also, deinem Herrn und Meister sein Getränk vorzuenthalten«, sagt er. »Was bist du doch für ein ungezogenes Dienstmädchen.«
Wieder lacht sie und windet sich unter ihm. Ihre Brüste drängen gegen den V-Ausschnitt ihres Badeanzugs. »Du bekommst die Dose nie«, erwidert sie. »Ich werde sie mit meinem Leben verteidigen!«
Und er denkt: Klug und wunderschön, der Herr habe Erbarmen mit mir. Sie lacht, er lacht. Er drückt sie mit seinem Körpergewicht auf die Liege, spürt ihren warmen Körper unter sich.
»Glaubst du etwa, du kannst sie mir vorenthalten?« Er will wieder nach der Dose greifen, und Enuma windet sich unter ihm. Er packt ihr Handgelenk.
Sie legt ihre Hand auf seine.
Der Geruch nach Orangenblüten breitet sich aus. Wind kommt auf und weht einige Blütenblätter ins Wasser.
Tunde hat das Gefühl, als habe ihn etwas gestochen. Er senkt den Blick, um das Insekt zu verscheuchen, doch er sieht nur seine Hand in ihrer warmen Handfläche.
Das Gefühl verstärkt sich. Zuerst sticht es in seiner Hand und im Unterarm, dann kribbelt es, schließlich setzt der Schmerz ein. Er atmet zu schnell, bringt keinen Ton heraus. Er kann seinen linken Arm nicht bewegen. Sein Herzschlag dröhnt in seinen Ohren. Seine Brust fühlt sich an wie eingeschnürt.
Sie lacht immer noch, leise und tief, lehnt sich vor und zieht ihn näher zu sich. Sie sieht ihm in die Augen, ihre Iris ist von braunen und goldenen Lichtern durchzogen, ihre Unterlippe ist feucht. Er hat Angst und ist gleichzeitig aufgeregt. Er kann sie nicht aufhalten, egal was sie als Nächstes tun wird. Der Gedanke ist Furcht einflößend. Und gleichzeitig elektrisierend. Er ist so hart, dass es schmerzt, und er hat seine Erektion bisher nicht einmal bemerkt. Sein linker Arm ist völlig gefühllos.
Sie beugt sich noch weiter vor, haucht ihm ihren Kaugummiatem entgegen und küsst ihn sanft auf die Lippen. Dann windet sie sich unter ihm hervor, läuft zum Pool und taucht mit einem geschmeidigen Sprung ins Wasser.
Er wartet, dass das Gefühl in seinen Arm zurückkehrt. Sie zieht ruhig ihre Bahnen, ruft ihm weder etwas zu, noch bespritzt sie ihn mit Wasser. Er ist aufgeregt, schämt sich, will mit ihr reden, doch er hat Angst. Vielleicht hat er sich das alles auch nur eingebildet. Vielleicht beschimpft sie ihn, wenn er sie fragt, was geschehen ist.
Er geht zur Bude an der Straßenecke, um sich einen gefrorenen Orangensaft zu kaufen, damit er nicht mit ihr sprechen muss. Als die anderen vom Strand zurückkehren, stimmt er erleichtert ihren Plänen zu, am nächsten Tag einen entfernten Cousin zu besuchen. Er braucht dringend Ablenkung und möchte nicht allein sein. Er weiß nicht, was passiert ist, und er kann auch mit niemandem darüber reden. Bei der puren Vorstellung, wie er seine Freunde Charles oder Isaac um Rat bittet, schnürt sich seine Kehle zu. Wenn er erzählt, was ihm zugestoßen ist, würden sie ihn für verrückt halten oder schwach oder ihn der Lüge bezichtigen. Er erinnert sich daran, wie sie über ihn gelacht hat.
Er sucht in ihrem Gesicht nach Antworten auf seine Fragen. Was hat sie getan? Wollte sie es? Wollte sie ihm gezielt wehtun oder ihm Angst einjagen? Oder war es nur ein Unfall? War ihr überhaupt bewusst, dass sie etwas getan hatte? Oder war gar nicht sie schuld, sondern irgendeine lustbedingte Fehlfunktion seines Körpers? Die Sache nagt an ihm. Enuma lässt sich nichts anmerken. Am letzten Tag ihres Aufenthalts hält sie Händchen mit einem anderen Jungen.
Scham frisst sich wie Rost durch seinen Körper. Er kann nicht aufhören, an diesen Nachmittag zu denken. Nachts im Bett sieht er ihre Lippen vor sich, ihre Brüste, die sich gegen den dünnen Badeanzug pressen, ihre Nippel, seine vollkommene Hilflosigkeit, das Gefühl, dass sie ihn jederzeit überwältigen könnte. Die Vorstellung erregt ihn, und er berührt sich selbst. Er sagt sich, dass ihn die Erinnerung an ihren Körper erregt, ihr Geruch nach Hibiskusblüten, doch er weiß es nicht sicher. Alles hat sich mittlerweile in seinem Kopf vermischt: Lust und Macht, Verlangen und Angst.
Vielleicht liegt es daran, dass er diesen Nachmittag so oft aufs Neue durchlebt hat, vielleicht, weil er sich nach einem handfesten Beweis sehnt, einem Foto oder einem Video, einer Tonaufnahme. Vielleicht ist das der Grund, warum er im Supermarkt als Erstes nach seinem Handy greifen will. Oder es liegt an den Dingen, die man ihnen am College beizubringen versucht – über den Graswurzel-Journalismus, über den richtigen Riecher für Storys –, und die er tatsächlich verinnerlicht hat.
Ein paar Monate nach dem Zwischenfall mit Enuma ist er mit seinem Freund Isaac in einem Goodies-Supermarkt. Sie stehen gerade beim Obst und Gemüse, atmen den süßen Duft von reifen Guaven ein, davon angezogen wie die kleinen Fliegen, die sich auf der Oberfläche der überreifen, aufgeschnittenen Frucht niederlassen. Tunde und Isaac diskutieren über Mädchen und was diese mögen. Tunde versucht, seine Scham so tief in sich zu vergraben, dass sein Freund nicht ahnt, dass er ein Geheimnis hat. Da gerät ein Mädchen im Supermarkt in Streit mit einem Mann. Er ist etwa dreißig, sie vielleicht fünfzehn oder sechzehn.
Er hat sie angemacht; Tunde dachte zuerst, die beiden kennen sich. Er erkennt seinen Fehler erst, als sie sagt: »Lass mich in Ruhe.« Der Mann lächelt entspannt und macht noch einen Schritt auf sie zu. »Ein hübsches Mädchen wie du verdient doch ein Kompliment.«
Sie beugt sich vor, sieht zu Boden, atmet schwer. Ihre Finger krallen sich in den Rand einer Holztrage voller Mangos. Tundes Haut fängt zu kribbeln an, und er holt sein Handy aus der Tasche, schaltet die Videofunktion ein. Hier geschieht gleich das, was ihm passiert ist. Er will es besitzen, es mit nach Hause nehmen und immer wieder ansehen können. Seit dem Tag mit Enuma kann er an kaum etwas anderes denken, hofft, dass es ihm noch einmal begegnet.
Der Mann sagt: »Hey, schau mich an. Lächel doch mal.«
Das Mädchen schluckt angestrengt und sieht weiter nach unten.
Die Gerüche im Supermarkt intensivieren sich; Tunde kann mit einem Atemzug Äpfel identifizieren, Paprika, süße Orangen.
Isaac flüstert: »Ich glaube, sie verpasst ihm gleich eine mit einer Mango.«
Kannst du die Blitze steuern? Oder sagen sie zu dir: »Hier sind wir?«
Tunde filmt, als sie sich umdreht. Das Bild verschwimmt, als das Mädchen reagiert. Ansonsten bannt er das ganze Geschehen klar und deutlich auf Video. Sie legt ihre Hand auf den Arm des Mannes, während er lächelt und glaubt, dass sie ihre Wut nur spielt. Wenn man das Video an diesem Punkt anhält, sieht man, wie die elektrische Ladung überspringt. Eine Lichtenberg-Figur breitet sich aus, wirbelt und verzweigt sich wie ein Fluss über seine Haut, vom Handgelenk bis zum Ellenbogen, während die kleinen Blutgefäße platzen.
Tunde filmt, wie der Mann zuckend und würgend zu Boden fällt. Dann fängt er das Mädchen ein, als es aus dem Supermarkt flüchtet. Lärm brandet im Hintergrund auf, als andere Kunden nach Hilfe rufen, sagen, das Mädchen hätte den Mann vergiftet. Ihn geschlagen, mit einer Giftspritze angegriffen. Oder nein, zwischen dem Obst war eine Schlange versteckt, eine Viper oder Puffotter. Jemand sagt: »Aje ni girl yen, sha! Das Mädchen war eine Hexe! So tötet eine Hexe einen Mann.«
Tunde richtet die Kameralinse wieder auf den Mann am Boden, der mit den Fersen gegen die Linoleumfliesen trommelt. Rosafarbener Schaum dringt aus seinem Mund, seine Augen sind verdreht. Er schlägt den Kopf hin und her. Tunde dachte, wenn er das Unheimliche in dem hellen Fenster seines Handys einfangen könnte, hätte er nicht länger Angst. Doch als er dem Mann zusieht, der roten Schleim aushustet und weint, kriecht die Furcht wie ein heißer Draht sein Rückgrat entlang. Er weiß jetzt, was er damals am Pool gespürt hat: dass Enuma ihn hätte töten können, wenn sie es gewollt hätte. Er hält die Kamera so lange auf den Mann gerichtet, bis die Sanitäter eintreffen.
Er stellt das Video online und begründet damit den Tag der Mädchen.
Margot
»Das muss eine Fälschung sein.«
»Fox News sagt, dass es echt ist.«
»Fox News sagt immer das, was nötig ist, damit die meisten Leute auch ganz sicher Fox News einschalten.«
»Stimmt schon. Trotzdem.«
»Was sind das für Fäden, die da aus ihrer Hand schießen?«
»Elektrizität.«
»Aber das ist doch … ich meine …«
»Genau.«
»Woher ist das Video?«
»Ich glaube, Nigeria. Ist gestern online gegangen.«
»Es gibt eine Menge Verrückte da draußen, Daniel. Fälscher, Betrüger.«
»Es gibt noch mehr Videos. Seit das hier aufgetaucht ist, sind noch vier oder fünf weitere hochgeladen worden.«
»Fälschungen. Die Leute lassen sich von so etwas mitreißen. Das sind … wie heißt das noch? … Memes, Internetphänomene. Hast du von diesem Slender Man gehört? Einige Mädchen haben versucht, ihm ihre Freundin zu opfern. Nicht ihm, dieser Kunstfigur. Schrecklich.«
»Vier oder fünf Videos pro Stunde, Margot.«
»Verdammt.«
»Ja.«
»Nun, und was soll ich jetzt tun?«
»Die Schulen schließen.«
»Hast du auch nur eine Ahnung, was ich mir dann von den Eltern anhören darf? Kannst du dir die Millionen wählender Eltern vorstellen und was sie tun werden, wenn ich ihre Kinder heute nach Hause schicke?«
»Kannst du dir vorstellen, was du dir von den Lehrerverbänden anhören darfst, wenn eines ihrer Mitglieder verletzt wird? Verkrüppelt? Getötet? Denk doch an die Haftung.«
»Getötet?«
»Wir müssen mit allem rechnen.«
Margot blickt auf ihre Hände, die die Schreibtischkante umklammern. Wenn sie auf Daniels Empfehlung eingeht, macht sie sich zum Idioten. Das muss doch einfach ein Video für irgendeine Fernsehsendung sein. Sie wird als die Dumpfbacke dastehen, die Bürgermeisterin, die die Schulen dieser riesigen Metropole wegen eines verdammten Scherzes schließen lässt. Aber wenn sie sie nicht schließt und etwas passiert … Daniel wird der Gouverneur dieses Bundesstaates sein, der die Bürgermeisterin gewarnt hat, der versucht hat, sie zum Handeln zu überreden, leider jedoch vergeblich. Sie sieht schon die Tränen vor sich, die über seine Wangen laufen, während er über eine Live-Schaltung aus dem Präsidentensitz interviewt wird. Scheiße.
Daniel wirft einen Blick auf sein Handy. »In Iowa und Delaware werden die Schulen geschlossen«, verkündet er.
»Na gut.«
»Und das heißt?«
»Genau das. Na gut. Ich werde die Schulen schließen.«
Die nächsten vier oder fünf Tage vergehen wie in einem Traum. Sie kann sich nicht erinnern, das Büro verlassen zu haben, nach Hause gefahren oder ins Bett gegangen zu sein, auch wenn sie all das getan haben musste. Ihr Telefon hört nicht auf zu klingeln. Sie geht damit ins Bett und hält es beim Aufwachen immer noch in der Hand. Die Mädchen sind zum Glück bei Bobby, sodass sie sich darum nicht kümmern muss. Und Gott möge ihr vergeben, aber sie denkt auch nicht an ihre Töchter.
Das unheimliche Phänomen hat sich über die ganze Welt ausgebreitet, und keiner weiß, was eigentlich vor sich geht.
Anfangs sah man noch zuversichtliche Gesichter im Fernsehen, Sprecher der CDC, der amerikanischen Seuchenschutzbehörde, die die Ansicht vertraten, es handele sich um ein leichtes Virus, von dem sich die Betroffenen gut erholten. Außerdem sehe es nur so aus, als würden junge Mädchen Menschen mit ihren Händen einen Stromschlag verpassen. Wir wissen doch alle, dass das unmöglich ist, nicht wahr, völlig verrückt – die Nachrichtensprecherinnen lachten so sehr, dass ihr Make-up Risse bekam. Und weil es gerade so lustig war, holten sie Meeresbiologen ins Studio, die etwas von Zitteraalen und deren spezifischen Fähigkeiten erzählten. Ein verschrobener Typ mit Vollbart, eine junge Wissenschaftlerin mit Brille, Fische in einem Aquarium – die heutige Ausgabe des Frühstücksfernsehens ist gesichert. Kristen, wusstest du, dass der Erfinder der Batterie sich von Zitteraalen inspirieren ließ? Nein, Tom, das wusste ich nicht, wie interessant. Ich habe gehört, dass sie ein Pferd zu Fall bringen können. Nein, wirklich? Das hätte ich nie gedacht. Ein japanisches Labor hat offenbar seine Weihnachtsbaumlichter mit dem Strom aus einem Tank voller Zitteraale betrieben. Das können wir aber mit den Mädchen nicht machen, nicht wahr? Ich glaube nicht, Kristen, ich glaube nicht. Obwohl – ist denn nicht jedes Jahr früher Weihnachten? So fühlt es sich zumindest an. Und jetzt zum Wetter.
Bürgermeisterin Margot und ihr Büro haben die Bedrohung schon längst ernst genommen, bis auch die Nachrichtensender begreifen, dass eine reale Gefahr besteht. Sie bekommen schließlich die ersten Berichte über Kämpfe auf den Spielplätzen. Ganz seltsame neue Auseinandersetzungen, bei denen die Jungen – meistens, manchmal auch Mädchen – Narben zurückbehalten, die sich wie Blattwerk über ihre Arme, Beine oder das weiche Fleisch ihres Bauches emporwinden, nachdem sie atemlos und zuckend zu Boden gegangen waren. Der erste Gedanke, wenn es sich hier um keine Krankheit handelt, gilt einer neuen Waffe, die die Kinder in die Schule mitbringen. Doch mit Anbruch der zweiten Woche der unheilvollen Vorkommnisse weiß man, dass auch das nicht die Erklärung ist.
Man klammert sich an jede verrückte Theorie, die kursiert, und weiß nicht, wie man Wahrscheinliches von Lächerlichem trennen soll. Eines Abends liest Margot einen Bericht von einem Team aus Delhi, die als Erste den seltsamen, muskelartigen Auswuchs entdeckt haben, der sich über das Schlüsselbein der betroffenen Mädchen zieht. Sie nennen ihn »das Organ der Elektrizität« oder den Strang, wegen der ineinander verschlungenen Muskelstränge. An den Punkten, an denen er mit dem Schlüsselbein verwachsen ist, ermöglichen vermutlich Rezeptoren eine Form von elektrischer Echoortung. Mittels MRT hat man die Wurzeln des Strangs in den Schlüsselbeinen neugeborener Mädchen nachgewiesen. Margot kopiert den Bericht und schickt ihn per E-Mail an jede Schule im Staat. Ein einziger handfester, wissenschaftlich belegbarer Hinweis in der Flut an wirren Vermutungen. Selbst Daniel ist kurzzeitig dankbar, bevor ihm wieder einfällt, dass er sie ja eigentlich hasst.
Ein israelischer Anthropologe vertritt die Ansicht, dass die Entwicklung dieses Organs in einem Menschen der Beweis der Wasseraffentheorie ist; dass wir unbehaart sind, weil wir uns aus den Weltmeeren heraus entwickelt haben, nicht aus dem Urwald. Wie der Zitteraal oder der Zitterrochen hätten wir früher die Meerestiefen in Angst und Schrecken versetzt. Prediger und Fernsehevangelisten stürzen sich auf die Meldung und extrahieren daraus unleugbare Vorzeichen auf den bevorstehenden Weltuntergang. In einer beliebten Wissenschaftssendung bricht eine Schlägerei zwischen einem Wissenschaftler und einem Mann Gottes aus. Ersterer fordert, dass die elektrisch geladenen Mädchen operativ untersucht werden sollten, Letzterer glaubt, sie seien die Vorboten der Apokalypse, und kein Mensch dürfe Hand an sie legen. Man streitet darüber, ob dieses neue Organ schon immer im menschlichen Genom versteckt war und jetzt zum Leben erweckt wurde, oder ob es sich hier um eine Mutation handelt, eine schreckliche Deformierung.
Vor dem Einschlafen denkt Margot an geflügelte Ameisen, die an just einem Tag im Sommer das Haus am See einnehmen, wie der Boden von ihnen wimmelt, wie sie sich an die Holzfassade klammern, wie die Baumstümpfe vor Flügelschlägen vibrieren. Die Luft ist so voller Ameisen, dass man sie fast unweigerlich einatmet. Das ganze Jahr über leben sie allein für sich unter der Erde. Sie entwickeln sich aus den Eiern, sie essen – Staub und Samen, was auch immer –, und sie warten, warten. Eines Tages, wenn die Temperatur einige Tage lang ideal war, wenn die Luftfeuchtigkeit ebenfalls die richtige Höhe erreicht hat … dann erheben sie sich alle gleichzeitig in die Luft. Um sich zu finden. Margot konnte diese Gedanken mit niemandem teilen. Man würde denken, über den ganzen Stress sei sie verrückt geworden. Außerdem gibt es weiß Gott genug Leute, die auf ihren Posten scharf sind. Dennoch liegt sie abends im Bett, nach einem langen Tag, an dem sie sich mit Berichten von verbrannten Kindern herumgeschlagen hat, Kindern mit Krampfanfällen, gegeneinander kämpfenden Mädchengangs, die man zu ihrer eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen hat, und denkt: Warum jetzt? Warum gerade jetzt? Und immer wieder muss sie an die geflügelten Ameisen denken, die auf den Sommer warten, auf den richtigen Zeitpunkt.
Drei Wochen nach Bekanntwerden der ersten Zwischenfälle ruft Bobby sie an, man habe Jocelyn beim Kämpfen erwischt.
Am fünften Tag hatten sie die Mädchen von den Jungen getrennt, nachdem klar geworden war, dass die Aggression von den Mädchen ausging. Eltern befehlen ihren Söhnen bereits, nicht allein aus dem Haus zu gehen, sich nicht zu weit davon zu entfernen. »Wenn man einmal gesehen hat, wie es passiert …«, sagt eine graugesichtige Frau im Fernsehen. »Ich habe gesehen, wie ein Mädchen im Park einen Jungen grundlos angegriffen hat. Das Blut ist aus seinen Augen geströmt. Seinen Augen! Wenn man es einmal gesehen hat, darf keine Mutter ihre Söhne mehr unbeaufsichtigt lassen.«
Allerdings konnte man das öffentliche Leben nicht für immer einfrieren; man musste es umorganisieren. Jungen wurden mit speziellen Bussen in nur für sie bestimmte Schulen transportiert. Man gewöhnte sich rasch daran. Man musste sich nur ein paar Videos im Internet anschauen, um von der realen Gefahr überzeugt zu sein.
Für die Mädchen kann dagegen keine so einfache Lösung gefunden werden. Man kann sie nicht voneinander fernhalten. Einige sind wütend, andere bösartig, und nachdem sich jetzt keine mehr verstecken muss, wollen einige ihre Kraft und neu gewonnenen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es gab Verletzungen und Unfälle, ein Mädchen wurde von einem anderen geblendet. Die Lehrer sind verängstigt. Fernsehexperten sagen: »Sperrt sie alle in Hochsicherheitsgefängnisse.« Soweit man das bisher sagen kann, sind alle Mädchen im Alter von etwa fünfzehn Jahren betroffen. Man kann sie nicht alle einsperren, das ist sinnlos. Dennoch fordert es die Öffentlichkeit.
Jetzt hat man also auch Jocelyn erwischt. Die Presse weiß schon davon, noch bevor Margot zu Hause bei ihrer Tochter eingetroffen ist. Die Wagen der Fernsehsender drängen sich vor ihrem Haus. Frau Bürgermeisterin, was können Sie zu den Gerüchten sagen, dass wegen Ihrer Tochter ein Junge im Krankenhaus liegt?
Nein, dazu kann sie nichts sagen.
Bobby sitzt im Wohnzimmer auf der Couch, Maddy neben ihm. Sie trinkt ihre Milch und schaut Powerpuff Girls. Ihr Blick zuckt kurz zu ihrer Mutter, als diese den Raum betritt, dann wieder zurück zum Fernsehbildschirm. Zehn, und benimmt sich schon wie fünfzehn. Okay. Margot küsst Maddy auf den Kopf und ignoriert, dass ihre Tochter an ihr vorbei zum Fernseher schauen will. Bobby drückt Margots Hand.
»Wo ist Jos?«
»Oben.«
»Und?«
»Sie ist genauso verängstigt wie alle anderen.«
»Verständlich.«
Margot schließt leise die Schlafzimmertür.
Jocelyn sitzt mit ausgestreckten Beinen auf dem Bett und hält Mr. Bear. Sie ist doch noch ein Kind. Nur ein Kind.
»Ich hätte dich anrufen sollen«, sagt Margot, »sobald es angefangen hat. Es tut mir leid.«
Jocelyn ist den Tränen nahe. Margot setzt sich vorsichtig auf das Bett. »Dad sagt, du hast niemanden verletzt, zumindest nur leicht.«
Jos schweigt, weshalb Margot einfach weiterredet. »Da waren noch … drei andere Mädchen? Ich weiß, dass sie angefangen haben. Dieser Junge hätte sich dir überhaupt nicht nähern dürfen. Man hat sie im John Muir Hospital untersucht. Du hast den Jungen nur erschreckt.«
»Ich weiß.«
Gut. Verbale Kommunikation. Ein Anfang.
»War das … das erste Mal?«
Jocelyn verdreht die Augen. Mit einer Hand zupft sie an der Tagesdecke.
»Das hier ist für uns beide etwas Neues, okay? Wie lange spürst du es schon?«
Ihre Tochter antwortet so leise, dass Margot sie kaum verstehen kann. »Sechs Monate.«
»Sechs Monate?«
Falsch. Zeig niemals Ungläubigkeit, niemals Besorgnis. Jocelyn zieht die Beine an.
»Es tut mir leid«, sagt Margot. »Es ist nur … eine Überraschung.«
Jos runzelt die Stirn. »Viele Mädchen haben schon vor mir angefangen. Irgendwie … war es lustig. Wie eine statische Aufladung.«
Statische Aufladung. Wie war das – man kämmte sich das Haar, und dann blieb ein Ballon daran haften? Ein Spiel für Sechsjährige an Kindergeburtstagen.
»Es war einfach so etwas Lustiges, Verrücktes, was nur Mädchen gemacht haben. Es gab geheime Videos im Netz. Wie man Tricks damit anstellen konnte.«
In einem Alter, in dem Geheimnisse vor den Eltern kostbar sind. Alles, von dem die Erwachsenen noch nie gehört haben.
»Wie hast du … woher weißt du, was du tun musst?«
Jos antwortet: »Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwann einfach das Gefühl, dass ich es kann. Es ist irgendwie wie … wenn man etwas loslässt.«
»Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du es mir nicht erzählt?«
Sie sieht durch das Fenster in den Garten. Hinter dem hohen Zaun drängen sich Männer und Frauen mit Kameras.
»Ich weiß es nicht.«
Margot erinnert sich, wie sie damals versucht hat, mit ihrer eigenen Mutter über Jungs oder das, was auf Partys passierte, zu reden. Was »zu weit« genau bedeutete, wo die Hand eines Jungen innehalten sollte. Sie erinnert sich, wie unmöglich solche Gespräche waren.
»Zeig es mir.«
Jos verengt die Augen. »Ich kann nicht … ich würde dir wehtun.«
»Hast du geübt? Kannst du es so gut kontrollieren, dass du mich nicht töten oder einen Anfall auslösen würdest?«
Jos holt tief Luft, bläst die Wangen auf, atmet langsam aus. »Ja.«
Ihre Mutter nickt. Das ist die junge Frau, die sie kennt: gewissenhaft und ernst. Jos ist immer noch da. »Dann zeig es mir.«
»Ich habe es nicht so weit im Griff, dass es nicht wehtut. Okay?«
»Wie sehr wird es schmerzen?«
Jos spreizt die Finger, blickt auf ihre Handflächen. »Es kommt und geht. Manchmal ist der Schlag stark, manchmal kaum spürbar.«
Margot presst die Lippen aufeinander. »Okay.«
Jos streckt die Hand aus, zieht sie wieder zurück. »Ich will nicht.«
Früher einmal war es Margots Aufgabe, jeden Millimeter dieses Kinderkörpers zu säubern und zu pflegen. Sie muss wissen, über welche Kraft ihre Tochter verfügt. »Keine Geheimnisse mehr. Zeig es mir.«
Jos ist den Tränen nahe. Sie legt Zeige- und Mittelfinger auf den Arm ihrer Mutter. Margot wartet, ob Jos irgendetwas tut; den Atem anhält, die Stirn furcht oder die Muskeln in ihrem Unterarm anspannt. Nichts. Nur der Schmerz, der sie plötzlich durchzuckt.
Sie hat die vorläufigen Berichte der CDC gelesen, die zu dem Schluss gekommen sind, dass diese geheimnisvolle Kraft »besonders das Schmerzzentrum im menschlichen Gehirn angreift«. Das bedeutet, dass der elektrische Schlag stärker schmerzt, als er eigentlich sollte. Ein gezielter Impuls, der eine Antwort der körpereigenen Schmerzrezeptoren triggert. Nichtsdestotrotz hätte sie erwartet, etwas zu sehen: verbranntes Fleisch oder den Lichtstrahl aus den Fingern ihrer Tochter, so schnell wie der Biss einer Schlange.
Stattdessen breitet sich der Geruch nach regenfeuchtem Laub aus. Ein Apfelhain, in dem das Fallobst vergärt, genauso wie auf der Farm ihrer Eltern.
Dann setzt der Schmerz ein. An der Stelle, an der Jos ihren Unterarm berührt, spürt sie es tief im Knochen. Wie die Grippe, die sich in Muskeln und Gelenken festsetzt. Das Gefühl verstärkt sich. Etwas lässt ihren Knochen knacken, verdreht ihn, biegt ihn, und sie will Jos schon bitten aufzuhören, doch sie kann den Mund nicht öffnen. Es gräbt sich durch den Knochen, als wolle es ihn von innen zersplittern; sie stellt sich einen Tumor vor, eine feste, klebrige Masse, die sich in ihrem Knochenmark ausbreitet, Elle und Speiche in scharfe Stücke sprengt. Ihr wird übel. Sie will schreien. Der Schmerz pulsiert durch ihren Arm, ihren ganzen Körper. Sie spürt das Echo im Kopf, in ihrer Wirbelsäule, in ihrem ganzen Rücken. Es wandert zu ihrer Kehle und breitet sich über das Schlüsselbein aus.
Das Schlüsselbein. Nur ein paar Sekunden dauert der Angriff, doch es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Nur Schmerz lässt einen so in den Körper hineinhorchen. So bemerkt Margot das Antwortecho in ihrer Brust. Zwischen den Wäldern und Bergen aus Schmerz erklingt eine helle Note an ihrem Schlüsselbein. Gleiches ruft nach Gleichem.
Sie fühlt sich an etwas erinnert. Ein Spiel, das sie als Mädchen gespielt hat. Wie seltsam, daran hat sie seit Jahren nicht gedacht. Sie hat nie jemandem davon erzählt; aus irgendeinem Grund wusste sie, dass sie das nicht durfte. Bei dem Spiel war sie eine Hexe und konnte eine Lichtkugel in ihrer Hand formen. Ihre Brüder spielten, sie wären Raumfahrer mit Plastikstrahlerkanonen, die sie mit Sammelcoupons aus Cornflakespackungen gekauft hatten. Doch das Spiel, in das sie allein bei den Buchen am Rand des Grundstücks versunken ist, war etwas völlig anderes. Sie brauchte keine Pistole, keinen Astronautenhelm oder ein Laserschwert. Sie selbst war sich völlig genug.
Ein kribbelndes Gefühl breitet sich in Brust und Armen und Händen aus. Wie ein eingeschlafener Körperteil, der gerade wieder aufwacht. Der Schmerz ist nicht verschwunden, aber in den Hintergrund gerückt. Irgendetwas anderes geschieht gerade. Instinktiv krallt sie ihre Hände in Jocelyns Patchworktagesdecke. Der Geruch der Buchen steigt ihr in die Nase, als befände sie sich wieder unter ihren schützenden Blätterhauben, umgeben vom Duft nach altem Holz und nassem Lehm.
Sie schickt ihr Licht bis ans Ende der Welt.
Als sie die Augen öffnet, sieht sie das Muster, das sich auf ihren Händen abzeichnet. Konzentrische Kreise, hell und dunkel, hell und dunkel, die sich auch in die Tagesdecke gebrannt haben. Und sie weiß es, sie hat die Eruption gespürt, und sie erinnert sich, dass sie es vielleicht schon immer gewusst und es schon immer ihr gehört hat. Sie soll es in der Hand halten, sie soll darüber befehlen.
»O Gott«, sagt sie. »O Gott.«
Allie
Allie zieht sich auf das Grab und lehnt sich zurück, um die Aufschrift auf dem Grabstein zu lesen. Sie widmet den Menschen unter ihr immer einen Moment: Hey, wie geht’s Ihnen, Annabeth MacDuff, liebevolle Mutter? Dann zündet sie sich eine Marlboro an.
Zigaretten gehören zu den etwa vier- oder fünftausend Freuden auf dieser Erde, die Mrs. Montgomery-Taylor im Angesicht des Herrn für verabscheuungswürdig hält. Die glühende Asche, das Inhalieren, der Rauch, der zwischen den geöffneten Lippen entweicht, das alles sagt laut und deutlich: Leck mich, Mrs. Montgomery-Taylor, leck mich, und die ganzen Kirchendamen und Jesus fucking Christus ebenso. Es hätte völlig gereicht, es auf die herkömmliche Art und Weise zu tun, immer noch beeindruckend und ein ausreichendes Versprechen hinsichtlich der Dinge, die da noch kommen würden. Doch Allie hat keine Lust, ihre Zigarette auf die übliche Art und Weise anzuzünden.
Kyle deutet mit dem Kinn in Richtung Zigarette und sagt: »Hab gehört, dass ein paar Jungs letzte Woche ein Mädchen in Nebraska deswegen umgebracht haben.«
»Weil sie geraucht hat? Ganz schön heftig.«
Hunter sagt: »Die Hälfte der Kids in der Schule weiß, dass du es kannst.«
»Und?«
Hunter erwidert: »Dein Dad könnte dich in seiner Fabrik brauchen. Spart Geld und Strom.«
»Er ist nicht mein Dad.«
Sie lässt wieder eine silberne Flamme an ihren Fingerspitzen aufglühen, während die Jungs zusehen.
Als die Sonne untergeht, erwachen die Grillen und Frösche auf dem Friedhof zum Leben, warten auf den Regen. Der Sommer war lang und heiß. Die Erde lechzt nach Gewittern.
Mr. Montgomery-Taylor besitzt eine Fleischverpackungsfabrik mit Niederlassungen hier in Jacksonville, oben in Albany und sogar in Statesboro. Man nennt es Fleischverpackung, aber eigentlich geht es um Fleischproduktion. Das Töten von Tieren. Mr. Montgomery-Taylor hat Allie als junges Mädchen dorthin mitgenommen. Er hielt sich wohl für einen guten Mann, der ein kleines Mädchen in die Männerwelt einführt. Sie ist irgendwie stolz darauf, dass sie sich alles angesehen hat, ohne mit der Wimper zu zucken oder wegzulaufen. Mr. Montgomery-Taylors Hand lag die ganze Zeit auf ihrer Schulter wie eine Klaue, schob sie zu den Boxen, in denen die Schweine zusammengepfercht wurden, bevor man ihnen die Kehle durchschnitt. Schweine sind sehr intelligente Tiere. Wenn man sie verängstigt, schmeckt das Fleisch danach nicht mehr. Man muss sehr vorsichtig sein.
Hühner sind nicht intelligent. Sie darf zusehen, wie die Hühner ausgepackt werden, ganz weiß und fedrig. Die Hände, die nach ihnen greifen, sie umdrehen, ihre weißen Hinterteile zeigen, ihre Beine an das Förderband fesseln, das ihre Köpfe durch ein mit Strom versetztes Wasserbecken zieht. Die Vögel kreischen und winden sich. Einer nach dem anderen versteift sich und erschlafft.
»Es ist eine Gnade«, sagte Mr. Montgomery-Taylor. »Sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht.«
Er lachte, und seine Angestellten stimmten ein.
Allie hatte bemerkt, dass ein oder zwei Hühner die Köpfe gehoben hatten. Das Wasser hatte sie nicht betäubt. Sie waren immer noch bei Bewusstsein, als sie im Brühtrog landeten.
»Effizient, hygienisch und rücksichtsvoll«, sagte Mr. Montgomery-Taylor.
Allie dachte an Mrs. Montgomery-Taylors eifernde Vorträge über die Hölle, an die herumwirbelnden Messer und das siedend heiße Wasser, das den ganzen Körper verschlingen wird, das kochende Öl und die Flüsse geschmolzenen Bleis.
Allie wollte zu dem Förderband rennen und die Hühner befreien. Sie stellte sich vor, wie diese sich wütend mit Schnäbeln und Krallen auf Mr. Montgomery-Taylor stürzten. Doch die Stimme sagte zu ihr: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, Tochter. Dein Moment ist noch nicht gekommen. Bisher hatte die Stimme sie ihr ganzes Leben lang gut beraten. Weshalb Allie nickte und sagte: »Das ist alles sehr interessant. Danke, dass ich dich begleiten durfte.«
Schon bald nach ihrem Besuch in der Fabrik fiel ihr ihre neue Fähigkeit auf. Es kam nicht plötzlich, sondern eher so, wie man bemerkt, dass die eigenen Haare lang geworden sind. Ein schleichender Prozess.
Sie saßen beim Abendessen. Allie griff nach ihrer Gabel, und ein Funken sprang von ihrer Hand.
Die Stimme sagte: Tu es noch einmal. Du kannst es. Konzentrier dich. Etwas regte sich in ihrer Brust, etwas löste sich. Da war der Funken. Gut gemacht, sagte die Stimme, aber zeig es ihnen nicht, es ist nicht für sie bestimmt. Die Montgomery-Taylors bemerkten nichts. Allie hielt den Blick gesenkt und zeigte keine Regung. Die Stimme sagte: Das ist mein erstes Geschenk an dich, Tochter. Lerne, wie du es einsetzen kannst.
Sie übte in ihrem Schlafzimmer, ließ den Funken von einer Hand auf die andere überspringen. Erst ließ sie ihre Nachttischlampe heller brennen, dann gedämpfter. Sie brannte kleine Löcher in ein Kleenex und übte so lange, bis sie so fein wie Nadelstiche waren. Diese Dinge verlangen ständige Aufmerksamkeit. Das kann sie gut. Sie hat bisher von niemandem gehört, der damit Zigaretten anzünden kann.
Die Stimme sagte: Der Tag wird kommen, an dem du deine Fähigkeit einsetzen kannst, und wenn dieser Tag gekommen ist, wirst du wissen, was zu tun ist.
Normalerweise lässt sie zu, dass die Jungs sie anfassen, wenn sie das wollen. Sie glauben, dass sie sich aus diesem Grund auf dem Friedhof treffen. Eine Hand gleitet einen Schenkel hinauf, eine Zigarette wird zur Seite gehalten, während sie geküsst wird. Kyle setzt sich neben sie, legt ihr eine Hand auf die Taille und will ihr Top hochschieben. Sie bedeutet ihm mit einer Geste aufzuhören. Er lächelt.
»Komm schon«, sagt er und zupft an ihrem Top.
Sie verpasst ihm einen kleinen Schock auf dem Handrücken. Ganz harmlos, gerade genug, um ihn innehalten zu lassen.
Er zieht seine Hand zurück, sieht Allie an und sagt aufgebracht zu Hunter: »Hey, was ist los?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Keine Lust.«
Hunter setzt sich auf ihre andere Seite. Die beiden Jungskörper pressen sich an sie, die Ausbuchtungen in ihrem Schritt sprechen eine deutliche Sprache.
»Kein Problem«, meint Hunter, »aber weißt du, du hast uns hierhergebracht, und wir haben definitiv Lust.«
Er legt ihr einen Arm um die Taille, sein Daumen streift ihre Brust, seine Hand ist groß und stark. »Komm schon«, drängt er, »wir drei werden viel Spaß haben.«
Er will sie küssen, sein Mund öffnet sich.
Sie mag Hunter. Er ist einen Meter neunzig groß, stark, mit breiten Schultern. Sie hatten tatsächlich schon Spaß miteinander. Doch deshalb ist sie heute nicht hier. Sie hat so ein gewisses Gefühl.
Sie erwischt ihn in der Achselhöhle, einer ihrer Nadelstiche genau in den Muskel. Präzise und sorgfältig, wie ein scharfes Messer, das in seine Schulter eindringt. Sie verstärkt den Effekt, wie wenn die Lampe immer heißer wird, das Messer aus Feuer zu bestehen scheint.
»Scheiße!«, ruft Hunter und rückt von ihr ab. »Scheiße!« Er massiert seine linke Achselhöhle mit der rechten Hand. Sein linker Arm zittert.
Kyle zieht Allie wütend an sich. »Warum hast du uns den ganzen Weg hier rausfahren lassen, wenn du …«
Sie erwischt ihn an der Kehle, genau unter dem Kiefer. Wie eine Metallklinge, die durch seinen Kehlkopf schneidet. Sein Unterkiefer fällt herab, er gibt würgende Geräusche von sich. Er atmet noch, kann aber nicht sprechen.
»Fick dich!«, brüllt Hunter. »Dann bleibst du eben hier!«
Hunter weicht zurück. Kyle rafft seinen Schulrucksack an sich, während er sich immer noch die Kehle hält. »Uck! Ou!«, stößt er hervor, als sie zu ihrem Auto hasten.
Nach Einbruch der Dunkelheit wartet sie noch lange, liegt ausgestreckt auf dem Grab von Annabeth MacDuff, der liebevollen Mutter, und zündet eine Zigarette nach der anderen mit einem Knistern aus ihren Fingerspitzen an. Sie raucht sie bis zum Filter auf. Die Laute der Nacht erheben sich um sie herum, und sie denkt: Kommt und holt mich doch.
Sie sagt zu der Stimme: Hey, Mom, heute ist der Tag, nicht wahr?
Die Stimme sagt: Das stimmt, Tochter. Bist du bereit?
Allie erwidert: Es kann losgehen.
Sie klettert das Blumengitter hinauf, um wieder ins Haus zu gelangen. Ihre Schuhe hängen mit zusammengebundenen Schnürsenkeln um ihren Hals. Mrs. Montgomery-Taylor sah einmal, wie sie als kleines Mädchen einen Baum hinaufgeklettert ist – eins, zwei, drei war sie oben –, und sagte: »Die Kleine klettert ja wie ein Äffchen.« Sie sagte es, als hätte sie schon lange diesen Verdacht gehabt. Als ob sie nur auf eine Bestätigung gewartet hätte.
Allie stößt ihr Schlafzimmerfenster, das sie einen Spalt offen gelassen hat, auf und wirft ihre Schuhe in den Raum. Dann hievt sie sich durch das Fenster. Sie wirft einen Blick auf ihre Uhr; sie ist nicht einmal zu spät zum Abendessen, also kann ihr niemand Vorwürfe machen. Sie lacht, leise und heiser. Ein Lachen antwortet ihr. Sie merkt, dass sie nicht allein im Raum ist. Natürlich weiß sie, um wen es sich handelt.
Mr. Montgomery-Taylor entfaltet sich aus dem Lehnsessel wie ein langer Arm einer seiner Fabrikmaschinen. Allie holt Luft, doch bevor sie auch nur ein Wort herausbringen kann, schlägt er sie hart mit dem Handrücken über den Mund. Wie ein Tennisschlag im Country Club. Das Knacken ihres Kiefers ist der Aufprall des Schlägers auf dem Ball.
Seine Wut war schon immer sehr kontrolliert, sehr ruhig. Je weniger er sagt, desto wütender ist er. Er ist betrunken, man riecht es, außer sich, und er knurrt: »Ich habe dich gesehen. Habe dich mit diesen Jungs gesehen. Dreckige. Kleine. Hure.« Jedes Wort unterstreicht er mit einem Fausthieb, einer Ohrfeige oder einem Tritt. Sie krümmt sich nicht zu einer Kugel zusammen. Sie fleht ihn nicht an aufzuhören. Sie weiß, dass es sonst nur noch länger dauert.Er zwingt ihre Knie auseinander. Seine Hand liegt an seiner Gürtelschnalle. Er wird ihr zeigen, was für eine kleine Hure sie ist. Als ob er das nicht schon unzählige Male getan hätte.
Mrs. Montgomery-Taylor sitzt unten und hört Polka im Radio. Sie trinkt Sherry in winzigen Schlucken, die keinen Schaden anrichten können. Es ist ihr egal, was Mr. Montgomery-Taylor abends im Obergeschoss tut; wenigstens schläft er sich nicht durch die Nachbarschaft, und das Mädchen hat sich schließlich alles selbst zuzuschreiben. Wenn ihr ein Reporter der Sun-Times