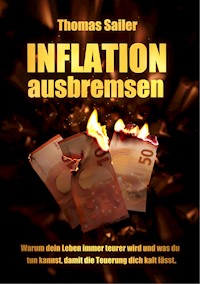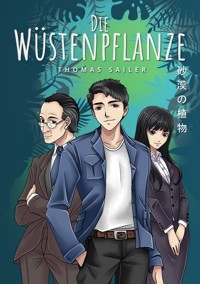7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Martin Eichendorf ist seit mehr als zwei Jahren in der Hochsicherheitsanstalt Werra I inhaftiert. Der junge Journalist ist das Opfer eines Komplotts: Da er zu viel wusste, sollte er auf Lebenszeit weggesperrt werden - doch dann gelingt ihm die Flucht! Seine Freude ist groß, doch sie währt nur kurz: Kaum ist er dem Gefängnis entkommen, erkennt er, dass er sich auf einer kleinen Insel mitten im Meer befindet. Es gelingt ihm, die Behörden zu täuschen: Während vermutet wird, dass Eichendorf bei seiner Flucht im Meer ertrunken ist, hält er sich tatsächlich auf der Insel versteckt. Doch schon bald fühlt er sich im Verborgenen ähnlich eingesperrt wie zuvor in der Gefängniszelle. Ein packendes Abenteuer, das den wahren Wert von Freiheit hautnah erfahren lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Thomas Sailer
DIE GEFÄNGNISINSEL
© 2018 Thomas Sailer
Umschlaggestaltung: Fiction-Atlas Press LLC
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7469-2713-8
Hardcover:
978-3-7469-2714-5
e-Book:
978-3-7469-2715-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
INHALTSVERZEICHNIS
1. HINTER SCHLOSS UND RIEGEL
2. DAS PÄCKCHEN
3. ERKUNDUNGSTOUREN
4. GEFANGEN IN FREIHEIT
5. ALLTAGSTROTT
6. EIN GROßES ABENTEUER
7. EINE ALTE BEKANNTE
8. ENDLICH DAHEIM
9. NEUE PERSPEKTIVEN
10. EIN GEFÄHRLICHES SPIEL
11. EINE NEUE REALITÄT
EPILOG
1. Hinter Schloss und Riegel
Ich starre an die Wand. Innerlich ringe ich mit dem Wahnsinn. Ausweglos. Hier führt kein Weg heraus. Ich kann nichts tun, nichts angreifen, auch nichts in Bewegung setzen das etwas an dieser harten Wirklichkeit ändern würde. Ich bin machtlos; eingesperrt in einer farblosen Welt aus Stahlbeton. Grau in grau, das ist meine traurige Realität. Reizlos, freudlos, hoffnungslos. Ein Dasein das mir zwar die Luft zum Atmen lässt, doch alles in mir nach und nach erstickt.
Unzählige Male hatte ich mir selbst die Frage gestellt, was ich denn so Schreckliches getan hätte, für das mich das Leben derart bestraft hatte. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass es keine Bestrafung war, sondern schlicht und einfach Pech. Der Lauf der Dinge war mir zum Verhängnis geworden und hatte mich dorthin gebracht wo ich heute war – in lebenslanger Haft.
Bevor ich meiner Freiheit beraubt worden war, war ich ein junger, aufstrebender Journalist gewesen. Ich schrieb für ein renommiertes Blatt, hatte Spaß an meinem Beruf und wollte hoch hinaus. Das Leben hatte mir vieles zu bieten gehabt und ich war begierig darauf es richtig auszukosten. Oh ja! Da waren so viele Träume und Wünsche für meine Zukunft … niemals hätte ich daran gedacht, dass die Dinge ganz anders kommen würden.
Eines Tages hatte ich einen anonym zugesandten Umschlag erhalten. Er war an mich adressiert gewesen, doch der Absender hatte meinen Namen wohl nur zufällig ausgewählt. Er hätte sein Schreiben auch an jeden anderen Redakteur richten können. Seine Absicht war schlicht und einfach die Sendung der Presse zukommen zu lassen: Ein paar Seiten voller hoch brisanter Informationen über einen gigantischen, jedoch vertuschtenFinanzskandal des OVCO-Konzerns, die gut und gerne dessen Ruin bedeuten hätten können.
Hätten – wohl gemerkt. Der Absender lebte nicht mehr. Ermordet. So wie vier weitere Personen. Laut dem Urteil eines Richters war ich deren Mörder. Die Anklage hatte mir vorgeworfen fünf Menschen kaltblütig umgebracht zu haben, als Teil eines perfiden Plans: Ich hätte beabsichtigt einen Skandal zu erfinden, damit ich ihn anschließend in der Zeitung aufdecken konnte – in der Hoffnung dadurch schnell Karriere zu machen. Nur zu diesem Zweck hätte ich skrupellos Morde begangen. Das Gericht hatte der Anklage Recht gegeben und mich zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit zur vorzeitigen Begnadigung. Meine Unterbringung sollte zudem in einem Hochsicherheitsgefängnis erfolgen.
Der ganze Prozess war eine Farce gewesen. Durch die Bank konstruierte Beweisstränge. Doch alle waren gegen mich gewesen: Richter, Staatsanwalt – beide mussten sie hohe Bestechungsgelder erhalten haben. Alle Beweise die ich in der Hand gehabt hatte, wie etwa die mir zugespielten Materialien, waren plötzlich verschwunden gewesen – es wurde vehement behauptet, ich hätte falsche Unterlagen angefertigt, um damit in der Redaktion zu bluffen; dafür hatte es etwa Tatwaffen gegeben, die ich niemals in den Händen gehalten hatte, die jedoch als Beweise anerkannt worden waren.
Der Umstand, dass ich meine Recherche geführt hatte, ohne die wahre Gefahr auch nur im Ansatz zu kennen, hatte es den Verantwortlichen im Konzern besonders einfach gemacht mir eine Mordgeschichte anzudichten.
Ich wusste nicht wie mir geschah. Von einem Tag auf den anderen wurde ich aus meinem gewohnten Leben gerissen und in eine Zelle gesperrt – in einer offenbar länderübergreifend betriebenen Hochsicherheitseinrichtung: Werra I.
Soviel wusste ich also. Ich kannte den Namen der Anstalt und mir war auch nicht entgangen, dass das Gefängnispersonal durchwegs deutscher Herkunft war. Mehr Informationen hatte ich nicht. Aufgrund des Namens vermutete ich, dass der Gefängniskomplex irgendwo in Deutschland, am Fluss Werra lag. Doch das war nur Spekulation. Wo ich mich tatsächlich befand? Ich hatte keine Ahnung!
Es galt absolute Informationssperre. Ich durfte keinen Besuch empfangen und mit niemandem von außen kommunizieren; weiters war es mir untersagt das Weltgeschehen zu verfolgen: Meine Bitte eine Tageszeitung lesen zu dürfen, war entschieden abgewiesen worden; auf der Zelle hatte ich weder Radiogerät, noch Fernseher, um mediale Nachrichten zu empfangen. Die Außenwelt hatte mich schlichtweg nicht zu interessieren – schließlich sollte ich sie niemals wiedersehen.
Mir war vollkommen klar gewesen, weshalb man mich an diesen Ort gebracht hatte: Nicht weil die Verantwortlichen in der Justiz mich tatsächlich für einen geisteskranken, gefährlichen Mörder hielten. Ich war hier, weil ich etwas wusste das ich nicht wissen durfte; weil ich damals Informationen bekommen hatte, die keinesfalls an die Öffentlichkeit dringen durften.
Fünf Menschen waren tot, weil sie ihrem Gewissen gefolgt waren und die Bevölkerung dennoch informieren wollten. Ich atmete noch, doch mein Leben war zerstört.
Anfangs hatte ich mich selbst dazu gezwungen dieser Situation mit Verstand zu begegnen: Ich versuchte die grauenvolle Leere in der Zelle mit Erinnerungen an schöne Zeiten zu füllen. Damals hatte ich das Gefühl von Freiheit noch gekannt – und ich war entschlossen gewesen es wieder zu spüren. Bald!
Eine Vorstellung, die natürlich jeden Bezug zur Realität entbehrt hatte – doch was hätte ich anderes tun sollen? Ich musste die Hoffnung bewahren, sonst hätte ich nichts mehr gehabt für das es sich zu leben gelohnt hätte. Ich glaubte fest daran, dass es einen Weg aus diesem Loch geben musste. Vielleicht eine unerwartete Rehabilitation, falls bei weiteren Ermittlungen doch festgestellt würde, dass ich niemanden ermordet hatte? Oder aber … Flucht. Oh ja, Flucht! Jener Gedanke, der mich speziell während der ersten Wochen in Haft ungemein faszinierte. Es war geradezu köstlich, mir die verschiedensten Szenarien vorzustellen, wie ich diesem Gefängnis entkommen würde.
So hatte ich, nachdem ich den ersten Schock nach der Inhaftierung verwunden hatte, in den ersten Wochen und Monaten in der Zelle sehr oft an die Freiheit gedacht. Ein Gedanke, der mich beflügelt hatte und mir Kraft gegeben hatte: Stärke, um all das durchzustehen und den Antrieb, mir immerzu Gedanken darüber zu machen wie ich von hier fliehen würde. So gelang es mir vorerst Zuversicht zu bewahren.
Doch der bloße Traum von einer sagenhaften Flucht war auf Dauer nicht befriedigend. Je länger ich diesen Gefängnisalltag hatte erdulden müssen, umso eher war mir bewusst geworden, dass ich ihm nicht entkommen konnte. Ich unterstand der perfekten Kontrolle!
In mir loderte das Verlangen zu fliehen. Mein sehnlichster Wunsch! Lange hatte ich die Augen offen gehalten, nach einer Gelegenheit … doch es hatte ihn einfach nicht gegeben – diesen Moment in dem gerade keiner der Wärter hingesehen hätte, während dem ich durch das zufällig einstweilen offen stehende Gefängnistor hätte entkommen können. Natürlich nicht. Ich hatte mich in einer Hochsicherheitseinrichtung befunden; einer Anstalt aus der, wie mir gesagt worden war, noch niemals jemand erfolgreich geflohen war. Möglichkeiten zur Flucht hatte es nur in meiner Phantasie gegeben – nicht aber in dieser steinharten Realität.
Ich war ständig bewacht gewesen. Jeder noch so kleine Fehler war streng bestraft worden: Wer den Wärtern gegenüber nicht sofort pariert hatte, wurde mit Knüppeln niedergeschlagen oder über Wochen in Dunkelhaft gesperrt; das einzige Los das noch grauenvoller gewesen sein musste als das Ausharren in der Zelle.
Doch das war nicht alles. Ich war darüber aufgeklärt worden, dass der Außenbereich der Gefängnisanlage permanent von Scharfschützen überwacht wurde. Würde ein Häftling ohne die Begleitung eines Wärters auch nur einen Schritt in den Gefängnishof tun, so würde er ohne jede Vorwarnung per Kopfschuss getötet. Die Ausbruchssicherheit der Anstalt hätte in jedem Fall entschiedene Priorität gegenüber dem Leben eines Insassen.
Nach und nach war mir bewusst geworden, dass meine Ausbruchsphantasien sowie auch generell meine Vorstellung, dass ich eines Tages wieder außerhalb dieses Gefängnisses leben würde, rein gar nichts mit den Tatsachen zu tun gehabt hatten. Je länger ich in Haft, fernab meiner früheren Alltagsumstände, lebte, umso stärker und schmerzlicher war mir dies bewusst geworden.
So nahm die Zeit ihren Lauf: Aus Wochen wurden Monate, aus Monaten bald Jahre. Zwei Jahre und vier Monate lang war ich nun schon in Gefangenschaft. Die Zeit im Gefängnis hatte längst ihren Tribut gefordert: Mein Körper war schwächer und anfälliger geworden; mein Geist müder und verbitterter. Mit der Zeit hatte der harte Alltag in Gefangenschaft die positive Kraft aufgezehrt, die ich anfangs aus Erinnerungen geschöpft hatte. Frei sein, froh sein. Ich wusste nicht mehr wie sich das anfühlen sollte. Ich konnte diese Gefühle nicht mehr länger mithilfe von Gedächtnisinhalten abrufen. Sie aufs Neue erleben, konnte ich in meinem Gefängnisalltag erst recht nicht.
Es war nie so, dass ich mich mit meinem Los abgefunden hätte. Das konnte ich nicht. Verdammt, das wollte ich nicht! Doch dieses dauernde Verlangen nach etwas, nach Freiheit, nach Freude, marterte mich. Es quälte mich, da ich beides nicht haben konnte, ganz egal was ich tun würde.
Jeder Tag in Gefangenschaft schien sich in die Unendlichkeit zu ziehen. Am schlimmsten war es in der Zelle: In diesem sterilen, farblosen Raum gab es kein Fenster nach draußen, nur künstliche Beleuchtung. Tageslicht konnte ich lediglich vom Gang aus, wenn ich die Zelle verlassen durfte, durch die Oberlichten des Zellenblocks sehen. Persönliche Gegenstände waren in der Zelle nicht gestattet: Keine Bücher, keine Sammelfiguren, keine Poster. Nichts das irgendwie Farbe in dieses graue Loch gebracht hätte.
Die einzige Form der Unterhaltung bestand in einer Filmvorführung die den Insassen, aufgeteilt in Gruppen, einmal pro Woche unter strengen Auflagen gestattet war. Ein kleiner Fernseher für dutzende Zuseher, die allesamt unter Bewachung stramm dazusitzen hatten. Die kleinste Missachtung der Vorschriften – es musste nur einer der Häftlinge versuchen eine etwas bequemere Sitzposition einzunehmen – führte zu einem sofortigen Abbruch der Filmvorführung. Gezeigt wurden ausschließlich veraltete Filme, die längst nicht mehr zeitgemäß waren. Auch waren es selten richtig gute Filme … und doch waren diese Fernsehabende mit Abstand das Schönste das ich als Gefangener erleben durfte.
Der Alltag im Gefängnis war hart: Täglich musste ich um 6:00 Uhr Früh aufstehen und in den Speisesaal zum Frühstück gehen; ein Butterbrot oder manchmal ein hart gekochtes Ei – viel Zeit zu essen, gab es nicht.
Nach dem Frühstück wurde ich gemeinsam mit den anderen Insassen in den Arbeitsbereich geführt. Dort mussten wir unter ständiger Bewachung Dinge wie Autowracks und Maschinen zerlegen und die Materialien sortieren. Acht Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche. Obwohl die Arbeit oft an der Substanz zehrte, glich sie meist einem Lichtblick im Gefängnisalltag: So war ich immerhin nicht in der engen, grauen Zelle. Die Dinge die ich zerlegen musste, waren meist sehr schmutzig und nicht selten verletzte ich mich an den Armen und Händen – so etwa wenn ich mit einem Werkzeugschlüssel von einer alten Schraube abrutschte. Doch sie hatte etwas Aufbauendes, diese Arbeit: Es waren fast täglich neue Gegenstände, die ich zerlegen sollte. Farben und Formen; Gerüche – eine Abwechslung gegenüber der vollkommenen Monotonie in der Zelle! Außerdem war dieses Bewusstsein in mir, dass all diese ausgedienten Gegenstände von draußen kamen. So etwa die Autos, die bis vor einiger Zeit noch auf der Straße gefahren worden waren. Es wäre so unglaublich toll gewesen, mit einem alten, mitgenommenen Auto über die Landstraße zu fahren. In Freiheit!
Schließlich dachte ich auch gerne daran, wohin die sortierten Einzelteile gebracht werden würden: Erneut nach draußen! Weg von hier! Die Container würden wieder abgeholt und zu einer Metallrecyclingstelle gebracht. Dort arbeiteten Leute … die nach Feierabend frei waren! War deren Arbeit erst getan, konnten sie hinausgehen und tun was sie wollten! Sie konnten heim zu ihrer Familie gehen, oder mit Freunden etwas trinken. Egal was, sie konnten es tun! Und ich? War die Arbeit hier getan, musste ich zurück in die Zelle – wo ich nichts tun konnte als ins Nichts zu starren und zu warten … warten, bis am Abend das Licht ausgehen würde. Warten, bis ich wenigstens im Schlaf, in meinen Träumen, diesem Loch aus Monotonie und Sinnlosigkeit entkommen würde.
Manchmal, da phantasierte ich darüber nach der Arbeit einfach in einen Altmetallcontainer zu steigen. Ein beflügelnder Gedanke, aber leider pure Utopie: Selbst wenn die Wärter lange genug unachtsam gewesen wären, wäre meine Abwesenheit sofort bemerkt worden … und es wäre klar gewesen, dass ich in einem der Container gewesen wäre. Ohnehin war ich nach meiner Inhaftierung, als ich die Arbeit hier hatte aufnehmen müssen, darüber informiert worden, dass die Container gründlich durchsucht würden, ehe sie das Gebäude verließen und, dass ich gut daran täte gar nicht erst daran zu denken auf diesem Wege einen Fluchtversuch zu wagen.
So sehr ich es auch wollte – ich konnte nicht fliehen! So blieb mir nichts über als zu tun was ich tun musste. Zu funktionieren, wie eine Maschine. Nicht zu denken, nicht zu fühlen. Tag für Tag das gleiche, leere Dasein fristen. Mein Los im Leben – heute und für immer.
2. Das Päckchen
In diesem Bewusstsein verließ ich auch am 02. April 2017 das Bett, als um 6:00 Uhr in der Früh das unangenehme Wecksignal im Zellenblock ertönte. Wie an jedem Tag putzte ich schnell meine Zähne um fertig zu sein bis der Schließmechanismus der Zellentür öffnete.
Als dann die Gittertür kurz darauf entriegelt wurde, waren auf dem Gang zwischen den Zellen überall Wärter positioniert, die darauf achteten, dass alle Insassen wie angewiesen zum Frühstück gingen. Also marschierte ich gemeinsam mit den anderen Sträflingen in Reih und Glied in den Speisesaal.
Zu essen gab es wie sooft ein fades Toastbrot und ein hart gekochtes Ei. Dann, etwa zehn vor sieben Uhr, mussten sich sämtliche Häftlinge im Arbeitsbereich einfinden – rasch den Arbeitsoverall anstelle der Gefangenenkluft anziehen und an die Arbeit gehen: In der Arbeitshalle standen Autowracks und ausgediente Industriemaschinen bereit um zerlegt zu werden. Es war wie an jedem Morgen seit nun mehr als zwei Jahren.
Als ich an den Platz kam an dem ich üblicherweise arbeitete, wies mir der Wärter der die Arbeit einteilte einen schrottreifen Ford zu, den ich in seine Einzelteile zerlegen sollte.
„Wär’s möglich, dass ich den alten Ford da übernehme?“, hörte ich einen Mitgefangenen sagen, der den Arbeitsplatz daneben innehatte. „Mit dem Modell kenne ich mich aus. Habe früher öfter an so etwas gearbeitet!“
Das war ausgesprochen ungewöhnlich. Es war nicht an den Gefangenen, die Arbeit selbst auszusuchen.
„Es gibt keine Sonderwünsche!“, brüllte ein Wärter und hob drohend seinen Gummiknüppel. „Zurück auf Position. Sofort!“
Der andere Gefangene parierte. Er schien stark mit sich selbst zu ringen. Zwar versuchte er sich nichts anmerken zu lassen, doch ich konnte erkennen, dass er sehr angespannt war. Weshalb war er so erpicht darauf diesen alten Ford zu zerlegen?
Ich dachte nicht weiter darüber nach und begann den Wagen auseinander zu nehmen: Erst die Türen, Motorhaube und Heckklappe. Irgendwo musste ich schließlich anfangen. Ich demontierte die Innenverkleidungen der Türen und entfernte die Scheiben, sodass nur noch das Stahlblech übrig blieb. Dabei arbeitete ich sehr sorgfältig. Jede noch so kleine Schraube sollte ihren Weg in den Verwertungskreislauf finden.
Als ich gerade nicht im Visier eines Aufsehers war, strich ich mit der Handfläche über die verschlissenen, befleckten Velours der Paneele: Ich versuchte mir vorzustellen, ich wäre in Freiheit, hätte gerade einen alten, schäbigen Wagen gekauft und stünde vor einer aufregenden Reise. So recht glückte mir diese Vorstellung nicht – unzählige Male hatte ich bereits versucht, mir auf diese Weise den Alltag im Gefängnis erträglicher zu machen. Mittlerweile hatte ich schon zu sehr verinnerlicht, dass es nur Träumerei war und niemals wieder Realität werden sollte; so fühlte sich auch das Träumen längst nicht mehr so real an wie zu Beginn meiner Haftstrafe. Dieser Effekt hatte sich längst abgenutzt.
Nachdem ich alle Türen, die Heckklappe und die Motorhaube von sämtlichen Anbauteilen befreit hatte, trug ich die Teile zu einem Alteisencontainer und warf sie in dessen Inneres.
Dann fing ich an den Innenraum des Wagens zu zerlegen; als ich die Rückbank demontierte, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches: Da lag ein Päckchen. Nichts das irgendwann einmal versehentlich unter die Rückbank gerutscht war. Nein. Mit einem Mal verstand ich weshalb der andere Sträfling unbedingt an dieses Auto wollte: Jemand hatte genau dieses Autowrack präpariert, mit etwas das dieser andere Häftling bekommen sollte. Möglichst unauffällig versuchte ich etwas von der Papierverpackung zu öffnen: Wie ich sofort erkannte, befand sich darunter, vakuumverpackt in Plastik – eine Wärteruniform! Hier war ein Ausbruchsversuch im Gange!
Mein Puls begann zu rasen. Konnte es wahr sein? War das hier etwa meine lang ersehnte Fahrkarte in die Freiheit? Konnte ich es riskieren? Sollte ich etwa … Moment mal – ich starrte schon viel zu lange auf dieses Päckchen. Die Wärter würden gleich bemerken, dass ich etwas gefunden hatte! Würden sie mich jetzt sehen, mit diesem Päckchen in der Hand, wäre meine Chance auf Flucht dahin. Weil ich es nicht gemeldet hätte, bekäme ich wahrscheinlich – erstmalig – mehrere Wochen Dunkelhaft … wahrscheinlich würden sie sogar denken, dass ich das hier selbst fingiert hätte und würden mich noch härter bestraften!
Unfähig so schnell eine Entscheidung zu treffen, legte ich das Päckchen rasch unter der bereits demontierten Rückbank ab und begann die Verkleidungselemente der C-Säulen abzumontieren – um den Anschein zu wahren, dass ich hier bloß meine Arbeit tat.
Da – ein Wärter der genau zu mir herüber sah. Er hatte bestimmt schon Verdacht geschöpft! Ich tat als wäre ich auf die Arbeit konzentriert und würde ihn gar nicht bemerken. Außerdem versuchte ich ein möglichst gelangweiltes Gesicht zu machen. Das schien zu funktionieren: Er kam nicht zu mir herüber, sondern ging wieder auf Position.
Sogleich war ich mit der nächsten Herausforderung konfrontiert: Ich konnte die ausgebaute Sitzfläche nicht im Auto liegen lassen. Es würde auffallen, würde ich zu viele demontierte Teile im Fahrgastraum horten – die Wärter würden misstrauisch und nachsehen kommen was ich hier versteckte. Rasch sah ich mich um. Hinter den Radläufen befand sich ein schmaler Hohlraum, in den das flache Päckchen gut passen würde. Ich begab mich in den bereits ausgeräumten Kofferraum, scheinbar um die C-Säulen-Verkleidung aus dem Auto zu reißen. Dabei griff ich nach dem Päckchen und versenkte es unauffällig in dem Hohlraum, während ich tat als würde ich mir ansehen wie das C-Säulen-Verkleidungsteil mit der Karosserie verbunden war. Ich sah mich erneut um. Niemand schien ernsthaften Verdacht geschöpft zu haben. Mit beiden Händen riss ich an der Plastikverkleidung, legte die entfernten Stücke auf die ausgebaute Rücksitzbank und trug diese zu einem der Restmüllcontainer.
Zurück beim Autowrack versuchte ich mich so zu verhalten als wäre nichts weiter. Ich mimte den Vergrämten, während ich Anbauteil für Anbauteil von der Karosserie entfernte. Innerlich war ich hingegen überwältigt von dieser plötzlichen Möglichkeit, einen Ausbruch wagen zu können. Tatsächlich: Mit dieser Uniform könnte ich unbehelligt aus diesem Gefängnis herausspazieren. Ein zu schöner Gedanke … so unwirklich – und plötzlich so real!
In mir erwachten neue Lebensgeister. Ich spürte Energie in mir, die ich schon seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Allerdings verstand ich auch, dass ich noch keineswegs entkommen war. Obwohl ich nun vollkommen unverhofft eine Wärteruniform zur Verfügung hatte, gab es diverse Probleme, die ich erst lösen musste: Ich war fast ständig überwacht, wenn ich nicht gerade in der Zelle saß – wann also sollte ich die Uniform anlegen? Wie sollte ich sie unbemerkt aus der Autokarosserie herausnehmen, sodass ich sie im richtigen Zeitpunkt anziehen könnte? Gab es ihn überhaupt, diesen richtigen Zeitpunkt? Wie sollte ich das alles bloß anstellen?
Nach einigen Stunden erklang ein akustisches Signal: Es war Zeit zum Mittagessen. Also verließen wir Häftlinge den Arbeitsbereich, wuschen die Hände und gingen in den Speisesaal. Während ich aß, sah ich zu dem Gefangenen, der dieses Päckchen eigentlich erwartet hatte. Mit finsterem Blick sah er zu mir herüber. Rasch wandte ich den Blick ab. Ich bekam eine Gänsehaut. Er wusste, dass ich die Uniform gefunden hatte, die für ihn bestimmt gewesen war. Er konnte jederzeit einem der Wärter sagen, dass er glaubte ich würde etwas in dem Wrack versteckt halten. Außerdem war ich nicht gerade erpicht darauf, mich körperlich mit ihm anzulegen. Falls er mich attackieren sollte, würden wir beide Schwierigkeiten bekommen – und die Uniform würde wohl auch entdeckt.
Als am Nachmittag die Arbeit fortgesetzt wurde, begann ich meine Flucht zu planen. Ich kannte die Routine in diesem Gefängnis: Wurde man am Abend mit dem Zerlegen nicht fertig, bekam man üblicherweise dasselbe Wrack auch am kommenden Tag zugeteilt – wohl damit niemand in Versuchung kommen konnte sich unliebsame Arbeitsschritte bewusst zu ersparen. Ich konnte die Uniform also getrost über Nacht im Auto lassen. Am kommenden Vormittag müsste ich es schaffen die Karosserie von Motor und anderen Anbauteilen zu befreien, sodass ich morgen nach dem Mittagessen den Wärtern Bescheid geben könnte, dass die Karosserie mit dem Stapler abtransportiert werden könnte. Während das gemacht würde, würde ich irgendeinen Anbauteil davontragen, unter dem ich die Uniform verbergen würde. Nun würde mich ein paar Minuten lang niemand vermissen und ich könnte mir die Uniform versteckt zwischen den Containern überziehen. Man würde von mir erwarten, dass ich den Motor weiterzerlege. Aber eine Motor-Getriebeeinheit die hier zwischen all dem Schrott liegen würde, würde nicht so sehr auffallen wie eine Karosserie … also würde vielleicht nicht sofort bemerkt, dass ich nicht bei der Arbeit sein würde. Diese Zeit würde ich nutzen um als Wärter getarnt die Arbeitshalle zu verlassen. Ich würde durch den Gang gehen, bis ganz nach vorn, wo wir Insassen nicht hin durften; in den vorderen Gefängnishof. Dort, wo ich damals dem Gefangenentransporter entstiegen war, als man mich hier her gebracht hatte. Mit etwas Glück würde man mir das Haupttor öffnen – und ich könnte unbehelligt vom Gefängnisareal verschwinden!
Vielleicht würde ich es schaffen, ausreichend Distanz zu dem Gefängnis aufzubauen. Ich wusste nicht wie das Gelände rund um die Anlage aussah. Ob ich mich hier in einer Stadt befand, oder aber mitten im Nirgendwo. Ich hatte keine Ahnung. Aber es war mir irgendwie egal. Auch der Gedanke, dass die Polizei klar im Vorteil war und mich wahrscheinlich bald wieder aufgegriffen haben würde. Ja sogar das Bewusstsein, dass ich auf der Flucht erschossen werden könnte … dieses Risiko war gegeben, eindeutig. Ich wollte mir gar nicht vorstellen wie es sein würde, wenn mich eine Kugel träfe. Schauderhaft! Allerdings – was war meine Existenz schon wert, wenn ich sie ohne Aussicht auf Begnadigung hier in diesem Loch verbringen müsste? Diese vielleicht einmalige Chance auf Flucht, auch wenn sie noch so klein und risikobehaftet sein mochte, wollte ich mir keinesfalls entgehen lassen. Jetzt hatte ich es in der Hand, meine Freiheit zurück zu gewinnen!
Schließlich ertönte abermals ein akustisches Signal. Es war Zeit die Arbeit niederzulegen und zurück in die Zellen zu gehen. Mir graute – doch weit nicht so sehr wie sonst. Im Tross mit den anderen Häftlingen ging ich in den Umkleideraum. Wie immer sollten wir unsere Arbeitskleidung ablegen, unter die Dusche gehen, die Gefangenenkluft anlegen und zurück in die Zelle gehen. Diesmal jedoch, als ich mir gerade den Overall ausziehen wollte, kam in einem unbeobachteten Augenblick jener Gefangener auf mich zu, der die Uniform hätte bekommen sollen. Ich wusste: Das bedeutete Ärger!
„Wo hast du sie?“, zischte er.
„Wo habe ich was?“, erwiderte ich und tat überrascht.
Da packte er mich mit beiden Händen beim Kragen und drückte mich gegen die Wand; so fest, dass ich kaum Luft bekam. In seinen Augen sah ich, dass er zu allem bereit war.
„Du weißt genau wovon ich spreche. Raus mit der Sprache!“
In diesem Moment spürte ich einen heftigen Schmerz in der Bauchgegend, er hatte mir sein Knie in die Magengrube gerammt. Ich krümmte mich vor Schmerzen.
„HEY! GIBT ES HIER IRGENDEIN PROBLEM?“, hörte ich einen Wärter rufen. Ich sah wie dieser und noch ein anderer auf uns zugelaufen kamen.
„SOFORT AUFHÖREN“, brüllte einer der beiden. Ohne weitere Vorwarnung schlug er meinem Angreifer mit aller Kraft einen Gummiknüppel in den Rücken; dieser löste nun seinen Griff um meinen Hals und ging zu Boden. Sofort kamen noch zwei weitere Wärter herbei. Sie zogen ihre Waffen; einer richtete diese auf den am Boden liegenden Häftling, der andere visierte mich an. Ich wagte es nicht auch nur eine Bewegung zu machen.
“Das gibt einen Monat Dunkelhaft, Freundchen!“, rief ein Wärter, als er den Angreifer am Boden fixiert hielt und ihm Handschellen anlegte; einstweilen stürmte ein anderer Wärter auf mich zu, packte mich am Kragen und drückte mich gegen die Wand; kaum sanfter als es der andere Häftling zuvor getan hatte.
„Du da! Was war hier los, verdammt?“, brüllte er mir ins Gesicht.
„Ich – ich glaube es ging um dieses Auto …“, stammelte ich; wegen der schmerzhaften Attacke des Mitgefangenen konnte ich vorerst kaum sprechen.
„Auto? Welches Auto?“, schrie der Wärter.
„Dieser Ford, an dem ich heute gearbeitet habe … heute Morgen hat der Kollege, der mich jetzt attackiert hat darum gebeten, dass er an dem Wagen arbeiten darf. Wie er mir gerade gesagt hat, hatte er früher so ein Modell und hätte so gerne alte Erinnerungen geweckt. Er war eifersüchtig, weil ich an dem Wagen arbeiten durfte – da ist ihm der Kragen geplatzt.“
„War es so?“, brüllte der Wärter den Angreifer an.
„Ja, es stimmt … jedes Wort“, keuchte der Häftling. „Ich war eifersüchtig … es tut mir leid.“
In seinem Blick sah ich immer noch Zorn, aber auch Dankbarkeit; er schien froh zu sein, dass ich nichts von der Uniform gesagt hatte.
„Sie sagen die Wahrheit“, äußerte einer der anwesenden Wärter. „Heute Früh hat mich dieser Insasse gefragt ob er an dem Wagen arbeiten darf. Ich habe es ihm natürlich verboten.“
„Gut“, erwiderte ein anderer Wärter. „Abführen!“
Damit griffen zwei Wachen den mit Handschellen Gefesselten und brachten ihn weg.
Ich atmete auf. Einen Moment lang hatte ich gedacht dieser Kerl würde mich erschlagen.
„Du da!“, sprach mich der Wärter an, der die Befehle gegeben hatte. „Ist dir an diesem Wagen irgendetwas aufgefallen? Hast du etwas gefunden? Eine Waffe? Drogen vielleicht?“
„Nein, da war nichts“, log ich.
„Los, durchsucht ihn!“, befahl der Wärter, woraufhin mir zwei Wachen den Overall vom Leib rissen und diesen gründlich durchsuchten.
„Er hat wirklich nichts dabei“, sagte einer der Wachen.
„Gut. Dann soll er jetzt duschen gehen. Behaltet ihn im Auge, damit er keine Dummheiten macht“, äußerte der Wärter und ging davon. Die anderen beiden folgten mir in den Duschraum.
Ich versuchte mich möglichst normal zu verhalten, während ich mich wusch. Niemand sollte bemerken, dass ich ein Geheimnis hatte. Innerlich schien heute alles anders als sonst; anstatt wie üblich in Sinnlosigkeit und Verzweiflung zu versinken, war ich nun ausgesprochen fokussiert: Ich hatte einen Plan; einen Ansatz und den starken Willen, ihn zu nutzen!
Nach dem Duschen ging es noch einmal in den Speisesaal, zum Abendessen. Anschließend musste ich zurück in die Zelle. Zum ersten Mal seit langer Zeit war dieser Gedanke für mich nicht erschreckend. Heute Abend würde ich nicht von Eintönigkeit um den Verstand gebracht; ich würde die Zeit nutzen um mich mental auf das vorzubereiten, was ich am kommenden Tag tun würde.
So saß ich auf dem Zellenbett, sah hinaus auf den Gang und fühlte dabei fast so etwas wie Entspannung. Immerzu dachte ich daran, wie es sein würde: Einfach den Arbeitsbereich zu verlassen, unbeaufsichtigt durch die Gänge zu spazieren und dann, vorne im Gefängnishof, durch das große Metalltor zu gehen – und das Weite zu suchen! Ein wahrlich aufregender Gedanke: Dieses Loch endlich zu verlassen, mich wieder frei bewegen zu können. Das würde großartig!
Ich freute mich unheimlich darauf, durch Wiesen und Wälder zu flüchten. Ich freute mich auf alles das ich in Freiheit sehen würde: Jeden Baum, jedes Blatt, jeden Stein. Vor allem aber freute ich mich darauf endlich wieder die Menschen zu sehen, die mir nahe standen. Meine Eltern, meine Freunde. Sobald ich könnte, würde ich versuchen mit ihnen in Kontakt zu treten; seit meiner Inhaftierung hatte ich von niemandem aus meinem Umfeld gehört. Natürlich dachte ich auch an Irina, meine Verlobte. Ich musste sie unbedingt wieder sehen! Auch wenn mir im Grunde genommen klar war, dass sie wohl schon längst nicht mehr meine Verlobte wäre. Ich war zu lebenslanger Haft verurteilt worden und durfte keinerlei Kontakt zu ihr aufnehmen. Das war damals wohl einem unfreiwilligen Ende unserer Beziehung gleichgekommen.
Gegen Abend marschierte ein Trupp Wärter durch den Gang und hielt vor meiner Zelle. Die Männer, angeführt von jenem der bei dem Vorfall im Umkleideraum die Befehle gegeben hatte, öffneten die Zellentür und traten ein. Während ich äußerlich ruhig blieb, geriet ich innerlich in Panik: Weshalb wohl waren sie hier? Sie mussten die Uniform im Auto gefunden haben! Nun waren sie gekommen um mich dafür zu bestrafen; sie würden mich mit ihren Knüppeln niederschlagen und für einige Wochen in Dunkelhaft sperren – in einen abgeschotteten Raum; der einzige Ort in diesem Gefängnis der wohl noch abstoßender war als diese Zelle. Ein Raum, in dem ich noch weniger tun und wahrnehmen könnte als hier in der Zelle. Ich kannte diesen Zellenblock, da er mir gezeigt worden war, als ich in diese Haftanstalt gekommen war; zur Abschreckung, damit ich wüsste was mir blühen würde, wenn ich mich nicht angepasst verhielt. Bis jetzt hatte ich es vermieden in diese Situation zu geraten – jetzt stand mir anstatt Freiheit wohl eine Zeit in absoluter Abschottung bevor.
“Ausziehen und mit der Stirn an die Wand!“, befahl der Wärter der den Trupp anführte. Ich tat wie mir befohlen worden war und erwartete den ersten Knüppelschlag auf meinen entblößten Rücken.
„Alles durchsuchen!“, rief der Mann. „Kleidung, Bettwäsche, Abflussrohre, die Hohlräume vom Bettgestell – alles!“
Ich stand da und versuchte zu verstehen was hier gerade vor sich ging. Hatten sie die Uniform nun gefunden? Waren sie hier um nachzusehen ob ich vielleicht noch andere Sachen ins Gefängnis geschmuggelt hatte?
„Die Zelle ist sauber“, sagte einer der Wärter schließlich, nach Momenten die mir wie Stunden geschienen hatten. „Er hat wirklich nichts aus der Werkstatt hier her mitgenommen.“
„Was ist mit der Werkstatt? Kann er dort irgendetwas versteckt haben?“, fragte der Befehlshaber sehr lautstark nach.
„Wir haben alle Werkzeugladen genau durchsucht“, erklärte einer der Wachen. „Auch in das Autowrack haben wir gesehen … sogar Teile vom Motor haben wir zerlegt um zu sehen, ob er da etwas drin versteckt hat. Aber da war nichts.“
„Du da!“, schrie der Befehlshaber. „Umdrehen!“
Ich tat was er mir befohlen hatte. Einer der Wachen reichte mir die Gefängniskluft. Der dominante Wärter verließ die Zelle und ging davon. Auch die anderen folgten ihm.
Ich stand da, immer noch entblößt, die Gefängniskluft in der Hand, als der letzte der Wachmänner die Zellentür verriegelte.
„Nur eine Routinedurchsuchung, wegen der Schlägerei in der Umkleide“, erklärte er, deutlich freundlicher als der befehlshabende Wärter. „Kein Grund zur Besorgnis.“
Ich nickte. Tunlichst versuchte ich eine konzentrierte Miene zu ziehen, während ich am liebsten lauthals lachen wollte: Die Wärter waren total auf dem Holzweg! Sie vermuteten wohl immer noch, dass ich vielleicht Drogen oder eine Waffe in dem Auto gefunden hätte; sie hatten sich die Arbeit gemacht den riesigen Arbeitsbereich zu durchsuchen und weitere Teile von dem Ford abzumontieren, um zu sehen ob ich dort etwas versteckt hatte – aber die vakuumverpackte Uniform, die ich vorsorglich mit einem Stück Dämmmatte verklebt hatte, hatten sie nicht gefunden. Vielleicht hatte sogar jemand in den Hohlraum gegriffen, doch das Päckchen unter der alten Dämmmatte nicht ertastet? Wer weiß – jedenfalls muss es unentdeckt geblieben sein!
Ich konnte aufatmen: Mein Fluchtplan war nach wie vor nicht vereitelt worden; zusätzlich schienen die Wärter mit einer falschen Fährte beschäftigt zu sein. Letztendlich hatte die Schlägerei im Umkleideraum sogar ihr Gutes: Wenngleich mir der Bauch immer noch etwas wehtat, befand sich der Häftling, für den die Uniform eigentlich bestimmt gewesen war, nun in Dunkelhaft. Er würde am kommenden Tag folglich nicht arbeiten. Damit war tatsächlich eine große Hürde genommen, die ich bisher verdrängt hatte: Dieser Mann hatte gewusst, dass in dem Wagen eine Uniform versteckt war. Er hätte sofort bemerkt, wenn ich damit von meinem Arbeitsplatz verschwunden wäre. Mit ziemlicher Sicherheit hätte er das umgehend einem Wärter gemeldet, damit ich nicht mit seiner Uniform entkommen würde. Nun da er in Dunkelhaft war, gab es einen entscheidenden Risikofaktor weniger.
So war ich beinahe in Feierlaune, als ich an diesem Abend zu Bett ging. Ich war erfüllt von Vorfreude. Trotz starker innerer Anspannung versuchte ich zu schlafen, damit ich am kommenden Tag gut in Form wäre – für meine Flucht!
Als ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit nicht schwach; nicht verzweifelt; nicht verloren. Ich hatte eine Mission!
Erstmals seit langem schien das Frühstück nach etwas zu schmecken; nun aß ich nicht, um nicht zu verhungern – sondern um Energie für meine Flucht zu haben! Ein weiteres beflügelndes Gefühl erlebte ich kurz darauf, als ich im Umkleideraum die Gefängniskleidung auszog und den Arbeitsoverall anlegte: Ich hoffte innig, dass ich die Gefängniskluft niemals wieder tragen würde.
Im Arbeitsbereich angekommen bekam ich wie erhofft den teilzerlegten Ford zugewiesen. Tatsächlich hatten die Wachen bei der Durchsuchung den Ventildeckel, den Luftfilterkasten und Teile des Ansaugtrakts demontiert. Sogleich begann ich ein Rücklicht aus dem Auto auszubauen; diese Gelegenheit nutzte ich, um einen unauffälligen Kontrollgriff nach der Uniform zu machen: Sie war noch da. Erleichterung! Nun musste ich es bloß noch schaffen den Wagen an diesem Vormittag soweit zu zerlegen, dass die Karosserie nach dem Mittagessen abtransportiert werden könnte.
Vorerst gelang es mir auch das Arbeitstempo so zu gestalten, dass ich die Karosserie bis Mittag freigelegt haben würde. Ich bemerkte, dass ich an diesem Vormittag unter besonderer Beobachtung stand: Mindestens zwei Wärter hatten mich fast pausenlos im Blick; der Verdacht, ich könnte etwas in diesem Autowrack versteckt haben, schien also immer noch zu bestehen. Allerdings versuchte ich so zu tun als würde ich die Wärter nicht bemerken; so als wäre heute nichts anders als sonst; so als würde ich einfach meine Arbeit tun und den Alltag hier im Gefängnis längst akzeptieren.
Bis dahin schien alles gut zu funktionieren. Dann aber, als es an der Zeit war den Motor auszubauen, geriet ich in Verzweiflung: Eine Schraube war bis zur Unkenntlichkeit verrostet. Wie sollte ich diesen Teil der Motoraufhängung nur zerlegen? Ich hatte nicht mehr viel Zeit: Gleich würde das Signal zur Mittagspause ertönen. Um keine wertvolle Zeit zu verlieren, tat ich etwas das ich sonst normalerweise vermied: Ich ging zu einem Wärter, erklärte, dass ich eine verrostete Schraube nicht lösen konnte und bat ihn um einen Winkelschleifer mit Trennscheibe. Vor diesem Werkzeug hatte ich einen gewissen Respekt: Das Verletzungsrisiko war sehr hoch, vor allem in ungeübten Händen. Im Normalfall bevorzugte ich es eine korrodierte Schraube in mühevoller Kleinstarbeit mit der Eisensäge zu lösen – die Zeit dazu hatte ich schließlich. Das war mir lieber gewesen als mich mit der Trennscheibe ernsthaft zu verletzen – doch heute war das anders: Der Motor musste aus dem Autowrack, koste es was es wolle!
Gesagt, getan: Ich bekam einen Winkelschleifer ausgehändigt und begann unter Aufsicht eines Wärters die Motoraufhängung durchzuschneiden: Ohrenbetäubender Lärm, Funkenflug. Ich hatte Mühe das Gerät in Zaum zu halten; nicht auszudenken, wenn es meinem Griff entglitten wäre. Die Trennscheibe hätte bersten können – hätten mich Teile davon getroffen, so hätte das im schlimmsten Fall tödlich enden können. Ein Risiko, welches ich bestimmt nicht eingegangen wäre, nur damit die Arbeit hier etwas schneller vorangehen würde … sehr wohl aber war ich gerne bereit mich in die Höhle des Löwen zu wagen, damit mein Fluchtplan funktionieren konnte.
Nur Minuten nachdem ich die solide Motoraufhängung durchtrennt hatte und die Motor-Getriebeeinheit mittels Motorhebekran entfernt hatte, erklang das Signal das die Mittagspause einläutete. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte jeder Teil meines Plans perfekt funktioniert. Ich musste nur noch essen – dann würde ich diesem Gefängnis endlich entfliehen!
Voller Genugtuung saß ich im Speisesaal und stärkte mich. Zu essen gab es irgendeinen Auflauf. Im Grunde genommen ekelhaft – und dennoch, angesichts der Umstände, das beste Essen seit Jahren! Ich genoss es, Bissen für Bissen; wissentlich, dass es wahrscheinlich die letzte Stärkung für einige Zeit sein würde … oder meine Henkersmahlzeit, falls ich bei der Flucht von den Wachen erschossen würde. Ja, in der Tat, es war ein äußerst seltsamer Gedanke: In einer Stunde würde ich frei – oder nicht mehr am Leben sein. Ich hatte Angst … große Angst! Doch ich war auch voller Verlangen; Begierde nach Freiheit! Die Sehnsucht dieser Hölle der Monotonie zu entkommen, war viel stärker als meine Angst; ich konnte es kaum abwarten, endlich diese Uniform anzulegen!
Dann ertönte das Signal wieder an die Arbeit zu gehen. Meine Stunde war gekommen. Trotz des Risikos war ich voller Zuversicht. Getötet werden oder den Rest meines Lebens in diesem Gefängnis verbringen – worin lag eigentlich der Unterschied? Heute innerhalb der nächsten 50 Minuten erschossen zu werden, würde schneller gehen als hier dazu gezwungen zu sein mein ganzes Leben zu verwarten. Mein Dasein mit der einzigen Perspektive es hier zu verbringen, hatte keinen Wert! Aber was am Tag zuvor durch Zufall in mein Leben getreten war, gab mir die Chance alles zu verändern. So spürte ich in mir ein gewaltiges Brennen das mich furchtlos werden ließ. Ich würde es tun – und ich würde es schaffen! Ich würde wieder leben!
Zurück im Arbeitsbereich montierte ich dem Wagen noch die Räder ab; ich nahm die Fußmatten zur Hand, die ich bis jetzt nicht weggeworfen hatte und platzierte in einem unbeobachteten Augenblick die Uniform zwischen diesen. Ich atmete tief durch; dann ging ich abermals zu einem der Wärter und gab Bescheid, dass die Karosserie bis auf Achsen und Auspuff aller Anbauteile entledigt und damit bereit für die Schrottpresse war. Der Wärter nickte; er schien erleichtert, dass dieses Autowrack nun aus meiner Reichweite gebracht werden sollte – zumal es am Tag zuvor für nennenswerte Aufregung gesorgt hatte.
Damit gab der Wärter einem Kollegen Bescheid, der den Stapler fahren durfte; bald kam dieser angefahren und hob die Karosserie mit den Staplerzinken. Das war mein Stichwort!
“Ich gehe mal diesen Abfall wegwerfen“, sagte ich, mit den Fußmatten in der Hand; der Wärter nickte. Da das Autowrack nun weggebracht wurde, würdigte er mich einstweilen keines weiteren Blickes.
„Jetzt oder nie!“ dachte ich und spürte einen enormen Adrenalinschub. Versteckt zwischen zwei Containern öffnete ich die Verpackung, die ich zuvor mit einem Stanleymesser entsprechend angeritzt hatte; rasch zog ich die Uniform über meinen Arbeitsoverall an. Mein Herz pochte. Ich tat es wirklich! Ich konnte es gar nicht glauben – aber es war real!
Schnell hatte ich Hemd, Sakko, Hose und Kappe angezogen. Schuhe hatte ich keine – aber das machte nichts: Die Stahlkappenschuhe die ich im Arbeitsbereich trug, sahen auf den ersten Blick nicht anders aus als die der Wärter. Dunkles, solides Schuhwerk eben.
Mit meinem neuen Äußeren wagte ich mich hinter den Containern hervor. Niemand schlug Alarm. Ich visierte den Ausgang an und ging direkt auf diesen zu. Keiner der anderen Wärter schien mich zu beachten – sie dachten wohl, ein Kollege würde nur einmal eben auf das WC verschwinden.
Ich mimte Routine; nun hatte ich eine Rolle zu spielen: Ich war ein Wärter; ein freier Mann, der in dieser Gefangenenanstalt seinen Job ausübte. Nichts Besonderes.
Nun ging ich durch den langen Gang; vollkommen unbewacht. Niemand beobachtete meine Schritte. Ich konnte mich frei bewegen! So spazierte ich vorbei an dem Ausgang zum Umkleideraum, den ich im Normalfall immer nehmen musste; auch an dem Eingang zum Speisesaal, von dem aus ich an den Nachmittagen üblicherweise weiter in den Zellenblock gehen musste. Ich ging einfach weiter! Nach vorne! Bis zur Tür; eine Panzerglastür die ich bisher immer nur aus der Entfernung hatte ansehen können; doch nun ging ich auf sie zu – im Begriff sie zu öffnen. Ich spürte überschäumende Freude, als ich meine Hand auf die Türklinke zubewegte. Ich drückte sie nach unten – doch es passierte nichts. Abgeschlossen! Natürlich – ich befand mich schließlich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Die Freude in meinem Inneren wich akuter Panik. Was sollte ich tun? Verdammt, was konnte ich tun? Ich konnte meine Flucht nicht fortsetzen! Meine Chance auf Freiheit war vertan!
Eine Sekunde lang dachte ich alles wäre aus und vorbei. Dann besann ich mich darauf, dass der Ausbruch des anderen Häftlings bestimmt nicht dilettantisch geplant worden war – hektisch durchsuchte ich die Hosentaschen und die Sakkotaschen der Uniform. Da! Ich ertastete etwas Hartes. Eine Schlüsselkarte, wie ich sogleich feststellte. Unter Hochspannung stehend führte ich sie an den Sensor neben der Tür. Ich hörte, wie das Schloss entriegelte. Ich atmete auf– und öffnete die Tür ins Freie.
Als ich den Gangnach dieser Schrecksekunde verlassen hatte, befand ich mich in einem Innenhof; einem Bereich, den Gefangene nur einmal – bei ihrer Ankunft im Gefängnis – betreten durften. Frischluft! Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Doch ich hatte es längst noch nicht geschafft. Meine Nerven waren angespannt wie Drahtseile. Vor mir sah ich ein gigantisches Tor aus Metall. Ich ging quer über den Platz, direkt auf die Pforte zu; wie ich sie öffnen sollte, wusste ich noch nicht. Diesmal würde mir die Plastikkarte wohl nicht weiterhelfen. Mir war klar, dass ich ein Fremdkörper war, hier in diesem Bereich; würde ich als solcher erkannt, wäre ich einen Moment später eliminiert: Per Kopfschuss, von einem der Scharfschützen.
Ich ging weiter und näherte mich dem Haupttor. Der Angstschweiß rann mir über die Stirn. Zu meiner linken erkannte ich ein Portierhäuschen direkt neben dem Ausweg aus dieser Gefangenenanstalt. Ich ging näher heran – jedes andere Verhalten hätte mich wohl verraten.
„Runter in den Hafen?“, fragte der Portier, sobald ich in Hörweite war.
„Jawohl“, erwiderte ich, einfach um nicht wortlos dazustehen; nun wusste ich immerhin, dass es hier einen Hafen geben musste. Der Portier nickte und drückte einen Knopf: Das Tor begann sich zu öffnen. In meinem Inneren spürte ich unbeschreibliche Freude – nach Jahren in Gefangenschaft öffnete sich mir die Pforte in die Freiheit!
Es war so unwirklich. Dass ich hier tatsächlich herausspazieren konnte. Jahrelang hatte ich davon geträumt, doch es hatte immer unerreichbar geschienen. Doch in diesem Moment öffnete sich direkt vor mir jenes Tor das nun noch zwischen mir und meiner Freiheit stand. Es war wie ein Traum … doch ich fühlte, dass es real war. In wenigen Sekunden würde ich diese Gefängnisanstalt verlassen; einen Schritt tun, nach dem ich mich so unglaublich lange schon gesehnt hatte.
Diszipliniert und stramm stehend, wie es meiner Rolle als Wärter entsprach, wartete ich ab; dann hatte sich das Tor soweit geöffnet, dass ich es passieren konnte. Ich ging ein paar Schritte vorwärts. Das Unmögliche war eingetreten: Die Mauern dieses Gefängnisses hielten mich nicht länger gefangen – ich war draußen!
In mir spürte ich ein Kribbeln, als würde ich im nächsten Moment explodieren – vor Freude! Ich wollte ihn küssen, den Boden auf dem ich stand! Direkt vor mir sah ich von einer felsigen Anhöhe hinunter auf das Meer. Ach du wunderschöne, blaue Wasseroberfläche! Ferne! Wie lange war es her, seit ich so weit bis zum Horizont hatte sehen können? Gefühlt eine Ewigkeit. Doch jetzt, nach Jahren in der Hölle, war ich wiedergeboren – ja! Ich war wieder da und direkt vor mir lag sie, die Freiheit; die aufregende, neue Welt, die ich nun erkunden würde.
Doch halt! Ich hatte die Mauern des Gefängnisses überwunden – aber in Sicherheit war ich noch lange nicht. Ich musste mich konzentrieren! Verdammt, ich musste hier weg! So schön der Blick hinaus auf das Meer auch war; in diese Richtung konnte ich nicht flüchten. Es hätte mir nichts genutzt diese asphaltierte Straße, die sich vor mir kurvenreich die Felswand hinunter wand, entlang zu laufen. Ich würde in dem Hafen angelangen, von dem der Portier gesprochen hatte. Und dann? Was sollte ich tun? Davonschwimmen? Wohl kaum! Ich musste ins Landesinnere flüchten. Das war meine einzige Chance!
Ich sah mich um: Direkt hinter mir, bestimmt mehrere hundert Meter in jede Richtung, die meterhohe Gefängnismauer; ein Wall der die gesamte Anlage zu umschließen schien. Das Areal davor: Nichts als karger Fels! Ich musste auf die Rückseite des Gefängniskomplexes. Irgendwie. Also verließ ich linkerhand die Straße und ging entlang der Gefängnismauer. Ich hatte panische Angst. Gewiss war ich sichtbar, für die Scharfschützen in den Wachtürmen rings um das Areal. Einzig bestärkte mich die Hoffnung, dass die Uniform mir ausreichend Tarnung geben würde: Dass keiner der Scharfschützen einen ausgebrochenen Häftling vermuten würde, in diesem vermeintlichen Kollegen, der da unten der Gefängnismauer entlangging.
So gelangte ich an das Ende der Mauer; ich ging um das Eck und entlang der Seitenmauer auf die in mehreren hundert Metern Entfernung gelegene Hinterseite der Gefängnisanlage zu. Ich wollte laufen, trotz dem unebenen, felsigen Untergrund – doch dann wäre meine Tarnung wohl aufgefallen. Nein! Ich musste mich verhalten wie ein Wärter der hier auf Kontrollgang war; oder sich eben einmal die Beine vertrat.
Am hinteren Ende der Anlage angekommen wollte ich schon loslaufen – doch ich erschrak: Hinter der Gefängnisanlage befand sich vielleicht noch ein paar hundert Meter weit felsiges Gelände, dann eine Baumreihe – dahinter nichts als Wasser! Es konnte einfach nicht wahr sein! Ich befand mich nicht in Deutschland. Keineswegs, ich war auf irgendeiner Insel; schon die ganze Zeit über.
Nun hatte ich es geschafft die Gefängnismauern zu überwinden. Doch was hatte mir das genutzt? Ich konnte nicht weg! Ich konnte keine Distanz zu der Gefangenenanstalt aufbauen. Bald würde man meine Abwesenheit im Arbeitsbereich bemerken. Egal was ich tun würde – ich konnte nur verlieren!
In diesem Moment verlor ich jede Hoffnung. Ich geriet in Panik. Jedoch – aufgeben wollte ich auch nicht; ich wollte mich nicht einfach stellen. Nicht nachdem ich schon so weit gekommen war! Ich wollte gar nicht daran denken, dass man mich nach diesem sehr kurzen Exkurs außerhalb der Gefängnismauern einfangen und zurück in die Zelle sperren würde; dass dieser Gefängnisalltag weitergehen sollte, so als wäre nie etwas passiert. Oh nein! Nicht mit mir! Garantiert nicht!
Unfähig eine wirklich rationale Handlung zu vollziehen, rannte ich los. Ich lief über den steinernen Untergrund, direkt auf die Bäume zu. Im Gegensatz zu der Felsoberfläche würden sie mir wenigstens irgendeine Art von Schutz bieten. Je näher ich kam, umso besser erkannte ich, dass dort nicht bloß ein paar Bäume wuchsen; viel eher schien sich auf dieser Seite der Insel ein bewaldeter Hang zu befinden, der relativ flach von diesem Felsplateau hinunter zum Meeresufer abfiel. Vielleicht konnte ich mich in diesem Waldstück verstecken? Es war geradezu kindlich naiv – doch es war die einzige Hoffnung die ich hatte.
Noch ehe ich den Waldrand erreicht hatte, hörte ich die Sirenen heulen. Jemand musste mich beobachtet haben – oder meine Abwesenheit im Arbeitsbereich war aufgefallen. Jedenfalls war meine Flucht entdeckt worden!
In Panik stürmte ich in den Wald. Gleich würden sie hier sein, um mich einzufangen! War er schon wieder vorbei, der Traum von Freiheit? So schnell mich meine Füße trugen, rannte ich durch den Wald. Kurz fiel mir ein, dass dieses Areal womöglich vermint gewesen sein könnte – doch irgendwie ließ mich dieser Gedanke kalt. Viel größer als meine Angst davor auf eine Mine zu treten, war die Angst davor aufgegriffen zu werden. Also schlug ich mich durch das Gebüsch, kletterte ohne Rücksicht auf Verluste kleine Felsvorsprünge hinab und erreichte kurz darauf das Meeresufer.
Was nun? Irgendetwas musste ich tun! Verdammt, die Gefängniswärter würden gleich hier sein! Obwohl mir selbst in dieser Situation klar war, dass es mir kaum etwas nutzen würde, mich im Wald zu verstecken, entschied ich genau das zu tun. Eine andere Möglichkeit hatte ich nicht. Ich hörte bereits das Gebell von Spürhunden. Sie waren schon auf der Suche nach mir.
Gerade als ich wieder zurücklaufen wollte, hatte ich einen Einfall: Ich würde meine Schuhe am Ufer zurücklassen. Vielleicht würde das den Eindruck erwecken, ich hätte versucht davonzuschwimmen und wäre dabei ertrunken. Wahrscheinlich würden sie das durchschauen und trotzdem nach mir suchen – jedoch war es das einzige Mittel das ich zur Verfügung hatte. Also tat ich es! Ich zog die Schuhe aus, warf sie an die Küste und lief mit bloßen Füßen zurück in den Wald.
Die Suchtrupps schienen schon sehr nahe zu sein. So gut es ging, versuchte ich sie akustisch zu orten und mich möglichst von ihnen weg zu bewegen. Mit bloßen Füßen lief ich wieder nach oben. Hundegebell! Unmittelbar vor mir; vielleicht ein dutzend Meter weit entfernt, hinter dem Gebüsch. Sofort machte ich kehrt und lief in eine andere Richtung. Ich versuchte möglichst kein Geräusch zu verursachen. Hätten sie mich erst lokalisiert, würde es keinen Sinn mehr machen noch länger vor ihnen davonzulaufen.
Plötzlich war da ein Felsvorsprung direkt vor mir. Um zu klettern, blieb mir keine Zeit. Ich versuchte den Felsen möglichst unbeschadet herunter zu gleiten. Ein törichter Versuch: Ich verlor den Halt und fiel geradewegs in das Gestrüpp am Fuß des Vorsprungs. Schmerzen! Ich war durch das Blätterdach gefallen und mit dem Rücken voran direkt auf dem harten Felsuntergrund gelandet. Kieselsteine und herab gefallene Aststücke hatten sich in meinen Rücken gebohrt. Dennoch verkniff ich mir jeden Laut – und hoffte innig, dass mein Fall die Aufmerksamkeit der Wärter nicht auf sich gezogen hatte.
Vorsichtig versuchte ich mich aufzurichten – und da sah ich etwas Interessantes! Verborgen im Dickicht lag direkt vor mir der Eingang zu einer Höhle. Sollte ich mich hier verstecken? Vielleicht kannte das Gefängnispersonal diesen Unterschlupf längst und würde hier als erstes suchen? Eigentlich war davon auszugehen. Aber egal! Wohin sollte ich sonst? Suchtrupps waren überall und da schien es mir am klügsten möglichst geräuschlos in die Höhle zu kriechen.
Kaum hatte ich mich mühevoll in die Höhle bewegt, hörte ich erneut Hundegebell.
„Was ist? Ist er hier?“, rief ein Wärter. Er schien sich direkt über mir auf dem Felsen zu befinden. Mir gefror das Blut in den Adern! Gleich würden sie mich ertappen! Zitternd versuchte ich mich noch ein Stückchen tiefer in die Höhle zu bewegen. Ich presste meinen wunden Rücken gegen die steinerne Höhlenwand, in der innigen Hoffnung ungesehen zu bleiben.
Sofort begann ich mir die Uniform auszuziehen. Die Wärter würden erwarten, dass ich eine Uniform tragen würde … auf die Farben dieser Kleidung würden sie besonders achten. Mein ausgewaschener blassbrauner, fleckenübersäter Arbeitsoverall schien mir daher eine viel bessere Tarnung zu sein. Also entledigte ich mich Kappe, Sakko, Krawatte, Hemd und Hose. Das weiße Hemd und die Kappe, die ebenfalls weiße Elemente hatte, verhüllte ich mit dem dunkelblauen Sakko und verstaute die Kleidungsstücke anschließend möglichst weit hinten in der Höhle.
Immer noch hörte ich das Bellen von mindestens zwei Spürhunden. Ich sah es bereits vor mir: Gefängniswärter die durch das Dickicht kommen und mich hier in der Höhle finden würden. Tatsächlich! Der Geräuschkulisse nach zu urteilen schienen die Wärter den Abhang seitlich zu umgehen. Würden die Hunde sie direkt zu mir führen? Ich wartete. Doch es kam niemand. Kein Spürhund, der sich durch das Dickicht kämpfte. Auch kein Wärter, der mich hier vermutete.
Was war geschehen? Hatten die Hunde meine Spur verloren als ich von dem Felsen gestürzt war? Oder waren die Wärter etwa nach unten an die Küste gerufen worden, wo ein anderer Suchtrupp meine Schuhe entdeckt hatte? Hatte mein Plan tatsächlich funktioniert? Oder wussten sie, dass ich hier war? Lauerten sie womöglich vor dem Dickicht? Aus Vorsicht, falls ich bewaffnet gewesen wäre? Vielleicht war das Gebüsch längst umstellt; ein Scharfschütze oberhalb des Felsens positioniert um mich zu erschießen sobald ich die Höhle verlassen würde?
Ich wusste nicht was hier im Gange war. Im Griff hatte ich die Lage erst recht nicht. Ich hatte die Flucht gewagt, die Gefangenenanstalt erfolgreich verlassen und sogar ein Versteck gefunden. Nun konnte ich nichts mehr weiter tun. Nur abwarten und das Beste hoffen.
So verharrte ich eine ganze Weile lang in der Höhle. In mir spürte ich einen sprudelnden Quell der Freude, bei dem Gedanken, dass mich noch kein Suchtrupp aufgespürt hatte. Allerdings wusste ich, dass die Suche nach mir bestimmt weitergehen würde. Sie würden den Wald weiter durchkämmen, da ich schließlich noch abgängig war. Meine zurückgelassenen Schuhe würden nicht als eindeutiges Indiz dafür genügen, dass ich die Insel verlassen hatte.
Draußen schien es ruhig, doch ich wagte nicht die Höhle zu verlassen. Während ich dasaß, auf dem steinernen Boden, und mich jedenfalls für den Moment in Sicherheit wähnte, begann ich mir weitere Gedanken zu machen: Falls ich weiterhin unentdeckt bleiben sollte, wie würde ich es schaffen die Insel zu verlassen? Wie sollte ich mich versorgen? Ich hatte nichts: Keine Nahrung, kein Trinkwasser. Würde mir das Waldstück bieten was ich zum Überleben brauchen würde?
Ich fing an darüber nachzudenken wie jener Häftling, der die Uniform hätte bekommen sollen, hatte vorgehen wollen. Hatte er gewusst, dass die Gefängnisanlage auf einer Felsinsel steht? Wahrscheinlich hatte er das gewusst … er musste Verbündete gehabt haben – auch jemanden aus dem Gefängnispersonal. Irgendjemand musste ihm schließlich gesagt haben, dass er eine Wärteruniform zugeschickt bekommen würde; genau am gestrigen Tag, versteckt in diesem alten Ford. Seine Flucht hätte tadellos funktioniert, wäre der Wagen von seinem Verbündeten nicht versehentlich in meinem Arbeitsbereich abgestellt worden.
„Jemand aus dem Gefängnispersonal muss davon gewusst haben. Alle Insassen werden von der Außenwelt abgeschottet. Sie dürfen weder Besuch empfangen, noch brieflich, digital oder telefonisch mit Menschen von außerhalb kommunizieren und haben de facto auch nicht die Möglichkeit dazu dieses Verbot zu missachten. Also muss es jemanden gegeben haben, der ihn im Gefängnis mit Informationen versorgt hat. Wer weiß schon was das für ein Mensch war. Vielleicht ein Verbrecherboss? Irgendjemand aus seinem Umfeld wird es geschafft haben einen Wärter zu bestechen, sodass er als Fluchthelfer fungiert hat. Das ist die einzige Möglichkeit wie diese Flucht zustande gekommen sein kann.“
Alles schien logisch zu sein. Wenn dieser Mann derart einflussreiche Kontakte hatte – und die musste er gehabt haben – dann war bestimmt auch seine Flucht von der Insel geplant gewesen. Er hätte die Uniform gestern bekommen sollen … also war vermutlich auch gestern ein Boot in der Nähe der Insel unterwegs, um den Entflohenen irgendwo am Ufer aufzunehmen; sein Informant würde ihm gesagt haben wann und wo. So schien es mir am wahrscheinlichsten.
Damit hatte ich eine plausible Theorie dazu, wie der andere Häftling die Flucht geschafft hätte – doch mir nutzte das in keiner Weise: Erstens, da ich einen Tag später geflohen war und wohl kein Boot mehr warten würde; und zweitens, da mir die Verbündeten dieses Mannes wohl kaum geholfen hätten. Nein. Sie hätten mich bestimmt nicht mitgenommen; eher hätten sie mich umgebracht weil ich die Flucht ihres Freundes vereitelt hatte.
Wäre dieser andere Mann gestern geflohen, dann hätte seine Flucht wohl funktioniert. Aber ich? Ich hatte niemanden der mich von dieser Insel abholen konnte. Der Weg der für ihn funktioniert hätte, würde für mich nicht funktionieren. Ich musste meinen eigenen Weg gehen. Wie dieser aussehen sollte? Ich hatte keine Ahnung; ein Umstand der mich in Verzweiflung stürzte. Aber es gab auch etwas das mich gleichermaßen Dankbarkeit empfinden ließ: Es war keinesfalls selbstverständlich, dass ich jetzt hier draußen sein durfte und mir Gedanken darüber machen konnte, wie ich die Insel verlassen würde können. Noch vor kurzem wären derartige Gedanken nichts als Utopie gewesen. Es war durchaus ein gewonnenes Stückchen Freiheit, dass ich überhaupt an den Punkt gekommen war an dem es wirklich Sinn machte, mich mit dieser Problemstellung auseinanderzusetzen.
Langsam brach die Dämmerung herein. Nach wie vor hielt ich mich versteckt. Doch ich spürte einen immensen Drang: Ich wollte die Höhle verlassen und hinunter an die Küste gehen. Es reizte mich ungemein, mir dort den Sonnenuntergang anzusehen … den ersten Sonnenuntergang den ich seit Jahren gesehen hätte – welch eine Verlockung! Alleine die Tatsache, dass ich theoretisch dazu in der Lage war und keine Mauer mich gehalten hätte, bescherte mir ein gutes Gefühl.
Diesem Verlangen zu widerstehen, war nicht einfach. Jedoch gelang es mir da ich verinnerlicht hatte, dass ich ab sofort wieder die Freiheit haben würde sämtliche Sonnenuntergänge zu betrachten – würde ich sie bloß nicht aufs Spiel setzen, um diesen einen anzusehen.
Es war gut, dass ich mein Versteck nicht verlassen hatte. Als die Dunkelheit hereinbrach, vernahm ich ein lautes Geräusch. Die Rotorblätter eines Helikopters! Er musste vom Festland gekommen sein, wohl um mich von der Luft aus zu suchen.
Nachdem das Fluggerät schon seit einiger Zeit über der Insel gekreist haben musste, wurde das Geräusch immer lauter. Der Hubschrauber musste direkt über mir gewesen sein! Ein greller Lichtschein durchdrang die Finsternis. Der Suchscheinwerfer erhellte das eben vorhin noch stockfinstere Dickicht. Selbst hier drinnen, in der Höhle, wurde es hell. Mein Puls raste, doch ich versuchte Ruhe zu bewahren: Vom Helikopter aus sollte es unmöglich gewesen sein den von Blättern und dem Felsvorsprung versteckten Höhleneingang zu erkennen.
Ich wähnte mich in Sicherheit, so lange ich nur weiter in der Höhle ausharren würde. Dann jedoch hörte ich erneut Hundegebell. Stimmen. Unzählige Schritte, die sich durch den dichten Wald kämpften.
Es musste ein Großaufgebot an Wärtern unterwegs gewesen sein, um das Waldstück zu durchkämmen.
Ich wusste es! Mir war von Anfang an klar gewesen, dass die falsche Fährte die ich gelegt hatte, nicht ausreichen würde. Sie vermuteten mich hier, irgendwo im Wald. Sie durchsuchten den gesamten Teil der Insel. Sie würden überall nachsehen. Sie würden mich finden und zurück in die Gefängniszelle sperren – oder aber vor Ort erschießen! Vielleicht hätte ich ihn mir vorhin doch ansehen sollen, diesen einen Sonnenuntergang?
Die Suchmannschaft kam immer näher. Sie erreichten den Felsen. Mit lichtstarken Taschenlampen leuchteten sie in das Dickicht vor dem Höhleneingang. Erst von oben herab – dann näherten sie sich von vorne.
„Ist er hier?“, rief einer der Wärter. Ein Lichtschein drang in die Höhle; so gut ich konnte, wich ich aus, damit dieser mich nicht sichtbar machen würde. Gleichzeitig versuchte ich zu erspähen was dort draußen vor sich ging. Mindestens fünf Mann hatten das Dickicht umzingelt. Sie schlugen das Gestrüpp mit Buschmessern nieder und drangen immer weiter zum Höhleneingang vor. Mit ihren Lampen leuchteten sie durch das dichte Pflanzenwerk, bis hin zum Felsen. Mir gefror das Blut in den Adern. Das war’s. Aus der Traum von Freiheit!
„Hier ist nichts!“, rief einer der Männer. Ich traute meinen Ohren kaum. Sie mussten den verwachsenen Höhleneingang übersehen haben. Es schien zu schön um wahr zu sein: Die Männer machten kehrt und zogen weiter.
Die ganze Nacht über tat ich kein Auge zu. Ich war nach wie vor in Alarmbereitschaft. Doch seit der Wald durchkämmt worden war, war es ruhig draußen. Auch der Helikopter hatte sich zurückgezogen. Weshalb sie mich nicht gefunden hatten? Vielleicht hatten sie gar nicht ernsthaft damit gerechnet, dass ich mich noch auf der Insel aufhielt? Vielleicht war die ganze Suchaktion bloß reine Routine gewesen?