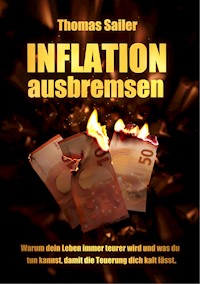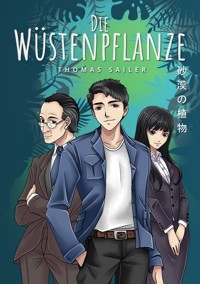7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: serendii publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frustriert von seinem auslaugenden Job bei einer riesigen Wiener Druckerei lebt Ferdinand Grenzmann nur noch in den Tag hinein. Stundenlanges Pendeln und häufige Überstunden rauben ihm sein letztes bisschen Freizeit. Doch als die Firma ihn überraschend kündigt, ändern sich seine Lebensumstände abrupt. Anstatt sich resignierend in die von der Gesellschaft erwartete Rolle als Arbeitsloser zu fügen, erkennt er die Kündigung vielmehr als neue Chance, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. So versucht Ferdinand, einer neuen Anstellung vorerst auszuweichen und arbeitet stattdessen auf seine persönlichen Träume hin. Trotz aller Hindernisse erlebt er nun nach und nach Dinge, von denen er früher bestenfalls träumen konnte. Aber der Druck auf Ferdinand wächst – und droht ihn schließlich wieder in seine alte Realität zurück zu drängen. Ein Buch für alle, die sich nach echter Freiheit sehnen – und nicht mehr länger nur davon träumen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 892
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
2. Ausgabe © 2015 Thomas Sailer Umschlaggestaltung, Illustration: serendii Lektorat, Korrektorat: serendii Verlag: serendii publishing, Siegendorf
1. ALTE FREUNDE2. ERSEHNTE FREIHEIT3. NEUE PLÄNE4. DIE AUSFAHRT5. DER FLOHMARKT6. DIE GROßE FAHRT7. DIE KÜSTENSTRAßE8. MAKARSKA9. DIE HEIMKEHR10. ALLES VERGEBENS?11. EINE SCHWERE ENTSCHEIDUNG
Ein schriller Laut durchdrang die Stille; langsam erwachte ein junger Mann und blickte verschlafen auf das Display seines Weckers: Die digitalen Ziffern zeigten 4:31 Uhr an.
Oh verdammt! Erst Dienstag“, murmelte er grämig, während er sich aufrichtete und träge aus dem Bett stieg. Müde verließ er das Zimmer; er tastete sich durch den dunklen Vorraum, bis er im Badezimmer anlangte. Mürrisch putzte er seine Zähne und streifte halbherzig einen mehrfach be- nutzten Einwegrasierer über seine Bartstoppel; dann fuhr er mit einem alten, mit Haaren übersäten Kamm flüchtig durch sein zerzaustes, schwarzes Haar. Zurück in seinem unaufgeräumten Schlafzimmer zog er eine ausgewaschene Jeans und ein abgenutztes, bereits getragenes T-Shirt an. In der Küche strich er sich einige Butterbrote, aß eines davon gleich und packte die übrigen in seine Lunchbox.
Wenig später verließ er das Haus; immer noch verschlafen taumelte er durch den finsteren Innenhof. Er öffnete das große, hölzerne Einfahrtstor und ging hinaus auf die Gasse; im Schein einer Laterne schloss er seinen Wagen auf; mit Widerwillen setzte er sich hinter das Steuer. Der Innenraum des in die Jahre gekommenen Renault Clio war schmutzig – und überfüllt mit lee- ren Getränkedosen und Verpackungen von Pausensnacks.
„Komm schon!“, murmelte er, während er versuchte, das Auto zu star- ten. „Spring an! Es hilft ja doch nichts.“
Nach mehreren Startversuchen sprang der Motor an und begann stot- ternd zu laufen; also fuhr der junge Mann los: Kurz nach fünf Uhr früh ver- ließ er die Illmitzer Feldgasse; er bog auf die Durchzugsstraße ab und folgte dieser nun in Richtung Neusiedl am See.
Etwa zwanzig Minuten nachdem er losgefahren war, begann es hell zu wer- den: Der Seewinkel erstrahlte im Licht der Morgensonne. „Es ist so schön hier …“, dachte der junge Mann, als er einer langen, ge- raden Landstraße entlangfuhr. „… aber wie immer habe ich keine Wahl – ich kann nicht bleiben.“
Bei Weiden am See gelangte er schließlich auf die A4-Autobahn, in Fahrt- richtung Wien: Auf dem Beschleunigungsstreifen gab er Vollgas, damit der Kleinwagen die Autobahngeschwindigkeit erreichte; der Motor dröhnte und der Fahrtwind schaukelte das kleine Fahrzeug hin und her, während der junge Mann der viel befahrenen Autobahn folgte. Als er sich langsam Wien näherte, verdichtete sich der Verkehr zusehends – bis es kurz darauf zu einem Verkehrsstau kam. „Das war klar! Jeden Tag der gleiche Schmarrn“, ärgerte sich der junge Mann. „Hoffentlich komme ich nicht zu spät.“ Tatsächlich kam er, wie auch viele andere Pendler, nur noch sehr langsam voran: Meter für Meter tastete er sich im stagnierenden Berufsverkehr vor- wärts, während sein Adrenalinspiegel kontinuierlich stieg; immer wieder sah er auf die Autouhr – in der Hoffnung, seinen Arbeitsplatz noch vor acht Uhr zu erreichen. Doch die Sorge, er könnte sich verspäten, war einstweilen längst nicht seine einzige. „Wenn ich heute schon wieder Überstunden machen muss, dann raste ich aus! Ich kann echt nur hoffen, dass nicht gar so viel zu tun ist wie sonst.“ Mittlerweile war der junge Mann in Wien angelangt; doch hier war der Ver- kehr erst recht zum Erliegen gekommen: Aus allen Richtungen strömten Pendler in die Stadt und so waren sämtliche Straßen hoffnungslos verstopft. Angespannt saß er in seinem Clio und wartete darauf, dass sich die riesige Fahrzeugkolonne vor ihm endlich in Bewegung setzen würde – und begann unterdessen über seinen Alltag nachzudenken. „Ein tolles Leben hast du, Ferdinand: Du bist 22 und verbringst den lie- ben langen Tag in der verdammten Firma – wo du einen Job machst, den du nicht ausstehen kannst!“ Ferdinand arbeitete für Ducker Druck – eine namhafte Offsetdruckerei mit über 200 Beschäftigten, die seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf genoss: Sie war bekannt für Produktqualität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und gute Prei- se. Dieser Leumund hatte allerdings zur Folge, dass den Mitarbeitern sprich- wörtlich nicht der geringste Fehler passieren durfte – denn jedes noch so kleine Missgeschick kostete Zeit und Geld. Um konkurrenzfähige Angebote machen zu können, wurden die Preise stets sehr knapp kalkuliert – und so stand Stress bei Ducker Druck an der Tagesordnung. Nach einiger Zeit erreichte Ferdinand ein Industriegebiet am Rand von Wien-Donaustadt. Aus sämtlichen Produktionsstätten drang Maschinenlärm; auf den Zufahrtstraßen rollten unzählige Lastwägen. Vor den Gebäuden parkten die großen, repräsentativen Limousinen der Manager; auf den hinte- ren Parklätzen fanden sich die bescheideneren Fahrzeuge der Arbeiter. Bei einem dieser Gebäude bog Ferdinand auf das Firmengelände ab, fuhr an dem Bürokomplex vorbei und parkte seinen Wagen hinter der riesigen Pro- duktionshalle; dort, wo vorwiegend die hier beschäftigten Hilfsarbeiter und Lehrlinge ihre Fortbewegungsmittel abstellten. „Zehn vor acht. Das schaffe ich noch!“, sagte Ferdinand zu sich selbst, schloss eilig sein Auto ab und lief auf das Gebäude zu; er öffnete einen der Arbeitereingänge, woraufhin ihm ohrenbetäubender Lärm wie eine Faust entgegenschlug: In der gigantischen Halle liefen mehrere dutzend Druckma- schinen längst auf Hochtouren; einige der sündhaft teuren, modernen Ma- schinen wurden gar 24 Stunden am Tag im Schichtbetrieb eingesetzt. Nun eilte Ferdinand durch die Halle, vorbei an den vielen Maschinen und Papier- paletten, und gelangte in den Umkleideraum; wo ein penetranter Gestank nach getragenen Socken und ranzigen Lebensmitteln in der Luft lag. Rasch öffnete er die Tür eines Arbeiterspinds, auf der ein Zettel mit der Aufschrift ‚Ferdinand Grenzmann’ klebte. Gehetzt zog er seine Arbeitsgarderobe an, die aus einer zerschlissenen Hose, einem mit Druckfarbenflecken übersäten T-Shirt und vollkommen ausgetragenen Schuhen bestand. Als er sich umgezogen hatte, lief er zu einem riesigen Regal am vorderen Ende der Druckhalle, in dem sich die Druckaufträge für diesen Tag befan- den; er warf einen Blick auf die ihm zugeteilten Auftragsblätter – und stieß ein tiefes Seufzen aus. „Das dauert bestimmt bis in den späten Nachmittag hinein“, murmelte Ferdinand geknickt und marschierte in den Raum, in dem sich die CTP- Maschinen der Firma befanden – um sich die Druckplatten zu holen, die er für seine Arbeit benötigte. Schließlich machte er sich, bepackt mit Aluplat- ten, auf den Weg zu der Druckmaschine, auf der er an diesem Tag drucken sollte. Ferdinand arbeitete auf alten Heidelberg-Druckmaschinen, die bloß ein oder zwei Farbwerke besaßen: Diese Maschinen konnten somit nur eine oder zwei Farben pro Durchlauf auf den Papierbogen drucken; die neuen Maschinen hatten allesamt vier oder mehr Farbwerke und waren damit in der Lage, die drei Grundfarben Cyan, Magenta und Yellow, sowie Schwarz als Kontrast- farbe auf einmal zu Papier zu bringen – und auf diese Weise in einem Durch- gang bunte Bilder zu produzieren. Die alten Einfarbenmaschinen mussten von den Papierbögen allerdings vier Mal durchlaufen werden, um vierfärbige Ausdrucke zu erzielen. Eine große Schwierigkeit dabei bestand darin, die Maschine so einzustellen, dass die Farben bei den weiteren Durchläufen genau auf das Druckbild des ersten Durchganges passen würden. Zu früher en Zeiten waren Einfarbenmaschinen tatsächlich verwendet worden, um vierfärbig zu drucken – mittlerweile wurden sie im Normalfall aber nur noch eingesetzt, wenn die angeforderte Ware bloß ein- oder zweifärbig bedruckt werden sollte. Für bestimmte, kleinere Aufträge rentierte es sich allerdings dennoch, die alten Maschinen für vierfärbige Drucke zu verwenden: Eine alte Druckmaschine war im Regelfall längst ausbezahlt, weshalb der Stunden- satz auf diesen Maschinen, verglichen mit neuen, sündhaft teuren Geräten, relativ niedrig war. So war deren Einsatz in manchen Fällen immer noch praktikabel, um der Kundschaft ein besseres Angebot unterbreiten zu kön- nen – für den Drucker war es allerdings oft eine wahre Herausforderung, mit einer alten Maschine zumindest annähernd heutige Qualitätsstandards zu erreichen. Bei der Druckmaschine angekommen legte Ferdinand die Druckplatten auf einem kleinen Tisch ab und nahm einen der Druckaufträge an sich: Dieser erste Auftrag für den heutigen Arbeitstag war ein beidseitig zu bedruckender Beipackzettel mit einer Auflage von 2.000 Stück. „Mal sehen. Auf der Druckplatte sind vier Nutzen1, also macht das netto 500 Druckbögen – einmal Schöndruck, einmal Widerdruck“, faselte Ferdi- nand desinteressiert, während er die zugehörige Druckplatte an einem Ende abknickte und diese in die Maschine einzuspannen begann. „Die meisten Aufträge auf meiner Liste sollen heute noch geliefert wer- den … dabei muss ich sie erst drucken – und endgefertigt müssen sie auch noch werden“, murmelte Ferdinand kopfschüttelnd; ihm war klar, dass die- ser Tag, wie fast jeder seiner Arbeitstage, einiges an Stress für ihn bereithal- en würde. Ehe er die Maschine weiter auf den Druckvorgang vorbereitete, sah er sich auch die übrigen Aufträge an, die noch am Vormittag erledigt werden muss- ten. Auf einem Schmierzettel notierte er sich die benötigten Papiersorten, sowie die erforderliche Papiermenge, und eilte damit in das Papierlager. Dort lud Ferdinand die Papierbögen, die jedoch nur im Ganzbogenformat vor- handen waren, verschränkt auf eine Palette, sodass er sie anschließend ein- fach voneinander trennen konnte, und führte diese mit einem kleinen Hub- wagen zu einer der Schneidmaschinen.
„Die Drucker auf den großen Maschinen haben Helfer für diese Drecks- arbeit – ich muss das alles selber machen!“, fluchte Ferdinand, während er apiersorte für Papiersorte auf das jeweils erforderliche Format zuschnitt. Als er damit fertig war, beeilte er sich, an die Druckmaschine zu kommen, denn längst war es nach acht Uhr – und bisweilen war an diesem Tag noch kein einziger Druckbogen durch seine Maschine gelaufen. Flott justierte Ferdinand die Druckmaschine, ließ Farbe auf die Walzen laufen und schickte die ersten Druckbögen durch die Maschine. „Das sieht doch passabel aus“, murmelte Ferdinand, nachdem er einen der Bögen begutachtet hatte. „Noch etwas mehr Farbe, dann ist es gut.“ Schließlich startete er den eigentlichen Druckvorgang und achtete neben- bei akribisch auf mögliche Fehlerquellen. Rund um ihn liefen sämtliche Ma- schinen auf Höchstgeschwindigkeit, um die vielen Aufträge der Firma recht- zeitig drucken zu können. Für die Drucker war praktisch fehlerfreies und dennoch schnelles Arbeiten eine absolute Grundvorrausetzung, um in die- sem Betrieb mithalten zu können. Gestoppt wurden die Maschinen im Re- gelfall nur, um die Druckplatten zu wechseln und um die Gummituchzylin- der zu waschen. Während der Druckvorgänge musste penibel darauf geach- tet werden, dass die Farbintensität und der Ausdruck in Ordnung waren. Darüber hinaus konnte andauernd Schmutz oder Ähnliches in das Druckbild gelangen; war das der Fall, musste die Maschine umgehend gestoppt und die Verschmutzung entfernt werden. Blieb eine Verunreinigung ungesehen, wurde die Auflage weggeworfen und auf Kosten der Firma neu gedruckt: Für den verantwortlichen Drucker konnte solch ein kleiner, jedoch kostspie- liger Fehler unter Umständen schwerwiegende Konsequenzen haben. Daher musste trotz des enormen Zeitdrucks jeder Auftrag mit größter Genauigkeit erledigt werden. Zwei Stunden nach Arbeitsbeginn hatte Ferdinand bereits ein paar der Aufträge erledigt und arbeitete nun an einem zweiseitigen Firmenrundschreiben mit einer Auflage von 3.000 Stück. Der Schöndruck war schon abgeschlossen und so bedruckte die Maschine momentan die Rückseite des Papiers. „Die Rückseite passt auf die Vorderseite und die Farbe ist schön kräftig“, murmelte Ferdinand, während er einen der Druckbögen kontrollierte. „Aber was ist …? Ach, Mist verdammter!“, fluchte er. „Jetzt fängt dieser Dreck an zu schmieren: Zu wenig Wischwasser. Wie sehr ich diesen Job doch hasse!“
Tatsächlich war die Wischwasserzufuhr für die Menge an Farbe, die auf die Druckplatte gelangte, nicht mehr ausreichend: Als Folge davon hatte die Druckfarbe auf dem Papier zu schmieren begonnen. „Ausgerechnet beim Widerdruck! Jetzt muss ich neues Papier zuschneiden, den Widerdruck fertig drucken, die alte Platte noch mal einspannen und den Schöndruck auf einigen Bögen nachdrucken“, jammerte Ferdinand, bereits jetzt der Verzweiflung nahe; er war sich darüber gewiss, dass er sein Pensum an diesem Vormittag längst nicht erfüllen konnte. Sehnsüchtig sah er immer wieder auf die Uhr, da er die Mittagspause kaum erwarten konnte. Nach einem schier endlosen Vormittag standen die Zeiger der Uhr endlich auf zwölf. Ferdinand druckte den Schöndruck des aktuellen Auftrages fertig und ließ die Maschine dann stehen. Bereits jetzt tat ihm sein ganzer Körper weh. „Der Job ist die Hölle: Den ganzen Tag lang habe ich keine Möglichkeit, mich auch nur einen Moment lang hinzusetzen und auszuruhen – meine Knie machen das nicht mehr lange mit … außerdem ist mir schwindlig von den verdammten Chemikalien – mit diesen Giften ruiniere ich mich noch!“, grübelte Ferdinand frustriert, während er in den Umkleideraum trottete. Als er seine Lunchbox aus dem Spind geholt hatte, vernahm er aus dem Arbeiteraufenthaltsraum Gequassel, Gelächter und einen furchtbaren Mief. Doch Ferdinand bevorzugte es ohnehin, seine Mittagspause im Freien zu verbringen. „Ich bin heilfroh, wenn ich diesem Gefängnis wenigstens eine halbe Stunde lang entkommen kann!“ Geradewegs marschierte er durch die Druckhalle; vorbei an den großen, modernen Druckmaschinen, die auch um die Mittagszeit auf Hochtouren liefen – und schließlich auch an den kleinen, alten Maschinen, die im hinteren Bereich der Halle standen. „Dieser Stress macht mich fertig: Gut arbeiten, schnell arbeiten – und wenn dabei ein Fehler passiert, dann habe ich natürlich Schuld!“, ging Ferdinand durch den Kopf, als er die Druckhalle durch den Arbeitereingang verließ.
„Endlich draußen!“, dachte er – froh darüber, nun fast eine halbe Stunde lang seine Ruhe zu haben; so spazierte er auf seinen Wagen zu, setzte sich hinter das Steuer und begann die mitgebrachten Brote zu essen. Aber schon nach ein paar Bissen fing er wieder an über seine triste Alltagssituation nachzudenken.
„Was mache ich hier eigentlich? Ich vergeude meine Zeit mit stumpfsinniger, gesundheitsschädlicher Arbeit! Seit über zwei Jahren geht das schon so: Damals im Frühjahr 2009 war ich froh, nach dem Bundesheer überhaupt einen Job bekommen zu haben … und jetzt, seit einem Monat bin ich ausgelernter Drucker und verdiene wenigstens etwas mehr – während meiner Lehrzeit habe ich mir diese Schinderei ja für ein paar lächerliche hundert Euro im Monat angetan!“ Verkrampft packte Ferdinand seine Knie mit den Händen, beugte sich nach vorn und lehnte seinen Kopf gegen das Lenkrad seines Wagens. „Aber was bringt mir das Geld, wenn ich mit meinem Alltag derart unglücklich bin? Früher dachte ich, dass es besser ist, irgendeine Arbeit zu haben, als arbeitslos zu sein … heute bin ich mir da gar nicht mehr so sicher“, zischte er grantig, während ein peinigendes Gefühl der Ausweglosigkeit von ihm Besitz ergriff. „Tag für Tag stehe ich um 4:30 Uhr in der Früh auf, fahre gegen 5:30 Uhr los und komme zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr hier an; jeden Morgen hoffe ich, dass einmal nicht so viel zu tun ist: Auf den kleinen Maschinen gibt es keine Schicht … ich muss so lange drucken bis alles fertig ist – und ich weiß nicht, wann ich zuletzt Punkt 16:30 Uhr die Maschine ausschalten konnte. Während der vergangenen Wochen bin ich an keinem Tag vor 18:00 Uhr fertig geworden! Ja – oft dauert die Arbeit sogar noch viel länger … aber die ganzen Überstunden bringen mir absolut nichts: Der Abteilungsleiter hat uns ja dringend nahe gelegt, nicht alle Überstunden aufzuschreiben – da wir selbst schuld wären, wenn wir länger brauchen. Schreibe ich doch welche auf, bekomme ich sie trotzdem fast nie ausbezahlt … und wenn ich deshalb zur Gewerkschaft gehe, bin ich den Job los. Es ist echt verrückt, dass ich bei diesem alltäglichen Wahnsinn mitspiele!“, resümierte Ferdinand verärgert. „Aber was soll ich denn schon machen? Es bleibt mir ja doch nichts über, als der Realität ins Gesicht zu sehen und alles so zu nehmen, wie es ist“, grübelte er verzweifelt, lehnte sich erschöpft zurück und begann an einem weiteren Butterbrot zu kauen. Kurz vor halb eins verließ Ferdinand sein Auto – und begab sich erneut an die Druckmaschine. Stunde um Stunde verging, doch Ferdinand erschien die Zeitspanne, als wollte sie partout nicht enden. Die harte Arbeit, die Druckerchemikalien und die schlechte Luft in der Halle belasteten ihn sehr; und so fühlte er sich bald gerädert und gar etwas benommen. Doch immerhin liefen die Druckvorgänge einstweilen weitgehend reibungslos und so leerte sich der Stapel von Druckaufträgen schneller, als Ferdinand angenommen hatte: Kurz nach halb fünf war er mit dem vorletzten Auftrag fertig.13
„Einen Job muss ich noch drucken – dann kann ich endlich Feierabend machen!“, dachte Ferdinand und empfand dabei einen kleinen Anflug von Erleichterung; dieser währte allerdings nur so lange, bis er einen genaueren Blick auf das Auftragsblatt warf. „Fünfhundert Stück Visitenkarten; vierfärbig gedruckt – auch das noch!“, murmelte Ferdinand geknickt; seine Hoffnung darauf, diesen Auftrag schnell erledigen zu können, schwand dahin.
Frustriert spannte er die erste Druckplatte ein und bedruckte das Papier in einem ersten Durchlauf mit Schwarz, da diese Druckfarbe bereits im Farbwerk vorhanden war. Zwar dauerte es nicht lange, bis die wenigen Bögen die Maschine durchlaufen hatten – doch anschließend war ein Farbwechsel erforderlich: Dazu musste Ferdinand die Druckfarbe, eine zähflüssige, klebrige Masse, sorgfältig aus dem Farbwerk spachteln und dieses, sowie die Walzen und das Gummituch, von deren Rückständen befreien. „Wie ich dich hasse, du verdammter Schrotthaufen!“, fluchte Ferdinand, während er die Walzen der Druckmaschine mit einem Lappen, den er zuvor in starkem Reinigungsbenzin getränkt hatte, aufwendig säuberte; die giftigen Dämpfe, die er dabei notgedrungen mit jedem Atemzug inhalierte, riefen bei ihm ziemliche Kopfschmerzen hervor.
Nach zwei weiteren Durchläufen reinigte Ferdinand die Druckmaschine, alleine für diesen Auftrag bereits zum dritten Mal; nur einmal noch musste er die Druckbögen durch die Maschine laufen lassen, ehe er auch diesen Auftrag ad Acta legen konnte. Der Schweiß rann ihm über die Stirn, während er den Druckvorgang mit akribischer Genauigkeit beobachtete. „Ich kann nur hoffen, dass die Farbintensität konstant bleibt und sich keine Partikel von den kaputten Stoffwischern lösen, die dann das Druckbild verunstalten!“, dachte Ferdinand verkrampft, während Bogen für Bogen durch die Jahrzehnte alte Maschine lief. „Wenn jetzt etwas schief geht, dann muss ich im schlimmsten Fall alles neu drucken … läuft aber alles gut, muss ich nur noch die Maschine reinigen – und kann dann für heute endlich nach Hause fahren.“ Es war kurz nach 18:30 Uhr, als Ferdinand die fertig bedruckten Bögen auf iner Palette neben der Maschine absetzte. Eilig reinigte er die Maschine und verließ anschließend seinen Arbeitsplatz. „Hoffentlich laufe ich dem Abteilungsleiter nicht über den Weg: Alleine letzte Woche hat er mich zwei Mal, nachdem ich schon umgezogen und auf dem Nachhauseweg war, zurück auf eine Druckmaschine geschickt – ich14 habe die Schnauze echt voll von diesen ach so wichtigen Aufträgen, die unbedingt heute noch gedruckt werden müssen!“, ging Ferdinand durch den Kopf, während er auf Unauffälligkeit bedacht in Richtung des Umkleideraums schlich. Doch der Abteilungsleiter, ein hoffnungsloser Workaholic namens Heinz Radler, schien einstweilen ohnehin nicht in der Druckhalle zu sein. So zog Ferdinand sich eilig um und verließ das Gebäude – ehe der Abteilungsleiter ihn eventuell doch noch abpassen konnte. Und als er über den Parkplatz marschierte, keimte gar ein Hauch von Freude in ihm auf. „Gott sei Dank bin ich für heute fertig ... nach schier endlosen Stunden kann ich endlich zurück ins Burgenland fahren und mich von dieser elenden Schinderei erholen!“ Allerdings war ihm dieser Gedanke nur ein schwacher Trost, da ihn sein Arbeitsalltag generell stark frustrierte – und so begann er, schon als er in seinem Wagen saß, neuerlich zu grübeln. „Wie lange soll es noch so weitergehen? Ich fahre ja nur als kurze Unterbrechung des Arbeitstages nach Hause; mehr als ein hastig zubereitetes Abendessen und ein paar Stunden Ruhe habe ich nicht zu erwarten“, dachte er geknickt. „Seit ich angefangen habe zu arbeiten, dreht sich mein Leben unfreiwilliger Weise nur noch um den verdammten Job! Ich fühle mich fast wie ein Häftling – der den ganzen Tag in seiner Zelle festsitzt und nur gelegentlich kurzen Ausgang bekommt.“ Nun drehte er den Zündschlüssel um und hoffte, dass der Motor auch anspringen würde – seit einiger Zeit schon hatte sein Auto Probleme beim Starten: Die Zündkerzen waren längst nicht mehr die besten und der Motor wies auch keine guten Kompressionswerte mehr auf. Doch Ferdinand hatte Glück und der Wagen sprang nach kurzem Bangen an. So fuhr er unverzüglich los: Vorbei an den Rostlauben der Lehrlinge und Hilfsarbeiter, sowie an den Mittelklassewagen der besser verdienenden Drucker, der Druckvorstufentechniker und des Verwaltungspersonals; schließlich erblickte er auch Peter Duckers schwarzen Jaguar, der direkt vor dem Eingang parkte. „Dieses Auto ist ein Traum! Es ist echt eine Schande, ein so schönes Auto für die Arbeit zu verbrauchen“, dachte Ferdinand; wie so oft, wenn er den Wagen seines Chefs zu sehen bekam. Dann gab er Gas und fuhr aus der Betriebsausfahrt in den immer noch dichten Verkehr ein. Eine Weile lang kämpfte er sich durch den Wiener Stadtverkehr – bis er schließlich die Ostautobahn erreichte.
Mittlerweile dämmerte es; der Verkehr ließ merkbar nach. Ferdinand folgte der Autobahn – als etwa auf Höhe Schwechat der Zeiger des Fernthermo-15 meters plötzlich in den kritischen Bereich schnellte und die Temperaturwarnleuchte rot aufleuchtete. Er bemerkte diese Warnhinweise augenblicklich, lenkte den Wagen besonnen auf den Pannenstreifen und stellte den Motor ab; etwas erschrocken öffnete er die Motorhaube und begann nach der Ursache für den Defekt zu suchen. „Der Kühler ist kalt – also öffnet der Thermostat nicht in den großen Kühlerkreislauf“, stellte Ferdinand bald fest; also schloss er die Motorhaube, lehnte sich gegen den Wagen und überlegte sich seine nächsten Schritte. „Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als den Motor auskühlen zu lassen und vorsichtig bis zur nächsten Ausfahrt zu fahren … soweit ich weiß, gibt es in der Nähe eine Renault-Werkstatt. Wenn ich das Auto dort abgestellt habe, werde ich mir irgendwo ein Quartier nehmen müssen.“
Nur Momente später glitt ein silberner Porsche vorbei, bremste scharf ab und hielt auf dem Pannenstreifen, nur wenige dutzend Meter vor Ferdinands Wagen, an. Der Fahrer des Sportwagens stieg aus und kam auf Ferdinand zu; es war ein gut gekleideter junger Mann, dessen Designerkleidung offenkundig anzusehen war, wie viel Geld sie gekostet hatte. „Kann ich behilflich sein?“, fragte dieser charmant grinsend, als er auf Ferdinand zukam; dieser sah sein Gegenüber erstaunt an. „Ich glaub’s ja nicht – wir haben uns ewig nicht mehr gesehen!“ Der junge Mann war niemand anderes als Ferdinands alter Schulfreund Jonathan ‚Johnny’ Hofmeister. Während Ferdinand sich in der Schule meist sehr zurückhaltend verhalten hatte, nie sonderlich beliebt und in einigen Fächern nur mäßig begabt gewesen war, war Johnny schon immer ein absoluter Gewinner gewesen: Er hatte einen Notenschnitt von eins und seine Schulakte war makellos; im Turnunterricht brach er Schulrekorde und nahm scheinbar mühelos an sämtlichen schulischen Projekten teil. Dank seines blendenden Aussehens war Johnny ein echter Mädchenschwarm und so hatte er immer sehr hübsche Freundinnen gehabt. Auch bei den männlichen Kollegen war er sehr beliebt – denn jeder wollte gerne so sein wie er. Neben seinem guten Aussehen, seinem Charme, dem Charisma und der Intelligenz war an seiner unangefochtenen Beliebtheit auch nicht unwesentlich der Reichtum seiner Eltern beteiligt gewesen … denn Johnny hatte einfach alles: Schon als Kind hatte er immer die neuesten Videospiele, teures Gewand, Mountainbikes, mit 16 ein neues Moped und mit 17 schließlich ein eigenes Auto. Auch beim Lehrkörper war Johnny äußerst beliebt gewesen, denn er verstand es mit Fleiß, Engagement und gutem Benehmen aufzutrumpfen. Trotz dieser Be- liebtheit war Ferdinand von Kindergartentagen an sein bester Freund gewesen. Nachdem die beiden das Gymnasium abgeschlossen hatten, mussten sie ihren Wehrdienst ableisten: Während Ferdinand gewöhnlicher Grundwehrdiener war, bekam Johnny durch Kontakte seines Vaters eine bessere Position – nach dem Bundesheer war er umgehend in dessen Immobiliengeschäft eingestiegen und bald darauf nach Wien übersiedelt. Von dieser Zeit an war Johnny stets sehr beschäftigt gewesen und so hatte der Kontakt zu Ferdinand rasch abgenommen – bis er schließlich ganz verschwunden war. Nun jedoch hatten sich die beiden nach beinahe zwei Jahren zufällig wieder getroffen.
„Wie geht es dir? Was hast du so gemacht, seit wir uns zuletzt gesehen haben?“, erkundigte Ferdinand sich aufgeregt. „Das kann ich dir gerne erzählen – aber vorher werde ich dir dabei helfen, dein Auto von hier wegzuschaffen“, entgegnete Johnny souverän. „Hast du ein Abschleppseil dabei?“ „Ja“, antwortete Ferdinand. „Ich habe eines im Kofferraum.“ Damit öffnete er die Heckklappe, entnahm das Abschleppseil und koppelte den Clio an den Porsche seines Freundes an. Anschließend stiegen die beiden wieder in ihre Autos; Johnny schleppte Ferdinands Kleinwagen bis zur nächsten Ausfahrt – und von dort aus bis zur nächstgelegenen RenaultWerkstätte. „Wie gehst du jetzt weiter vor?“, erkundigte sich Johnny, nachdem er vor er mit einem Schranken abgesperrten Einfahrt des Autohauses angehalten hatte. „Ich werde mir hier irgendwo ein Quartier suchen“, entgegnete Ferdinand, löste das Abschleppseil von den Autos, verstaute dieses im Kofferraum des Clio und warf seine Autoschlüssel in den Postkasten der Werkstatt. „Ach komm! Von mir aus kannst du heute bei mir übernachten. Ich war eigentlich zu einer Firmenfeier eingeladen – die wurde aber kurzfristig abgesagt. Also habe ich sogar etwas Zeit über, damit wir uns mal wieder unterhalten können“, bot Johnny ihm daraufhin an. „Danke, das ist sehr nett von dir“, erwiderte Ferdinand ohne zu zögern; von Johnnys Mobiltelefon aus rief er rasch seine Eltern an und gab ihnen Bescheid, dass er an diesem Abend nicht nach Hause kommen würde; dann steigen die zwei in den Porsche und fuhren davon.
„Ich war gerade unterwegs zu einem Schnellimbiss. Den ganzen Tag lang war ich auf Achse und jetzt brauche ich etwas zu essen“, erklärte Johnny, während er mit seinem Sportwagen durch die Straßen von Schwechat brauste.
„Kein Problem“, entgegnete Ferdinand, der durchaus Gefallen an der Mitfahrt in dem Porsche fand. Nur wenige Minuten später erreichten die beiden ein Fast-Food-Restaurant, bestellten etwas zu essen und setzten sich an einen der vielen Tische. Ferdinand, der nach seinem anstrengenden Arbeitstag selbst sehr hungrig war, sah ungläubig zu, wie Johnny in Windeseile zwei große Burger und eine große Portion Pommes Frites verschlang. „Na los – fahren wir!“, äußerte dieser dominant, sobald er sein Essen verputzt hatte. Verwundert über die Hektik seines Freundes, stopfte Ferdinand sich eilig den Rest seines Burgers in den Mund und folgte diesem hinterher. Kurz darauf fuhren die beiden zurück in Richtung des Stadtzentrums, wobei Johnny die ganze Zeit über aufschneiderisch von seiner Firma erzählte.
„Hier wohne ich“, erklärte dieser, als er und Ferdinand wenig später vor einem modernen, weißen Wohnblock angelangten. In schnellem Tempo befuhr er die im Erdgeschoss des Gebäudes gelegene Parkgarage und parkte seinen Porsche in der Nähe des Aufzuges. Nachdem er den Motor abgestellt hatte, zückte er einen kleinen Kamm aus dem Handschuhfach und fuhr damit geschwind durch sein modisch geschnittenes, volles blondes Haar. Schließlich stiegen die beiden aus dem Wagen und fuhren mit dem Lift hinauf in den obersten Stock des Wohnblocks. Dort angelangt stellte Ferdinand fest, dass obwohl das Bauwerk eine beachtliche Grundfläche hatte, sich nur zwei Wohnungstüren im Obergeschoss fanden. „Was kostet dich die Monatsmiete hier?“, erkundigte Ferdinand sich beiläufig. „Glaub mir – das möchtest du gar nicht wissen“, prahlte Johnny, schloss die schwere Sicherheitstür auf und trat ein. Ferdinand folgte ihm und bemerkte sogleich, dass die Wohnung vom Feinsten ausgestattet war: Die edlen Steinböden wurden von Perserteppichen geschmückt und an den Wänden hingen moderne Kunstwerke; die modisch schlichten Möbel waren wohl allesamt vom Tischler in Handarbeit hergestellt worden. Staunend sah sich Ferdinand um: Ein solches Luxusambiente bekam er freilich nicht oft zu Gesicht. Dennoch hatten diese großzügig dimensionierten Räumlichkeiten etwas an sich, das ihm unbehaglich erschien. „Irgendwie wirkt alles in dieser Wohnung farblos, kalt und wenig ansprechend“, ging Ferdinand durch den Kopf, während er Johnny in dessen Wohnzimmer folgte. „Überhaupt habe ich den Eindruck, dass Johnny sich sehr verändert hat: Er wirkt hektisch und ungemütlich; ganz anders als früher – er hat wohl stark von seinen spießigen Eltern angezogen, denen Arbeit, Geld und Prestige scheinbar alles bedeuten.“
Während Ferdinand sich über den Wandel seines alten Freundes zu sorgen begann, rief Johnny lautstark: „Hey Süße – schau mal, wen ich mitgebracht habe!“ Auf diese Worte hinaus trat ein bildhübsches Mädchen aus der Küche und sah Ferdinand verdutzt an. Das lange, braune Haar der jungen Frau umschmeichelte ihr ungeschminktes, und doch makellos schönes Gesicht. Nach einem Moment der Verwunderung begann das Mädchen zu lächeln, lief auf Ferdinand zu – und fiel ihm sogleich stürmisch um den Hals. „Ferdinand – ich freue mich sehr dich zu sehen! Es muss bestimmt zwei Jahre her sein, seit wir uns zuletzt getroffen haben. Erzähl! Was tut sich bei dir?“ Etwas überrascht erwiderte Ferdinand die Umarmung. “Ja weißt du – seit etwa zwei Jahren mache ich nichts als zu arbeiten: Das Pendeln und der Job haben mich fest im Griff. Es ist nicht das große Los … aber ich kann es wohl nicht ändern. Aber wie auch immer – wie geht es dir, Alexandra?“
Es war eine äußerst willkommene Überraschung für Ferdinand, Alexandra nach langer Zeit nun wieder gegenüberzustehen – auch sie kannte er noch aus dem Gymnasium. „Sie ist in die Parallelklasse gegangen; eine der Wenigen, die Johnny in der Schule noch übertrumpfen konnten“, erinnerte sich Ferdinand, innerlich schmunzelnd. „Die meiste Zeit über war sie eher unbeliebt – weil sie ein Jahr jünger war als die anderen und sich lange Zeit absolut nichts aus Mode gemacht hat; erst in der Abschlussklasse hat sie sich dann gemausert … ich kann mich noch genau erinnern: Über die Sommerferien ist aus der unscheinbaren Alexandra eine junge Frau geworden, die es fast jedem in unserer Oberstufe angetan hatte. Unsäglich neidisch auf ihre natürliche Schönheit, waren die anderen Mädels doch alle um ihre Freundschaft bemüht – plötzlich war sie die Traumfrau der ganzen Schule.“ Bei der Erinnerung an seine unbeschwerte Schulzeit und an intakte Freundschaften wurde ihm kurzfristig richtig warm ums Herz. „Oh ja – und so war es für uns alle nur eine Frage der Zeit, bis sie mit Johnny zusammenkommen würde. Sein Interesse hat er bald gezeigt – aber dabei hat es erst einmal gar nicht gut für ihn ausgesehen: Alexandra meinte, er wäre nur ein kindischer Angeber – und ein Playboy. Kurz vor Weihnachten hat er sie dann gefragt – und die erste Abfuhr seines Lebens kassiert“, schwelgte Ferdinand weiter in Erinnerungen. „Ich weiß es noch genau – das hat ihn damals sehr getroffen: Er war in seinem Stolz verletzt; aber es war nicht nur das: Er hat in Alexandra doch viel mehr gesehen als in den ganzen Mädchen, mit denen er vorher zusammen gewesen war. Ich glaube, es war das erste Mal, dass er sich richtig verliebt hatte. Ach – und als er sich dann vor Weihnachten für sein selbstverliebtes Auftreten vor ihr entschuldigen wollte … und sie das eiskalt abgelehnt hat – das war echt hart für ihn – die ganzen Feiertage über hat er nur gejammert und war richtig mies drauf; da konnten ihn auch die teuren Weihnachtsgeschenke von seinen Eltern nicht trösten.“ Es gefiel Ferdinand sehr, zur Ausnahme an etwas denken zu dürfen, das ihn persönlich berührte; ganz im Gegensatz zu all den Dingen, mit denen er sich Tag für Tag in der Firma konfrontiert sah. „Aber im Neuen Jahr dann hat sie seine Entschuldigung angenommen – und sich bereiterklärt, einmal mit ihm auszugehen. Und keine zwei Wochen später waren die zwei auch schon ein Paar. Ich habe mich sehr für Johnny gefreut; und Alexandra war im Gegensatz zu all seinen Verflossenen immer sehr nett zu mir – auch wir waren bald gut befreundet. Aber als der Kontakt zu Johnny immer weniger wurde, habe ich auch Alexandra nicht mehr getroffen. Und jetzt – siehe da – knapp zwei Jahre später sehen wir uns wieder.“
„Fabelhaft geht es ihr!“, äußerte Johnny mit künstlichem Lachen, ehe Alexandra die Möglichkeit dazu hatte, selbst zu antworten. „Wie sonst sollte es ihr auch gehen, in einer so feinen Wohnung?“ Als er dies gesagt hatte, wandte er sich umgehend an Alexandra: „Ferdinand hatte eine Panne mit seiner Rostlaube und wusste gar nicht wohin, also habe ich ihm angeboten, dass er heute hier übernachten kann. Deshalb ist er hier.“ Ferdinand, aus seinen Erinnerungen gerissen, bestätigte dies nur mit einem flüchtigen Nicken. Nun forderte Johnny seine Freundin dazu auf, das Gästezimmer vorzubereiten. Diese tat, was er ihr aufgetragen hatte, und ließ die beiden im Wohnzimmer alleine – abermals war Ferdinand aufgefallen, dass sein alter Freund sich stark verändert hatte. „Gerade eben hat Johnny nicht sehr freundlich von mir gesprochen – und Alexandra hat er behandelt wie eine Angestellte. Das war früher nie seine Art!“ Durch Johnnys Verhalten etwas nachdenklich, sah Ferdinand durch ein großes Fenster, das einen beachtlichen Ausblick auf die Stadt bot. „Wie gefällt dir die Wohnung?“, fragte Johnny, setzte sich auf seine große, makellos weiße Ledercouch und lehnte sich mit stolzer Miene zurück. „Du hast es hier wirklich sehr nett“, antwortete Ferdinand zurückhaltend und setzte sich ebenfalls. „Natürlich kostet das alles hier viel Geld – aber das muss es einem wert sein!“, prahlte Johnny indirekt mit seinem hohen Einkommen, gerade als Alexandra aus dem Gästezimmer kam und sich neben ihn auf die Couch setzte. Sogleich begann er angeberisch davon zu sprechen, wie beispielhaft seine bisherige Karriere verlaufen war und welche Freude ihm der tägliche Umgang mit wichtigen und einflussreichen Leuten bereitete; dabei erklärte er immer wieder eindringlich, wie teuer sein derzeitiger Lebensstandard war. Mit jedem seiner Sätze wuchs Ferdinands Klarheit darüber, dass sein Freund sich tatsächlich sehr verändert hatte. Längst lauschte er Johnny nur noch mit halber Aufmerksamkeit, da dieser ihn schlichtweg unsäglich fadisierte. „Es ist nicht wie früher, als wir über Autos, Mädchen und Partys gesprochen haben: Pausenlos spricht er von seiner Arbeit und von seinem überteuerten, spießigen Lebensstil; alles andere scheint ihn überhaupt nicht mehr zu interessieren“, ging Ferdinand durch den Kopf. „Er gerät seinem Vater in beängstigender Weise nach: Herr Hofmeister hat sieben Tage pro Woche gearbeitet – und das meist bis spät in die Nacht hinein. Ihn interessierten echt nur Arbeit, Geld und Prestige. Einmal, als er zwischen zwei Terminen für etwa eine halbe Stunde nach Neusiedl gekommen ist, hat er mit Johnny ausschließlich über seinen Beruf gesprochen. Sobald sein Vater wieder weg war, hat er mir gesagt, dass er selbst nie so werden möchte – aber wie es aussieht, haben sich seine Ansichten seither stark geändert!“ Etwa eine Stunde lang erzählte Johnny unentwegt von seiner Arbeit; über sein Privatleben verlor er jedoch kein Wort. Schließlich wandte sich Alexandra an Ferdinand: „Und, was hat sich bei dir getan? Du hast doch bestimmt auch etwas zu erzählen.“ „Ach ja – richtig“, sagte Johnny insgeheim irritiert durch diese Unterbrechung; er zog eine gelangweilte Miene und verschränkte seine Arme. „Also Ferdinand – schieß los!“ Dieser hatte durchaus bemerkt, dass Alexandra sich während Johnnys Erzählungen furchtbar gelangweilt hatte; ihm war klar, dass sie dessen Angeberei bestimmt längst auswendig kannte. Erfreut darüber, nun auch zu Wort zu kommen, begann er zu erzählen: “Im Herbst nach dem Abschluss musste ich zum Bundesheer. Die Grundausbildung war ziemlich anstrengend, aber davon wird jeder berichten, der sie durchgemacht hat. Danach war der Wehrdienst gar nicht mehr so schlimm – ja zeitweise sogar ganz unterhaltsam! Ende Februar durfte ich abrüsten und stand plötzlich ziemlich planlosda; also habe ich eine Lehre in einer Druckerei begonnen. Seit einem Monat bin ich jetzt ausgelernter Drucker.“ „Ein sehr guter Entschluss! Du hast dich nicht unnötig mit einem Studium aufgehalten, sondern gleich zu arbeiten begonnen. Das finde ich sehr gut!“, äußerte Johnny überzeugt. „Wo arbeitest du denn?“ „Ich arbeite bei Ducker Druck in Wien – falls du die Firma zufällig kennst?“, entgegnete Ferdinand. „Selbstverständlich! Ihr habt einen super Ruf … ja – wir lassen sogar allerhand bei euch drucken. Mein Vater kennt deinen Chef persönlich und soweit mir bekannt ist, seid ihr sehr gut ausgelastet. Wenn du dich anstrengst, dann hast du dort bestimmt einen sicheren Arbeitsplatz!“, antwortete Johnny, beim Thema ‚Arbeit’ nun erneut in seinem Element. Ferdinand ließ sich durch dessen Sicht der Dinge nicht beirren und begann von seiner harten Lehrzeit zu erzählen: Ausführlich sprach er darüber, dass er oft Überstunden machen musste, andauernd Staub und Chemikalien ausgesetzt war und die harte Arbeit ihn regelmäßig in die Erschöpfung trieb. Auch schilderte er, dass er pro Arbeitstag in der Praxis etwa vier Stunden Fahrtzeit in Kauf nehmen musste und ihn seit zwei Jahren das Gefühl begleitete, als hätte er praktisch kein Privatleben mehr. Während Alexandra ihm mit zusehends besorgter und mitleidiger Miene zuhörte, geriet Johnny durch Ferdinands Worte schließlich in Rage.
„Das kann ich mir nicht mehr anhören!“, schnauzte er. „Sei froh, dass du arbeiten darfst! Du hast ein sicheres Einkommen, also hör gefälligst auf, dich zu beschweren!“ „Ja … toll – ein sicheres Einkommen alleine bedeutet aber noch längst keine Lebensqualität!“, vertrat Ferdinand weiter seinen Standpunkt – obwohl er im Grunde begriffen hatte, dass er seine Meinung vor Johnny nicht mehr ohne weiteres äußern konnte. „Was willst du Faulenzer sonst machen? Willst du kündigen und auf Kosten der Steuerzahler leben?“, erwiderte Johnny spöttisch. „Sicher kennst du das Sprichwort: ‚Arbeite um zu leben, aber lebe nicht um zu arbeiten’. Einstweilen fühlt es sich an, als würde der Beruf mein Leben vollkommen dominieren – und wenn ich dir so zuhöre, scheint es bei dir nicht anders zu sein“, konterte Ferdinand. „HALT DEN RAND!“, schrie Johnny aufgebracht. „Ist dir eigentlich klar, wie wichtig meine Arbeit ist? Ich finanziere mir damit einen exquisiten Lebensstandard! Davon abgesehen ist sie der Gesellschaft von großem Nutzen: Ich schaffe Jobs, sorge für zahlreiche neue Aufträge in der Bauwirtschaft und unterstütze das System mit Steuern in Millionenhöhe! Möchtestdu wissen, wie viel ich jedes Jahr an das Finanzamt überweise? Diese Summe kannst du Taugenichts gar nicht aussprechen! Und wie du siehst, konsumiere ich auch Einiges – davon können wieder andere existieren! Also verzapfe verdammt noch mal keinen solchen Schwachsinn!“ Obwohl Ferdinand klar war, dass es klüger gewesen wäre sich zusammenzureißen und sich jedwede Kritik an Johnny zu verkneifen, erwiderte er kopfschüttelnd: „Sei mir nicht böse – aber du hast eindeutig gelernt, deinem Vater alles nachzuplappern.“ Nun war Ferdinand sich gewiss, dass er sich wohl auf die Suche nach einem anderen Quartier würde machen müssen. Tatsächlich war Johnny sein Zorn nun erst recht anzusehen; er holte bereits tief Luft, um Ferdinand anzubrüllen – doch da rief Alexandra: „HÖRT AUF! Ihr zwei begegnet euch nach über zwei Jahren zum ersten Mal wieder und streitet wegen solcher Kleinigkeiten. Ist euch diese Meinungsverschiedenheit wirklich einen Streit wert?“ Überrascht sah Johnny seine Freundin an; ohne ein Wort zu sagen, stand er auf und ging erhaben auf das mannshohe Fenster zu. „Ja … wie auch immer – ich habe morgen einen langen Tag vor mir und jetzt wirklich keinen Nerv für diesen Blödsinn!“, erklärte er hochmütig, den Blick auf das nächtliche Wien gerichtet. „Ich fahre morgen um Punkt 4:00 Uhr von hier weg. Ruf morgen Früh in der Werkstätte an, damit die deinen Schrotthaufen reparieren – Alexandra wird dich in die Arbeit fahren.“ Ohne Ferdinand eines weiteren Blickes zu würdigen, verließ er den Raum.
„Alexandra – es tut mir leid!“, entschuldigte sich Ferdinand beschämt. „Es ist schon in Ordnung“, entgegnete diese und seufzte. „Am besten gehst du jetzt auch schlafen.“ Ferdinand nickte zustimmend; dann trottete er ins Gästezimmer und begann sich bettfertig zu machen. Im Zimmer angelangt bemerkte er, dass Alexandra ihm einen von Johnnys Schalfanzügen und sogar Zahnpflegekaugummis auf das Bett gelegt hatte. Betrübt über den verpatzten Abend legte er sich in das gemütliche Gästebett und versuchte zu schlafen. Allerdings beschäftigten ihn zu viele Gedanken, als dass er gleich einschlafen konnte. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, Johnny und Alexandra nach so langer Zeit wieder zu sehen. Aber ich kann es nicht fassen, dass ich mit Johnny gestritten habe! Früher haben wir uns immer zugehört und eine Lösung für Differenzen gefunden; aber mittlerweile haben wir uns scheinbar dermaßen voneinander entfremdet, dass wir wegen verschiedener Ansichten gleich zu streiten beginnen.“ Eine ganze Weile lang wälzte sich Ferdinand ruhelos im Bett hin und her, ehe er schließlich doch einschlief.
Es war 6:00 Uhr, als der Radiowecker Ferdinand aus dem Schlaf riss. Ungewohnt munter stand er auf, kleidete sich rasch an und schüttelte die Bettdecke sorgfältig auf. „Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass ich unter der Woche bis sechs Uhr früh ausschlafen darf; normalerweise müsste ich schon seit anderthalb Stunden wach sein“, dachte Ferdinand und verließ mit diesem Gedanken das Gästezimmer. Vorsichtig tappte er durch die fremden, von der Morgensonne hell erleuchteten Räume von Johnnys Wohnung. „Guten Morgen!“, sagte Alexandra heiter, als Ferdinand die Küche betrat. Zu seiner großen Überraschung hatte sie bereits einen reichhaltig gedeckten Frühstückstisch bereitet. „Guten Morgen Alexandra. So viel Gastfreundschaft steht mir doch gar nicht zu!“, äußerte Ferdinand überrascht. „Ach Unsinn – das mache ich doch gerne“, entgegnete Alexandra. „Ich bin sowieso daran gewöhnt, zeitig aufzustehen, um für Johnny Frühstück zu machen – sonst isst er den ganzen Tag lang ohnehin nur Fast-Food.“ „Johnny nimmt seine Arbeit wohl sehr ernst“, sagte Ferdinand zurückhaltend, nachdem er und Alexandra sich an den Tisch gesetzt hatten. Tatsächlich hatte er längst erkannt, dass sein alter Freund ein Workaholic geworden war – und doch wäre es ihm peinlich gewesen, Alexandra zu direkt auf diesen Umstand anzusprechen. „Ja, das hast du richtig erkannt. Er tut kaum noch etwas anderes als zu arbeiten“, seufzte Alexandra und stocherte dabei abwesend mit der Gabel in ihrem Spiegelei herum; ihre Heiterkeit war mit einem Mal wie weggeblasen. „Das habe ich mir gedacht“, antwortete Ferdinand verhalten. „Ich mache mir große Sorgen um Johnny. Er geht in seiner Arbeit unter und denkt an gar nichts anderes mehr!“, erklärte Alexandra bedrückt – ehe sie plötzlich zu lächeln begann und beschwingt fortfuhr: „Aber so ist Johnny eben. Und jetzt lassen wir uns am besten das Frühstück schmecken.“
Ein wenig irritiert begann Ferdinand, die Köstlichkeiten zu essen, die Alexandra für ihn zubereitet hatte. Er schwieg, da er sehr wohl verstanden hatte, dass diese nicht weiter über Johnnys Arbeitswut sprechen wollte. Dennoch war ihm klar, dass ihr geradezu unwirklich schönes Lächeln nichts weiter als eine Maske war, hinter der sie ihre Traurigkeit verbarg. „Alexandra tut mir wirklich leid! Sie ist ein bezauberndes Mädchen und noch immer so liebenswert wie früher – aber Johnny hat sich allem Anscheinnach zu einem richtigen Ekel entwickelt. Ich kann nur vermuten, wie sehr sie unter seiner Arbeit leidet.“
Nachdem die beiden aufgegessen hatten, rief Ferdinand in der Autowerkstätte an und beauftragte diese an seinem Wagen den Thermostat zu wechseln. Im Anschluss daran verließen Alexandra und er die Wohnung und fuhren mit dem Aufzug hinab in die Parkgarage. „Das gibt es doch nicht!“, rief Ferdinand begeistert als er dort auf einem der abseits gelegenen Parkplätze Johnnys altes Cabrio erblickte. Aufgeregt lief er auf das Auto zu und musterte erstaunt den 25 Jahre alten, silbernen Saab: Sogleich wurden Erinnerungen in ihm wach – vor wenigen Jahren waren er und Johnny oft mit diesem Auto unterwegs gewesen; seither hatte sich vieles verändert – doch dieser automobile Klassiker stand nun erneut vor ihm und präsentierte sich nach wie vor in makellosem Zustand. „Das Auto sieht noch genauso aus wie damals – als Johnny es zu seinem 17. Geburtstag bekommen hat!“, äußerte Ferdinand wehmütig. „Johnny wollte das Auto schon längst verschrotten und durch einen Neuen ersetzen – er meinte, der alte Saab wäre nicht mehr präsentabel. Ich war mit diesem Entschluss aber nicht einverstanden und da Johnny ihn trotzdem nicht behalten wollte, hat er ihn mir geschenkt. Eigentlich hat sich dadurch nichts geändert, da ich schon mit dem Auto fahre, seit er seinen Porsche hat. Nur gehört mir das Auto jetzt auch auf dem Papier“, schilderte Alexandra und schloss die Wagentüren auf. Nachdem sie und Ferdinand im Auto Platz genommen hatten, drehte sie den Zündschlüssel um, stellte den Automatikwahlhebel auf ‚D’ und fuhr langsam aus dem Parkhaus.
Während Alexandra den Saab durch die viel befahrenen Straßen Wiens steuerte, genoss Ferdinand die Mitfahrt in dem klassischen Cabrio. Längst hatte er nicht mehr damit gerechnet, dass er jemals wieder in diesem Auto sitzen würde. Er liebte den Komfort des alten Schwedenfahrzeugs und den souveränen Klang dessen starken Motors. Davon abgesehen rief der Geruch der gepflegten Lederausstattung in Ferdinand Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervor: So dachte er eine Weile lang verträumt an sein letztes Schuljahr zurück – bis Alexandra ihn schließlich verunsichert ansprach: „Sag mal, Ferdinand … bist du eigentlich böse auf mich?“ „Warum sollte ich dir böse sein?“, entgegnete Ferdinand überrascht. „Ich kann mich nicht erinnern, dass du mir auch nur ein einziges Mal in irgendeier Weise einen Grund dazu gegeben hättest.“ „Aber … hat es dich nie gestört, dass Johnny plötzlich so viel Zeit mit mir verbracht hat? Oder, dass wir nach Wien gezogen sind und nach kurzer Zeit jeder Kontakt zu dir abgerissen ist?“, hakte Alexandra beunruhigt nach. „Während der Schulzeit warst du von all den Mädchen, mit denen Johnny ausgegangen ist, die einzige, die nichts gegen mich hatte: Seine bisherigen Freundinnen wollten ihn immer davon überzeugen, sich nicht mehr mit einem Verlierer wie mir zu treffen – du hingegen hast mich immer akzeptiert und Johnny den nötigen Raum gelassen, damit er für mich überhaupt noch Zeit haben konnte. Also wie um alles in der Welt könnte ich dir böse sein?“, antwortete ihr Ferdinand. „Und der Umzug nach Wien? Von dieser Zeit an hat Johnny den Kontakt zu dir aufgegeben. Anfangs hast du oft angerufen … aber er hatte nie Zeit für dich“, sprach Alexandra angespannt weiter. „Ich gebe nicht dir die Schuld daran, dass die Dinge so gekommen sind. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass du Johnny während der Abschlussklasse oft gesagt hast, wie sehr du von einem beschaulichen Leben auf dem Land geträumt hast. Du hast ihn nie zur Karriere gedrängt und trägst keine Schuld dafür, dass er so geworden ist!“, entgegnete Ferdinand bestimmt. „Darf ich dir etwas anvertrauen?“, fragte Alexandra zögerlich. „Natürlich darfst du das“, willigte Ferdinand sofort ein. „Wie du bestimmt erkannt hast, hat sich einiges verändert: Johnny kümmert sich bloß noch um seine Arbeit. Er hat keine Zeit mehr für Freizeitbeschäftigungen, er hat keine Zeit mehr für Freunde – und er hat keine Zeit mehr … für mich“, erklärte Alexandra vorsichtig; sie war sichtlich darum bemüht, ihre Fassung zu bewahren. Mittlerweile war der morgendliche Berufsverkehr zum Erliegen gekommen und so standen die beiden im Stau. „Ich will dich wirklich nicht mit meinen Problemen belästigen – ich weiß nur nicht, mit wem ich sonst darüber sprechen sollte: Meine alten Schulfreundinnen habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen und hier in der Stadt habe ich keine neuen Freunde gefunden. Meine Eltern sehe ich nur hin und wieder an Wochenenden und bringe es nicht übers Herz ihnen zu erzählen, wie ich mich fühle – sie freuen sich so sehr für mich, da Johnny so gut verdient und wir keine Geldsorgen haben müssen. Sie denken, ich wäre glücklich damit … aber in Wahrheit sitze ich den ganzen Tag lang in diesem verdammten goldenen Käfig!“, schilderte Alexandra, bereits den Tränen nahe. „Bestimmt ist diese Frage überflüssig – aber hast du Johnny denn schon auf seine Arbeitswut angesprochen?“, hakte Ferdinand nach. „Natürlich habe ich das – aber du hast gesehen wie er reagiert, wenn man ihn wegen seiner Rastlosigkeit kritisiert. Überhaupt scheint kaum jemand übertriebenen Arbeitseifer als Problem anzusehen – ich glaube, du bist derEinzige, dem ich mich im Moment anvertrauen kann“, entgegnete Alexandra, sichtlich verzweifelt. Unterdessen hatte Ferdinand längst erkannt, dass ihr Leben einem Scherbenhaufen glich: Er empfand großes Mitleid für sie – jedoch wusste er nicht, wie er ihr helfen konnte.
Langsam begann sich der Stau zu lichten und so gelangten die beiden bald nach Wien-Donaustadt. Um zwanzig vor acht rollte das schöne Cabrio schließlich über den großen Firmenparkplatz von Ducker Druck in Richtung des Hintereingangs. „Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag!“, sagte Alexandra, nachdem Ferdinand aus dem Auto gestiegen war. „Vielen Dank! Überhaupt möchte ich mich bei dir für alles bedanken, was du seit gestern für mich getan hast“, entgegnete dieser, zögerte einen Moment und fuhr schließlich fort: „Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, dann bin ich gerne für dich da.“ „Ich danke dir!“, antwortete Alexandra und lächelte. „Ruf mich einfach an, wenn du geholt werden möchtest – ich fahre dich gerne zur Werkstatt.“ Erfreut über ihr Angebot bedankte sich Ferdinand abermals, ehe er die Fahrzeugtür schloss und sich der verhassten Firma zuwandte.
Nun stand er wieder vor dem Hintereingang – genau wie es 24 Stunden zuvor ebenfalls der Fall gewesen war. Zögerlich öffnete er die Tür und betrat das Betriebsgebäude: Demotiviert wandelte er abermals durch die Halle, vorbei an all den lärmenden Maschinen. Als er den Umkleideraum erreicht hatte, trat ihm, wie so oft, ein furchtbarer Gestank nach getragenen Turnschuhen und verdorbenen Lebensmitteln entgegen; doch darauf achtete er einstweilen kaum. Er zog eilig seine mit Druckfarbe beschmierte Arbeitskleidung an – bereit einen weiteren Arbeitstag zu überstehen. Während er sich umkleidete, wurde er plötzlich unsanft von hinten angestoßen. „Scheiße Alter! Wo hat einer wie du so eine Puppe aufgerissen?“, sagte ein Hilfsarbeiter namens Radoslaw; ein kleiner Mann um die 30, dessen ärmellose Arbeitskleidung seine über und über tätowierten Oberarme zeigte. Von Neugierde fast zerfressen stand er hinter Ferdinand; eine ganze Horde on Helfern, die sich hinter Radoslaw scharte, lachte im Chor – tatsächlich war jedoch jeder einzelne von ihnen nicht minder auf eine Antwort gespannt. „Freilich interessiert sie das: Mädchen wie Alexandra bekommen diese Schmierlappen sonst allenfalls in Hochglanzmagazinen zu Gesicht“, dachte Ferdinand verächtlich. Er hatte jedoch keinerlei Lust, auf irgendwelche Debatten und erfand daher prompt eine Notlüge. „Sie ist meine Cousine – und nicht meine Freundin.“ „Und ist die zu haben?“, erkundigte sich ein vorlauter Helfer sogleich. „Nein, sie ist verheiratet“, entgegnete Ferdinand und rannte darauf hinaus aus dem Umkleideraum. „Ich passe einfach nicht in die Welt meiner Arbeitskollegen! Ihnen macht es nicht viel aus, in der Firma zu sein. Das alles hier, die Arbeit auf den Maschinen und der Umgang untereinander ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie sind schlichtweg andere Sitten gewohnt! Daher können diese Menschen auch nicht verstehen, dass ich mit Alexandra nur befreundet bin“, dachte Ferdinand, während er die Druckplatten durch die Halle schleppte. Mittlerweile war es eins nach acht Uhr: Also eilte er an die Maschine, nahm diese umgehend in Betrieb und spannte die erste Druckplatte ein.
Nach gut einer Viertelstunde hatte Ferdinand die Maschine so weit eingestellt, dass er mit dem Druck des ersten Auftrages beginnen konnte. Sogleich schickte er einige Bögen Papier durch die alte Einfarbenmaschine, um den Farbverlauf auf diese Weise einzupendeln. Im Anschluss daran kontrollierte er den Ausdruck – und da er mit dem Ergebnis zufrieden war, startete er den eigentlichen Druckvorgang. Und während er diesen penibel beobachtete, ertönte plötzlich eine laute Stimme hinter seinem Rücken: „Grenzmann!“ Erschrocken drehte Ferdinand sich um: Hinter ihm stand Heinz Radler. „Mach den Auftrag hier noch fertig – dann soll einer der Helfer auf der Maschine weiterdrucken. In exakt einer Viertelstunde meldest du dich in meinem Büro!“, brüllte der Abteilungsleiter, um neben dem Maschinenlärm überhaupt verstanden zu werden. Ferdinand nickte unterwürfig, woraufhin Heinz Radler gehetzt weitermarschierte. „Ich frage mich, was ich diesmal falsch gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich zu viel Papier verbraucht oder es ist eine Reklamation eingegangen“, grübelte Ferdinand bang. Während Bogen für Bogen durch die Maschine lief, wuchs seine Nervosität stetig: Er wusste nur zu gut, dass der Abteilungsleiter es durchaus verstand, Mitarbeiter einzuschüchtern. „Während meiner Lehrzeit hat Heinz Radler mich oft wegen kleiner Fehler in sein Büro beordert. Dort stand ich ihm hilflos gegenüber, während er mich aus voller Kehle anschrie und beschimpfte.“ Es dauert nicht lange, bis auch der letzte Papierbogen durch die alte Einfarbenmaschine gelaufen war; also bat Ferdinand den Helfer Radoslaw die Arbeit auf der Maschine zu übernehmen. Zwar hatte dieser nie eine Lehre als Drucker gemacht, jedoch war er angelernt worden und hatte weit mehr Talent im Umgang mit Druckmaschinen als mancher Geselle. Radoslaw, der soeben aufwendige Wartungsarbeiten an einer Maschine durchführte, wargerne bereit, diese zu unterbrechen und dafür auf der Einfarbenmaschine weiterzuarbeiten.
Einstweilen eilte Ferdinand in den Umkleideraum, um sich noch einen Schluck Wasser zu gönnen, ehe er sich dem Abteilungsleiter stellen würde. Dann marschierte er stark angespannt zu Heinz Radlers Büro, nahm seinen Mut zusammen und klopfte vorsichtig an die Tür. „Herein!“, drang die genervte und doch ungewohnt ruhige Stimme des Abteilungsleiters aus dem Raum. Verhalten betrat Ferdinand das Büro und schloss die Tür hinter sich. „Setz dich, Grenzmann!“, äußerte Heinz Radler schroff; mit ernstem Gesichtsausdruck saß er hinter seinem Schreibtisch. „Das ist seltsam: Normalerweise läuft das Procedere so ab, dass Radler den jeweiligen, ohnehin wie angewurzelt vor ihm stehenden Angestellten mit gehörigem Geschrei zurechtweist“, wunderte sich Ferdinand, als er sich dem Schreibtisch zurückhaltend näherte und sich schließlich auf einen davor platzierten Sessel setzte. „Grenzmann, kannst du dir vorstellen, wieso du hier sitzt?“, begann Heinz Radler streng, jedoch immer noch untypisch ruhig zu sprechen; und ehe Ferdinand antworten konnte, fuhr er fort: „Die Arbeit, die du gestern geleistet hast, ist der letzte Mist! Der Kunde hat sofort bei Erhalt der Ware reklamiert.“ Ferdinand, der seinem Abteilungsleiter eingeschüchtert gegenübersaß, versuchte erst gar nicht, sich zu rechtfertigen. „Deine Schlampereien sind mir längst zu mühselig. Du hattest Chancen genug, um zu zeigen was du kannst. Aber wie man sieht, ist das nicht viel!“, äußerte Radler in eindringlichem Tonfall, griff in eine seiner Schreibtischladen und holte ein verschlossenes C4-Kuvert hervor. „Ich rede nicht um den heißen Brei herum: Hier sind deine Kündigungspapiere. Die Firma hat keine Verwendung mehr für dich. Unser Arbeitsverhältnis ist hiermit beendet!“, erklärte Heinz Radler kühl, als er Ferdinand den Umschlag aushändigte. Dieser nahm die Papiere wortlos an sich und verließ das Büro seines nunmehr ehemaligen Abteilungsleiters. „Bevor du gehst, räume dein Schließfach aus! Den Schlüssel gibst du bei Frau Huber ab!“, rief Heinz Radler ihm hinterher, als dieser im Begriff war den Raum zu verlassen. Ferdinand nickte und schloss die Tür hinter sich. Sein Puls raste, als er schnellen Schrittes in den Umkleideraum marschierte.
„Ich kann nicht fassen, dass ich den Job verloren habe! Wie soll es jetzt weitergehen?“, ging Ferdinand durch den Kopf, während er seinen Arbeiterspind ausräumte. „Ein paar Monate lang bekomme ich sicher Geld vom Arbeitsamt – aber was dann? Meine Eltern haben nicht genug Geld, um mich längerfristig zu unterstützen: Ich muss so bald wie möglich wieder Arbeit finden!“ Obwohl er seinen Job bei Ducker Druck vom ersten Tag an nicht ausstehen konnte, war er sich sehr wohl bewusst, dass es noch weitaus schlimmere Tätigkeiten gab. „Die nächste Station ist vermutlich Fließbandarbeiter oder Baustellenhelfer – vielleicht sogar ohne feste Anstellung!“ Aufgewühlt stopfte Ferdinand seine Sachen in einen Sack, verschloss den Arbeiterspind und verließ den Umkleideraum. „Wahrscheinlich steht mir keine einfache Zeit bevor“, grübelte Ferdinand, als er in den vorderen Bereich des Gebäudes ging; langsam wich der erste Schrecken von ihm. „Aber … irgendwie fühle ich mich gerade total erleichtert!“ Nach wie vor war er sich der Konsequenzen der Kündigung bewusst, und doch konnte er kaum anders, als an deren positive Aspekte zu denken: „Okay, ich weiß nicht, was ich als nächstes arbeiten werde – aber hey: Morgen brauche ich nicht in aller Früh aufstehen; nicht in die Firma fahren und mich vor allem nicht eine gefühlte Ewigkeit lang in der Druckhalle kaputt zu arbeiten. Auch wenn ich mir das im Moment noch kaum vorstellen kann – aber dieser quälende Alltag wird mir ab sofort erspart bleiben!“ Bei diesem Gedanken formten seine Mundwinkel sich unweigerlich zu einem Lächeln. Plötzlich fühlte Ferdinand einen Anflug von belebender Aufregung, der rasend schnell seinen ganzen Körper durchströmte. Sein omnipräsenter Frust war nun, erstmals seit über zwei Jahren, von einem Hoffnungsschimmer vertrieben worden. „Endlich werde ich wieder Zeit für mich selbst haben! Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ist“, dachte Ferdinand; in sich spürte er einen intensiven Motivationsschub. So marschierte er guter Dinge durch den vorderen Teil des Gebäudes und begann sogleich zu planen: „Ich kann es kaum abwarten, heute nach Hause zu kommen! Jetzt werde ich noch den Schlüssel zurückgeben – und dann nichts wie weg von hier!“
Bevor Ferdinand den Bürotrakt betrat, warf er einen flüchtigen Blick auf seine Kündigungsunterlagen. „Hier steht, dass ich bereits Mitte des Monats gekündigt wurde. So ist Radler die Kündigungsfrist umgangen. Das ist illegal; aber er weiß, dass ich mich nicht mit der Firma anlegen werde“, grübelte Ferdinand und steckte dieKündigungsunterlagen zurück in das Kuvert. „Aber was kümmert mich das? Ich bin frei! Alles andere ist mir im Moment egal.“ Nur Momente später betrat er einen riesigen Büroraum und spazierte schnurstracks über den grauen Teppich, vorbei an zahlreichen Nischen. Rund um ihn saßen Sekretärinnen an ihren kleinen Schreibtischen; diese telefonierten entweder mit Kunden oder arbeiteten an Formularen. An den filigranen Abtrennungselementen zwischen den Schreibtischen waren die jeweiligen Namensschilder angebracht. Suchend durchstreifte Ferdinand den Raum, bis er auf einem dieser Schilder ‚Frau Margarethe Huber’ las. „Entschuldigung. Darf ich Sie kurz stören?“, sagte Ferdinand höflich zu der molligen, etwa sechzigjährigen Dame, die eifrig an ihrem Computer arbeitete. „Freilich dürfen Sie das. Was kann ich für Sie tun, junger Mann?“, erkundigte sich die freundliche Sekretärin. „Herr Radler schickt mich, da ich bei Ihnen meinen Schließfachschlüssel abgeben soll!“, antwortete Ferdinand. „Oh weh! Wieso denn das?“, hakte Frau Huber gesprächig nach. „Weil ich soeben gekündigt wurde“, antwortete Ferdinand gelassen und legte den Schlüssel auf ihren Schreibtisch. „Du meine Güte! Das tut mir sehr leid für Sie! Wollen Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Oder ist das dem Magen jetzt zu viel?“, erwiderte die ältere Dame mitleidig. „Danke, ein Kaffee wäre wirklich sehr nett“, entgegnete Ferdinand. „Das heißt, falls ich Sie damit nicht unnötig aufhalte.“ „Ach papperlapapp! Ich arbeite schon seit Mitte der siebziger Jahre hier bei Ducker Druck. Damals gehörte der Betrieb noch Alois Ducker, dem Vater des heutigen Chefs. Da werde ich doch Zeit haben, um Ihnen einen Kaffee zu machen!“, antwortete Frau Huber entschlossen, unterbrach ihre Arbeit und verließ den Raum. Nur Minuten später kehrte sie mit einer großen Tasse Kaffee zurück und gab diese Ferdinand in die Hand. „Danke!“, sagte dieser freundlich und begann zu trinken. „Wissen Sie, mein zweitältester Sohn war auch bis vor kurzem ohne Arbeit“, fing Frau Huber unterdessen an zu erzählen. „Er ist gelernter Koch und war ganze acht Monate lang arbeitslos. Der Junge hat mir so leidgetan – aber zum Glück hat er vor einigen Wochen Arbeit in einem Gasthaus gefunden, wo es ihm richtig gut gefällt.“
„Haben Sie vielen Dank für den Kaffee!“, sagte Ferdinand höflich, sobald er ausgetrunken hatte; es erstaunte ihn durchaus, dass in einer Firma wie Ducker Druck dermaßen entspannte Leute wie Frau Huber arbeiteten. „Gern geschehen“, entgegnete diese herzlich. „Und nehmen Sie die Kündigung bloß nicht zu schwer. Sie werden sehen: Es wird sich wieder etwas für Sie finden. Ich wünsch Ihnen alles Gute!“ Lächelnd bedankt Ferdinand sich abermals und verabschiedete sich von der gastlichen Dame; doch ehe er den Raum verließ, machte er kehrt. „Ach – Frau Huber! Ich habe noch eine Bitte.“ „Wie kann ich Ihnen helfen?“, entgegnete diese. „Darf ich vielleicht kurz ihr Telefon benutzen? Ich besitze kein Mobiltelefon und müsste einer Bekannten Bescheid geben, damit sie mich abholt; mein Auto steht nämlich in der Werkstatt“, erklärte Ferdinand. „Aber selbstverständlich“, antwortete die ältere Dame, nach wie vor mit mitleidigem Unterton. Daraufhin nahm Ferdinand den Hörer ab und wählte die Nummer von Alexandras Mobiltelefon. Drei Mal klingelte es, ehe er am anderen Ende der Leitung ihre liebliche Stimme vernahm. „Alexandra Zwetkowa, Hallo?“ „Hallo Alexandra – hier ist Ferdinand. Du hast mir doch angeboten, mich nach der Arbeit abzuholen. Falls du gerade nichts Wichtiges zu tun hast – ich wäre hier fertig“, äußerte Ferdinand nüchtern.