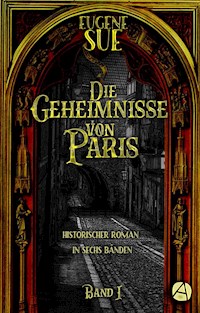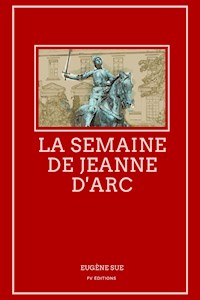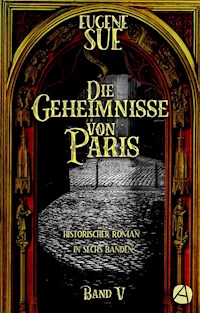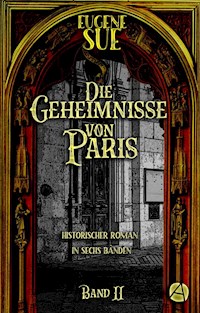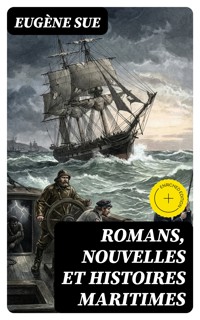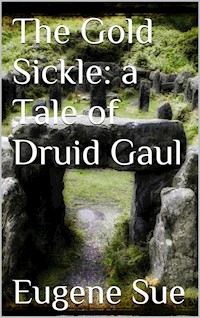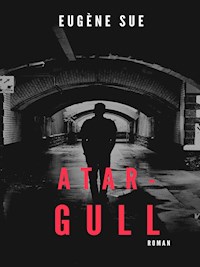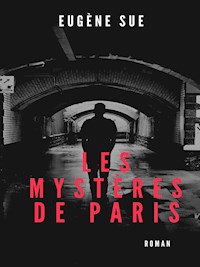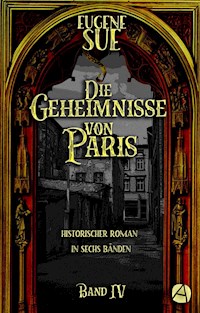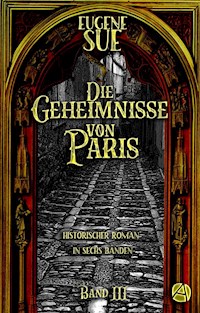4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Eugène Sues Die Geheimnisse von Paris entführt den Leser in die elenden Arbeiterviertel von Paris in der Mitte des 19. Jahrhunderts: in die schicken Salons der adligen Oberschicht, wo sich familiäre Dramen abspielen, während um jeden Preis die Fassade gewahrt werden muss, und in die schmutzigen Spelunken, wo sich die Verbrecher der Stadt treffen, um finstere Pläne zu schmieden. Dem Autor war daran gelegen, seinen Lesern die Barbarei direkt vor ihren Augen, im Dschungel der Großstadt, zu zeigen und zugleich auf die himmelschreienden Ungerechtigkeiten hinzuweisen, mit denen die Pariser Unterschicht tagtäglich konfrontiert war. Dieser Notlage begegnet er im Roman zum einen mit praktischen Vorschlägen, wie das Leid der Arbeiter gemindert und das Strafrecht verbessert werden könnte. Zum anderen lässt er seinen beinahe gottgleichen Helden Rudolf das Los der Armen lindern und die Bösen strafen. Sues Engagement für die Schwachen, aber auch die facettenreichen Einblicke in eine Gesellschaft zu Beginn der Industrialisierung, das sind die Zutaten, die Die Geheimnisse von Paris bis heute zu einer mitreißenden Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eugène Sue
Die Geheimnisse von Paris
Ein Sitten-Roman
2. Band
Impressum
Texte: © Copyright by Eugène Sue
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Philipp Wanderer
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Achter Teil
Erstes Kapitel. Graf von Saint-Remy.
Vicomte von Saint-Remy wohnte in der Rue Chaillot, in einem schmucken kleinen Hause, das zwischen Hof und Garten stand. Der Stadtteil ist trotz der Nähe der Elysäischen Felder, der vornehmsten Promenade von Paris, doch verhältnismäßig still und einsam. Daß eine solche Wohnung für den jungen Elegant, der hauptsächlich auf sein Glück bei der Frauenwelt spekulierte, ihre besonderen Vorteile bot, braucht nicht erst gesagt zu werden, bemerkt sei nur, daß durch die Pforte des großen Gartens, die in ein völlig ödes, die Rue Chaillot mit der Rue Marboeuf verbindendes Gäßchen führte, jedermann unbemerkt zu ihm gelangen konnte.
Vicomte von Saint-Remy stand vor dem völligen Ruin. All seine Pferde und Equipagen hatte er bereits seinem Stallknecht, alles Mobiliar, alle Gemälde, wie auch die Einrichtung seines Hauses seinem Kammerdiener verpfändet. Sein Vater lebte zurückgezogen in Asnières und verkehrte mit seinem Sohne gar nicht. Das hing so zusammen: Seine Gemahlin hatte mit einem polnischen Grafen ein Liebesverhältnis unterhalten, und der Vicomte hatte triftigen Grund zu der Annahme, daß Florestan – so hieß der junge Vicomte – gar nicht sein Sohn sei. Diesen Galan seiner Frau hatte er in einem Duell erschossen; bald darauf war seine Frau verstorben und hatte ihrem Sohne eine Million vermacht, die dieser jedoch in kurzer Zeit vergeudet hatte.
Urplötzlich war nun der alte Vicomte in Paris aufgetaucht, um sich nach Frau von Fermont, über deren Unglück er unterrichtet worden war, zu erkundigen. Der verstorbene Gemahl dieser Frau hatte ihm bei jenem Duell mit dem polnischen Grafen als Sekundant gedient und war zeitlebens sein intimster Freund gewesen. Nun fühlte er sich um so mehr verpflichtet, seiner hinterbliebenen Frau in ihrer prekären Lage beizustehen, als er den Verdacht hegte, daß deren Bruder – derselbe Edelmann, der das gesamte Vermögen der Frau von Fermont, seiner Schwester, dem Notar Jakob Ferrand überantwortet hatte – keines natürlichen Todes gestorben, sondern ermordet worden sei. Durch die Herzogin von Lucenay, mit deren Vater, dem Fürsten von Noirmont, er gleichfalls befreundet war, hatte er erfahren, daß Frau Marquise von Harville die Spur der mit ihrer Tochter im tiefsten Elend lebenden Frau von Fermont gefunden habe; indessen war, wie der Leser ja weiß, Frau von Harville auf Rudolfs Rat zu ihrem Vater, dem Grafen von Orbigny, gereist, um einen dessen Leben drohenden Anschlag, den seine zweite Frau im Verein mit Bradamanti, alias Polidori, geschmiedet hatte, womöglich zu vereiteln. In dem alten Vicomte war zweifellos dem Notar Ferrand ein sehr gefährlicher Feind erstanden.
Der alte Vicomte begab sich zu seinem Sohne, dem jungen Vicomte Florestan. Als er dessen Palais betrat, bemerkte er an einer Tür die ihm von ihrer Jugend her bekannte Herzogin von Lucenay lauschend stehen. Die Worte, die gleich darauf zu seinen Ohren drangen, bestimmten ihn, an ihrer Seite zu bleiben und gleichfalls einem Gespräche zuzuhören, das im Nebenzimmer zwischen seinem Sohne Florestan und dessen Agenten Badinot stattfand. Badinot drohte dem jungen Vicomte, ihn wegen der Wechselfälschungen, die man entdeckt habe, auf die Galeeren zu bringen, wenn er nicht sofort den Betrag des letzten Darlehns von 25 000 Franks hinterlegte, und forderte ihn auf, sich noch einmal an Frau von Lucenay zu wenden, die als seine Geliebte doch sicher für ihn alles tun würde . . . Florestan erklärte darauf, daß damit nicht zu rechnen sei, da die Herzogin ihm bereits 100 000 Franks vorgestreckt habe, an deren Rückzahlung er nicht denken könne. Nach langem Hin und Her versprach er, den Versuch machen zu wollen, und Badinot entfernte sich . . .
Als die Tür sich hinter Badinot geschlossen hatte, fing Florestan zu jammern und zu wehklagen an. Augenscheinlich hatte ihn die höchste Verzweiflung befallen. Draußen hatten sowohl die Herzogin von Lucenay als der alte Vicomte diesem Gespräche zwischen dem Wucherer Badinot und dem jugendlichen Fälscher mit äußerster Spannung gelauscht, und beide waren aus tiefstem Herzen unglücklich darüber, daß der Mann, dem sie ihre Liebe geschenkt hatten, den Pfad der Ehrlosigkeit gewandelt war und jetzt vor der traurigsten Zukunft stand, wenn er sich nicht zu dem Entschlusse aufraffte, seinem Leben freiwillig ein Ziel zu setzen. Der alte Vicomte schien ganz zusammenbrechen zu wollen, und sein Anblick rührte die Herzogin auf das tiefste . . .
»Mut, Mut, mein lieber alter Freund,« sagte sie leise zu ihm, »ich weiß, was mir zu tun bleibt . . . für Sie sowohl als für Ihren Sohn, den lieben und doch so bösen, bösen Menschen.« –
Der alte Vicomte starrte sie an. Dann schien er sich aufzuraffen, sein Kopf schnellte in die Höhe, auf sein Gesicht trat ein Ausdruck unheimlichen Zornes . . . und vergessend, daß sein Sohn ihn hören mußte, rief er mit Stentorstimme: »Auch ich weiß, was mir um Ihret-, um seinet-, um meinetwillen zu tun bleibt!«
Außer sich vor Bestürzung, fragte Florestan, wer da sei. Die Herzogin, die eine Begegnung mit ihm in diesem Augenblicke fürchtete, verschwand durch eine Seitenpforte und lief eine versteckte Treppe hinunter. Noch einmal fragte Florestan, wer da sei, und da er keine Antwort erhielt, trat er in das Zimmer . . . wich aber erschrocken zurück, als er sich seinem Vater gegenüber sah, den er in der bescheidenen Kleidung, die er trug, fast nicht wiedererkannte, und der mit flammenden Blicken, mit Zornesröte auf der Stirn, das weiße Haar zu Berge stehend, die Arme über der Brust gekreuzt, ihn mit Blicken maß, als ob er ihn durchbohren wolle . . . »Vater!« rief Florestan mit bebender Stimme, »Vater! Sie hier?« – »Ja,« erwiderte der alte Vicomte, »und ich weiß, was du eben für Besuch hattest!« – »Sie haben alles gehört?« – »Alles! Alles!«
Florestan, über das unerwartete Erscheinen seines Vaters nicht sowohl verwundert als erschrocken, gedachte bald des Vorteils, den er aus solchem Zufall zu ziehen vermöchte . . . »Na, so scheint doch noch nicht alles verloren!« sprach er bei sich; »mein Vater wird seinen Namen nicht brandmarken lassen, sondern alle Hebel ansetzen, seinen Sohn vor der tiefsten Schande zu bewahren,« Mit heuchlerischer Miene trat er auf den Greis zu . . . »Wenn Sie das Gespräch mitangehört haben, das ich eben mit diesem Wucherer führte, so kennen Sie meine Situation genau . . . Nun denn, ich bekenne mich einer schimpflichen Aufführung schuldig, Vater, und mache keinen Versuch, sie zu beschönigen . . . Mir sind jetzt nur zwei Auswege noch offen, und zu beiden bin ich entschlossen: entweder bringe ich mich um, denn wenn ich nicht heute 25 000 Franks bezahle, dann klagt der Wicht von Badinot, und ich bin gebrandmarkt . . . oder ich werfe mich Ihnen in die Arme, Vater, und flehe Sie an, mich zu retten. Und wenn Sie es tun, wenn Sie mich aus diesem schrecklichen Dilemma erretten, dann gelobe ich Ihnen, morgen nach Algier mich einzuschiffen und mich dort in das Freiwilligenregiment einreihen zu lassen, um entweder vorm Feinde zu sterben oder dereinst als herrlicher, ruhmgekrönter Krieger in die Heimat zurückzukehren.«
Der alte Graf erhob sich . . . »Meinen Namen werde ich nicht brandmarken lassen,« sagte er kalt zu seinem Sohne; »gib mir Papier, Feder und Tinte!« – Er setzte sich an den Schreibtisch und schrieb mit fester Hand: »Ich verpflichte mich, bis heut abend um 10 Uhr die 25 000 Franks zu bezahlen, die mein Sohn zu bezahlen sich durch seine Unterschrift verpflichtet hat. Graf von Saint-Remy.« Dann herrschte er seinen Sohn an: »Du wirst mich heut abend hier erwarten. Um 10 Uhr bin ich mit der Summe zur Stelle. Der Mann, dem du das Geld schuldig bist, soll zur Stelle sein . . .« – »Gut, Vater, und übermorgen werde ich nach Algier unterwegs sein . . . Sie werden sehen, daß ich kein undankbarer Mensch bin; und vielleicht wenden Sie mir Ihre Liebe wieder zu, wenn ich ehrlich gebüßt habe?«
»Du bist mir keinen Dank schuldig,« versetzte der Graf, »ich habe gesagt, ich will nicht, daß mein Name entehrt werde, und das zu verhindern, werde ich tun, was ich tun muß!« Nach diesen Worten nahm der Graf seinen Stock und ging.
Florestan klatschte vergnügt in die Hände . . . »Gerettet, gerettet!« rief er, »wenigstens aus dem ärgsten Pech, in das ich geraten bin! . . . Vielleicht wärs das gescheiteste, ich gestünde ihm auch die andere Misere? Er ist nun einmal im Zuge, mir beizuspringen! Allem Anschein nach ist er so arm nicht, wie er sich immer stellt. Bei seiner bescheidenen Lebensweise muß er ja auch ganz hübsch noch gespart haben, der alte Herr Papa! Ich kann wirklich sagen, daß mir seine Ankunft gelegen kommt, als wenn er mir vom Himmel geschickt wäre!«
Er wollte gerade gehen, als an die Tür geklopft wurde . . . Auf sein Herein erschien ein Kammerdiener, mit einem silbernen Tellerchen in der Hand, auf dem ein ziemlich dickes, schwarz gesiegeltes Päckchen lag . . . Florestan erbrach das Siegel. In dem Päckchen lagen 25 000 Franks in Bankscheinen. Sonst weiter nichts . . . »Hurra!« rief er, »das war einmal ein Tag! Jetzt bin ich aus allen Schwulitäten! bin vollständig gerettet! Hurtig nun zum Juwelier! Aber – vielleicht ist's doch besser noch zu warten . . . Verdacht gegen mich kann man nicht haben . . . Fürs erste will ich die 25 000 Franks doch lieber noch behalten . . . Aber woher kommt mir das Geld in die Bude geschneit? Ich kenne die Handschrift ja nicht . . . aber das Siegel? N. und L. – Aha! Von Klotilden! Sie hat gewiß was läuten gehört . . . Aber daß sie kein Wort dazu schreibt, ist doch seltsam . . . Ei! Jetzt fällt mir ein, daß ich ihr zu heut früh ein Stelldichein versprochen hatte. Das ist mir über den Drohungen dieses Badinot ganz aus dem Gedächtnis gekommen . . . Sie hat gewiß auf mich gewartet und ist wieder weggegangen! . . . Heda, Jean!« rief er dem Lakaien zu, »wer hat dies Paket da gebracht?« – »Kanns nicht sagen, Herr Vicomte,« antwortete der Diener.
Zweites Kapitel. Die Zusammenkunft
Das Palais Lucenay war eine jener wahrhaft königlichen Wohnungen der Vorstadt Saint-Germain, die wegen des darin verschwendeten Raumes eigentümlich großartig wirken. Im Treppenraume solchen Palastes fände recht wohl ein modernes Haus Unterkunft, und an der Stelle, wo sie stehen, könnte man eine ganze Straße anlegen . . . Vicomte von Saint-Remy hatte zunächst seinen Gläubiger von der Verpflichtung seines Vaters, mit dem Gelde um 10 Uhr bei ihm zu sein, unterrichtet, und dieser hatte sich einverstanden erklärt, bis zu dieser Zeit zu warten. Dann verfügte er sich zu der Herzogin von Lucenay, um ihr für den ihm abermals geleisteten Dienst seinen Dank abzustatten. Ein Lakai öffnete die beiden Flügeltüren und meldete ihn an. Die Herzogin, die der Meinung war, der Graf könne seinem Sohne nicht verschwiegen haben, daß sie mit ihm zusammen gelauscht, daß auch sie alles mitangehört habe, war nicht bloß erstaunt, den Vicomte bei sich zu sehen, sondern höchst unwillig darüber, daß er zu ihr kam . . . Mit den Worten: »Teure Klotilde! Wie gütig sind Sie!« trat er auf sie zu . . . Aber er konnte nicht weiter sprechen, denn die Herzogin maß ihn mit einem so kalten, verächtlichen Blicke, daß ihm aller Mut sank, daß er keinen Schritt weiter entgegenzugehen wagte. So hatte er sie noch nie gesehen und konnte kaum glauben, daß er derselben Frau gegenüberstände, die er so oft so zärtlich, so sanft, so liebevoll und unterwürfig gesehen hatte. Kaum war aber seine erste Ueberraschung verflogen, so schämte er sich seiner Schwäche, und seine gewöhnliche Keckheit gewann wieder die Oberhand . . . Einen Schritt näher zu der Herzogin tretend, wollte er ihre Hand ergreifen und begann im einschmeichelndsten Tone: »Aber, Klotilde! Was ist dir denn? So schön habe ich dich ja noch nie gesehen und doch . . .« – »Das geht doch zu weit!« rief die Herzogin empört und so weit zurückweichend, daß Florestan abermals wie niedergedonnert dastand . . . Langsam sammelte er sich aber und fragte: »Aber, wollen Sie mir nicht wenigstens sagen, woher diese jähe Wandlung kommt? Habe ich Ihnen denn etwas zu leide getan? Was begehren Sie?«
Ohne ihn einer Antwort zu würdigen, maß ihn die Herzogin vom Kopf bis zu den Füßen mit einer so verletzenden Miene, daß Florestan die Zornesröte in die Wangen schoß und er ausrief: »Madame, daß Sie es zuweilen lieben, Verhältnisse jäh abzubrechen, weiß ich, aber ich hielt mich gefeit dagegen und frage Sie jetzt nur: Liegt Ihnen daran, unser Verhältnis abzubrechen?« – »Eine wunderliche Anmaßung!« erwiderte die Herzogin mit höhnischem Lachen, »bestiehlt mich ein Lakai, dann breche ich nicht ab mit ihm, sondern werfe ihn zum Hause hinaus!« – »Madame!« rief Vicomte. – »Machen wir ein Ende!« rief die Herzogin, noch immer in demselben beleidigenden Tone, »Ihre Gegenwart ist mir ein Greuel! Was wollen Sie noch hier? Haben Sie Ihr Geld nicht erhalten?« – »Also habe ich doch richtig geraten? Diese 25 000 Franks stammen von Ihnen?« – »Nun, Ihr letzter falscher Wechsel ist präsentiert worden, nicht wahr? Hoffentlich haben Sie ihn eingelöst und also die Ehre Ihres Namens, Ihrer Familie gerettet? . . . Nun aber gehen Sie!«
»Klotilde! Klotilde!«
»Nennen Sie mich nicht noch ein einziges Mal so!« rief die Herzogin empört: »schade um das schöne Geld! Wieviel rechtlichen Menschen hätte damit geholfen werden können! Aber es war notwendig, den Schimpf von Ihrem Vater zu nehmen, den Schimpf von mir zu nehmen!« – »Sie wissen also alles? Klotilde, alles? dann bleibt mir freilich nichts anderes übrig als der Tod . . .« – Die Herzogin ließ ein schrilles Lachen hören . . . »Ich hätte nicht geglaubt,« rief sie höhnisch, »daß Niederträchtigkeit sich so albern breitmachen könnte . . .« – Aus Florestans Zügen flammte wilde Wut . . . »Madame!« schrie er. – »Genug, genug!« rief die Herzogin, »auf der Stelle verlassen Sie meine Wohnung!«
Mit wutverzerrtem Gesicht drehte Saint-Remy sich auf dem Absatze herum und stürzte aus dem Zimmer . . . Im Hofe angelangt, herrschte er seinem Kutscher zu: »Nach Hause!« und war mit einem Satze im Wagen . . . Als er zu Hause ankam, meldete ihm der auf ihn wartende Lakai, daß sein Herr Vater bereits auf ihn warte . . .
»Es ist auch ein anderer Mann noch da, ein Herr Petit-Jean, den der Herr Vicomte heute abend um zehn hierher bestellt haben.«
»Gut!« rief der Vicomte und trat in sein Zimmer . . . »Ach, lieber Papa, ich bitte tausendmal um Entschuldigung, daß ich Sie habe warten lassen . . .« – Der Graf fiel ihm mit strenger Stimme ins Wort: »Ist der Mann zur Stelle, der den gefälschten Wechsel in Händen hat?« – »Jawohl, Vater, er wartet unten.« – »So laß ihn heraufkommen!« – Florestan klingelte.
»O, Vater, Sie sind wirklich edel und voll Güte!« sagte er. – »Mein Name soll nicht entehrt werden und wird nicht entehrt werden, solange ich über ihn wachen kann,« versetzte der Graf und sah seinen Sohn mit seltsamem Blicke an . . .
»Herr Petit-Jean,« meldete der Kammerdiener, einen Menschen mit bauernschlauem Gesicht, auf dem deutlich die Gemeinheit zu lesen stand, in das Zimmer führend. – »Wo ist der Wechsel?« fragte der Graf. – »Hier, Herr Graf,« erwiderte Petit-Jean, der nichts anders war als der vorgeschobene Agent Jakob Ferrands – und behändigte dem Grafen den Wechsel. – »Ist das der richtige Wechsel?« fragte er den Sohn. – »Ja, Vater,« antwortete dieser. – Der Graf nahm aus seinem Portefeuille 25 Tausendfranks-Scheine und gab sie dem Sohne mit den Worten: »Da, nimm und bezahle!« –
Mit einem tiefen Seufzer übergab Florestan dem Agenten das Geld und nahm den Wechsel dafür entgegen. Petit-Jean überzählte das Geld genau und steckte es dann in seine Brieftasche. Während der Graf den Mann zur Tür hinaus begleitete, zerriß Florestan den Wechsel, bei sich denkend: »Auf diese Weise bleiben mir doch wenigstens die 25 000 Franks von Klotilden, das ist immerhin ein Trost! Aber wie sie mich behandelt hat, war geradezu schändlich . . . Was mag denn Papa draußen mit dem Wichte Petit-Jean reden?«
Da fuhr er unwillkürlich zusammen, denn er hörte, wie die Tür zweimal verschlossen wurde, und sah im andern Augenblicke den Vater vor sich stehen . . . »Mir war es doch, als wenn die Tür geschlossen würde, Vater.« – »Ganz recht. Ich habe sie geschlossen.« – »Und warum?« fragte Florestan verwundert. – »Du sollst es gleich hören,« antwortete der alte Graf mit der strengen Stimme von vorhin. »Heute früh beherrschte dich kein anderer Gedanke als: der Vater läßt solchen Makel nicht auf seinen Namen kommen und wird schon Geld schaffen, wenn ich ihn durch ein paar reuige Redensarten mürbe mache« . . . »Aber, Papa!« – »Still!« befahl der Graf, »unterbrich mich nicht! Aber ich habe mich durch dich nicht irre führen lassen! Du kennst weder Reue noch Scham, denn du bist bis ins Mark verdorben und hast nie einen rechtschaffenen Gedanken gehabt. Erst hast du mir, um deine Launen zu befriedigen, Geld aus dem Kasten gestohlen; dann kamen andere unsaubere Dinge, Gemeinheiten, erbärmliche Streiche, zuletzt wurdest du zum Verbrecher, zum Fälscher . . . Aber das ist nur der erste Abschnitt deiner Laufbahn, hast du dir schon gesagt, wie der zweite verlaufen wird? Ich mag ihn dir nicht ausmalen; aber das Ende will ich dir sagen: es wird das Schafott sein, das dem Mörder winkt! – Noch komme ich zurecht, meinen Namen vor dem äußersten Schimpfe zu bewahren. Das Verhältnis zu dir muß ein Ende nehmen!«
Florestan fuhr vor dem starren Ausdruck, den das Gesicht seines Vaters annahm, entsetzt zusammen und stotterte: »Ein Ende nehmen? Vater! Was meinen Sie mit diesen Reden?«
Da wurde heftig an die Tür geklopft . . . Florestan wollte hinstürzen; aber der alte Graf packte ihn mit eiserner Faust am Handgelenk und hielt ihn zurück . . . »Wer begehrt Einlaß?« fragte er. – »Ich bin Polizeikommissar und soll Haussuchung halten. Ein Herr von Saint-Remy ist angeschuldigt, Diamanten gestohlen zu haben. Juwelier Baudoin hat die Anzeige erstattet. Wird nicht geöffnet, muß ich Gewalt brauchen.« – »Also schon beim Spitzbuben angelangt?« rief der Graf leise, aber mit markdurchdringender Stimme; »ich habe mich also nicht getäuscht.« Er trat einen Schritt näher zu dem Sohne heran . . . »Es ist der Schande genug. Kommen wir zum Abschluß! Du wirst dir auf der Stelle eine Kugel durch den Kopf jagen, wenn du nicht zum Mörder an mir werden willst. Denn weigerst du dich, es zu tun, so schieße ich mich vor deinen Augen nieder!«
Er gab seinem Sohne ein Pistol in die Hand, das er kaltblütig aus der Tasche genommen hatte. Totenbleich wich Florestan vor dem Greise zurück, der ihn noch immer an der Hand hielt. Aus dem Blicke seines Vaters konnte er ersehen, daß er auf kein Mitleid rechnen durfte . . . Ein verzweifelter Entschluß beseelte ihn, er leistete dem Vater keinen Widerstand mehr, sondern rief mit Festigkeit und Ergebung: »Sie haben recht, Vater, geben Sie die Waffe her! Mein Name ist entehrt. Ich habe ein schlimmes Leben zu erwarten, das der Mühe, es zu erhalten, nicht lohnt . . . Her die Waffe! Ich will Ihnen zeigen, daß ich kein Feigling bin!«
Draußen krachte die Tür und brach in Trümmer . . . »Vater, sie kommen . . . Ja, ich fühle, der Tod wird mir eine Wohltat sein . . . Gehen Sie den Leuten entgegen, damit kein Verdacht wider Sie aufkomme! Brächen sie herein, dann möchten sie mich an der Tat hindern . . .«
Schritte klangen aus dem Vorzimmer. Florestan setzte das Pistol aufs Herz. In demselben Moment knallte der Schuß, als der Graf, dem gräßlichen Anblicke zu entgehen, das Gesicht abwendend, aus dem Zimmer eilte . . .
Als der Kommissar den Knall hörte und des alten Grafen entsetztes Gesicht sah, blieb er einen Moment auf der Schwelle stehen und winkte seinen Leuten, nicht weiter zu gehen . . . »Herr Graf,« wandte er sich zu dem alten Saint-Remy, »ersparen Sie sich einen schmerzlichen Anblick und gehen Sie aus diesem Hause . . . Mir liegt jetzt eine traurigere Pflicht ob, als die mich herführte!« – »Sie haben recht,« versetzte der Graf . . . »wie hoch beläuft sich die Summe, um die der Juwelier bestohlen worden?« – »Auf 30 000 Franks,« antwortete der Polizeikommissar, »die Person, die sie kaufte und durch die der Diebstahl an den Tag kam, hat diese Summe an – Ihren Sohn dafür bezahlt.« – »Nun, den Betrag zu decken, wird mein Vermögen gerade noch reichen. Sagen Sie dem Bestohlenen, er möge sich zum Bankier Dupont bemühen; er wird die nötigen Weisungen dort vorfinden.«
Der Kommissar verbeugte sich, und der Graf ging. Im andern Augenblick ging die Tür zum Kabinett auf, und ein Beamter trat herein . . . »Der Patron ist auf und davon!« rief er; »so hat uns noch keiner genasführt!« – »Was?« rief der Kommissar, in das Zimmer stürzend, worin nicht die geringste Spur von dem tragischen Ereignis wahrzunehmen war, unter dessen vermeintlichem Eindrucke der alte Graf eben das Haus verlassen hatte . . . Im Nu gewahrte er die Tapetentür und riß sie auf . . . »Also auf diesem Wege ist er entflohen?« rief er. »Wer hätte solcher Finte sich versehen!«
Vor des Vaters Augen hatte der Vicomte wohl das Pistol abgeschossen, aber nicht aufs Herz, sondern zwischen dem Arme hindurch gezielt und war, durch den Rauch verhüllt, im selben Augenblicke durch die Tapetentür entwischt, als sein Vater den Polizisten entgegenging. Vom Boudoir aus hatte er das Treibhaus, von da das Gäßchen gewonnen und den Weg nach den elysäischen Feldern genommen.
Drittes Kapitel. Wieder auf der Seine-Insel
Am andern Tage verließ Marienblümchen das Gefängnis Saint-Lazare und begab sich in Ferrands Haus, wo sie von Frau Seraphim in Empfang genommen wurde. Sie trug die ländliche Tracht, die sie in Bouqueval getragen hatte. Es war dem Notar ein Leichtes gewesen, ihre Freilassung zu erwirken, und niemand im Gefängnisse zweifelte daran, daß dieselbe durch die Marquise von Harville erwirkt worden sei, die sich bei der Aufseherin so angelegentlich erkundigt hatte: So verdorbenen Sinnes auch die Seraphim war, so fühlte sie doch jetzt Mitleid mit dem liebreizenden Mädchen, das sie als Kind im Auftrage Ferrands an das unter dem Namen Eule bekannte böse Weib überantwortet hatte und jetzt dem sichern Tode zuführen wollte.
»Wir fahren doch zur Frau Georges nach Bouqueval?« fragte Marienblümchen. – »Jawohl, mein Kind,« versetzte die Seraphim, »zu Frau Georges, doch nicht gleich; erst machen wir noch einen kleinen Abstecher, damit Sie nach allem Verdruß, den Sie gehabt haben, auch ein klein wenig Freude haben . . . Kommen Sie, kommen Sie! Der Wagen wartet schon auf uns.«
Sie standen unter dem hohen Portal, das auf die Straße Faubourg Saint-Denis führt, als sie einem Mädchen in den Weg liefen, das auf dem Wege ins Gefängnis zu sein schien, um eine Insassin desselben zu besuchen . . . Im nächsten Augenblicke hatte Marienblume in dem Mädchen ihre ehemalige Zellenkameradin, Lachtaube, erkannt . . . »Ei, Schalldirne!« rief da ihrerseits die Grisette . . . und beide sanken einander in die Arme . . . »Aber trifft sich das gut!« rief Lachtaube . . . »ist das eine Ueberraschung! Wir haben uns so lange nicht gesehen und müssen uns gerade jetzt wiedersehen, wo ich auf dem Wege ins Gefängnis bin, eine andere arme Leidensgenossin zu besuchen!« – »Ach, Lachtaube!« erwiderte Marienblume, »das hätte ich mir auch nicht träumen lassen . . . Ich will aufs Land hinaus zu einer guten lieben Frau . . . Frau Georges heißt sie . . . draußen in Bouqueval . . . Doch sprich! Wen willst du im Stockhause aufsuchen?« – »Ach, die arme Luise Morel aus der Rue du Temple . . . das Kind eines ehrlichen Steinschneiders, der über all dem Unglück, das ihn verfolgt, den Verstand verloren hat!«
Frau Seraphim fuhr zusammen, als sie den Namen Morel hörte, der auch eines der Opfer war, die Notar Ferrand auf dem Gewissen hatte. Sie kannte das Mädchen nicht, das zu den Bekannten Marienblümchens gehörte, horchte aber nichtsdestoweniger aufmerksam auf das Gespräch, das die beiden Mädchen zusammen führten.
»Ach, Kind, ich muß dir noch ganz was anderes sagen,« plauderte Lachtaube weiter, »wie du mich hier siehst, so komme ich aus dem Männergefängnisse in unserm Viertel. Sieh doch mein Körbchen an: es hat zwei Abteilungen . . . jede Hälfte hat ihre Bestimmung: die eine enthält das, was ich der armen Luise, die andre, was ich dem armen Germain bringe.« – »Germain? Germain?« fragte Marienblümchen, »wer ist denn das?« – »Ach, ein lieber Mensch, ein ehemaliger Nachbar von mir, der ehrlichste Mensch unter Gottes Sonne, dem ich von Herzen gut bin wie einem Bruder, der aber von einem schlimmen Manne verfolgt wird . . . demselben, der auch die arme Luise ins Gefängnis gebracht hat . . . Ach Gott, wie ist es bloß möglich, daß es so grundschlechte Menschen in der Welt gibt!«
Frau Seraphim hatte abermals die Ohren gespitzt, als sie den Namen Germain hörte . . . Lachtaube hatte zwar keinen unmittelbaren Grund, ihr zu mißtrauen, sie gedachte aber der Warnungen, die Rudolf ihr mit auf den Weg gegeben, und sah es deshalb, um der Möglichkeit, noch mehr auszuplaudern, entrückt zu werden, nicht ungern, daß Frau Seraphim die Freundin zum Aufbruche drängte . . .
»Du bist und bleibst eben die gute, liebe Seele, die all und jedem helfen möchte, der in Not und Trübsal gerät . . . Du bist wohl dem Germain so recht von Herzen gut? Wie?« – »O, warum sollte ich nicht?« erwiderte Lachtaube, »es ist doch schrecklich, wenn jemand nichts Böses getan hat und von solch bösem Menschen ins Gefängnis gebracht wird! Der alte Wicht ist hinter den beiden armen Menschen her wie der Teufel, trotzdem ihm keins von beiden das geringste zu leide getan hat. Aber nur Geduld! An ihn wird schon auch noch die Reihe kommen.«
»Wie heißt denn der schlimme Mann, von dem Sie das erzählen?« fragte Frau Seraphim, nachdem sie abermals zum Aufbruche gedrängt hatte. – »Ferrand heißt er, liebe Frau,« antwortete Lachtaube, »und ist Notar, um so schlechter also ist's von ihm, die Menschen in Jammer und Not zu bringen, da es doch seine Pflicht wäre, sie daraus zu erlösen!« – Da traf sie ein böser Blick der Frau, so daß Lachtaube unwillkürlich zusammenschreckt und einen ängstlichen Blick auf die Freundin heftete.
»Länger warten wir nun aber nicht, Kind,« sagte die Seraphim zu Marienblümchen, »ihr habt schon über eine Viertelstunde zusammen geschwatzt. Wir laufen ja Gefahr, den ganzen Tag zu versäumen. Und wer soll den Wagen für die müßig verlorene Zeit bezahlen?« – Lachtaube trat zu der Freundin, während die Seraphim sich zu dem Kutscher wandte, und flüsterte ihr zu: »Du, weißt du, gegen die Frau habe ich eine seltsame Abneigung . . . ich sage dir, nimm dich vor ihr in acht!« Und laut fuhr sie fort, als die Seraphim sich wieder zu ihnen wandte: »Kommst du wieder nach Paris, meine Liebe, dann vergiß nicht, bei mir vorzusprechen; ich werde mich immer freuen, dir guten Tag zu sagen.«
Die beiden Mädchen küßten einander; Lachtaube ging in das Gefängnis mit dem ihr von Rudolf verschafften Erlaubnisscheine Luisen zu besuchen, während Marienblume mit Frau Seraphim in den Wagen stieg, der sie nach der Seine-Insel führen sollte.
Dort lagen drei Kähne am Aussteigeplatze angebunden. In einem kauerte Niklas, die Klappe probierend, die er darin angebracht hatte, während die ältere Schwester, Kürbis benannt, auf einer Bank vor der grün angestrichenen Laube stand, die Hand wie einen Schirm über die Augen deckend und in der Richtung Ausblick haltend, von woher Frau Seraphim mit Marienblümchen erwartet wurde.
»Niklas,« sagte die Schwester, »Martial scheint zu schlafen, wenigstens hat er sich heute früh nicht wieder gerührt, und auch sein Hund verhält sich still.« – »Vielleicht hat er ihm den Hals umgedreht, um sich an ihm satt zu fressen. Zwei Tage haben sie schon nichts zu brechen und zu beißen, und müssen ja schon halb verhungert sein.« – »Das wird ihn schon kirre machen,« sagte Niklas, »aber aushalten kann ers weit länger, sage ich dir. Wenn er verhungert, so heißt's dann eben, man hat nicht gewußt, wo er steckt; dann wird kein Hahn nach ihm krähen. Mir wäre eine schnellere Weise lieber gewesen.« – »Ein anderes Mittel, zum Ziele zu kommen, gab es eben nicht. Wenn Martial wild wird, dann ist er schlimmer als ein Teufel, zudem stark wie ein Bulle. Ohne Gefahr hätten wir ihm nicht auf den Leib rücken können. Nachdem wir aber seine Tür von außen verrammelt und das Fenster mit dem von Micou gekauften Eisenblech vernagelt hatten, konnte er uns nicht mehr schädlich werden.« – »Ein Glück, daß es in seiner Kammer an einem Kamine fehlt.« – »Jawohl, und daß die Tür fest ist, und daß wir ihm die Hand mit dem Beile zerschlugen . . . sonst wäre er imstande, sich durch die Dielen ein Loch zu graben!« – »Daß bloß die Wölfin nicht aus dem Gefängnisse bricht und ihren Liebsten bei uns sucht! Dann . . .« – »Na, was denn dann? Soll sie ihn sich doch suchen!«
Jetzt erblickte Kürbis die beiden Personen, auf die so sehnlich wartete; im selben Augenblicke trat aber auch die Mutter zu ihnen, die unwillkürlich einen Blick zu dem Fenster hinaufwarf, hinter dem ihr ältester Sohn eingesperrt war . . . »Es ist doch bloß seine Schuld!« murmelte sie, die Brauen zusammenkneifend, konnte sich aber eines Schauders nicht erwehren.
Kürbis zeigte auf die den Fußweg entlang kommenden beiden Frauen, auf Seraphim und die Schalldirne, alias Marienblume, und rief Niklas zu: »He! Siehst du sie? Eine Städtische und eine vom Lande, Niklas!« – »Ach, die Dicke kenne ich ja,« erwiderte Niklas, »wir müssen uns nun darüber verständigen, wie wir uns verhalten wollen. Ich werde die Alte und die Junge ins Boot mit der Klappe hinein nehmen; im andern folgst du mir und hältst dich so dicht neben dem andern, daß ich im rechten Moment hinüberspringen kann, ohne mich und dich dabei in Gefahr zu setzen . . . hörst du?« – »Habe keine Bange,« sagte Kürbis, »sieh! jetzt winkt die Alte mit dem Tuche!« – »Komm, Mutter, komm!« antwortete Niklas, das Boot losmachend, »setz dich mit in mein Boot! Dann werden die beiden drüben nicht Gefahr wittern . . . Kürbis mag ins andere springen und tüchtig ausgreifen mit den Rudern . . . Da, nimm den Haken und lege ihn neben dich, falls wir staken müssen . . . So, und nun vorwärts!«
Nach wenigen Augenblicken hatten die beiden Kähne das Ufer gewonnen, wo Madame Seraphim mit Marienblümchen wartete. Niklas band sein Boot fest. Die Seraphim trat zu ihm und sagte leise: »Sagen Sie, daß Frau Georges uns schon lange erwarte.« Dann sagte sie laut: »Wir haben uns leider etwas versäumt.« – Und Niklas erwiderte: »Ja, das haben wir gemerkt, denn Frau Georges hat schon ein paarmal hergeschickt und fragen lassen, wo wir bleiben . . .«
»Nun, Sie hören also,« wandte Frau Seraphim sich an das Mädchen, »daß wir uns beeilen müssen, wenn wir die liebe Frau nicht ärgerlich machen wollen!« – Marienblümchen war es bei dem Anblick der beiden Geschwister Niklas und Kürbis nicht recht geheuer gewesen, die Worte der Frau beruhigten sie aber wieder. Sie lehnte sich leicht auf die Hand, die Niklas ihr bot, und stieg in das Boot . . . »So! Und nun steigen Sie ein,« sagte Niklas zur Frau Seraphim, die aber, ob nun von einer Ahnung bestimmt, oder von Mißtrauen erfüllt, meinte, es möchte doch wohl geratener sein, sich in das andere Boot zu setzen . . .
Niklas antwortete, ihm könnte das gleichgiltig sein, warf seiner Schwester einen vielsagenden Blick zu und stieß ab. Als die Seraphim sich neben sie gesetzt hatte, stieß auch die Kürbis ab, und langsam entfernten sich beide Kähne vom Ufer . . .
Viertes Kapitel. Frohes Wiedersehen.
Kurz nach Marienblümchens Weggang aus Saint-Lazare war auch die Wölfin in Freiheit gesetzt worden. In ihrem Gemüte hatte sich durch den Aufenthalt daselbst eine vollständige Wandlung vollzogen, sie hatte ihr früheres Leben verachten lernen; jetzt schwebte ihr ein Leben in Ehren und Arbeit, wie es Marienblümchen ihr geschildert hatte, vor, und ihr einziges Ziel war, sich mit Martial vorm Altare als Christin trauen zu lassen, um dann als seine von Gott und den Menschen anerkannte Ehefrau einsam und verborgen mit ihm im Walde zu leben. Begreiflich, daß all ihr Sinnen und Trachten sich darauf richtete, mit Martial so schnell wie nur möglich zusammenzutreffen. Nun hatte sie aber seit einer Reihe von Tagen gar keine Nachricht mehr von ihm erhalten. Sie meinte, am sichersten zu gehen, wenn sie ihn auf der Seine-Insel suchte, und falls sie ihn dort nicht fände, dort auf ihn zu warten. Sie fuhr nach der Asnières-Brücke, und während die Seraphim mit Marienblümchen am Seine-Ufer unfern vom Gipsofen auftauchte, passierte sie etwa eine Viertelstunde vorher die Brücke. Da nun Martial sich in seinem Boote nicht sehen ließ, sie herüberzuholen, wendete sie sich an den in der Nähe aufhältlichen Fischer Ferot, einen silberhaarigen Greis, der vor der Tür seiner Hütte, mit dem Ausflicken von Netzen beschäftigt, saß. Schon von weitem rief sie ihm zu, sein Boot zur Ueberfahrt fertig zu machen.
»Ach, Sie sinds, Mamsell?« antwortete er, »guten Tag, guten Tag! Hab Sie ja lange nicht gesehen, aber heute überzusetzen, geht nicht an, geht wirklich nicht an, Mamsell!« – »Aber, Vater Ferot, warum denn nicht?« – »Ja, sehen Sie, Mamsell, mein Junge hat das Boot mitgenommen und ist mit nach Saint-Ouen zum Wettfahren . . . Am ganzen Ufer ist kein Boot heute aufzutreiben.« – »Aber ich muß hinüber, Vater Ferot.« – »Ja, Mamsell, es wird eben nicht gehen! Und auf Martial werden Sie auch nicht rechnen dürfen, denn soviel ich weiß . . .« – »Was wissen Sie?« rief die Wölfin, den Greis am Kragen packend, »ist er etwa krank?« – »So krank, daß er sich nicht rühren kann!« – »Aber dann hätte ers mir doch geschrieben, Ferot!« – »So? Wenn er sich nicht rühren kann?« – »Aber auf der Insel ist er doch?« – »Nun, was ich weiß, will ich Ihnen erzählen,« erwiderte Ferot, »denn sehen Sie, der Martial, wenn er auch ein Hitzkopf ist, ist doch ein guter Kerl, und es wäre wirklich jammerschade, wenn er durch die schlimme Alte, seine Mutter, oder durch seinen noch schlimmern Bruder ins Unglück geraten sollte!«
»Ferot, Ferot!« rief die Wölfin, »erzählen Sie, erzählen Sie! Sie sehen ja doch, daß mich der Schlag zu rühren droht!« – »Ist das ein Mädel, ist das ein Mädel!« rief Ferot; »lassen Sie mich doch bloß nachdenken! Also erstens muß ich Ihnen sagen, daß Martial mit seiner Familie schlechter steht als je, so daß ich mich gar nicht wundern würde, wenn sie ihm mal eins versetzten. Drum tuts mir ja auch so leid, daß ich gerade jetzt mein Boot nicht da habe, denn wenn sie etwa denken sollten, die drüben würden Sie holen, so sind Sie arg auf dem Holzwege!«
»Darauf rechne ich nicht . . . Aber Martial ist noch auf der Insel? He?« rief das Mädchen. – »Aber lassen Sie mich doch ausreden! Heute morgen sagte ich zu der Witwe: ›Wo steckt denn Martial? Ich habe ihn wohl schon drei Tage nicht gesehen. Ist er etwa in der Stadt? Sein Boot liegt ja drüben noch immer angebunden.‹ – Darauf guckt mich die Witwe groß an und erwidert: ›Drüben auf der Insel liegt er krank, und an seinem Aufkommen zweifelt jeder, der ihn sieht . . . Ich glaube auch nicht mehr dran.‹ – Da dachte ich bei mir: Wie mag das wohl zugehen? Vor drei Tagen war er noch blitzmunter . . . Da sah ich, daß die Witwe wieder weg wollte . . . Ich rufe ihr nach: Wohin denn, Nachbarin, wohin?«
Aber die Wölfin, von namenloser Angst und Wut befallen, hörte schon nicht mehr auf ihn, sondern war schon ein weites Stück an der Seine entlang unterwegs. Ohne auf ihre Umgebung zu achten, rannte sie weiter, bloß beherrscht von der Sorge um ihren Liebsten, und so gewahrte sie auch nicht, daß zwei Männer an ihr vorbeischritten . . . Es waren der Graf von Saint-Remy, der am linken Seine-Ufer, fast dicht an der Stelle, wo sich die Wölfin jetzt befand, sein Landhaus hatte, und Doktor Griffon.
Durch die Weiden und Pappeln hindurch konnte die Wölfin das Dach der Hütte sehen, wo ihr Martial jetzt vielleicht im Sterben lag! Ein lautes Ach! ausstoßend, warf sie Schal und Haube von sich, streifte ihr Kleid vom Leibe und sprang im Unterrocke, ohne sich zu besinnen, in den Fluß, um nach der Insel hinüber zu schwimmen. Da ertönte von der andern Seite der Insel ein lautes Angstgeschrei zu ihr herüber . . . ein Schrei aus Todesverzweiflung . . . Die Wölfin erschrak . . . Der Schrei erklang von neuem, aber schwächer, wie bittend, krampfhaft, aus sterbender Brust . . . Dann war alles totenstill . . .
Der Graf und der Doktor, die die Wölfin an ihrem Beginnen nicht hatten hindern können, hatten die Angstrufe vernommen und blieben erschrocken stehen . . . »Die Arme ertrinkt doch,« sagte der eine. Aber sie sorgten sich ohne Grund, denn Martials Geliebte schwamm wie ein Otter, und nach wenigen Armstößen gelangte das mutige Mädchen ans Ufer. Schon hatte sie wieder Grund unter den Füßen und hielt sich, um aus dem Wasser zu steigen, an einem der eingerammten Pfähle, die am Ausgange der Insel eine Art Staket bildeten, als plötzlich, vom Strome getragen, der Leib eines jungen Bauernmädchens herantrieb. All ihre Kraft zusammenraffend, packte die Wölfin den treibenden Menschenleib und hob ihn auf die Achseln, trug ihn aus dem Wasser ans Land und bettete ihn auf dem Uferrasen . . .
»Mut, Mut!« rief Graf von Saint-Remy ihr zu, der mit dem Doktor Griffon das mutige Werk mitangesehen, »warten Sie! Wir eilen über die Asnières-Brücke und kommen Ihnen mit einem Boote zur Hilfe.« – Kurz darauf führte der Strom eine andere Leiche hinweg, ohne daß die Wölfin sie bemerkte: es war die Haushälterin des Notars, die verschwinden zu lassen Niklas ebenso großes Interesse hatte wie Notar Ferrand selbst. Niklas hatte sie ins Wasser geschleudert, als er sich in das andere Boot hinüber gerettet hatte, und ihr durch einen Schlag mit dem Ruder den Garaus gemacht.
Aufs äußerste erschöpft, kniete die Wölfin neben dem geretteten Mädchen in das Gras und sah ihr ins Gesicht . . . »Die Schalldirne!« rief sie plötzlich, ganz erschrocken . . . »ist das aber ein seltsamer Vorgang!« Eine Weile fand sie vor Staunen keinen Gedanken. Dann sann sie weiter: »Wollte ich nicht eben noch dem Martial alles von ihr erzählen, was sie mir im Kasten drin gesagt und getan! Ach, das arme Ding! Wie kommt sie bloß in die Seine! Nein! Daß ich sie nun tot finden muß! Aber ich irre vielleicht? Vielleicht lebt sie noch!« Und sich dichter über das Mädchen beugend, legte sie das Ohr auf dessen Herz und meinte, ihren Atem zu hören . . . »Gott, ach Gott!« lallte sie, »sollte ich sie im letzten Augenblicke noch gerettet haben! Ja ja, sie lebt! O, ist das aber eine Freude für mich!« und wieder nach einer Weile sinnierte sie weiter: »Und mein Mann? Vergesse ich ihn ganz über der Dirne? Und wenn nun er, statt ihrer, im Sterben läge? Habe ich nicht eben gehört, daß seine Mutter und sein Bruder imstande wären, ihn zu ermorden!« – Nicht daran zweifelnd, daß die Witwe Martial und deren Tochter so schlecht nicht sein könnten, der vom Ertrinken Geretteten Beistand und Hilfe zu weigern, rannte sie nach der Hütte hin.
Niklas hatte sich mit seiner Mutter und Schwester, als Martials Liebste auf den höchsten Punkt der Insel gelangte, bereits zu Rotarm auf den Weg gemacht, in der festen Meinung, den Doppelmord glücklich vollführt zu haben, und gleichzeitig mit ihm war ein Mann, der hinter dem Gipsofen ungesehen Zeuge des gräßlichen Vorganges gewesen war, dahinter vorgekrochen; und dieser Mann war kein anderer als Notar Ferrand . . . Kaum hatte er seinen Schlupfwinkel verlassen, als Graf von Saint-Remy mit Griffon über die Asnières-Brücke gingen, um auf dem Niklasschen Boote, das sie von weitem gesehen, zur Insel hinüber zu fahren.
Zu ihrer nicht geringen Verwunderung fand die Wölfin die Tür der Hütte, in der Martials hausten, verschlossen. Marienblume war noch immer ohnmächtig. Die Wölfin legte sie auf den Rasen und ging um die Hütte herum. Sie wußte, in welcher Stube Martial zu nächtigen pflegte, und erschrak nicht wenig, als sie den Fensterladen mit Blech verschlagen und durch zwei Eisenstangen verbarrikadiert fand . . . Auf der Stelle erriet sie den Zusammenhang und rief mit aller Kraft »Martial, Martial!« – Keine Antwort.
Erschrocken darüber, daß sich nichts in der Hütte regte, rüttelte sie an den Eisenstangen vor dem Fenster, schlug gegen die Mauer, schlug an die Tür. Endlich gab ihr ein schwaches, ein paarmal wiederholtes Klopfen Antwort . . . Da sah die Wölfin eine große Leiter hinter einem Fensterladen des untern Saales stehen. Als sie heftig an dem Laden rüttelte, fiel ein Hausschlüssel auf die Erde, den die Witwe Martial dort versteckt hatte . . . Sie versuchte, ob der Schlüssel zur Tür paßte, und als sie sah, daß dies der Fall war, rief sie freudig: »Warte, warte, Martial! Jetzt befreie ich dich! Im Augenblick bin ich bei dir!« Als sie in die Küche trat, hörte sie die Kinder rufen, die im Keller eingesperrt waren und sobald die Wölfin aufgeschlossen hatte, ihr entgegen sprangen . . . »Ach!« riefen sie, »liebe Wölfin, rette doch den armen Martial, der oben verhungern soll, und den die böse Mutter seit zwei Tagen oben in der Kammer eingesperrt hält.« – »Ist er verletzt?« fragte die Wölfin. – »Nein, soviel wir wissen, nicht.« – »Nun, so komme ich ja gerade noch zur rechten Zeit,« erwiderte die Wölfin, zur Treppe eilend; aber kaum war sie ein paar Stufen hinaufgeeilt, so kehrte sie um und sagte: »Ach, und die arme Schalldirne vergesse ich ganz? Amandine, mach sogleich Feuer an und trage mit deinem Bruder ein armes Mädchen an den Kamin, das ich aus der Seine gerettet habe, knapp vorm Ertrinken . . . Sie liegt unten in der Laube.«
Mit zwei Sätzen waren die Kinder in der Laube, und die Wölfin am Ende des Ganges, der zu Martials Stube führte . . . Mit einem wuchtigen Axthiebe zertrümmerte sie die Tür . . . und bleich, fast kaum noch imstande, sich zu bewegen, sank Martial in die Arme der Geliebten.
»Endlich, endlich habe ich dich wieder, Martial,« rief die Wölfin und trug ihn auf eine im Gange stehende Bank. Dort saß Martial, ein paar Minuten lang matt, mit verstörtem Gesicht um sich starrend, bemüht, sich von den Qualen zu erholen, die er gelitten hatte. Zitternd vor Freude und Angst, ihren Liebsten wiedergefunden zu haben und vielleicht wieder verlieren zu sollen, die Augen in Tränen gebadet, lag die Wölfin auf den Knien und beobachtete alle Bewegungen in Martials Gesicht, der sich allmählich zu erholen schien und in gewaltigen Zügen die reine Luft einsog. – »Jetzt – atme ich, – ich atme. – Mein Kopf wird freier –« sagte Martial, der nun ganz zu sich kam. Dann rief er, als erkenne er jetzt erst den Dienst, den ihm die Wölfin geleistet hatte, im Tone unaussprechlichen Dankes: »Ohne dich hätte ich sterben müssen, meine gute Wölfin.« – »Hast du Hunger?« – »Nein, – ich bin zu matt. Am meisten litt ich unter dem Mangel an Luft. Ich würde erstickt sein, es wäre schrecklich gewesen.« – »Aber deine Hände – deine armen Hände! Diese Wunden! Mein Gott, was haben sie dir getan?« – »Niklas und die Schwester, die mich nicht zum zweiten Mal anzugreifen wagten, hatten mich eingesperrt, um mich verhungern zu lassen. – Ich wollte sie hindern, den Fensterladen zuzunageln – und die Schwester hieb mit dem Beile auf die Hand.« – »Die Unmenschen! Man sollte glauben, du hättest krank werden und sterben müssen. Deine Mutter hatte schon erzählt, du wärst so krank, daß du nie wieder aufkommen würdest. – Deine Mutter – Mann – deine Mutter!«
»Sprich nicht von ihr,« – sagte Martial bitter. – Dann erst bemerkte er die nassen Kleidungsstücke und das seltsame Aussehen der Wölfin und fragte: »Was ist dir geschehen? Dein Haar ist ganz naß? Du bist im Unterrock? Und der ist auch ganz naß?« – »Ich wußte, daß du in Gefahr warst, fand kein Boot –« »Und du bist herübergeschwommen? Meine gute Wölfin!« rief Martial. »Meinetwegen solches Wagnis!« – »O, nicht ich war in Gefahr, sondern ein armes Mädchen, das ich glücklich gerettet, als ich den Fuß auf die Insel setzte.« – »Du hast sie gerettet? Wo ist sie?« – »Unten bei den Kindern.« – »Wer ist das Mädchen?« – »Ach, wenn du wüßtest, welcher Zufall, welcher glückliche Zufall hier gewaltet hat! Sie ist mit mir in Saint-Lazare gewesen und ein Mädchen, wie man ihrer nicht viel findet. – Höre! Ich wollte dich um etwas bitten. Darum war ich hergekommen.«
»Gut! sage, was ich tun soll; aber nur muß ich gleich betonen, ich verlasse Amandine und Franz nicht mehr.« – »Deinen kleinen Bruder und deine kleine Schwester?« – »Ja; ich muß Vaterstelle bei ihnen vertreten, muß für sie sorgen. Man möchte sie zu Spitzbuben machen, und um sie zu retten, werde ich mit ihnen fortgehen – dich nehme ich auch mit.« – »Du willst mich mitnehmen?« rief die Wölfin in freudigem Erstaunen aus. Sie konnte an ein so großes Glück nicht glauben. »Ich soll dich nicht mehr verlassen?« – »Nein, meine gute Wölfin, nie! Du hilfst mir die Kinder erziehen. Ich kenne dich; wenn ich zu dir sage: meine arme kleine Amandine soll ein braves Mädchen werden, sprich mit ihr in diesem Tone, so wirst du eine gute Mutter für sie sein, ich weiß es.« – »Ach, ich danke dir, Martial, ich danke dir.«
»Wir leben als rechtschaffene Leute; wir finden Arbeit, verlaß dich darauf, und wir wollen arbeiten wie Sklaven. Die Kinder sollen wenigstens nicht werden wie ihr Vater und ihre Mutter. Aber was ist dir? was hast du?« – »Martial, es ist zu viel! Eben darum wollte ich dich ja bitten, mit dir in den Wald zu ziehen, hinfort dort leben als deine ehrsame Frau – als die Frau eines mit einer einträglichen Stelle bekleideten ehrlichen Mannes!«
Martial sah sie nun seinerseits mit Verwunderung an, denn er verstand ihre Reden nicht. »Was faselst du von einer Stelle?« – »Du sollst Waldhüter werden.« – »Und bei wem?« – »Die Gönner des Mädchens, das ich gerettet habe, wollen dich damit versorgen.« – »Ach, das wäre ja großartig,« rief Martial, »der Franz ist zwar noch nicht völlig verdorben, aber doch so lange bei den andern Geschwistern gewesen, daß es ihm im Walde besser gefällt als in der Stadt. Amandine könnte dir in der Wirtschaft zur Hand gehen, und ich gebe gewiß einen Jäger ab so gut wie irgend einer, der eine Büchse führen kann, bin ich doch kein schlechter Wilddieb gewesen. Du aber wärst meine Hausfrau, gute Wölfin, und dann hätten wir Kinder, was fehlte uns noch? Hat man sich einmal an den Wald gewöhnt, so fühlt man sich darin wie zu Hause; man könnte hundert Jahre da leben, ohne daß man Langeweile fühlte. Aber bin ich nicht ein Narr? Du hättest von solch schönem Leben lieber nichts sagen sollen – es erweckt Sehnsucht und kann einem doch nichts nützen!«
»Wenn die arme, kleine Schalldirne sich täuscht, so liegt es an den andern, denn sie sah ganz aus, als glaubte sie, was sie sagte. Uebrigens sagte mir die Aufseherin, als ich das Gefängnis verließ, ihre Gönner, die gar vornehme Leute wären, hätten auch ihre Freilassung bewirkt, doch wohl ein Beweis dafür, daß sie auch halten kann, was sie mir versprochen hat.« – »Ich weiß aber nicht,« sagte Martial, indem er rasch aufstand, »was wir eigentlich denken.« – »Was meinst du?« – »Das junge Mädchen liegt unten vielleicht im Sterben, und statt ihr beizustehen, sitzen wir da und schwatzen.« – »Beruhige dich, Franz und Amandine sind bei ihr, und wenn es schlimmer mit ihr geworden wäre, wären sie sicher heraufgekommen. Aber du hast recht, wir wollen zu ihr gehen; du mußt sie sehen, verdanken wir doch ihr all unser Glück!« Martial stützte sich auf den Arm der Wölfin und ging die Treppe hinunter.
Marienblume, von Franz und Amandinen neben das Feuer in der Küche getragen, lag noch immer ohne Bewußtsein, als der Graf von Saint-Remy mit dem Doktor Griffon aus Niklas' Boot stiegen, auf dem sie vom andern Ufer herübergekommen waren. Der Doktor nahm sich der Ohnmächtigen sofort an. Er war ein hagerer, bleicher Mann von hoher Figur mit Glatze. Sein Gesicht verriet Kälte, aber auch nicht ungewöhnlichen Verstand . . . »Eine hervorragende Schönheit!« sagte der Graf, das Mädchen mit traurigem Blicke betrachtend, »und noch so jung!« – »Das Alter hat nichts zu sagen,« erwiderte der Arzt rauh, »auch nicht das Wasser, das sich in den Lungen schon angesammelt hat.« – »Glauben Sie, das Mädchen noch retten zu können?« – »Viel Hoffnung ist nicht vorhanden,« versetzte Doktor Griffon, »sind doch die Extremitäten schon kalt!«
In diesem Augenblicke kam Martial herein, auf den Arm seiner Liebsten gestützt, die sich den karierten Umhang seiner Schwester umgenommen hatte. Als der Graf ihn sah, fragte er, wer der Mann sei . . . »Mein Mann,« antwortete die Wölfin, auf Martial einen unbeschreiblichen Blick voll Stolz und Liebe heftend. – »Ei, Sie haben eine recht mutige Frau,« sagte der Graf zu Martial, »ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie sie dies junge Mädchen da aus dem Wasser gefischt hat!« – »Das wohl,« antwortete Martial, »brav und unerschrocken ist sie, das muß man sagen, hat sie mich selbst doch auch eben aus höchster Not gerettet!« – »Aber, Mann, was ist denn mit Ihren Händen geschehen? Die sind ja ganz zerhackt!« –
Doktor Griffon sah sich um, ließ sich die Hände Martials zeigen und hieß ihn sie auf- und zumachen . . . »Zum Glück,« sagte er, »ist keine Sehne verletzt. Der Mann wird die Hände also wieder brauchen können.« – »Gott sei Dank!« rief die Wölfin; »und das Mädchen unten? Sie kommt doch mit dem Leben davon? Wie? . . . Es wäre ja gräßlich, könnten wir ihr nicht einmal danken für alles, was wir ihr schulden!« Und zu Martial gewandt, sagte sie: »Da sieh! Hier liegt sie, und ihr verdanke ich es, daß ich jetzt andere Anschauungen vom Leben und von meinem Verhältnis zu dir habe . . . Sie hat mir erst den Gedanken eingegeben, her zu dir zu gehen und dir alles zu sagen, wie es mir ums Herz ist . . . Und nun fügt es der Zufall, daß ich sie aus Todesgefahr erretten mußte!«
»Das Mädchen ist unser guter Engel,« erwiderte Martial, »und sie sieht ja auch aus wie ein Engel so schön! Nicht wahr, Herr Doktor, der Tod wird sie noch nicht holen?« – »Ich kann Gewisses darüber noch nicht sagen,« erwiderte Griffon, »vor allem muß ich wissen, ob sie hier bleiben kann, und hier die rechte Pflege finden wird?« – »Hier?« rief die Wölfin, »in solcher Mörderhöhle?« – »Still!« rief Martial, ihr mit der Faust drohend. – »Freilich,« sagte der Doktor zu dem verwundert dreinschauenden Grafen, »das Haus steht nicht im besten Rufe, und es sollte mich freilich wundern . . .« – »Sie sind also gewalttätigen Menschen zum Opfer gefallen?« fragte der Graf den Verletzten . . . »wer hat Sie denn so zugerichtet?« – »Ich bin in einer Schlägerei verwickelt gewesen,« sagte Martial ausweichend, »und dabei verletzt worden . . . aber,« setzte er hinzu, »daß das Mädchen hier bleibt, wird schwerlich angehen, denn ich bleibe auch nicht hier und will auch meinen Bruder und meine Schwester nicht hier lassen . . . wir werden der Insel auf Nimmerwiedersehen den Rücken wenden . . .«
»Ach, wie schön! wie schön!« riefen Franz und Amandine wie aus einem Munde . . . »Und wann wollen Sie weg?« fragte der Doktor, »das ohnmächtige Mädchen bedarf noch der größten Schonung. Es wäre deshalb wohl gut, wenn wir ein sicheres Obdach für sie fänden . . . Wie wäre es mit dem Hause, Herr Graf, das Sie mir angewiesen haben? Die Gärtnersfrau mit ihrer Tochter würden gute Pflegerinnen abgeben, und Sie haben, scheints, selbst Interesse genug für die Arme, daß Sie hin und wieder wohl nach dem Rechten sehen würden?«
Der Graf zollte diesem Plane aus vollem Herzen Beifall, und eine halbe Stunde später befand sich Marienblume, noch immer ohnmächtig, im Hause des Arztes und unter der Obhut der Gärtnersfrau desselben und der Wölfin, die nicht eher von ihr weichen wollte, als bis sie sie außer Gefahr wußte.
Fünftes Kapitel. Das Porträt.
Auf einem der Boulevards in der Nähe des Observatoriums ging Tom Seyton, der Bruder der Gräfin Sarah Mac Gregor, auf und nieder, als er der Eule ansichtig wurde, aus deren Strohtasche die Spitze der Mordwaffe hervorguckte, die bislang Bakel bei sich geführt hatte, und die Seytons Blicke entgangen war . . . »Eben schlägts drei,« sagte sie, »ich komme also pünktlich.« – »Folgen Sie mir!« sagte Seyton und führte sie durch ein ödes Gäßchen unfern der Straße Cassini. An einem Drehkreuze in seiner Mitte blieb er stehen, schloß eine Pforte auf und hieß sie hier warten. Darauf verschwand er. Die Eule ging mit sich zu Rate . . . »Hoffentlich läßt er mich hier nicht zu lange stehen,« sagte sie bei sich, »denn ich muß, um die Mäklerin abzufertigen, mit Martials bei Rotarm sein. Meinen Dolch habe ich ja! Aha! Da guckt sich der Spitzbube um! Geschieht mir schon recht, warum habe ich ihn nicht in der Scheide gelassen! Na, vielleicht kann er mir dieser Mäklerin gegenüber Dienste tun! 30 000 Franks, das war ein feiner Fang heute! Da ist doch ein bißchen mehr abgefallen als bei dem Halunken von Notar, der sich keinen Sou abzwacken ließ . . . Da konnte ich schön drohen: es half alles nichts! Der hatte keine Furcht, als ich ihm sagte, seine Haushälterin hätte mir doch das Mädchen, das jetzt die Schalldirne sei, überantwortet, sondern schalt mich eine Lügnerin und schlug mir die Tür vor der Nase zu . . .« – Sie sah sich scheu um und bemerkte, daß am Ende der Allee eine Dame auftauchte . . . »Aha!« sagte sie, »die bleiche Frau wieder, die mit dem langen schwarzen Duckmäuser im Weißen Kaninchen war . . . Hm, da heißts auf dem Posten sein!«
Die nahende Person war tatsächlich die Gräfin Sarah, auf deren Gesicht all jene Verachtung zum Ausdrucke kam, die von vornehmen Leuten gemeinhin gegen Leute niedrigen Standes empfunden wird, die sie als Werkzeuge oder Mitschuldige nicht entbehren können. Ihr Bruder hatte sich geweigert, die bisherige Rolle weiter zu spielen, und sich bloß dazu noch verstanden, seine Schwester zu diesem Zusammentreffen mit der Eule zu begleiten, lehnte aber jede Beteiligung an den Plänen, die sie neuerdings geschmiedet hatte, entschieden ab. Rudolf wieder an sich zu ziehen dadurch, daß sie die ihm ihrer Meinung nach teuren Bande zerriß, war ihr nicht geglückt. Nun dachte sie, ihren ehrgeizigen Traum so zu verwirklichen, daß sie ihn auf unwürdige Weise hinterging: es sollte ihm eingeredet werden, die ihm von Sarah geborene Tochter sei nicht tot, und eine Waise für ihrer beider Kind ausgegeben werden. Dazu hatte sie Ferrand bestimmen wollen, der sich aber, wie dem Leser bekannt ist, geweigert hatte, ihr dabei zu helfen, statt dessen, und zwar aus Furcht vor der Aussage der Eule einerseits, aus Besorgnis vor dem Ansinnen der Gräfin anderseits, beschlossen hatte, die Schalldirne verschwinden zu lassen. Die Gräfin aber, nach wie vor der Meinung, daß sich Ferrand noch bestechen oder einschüchtern lassen werde, sobald sie ein junges Mädchen gefunden hätte, das zu solcher Rolle sich eigne, hatte ihren Plan keineswegs aufgegeben . . . Sarah eröffnete das Gespräch mit der Eule ohne weiteres durch die Frage, ob sie ihr ein Mädchen nachweisen könne, das von frühester Jugend an verwaist sei, ein hübsches, einnehmendes Gesicht und ein sanftes Gemüt habe, auch nicht über 17 Jahre alt sein dürfe . . . »So etwas wird wohl so leicht nicht zu finden sein,« erwiderte die Eule, die Gräfin verblüfft anstarrend . . . »Man wird sich in den Findelhäusern umsehen müssen . . . »antwortete die Gräfin. – »Es käme auf den Preis an, der sich dabei verdienen ließe,« meinte die Eule . . . »schaut ein ordentliches Stück Geld dabei heraus, dann ließe sich schon darüber reden.« – »Nun, ich zahle Ihnen, was Sie fordern, wenn mir die Person recht ist, die Sie mir zuführen,« versetzte die Gräfin. – »Das läßt sich hören,« sagte schmunzelnd die Eule; »mir fällt gleich ein Mädel ein, das sich eignen könnte – kennen Sie die Schalldirne?« – »Wer ist das?« fragte die Gräfin ihrerseits. – »Die wir aus Bouqueval abgeholt haben,« sagte die Eule. – »Von der kein Wort,« rief die Gräfin zornig, »die bleibt ganz außer Betracht, verstehen Sie?« – »Na, warum denn? Sie paßt doch für Sie, wie gemacht! Wenn sie aus Saint-Lazare entlassen wird, könnten Sie sie, meiner Meinung nach, gar wohl verwenden. Sie ist noch keine 17 Jahre alt, ist hübsch, hat ein zutrauliches Wesen und weiß sich auch zu bewegen . . . Vor zehn Jahren, als sie mir der Schuft Ferrand überantwortete, war sie knapp sechs Jahre alt, und Tournemine, der auf die Galeeren gekommen ist und sie zu mir brachte, hat mir ausdrücklich gesagt, das Mädel sei ganz sicher ein Kind, das beseitigt und für tot erklärt werden solle . . .«
Mit einer so wildbewegten Stimme, daß die Eule unwillkürlich zurückwich, rief die Gräfin: »Was sagen Sie? Jakob Ferrand hat Ihnen das Kind überantwortet?« – »Ja doch, ich sage es ja,« antwortete die Eule, »was regt Sie dabei so auf? Als Tournemine sie mir brachte – es sind gerade zehn Jahre her, – da sagte er: Nimm den Balg! Laß ihn leben oder bring ihn um die Ecke, mir ist's gleich: so oder so, 1000 Franks sind dabei zu verdienen.« – »Vor zehn Jahren, sagen Sie?« – »Ja doch.« – »Es war ein hübsches blondes Mädchen?« – »Jawohl, mit tiefblauen Augen – also eine Rarität als Blondine,« erwiderte die Eule. –
Sarah sank auf die Knie und hob die Hände zum Himmel auf . . . »Gott! O, Gott!« rief sie, »deine Wege sind wahrlich unerforschlich, und ich beuge mich vor deiner Weisheit! O, sollte mir solches Glück noch beschieden sein! Doch nein, nein! Ich kann nicht daran glauben . . . denn ich verdiene nicht, daß es mir zuteil würde!« – Die Eule stand da, wie an die Erde gewurzelt und war kaum imstande, der Gräfin zu folgen, als diese sie jetzt dazu aufforderte.
Sarah ging raschen Schrittes vor ihr her, bis sie das Ende der Allee erreicht hatte, wo ein paar Stufen zur Glastür eines prächtig möblierten Arbeitszimmers führten. Dorthin führte Sarah ihre Begleiterin und riegelte hinter sich die Tür zu, trat zu einem Sekretär, nahm ein Kästchen aus Ebenholz heraus und stellte es auf einen mitten im Zimmer stehenden Tisch. Das Kästchen war bis an den Rand mit Juwelen gefüllt, daß der Eule schier die Augen übergingen. Sarah war so ungeduldig, auf den Boden des Kästchens zu gelangen, daß sie Hals- und Armbänder und Diademe, die von Smaragden, Topasen, Rubinen und Diamanten in allen Farben spielten, auf den Tisch warf . . .
Die Eule dachte an ihren Dolch, sie dachte daran, daß sie allein mit der Frau sei, daß sie leicht und sicher entkommen könne . . . und mit der Schlauheit einer Tigerkatze, die sich aus dem sichern Hinterhalt auf ihre Beute stürzt, nahm sie den Umstand wahr, daß die Gedanken der Gräfin sich auf einen einzigen Gegenstand richteten, schlich sie leise um den Tisch herum, der sie von ihrem Opfer trennte . . . Da aber sah sie sich plötzlich gezwungen, einzuhalten. Die Gräfin nahm aus dem Juwelenkästchen, dessen Inhalt nun vor ihr auf dem Tische lag, ein Medaillon heraus und hielt es der Eule mit zitternder Hand hin . . . »Da! Sehen Sie sich das Bild an!« – »Die Schalldirne!« rief die Eule, überrascht von der Aehnlichkeit, »das ist das Mädchen, das Tournemine mir übergeben hat . . . gewiß, gewiß! Das sind dieselben langen Locken, die ich sogleich vom Kopfe schnitt und zu Gelde machte . . .«