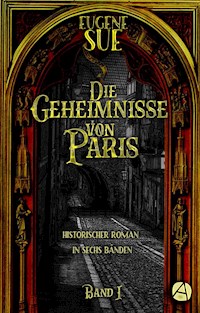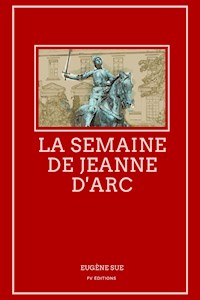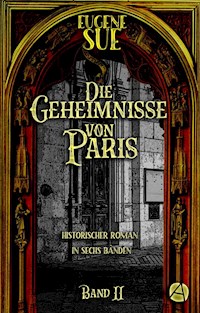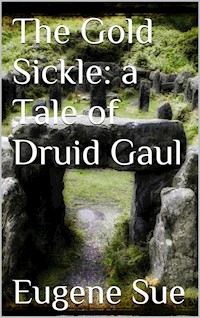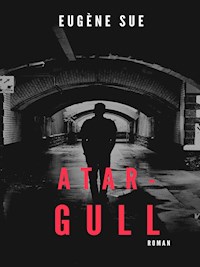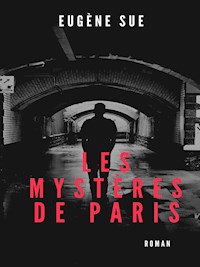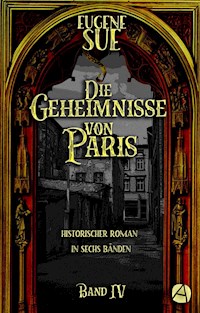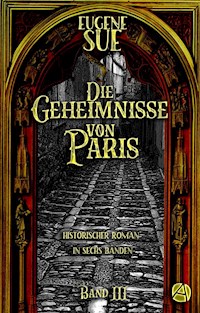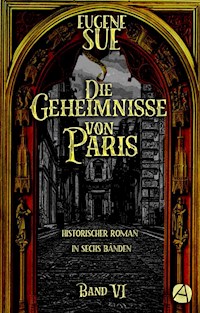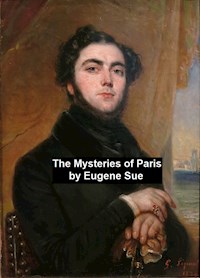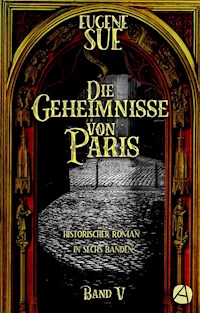
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Geheimnisse von Paris
- Sprache: Deutsch
Entführung, Mord und Prostitution: Eugène Sues "Die Geheimnisse von Paris" entführt die Leser in die elenden Arbeiterviertel und die Unterwelt von Paris im Jahre 1838. In den schmutzigen Spelunken, wo sich die Verbrecher der Stadt treffen, werden finstere Pläne geschmiedet, während sich in den schicken Salons der adligen Oberschicht familiäre Dramen abspielen, aber um jeden Preis die Fassade gewahrt werden muss. Der Moloch Paris lässt hier mit seiner Enge, seinem Dreck und den allgegenwärtigen Verbrechen die Menschen verrohen. Und mitten in diesem Sumpf der zwielichtigen Gassen des Großstadtdschungels erscheint wie aus dem Nichts ein fremder Retter, der sich den Hilflosen und Entrechteten zur Seite stellt, um das Boshafte zur Rechenschaft zu ziehen. Auf insgesamt knapp 2000 Seiten entfaltet sich ein detailreiches und farbenprächtiges Bild des Pariser Alltags Mitte des 19. Jahrhunderts. Dutzende von Figuren aus unterschiedlichen sozialen Ständen und ihre Geschichten werden mit dem Haupthandlungsfaden des Werkes verwoben. Sue verbindet Elemente des Kriminalromans, des Gesellschaftsromans und des Melodrams und erschafft daraus ein bildgewaltiges Epos einer vergangenen Zeit, das durch sein Rachemotiv und die intriganten Verwicklungen zuweilen an den Graf von Monte Christo von Alexandre Dumas erinnert, der von Sue inspiriert wurde. Der Abenteuer-Klassiker liegt hier in der ungekürzten Übertragung ins Deutsche von August Diezmann vor. Zeichensetzung und Rechtschreibung der Erstübertragung wurden teilweise dem heutigen Sprachgebrauch angenähert, teilweise beibehalten. Dies ist der Versuch eines Kompromisses zwischen einem Zugeständnis an die Lesegewohnheiten heutiger Leserinnen und Leser sowie der Bewahrung des damaligen Sprachkolorits, welches wesentlich zur Atmosphäre der Geschichte beiträgt. Dieses ist der fünfte von sechs Bänden des monumentalen Werkes. Der Umfang des fünften Bandes entspricht ca. 340 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Eugène Sue
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS
Historischer Roman
in sechs Bänden
BAND V
Ungekürzte Ausgabe
in einer
Übersetzung von
August Diezmann
Die Geheimnisse von Paris wurde im französischen Original Les mystères de Paris zuerst veröffentlicht vom 19. Juni 1842 bis zum 15. Oktober 1843 in der Tageszeitung Le Journal des Débats (Paris).
Diese ungekürzte und vollständige Ausgabe in sechs Bänden wurde aufbereitet und herausgegeben von: apebook
© apebook Verlag, Essen (Germany)
Band 5 von 6
www.apebook.de
1. Auflage 2020
Anmerkungen zur Transkription: Der Text der vorliegenden Ausgabe folgt der Übersetzung von August Diezmann (Otto Wigand Verlag). Zeichensetzung und Rechtschreibung der Erstübertragung wurden teilweise dem heutigen Sprachgebrauch angenähert, teilweise beibehalten. Dies ist der Versuch eines Kompromisses zwischen einem Zugeständnis an die Lesegewohnheiten heutiger Leserinnen und Leser sowie der Bewahrung des damaligen Sprachkolorits, welches wesentlich zur Atmosphäre der Geschichte beiträgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-201-7
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Alle verwendeten Bilder und Illustrationen sind – sofern nicht anders ausgewiesen – nach bestem Wissen und Gewissen frei von Rechten Dritter, bearbeitet von SKRIPTART.
Alle Rechte vorbehalten.
© apebook 2020
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
Inhaltsverzeichnis
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. Band V
Impressum
FÜNFTER BAND
I. Erinnerungen.
II. Das Boot.
III. Des Wiedersehens Glück.
IV. Die Wölfin und Martial.
V. Der Doctor Griffon.
VI. Das Portrait.
VII. Der Sicherheitsdiener.
VIII. Die Eule.
IX. Der Keller.
X. Die Vorstellung.
XI. Nachbar und Nachbarin.
XII. Murph und Polidori.
XIII. Die Strafe.
XIV. Die Schreibstube.
XV. Du sollst nicht begehren ...
XVI. Die Klappe in der Türe.
XVII. Das Gefängnis La Force.
XVIII. Der Spitzige.
XIX. Vergleichung.
XX. Herr Boulard.
XXI. Franz Germain.
XXII. Lachtaube.
XXIII. Die Löwengrube.
XXIV. Das Complott.
XXV. Der Erzähler.
Eine kleine Bitte
Direktlinks zu den einzelnen Bänden
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
Fünfter Band
I. Erinnerungen.
Jacob Ferrand hatte leicht und schnell die Freilassung der Marien-Blume erlangt, die von einem einfachen administrativen Beschlusse abhing.
Nachdem er durch die Eule den Aufenthalt der Schallerin in St. Lazarus erfahren, hatte er sich sogleich an einen seiner Klienten, einen ehrenwerten und einflußreichen Mann gewendet, und diesem gesagt, ein junges Mädchen, das anfangs allerdings auf Abwege gekommen sei, jetzt aber aufrichtige Reue fühle, und neuerdings in St. Lazarus eingesperrt worden, sei der Gefahr ausgesetzt, durch den Umgang mit den andern in ihren guten Vorsätzen wieder erschüttert zu werden. Da ihm, hatte Jacob Ferrand hinzugesetzt, das Mädchen durch achtbare Personen dringend empfohlen worden sei, die sich ihrer annehmen wollten, sobald sie aus dem Gefängnisse entlassen, so ersuche er seinen vielvermögenden Gönner im Namen der moralischen Religion und im Interesse der Unglücklichen, sich für die Freilassung derselben zu verwenden.
Auch hatte der Notar, um sich vor jeder weitern Nachforschung sicher zu stellen, seinen Gönner vor allen Dingen und dringend gebeten, ihn bei der Ausführung dieses guten Werkes nicht zu nennen. Dieser Wunsch, den man der menschenfreundlichen Bescheidenheit Ferrand's, des ebenso frommen als angesehenen Mannes, zuschrieb, wurde gewissenhaft befolgt. Die Freilassung der Marien-Blume wurde bloß unter dem Namen des Gönners erbeten, der, um sich noch gefälliger zu zeigen, dem Notar den Entlassungsbefehl direkt zuschickte, damit er denselben den Beschützern des jungen Mädchens zufertigen könnte.
Mad. Seraphin übergab den Entlassungsbefehl dem Direktor des Gefängnisses und setzte hinzu, sie habe den Auftrag, die Schallerin zu den Personen zu bringen, welche sich für dieselbe interessierten.
Nach den vortrefflichen Zeugnissen, welche die Aufseherin der Frau von Harville über Marien-Blume gegeben hatte, zweifelte Niemand, daß dieselbe ihre Freilassung der Vermittlung der Marquise verdanke.
Die Haushälterin des Notars konnte deshalb das Mißtrauen ihres Opfers in keiner Weise erregen.
Mad. Seraphin konnte bei Gelegenheit eine recht gutmütige Miene annehmen, und es gehörte ein ziemlicher Grad von Beobachtungskunst dazu, um etwas Hinterlistiges, Falsches und Grausames in ihrem Blicke, in ihrem heuchlerischen Lächeln zu erblicken.
Trotz ihrer tiefen Verdorbenheit, die sie zur Mitschuldigen oder Mitwisserin der Verbrechen ihres Herrn gemacht hatte, fiel der Mad. Seraphin die rührende Schönheit des jungen Mädchens auf, die sie als Kind der Eule überliefert hatte, und die sie jetzt zum sicheren Tode führen wollte.
»Nun, meine liebe Mademoiselle«, sagte Mad. Seraphin mit süßlicher Stimme, »Sie sind gewiß recht froh, aus dem Gefängnisse herauszukommen.«
»Ach ja, Madame, und gewiß verdanke ich diese Gnade der Gunst der Frau von Harville, die so gütig gegen mich war?«
»Sie irren sich nicht. — Aber kommen Sie, wir haben uns schon etwas verspätet und müssen noch einen weiten Weg machen —«
»Wir gehen nach Bouqueval, zu der Mad. Georges, nicht wahr?« fragte die Schallerin.
»Ja — wir gehen auf das Land, zu Mad. Georges«, antwortete die Haushälterin, um jeden Argwohn des Mädchens zu entfernen. Dann setzte sie hinzu: »aber nicht sogleich; ehe Sie Mad. Georges sehen, steht Ihnen eine kleine Überraschung bevor. Kommen Sie, kommen Sie, ... der Fiacre wartet. — Wie frei müssen Sie jetzt aufatmen, liebe Mademoiselle, da Sie das Gefängnis hinter sich haben!«
Mad. Seraphin verbeugte sich vor dem Secretair und ging mit der Schallerin fort.
Ein Diener folgte ihnen, um ihnen das Tor zu öffnen.
Dieses hatte sich hinter den beiden Frauen wieder geschlossen, und sie standen unter dem großen Portal, das auf die Straße Faubourg-Saint-Denis geht, als sie einem jungen Mädchen begegneten, das ohne Zweifel eine Gefangene besuchen wollte.
Es war Lachtaube, — die immer flinke und zierliche Lachtaube. Ein sehr einfaches, aber frisches mit kirschroter Bandschleife ausgeputztes Häubchen faßte ihr hübsches Gesicht ein; ein sehr weißer Kragen fiel aus ihren langen brauncarrirten Shawl. Am Arme trug sie ein Strohkörbchen und in Folge ihres vorsichtigen Ganges waren ihre Stiefelchen völlig rein, ob sie gleich weit her kam.
»Lachtaube!« rief Marien-Blume aus, als sie ihre ehemalige Gefängnisgenossin erkannte.
»Schallerin!« rief ihrerseits die Grisette.
Und die Mädchen sanken einander in die Arme.
Man kann sich nichts Lieblicheres denken als den Contrast dieser beiden sechzehnjährigen Mädchen, die einander umschlungen hielten, beide so hübsch und doch ganz verschieden waren:
Die eine, blond, mit großen blauen melancholischen Augen, einem idealen, etwas bleichen, englischreinen Profil; die andere, eine pikante Brünette mit vollen rothen Wangen, schönen schwarzen Augen und heiterer Miene, ein reizendes Bild der Jugend und Sorglosigkeit, ein seltenes Beispiel von Glück in der Armut, der Rechtlichkeit bei aller Verlassenheit und der Freude bei der Arbeit.
Nachdem die beiden jungen Mädchen einander aufrichtig geliebkost hatten, sahen sie einander an.
Lachtaube war über dieses Zusammentreffen hocherfreut; Marien-Blume konnte ihre Verlegenheit nicht bergen. Der Anblick ihrer Freundin erinnerte sie an die wenigen Tage des ruhigen Glückes, die ihrer ersten Entwürdigung vorausgegangen waren.
»Du bist es? Welches Glück!« rief Lachtaube nochmals aus.
»Ja, ... welche liebe Überraschung! Wir haben einander so lange nicht gesehen«, antwortete die Schallerin.
»Jetzt wundere ich mich nicht mehr, Dich seit sechs Monaten nicht gesehen zu haben«, fuhr Lachtaube mit einem Blicke auf die ländliche Kleidung der Schallerin fort: »Du wohnst auf dem Lande?«
»Ja—seit einiger Zeit«, — antwortete Marien-Blume mit niedergeschlagenen Augen.
»Und Du willst wie ich Jemanden in dem Gefängnisse besuchen?«
»Ja — ich habe—ich habe Jemanden besucht«, sagte Marien-Blume stotternd und errötend.
»Jetzt gehst Du nach Hause? wohl weit fort von Paris? Liebe kleine Schallerin, Du bist immer so gut, daran erkenne ich Dich. — Erinnerst Du Dich noch der armen Frau, die niedergekommen war und der Du Deine Matratze, Wäsche und das wenige Geld gabst, das Du noch besaßest und das wir auf dem Lande verzehren wollten? Damals schon liebtest Du das Land —«
»Und Dir gefiel es gar nicht, Lachtaube, aber Du warst so gefällig und begleitetest mich nur meinetwegen.«
»Doch auch meinetwegen, denn Du warst immer ein wenig ernst und wurdest so zufrieden, so heiter, so lustig, sobald Du auf dem Felde oder im Walde warest, daß es mir schon Vergnügen machte, Dich zu sehen. Aber laß mich Dich ansehen! Wie gut Dir das runde Häubchen steht! Wie hübsch Du geworden bist! Ja, ja, es war Deine Bestimmung, ein Bauernhäubchen zu tragen, wie es die meinige war, ein Grisettenhäubchen zu tragen. Du hast Deinen Wunsch erreicht und mußt nun recht zufrieden sein, das wundert mich nicht. — Als ich Dich nicht mehr sah, dachte ich bei mir: die gute kleine Schallerin ist nicht für Paris geschaffen; sie ist ein wahres Waldblümchen und diese Blumen gedeihen in der Hauptstadt nicht; die Lust da sagt ihnen nicht zu. Die Schallerin wird also zu braven Leuten auf das Land gegangen sein, und das hast Du denn wirklich getan, nicht wahr?«
»Ja — «, antwortete Marien-Blume errötend.
»Einen Vorwurf habe ich Dir aber doch zu machen.«
»Mir?«
»Du hättest mir es anzeigen sollen; man läuft doch nicht so voneinander fort, und gibt seinen Freundinnen wenigstens Nachricht.«
»Ich—, ich habe Paris so schnell verlassen«, antwortete Marien-Blume in immer größerer Verlegenheit, »daß mir es nicht möglich war —«
»Ich bin ja auch nicht böse darüber, — ich freue mich zu sehr, Dich wiederzusehen. Du hast Recht daran getan, Paris zu verlassen; es ist so schwer, hier ruhig zu leben, ungerechnet, daß ein armes einzelnes Mädchen, ohne es zu wollen, auf einen schlechten Weg kommen kann. Wenn man Niemanden kennt, der einem einen guten Rat gibt, — die Männer versprechen immer so viel, und — die Armut tut bisweilen so weh. Erinnerst Du Dich noch der kleinen Julie, die so hübsch war, und der Rosine, der Blondine mit den schwarzen Augen?«
»Ja, ich erinnere mich ihrer —«
»Nun siehst Du, arme Schallerin, sie sind beide hintergangen und dann verlassen worden. Von Unglück zu Unglück sanken sie tiefer und tiefer, bis sie solche schlechte Mädchen wurden, die man hier einsperrt —«
»Ach Gott!« rief Marien-Blume aus, die den Kopf sinken ließ und feuerrot wurde.
Lachtaube, welche die Bedeutung dieses Ausrufes ihrer Freundin nicht erriet, fuhr fort:
»Sie sind sehr schlecht, sehr verächtlich selbst, wenn Du willst, aber wir dürfen nicht zu streng gegen die Andern sein, weil wir beide rechtlich geblieben sind, Du, weil Du auf dem Lande bei braven Leuten lebtest, ich, weil ich keine Zeit mit Liebhabern zu verlieren hatte, weil ich ihnen meine Vögel vorzog und mein größtes Glück darin fand, mir durch meine Arbeit eine hübsche kleine Wirtschaft zu erwerben. — Wer weiß, ob nicht Gelegenheit, Betrug und Not viel zum Verderben der Rosine und Julie beitrugen und ob wir es an ihrer Stelle nicht auch so gemacht hätten —«
»Ach«, sprach Marien-Blume bitter, »ich klage sie nicht an, ich bedauere sie.«
»Wir haben Eile, liebe Mademoiselle«,sagte Madame Seraphin, indem sie ungeduldig ihrem Opfer den Arm bot.
»Gestatten Sie uns nur noch einige Augenblicke, Madame; ich habe meine arme Schallerin so lange nicht gesehen«, entgegnete Lachtaube.
»Es ist spät, schon drei Uhr, und wir haben noch einen weiten Weg vor uns«, sagte Madame Seraphin, für welche dieses Zusammentreffen sehr unangenehm war. Dann setzte sie hinzu:
»Ich bewillige noch zehn Minuten —«
»Und Du?« fragte Marien-Blume, indem sie die Hände der Freundin in die ihrigen nahm; »Du besitzest einen so glücklichen Charakter! Bist Du immer heiter, immer zufrieden?«
»Ich war es bis vor wenigen Tagen, jetzt aber ...«
»Hast Du Kummer?«
»Ich? Ja wohl, ja wohl. Ich freilich habe mich nicht geändert, aber leider ist nicht Jedermann wie ich. Da nun Andere Kummer haben, so leide ich mit —«
»Immer so gut!«
»Denke Dir nur, ich komme hierher, um ein armes Mädchen zu besuchen, — eine Nachbarin, eine gutmütige Seele, der man ganz mit Unrecht ein Verbrechen schuld gibt und die recht zu beklagen ist. Sie heißt Louise Morel und ist die Tochter eines ehrlichen Handwerkers, der vor übergroßem Unglück den Verstand verloren hat —«
Madame Seraphin zuckte zusammen, als sie Louise Morel, eines der Opfer des Notars nennen hörte, und sah Lachtaube aufmerksam an.
Das Gesicht des Mädchens war ihr völlig unbekannt; nichts desto weniger horchte die Haushälterin von nun an weit aufmerksamer auf das Gespräch der beiden jungen Mädchen.
»Die Arme!« entgegnete die Schallerin; »wie muß sie sich freuen, daß Du sie in ihrem Unglücke nicht vergißt.«
»Das ist noch nicht Alles. Wie Du mich da siehst, komme ich weit her, aus einem andern Gefängnisse, — aus einem Männergefängnisse.«
»Du aus einem Männergefängnisse?«
»Leider ja; ich habe da einen andern armen recht traurigen Bekannten. — Sieh mein Körbchen da, — es ist in zwei Hälften geteilt, und jede Seite hat ihre Bestimmung; heute bringe ich Louisen etwas Wäsche und letzthin brachte ich auch dem armen Germain etwas, — mein Gefangener heißt Germain. — Ich kann an das, was mir mit ihm begegnet ist, nicht denken, ohne daß mir die Tränen in die Augen treten; es ist das dumm, ich weiß, daß es nicht der Mühe wert ist, aber ich bin nun einmal so.«
»Und warum treten Dir die Tränen in die Augen?«
»Denke Dir, Germain ist so unglücklich, weil man ihn mit den Bösewichtern in dem Gefängnisse zusammengesperrt hat, daß er ganz niedergeschlagen dasitzt, zu nichts Lust hat, nicht ißt und zusehends abmagert. Ich bemerkte dies und dachte bei mir: er hat keinen Hunger, ich will ihm etwas mitnehmen, was er sehr liebte, als er mein Nachbar war, — das wird ihm wieder Appetit machen. — Es war gar nichts Besonderes, schöne gelbe Kartoffeln mit etwas Milch und Zucker — Kartoffelmus — Ich füllte damit eine hübsche Tasse, trug es ihm in sein Gefängnis und sagte, ich hätte es selbst gemacht, wie sonst, in guter Zeit — Du verstehst mich schon — Ich glaubte ihm damit Appetit zu machen, — ja, Du mein Gott! —«
»Nun?«
»Die Tränen traten ihm in die Augen, als er die Tasse erblickte, aus der ich so oft in seiner Gegenwart meine Milch getrunken hatte, — er weinte wirklich und endlich weinte ich selbst mit, ob ich es gleich gar nicht wollte. Da siehst Du, wie schlecht es mir geht; ich glaubte ihn aufzuheitern und betrübte ihn nur noch mehr —«
»Ja, aber diese Tränen werden ihm sehr süß gewesen sein.«
»Lieber wäre mir es doch gewesen, wenn ich ihn auf eine andere Weise hätte trösten können. Aber ich spreche da von ihm, ohne Dir zu sagen, wer er ist; er ist ein ehemaliger Nachbar von mir, der rechtlichste Mensch von der Welt, so sanft, so schüchtern wie ein Mädchen und ich liebte ihn wie einen Bruder —«
»Nun begreife ich, daß Dir sein Kummer das Herz auch schwer macht.«
»Nicht wahr? Aber Du sollst sehen, wie gut er ist. Als ich fortging, fragte ich ihn wie gewöhnlich, was er zu bestellen habe, und sagte lachend, um ihn aufzuheitern, ich sei seine kleine Wirtschafterin und würde recht pünktlich, recht fleißig sein, um mir seine Kundschaft zu erhalten. Da zwang er sich auch zum Lachen und bat mich, ihm einen der Romane von Walter Scott zu bringen, die er mir sonst Abends, während ich arbeitete, vorgelesen. Der Roman heißt Ivan —, Ivanhoe,ja, richtig — das Buch gefiel mir so gut, daß er mir es zwei Mal vorgelesen hat.
— Der arme Germain, er war so gefällig!«
»Er will eine Erinnerung an jene vergangene glückliche Zeit haben —«
»Freilich, denn er bat mich auch, in dieselbe Leihbibliothek zu gehen und dieselben Bände, die wir mit einander gelesen, nicht zu leihen, sondern zu kaufen — ja, sie zu kaufen. — Du kannst Dir denken, welches Opfer das für ihn ist, denn er ist so arm wie wir.«
»Ein vortreffliches Herz!« sagte die Schallerin bewegt.
»Siehst Du, es rührt Dich auch, wie es mich rührte, als er mir diesen Auftrag gab, meine gute Schallerin; Du kannst Dir aber denken, daß ich um so mehr zu lachen suchte, je näher mir das Weinen kam, denn zwei Mal bei einem Besuche zu weinen, den ich gemacht hatte, um den Gefangenen zu erheitern, wäre doch zu viel gewesen. Um das zu ändern, erinnerte ich ihn an die drolligen Geschichten von einem Juden, der in dem Romane vorkommt, und über den wir sonst viel gelacht hatten. Je mehr ich aber sprach, um so reichlicher strömten ihm die Tränen aus den Augen. Das schnitt mir in's Herz; vergebens drängte ich die Tränen eine Viertelstunde lang zurück, endlich mußte ich doch mit weinen. Als ich ihn verließ, schluchzte er, und ich sagte, aufgebracht über meine eigene Dummheit: wenn ich ihn auf diese Weise tröste und aufheitere, verlohne es sich der Mühe nicht, zu ihm zu gehen —«
Madame Seraphin hatte, als sie den Namen Germain's, des zweiten Opfers des Notars, vernommen, noch einmal so aufmerksam zugehört.
»Und was hat der junge Mann getan, daß er im Gefängnisse ist?« fragte Marien-Blume.
»Er!« rief Lachtaube, deren Rührung jetzt dem Unwillen wich, »er wird durch einen alten abscheulichen Notar verfolgt, der auch Louise angezeigt hat.«
»Louise, die Du hier besuchen willst?«
»Ja, sie war im Dienst bei dem Notar und Germain war sein Cassirer. Es würde zu lange dauern, wenn ich Dir erzählen wollte, was er dem armen jungen Manne mit Unrecht schuld gibt. Der alte schlechte Mann ist wie besessen gegen die beiden Unglücklichen, die ihm nie etwas zu Leide getan haben. Aber nur Geduld — die Reihe wird auch an ihn kommen.«
Lachtaube sprach diese letztern Worte mit einem Ausdrucke, der Madame Seraphin beunruhigte. Sie mischte sich von nun an in die Erzählung und sagte schmeichelnd zu Marien-Blume:
,Meine liebe Mademoiselle, es ist spät, wir müssen fort, — man wartet auf uns. Ich sehe wohl ein, daß das, was Ihre Freundin Ihnen erzählt, Sie sehr interessiert, denn mich rührt es, ob ich gleich das junge Mädchen und den jungen Mann nicht kenne. Kann es so schlechte Menschen geben! Wie heißt denn der abscheuliche Notar, von dem Sie sprechen, Mademoiselle?«
Lachtaube hatte keine Ursache, der Madame Seraphin zu mißtrauen, sie gedachte aber an die Empfehlungen Rudolphs, welcher ihr die größte Vorsicht in Bezug auf den Schutz angeraten hatte, welchen er insgeheim Germain und Louisen angedeihen ließ, und bereuete die Worte: »Geduld! die Reihe wird auch an ihn kommen.«
»Dieser schlechte Mensch heißt Ferrand, Madame«, fuhr Lachtaube fort, dann setzte sie aber klug hinzu, um ihren ersten Fehler wieder gut zu machen:
»Und es ist um so schlechter von ihm, Louise und Germain zu peinigen, da sie Niemanden haben, der sich ihrer annimmt, mich ausgenommen, und ich kann ihnen nicht viel nutzen.«
»Wie schade!« antwortete Madame Seraphin, »ich hatte das Gegenteil gehofft; als Sie sagten: aber Geduld! — da glaubte ich, Sie rechneten auf irgend einen Beschützer, der sich der beiden Unglücklichen gegen den schlechten Notar annehmen würde.«
»Ach nein, Madame«, fuhr Lachtaube fort, um den Argwohn der Madame Seraphin gänzlich zu zerstreuen. »Wer sollte so edel sein, sich der beiden armen jungen Leute gegen einen reichen und mächtigen Mann anzunehmen, wie es dieser Ferrand ist!«
»Ach, es gibt doch so edle Herzen«, fiel Marien-Blume nach einigem Nachdenken und mit kaum verhaltener Begeisterung ein. »Ja, ich kenne Jemanden, der es sich zur Pflicht macht, die Leidenden zu schützen und zu verteidigen; er, den ich meine, ist gegen rechtliche Leute so hilfreich, wie für die Bösen furchtbar.«
Lachtaube sah die Schallerin erstaunt an und war nahe daran, da sie an Rudolph dachte, zu entgegnen, sie kenne auch Jemanden, der mutig die Partei des Schwachen gegen den Starken nehme; da sie aber treu beobachten wollte, was ihr Nachbar ihr anempfohlen hatte, so antwortete sie der Freundin:
»Wirklich? Du kennst Jemanden, der edel genug wäre, den armen Leuten zu Hilfe zu kommen?«
»Ja, — und obgleich ich sein Mitleiden und seine Wohltaten schon für andere Personen in Anspruch zu nehmen habe, so bin ich doch überzeugt, daß, wenn ihm das unverdiente Unglück Louisens und Germain's bekannt wäre, er sie retten und ihren Verfolger strafen würde, denn seine Gerechtigkeit und seine Güte sind unerschöpflich wie die Gerechtigkeit und die Güte Gottes —«
Madame Seraphin sah ihr Opfer mit Verwunderung an.
»Sollte das Mädchen noch gefährlicher sein als wir glaubten?« dachte sie bei sich. »Wenn ich mit ihr hätte Mitleiden haben können, so würde das, was sie jetzt sagt, den Unfall, der uns von ihr befreien soll, unvermeidlich machen.«
»Da Du einen so guten Menschen kennst, meine liebe Schallerin, so empfiehl ihm meine Louise und meinen Germain, denn sie verdienen ihr schlimmes Schicksal nicht«, sagte Lachtaube, die der Meinung war, ihre Freunde könnten nur gewinnen, wenn sie zwei Beschützer hätten statt des einen.
»Sei ruhig, ich verspreche Dir, bei dem Herrn Rudolph für Deine Schützlinge zu tun, was ich vermag«, sagte Marien-Blume.
»Rudolph!« rief Lachtaube, seltsam überrascht, aus.
»Ja, Rudolph«, wiederholte die Schallerin.
»Rudolph! — ein Reisediener?«
»Ich weiß nicht, was er ist. — Aber warum erstaunst Du so?«
»Weil ich auch einen Herrn Rudolph kenne.«
»Dieser kann nicht derselbe sein.«
»Wir wollen das gleich sehen. Wie sieht er aus?«
»Jung.«
»Richtig.«
»Ein edles gutmütiges Gesicht.«
»Richtig! Aber, mein Gott, so sieht der meinige auch aus«, entgegnete Lachtaube, die sich mehr und mehr verwunderte und hinzusetzte: »er ist braun? Hat er einen kleinen Schnurrbart?«
»Ja.«
»Er ist groß und schlank, — hat eine herrliche Taille und sieht für einen Reisediener sehr vornehm aus. — Ist das bei dem Deinigen auch so?«
»Gewiß«, antwortete Marien-Blume; »er ist es, aber ich wundere mich, daß Du ihn für einen Reisediener hältst.«
»Was das betrifft, so bin ich meiner Sache gewiß, denn er hat es mir selbst gesagt.«
»Du kennst ihn?«
»Ob ich ihn kenne! Es ist ja mein Nachbar.«
»Herr Rudolph?«
»Er hat ein Zimmer im vierten Stock neben dem meinigen.«
»Er! Er!«
»Ist das so wunderbar? Ich denke, das ist ganz einfach; er verdient jährlich nur fünfzehn- bis achtzehnhundert Francs und kann sich also nur eine bescheidene Wohnung nehmen. Freilich scheint er auch nicht viel Ordnung zu halten, denn er weiß nicht einmal, was sein Rock kostet, — mein Herr Nachbar —«
»Nein, nein, das ist nicht derselbe«, sagte Marien-Blume nachdenkend.
»Der Deinige ist wohl ein Muster von Ordnung?«
»Der, von welchem ich spreche, siehst Du, Lachtaube«, sagte Marien-Blume in Begeisterung, »ist allmächtig, — man spricht seinen Namen nur mit Liebe und Verehrung aus, — sein Blick schon bringt in Verlegenheit und imponiert; man ist versucht, vor ihm niederzuknien, so hochherzig und gütig ist er —«
»Da muß ich freilich wie Du sagen, es ist nicht mehr derselbe; denn der meinige ist weder allmächtig noch imposant. Er ist sehr gutmütig, sehr lustig und man kniet nicht vor ihm nieder, im Gegenteil, — denn er hat mir versprochen, mir mein Stübchen bohnen zu helfen, und er will mich auch Sonntags spazieren führen. — Siehst Du, ein großer Herr ist er nicht. — Aber woran denke ich? Immer fällt mir das Spazierengehen ein. Und Louise und mein armer Germain! So lange sie im Gefängnisse sind, gibt es für mich kein Vergnügen.«
Marien-Blume war seit einigen Augenblicken in Gedanken versunken; sie erinnerte sich plötzlich, daß Rudolph, als sie ihn zum ersten Male bei der Wirtin gesehen, wie ein gewöhnlicher Gast des Wirtshauses gekleidet gewesen war und gesprochen hatte. Konnte er bei Lachtaube nicht die Rolle eines Reisedieners spielen?
Welchen Zweck konnte diese neue Verkleidung haben?
Die Grisette bemerkte das nachdenkliche Aussehen der Freundin und fuhr fort:
»Du brauchst Dir deshalb den Kopf nicht zu zerbrechen, gute Schallerin; wir werden es schon erfahren, ob wir einen und denselben Rudolph kennen. Siehst Du den Deinigen, so sprich mit ihm von mir; wenn ich den meinigen sehe, werde ich mit ihm von Dir sprechen. Auf diese Weise werden wir erfahren, woran wir sind.«
»Wo wohnst Du, Lachtaube?«
»Rue du Temple, Nr. 17.«
»— Das kann uns von Nutzen sein«, dachte Madame Seraphin bei sich, welche aufmerksam auf dieses Gespräch gehört hatte. »Dieser Rudolph, der geheimnisvolle, allmächtige Mensch, der sich ohne Zweifel für einen Reisediener ausgibt, hat eine Wohnung neben der der Grisette da, welche mehr zu wissen scheint, als sie sagen will, und dieser Verteidiger der Unterdrückten wohnt also in demselben Hause wie Morel und Bradamanti. Gut! wenn die Grisette und der angebliche Reisediener sich noch ferner in Dinge mischen, die sie nichts angehen, so weiß man sie zu finden.«
»Sobald ich mit Herrn Rudolph gesprochen habe, werde ich Dir schreiben«, sagte die Schallerin, »und ich werde Dir meine Adresse geben, damit Du mir antworten kannst; aber wiederhole mir die Deinige, ich fürchte sie zu vergessen.«
»Ich habe da gerade eine Karte bei mir, wie ich sie meinen Kunden zu übergeben pflege«, und sie übergab Marien-Blume eine kleine Karte, auf welcher geschrieben stand: Mademoiselle Lachtaube, Näherin, Rue du Temple, 17. »Es sieht aus wie gedruckt, nicht wahr?« setzte die Grisette hinzu; »die Karten hat mir noch der Herr Germain geschrieben; er war so gut, so zuvorkommend! Ich bemerke alle seine guten Eigenschaften erst, seit er unglücklich ist, und ich mache mir ordentlich Vorwürfe darüber, daß ich ihn nicht früher geliebt habe —«
»Du liebst ihn also?«
»Ach ja. — Ich muß doch einen Vorwand haben, um ihn in dem Gefängnisse zu besuchen. Bin ich nicht ein närrisches Mädchen?« sagte Lachtaube, indem sie einen Seufzer unterdrückte und unter Tränen lachte.
»Du bist freundlich und gut wie immer«, antwortete Marien-Blume, indem sie die Hand ihrer Freundin herzlich drückte.
Madame Seraphin hatte aus dem Gespräche der beiden jungen Mädchen ohne Zweifel genug erfahren, denn sie sagte jetzt fast barsch zu Marien-Blume:
»Aber nun müssen wir fort; es ist spät; wir haben eine ganze Viertelstunde versäumt.«
»Die Alte gefällt mir gar nicht«, sagte Lachtaube leise zu Marien-Blume; dann setzte sie laut hinzu: »wenn Du wieder nach Paris kommst, gute Schallerin, so vergiß, mich nicht; Dein Besuch würde mir große Freude machen; ich zeige Dir mein Stübchen, meine kleine Wirtschaft, meine Vögel. — Ich habe Vögel, — das ist mein Luxus —«
»Wenn es möglich ist, besuche ich Dich, gewiß aber schreibe ich Dir. Jetzt lebe wohl, meine gute Lachtaube. Wenn Du wüßtest, wie glücklich ich bin, Dich wiedergesehen zu haben!«
»Ich auch, — aber hoffentlich ist es nicht das letzte Mal, und dann bin ich so neugierig, zu erfahren, ob Dein Rudolph und der meinige ein und derselbe Rudolph ist. Schreibe mir recht bald darüber —«
»Ja, ja, — lebe wohl, Lachtaube.«
»Lebe wohl, meine gute Schallerin.«
Die beiden Mädchen küßten einander zärtlich.
Lachtaube ging in das Gefängnis hinein, um auf den Erlaubnisschein, den ihr Rudolph verschafft hatte, Louise zu besuchen.
Marien-Blume stieg mit Madame Seraphin in den Fiacre, dem sie befahl, nach Batignolles zu fahren und an der Barriere zu halten.
Ein sehr kurzer Seitenweg führte von da aus fast gerade an das Ufer der Seine, nicht weit von der Insel des Aussuchers.
Marien-Blume, die Paris nicht kannte, hatte nicht bemerken können, daß der Wagen auf einem andern Wege als nach der Barriere St. Denis hinfuhr. Erst als der Fiacre anhielt, sagte sie zu Madame Seraphin, welche sie aufforderte, auszusteigen:
»Das scheint mir nicht der Weg nach Bouqueval zu sein; — und wollen wir zu Fuße dahin gehen?«
»Ich kann Ihnen weiter nichts sagen, liebes Kind«, antwortete die Haushälterin herzlich, »als daß ich nach dem Auftrage Ihrer Wohltäter handele und daß Sie ihnen Schmerz verursachen würden, wenn Sie mir nicht folgen wollten —«
»Glauben Sie das nicht, Madame«, entgegnete Marien-Blume; »Sie sind von ihnen abgeschickt und ich habe Ihnen keine Fragen vorzulegen; ich folge Ihnen unbedingt; sagen Sie mir nur, ob sich Madame Georges wohl befindet?«
»Sie ist ganz wohl.«
»Und — Herr Rudolph?«
»Befindet sich auch ganz wohl.«
»Sie kennen ihn also, Madame? Gleichwohl sagten Sie nichts, als ich eben mit Lachtaube von ihm sprach?«
»Wahrscheinlich weil ich nichts sagen sollte. — Ich folge meinen Befehlen —«
»Er hat sie Ihnen gegeben?«
»Ist das Mädchen neugierig!« entgegnete die Haushälterin lachend.
»Sie haben Recht; verzeihen Sie meine Fragen, Madame. Da wir zu Fuße dahin gehen, wohin sie mich führen«, setzte Marien-Blume sanft lächelnd hinzu, »so werde ich ja bald erfahren, was ich zu wissen wünsche.«
»Ja, vor einer Viertelstunde werden wir an Ort und Stelle sein.«
Die Haushälterin ging mit Marien-Blume auf einem Wege hin, neben dem Nußbäume standen.
Es war ein schöner lauer Tag und der Himmel halb von Wolken verdeckt, welche die untergehende Sonne mit einem purpurnen Schein übergoß.
Je näher Marien-Blume dem Ufer des Flusses kam, um so sichtbarer färbten sich ihre bleichen Wangen; sie atmete mit Entzücken die reine Landluft ein. Ihr reizendes Gesicht drückte eine so innige Befriedigung aus, daß Madame Seraphin zu ihr sagte:
»Sie scheinen sehr zufrieden zu sein?«
»Ach ja, Madame, — ich soll ja Madame Georges, — vielleicht Herrn Rudolph wiedersehen ... Ich habe ihnen sehr unglückliche Menschen zu empfehlen und hoffe, daß denselben geholfen werde, sollte ich da nicht glücklich und zufrieden sein? Müßte meine Traurigkeit nicht schwinden, wenn ich auch traurig wäre? Und dann, sehen Sie, ist der Himmel so schön mit den rosenroten Wolken, — und der Rasen, wie grün, trotz der frühen Jahreszeit! Da unten hinter den Weiden der Fluß — wie groß! Und die Sonne blitzt daraus — wie eben in dem Bassin in dem Gefängnisse. — Gott vergißt auch die armen Gefangenen nicht, — er gibt auch ihnen einen Strahl von seiner Sonne«, setzte Marien-Blume mit einem gewissen frommen Dankgefühle hinzu. Dann rief sie freudig aus:
»Ach, Madame, da unten mitten im Flusse die schöne kleine Insel mit den Weiden und Pappeln und dem weißen Hause dicht am Wasser! Wie schön muß es da im Sommer sein, wenn alle Bäume grün sind! Wie still und wie frisch!«
»Es freut mich«, antwortete Madame Seraphin, »daß Sie diese Insel hübsch finden.«
»Warum, Madame?« ,
»Weil wir dahin gehen.«
»Auf diese Insel?«
»Ja. Sie wundern sich darüber?«
»Ein wenig, ja.«
»Und wenn Sie Ihre Freunde da fänden?«
»Was sagen Sie?«
»Ihre Freunde hier versammelt zur Feier Ihrer Entlassung aus dem Gefängnisse? Würden Sie sich darüber nicht freuen?«
»Wäre es möglich? Madame Georges? — Rudolph?«
»Sehen Sie, Sie locken mir mein ganzes Geheimnis ab —«
»Ich werde sie wiedersehen! Ach, Madame, wie mein Herz klopft!«
»Gehen Sie nicht so schnell. — Ich begreife Ihre Ungeduld, aber ich kann Ihnen kaum folgen —«
»Verzeihen Sie, Madame, aber es drängt und treibt mich —«
»Das ist natürlich, ich mache Ihnen auch keinen Vorwurf daraus, im Gegenteil —«
»Hier führt der Weg abwärts; er ist nicht gut; wollen Sie meinen Arm annehmen?«
»Ich schlage dies nicht aus, meine liebe Mademoiselle; Sie sind rasch und gut zu Fuße, während ich alt bin —«
»Stützen Sie sich nur fest auf mich und fürchten Sie nicht, mich zu ermüden.«
»Ich danke. — Ihre Hilfe ist nicht überflüssig; es geht so steil abwärts. — Endlich sind wir auf besserm Wege.«
»Es ist also wahr, daß ich Madame Georges wiedersehen soll? Ich kann es kaum glauben.«
»Gedulden Sie sich nur noch ein wenig. — In einer Viertelstunde werden Sie sich überzeugen —«
»Ich kann nicht begreifen«, setzte Marien-Blume nachdenkend hinzu, »warum Madame Georges mich hier erwartet und nicht in der Meierei.«
»Immer neugierig! Immer neugierig!«
»Ja, nicht wahr, Madame?« fragte Marien-Blume lächelnd.
»Um Sie zu strafen, möchte ich Ihnen nun auch die Überraschung erzählen, welche Ihre Freunde Ihnen bereitet haben —«
»Eine Überraschung? Mir, Madame?«
»Ich antworte nicht mehr, — Sie schwatzen mir sonst Alles ab.«
Wir wollen Madame Seraphin und ihr Opfer auf dem Wege verlassen, der nach dem Flusse führt, und ihnen auf einige Augenblicke auf die Insel des Aussuchers vorauseilen.
II. Das Boot.
In der Nacht sah die von der Familie Martial bewohnte Insel düster aus, bei glänzendem Sonnenscheine dagegen ließ sich nichts Freundlicheres, Lachenderes denken als dieses Raubnest.
Die Insel, welche an den Ufern mit Weiden und Pappeln bepflanzt, fast ganz mit dichtem Grase bedeckt war, durch das sich einige mit gelbem Sand bestreute Gänge schlängelten, enthielt einen kleinen Küchengarten und eine ziemliche Anzahl Obstbäume. Mitten in diesem Garten sah man den mit Stroh bedeckten Schuppen, in welchen sich Martial mit Franz und Amandine zurückziehen wollte. Aus dieser Seite endigte die Insel an ihrer Spitze in einer Art Stacket von dicken Pfählen, welche die Abschwemmung des Landes verhindern sollten.
Vor dem Hause, fast ganz dicht vor dem Landungsplatze stand eine Laube von grün angestrichenen Latten, welche im Sommer die kletternden Zweige von wildem Weine und Hopfen trug, und in welche die Trinker sich zu setzen pflegten.
An dem einen Ende des Hauses, das weiß angestrichen und mit Ziegeln bedeckt war, bildete ein Holzstall einen kleinen Flügel, der weit niedriger war als das Hauptgebäude. Fast über diesem Flügel bemerkte man ein Fenster mit Laden, der mit Blech beschlagen und von außen durch zwei eiserne Querstangen in starken Klammern festgehalten wurde.
An den Pfählen des Aussteigeplatzes schaukelten sich drei Böte.
In einem dieser Böte kauerte Nicolaus und probirte die Klappe, die er in demselben angebracht hatte.
Aus einer Bank vor der Laube stand Kürbiß, die ältere Schwester des Nicolaus, hatte die Hand schirmartig über die Augen gelegt und sah in der Richtung hin, in welcher Madame Seraphin mit Marien-Blume ankommen mußte.
»Ich sehe noch Niemanden, weder die Alte noch die Junge«, sagte das Mädchen zu Nicolaus, indem sie von der Bank herunterstieg; »es wird werden wie gestern; wir warten umsonst. Wenn sie nicht binnen einer halben Stunde ankommen, — müssen wir fort; das Unternehmen mit Roth-Arm ist besser und er wartet auf uns. Die Mäklerin kommt um fünf Uhr zu ihm; wir müssen vor ihr dort sein. Die Eule hat es uns diesen Morgen noch einmal gesagt.«
»Du hast Recht«, entgegnete Nicolaus, indem er aus seinem Boote trat. »Daß das Donnerwetter die Alte erschlage, die uns zu Narren hat! Die Klappe geht prächtig. Statt der zwei Geschäfte machen wir vielleicht nur eins. — Uebrigens brauchen Roth-Arm und Barbillon uns; sie allein können nichts tun.«
»Ja wohl, denn während der Schlag ausgeführt wird, muß Roth-Arm draußen Wache halten und Barbillon ist nicht stark genug, um allein die Mäklerin in den Keller zu ziehen —«
»Sagte die Eule nicht lachend, sie hätte den Schulmeister in diesen Keller in Pension getan?«
»In diesen nicht, in einen andern, der weit tiefer ist und in den das Wasser tritt, wenn der Fluß anschwillt —«
»Ein schöner Aufenthalt für den Schulmeister! So allein da zu sein und blind!«
»Wenn er auch die besten Augen hätte, würde er doch nichts sehen; es ist in dem Keller so finster wie in einem Backofen.«
»Nun, wenn er zu seiner Zerstreuung alle Lieder gesungen hat, die erkennt, muß ihm doch die Zeit niedlich lang werden.«
»Die Eule sagte, er vertreibe sich die Zeit mit der Rattenjagd und der Keller sei sehr reich an diesem Wildpret.«
»Nicolaus, bei den Leuten, die sich langweilen müssen«, sagte das Mädchen mit einem häßlichen Lächeln, indem sie aus das mit dem Laden verschlossene Fenster zeigte, »fällt mir ein, daß da Einer ist, der sein eigenes Blut essen muß —«
»Bah! er schläft. — Seit heute früh rührt er sich nicht mehr und sein Hund ist stumm —«
»Vielleicht hat er ihn erwürgt, um ihn zu essen. — Seit zwei Tagen müssen sie fürchterlich hungern und dursten.«
»Das ist ihre Sache. — Martial kann es noch lange aushalten, wenn er Lust dazu hat. — Ist es vorbei, so sagt man, er sei an einer Krankheit gestorben und es kräht kein Hahn darnach.«
»Meinst Du?«
»Gewiß. Die Mutter begegnete heute früh aus dem Wege nach Asnières dem alten Ferot, dem Fischer. Da er sich wunderte, seinen Freund Martial seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben, so sagte ihm die Mutter, er könne das Bett nicht verlassen, so krank sei er, und er werde wohl sterben. Der alte Ferot hörte es an und glaubte es; er wird es weiter erzählen, und wenn die Sache geschieht, so wird sie ganz einfach aussehen.«
»Ja, aber er wird noch nicht gleich sterben; aus diese Weise dauert es lange.«
»Es gab kein anderes Mittel, zum Ziele zu kommen. Der verfluchte Martial ist, wenn er wild wird, böse wie der Teufel und stark wie ein Ochse überdies; er traute nicht und wir hätten uns nicht ohne Gefahr an ihn wagen können. Was konnte er aber tun, nachdem seine Türe einmal von außen zugenagelt war? Sein Fenster war vergittert —«
»Er hätte die Gitterstäbe ausheben können, wenn er mit seinem Messer den Gyps ausgegraben hätte, und er würde es gewiß auch getan haben, wenn ich nicht auf der Leiter hinausgestiegen wäre und ihm die Hände mit dem Beile zerhackt hätte, so oft er an die Arbeit ging.«
»Eine schöne Art Schildwache! Du mußt Dich da oben gut unterhalten haben«, sagte der Räuber lachend.
»Ich mußte Dir doch Zeit lassen, mit dem Bleche anzukommen, das Du bei dem Vater Micou gekauft hattest.«
»Der bliebe Bruder wird wüthend gewesen sein —«
»Er knirschte mit den Zähnen wie ein Toller; zwei oder drei Mal wollte er mich zwischen den Stäben hindurch mit dem Stocke herunterstoßen; da er aber nur noch eine Hand frei hatte, so konnte er nicht arbeiten und die Stäbe nicht herausheben ...«
»Glücklicher Weise gibt es keinen Kamin in seiner Stube.«
»Und die Türe ist fest und die Hand ist ihm verdorben! Sonst wäre er im Stande, er machte sich durch die Dielen ein Loch —«
»Und die Balken? Wie könnte er durch diese kommen? Nein; wir brauchen nicht zu fürchten, daß er entkomme; der Laden ist mit Blech beschlagen und durch zwei Eisenstangen festgehalten, — die Türe ist mit drei Zoll langen Nägeln von außen zugenagelt. — Sein Sarg ist also fester als wäre er von Eichenholz und Blei.«
»Wenn aber die Wölfin aus dem Gefängnisse entlassen wird, hierher kommt und ihren Mann sucht — wie sie ihn nennt?«
»So sagen wir ihr: suche ihn —«
»Weißt Du, daß die beiden Kinder, wenn die Mutter sie nicht eingesperrt hätte, im Stande wären, die Türe wie Ratten zu zernagen, um Martial zu befreien? Der Franz ist ein wahrer Teufel, seit er merkt, daß wir den großen Bruder eingesperrt haben.«
»Lassen wir sie oben in der Stube, während wir die Insel verlassen? Ihr Fenster ist nicht vergittert; sie können also heraussteigen —«
In diesem Augenblicke erregte Geschrei und Schluchzen, das aus dem Hause drang, die Aufmerksamkeit der Geschwister.
Sie sahen die Türe des Erdgeschosses, welche bis dahin offen gestanden hatte, heftig zuschlagen und eine Minute später erschien das bleiche finstere Gesicht der Wittwe Martial an dem Gitter des Küchenfensters.
Sie winkte mit ihrem langen dürren Arme ihren Kindern, ihr zu Hilfe zu kommen.
»Es gibt etwas; ich wette, daß Franz wieder eigensinnig ist«, sagte Nicolaus. »Der verfluchte Martial! Wäre er nicht gewesen, so würden wir mit dem Jungen gar keine Not gehabt haben ... Nun, sieh Dich immer um und rufe mich, wenn die beiden Frauenzimmer kommen.«
Während die Schwester wieder aus die Bank stieg und sich umsah, ob Madame Seraphin und die Schallerin ankämen, ging Nicolaus in das Haus hinein.
Die kleine Amandine kniete mitten in der Küche, schluchzte und bat um Gnade für ihren Bruder Franz.
Dieser hatte sich in eine Ecke der Küche gedrückt, schwang drohend das Beil des Nicolaus und schien entschlossen zu sein, diesmal dem Willen seiner Mutter einen verzweifelten Widerstand entgegen zu setzen.
Die Wittwe stand kalt und schweigend da, deutete aus den Eingang in den Keller, dessen Türe angelehnt war, und winkte ihrem Sohne Nicolaus, Franz in denselben einzusperren.
»Ich lasse mich nicht da hinein sperren!« rief der Knabe entschlossen aus, dessen Augen funkelten wie die einer jungen wilden Katze. »Ihr wollt mich da mit Amandine verhungern lassen wie den Bruder Martial.«
»Mutter, um der Liebe Gottes willen, laß uns oben in unserer Kammer wie gestern«, bat das kleine Mädchen in flehentlichem Tone und mit gefaltenen Händen; »in den, dunkeln Keller fürchten wir uns zu sehr —«
Die Wittwe sah Nicolaus ungeduldig an, als mache sie es ihm zum Vorwurfe, daß er ihren Befehl noch nicht vollzogen habe, dann zeigte sie mit einer neuen gebieterischen Geberde auf Franz.
Der Knabe erhob, als er den Bruder herankommen sah, verzweifelt das Beil und rief aus:
»Wer mich in den Keller sperren will, — er mag die Mutter oder Nicolaus sein, — den haue ich mit dem Beile und das Beil ist scharf —«
Nicolaus fühlte wie die Wittwe die Notwendigkeit, die beiden Kinder zu hindern, Martial beizustehen, während sie allein im Hause blieben, eben so ihnen die Kenntniß der Austritte zu entziehen, die geschehen sollten, denn von ihrem Fenster aus sah man auf den Fluß, wo man Marien-Blume ertränken wollte.
Nicolaus, der so schlecht als feig war und keineswegs Lust hatte, sich einen Hieb mit dem gefährlichen Beile geben zu lassen, das sein jüngerer Bruder in der Hand hatte, zögerte noch immer, denselben zu fassen.
Die Wittwe erzürnte sich über dieses Zögern ihres älteren Sohnes und stieß ihn auf Franz zu.
Nicolaus aber wich von neuem zurück und sagte:
»Ich kann ja nichts tun, Mutter, wenn ich eine Wunde bekomme. — Du weißt, daß ich meine Arme eben sehr nöthig brauchen werde, und ich fühle den Schlag noch, den mir Martial gab —«
Die Wittwe zuckte verächtlich die Achseln und that einen Schritt auf Franz zu.
»Komm mir nicht zu nahe, Mutter!« rief Franz wüthend aus, »oder Du mußt für alle Schläge büßen, die Du mir und Amandinen gegeben hast —
»Bruder, laß Dich lieber einsperren. — Ach Gott! schlage die Mutter nicht!« rief Amandine entsetzt aus.
Nicolaus erblickte in diesem Augenblicke auf einem Stuhle eine große wollene Decke; diese nahm er, schlug sie halb auseinander und warf sie geschickt Franz über den Kopf, so daß der Knabe von seiner Waffe keinen Gebrauch machen konnte.
Nun fiel Nicolaus über ihn her und trug ihn mit Hilfe seiner Mutter in den Keller.
Amandine war mitten in der Küche aus ihren Knien liegen geblieben. Sobald sie das Schicksal ihres Bruders sah, stand sie rasch auf und eilte freiwillig, trotz ihrer Furcht, zu ihm in den finstern Keller hinein.
Die Türe wurde hinter ihnen verschlossen.
»Der Martial ist Schuld, daß die Kinder jetzt ganz des Teufels sind«, sagte Nicolaus.
»Man hört seit heute früh in seiner Stube nichts mehr«, sagte die Wittwe und sie schauderte, »gar nichts —«
»Das beweist, Mutter, daß Du ganz recht thatest, als Du zu dem alten Ferot in Asnières sagtest, Martial liege seit zwei Tagen todtkrank im Bette. — Wenn es vorbei ist, wird man sich nicht wundern.«
Nach einer kurzen Pause sagte die Wittwe, gleichsam als hätte sie einem peinlichen Gedanken entgehen wollen:
»Ist die Eule hier gewesen, während ich in Asnières war?«
»Ja, Mutter.«
»Warum blieb sie nicht, um uns zu Roth-Arm zu begleiten? Ich traue ihr nicht.«
»Du trauest Niemandem, Mutter; heute ist Dir die Eule nicht recht, gestern hattest Du gegen Roth-Arm Einwendungen.«
»Roth-Arm ist frei und mein Sohn in Toulon; dennoch hatten sie den Diebstahl zusammen gemacht.«
»Das wiederholst Du fortwährend. — Roth-Arm ist davon gekommen, weil er schlau ist. Es ist ja ganz einfach. — Die Eule blieb nicht hier, weil sie um zwei Uhr bei dem Observatorium eine Zusammenkunft mit dem großen Manne in Trauer hat, für dessen Rechnung sie mit Hilfe des Schulmeisters und des kleinen Lahmen das junge Landmädchen entführt hat. Warum sollte die Eule uns verrathen, da sie uns Alles sagt, was sie anspinnt, wir aber ihr nichts sagen? Sie weiß nichts von der Badegeschichte, die wir jetzt vornehmen wollen. — Die Wölfe fressen einander nicht, Mutter. — Es gibt heute einen guten Tag; denke Dir, die Mäklerin, hat oft für 20 bis 30,000 Frcs. Diamanten in ihrem Strickbeutel — und ehe zwei Stunden vergehen, haben wir sie in dem Keller Roth-Arms. Dreißigtausend Francs! Bedenke!«
»Roth-Arm soll draußen vor seinem Wirtshause bleiben, während wir die Mäklerin halten?« fragte die Wittwe argwöhnisch.
»Wo soll er sonst sein? Wenn Jemand zu ihm kommt, muß er doch da sein und die Leute abhalten, dahin zu kommen, wo wir unsere Sache abmachen.«
»Nicolaus! —Nicolaus!« rief jetzt dessen Schwester draußen; »es kommen zwei Frauenzimmer —«
»Schnell, Mutter, Deinen Shawl, ich will Dich gleich mit hinübernehmen«, sagte Nicolaus.
Die Wittwe hatte statt ihrer gewöhnlichen Mütze ein schwarzes Tüllhäubchen ausgesetzt. Jetzt nahm sie einen grau und weiß carrirten großen Shawl um, schloß die KüchenTüre zu, legte den Schlüssel hinter einen der Laden im Erdgeschosse und folgte ihrem Sohne an den Landungsplatz.
Fast unwillkürlich warf sie, ehe sie die Insel verließ, noch einen Blick aus das Fenster Martial's; sie kniff dabei die Augenbrauen zusammen, biß sich auf die Lippe und murmelte, während sie schauderte: »es ist seine Schuld! — es ist seine Schuld.«
»Nicolaus, siehst Du sie — da unten? Eine Frau aus der Stadt und eine vom Dorfe«, sagte die Schwester, indem sie aus das Ufer hinüber aus Madame Seraphin und Marien-Blume zeigte, die auf einem Fußwege herabkamen.
»Wir wollen das Signal abwarten, damit nicht etwa eine Verwechselung passirt«, sagte Nicolaus.
»Bist Du blind? Erkennst Du die alte dicke Frau nicht, die gestern hier war? Sieh doch ihren orange Shawl! Wie schnell das Bauermädchen läuft! O, — die ist noch unerfahren! Man sieht es, daß sie nicht weiß, was sie erwartet —«
»Ja, ich erkenne die dicke Frau ... Wir müssen nun einig werden, Schwester, wie wir uns benehmen. Ich werde die Alte und die Junge in das Boot mit der Klappe nehmen, Du folgst mir in dem andern und ruderst so, daß ich mit einem Sprunge in Deinem Boote sein kann, sobald ich die Klappe in dem meinigen ausgestoßen habe.«
»Fürchte nichts; rudere ich denn das erste Mal?«
»Ich fürchte nicht zu ertrinken, Du weißt ja, wie ich schwimme, aber —wenn ich nicht zu rechter Zeit in das andere Brot spränge, könnten sich die Frauenzimmer in der Angst an mich anklammern und — ich habe keine Lust, mit ihnen zu gehen.«
»Die Alte winkt mit ihrem Tuche«, sagte das Mädchen; »sie sind jetzt am Ufer.«
»Komm, komm, Mutter«, sagte Nicolaus, indem er sein Boot losband; »komm her in mein Boot. — Die Beiden drüben werden dann nichts argwöhnen. Du, Schwester, springe in das andere und rudere tüchtig. — Da, nimm meinen Haken — lege ihn neben Dich und nun vorwärts!« sagte der Bandit, indem er in das Boot seiner Schwester eine lange Stange mit einer scharfen Spitze legte.
Nach wenigen Augenblicken erreichten die beiden Böte das Ufer, wo Madame Seraphin und Marien-Blume warteten.
Während Nicolaus sein Boot an einem Pfahle am Ufer anband, trat Madame Seraphin zu ihm und sagte leise und schnell zu ihm: »Sagen Sie, Madame Georges warte auf uns;« dann fuhr die Haushälterin des Notars fort:
»Wir haben uns etwas verspätiget —«
»Ja, Madame Georges hat schon mehrmals gefragt.«
»Sehen Sie, liebes Kind, Madame Georges wartet auf uns«, sagte Madame Seraphin, indem sie sich nach Marien-Blume umdrehete, der es trotz ihrem Vertrauen bei dem Anblicke der Wittwe und der beiden Kinder derselben etwas unheimlich zu Muthe wurde. Aber der Name der Madame Georges beruhigte sie wieder, und sie antwortete:
»Ich sehne mich eben so sehr, Madame Georges zu sehen; zum Glück dauert die Ueberfahrt nicht lange —«
»Die liebe Dame wird sich freuen!« fuhr Madame Seraphin fort. Dann wendete sie sich an Nicolaus und sagte: »Ziehen Sie Ihr Boot noch etwas näher heran, damit wir einsteigen können.« — Leise setzte sie hinzu: »Die Kleine muß durchaus ertrinken; kommt sie empor, so stoßen Sie sie nur wieder hinein.«
»Ja, ja; ganz unbesorgt! Wenn ich Ihnen winke, geben Sie mir Ihre Hand. — Sie sinkt dann ganz allem. Alles ist vorbereitet, und Sie brauchen nicht ängstlich zu sein«, antwortete Nicolaus leise. Ohne von der Schönheit und Jugend der Schallerin gerührt zu werden, reichte er dieser die Hand.
Das Mädchen stützte sich leicht darauf, und trat in das Boot.
»Nun Sie, Madame«, sagte Nicolaus zu Madame Seraphin.
Und er bot ihr ebenfalls die Hand.
War es Ahnung, Mißtrauen oder bloß die Besorgniß, nicht schnell genug aus dem Boote herausspringen zu können, wenn es Nicolaus sinken lassen würde, genug die Haushälterin des Notars sagte zu Nicolaus:
»Ich werde doch lieber in dem andern Boote überfahren —«
Und sie nahm ihren Platz bei der Schwester des Nicolaus.
»Wie Sie wollen«, antwortete Nicolaus mit einem ausdrucksvollen Blicke auf seine Schwester, woraus er sein Boot abstieß.
Die Schwester folgte ihm, als Madame Seraphin neben ihr war.
Die Wittwe stand unterdeß unbeweglich am Ufer, gleichgiltig bei diesem Anblicke, und sah, in Gedanken vertieft, nach dem Fenster Martial's hinüber, das durch die Pappeln hindurch zu erkennen war.
Die beiden Böte, deren erstes Marien-Blume und Nicolaus, das zweite Madame Seraphin und die Tochter der Wittwe trug, entfernten sich langsam vom Ufer.
III. Des Wiedersehens Glück.
Ehe wir dem Leser die Entwicklung des Drama's in dem Boote mit der Klappe berichten, müssen wir einmal umkehren.
Wenige Augenblicke nachdem Marien-Blume mit Madame Seraphin St. Lazarus verlassen hatte, war auch die Wölfin aus dem Gefängnisse entlassen worden.
In Folge der Empfehlungen der Madame Armand und des Direktors, welche sie für die gute That für die Mont-Saint-Jean belohnen wollten, hatte man der Geliebten Martial's die wenigen Tage erlassen, die sie eigentlich noch in dem Gefängnis zubringen sollte.
In dem Geiste dieses verdorbenen unbändigen Mädchens war übrigens eine vollständige Umwandlung vorgegangen.
Die Wölfin hatte ihr früheres Leben verabscheuen lernen, da ihr fortwährend das Bild des stillen, arbeitsamen Lebens vorschwebte, das Marien-Blume ihr geschildert hatte.
Ihr einziges Ziel, ihr steter Gedanke, gegen welchen sich alle ihre frühern schlechten Neigungen vergebens gesträubt hatten, war jetzt, mit Martial allein und verborgen im tiefen Walde zu leben.
Um diese schnelle und aufrichtige Bekehrung zu bewirken, hatte Marien-Blume nach ihrem gesunden Verstande so bei sich gedacht:
Die Wölfin, ein heftiges und entschlossenes Mädchen, liebte ihren Martial leidenschaftlich, und muß also mit Freuden die Möglichkeit ergreifen, aus dem schmachvollen Leben herauszukommen, dessen sie sich zum ersten Male schämt, und sich ganz jenem rauhen Manne zu widmen, dessen Neigungen sie sämmtlich in sich aufgenommen hat, jenem Manne, welcher die Einsamkeit aussucht aus Neigung, und um der Schande zu entgehen, welche auf seiner verbrecherischen Familie lastet.
Mit Hilfe bloß dieser Elemente, die sie aus ihrem Gespräche mit der Wölfin geschöpft, hatte Marien-Blume, indem sie der ungestümen Liebe und dem kühnen Charakter des Mädchens eine gute Richtung gab, eine Ehrlose in eine brave Frau umgewandelt. Denn ist es nicht der Wunsch einer braven Frau, nur an die Heirath mit Martial zu denken, um sich mit ihm in den Wald zurückzuziehen und da arbeitend, vielleicht unter Entbehrungen zu leben?
Nachdem die Wölfin freigelassen war, dachte sie an nichts, als ihren Mann, wie sie sich ausdrückte, wiederzusehen. Seit mehrern Tagen hatte sie keine Nachricht von ihm erhalten. In der Hoffnung also, ihn aus der Insel des Aussuchers zu treffen, und entschlossen, dort zu warten, wenn er nicht da sein sollte, stieg sie in ein Cabriolet, und ließ sich an die Brücke von Asnières bringen, über welche sie etwa eine Viertelstunde vorher gegangen war, als Madame Seraphin und Marien-Blume an dem Seineufer in der Nähe des Gypsofens erschienen.
Da Martial nicht kam, um die Wölfin in seinem Boote auf die Insel hinüber zu holen, so wendete sie sich an einen Fischer, den alten Ferot, der in der Nähe der Brücke wohnte.