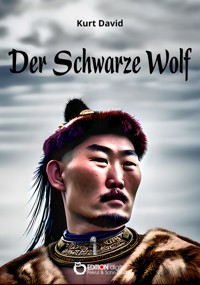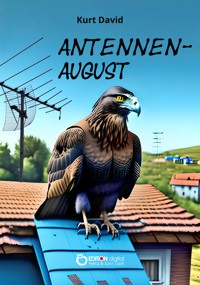5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tuja, die Tochter eines mongolischen Hirten, muss drei Tage in der Woche dem Fürsten dienen. Der Fürst hat ihrem Vater vier von sechs Schafen weggenommen. Alles als Strafe dafür, dass der Wolf zwei Schafe aus der Herde des Fürsten gerissen hat und Tujas Vater das nicht verhindern konnte. Tuja hört viel am Fürstenhof. Der Lama Bajar erzählt ihr von den Weißen, die nach der Revolution in Russland in ihr Land gekommen sind, um auch hier gegen die Roten zu kämpfen. Es brodelt im Land und am Fürstenhof.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Die goldene Maske
ISBN 978-3-96521-856-7 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1966 im Verlag Neues Leben Berlin als Heft 254 der Reihe „Das Neue Abenteuer“.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I.
Die Tempel standen am Südhang auf einem gewaltigen Felsplateau, umgeben von einer dicken weißen Mauer. Eine steinerne Treppe führte hinauf, an deren Ende zu beiden Seiten stumme Löwen hockten, Löwen, aus dem Granit der Berge gehauen, Löwen mit breitem unnatürlichem Rachen und ebenso unnatürlichen Augen, die gespenstisch hervorquollen. In den Löwenrachen lauerte die tückische Finsternis. Kein Sonnenfinger vermochte in sie einzudringen, kein Vogel schlüpfte in die Maulhöhle aus Stein, und hätte ein Mensch seine Hand in den weiten Schlund des Raubtieres gesteckt, er wäre lautlos auf die Treppe gestürzt und schmerzgekrümmt verstorben. Der Skorpion wachte in den toten Mäulern. Aber das war so bekannt wie gefürchtet, und alle, die zu den mächtigen Tempeln aufstiegen, blickten so ängstlich zu den beiden Löwen aus Granit, als könnten sie von ihnen selber gebissen werden.
Doch nun lebte in dieser Gegend ein mongolisches Mädchen namens Tuja. Tuja konnte zwar wie alle anderen Leute ihres Landes weder schreiben noch lesen und wusste von der Welt nicht viel mehr als die Schafe, die sie zu hüten hatte, aber Tuja besaß eine Eigenschaft, die kein anderer in ihrem Dorf mit ihr teilte: Sie fürchtete nichts, auch nicht die Götter, nicht die bösen Geister, nicht die heiße und nicht die kalte Hölle, mit der die Lamas in den Tempeln drohten. Gewiss, es gab manch tapferen Jüngling in ihrem Dorf, dem die Angst fremd war, der furchtlos Wölfe jagte, doch wenn er die Stufen zum Tempel emporstieg, duckte er sich. Ein Wolf war ein Wolf und eine Wölfin eine Wölfin, aber was war ein böser Geist, der zu töten vermochte, noch ehe man die Hand erhoben hatte? Tuja dagegen schritt aufrecht unter den Jünglingen zum Kloster der Lamas, und manchmal wirkte es wie Trotz, hinter dem nichts stand als die Freude am Trotz. Aber Tuja hatte noch eine andere Eigenschaft: Sie rang jeder Traurigkeit und jedem Leid noch ein Zipfelchen von Spaß ab. Davon hatten auch andere Freude, und darum war Tuja so beliebt im Dorf. In den Jurten flüsterten die Hirten mit ihren Frauen: Tujas Vorfahren seien sicher Bergmenschen gewesen, die so klein sind, dass sie mit dem Kopf gerade bis zum Steigbügel ragen, und die so klein geblieben sind, weil die Götter die Bergmenschen einer Aufsässigkeit wegen gestraft und sie nicht mehr haben wachsen lassen. An dieser Geschichte schien nicht mehr wahr zu sein, als dass Tuja eben fast so klein war wie die Leute jenes Stammes, der irgendwo in den fernen Bergen wohnte.
An einem frühen Morgen im Juni des Jahres 1921 ritt das Mädchen neben ihrem Vater zu den Tempeln. Obwohl schon die Sonne schien, war es kalt. Steif und steil stieg der Rauch aus den blechernen Rohren der Filzjurten. Bei den Schafen lagen die Hunde, gähnten, schüttelten sich. Ein Wasserkarren mit vorgespanntem Kamel, geführt von einem Jungen, knarrte aus dem Dorf und hinunter zum Fluss.
„Wenn der Fürst oder ein Angehöriger seiner Familie im Klosterhof steht’“, sagte der Vater, „schau ihm oder den Seinen nicht wieder so aufreizend ins Gesicht, sondern beuge deinen Kopf, wie es sich für uns geziemt, Tuja.“
„Ich werde zu den Tauben aufsehen, Vater.“
„Zu den Tauben? Wer spricht denn von den Tauben? Ich rede vom Fürsten und seinem Gefolge!“
„Aber den Fürsten, Vater, den werde ich ja gar nicht sehen, weder ihn noch sein Gefolge.“
„Woher willst du denn jetzt bereits wissen, dass er nicht im Klosterhof steht, Tuja?“
„Er kann dort stehen und er kann nicht dort stehen, Vater, einerlei, wo ich ja doch nur zu den Tauben aufschaue.“ Und noch bevor der verärgerte Vater etwas erwidern konnte, sagte das Mädchen: „Tauben sehen immer so vergnügt aus, und ich weiß auch, weshalb: Sie tun nur das, wozu sie Lust haben. Wünschen sie, sich auf eine der vergoldeten Tempelspitzen zu setzen, fliegen sie hinauf und sehen auf alles andere herab, auch auf den Fürsten und sein Gefolge, Vater, und …“
„Tuja!“
„... und wünschen sie, ein Lama möge sie auf der Schulter über den Klosterhof tragen, flattern sie zu seiner Schulter, und wenn sie hungrig sind, fressen sie den Mönchen sogar aus der Hand, und wenn sie schlafen wollen, schlafen sie, ohne dass sie jemand wecken dürfte, und wenn sie gurren wollen, gurren sie, ohne dass es jemand verbieten dürfte, und wenn sie nicht gurren wollen, gibt es niemand und niemand, der sie dazu zwingen kann, Vater.“
„Es sind ja auch heilige Tauben, Tuja!“
„Und der Fürst ist auch heilig!“
„Was redest du für einen Unsinn. Der Fürst ist Fürst, und allein die Taube ist heilig und …“
Erschrocken hielt der Alte inne. Das Mädchen lachte, stand aufrecht in den Steigbügeln und lachte, und der Vater fühlte wieder einmal, dass ihn seine Tochter in einen Hinterhalt gelockt hatte. Sie sagte: „So ist es recht, Vater. Also darf ich auch zu den heiligen Tauben aufsehen, ob der Fürst nun dasteht oder nicht, denn die Tauben sind heilig und der Fürst ist nur Fürst.“ Fröhlich schlug Tuja auf den Schimmel ein. Der Vater schüttelte den Kopf und dachte: So war ihre Mutter nicht.
Sie ritten nun schneller.
Freilich, dass der Alte seine Tochter ermahnt hatte, ja nicht wieder dem Fürsten aufreizend ins Gesicht zu sehen, sondern den Kopf zu beugen, war nicht grundlos geschehen. Er hatte es vor allem deshalb gefordert, weil die gierigen Wölfe aus jenem Teil der Fürstenherde, den er betreuen musste, zwei Schafe geholt hatten. Und die geringste Unachtsamkeit dem Fürsten gegenüber hätte diesen veranlassen können, nach seinen Schafen zu fragen. Es waren viele Wölfe gewesen, und er hatte hart um die Herde kämpfen müssen. Aber das kümmerte den Fürsten nicht.
Vater und Tochter näherten sich der Schlucht, die zum Kloster führte. Der Pfad wurde steiniger. Große Felsbrocken ragten aus dem mageren Gras der Steppe. Enzian und Edelweiß blühten ringsum. Geier stritten sich um einen Kadaver und krächzten; unter den mächtigen Schwingen, die erregt auf und nieder flatterten, beugten sich die Halme. Am Eingang der schattigen Felsenschlucht standen Tannen, still und einsam. Und plötzlich sprengten fünf Reiter hervor, aus den Bäumen, aus dem Gestrüpp, die Gewehre im Anschlag.
„Weiß oder Rot!“, schrie der eine, und sie hielten die Pferde an.
„Blau!“, antwortete Tuja, die sich über die Barschheit des Mannes ärgerte. Ihr Lachen schallte in der Schlucht.
„Dummkopf!“ Die Fremden hingen ihre Gewehre wieder über die Schulter. Tujas Lachen war wohl zu ihnen übergesprungen; denn sie lachten jetzt, wenn auch herablassend, so als bedauerten sie das Mädchen seiner Unwissenheit wegen. „Schwesterchen“, sagte der eine, und es klang sogar freundlich. „kannst du uns auch sagen, weshalb du ‚Blau’ geantwortet hast? Na?“
„Ich hätte auch Gelb sagen können!“
„Und vielleicht auch Grün?“ Er grinste.
„Nein, aber – Schwarz!“
„So! Und warum nicht Grün? Und warum nicht Rot? Und warum nicht Weiß?“
„Weil“, Tuja überlegte, verdrehte herausfordernd den Kopf, blickte zum Vater, der verdattert und schweigend auf seinem Pferde saß, „weil“, wiederholte sie, „ich nicht wüsste, weshalb ich die einen Grüne oder Rote oder Weiße nennen sollte.“
„Und wer sind die Gelben?“
„Die Lamas“, antwortete das Mädchen, „wir nennen sie ihrer gelben Kleider wegen so.“
„Und die Schwarzen?“
„Das sind die Fürsten. Sie tragen schwarze Gewänder. Und damit ihr nicht noch nach den Blauen fragen müsst, sage ich es euch gleich: Unser Himmel ist ewig blau, unsere Jurtentüren sind blau, also ist Blau unsere Lieblingsfarbe. Das solltet ihr wissen, wenn ihr von hier seid!“
„Ach was, wir kommen aus der Hölle! Mach Platz, kleine Göttin!“ Und während sie davonritten, schrie Tuja: „Und wer sind die Roten und die Weißen?“
„Das wird sich bald herausstellen“, kam es zurück. Zwischen ihnen und den fremden Reitern loderte der gelbe Staub in den Himmel.
Der Vater lobte seine Tochter ihrer Antworten wegen, und die Tochter tadelte ihren Vater nicht wegen seines Schweigens, sondern sagte nachdenklich: „Drei hatten so große Augen wie niemand hier im Land. Was waren es für welche?“
„Ich weiß es nicht, Tuja.“
„Sie schwiegen, Vater.“
„Hast du Yama, unseren fünfköpfigen Höllenrichter, schon mal reden hören?“, brummelte der Alte und ritt weiter.
Als sie eine Zeitlang still nebeneinander hergeritten waren, sprang das Mädchen vom Pferd, pflückte eine große gelbe Blume, steckte sie sich ins schwarze Haar, wo sie wie ein Stern leuchtete. „Gefällt sie dir, Vater?“
Der Alte sah flüchtig zu ihr hin, holte tief Luft und schwieg.
„Wart, Vater, ich hol mir noch eine. Zwei, über jedem Ohr eine, sieht schöner aus.“
„Gut, dass du nicht zehn Ohren hast, Tuja. Manchmal bist du noch wie ein Kind, wie so ein Hundejunges, das sich dauernd kugelt, das nach allen schnappt, das an der Lederleine zerrt, das immer bellt und jault, immer herumspringt, als wäre das Leben ein einziger Spaß!“
„Ist das schlecht, Vater?“