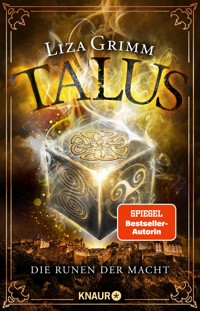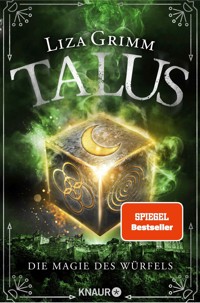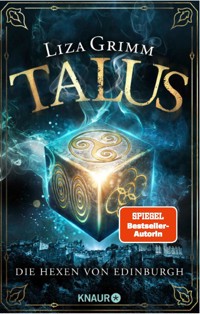9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Liza Grimms mitreißende Urban Fantasy-Saga für alle Fans von Marvels »Thor« oder den »Avengers« Was sagt man zu jemandem, der behauptet, einen vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen? Natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kára über eine Prophezeiung und das mögliche Ende Asgards. Stattdessen ergreift sie die Flucht. Und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Ray ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der List und Heimtücke, in die Geschehnisse einmischt, muss Ray auf einer abenteuerliche Reise ins Reich der Götter und Riesen herausfinden, ob sie wirklich eine Heldin sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Liza Grimm
Die Götter von Asgard
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was sagt man zu jemandem, der behauptet, einen vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen? Natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kára über eine Prophezeiung und das mögliche Ende Asgards. Stattdessen ergreift sie die Flucht. Und läuft dabei Tyr in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Ray ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen und Heimtücke, in die Geschehnisse einmischt, muss Ray auf einer abenteuerlichen Reise ins Reich der Götter und Riesen herausfinden, ob sie wirklich eine Heldin sein kann.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Basti. Für Oma & Opa. Für alle Helden Midgards.
Prolog
Trotz des lauten Schreis lief der Webstuhl weiter. Er kümmerte sich nicht darum, dass seine drei Herrinnen, die seit mehreren Jahrhunderten still und schweigsam das Gewebe beobachtet und gelenkt hatten, nun in heller Aufregung durch die halbdunkle Grotte liefen.
»Er ist golden«, flüsterte Urd. »Glänzend wie die Sonne!«, schrie Verdandi. »Unser Untergang.« Skuld erschauderte.
Die Nornen hatten versagt, und sie wussten, dass Odin diesen Fehler niemals verzeihen würde. Trotz ihrer Furcht begaben sie sich auf den Weg nach Asgard, denn das Schicksal der Götterwelt, das wussten sie, wog schwerer als ihre Angst vor Strafe.
Die Farben der Regenbogenbrücke leuchteten an diesem Tag nur stumpf und verwaschen. Selbst über Asgard schien eine dunkle Wolke zu liegen, wobei die Götter diese sicherlich noch nicht bemerkt hatten. Wie immer waren sie viel zu sehr mit ihrem Trinkgelage beschäftigt. Wer einmal tot war, musste nie wieder schlafen und konnte sich für den Rest der Ewigkeit an den Zweikämpfen und der Eberjagd erfreuen. Abend für Abend wurde der ruhmreiche Tag mit fässerweise Met und dem Fleisch der Jagd gefeiert, und noch bevor es wirklich dunkel wurde, ging die Sonne erneut auf, und alles begann von vorne. Selbst der Eber wurde zum Leben erweckt, um an jedem neuen Tag abermals zu sterben.
Es gab keine Nacht in Asgard. Keinen Schlaf. Und keine Langeweile. Odin mühte sich nach Kräften, seinen Gästen alles zu bieten, was sie verdienten, nachdem sie im Glauben an ihn ruhmreich im Kampf gestorben waren. In den Gewölben der Siegeshalle Walhall war jeder Tag ein großes Fest – doch die Ankunft der Nornen würde diese Feierlichkeiten beenden.
Die Seherinnen zögerten nicht einen Augenblick, als sie die heilige Brücke überquerten, die ihre Welt mit Asgard verband. Dabei war ihnen nur zu klar, dass Odins Zorn die Mauern aller zwölf Himmelsburgen erschüttern würde, sobald er ihre Nachricht hörte.
Die Schlösser waren aus purem Gold erbaut und mit glitzernden Edelsteinen verziert, ein Gebäude schöner als das andere, ein Triumph des Göttergeschlechts der Asen. Die Nornen aber hatten dafür keinen Blick. Hastig durchquerten sie die aus goldenen Speeren gefertigten Tore von Odins Burg, die den Namen Gladsheim trug, und betraten die goldgetäfelte Siegerhalle Walhall, an deren Decke die Schilder der ruhmreichsten Kämpfer hingen.
Die langen, goldenen Tische waren voll besetzt. Trotzdem würde immer Platz für Neuankömmlinge sein, denn der Raum verfügte über die Kraft, seine Größe nach seinen Besuchern zu richten. Dies war schon lange nicht mehr nötig gewesen. Die bereits anwesenden Götter verließen Walhall seit Jahrhunderten nicht mehr, und ebenso lange waren auch keine neuen Helden eingetroffen. So hatte Odin es den Nornen einst befohlen, und sie hatten sorgsam darauf geachtet, dass der Wunsch des Göttervaters erfüllt wurde. Bis heute.
Der Göttervater thronte am Kopf der Tafel neben seiner Frau Frigg und beobachtete das Schauspiel mit einem leuchtenden Auge und erhobenem Haupt. Obwohl er seit Jahrhunderten nicht mehr gekämpft hatte, trug er ein Schwert an seiner Seite und legte weder seinen Helm noch den Brustpanzer jemals ab. Als die Nornen den Saal betraten, hob er die Hand. Stille legte sich über alles. Die Kämpfer ließen ihre Waffen sinken, der Eber erstarrte in stummer Ehrfurcht, und die Walküren stellten vorsichtig die riesigen Krüge ab, in denen sie den Met darbrachten.
»Willkommen, meine Schwestern.«
Odin erhob sich und breitete die Arme aus.
»Urd, Verdandi und Skuld. Welch seltener Anblick.«
Als die Nornen bei ihren Namen genannt wurden, zuckten sie zusammen, doch auch jetzt hielten sie nicht inne und gingen unbeirrt weiter auf Odin und seine Gemahlin zu. Jeder der Krieger versuchte, einen Blick auf sie zu erhaschen, aber es war zwecklos, da die Nornen keine feste Gestalt hatten. Mit jedem Schritt veränderte sich ihr Äußeres, in jeder Sekunde waren sie jemand anderes. Dabei blieb ihre Erscheinung nicht immer menschlich. Eulenschnäbel blitzten auf, Schweineschnauzen stülpten sich nach vorne, eine Froschzunge suchte in der Luft nach Insekten.
Erst als sie vor Odin zum Stehen kamen, schlugen sie die Kapuzen ihrer grauen Umhänge zurück und manifestierten sich, sodass nur die zwei Götter vor ihnen ihre wahre Gestalt sehen konnten. Drei Frauen mittleren Alters. Sie wirkten zunächst unscheinbar, doch ein Blick in ihre Augen konnte jedem Lebewesen den Verstand rauben.
»Seid gegrüßt, Gottvater«, ergriff Urd das Wort.
»Setzt euch und genießt Speis und Trank! Heute ist ein neuer Tag des niemals endenden Festes!« Odin lächelte gütig, wobei seine blaue Iris aufblitzte. Die andere Augenhöhle war leer und schwarz wie die Nacht. In der Halle der Götter trug er einen prunkvollen goldenen Brustpanzer, eine Lederhose und einen roten Mantel mit goldenen Fäden. Auf seiner rechten Schulter thronte ein schwarzer Rabe, der die Nornen argwöhnisch musterte. Sein zweiter Rabe war nicht zu sehen.
»Es ist nicht die Zeit für Feste«, erwiderte Verdandi.
»Wir haben eine Nachricht, die wir Euch lieber hinter verriegelten Türen mitteilen würden«, fügte Urd schnell hinzu, bevor Verdandi weiterreden konnte. Verdandi war die mittlere der drei Schwestern und für ihre lose Zunge und fehlende Diplomatie bekannt. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte man, dass selbst eine Ziege geschickter in Verhandlungen vorging als die Norne, welche die Gegenwart repräsentierte.
»Was meint ihr damit?« Odin sprach nicht lauter, dennoch schien die Halle zu beben. Die Helden gingen hinter ihren Schilden in Deckung, als befürchteten sie einen Pfeilregen.
»Es wäre besser, wenn wir alleine sprechen«, wiederholte Urd.
Alle Anwesenden hielten den Atem an, als Odin die Lippen zusammenpresste und schließlich nickte. Dann führte er die Nornen durch eine große Silbertür hinter seinem Thron in einen Raum, der nur selten betreten wurde. Hier waren die Wände aus einem blauen Metall, das auf der Erde gänzlich unbekannt war. In der Mitte des Zimmers stand ein runder Tisch mit zwölf Stühlen. An den schillernden Farben und der kräftigen Aura erkannten die Nornen das Holz des Weltenbaumes und gingen in die Knie, um den Geschenken der heiligen Esche zu huldigen.
»Erhebt euch«, forderte Odin nach einer Weile und geleitete sie zu den Sitzplätzen.
»Wie ihr richtig bemerkt habt, hat Yggdrasil selbst mir diese Stücke geschenkt.« Er fuhr mit seiner kräftigen Hand über den Tisch, und eine sanfte Melodie erfüllte den Raum. Als Odin den Kontakt zum Holz unterbrach, verstummte das Lied. »Wer auf diesen Stühlen sitzt, muss die Wahrheit sagen. So setzt euch, ihr Kinder des Schicksals, und sprecht.«
Mit sichtlichem Unbehagen ließen die Schwestern sich nieder und rafften dabei ihre Umhänge, um nicht auf den Saum zu treten.
»Was habt ihr zu berichten?«, fragte Odin und sah die drei aufmerksam an.
Zur Antwort streckten die Seherinnen ihre linken Arme aus und legten sie auf den Tisch, die Handfläche nach oben gewandt. Zuerst Urd, anschließend Verdandi und letztendlich Skuld. Dann verschränkten sie ihre Hände ineinander, und als sie ihre Augen schlossen, erstarrten die Körper der Nornen, und sie begannen zu leuchten.
»Wir sahen«, begannen sie wie aus einem Mund zu sprechen, »einen goldenen Faden, gesponnen aus Heldenmut. Ein junges Menschenmädchen, das den Weg zu sich selbst noch nicht gefunden hat, aber bald finden wird. Ihr Faden war lange unscheinbar, aber jetzt, da sie fast erwachsen ist, schimmert ihr Heldentum unter der Oberfläche und wird bald erwachen.«
»Das kann nicht sein!« Wie die Nornen es vorhergesehen hatten, erzitterte ganz Asgard unter Odins Wutgeheul. »Ich habe euch aufgetragen, nie wieder einen goldenen Faden zuzulassen! Ein weiterer Held bedeutet unser aller Tod!«
Die Nornen lösten sich voneinander und schlugen die Hände vor ihre Gesichter. Ihre Körper zitterten.
»Der Faden ist einfach so aufgetaucht«, flüsterte Skuld. »Wir konnten nichts dagegen tun.«
»Dann werden wir jetzt etwas dagegen tun!«, donnerte Odin. Er flüsterte dem Raben auf seiner Schulter etwas ins Ohr, und der Vogel erhob sich gleich mit mächtigen Schwingen, um die anderen Götter zur Versammlung zu holen.
1
Schokolade. Sie brauchte jetzt ganz dringend Schokolade. Seit dem Beginn ihres Studiums hatte Rays Süßigkeitenkonsum stark zugenommen, aber das kümmerte sie in Augenblicken wie diesen nicht.
Während sie sich einen mit Karamell gefüllten Riegel in den Mund schob, füllte sie den Wasserkocher. Kamillentee mit Rum war neben einem Zuckerschock genau das, was sie jetzt benötigte. Dazu ein heißes Bad und gute Musik und ihr Tag wäre nur noch halb so schlimm. Ray hängte den Teebeutel in die Tasse, füllte sie mit Wasser auf und balancierte sie ins Badezimmer.
Dort platzierte sie die Kopfhörer auf dem Schrank und schloss ihr Handy an die Lautsprecher an, die über dem Waschbecken hingen. Als sie in der Wanne lag, schloss sie die Augen und seufzte. Versagt. Ihre Hände wanderten zu ihrem Handy auf der Ablage, öffneten das Telefonverzeichnis und schwebten über der Nummer ihrer Eltern.
Dann legte sie es weg, ohne anzurufen. Sie musste die Note nicht abwarten, um zu wissen, dass sie durchgefallen war. Immerhin hatte sie einen halbleeren Fragebogen abgegeben. Sie hörte bereits die Stimme ihrer Mutter im Ohr.
»Warum hast du dir keine Studiengruppe gesucht? Anna schwört darauf!« Anna, ihre perfekte Schwester. Anna, die sie irgendwann einfach hatte fallen lassen.
Ray nippte an ihrem Tee und verdrängte die Tränen. Sie wollte die Hilfe der anderen nicht.
Wenn ich es nicht alleine schaffe, habe ich den Erfolg nicht verdient. Ganz einfach.
Ihr Handy vibrierte. Ihre Mutter. Mit zitternden Fingern nahm Ray ab.
»Ja?«
»Hallo, Maus!«, trällerte Luise fröhlich. »Wie geht es dir?«
»Ganz gut«, log Ray und nahm einen weiteren Schluck Tee. Natürlich hatte ihre Mutter die Prüfung vergessen. Wahrscheinlich rechnete sie sowieso damit, dass Ray versagt hatte.
»Schön, schön. Hör mal: Dein Papa und ich fliegen morgen spontan zu deiner Oma. Nur damit du dir keine Sorgen machst.«
»Okay.« Zu gerne wäre Ray mit in die USA geflogen, um dem Alltagsstress zu entgehen. Allerdings hätte sie dann vorher ihren Eltern beichten müssen, dass sie die letzte Chance vermasselt hatte und somit nächstes Semester etwas anderes studieren musste. Schon wieder. »Ich wünsche euch viel Spaß! Grüß Grandma.«
Als sie aufgelegt hatten, überfiel Ray eine altbekannte Unruhe. Wie immer, wenn sich das schlechte Gewissen meldete, sobald sie ihre Mutter anlog. Sie stieg aus der Wanne, trocknete sich ab und schlüpfte in ihre Sportklamotten. Wenige Minuten später joggte sie durch die Münchner Straßen, überquerte rote Fußgängerampeln und ignorierte das wütende Gebrüll eines Fahrradfahrers, der wegen ihr so stark auf die Bremse treten musste, dass er das Gleichgewicht verlor.
Über ihr schien die Sonne an einem strahlend blauen Himmel, und die Luft duftete nach gegrilltem Fleisch und Sommer. Wie sie München verabscheute. Ray wusste, dass ihr Hass dieser wunderschönen Stadt gegenüber absolut ungerechtfertigt war. Aber wie sollte sie einen Ort lieben, an dem sie sich dauerhaft wie eine Versagerin fühlte? Es war bereits das zweite Studium, das sie nach zwei Semestern abbrach, und das nicht, weil sie es wollte, sondern weil ihre Leistungen so schlecht waren, dass sie zwangsexmatrikuliert wurde. Wenn ihre Eltern das erfuhren, würde sie sofort in ihr Heimatdorf in Hessen zurückkehren müssen. All ihre ehemaligen Schulkameraden würden erfahren, dass sie versagt hatte. Sie, die in der Schule damit geprahlt hatte, eines Tages eine berühmte Sängerin zu werden. Obwohl Ray wusste, dass diese Erkenntnis sie beunruhigen sollte, fühlte sie in ihrem Inneren nichts als Leere. Als hätte sie sämtliche Emotionen verloren.
Ray verlangsamte ihr Tempo und blieb stehen. Rechts von ihr ragte ein vierstöckiges gelbes Gebäude mit weißen Verzierungen in den Himmel. Das oberste Stockwerk besaß einen üppigen Erker, der Eingang zum Garten war mit einem schwarzen Eisentor verriegelt. Wohnungen, die sie sich niemals würde leisten können. In einer Gegend, in der Mittelschicht schon fast ein Schimpfwort war.
Als sie das Haus erkannte, atmete Ray auf. Ihre Beine hatten sie wie von selbst an den einen Ort gebracht, an dem sie jetzt sein wollte. Ray bog zwischen zwei protzigen Häusern nach links ab. Der Weg war so eng, dass Ray beide Gebäude hätte berühren können, wenn sie die Arme ausgestreckt hätte. Hinter der Gasse führte ein kleiner Trampelpfad steil hinab, der höchstens von Kindern oder rebellischen Teenagern benutzt wurde. Die Bewohner dieses Viertels nutzten den geteerten Weg weiter vorne, der zu einer gepflegten Anlage inklusive Kinderspielplatz und Sitzbänken führte.
Dieser versteckte und verwilderte Teil des Isarufers war seit mehr als einem Jahr Rays liebster Rückzugsort, wenn sie die Uni und den Alltag vergessen wollte. Den Trampelpfad säumten Brennnesseln und niedrige Büsche, deren Äste sich in Rays Jacke verfingen. Genervt riss sie sich frei und stapfte über den Kies, der sich vor ihr ausbreitete. Riesige Steine ragten hier aus dem Wasser. Zwischen ihnen sammelte sich der Müll, der an einer anderen Stelle achtlos in den Fluss geworfen worden war. Ray setzte sich auf einen der Steine, zog die Knie an den Oberkörper und fing an, hemmungslos zu weinen. Ihre Hände zitterten, und ihre Kehle schmerzte. Sie hatte die ganze Zeit geahnt, dass es passieren würde, und dennoch hatte sie die Realität mit voller Wucht getroffen. Trotz Albträumen und Befürchtungen war sie nicht annähernd vorbereitet gewesen. Ihre Augen brannten, und in ihrem Magen lag ein gigantischer Stein.
Mit zitternden Fingern holte sie ihr Handy hervor und starrte auf den Bildschirm, ohne zu wissen, wen sie überhaupt anrufen sollte.
Ray öffnete ihre Kontakte und durchsuchte sie systematisch nach jemandem, der hier in München wohnte. Sie brauchte mehr als bloße Trostworte am Telefon. In diesem Augenblick wünschte Ray sich nichts mehr als eine Umarmung. Je weiter sie in ihrer Kontaktliste voranschritt, desto schwerer wurde ihr Herz. Es gab niemanden, den sie anrufen konnte.
Ray steckte ihr Handy weg, legte den Kopf in den Nacken und schrie mit all ihrer Kraft, die noch übrig war. So laut, dass einige Raben auf der anderen Seite der Isar erschrocken in die Luft flogen. Die Tränen liefen über ihr Gesicht, ihr Herz stolperte, und ihr Atem ging unregelmäßig. Die Musik dröhnte laut in ihren Ohren, doch zum ersten Mal in ihrem Leben wollte Ray keinen Ton mehr hören. Sie riss sich die Kopfhörer herab und stopfte sie wütend in ihre Tasche. Wenn sie nur damals auf ihren eigenen Wunsch gehört und es an einer Musikschule versucht hätte! Stattdessen war sie dem Rat ihrer Eltern gefolgt und hatte etwas Vernünftiges studiert. Als Folge hatte sie sich selbst verraten und ihre Eltern enttäuscht. Zuerst hatte sie in Jura versagt und jetzt in Architektur.
Eine ganze Weile saß sie so da, stumm auf die Isar starrend und die Raben am anderen Ufer beobachtend, bis ihr Magen laut knurrte. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass sie mehr als zwei Stunden bewegungslos in dieser unbequemen Haltung verharrt hatte, obwohl es sich für sie so anfühlte, als wären nicht einmal fünf Minuten vergangen.
»Ich bin so eine Versagerin«, flüsterte sie.
»Erfolg ist immer Ansichtssache«, widersprach jemand hinter ihr.
Erschrocken drehte Ray sich um. Seit sie hierherkam, war sie noch nie einem anderen Menschen begegnet. Jetzt aber stand vor ihr eine junge Frau mit wilden roten Locken. Sie trug eine Jeans mit Löchern an den Knien, schwarze Turnschuhe und ein schlichtes dunkles Top, das nicht nur ihre Brüste, sondern auch ihre bemerkenswert durchtrainierten Oberarme betonte. Sie musterte Ray aus erstaunlich grünen Augen, und in ihrem Blick glaubte Ray Mitleid zu erkennen.
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte die Fremde, und zu ihrem eigenen Erstaunen nickte Ray. Bei aller Sehnsucht nach Nähe – sie sprach nicht gerne mit Menschen, die sie nicht kannte. In ihrem Zustand schon gar nicht. Dann lieber allein sein. Vielleicht war das sowieso das Beste. Der Schmerz in ihrer Brust saß tief, und es schien ihr, als könnte er sie von innen zerreißen. Als die Fremde nichts mehr sagte, legte Ray ihre Stirn auf ihre Knie und seufzte. So verharrte sie eine ganze Weile.
»Möchtest du darüber reden?«
Ray hob überrascht den Kopf. »Interessiert dich das wirklich?«, entgegnete sie resigniert und klammerte sich noch fester an ihre Beine.
»Ja.«
Die Antwort kam so schnell und steckte so voller Wärme, wie Ray es noch nie zuvor in einer einzelnen Silbe erlebt hatte. Unwillkürlich dachte sie, dass diese Frau eine großartige Sängerin wäre. Ray schob sich die zerzausten dunklen Haare aus der Stirn und sah die Fremde mit neuem Interesse an.
»Ich bin Kára«, sagte die andere und hob einen Mundwinkel nach oben. Ray hatte noch nie ein freundlicheres Lächeln gesehen. Der Name klang seltsam, doch da Ray ebenfalls einen ausländischen Namen trug, wusste sie, wie unangenehm es war, wenn jemand deshalb genauer nachfragte.
»Ich bin Rachel«, erwiderte sie. »Aber die meisten nennen mich Ray.« Erst jetzt registrierte sie, wie kratzig ihre Stimme klang. Auch Kára musste es bemerkt haben, denn sie kramte in ihrem Rucksack und holte eine Wasserflasche hervor.
»Hier, trink erst mal.«
Ray nahm das Angebot dankbar an und leerte die Flasche mit wenigen Zügen bis zur Hälfte. Leicht beschämt gab sie das Behältnis zurück.
»Danke«, flüsterte sie und wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln. Sie atmete ein paar Mal kontrolliert durch und zwang sich dann wie so oft zu einem Lächeln. »War ein doofer Tag.«
Kára antwortete nicht gleich darauf. Eine ganze Weile schwiegen sie beide und starrten auf das glitzernde Wasser.
»Wenn es mir schlecht geht, mache ich Musik«, sagte Kára irgendwann. »Das lenkt mich ab.« Sie lächelte schief. »Manchmal ist Ablenkung das Einzige, was hilft, die Zeit zu überstehen, bis die Wunden heilen.«
Ray sah Kára überrascht an. »Du bist Musikerin?«
Kára setzte ihre Ellbogen auf ihre Knie, damit sie ihren Kopf in die Hände stützen konnte, und nickte leicht. »Für mich gibt es nichts Schöneres als Musik. Schneller Rhythmus, sanfte Töne … Wenn ich Musik höre, sind alle Probleme plötzlich ganz klein. Es fasziniert mich, dass jede Kultur ihre eigene Musik hat und sogar eigene Instrumente entwickelt. Die Menschen haben sich in den letzten Jahrtausenden so sehr verändert, aber die Musik war immer da. Ich glaube sogar, dass die Musik bereits vor den Menschen existierte …« Kára seufzte. »Tut mir leid, das hört sich für dich bestimmt total verrückt an. Außerdem hast du offensichtlich gerade ganz andere Probleme.«
»Überhaupt nicht!«, beeilte Ray sich zu sagen. »Mir geht es genauso.« Tief in ihr regte sich ihre Leidenschaft zur Musik und verdrängte die traurigen Gedanken tatsächlich für einige Sekunden. Dann aber kam der Schmerz wie ein Bumerang mit solcher Wucht zurück, dass Ray zusammenzuckte und die Lippen fest zusammenpresste.
Nein, nicht mehr drüber nachdenken.
»Bist du aus München?«, fragte sie hastig, damit Kára weitersprach und sie von dem Chaos in ihrem Inneren ablenkte.
»Nein. Ich war nur für einen Auftritt hier, heute Abend geht es zurück nach Berlin«, erwiderte Kára, und Ray war ihr dankbar, dass sie sich um einen lockeren Tonfall bemühte. Doch noch während Kára sprach, regte sich in ihr zugleich ein anderes unangenehmes Gefühl. Eifersucht.
»Gutes Aussehen, wunderschöne Stimme, Auftritte und Berlin. Ist eine perfekte Schwester nicht genug?« Sie stieß einen abfälligen Laut aus und dachte an Anna, die sich nicht mehr bei ihr gemeldet hatte, seit sie nach München gezogen war.
Als sie Káras verwirrte und zugleich betroffene Miene sah, schalt Ray sich sofort selbst, und dafür hasste sie Kára noch mehr. Wieso war dieses hübsche, talentierte und höchstwahrscheinlich erfolgreiche Wesen auch noch so nett zu ihr?
»Ich wollte dir nicht wehtun«, flüsterte Kára, und Rays Wut verpuffte genauso schnell, wie sie gekommen war. Anna hatte sich nie für Rays Probleme interessiert. Verdammt. Dieses Wechselbad der Gefühle war schlimmer als jede Periode, die sie jemals gehabt hatte.
»Du kannst nichts dafür«, antwortete sie wahrheitsgemäß und lenkte ihren Blick wieder auf die Isar. »Momentan hasse ich einfach mein Leben.«
»Ach, weißt du, im Gegensatz zu Walhall ist dein Leben hier gar nicht so schlecht«, entgegnete Kára mit einem Achselzucken. »Die Götter rennen in ihr Verderben und tragen dabei die Nase noch so hoch, dass sie Loki nicht mal mehr sehen.«
Ray blinzelte verblüfft und starrte Kára mit offenem Mund an, ehe sie in schallendes Gelächter ausbrach. Kára stimmte ein, und als sie lachte, wurde Ray sofort warm ums Herz.
»Du interessierst dich für Mythen?«, fragte Ray und war froh, dass Káras gute Laune den Schmerz in ihrem Inneren etwas milderte. Wie eine warme Tasse Tee nach einem langen Wintertag im Schnee. Fehlte nur noch der Honig. Oder der Rum.
Káras Augen funkelten. »Ich liebe sie. Mythen, Sagen und Legenden stecken voller Wahrheiten.«
Ray rang ihren Mundwinkeln ein schiefes Lächeln ab. Diese schrullige Eigenart machte Kára auf seltsame Art liebenswert.
»Alles okay?«
»Klar«, antwortete Ray, um Káras Sorgenfalten von ihrer Stirn zu wischen.
»Das klingt für mich aber nicht danach. Bist du dir sicher, dass du nicht darüber reden willst?«
Einmal mehr war Ray überrascht. Sie war es nicht gewohnt, dass jemand ihre Maskerade durchschaute oder sich wirklich für ihre Probleme interessierte.
»Ich«, setzte sie an und zögerte, ob sie Kára wirklich die Wahrheit sagen sollte.
»Ja?«, hakte Kára nach und wirkte dabei so ehrlich interessiert, dass Ray ihre Zurückhaltung kurzerhand über Bord warf und ihr alles erzählte. Von ihrem großen Traum, Sängerin zu werden, von Annas perfektem Leben und ihrem eigenen eisernen Willen, ihren Weg allein zu gehen und zu zeigen, dass sie auch in irgendetwas gut war. Ja, sogar davon, dass Kára sie für einen grässlichen Moment an ihre Schwester erinnert hatte und sie deshalb so patzig reagiert hatte.
Als Ray verstummte, verfielen die beiden jungen Frauen in Schweigen. Ray musterte Kára verstohlen, wie sie die Vögel beobachtete und dabei mit einer losen Haarsträhne spielte. Mit dem wildbewachsenen Isarufer im Hintergrund und dem grauen Stein, auf dem sie saß, glich die Rothaarige einer Meerjungfrau. Ohne dass sie es wollte, schnürte schon wieder der Neid Ray die Kehle zu. Mit dieser Frau würde sie niemals mithalten können. Kára hatte unrecht – natürlich gab es Versager. Und natürlich war es leicht, klug daherzureden, wenn man von Natur aus schön, klug und vermutlich auch auf jede andere denkbare Art privilegiert war. Sie hätte ihre Geschichte einfach für sich behalten sollen. »Hey, danke, dass ich dir den ganzen Mist erzählen konnte«, murmelte Ray und wollte sich schon aufrappeln und einfach gehen. Doch gerade da drehte sich Kára zu ihr um.
»Kein Problem.« Sie lächelte, es war ein so warmherziges und geradezu liebevolles Lächeln, als wären sie und Ray seit Ewigkeiten beste Freundinnen. Und seltsamerweise hatte Ray in diesem Moment das Gefühl, dass das gar nicht so falsch war. »Zu mir kannst du immer ehrlich sein. Ich überlege nur, wie ich dir helfen kann, wenn du es eigentlich gar nicht willst.«
Noch immer verblüfft von ihren eigenen Empfindungen hob Ray abwehrend die Hände. »Du hast mir schon genug geholfen.« Entschlossen stand sie auf und klopfte sich den Dreck von der Hose. »Aber so langsam sollte ich nach Hause gehen und Pläne für meine Zukunft machen. Ein paar neue Studiengänge raussuchen. Solche Dinge eben.«
Sie warf noch einen Blick zu Kára. Es war wirklich merkwürdig, aber etwas in ihr wollte nicht, dass diese fremde junge Frau, die sich gar nicht fremd anfühlte, so schnell wieder aus ihrem Leben verschwand. Aber das war doch Unsinn … und bestimmt auch nicht in Káras Sinne.
»Komm einfach mit mir nach Berlin.«
Der Vorschlag kam so unerwartet, dass Ray in ihrer Bewegung innehielt und Kára aus großen Augen anstarrte.
»Ist das dein Ernst?«
»Klar, warum nicht?«, stellte Kára die Gegenfrage. »Mach mal was Verrücktes. Du hast dein Leben bisher nach deinen Eltern gerichtet und wolltest deiner Schwester nacheifern, statt deinem Traum zu folgen.«
Ray wollte unzählige Gründe aufzählen, die dagegen sprachen, aber ihr fiel kein einziger ein. Kára sah Ray tief in die Augen, und plötzlich schrie etwas tief in Ray danach, einfach mit ihr nach Berlin zu gehen. Fieberhaft suchte sie nach Argumenten, um das Angebot abzulehnen, aber ihr Verstand war wie leer gefegt.
»Ja, warum nicht?«, hörte sie sich sagen. Gleichzeitig breitete sich ein angenehm warmes Gefühl in ihrer Magengrube aus. Eine Mischung aus Aufregung und Erleichterung.
Ja, sie würde nach Berlin gehen. Wie sie es sich immer erträumt hatte.
2
Die Stimme der Ansagerin tönte durch den Bahnhof und verkündete, dass ihr Zug einfuhr. Ray spürte, wie sich ihr Bauch zusammenzog. Plötzlich überkamen sie Zweifel. Sie konnte doch nicht mit einer jungen Frau, die sie vor wenigen Stunden erst kennengelernt hatte, in eine völlig fremde Stadt fahren, um dort ein neues Leben zu beginnen. Oder?
Ein junges Paar drängelte sich an ihr vorbei, die Hände ineinander verschränkt, als würden sie einander nie wieder loslassen wollen. Das Mädchen kicherte.
Ray wandte den Kopf zu Kára, die sie besorgt mit ihren seegrünen Augen musterte. Ein Lächeln voller Verständnis umspielte ihre Lippen, und Ray konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass sie dieser Frau überallhin folgen konnte. Ray lächelte und sah wieder zu dem Pärchen, das zu einem anderen Bahnsteig eilte. Dabei biss sie erneut in die Brezel, die sie sich gekauft hatte. Die Papiertüte hatte sie direkt entsorgt.
Der Zug hielt unter lautem Getöse, und die Menschen drängten zu den Türen.
Während die anderen Reisenden sichtlich ungeduldig darauf pochten, so schnell wie möglich den Zug zu entern, überkam Ray eine angenehme Ruhe. Sie warf einen Blick zu Kára, die sich ebenfalls von der allgemeinen Aufbruchstimmung nicht anstecken ließ. Mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen stand sie da und wippte mit dem Fuß zu einem Beat, der nur in ihrem Kopf existierte. Als sie Rays Blick bemerkte, schmunzelte sie, nickte zu einer älteren Frau, die über die Ungehobeltheit der Jugend schimpfte, und verdrehte die Augen. Ray grinste.
Als sie schließlich den Zug betraten, folgte Ray Kára durch das Abteil. Dabei entging ihr nicht, dass sämtliche männliche Wesen in ihrem Alter der jungen Sängerin hinterherschauten. Diese bemerkte die Aufregung um ihre Erscheinung nicht und bahnte sich unbeirrt ihren Weg vorbei an Koffern, die mitten im Durchgang standen, und Reisenden, die darüber stritten, wer welchen Platz reserviert hatte.
Schließlich kamen sie bei den abgetrennten Abteilen an, die lediglich über je sechs Sitzplätze verfügten, und Kára schob eine der Türen auf.
Mit einem theatralischen Seufzen ließ sie sich auf ihrem Sitzplatz direkt am Fenster nieder.
»Bin ich froh, wenn wir da sind«, sagte sie und sah an Ray vorbei nach draußen auf den Bahnsteig, als suche sie nach jemandem.
»Soll noch jemand kommen?«, fragte Ray und wandte sich ebenfalls um. Als sie wieder zu Kára sah, schüttelte diese den Kopf, dass ihre rote Lockenpracht wild umherflog.
»Nein, ich dachte nur, der eine Kerl da draußen wäre ganz niedlich.«
Ray runzelte die Stirn, erwiderte aber nichts. Sie hatte nie groß Ausschau nach Jungs gehalten.
Der Zug setzte sich in Bewegung, der Münchner Bahnhof glitt an der Scheibe vorbei, und Kára rührte sich keinen Millimeter. Unruhe überfiel Ray von Neuem. Sie begann, mit dem Fuß zu wippen.
»Kommst du ursprünglich aus Berlin?«, fragte sie, um sich abzulenken.
»Nicht direkt.« Nun wandte auch Kára den Blick vom Fenster ab und sah auf ihre zierlichen Hände, die sie im Schoß gefaltet hatte. »Aber Berlin ist eine wunderschöne Stadt. So viele Menschen, so viel Kreativität. Die Leute und die Stadt verändern sich so schnell …«
Ihre Augen leuchteten bei jedem Wort wie die silberne Kette mit dem grünen Stein, die sie um den Hals trug, doch dann verstummte sie abrupt und riss die Augen so weit auf, als hätte sie ein riesengroßes Geheimnis verraten.
»Das klingt wirklich traumhaft«, bekräftigte Ray und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Ich war leider noch nie dort.«
In den Tiefen ihres Verstandes regte sich kurz das Gefühl, dass Kára sich irgendwie seltsam verhielt. Aber so schnell der Gedanke gekommen war, verschwand er wieder, sobald sich ihre Blicke trafen.
»Bei mir ist es auch schon eine ganze Weile her.«
»Warst du auf Tour?«, fragte Ray und wunderte sich gleichzeitig, warum Kára ohne Gepäck unterwegs war. »Wo sind eigentlich deine Koffer?«
»Die habe ich mit der Post verschickt, und sie sind schon in Berlin«, antwortete Kára. »Ich schleppe nicht so gerne.«
Ray kam nicht umhin, Káras Selbstsicherheit zu bewundern. Auf die Idee, den Koffer mit der Post zu schicken, wäre sie vermutlich nie gekommen. Kára schien in jedem Punkt erfahrener, und Ray kam sich neben ihr wie eine unbeholfene Schülerin vor. Wie sie das wurmte.
»Warum hast du mir eigentlich geholfen?«, fragte Ray.
»Hätte das nicht jeder getan?«, entgegnete Kára und hob beide Augenbrauen. »Das soll jetzt nicht böse klingen, aber du hast wirklich nicht gut ausgesehen. Ich finde, man sollte alles in seiner Macht Stehende tun, um Menschen zu helfen.«
»Das ist eine sehr«, setzte Ray an und suchte nach dem passenden Wort, »noble Einstellung. Die meisten wären einfach weitergegangen und hätten mich nicht einmal angeschaut. Aber du motivierst mich sogar, endlich das zu tun, was ich wirklich will. Ich meine … Danke. Wirklich. Danke.«
Kára schüttelte den Kopf. »Du musst mir nicht dankbar sein. Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe.«
Sie legte den Kopf schief und sah Ray eindringlich an, und einen Augenblick lang wollte Ray nachfragen, was sie damit meinte – was für einen Grund mochte jemand wie Kára haben, sich über eine Begegnung mit jemandem wie Ray zu freuen? Aber dann hatte sie das Gefühl, dass sie die Antwort vielleicht lieber unausgesprochen lassen wollte.
»Ich hör ein bisschen Musik, okay?«
Als Kára nickte, suchte Ray ihre Kopfhörer und setzte sie sich auf. Kurze Zeit später dröhnte ihr der Bass in den Ohren und ließ die Realität vibrieren, bis sie sich mit Rays Träumen vermischte.
Etwas berührte Rays Arm und unterbrach einen wirren Traum, in dem sie ihre Jura-Prüfung auf Japanisch ablegen musste. Eine Sprache, die sie mal lernen wollte, aber nie gemeistert hatte. Ray schlug die Augen auf und schloss sie sofort wieder, da die grelle Beleuchtung des Abteils unangenehm brannte. Sie hatte gar nicht mitbekommen, dass es dunkel geworden war. Wie lange hatte sie geschlafen? Sie blinzelte in das Licht, hielt sich die Hand vor den Mund und gähnte, dann setzte sie ihre Kopfhörer ab.
»Wo sind wir?«, fragte sie mit belegter Stimme und trank einen Schluck Wasser aus der Flasche, die sie am Münchner Bahnhof gekauft hatte.
»Wir kommen gleich in Berlin an.«
Sofort war sämtliche Müdigkeit wie weggewischt, und Ray blickte aus dem Fenster. Es war dunkel, und zuerst sah sie nur ihr eigenes Gesicht als Spiegelung in der Finsternis. Doch nach einer Weile konnte sie einzelne Straßenlaternen und Gebäudeumrisse erkennen, die sich von der Dunkelheit abhoben. Im Gegensatz zu München wirkte Berlin vor allem eines: heruntergekommen. Die Betonfassaden waren voller Graffiti, und alles schien zerfallen, aber auf eine Art und Weise, die Ray sofort in ihren Bann zog. Sie konnte sich nicht entscheiden, was sie mehr faszinierte: die Stadt oder die exzentrischen Personen, die sie an den Bahnhöfen, an denen der Zug vorbeiraste, erkennen konnte. Sie sah einen Jongleur, der mit Bierflaschen seine Kunststücke vorführte. Einen alten Mann mit spitzem Hut und langem Bart, der finster in die Nacht starrte. Bunte Haare und ausgefallene Klamotten waren keine Seltenheit. Steampunks, Cybergoths, Lolitas. All die Kleidungsstile, von denen sie in München irgendwann einmal gehört hatte, waren hier anzutreffen.
Schließlich wurden sie langsamer und fuhren in den Berliner Hauptbahnhof ein. Sie standen auf und reihten sich in die Warteschlange ein, die sich vor den Zugtüren gebildet hatte. Ray lehnte sich nach hinten gegen eines der Fenster und legte den Kopf in den Nacken. Sie fühlte sich seltsam ausgelaugt. Der ganze Stress der letzten Monate stürmte auf sie ein, jede einzelne verzweifelte Stunde, in der sie auf Unterlagen gestarrt hatte, ohne wirklich zu lernen. Jede Minute, in der sie versucht hatte, ein weißes Dokument mit ihrer Seminararbeit zu füllen, aber nichts weiteres als eine Überschrift zusammengebracht hatte.
Als sie endlich den Zug verlassen hatten, führte Kára sie zielsicher über Rolltreppen zu einem weiteren Gleis, an dem die S-Bahnen fuhren, und löste auch für Ray ein Ticket, während diese nichts weiter tun konnte, als müde die Augen zu schließen. Was war nur mit ihr los? Sie zwang sich, wach zu bleiben, indem sie einen jungen Mann mit langen Rastalocken und weiter Leinenhose beobachtete, der laut ein ihr unbekanntes Lied sang. Keiner der anderen Passanten beachtete ihn.
Ray spürte die Erschöpfung in jedem ihrer Glieder. Sie brauchte dringend einen warmen Tee, ein weiches Bett und entspannte Musik. »Wir fahren nicht lange«, beruhigte Kára sie, als könnte sie Rays Gedanken lesen.
»Wohnst du allein?«, fragte Ray. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Kára Single war, und die Wohnung mit einem Paar zu teilen, war keine besonders verlockende Vorstellung. Vielleicht konnte sie doch ein billiges Motel irgendwo auftreiben.
»Na ja …«, setzte Kára an, als gerade die S-Bahn einfuhr. Sie stiegen ein und setzten sich auf zwei Sitze, die hochklappbar waren und so Raum für Fahrräder boten, falls er benötigt wurde.
»Na ja?«, bohrte Ray nach, während Kára dem Musiker mit der Rastafrisur zulächelte, woraufhin dieser noch lauter sang.
»Na ja«, wiederholte Kára. »Momentan habe ich gar keine Wohnung, ehrlich gesagt.«
Ray spürte, wie ihr der Magen nach unten rutschte. »Willst du mich verarschen?« Wenn die schräge Musik des unbekannten Musikers nicht durch die Bahn getönt wäre, hätte man Ray am anderen Ende des Abteils noch gehört, aber so schüttelte lediglich ein älterer Herr, der ihnen gegenübersaß, den Kopf. Ray stutzte. Ein bekiffter Musiker wurde toleriert, aber sie durfte nicht schreien? Gerade als sie dem Mann diese Erkenntnis um die Ohren hauen wollte, legte Kára ihr eine Hand auf den Unterarm.
»Es ist alles etwas komplizierter. Ich war schon lange nicht mehr hier. Aber ich weiß, wo wir heute Nacht schlafen können. Mach dir keine Sorgen.«
»Du bist echt seltsam.« Ray lehnte den Kopf gegen die Glasscheibe hinter ihr und seufzte. Sie hatte keine andere Wahl, als Kára zu vertrauen. »Dieser Tag macht mich fertig.«
Als sie endlich ausstiegen, war Rays Laune auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Sie fühlte sich wie in einem schlimmen Albtraum. Der Geruch von Urin stieg ihr in die Nase, als sie um eine Straßenecke bogen, und Rays Magen rebellierte schmerzhaft. Seit der Brezel hatte sie nichts mehr gegessen, und dieser Augenblick am Münchner Bahnhof kam ihr vor, als stammte er aus einem anderen Leben.
Während Kára sie durch die Berliner Straße führte, versuchte Ray sich an den heutigen Morgen zu erinnern. Ihr Kopf dröhnte. Sie war aufgestanden und hatte einen Kamillentee zur Beruhigung getrunken. Und dann? Die Prüfung, die sie versaut hatte. Ein weiterer Tee mit Rum. Natürlich. Das Gespräch mit ihrer Mutter. Die Isar. Kára. Warum spürte sie keinerlei Verbindung zu diesen Ereignissen?
Ray sah auf ihre Hand und erstarrte, als sie diese nur schemenhaft wahrnahm. Auch die Lichter um sie herum verschwammen zu einer undeutlichen Mischung aus Rot, Gelb und Schwarz. Zu einem Flimmern.
»Ray?«
Sie fühlte sich, als wäre sie betrunken.
Eine Straßenlaterne tauchte über ihrem Kopf auf. Die Welt war ein wogendes Meer.
»Ray?«
Ray konnte nicht antworten. Káras Stimme ging in ein unverständliches Rauschen über, dann kippte die Welt, und alles wurde schwarz.
»Man sollte meinen, dass du die Dosierung inzwischen hinbekommst.« Eine unbekannte, flüsternde Stimme holte Ray aus ihrem traumlosen Schlaf.
»Das liegt nicht an mir. Ihre Gefühlswelt war in Aufruhr, deshalb hat sie so sensibel reagiert. Irgendwie musste ich sie ja zum Mitkommen bewegen.«
»Eigentlich sollst du mit dieser Fähigkeit Menschen zu ihren Ahnen und nicht in meine Wohnung bringen.«
»Ich weiß, ich weiß, aber …«
»Ich glaube, deine Freundin wird wach.«
Ray setzte sich auf und hielt sich den brummenden Kopf. Es fühlte sich an, als hätte jemand mit einem Hammer dagegen geschlagen. Sofort stieg ihr der Geruch nach frisch gemähtem Gras und Lavendel in die Nase, was ihre Kopfschmerzen seltsamerweise deutlich linderte.
Neugierig und leicht verwirrt sah sie sich in der neuen Umgebung um. Sie befand sich in der Wohnung eines Menschen, der offensichtlich die Natur liebte. Die Einrichtung war weitgehend aus unbehandeltem Naturholz gefertigt, inklusive der Leiter, die zu einer Plattform führte, die sich an eine Wandhälfte des Raumes schmiegte. Rays Blick glitt nach oben, und sie stellte mit Erstaunen fest, dass die Decke knapp drei Meter über ihr war. Ohne das kunstvolle Wandgemälde, welches einen Sommerwald darstellte, hätte die Wohnung wie eine Halle gewirkt, in der zufällig ein paar Möbel standen. Die Ebene befand sich ungefähr zwei Meter über dem Boden, weshalb darunter genügend Platz für eine Küche war, in der Kára und ein Mann standen. Er war so hochgewachsen, dass er sich leicht ducken musste, und Ray war sich sicher, dass die eingezogene Ebene nicht seine Idee gewesen war. Seine schneeweißen, langen Haare bildeten einen harten Kontrast zu seinem alterslosen Gesicht. Er durchdrang Ray mit eisgrauen Augen, die ihr einen Schauer über den Rücken jagten. Trotz der unbequemen Haltung strahlte er eine Würde aus, die Ray unter die Haut ging. In ihrem Kopf häuften sich die Fragen, aber keine drang über ihre Lippen.
Schließlich ergriff der Fremde wieder das Wort.
»Ich werde dann jetzt zurückgehen. Meine Kraft reicht in dieser Welt nicht mehr lange. Und langsam fällt es den Menschen sowieso auf.«
»Danke dir. Für alles. Auch dafür, dass du Ray hierhergetragen hast«, antwortete Kára, und Ray schoss das Blut ins Gesicht. Sie erinnerte sich wieder daran, wie sie ihr Bewusstsein verloren hatte. Der Gedanke, in den Armen dieses abweisenden Kerls gelegen zu haben, war beunruhigend.
»Ich werde nur noch schnell eine Waffe einpacken«, sagte er.
Rays Kinnlade klappte nach unten. Und als Kára mit einem wissenden Lächeln und einer einladenden Geste reagierte, sprang Ray vom Sofa und wich vor dem Fremden zurück. Dieser würdigte sie keines Blickes und schritt an ihr vorbei, als wäre sie nicht existent. Dann öffnete er einen massiven Holzschrank, der an der weißen Wand hinter Ray stand, und Ray holte tief Luft. Ihr funkelten zwei Schwerter entgegen, die an der Türinnenseite hingen. Dann aber erinnerte sie sich an die Cosplay-Gruppe, die sie mal bei einem Rock-Festival kennengelernt hatte, und atmete erleichtert aus. Berlin war voll mit schrägen Typen – natürlich mussten auch ein paar Mittelalterfans dabei sein, die ihr Hobby zu ernst nahmen. Der Mann schulterte einen Bogen sowie einen Köcher mit Pfeilen, wie Ray sie bisher nur in Hollywoodstreifen gesehen hatte, und steckte sich eines der Schwerter in eine lederne Scheide, die er sich zuvor umhängte. Die Ausrüstung bildete einen skurrilen Kontrast zu der zerrissenen Jeans, der schwarzen Lederjacke und den grünen Sportschuhen, die er trug. Obwohl die Waffen schwer aussahen, wandte er sich leichtfüßig um und ging wieder zu Kára. »Ich lasse dir ein Schwert da.«
»Ich denke nicht, dass das nötig ist«, erwiderte Kára, ohne Ray dabei aus den Augen zu lassen. Diese starrte abwechselnd Kára, den bewaffneten Mann und den Schrank hinter sich an, in dem das Metall seltsam verlockend glänzte. Rays Herz setzte einen Schlag aus. Für Nachbildungen sahen diese Schwerter sehr bedrohlich aus.
»Man kann nie wissen, wer es brauchen kann. Es ist sowieso nur billiges Midgard-Metall.«
Ohne sich noch einmal umzusehen, öffnete er die Tür und verließ die Wohnung.
Kára seufzte und kam mit erhobenen Händen auf Ray zu.
»Diese Herr-der-Ringe-Freaks sind echt ein bisschen verrückt, oder?«
»Der hat Waffen in seinem Schrank.« Mehr brachte Ray nicht hervor.
»Die sind nicht echt«, beschwichtigte Kára sie und schloss die Schranktüren. »Nachbildungen der Filmvorlagen, nichts weiter.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Ray argwöhnisch.
Kára wandte den Blick ab. »Ehrlich gesagt will ich es gar nicht so genau wissen. Es geht mich nichts an, was er treibt.«
Darauf wusste Ray nichts zu sagen, doch dann fiel ihr das seltsame Gespräch wieder ein, das sie im Halbschlaf unabsichtlich belauscht hatte.
»Worüber habt ihr euch vorhin unterhalten?«, fragte sie und kniff die Augen misstrauisch zusammen, als Kára ertappt zusammenzuckte. Sie klaubte einige Zettel zusammen, die überall in der Wohnung auf dem Boden verstreut lagen, und mied Rays Blick.
»Darüber, was er die ganze Zeit so gemacht hat, wo er seine Zukunft verbringt«, plapperte sie betont fröhlich los. »Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, und du hast lange geschlafen. Warum bist du denn vorhin auf der Straße einfach so umgekippt?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Ray nach kurzem Zögern. Sie versuchte sich krampfhaft an den Wortlaut zu erinnern, der nur dumpf in ihrem Gedächtnis widerhallte. »Was meinte er mit Vorfahren?«
»Du musst dich verhört haben.« Kára hielt inne und sah Ray besorgt an. Dann kam sie auf sie zu und legte ihren Handrücken auf Rays Stirn. »Fieber hast du nicht.«
»Ich weiß, was ich gehört habe!«, widersprach Ray.
»Du meinst doch nicht etwa sein wirres Gerede von Kräften, Elben und Ahnen?«
Ahnen. Das war das Wort, das Ray gesucht hatte.
»Doch, genau das meine ich.«
»Wie gesagt: Er ist ein absoluter Fantasy-Fan und lebt in einer eigenen Welt.« Sie machte eine ausladende Handbewegung und deutete auf die Inneneinrichtung, die Wandbemalung und eine Vitrine voller kleiner Stein- und Holzfiguren, die neben dem Waffenschrank stand. »Es tut mir leid, ich hätte dich vorwarnen sollen. Mir war nicht klar, wie … seltsam er auf Menschen wirkt, die ihn nicht kennen.«
»Ich hätte nicht gedacht, dass du solche Freunde hast«, platzte es aus Ray heraus. »Sind diese Waffen überhaupt erlaubt?«
Kára machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, und ich will es, glaube ich, auch nicht wissen. Hoffen wir einfach, dass die Polizei die Wohnung nicht untersucht, ich möchte gar nicht wissen, was er hier noch so versteckt.«
Sie grinste Ray schief an. Ray schüttelte den Kopf. Ihre Reise nach Berlin war schon in den ersten Stunden noch verrückter, als sie gehofft hatte.
»Wie wäre es, wenn ich dir einen Tee und einen kleinen Salat mache und wir uns dann aufs Ohr hauen? Ich glaube, das war ein wirklich anstrengender Tag für uns beide.«
Ray nickte. Ein Salat an einem Sommerabend war ganz nach ihrem Geschmack.
3
Wir sind uns also einig, dass wir den Faden ausreißen?«, fasste Odin zusammen und erntete zustimmendes Gemurmel der anwesenden Götter. Sie hatten sich in einer großen Halle versammelt, deren Decke mit einem Gemälde der Weltesche geschmückt war. Der Tisch und die Stühle waren goldverziert. An der Wand hingen bestickte Teppiche. Niemand bemerkte, dass sich hinter einem von ihnen etwas bewegte.
»Sobald ein goldener Faden erscheint, wird ein Mensch den Weg des Heldentums einschlagen«, flüsterte Frigg. Sie strich sich mit ihren schlanken Fingern durch die Haare und schüttelte den Kopf. »Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen verhindern, dass dieser Mensch zum Helden wird.«
»Der Glanz eines neuen goldenen Fadens, der den Webstuhl befällt, besiegelt das Ende der bekannten Götterwelt.« Odin rezitierte die alte Prophezeiung der Nornen und sah einem Gott nach dem anderen in die Augen. Der Wandteppich, unter dem fast unsichtbar zwei Schuhspitzen hervorlugten, bewegte sich. Ein Lufthauch wehte unbemerkt durch die große Halle. »Sobald der König der Riesen fällt, beginnt das Ende der bekannten Götterwelt. Wenn niemand das Heldentum gefangen hält, ist es das Ende der bekannten Götterwelt.«
Die Götter tuschelten. Die meisten von ihnen achteten nicht einmal auf das, was Odin ihnen sagte. Ein Glas nach dem anderen wurde geleert.
»Ich möchte sie sehen«, sagte Odin. »Dieses Mädchen, von dem die Nornen sprachen. Wenn wir das Heldentum in ihr nicht aufhalten, wird sie einen Eisriesen töten. Ganz gleich, ob die Grenzen versiegelt sind oder nicht. So heißt es in der Prophezeiung. Also bringt sie schnellstmöglich hierher, bevor einer unserer Feinde das tut.« Sein Blick wanderte zu Loki, der unschuldig seine Fingernägel musterte. »Sie soll durch meine Hand sterben. Unsere alten Gesetze besagen, dass ein Held nur durch zwei Hände sterben darf: meinen und denen des Schicksals. Diesen heiligen Brauch schworen wir damals auf Yggdrasil. Das bedeutet, dass sie so schnell wie möglich zu mir gebracht werden muss, und wir werden hier und heute festlegen, wer diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf.«
Bei dem Wort Aufgabe wurden sie hellhörig. Das war ein Begriff, der schon lange nicht mehr an ihre Ohren gedrungen war. Die Anwesenden senkten die Köpfe. Keiner von ihnen verspürte große Lust, Asgard zu verlassen. Weshalb sollten sie eine Welt verlassen, in der sie alles hatten und Leid eine entfernte Erinnerung war, die von Met und Glück überlagert wurde?
»Lasst mich gehen, Vater.« Ein muskulöser Mann erhob sich von seinem Platz. Auf einen Menschen hätte er nicht älter als fünfundzwanzig gewirkt, obwohl er schon unzählige Jahreszeitenwechsel erlebt hatte. Sein langes blondes Haar, der dichte Bart und die breiten Schultern zeugten davon, dass er großen Wert auf sein Äußeres legte. Odin musterte seinen Sohn von oben bis unten und wandte dann den Blick ab.
»Gibt es keine weiteren Freiwilligen?«
Thor ballte die Hände zu Fäusten und schlug auf den Tisch, der aus Yggdrasils Holz gefertigt war. Die Raben auf Odins Schulter flatterten mit den Flügeln und stießen einen Schrei aus, doch die anderen Götter ignorierten Thors Wutausbruch, plauderten und tranken. Es hatte sich ein Freiwilliger gefunden, damit war das Problem für sie gelöst.
Odin wischte sich mit einer Hand über das Gesicht und bedeutete dann den Walküren mit einer Geste, das Ausschenken des Mets zu unterbrechen.
»Es wird kein Tropfen mehr getrunken, bis wir nicht zu einer Entscheidung gekommen sind.«
Die Götter begehrten erbost auf, doch sobald Odins Blick sie streifte, verstummten sie. Sie waren es nicht gewohnt, ernste Dinge bereden zu müssen. Gierig starrten sie auf die großen Tonkrüge, in denen das flüssige Gold einen süßen Geruch verströmte.