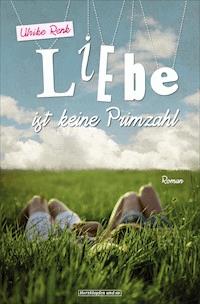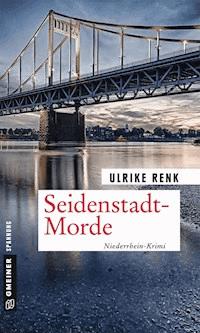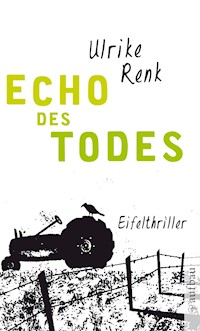16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Australien Saga
- Sprache: Deutsch
Die komplette Australien-Saga von Bestseller-Autorin Ulrike Renk in einem E-Book.
Die Australierin.
Von Hamburg nach Sydney - Als Tochter eines Werftbesitzers wächst Emilia in Hamburg auf. Sie soll eine gute Partie heiraten, aber nicht den Mann, in den sie sich verliebt hat. Carl Gotthold Lessing ist der Großneffe des berühmten Dichters. Er hat ein Kapitänspatent erworben und sich Geld geliehen, um ein Schiff zu bauen. Er will Emilia heiraten, doch ihre Familie ist strikt gegen diese Verbindung. Die beiden beginnen, nachdem Lessing von seiner ersten großen Fahrt zurückgekehrt ist, eine Affäre. Als ein Hausmädchen sie verrät, kommt es zum Bruch. Emilia beschließt, mit ihm zu reisen. In Südamerika kommt ihr erstes Kind zur Welt, in Hamburg das zweite. Doch sie haben ein anderes Ziel: Australien.
Die spannende Geschichte einer Auswanderung, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Die australischen Schwestern.
Die Wege der Liebe - Australien, 1891. Das Leben von Carola, Mina und Elsa verändert sich schlagartig, als ihre Mutter kurz nach der Geburt des jüngsten Kindes stirbt. Während Carola, die Älteste, ins ferne Deutschland geschickt wird, bleiben Mina und Elsa in Australien. So unterschiedlich sich die Lebenswege der drei jungen Frauen auch entwickeln, eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie geben nicht auf, wenn es darum geht, für ihre Träume zu kämpfen ...
Eine hochemotionale Saga um das Leben dreier außergewöhnlicher Schwestern – nach einer wahren Geschichte.
Das Versprechen der australischen Schwestern.
Schicksalhafte Jahre zwischen Sydney und Hamburg - Drei Schwestern, zwei Kontinente: Jede der drei ist ihren Weg gegangen. Elsa arbeitet in Sydney, Mina hat nach Jahren endlich ihren heimlichen Verlobten William geheiratet, und Carola lebt glücklich mit Werner in Hamburg. Doch dann ist ihr aller Glück in Gefahr: Nicht nur ein Todesfall erschüttert die Familie in ihren Grundfesten, sondern es bricht auch der Erste Weltkrieg aus. Plötzlich leben Carola, Elsa und Mina in verfeindeten Ländern. Wird das Band, das die drei Schwestern zusammenhält, stärker sein als die Schatten des Krieges?
Das bewegende Leben der australischen Schwestern zwischen Krieg und Frieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2321
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die komplette Australien-Saga von Bestseller-Autorin Ulrike Renk in einem E-Book!
Die Australierin:
Von Hamburg nach Sydney - Als Tochter eines Werftbesitzers wächst Emilia in Hamburg auf. Sie soll eine gute Partie heiraten, aber nicht den Mann, in den sie sich verliebt hat. Carl Gotthold Lessing ist der Großneffe des berühmten Dichters. Er hat ein Kapitänspatent erworben und sich Geld geliehen, um ein Schiff zu bauen. Er will Emilia heiraten, doch ihre Familie ist strikt gegen diese Verbindung. Die beiden beginnen, nachdem Lessing von seiner ersten großen Fahrt zurückgekehrt ist, eine Affäre. Als ein Hausmädchen sie verrät, kommt es zum Bruch. Emilia beschließt, mit ihm zu reisen. In Südamerika kommt ihr erstes Kind zur Welt, in Hamburg das zweite. Doch sie haben ein anderes Ziel: Australien. Die spannende Geschichte einer Auswanderung, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Die australischen Schwestern:
Die Wege der Liebe - Australien, 1891. Das Leben von Carola, Mina und Elsa verändert sich schlagartig, als ihre Mutter kurz nach der Geburt des jüngsten Kindes stirbt. Während Carola, die Älteste, ins ferne Deutschland geschickt wird, bleiben Mina und Elsa in Australien. So unterschiedlich sich die Lebenswege der drei jungen Frauen auch entwickeln, eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie geben nicht auf, wenn es darum geht, für ihre Träume zu kämpfen. Eine hochemotionale Saga um das Leben dreier außergewöhnlicher Schwestern – nach einer wahren Geschichte.
Das Versprechen der australischen Schwestern:
Schicksalhafte Jahre zwischen Sydney und Hamburg - Drei Schwestern, zwei Kontinente: Jede der drei ist ihren Weg gegangen. Elsa arbeitet in Sydney, Mina hat nach Jahren endlich ihren heimlichen Verlobten William geheiratet, und Carola lebt glücklich mit Werner in Hamburg. Doch dann ist ihr aller Glück in Gefahr: Nicht nur ein Todesfall erschüttert die Familie in ihren Grundfesten, sondern es bricht auch der Erste Weltkrieg aus. Plötzlich leben Carola, Elsa und Mina in verfeindeten Ländern. Wird das Band, das die drei Schwestern zusammenhält, stärker sein als die Schatten des Krieges? Das bewegende Leben der australischen Schwestern zwischen Krieg und Frieden.
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion. Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga und ihre Ostpreußen-Saga sowie zahlreiche historische Romane vor.
Mehr Informationen zur Autorin unter www.ulrikerenk.de
ABONNIEREN SIE DENNEWSLETTER DER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Die große Australien-Saga
Die Australierin &Die australischen Schwestern &Das Versprechen der australischen Schwestern
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Die Australierin
1842–1844 Emilia
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
1853–1856 Emilia
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
1856–1858 Auf erster großer Fahrt
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
1861–1862 Auf zu fremden Ufern
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
1880–1890 Minnie
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
1891–1909 Carola
Epilog
Nachwort
Danksagung
Die Australischen Schwestern
Carola – 1891
Auf dem Weg nach Europa
Währenddessen in Sydney
Warten auf Harry
An Bord der Centennial
Auf hoher See
Am Äquator
Durch den Sueskanal
Mina – 1900
Sydney
In den Blue Mountains
Darri
Der Pfad der Ahnen
Die drei Schwestern
Wentworth Falls
Zurück in Glebe
Carola – 1901
Besuch in Krefeld
Andere Sitten
Das Festmahl
Rückkehr nach Hamburg
Besuch in Berlin
Die Lessings
Elsa – 1904
An Bord unterwegs nach Cairns
Auf dem Weg zu den Atherton Tablelands
Millers Sheep Station
Bei Lily
Elsa und Otto
Weihnachten
Der erste Feiertag
Ein Tag in Cairns
Silvester
Ein neues Jahr
Zurück nach Sydney
Wieder zu Hause
Mina – 1905/1906
Der Laienprediger
William Cleugh Black
Wege des Schicksals
Ein neuer Anfang
Erwartungen
Erfüllungen
Carola – 1909
Die Botin
Das große Glück
Enttäuschung und Hoffnung
Epilog
Nachwort
Danksagung
Das Versprechen der australischen Schwestern
Stammbaum
Teil 1 – Die drei Schwestern
Die Legende der drei Schwestern
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Teil 2 – Die Familien
Die Legende des Mallagongans
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil 3
Die Prophezeiung der Ahnen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von dieser Familiensaga begeistert ist, liest auch ...
Orientierungsmarken
Cover
Inhaltsverzeichnis
Die Australierin
Die australischen Schwestern
Das Versprechen der australischen Schwestern
Impressum
Ulrike Renk
Die Australierin
Von Hamburg nach Sydney
Roman
Für Robyn Jessiman
»Carefully study the life of the Author
And remember his blood flows in your veins
Prove yourself of the Lessings a worthy daughter
A Lessing in Deed, not only in name.
Genius cannot be imitated
Nor acquired by the most ardent will,
To prove that you are of him related
Remain what you are, my genial good …
Your loving father
December 13th 1887
C. G. Lessing«
1842–1844 Emilia
1. KAPITEL
Der Tag, an dem Julius zur Welt kam, hatte sich für immer in Emilias Gedächtnis eingebrannt. Schon in der Nacht auf den 5. Mai wanderte ihre Mutter unruhig durch die Stube des Hauses in Othmarschen. Der Vater sah ihr verängstigt zu und wies das Mädchen an, Emilia früh zu Bett zu bringen.
Die Luft war lau, von der Elbe wehte der salzige Wind das Kreischen der Möwen ans Ufer.
»Es ist viel zu früh«, beschwerte Emilia sich. »Warum muss ich schon zu Bett gehen?«
»Deiner Mutter geht es nicht gut«, sagte Inken, die Dienstmagd. »Also füg dich.«
»Ich habe noch Hunger«, quengelte die Sechsjährige.
»Dann bringe ich dir eine Schale mit Dickmilch. Aber danach huschst du ins Bett.«
Ihre Mutter, das wusste Emilia, würde ein Kind zur Welt bringen. Sie würde schreien und weinen, und ihr Vater würde durch das Haus laufen und die Hände ringen. Es war nicht das erste Mal, dass dies geschah. Auf dem Friedhof gab es eine Reihe kleiner Gräber, und jedes Mal, wenn ihre Mutter ein Kind gebar, kam ein weiteres Grab hinzu. Diesmal hatte die Mutter das Kind länger getragen als sonst, und alle hofften auf ein gutes Ende.
Inken brachte die Dickmilch und strich dem Kind über den Kopf. »Du musst heute und morgen ganz brav sein, Emma.«
»Das weiß ich doch.« Emilia biss sich auf die Lippe, sie versuchte immer, ganz brav zu sein. Manchmal lächelte ihre Mutter, doch die Falten um ihren Mund wurden tiefer und ihre Augen blieben traurig, selbst wenn sie lachte.
Emilia öffnete das Fenster ihrer kleinen Kammer und schaute über die Bäume hinweg. Dort war die Elbe, und die floss ins Meer. Auf der anderen Seite des Meeres lagen fremde Länder. Über diese Länder sprachen ihr Vater und ihr Onkel, wenn die beiden zusammensaßen. Und das taten sie oft, auch wenn Onkel Hinrich in Hamburg wohnte.
Manchmal nahm der Vater Emilia mit an das sandige Ufer des großen Stroms und zeigte auf ein Segelschiff, das gerade den Hafen verließ.
»Das haben wir gebaut«, erklärte er stolz. »Unsere Familie baut Schiffe, die über die Weltmeere segeln.«
Es war noch hell, als Emilia sich ins Bett legte. Von unten waren leise Stimmen zu hören, aber noch keine Schreie und kein Weinen. Vielleicht würde es diesmal anders werden. Sie schloss die Augen und betete, so, wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte.
Es war immer noch hell, als sie wieder wach wurde. Lautes Jammern drang aus dem Erdgeschoss nach oben und Emilia kniff die Augen zusammen und presste die Hände auf die Ohren. Es roch seltsam, wunderte sie sich und öffnete die Augen. Rotes, flackerndes Licht fiel durch das Fenster in die Stube. Es roch wie im Herbst, dachte Emilia, wenn die Felder abgebrannt wurden. Vorsichtig nahm sie die Hände herunter und lauschte. Inken war es, die jammerte, nicht die Mutter. Was war nur passiert? War das Kind schon da und tot? Sie traute sich nicht, die Tür zu öffnen und nach unten zu gehen. Der Lichtschein war so seltsam, dass sie ans Fenster trat. Über der Elbe war der Himmel dunkel, doch in Richtung Stadt leuchtete es hell. Es brennt, dachte sie erschrocken. Es brennt in der Nachbarschaft. Dort wohnte der Lotse Jörgensen mit seiner Familie. Sie lief oft hinüber, um mit den Kindern zu spielen. In deren Haus war es immer laut und fröhlich, so ganz anders als bei ihnen.
Sie hörte Schreie von draußen und das Klappern von Hufen auf dem Kopfsteinpflaster der Straße. Und dann sah sie die Flammen, die wie Zungen über den Nachthimmel leckten.
Voller Angst öffnete sie die Tür, raffte ihr Nachthemd zusammen und stapfte die Treppe hinunter. Die Tür zur Stube war geschlossen, doch sie konnte Stimmengemurmel hören. Inkens Weinen kam aus der Küche.
»Inken, der Lichtschein da draußen …« Emilia blieb unsicher an der Tür stehen. Die Magd hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt, sie schluchzte laut.
»Ich weiß, mein Mäuschen«, sagte sie und wischte sich mit dem Schürzensaum die Tränen ab. »Hamburg brennt.«
»Es brennt nicht bei Jörgensens?«
»Nein. Komm her.« Sie breitete die Arme aus. Emilia kletterte auf Inkens Schoß und drückte sich an die Magd. Inken roch immer nach frischem Brot und Lavendel. Ein tröstlicher Geruch.
»Hamburg ist weit weg.« Emilia nickte, kuschelte sich aber noch enger an Inken. »Warum bist du so traurig?«
»Ich habe Angst um meine Familie. Das Feuer ist gewaltig, man kann es bis hierher sehen«, flüsterte sie.
Onkel Hinrich und Tante Minna wohnten auch in Hamburg, dachte Emilia und steckte sich den Daumen in den Mund.
»Ole soll anspannen.« Ihr Vater kam atemlos in die Küche. Emilia machte sich ganz klein, doch er schien sie gar nicht zu bemerken. »Wir fahren in die Stadt.«
»Jetzt?« Inken riss erschrocken den Mund auf. Sie setzte Emilia auf die Küchenbank am Herd. »Und Eure Frau?«
»Sie ist in Gottes Händen. Ich habe Mats nach der Hebamme geschickt. Jörgensen und Olufson kommen mit in die Stadt. Sie werden dort jede Hand, die einen Eimer halten kann, brauchen.«
Inken lief in die Gesinderäume, sie musste den Knecht nicht wecken. Wohl kaum einer schlief in dieser Nacht. Die Sorge, die sich in das Gesicht der Magd eingrub, wurde immer deutlicher. Emilia rollte sich auf der Küchenbank zusammen. Manchmal fielen ihr die Augen zu, doch dann kam jemand in die Küche und sie wurde wieder wach.
Inken kochte Suppe und Tee, sie buk Brot und holte einen Schinken aus dem Keller. »Wenn sie wiederkommen, brauchen sie etwas Kräftiges zu essen«, murmelte sie. Zwischendurch ging sie in die Stube. Durch den Türspalt konnte Emilia die Mutter sehen, die sich an die Lehne des Ohrensessels klammerte und stöhnte. Ihre Haare hingen ihr wirr und schwitzig ins Gesicht. Sie trug ein Nachtgewand und sah so fremd aus, dass es Emilia Angst machte. Dennoch konnte das Kind den Blick nicht abwenden, sobald sich die Tür öffnete.
»Was machst du hier?«, fragte die Hebamme verblüfft, als sie in die Küche kam.
Emilia hockte auf der Bank, hatte die Beine angezogen und den Saum des Nachthemdes unter die Füße gestopft.
Inken schaute sich um. »Sie ist heute Nacht wach geworden und hat dann auf der Bank geschlafen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie nach oben zu schicken.«
Die Hebamme, eine runzelige Alte, die nach Kampfer und anderen scharfen Kräutern roch, schüttelte den Kopf. »Sie sollte nicht hier unten sein. Heute ist Christi Himmelfahrt, sie sollte in die Kirche gehen und für uns alle beten.«
Inken schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Das habe ich ganz vergessen. Lauf, Emma, zieh deine guten Sachen an und kämm dir die Haare. Sicher nimmt Frau Jörgensen dich mit. Du musst dich sputen.«
Emilia stand zögernd auf.
»Nun geh schon, Kind«, sagte die Hebamme. »Und koch du mir einen Kaffee, Inken. Das wird sicher noch ein langer Tag werden.«
»Wie geht es ihr denn?«, fragte Inken. Emilia blieb hinter der Tür stehen und lauschte.
»Es geht. Sie verkrampft sich, das ist nicht gut. Ich werde ihr einen Aufguss machen.«
»Hat das Kind eine Chance?«
»Das weiß man doch nie. Aber mehr als die anderen vorher«, sagte die Hebamme.
Emilia schlich die Treppe nach oben. Obwohl der Tag schon angebrochen war, sah es düster draußen aus. Seit Wochen hatte es nicht geregnet, alles war ausgedörrt, das Gras vor dem Haus gelb und welk. Sie ging ans Fenster, öffnete es. Hatte Inken sich in der Zeit vertan? Bis zum Kirchgang war es sicherlich noch lange hin. Doch dann sah Emilia, dass dicke, schwarze Wolken die Sonne verdunkelten. Wind war aufgekommen, die Bäume rauschten wie das Meer bei Sturm. Emilia zog die Schultern hoch, in ihrem Magen grummelte es. Der rote Lichtschein des Feuers, der unter dem Qualm hervorleckte, wirkte angsteinflößend. Wie feuerspuckende Drachen, von denen ihr Onkel Hinrich manchmal erzählte. Doch Drachen gab es nur im Märchen, und dies war kein Märchen. Es roch beißend nach Rauch, Emilia musste husten und schloss schnell das Fenster, als könne sie so alle Gefahren aussperren.
Das gute Kleid sollte sie anziehen. Und waschen sollte sie sich. Schnell schlüpfte sie aus dem Nachthemd und tauchte den Lappen in das Wasser der Waschschüssel. Jeden Morgen brachte Inken ihr warmes Wasser, meist half sie ihr beim Ankleiden und mit den Haaren, aber heute war Inken beschäftigt. Sie hatte wichtige Dinge zu tun. Wenn ich alles ganz richtig mache, dachte Emilia, dann wird auch alles gut. Das Kind in Mamas Bauch wird am Leben bleiben. Es wird in der Wiege liegen und nicht auf dem Friedhof. Wenn ich alles richtig mache, dann hört das Feuer auf zu brennen. Das Feuer bedeutete etwas Schreckliches, das hatte sie in den Gesichtern der Erwachsenen gesehen. Feuer war beides – schrecklich, aber auch gut. Ohne Feuer hätten sie kein warmes Wasser. Der nasse Lappen war kalt und glitschig, sie fuhr sich über das Gesicht und die Arme, erschauerte. Reichte das? Die Hände, die müssen sauber sein, und der Hals. Das war wichtig, darauf achten die Leute. Sie rubbelte sich trocken, bis die Haut brannte, nahm dann ein sauberes Unterkleid aus der Truhe, eine Wäschehose mit Rüschen, die für Feiertage vorbehalten war. Ob sie es allein schaffte, die Hose an das Unterkleid zu knöpfen? Es musste gelingen. Dann nahm sie das gute Leinenkleid und zog es sich über den Kopf. Wer sollte die Knöpfe schließen? Wer würde die Schnüre schnüren, die Schleifen binden? Wie sie sich auch drehte und wendete, ihr gelang es nicht. Doch es musste, es war ihre Aufgabe, alles richtig zu machen.
Tränen stiegen ihr in die Augen, als sich die Zimmertür öffnete.
»Wie weit bist du?«, fragte Inken und schlug die Hände vor den Mund. »Oh lieber Herr Jesus, Kind!«
Nun flossen die Tränen ohne Halt. »Ich habe es versucht«, schluchzte Emilia.
»Nun, nun, nun, Mäuschen. Alles ist gut.« Mit flinken Händen schloss Inken Knöpfe, zog Säume gerade, schnürte Bänder. Dann bürstete sie Emilias Haare und steckte sie fest. »Noch die Schuhe, und schon bist du fertig. Was ist mit deinen Strümpfen?«
Die Strümpfe hatte das Mädchen ganz vergessen.
»Dann eben ohne«, beschloss die Magd. »Schnell, schnell, bevor Frau Jörgensen los ist.«
»Aber ich … habe Hunger.« Emilia folgte Inken die Treppe hinunter, ließ sich die Schnürstiefel anziehen. »Komm, ein Brot mit Butter auf die Hand muss ausreichen. Nachher bekommst du eine gute Suppe und nun lauf.« Sie setzte dem Mädchen die Haube auf und schob es hinaus. Als Emilia draußen stand, schrie die Mutter zum ersten Mal laut und quälend auf. Das Kind presste die Hände auf die Ohren und lief den Hang hinunter.
Etwas weiter zur Chaussee hin stand das Haus der Jörgensens. Es war aus rotem Backstein, hatte nur das Erdgeschoss und Kammern unter dem Reetdach. Vor zwei Jahren hatte die Familie angebaut, um der Heerschaar der Kinder Platz bieten zu können. Es gab eine Scheune und einen Stall. Einen Garten, so, wie bei der Familie Bregartner, gab es dort nicht. Emilias Mutter hatte vor dem Haus eine Rasenfläche anlegen lassen, mit einem Pavillon und vielen blühenden Büschen sowie gestutzten Buchsbäumen. Jörgensens hatten eine Wiese mit Obstbäumen und Beerensträuchern vor dem Haus, hinter dem Haus befand sich der Wirtschaftsgarten. Sie hielten einige Schafe und Ziegen auf den Deichen, so wie Bregartners auch. Beide Familien hatten einen Wirtschaftsgarten, doch gab es Unterschiede. Emilias Familie besaß Land und die Werft, Vater Jörgensen war Lotse im Hafen.
»Euch geht es viel besser als uns«, sagte Mette Jörgensen oft. »Deine Mutter kann Inken auf den Markt schicken, Schinken und Speck kaufen.«
Mette war zwei Jahre älter als Emilia, die beiden Mädchen liebten sich aufrichtig und verbrachten viel Zeit miteinander.
Doch bei Jörgensens, dachte Emilia oft, ist es anders als bei uns. Allein schon, dass Ida, die Magd, ihre Herrschaft mit »Mutter« und »Vater« ansprach, während Inken »gnädige Frau« und »gnädiger Herr« sagte. Es war wie mit den Kleidern, die sie trugen. Das Leinen ihrer Wäsche war immer gestärkt, während Mettes Sachen sich viel leichter und weicher anfühlten.
Emilia war gerne bei den Nachbarn drüben, während es für Mette nichts Schöneres zu geben schien, als bei Bregartners zu sein. Ida hatte immer etwas zu tun. Viel mehr als Inken und Sofie. Sofie war die alte Magd der Bregartners. Sie wohnte noch beim Gesinde, aber ihre Hände waren von der Gicht verkrümmt. Sie taugte nur noch, um den Besen ein wenig zu schwingen, die Hühner zu füttern und Unkraut zu zupfen. Doch sie würde bei ihnen wohnen bleiben, bis sie starb, das hatte Emilias Vater versprochen.
Schon kam das Reethaus des Lotsen in Sicht, das sich unter dem großen Rosskastanienbaum duckte wie ein Tier. Emilia lief schneller. Die Schreie der Mutter waren nun nicht mehr zu hören, seltsam still war es. Die Bäume rauschten im Wind, aber kein Vogel schrie, keine Möwe kreischte. Plötzlich bemerkte Emilia, dass es schneite. Flocke um Flocke landete auf ihrem Kleid, auf dem Gras und den Büschen. Dabei war es gar nicht kalt. Verwundert schaute sie in den Himmel, der von dunklen Wolken bedeckt war. Ein Schneesturm schien herniederzugehen. Sie fing die weichen Flocken ein, die nicht in der Hand schmolzen, und zerrieb sie zwischen den Fingern. Es waren Ascheflöckchen. Oh nein, dachte sie und strich hektisch über das helle Kleid, das dadurch graue Streifen bekam.
Ich muss doch alles richtig machen, aber es will mir einfach nicht gelingen. Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. Sie rannte zum Haus der Jörgensens und riss die Küchentür auf, ohne anzuklopfen. Schluchzend blieb sie stehen.
»Emma, Kind!« Grete Jörgensen lief zu ihr. »Was ist denn passiert?«
»Ich … ich soll … es ist doch … Kirche …« Emilia versuchte, die Luft anzuhalten, doch der Schluckauf wollte nicht aufhören.
»Sch-sch-sch.« Grete nahm sie in den Arm. »Beruhige dich, Kind. Ida, hol einen Becher Wasser und gib einen Fingerhut Branntwein hinein.«
Emilia wich aus ihrer Umarmung zurück. »Ich bin ganz dreckig«, flüsterte sie. »Es schneit Asche.«
Grete warf einen Blick aus dem Küchenfenster, ihr Blick wurde ernst. »Ja, ich weiß. Als ob das Fegefeuer naht.«
Der Weg zur Kirche in Ottensen erschien Emilia länger als sonst. Meistens fuhren sie mit dem Wagen, bei gutem Wetter liefen sie manchmal bis nach Ottensen. Mutter ging alle paar Tage zum Friedhof und betete. Vielleicht, wenn Emilia alles richtig machte und das Kind am Leben blieb, würde die Mutter bald nicht mehr so oft dorthin gehen müssen. Aber so viel war schon schiefgelaufen. Sie würde sich ab jetzt ganz besonders anstrengen, nahm sich Emilia vor.
»Lieber Gott«, keuchte Ida und hustete. »Dieser Qualm ist ein Elend.«
Besorgt schaute Grete Jörgensen in den Himmel. Der Wind trieb die Wolken zu ihnen. »Sie müssten das Feuer doch längst im Griff haben«, murmelte sie. »Gebe Gott, dass es nicht zu schlimm ist.«
»Da werden wohl die Speicher brennen«, meinte Ida düster. »Und so trocken, wie es in den letzten Wochen war, brennt alles wie Zunder.«
Gut eine halbe Stunde betrug der Weg zur Kirche, doch wegen der kleinen Kinder und der rauchgeschwängerten Luft kamen sie nur langsam voran.
Auf dem Kirchplatz hatten sich bereits viele Menschen versammelt, die immer wieder besorgt in Richtung Hamburg schauten. Die meisten Frauen waren ohne ihre Männer gekommen.
»Grüßt Euch, Frau Jörgensen«, sagte Frau Carstensen. »Mögt Ihr einen Schluck Wasser?« Sie reichte ihr einen Krug. »Und die Kinder sicher auch.«
Dankbar nahm Grete den Krug entgegen, trank durstig und reichte ihn dann an Levke weiter.
»Euer Mann ist auch in der Stadt?«
»So wie auch Herr Bregartner und Herr Peters. Sie haben die Knechte mitgenommen. Habt Ihr schon gehört, wie es steht?«
»Das Nikolaiviertel brennt. Bisher haben sie es nicht geschafft, das Feuer einzudämmen.«
»Das ganze Viertel?«, Grete schlug entsetzt die Hand vor den Mund.
»So wurde es berichtet.« Frau Carstensen schüttelte den Kopf. »Man kann es sich gar nicht vorstellen.«
In der Kirche war es kühl wie immer. Die Jörgensens saßen im hinteren Teil der Kirche. Die Familie Bregartner hatte eine eigene Bank mit einem kleinen Messingschild an der Seite. Diese Bank blieb heute leer, Emilia setzte sich neben Mette. Ihr Blick ging zu dem Engel, der über dem Taufbecken schwebte. Das rötliche Licht des Feuers, das man hier noch deutlicher sehen konnte als in Othmarschen, schien durch die hohen, bunten Fenster, malte farbige Flecken an die Wände und den Kanzelaltar. Es sah unheimlich aus, fand Emilia, die ansonsten die helle Kirche mit den weißen Bänken liebte.
Ida, die neben Mette saß, murmelte die ganze Zeit: »Das Fegefeuer, das ist das Fegefeuer. Möge der Herr uns gnädig sein.«
»Ida!«, zischte Grete vom anderen Ende der Bank wütend. »Du machst allen Angst. Senk den Kopf und bete still.«
Die Stimme des Pfarrers war ernster als sonst.
»Wir feiern Christi Himmelfahrt an diesem Tag. ›Er ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt nun zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten, seiner Herrschaft wird kein Ende sein.‹«
Der Pfarrer richtete den Blick zum Fenster.
»Dieser Tag, den wir lobpreisen, ist überschattet von einem großen Unglück. Wir beten für alle, die das Feuer bekämpfen.«
Zwei Stunden dauerte der Gottesdienst, eine Zeit, die Emilia sonst lang wurde. Doch diesmal betete sie, so gut sie konnte. Das Feuer, obwohl es in der Stadt war, bedrohte sie alle irgendwie, das hatte sie verstanden. Wieso und weshalb, wusste sie nicht, aber sie spürte Angst und Sorge bei allen um sich herum und auch aus den Worten des Pfarrers. Das Feuer musste etwas ganz Böses und Schlimmes sein. Onkel Hinrich und Tante Minna wohnten im Nikolaiviertel. Ob ihr Haus auch brannte? Vor Schreck bekam Emilia wieder Schluckauf. Sie schloss die Augen und faltete die Hände, so fest sie konnte.
»Lieber Gott, bitte, lass ihnen nichts passiert sein. Auch nicht dem schönen Kinderzimmer mit dem weißen Schaukelpferd.« Sie biss sich auf die Lippe. Frederik, ihr Cousin, war letztes Jahr an Cholera gestorben. Im Jahr davor war das kleine Mädchen von Tante Minna, Luisa, im Siel ertrunken. Erst vor zwei Wochen hatte sich Emilia, als sie in Hamburg zu Besuch waren, in das Kinderzimmer geschlichen und sich auf das Schaukelpferd gesetzt. Frederik hatte ihr das nie erlaubt, als er merkte, wie gut ihr das Spielzeug gefiel. War das böse von ihr gewesen, dass sie sich auf das Schaukelpferd gesetzt hatte?, fragte sie sich nun. Brannte es deshalb in der Stadt?
»Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut«, predigte der Pfarrer.
Nein, ich will das Pferd ja gar nicht, dachte sie beklommen. »Lieber Gott, bitte mach, dass Mutter ein gesundes Kind bekommt. Dass alles gutgeht und gut wird. Bitte mach, dass Mutter wieder glücklich wird. Ich werde alles dafür tun, immer lieb sein. Ich werde auch nie mehr von der Sahne naschen und es dann auf die Katze schieben. Nie, nie mehr. Das verspreche ich. Ich werde nie wieder etwas tun, was Mutter erzürnt.« Sie kniff die Augen zusammen. Dieses Versprechen war so schwer zu halten, weil Mutter so schnell wütend und zornig wurde. Manchmal reichte es schon, wenn Emilia singend durch das Haus hüpfte. Oder wenn sie sich dreckig machte oder aus Versehen eine der Blumen im vorderen Garten abbrach. »Ich werde mich nie wieder dreckig machen«, fügte sie in Gedanken ihrem Gebet hinzu. Dann öffnete sie die Augen und sah an sich herab. Die weiße Schürze war grau und fleckig, die Rüschen ihrer Wäschehose waren dunkel, das Kleid mit Rußflecken übersät. Oh nein, dachte sie. Dann sah sie sich um. Kaum einer sah besser aus. Der Ruß und die Asche hatten jeden getroffen. Selbst der Boden der Kirche und die weißen Bänke waren mit einer Ascheschicht bedeckt.
»Lieber Gott, ich verspreche, ab morgen sauber und reinlich zu sein. Und mich gar pfleglich zu verhalten, wenn du machst, dass alles gut wird.« Sie holte tief Luft. »Bitte!«
2. KAPITEL
»Lass uns zusehen, dass wir schnell nach Hause kommen«, sagte Grete mit einem Blick zum Himmel. Der Wind hatte gedreht, die Sonne war nun zu sehen. Aber immer noch stand Rauch über Hamburg.
»Unsere Gebete haben geholfen«, sagte Ida erleichtert.
Sie machten sich auf den Rückweg. Als sie endlich das Haus der Jörgensens erreichten, hatte der Wind abermals gedreht. Wieder regnete es Asche. Diesmal kam ein beißender Geruch hinzu.
»Wer weiß«, sagte Grete besorgt, »was da verbrennt. Alle ins Haus. Levke und Kasper, bringt die Tiere in den Stall.«
»Können wir nicht erst etwas essen?«, fragte Kasper und verzog das Gesicht.
»Ihr dürft rasch etwas trinken, aber dann bringt ihr die Tiere hinein«, sagte Grete ungewohnt streng.
Emilia blieb unsicher an der Tür stehen. Sie wusste nicht, ob sie mit hineinkommen oder nach Hause gehen sollte. Die Familie Jörgensen verschwand im Haus, niemand schien Emilia zu beachten.
Levke kam wieder heraus, wischte sich über den Mund und sah Emilia erstaunt an. »Was stehst du denn hier so rum? Willst du nicht reingehen?«
»Weiß nicht.« Emilia trat von einem Bein auf das andere, schaute den Hügel hinauf zu ihrem Elternhaus und wieder zurück.
»Geh rein. Es gibt Wasser mit Apfelwein, Brot und Schmalz. Frische Erbsensuppe mit Einlage gibt es gleich auch.«
Wasser mit Apfelwein. Das ließ sich Emilia nicht zweimal sagen. Sie schlüpfte ins Haus. Grete saß auf dem Stuhl, einen Lappen auf der Stirn. »Gebe Gott, dass es das wert war«, seufzte sie. »Gebetet haben wir für alle.«
»Mutter.« Ida räusperte sich. Grete schlug die Augen auf und bemerkte Emilia, die sich an der Tür herumdrückte.
»Ach Kind, was machen wir denn mit dir? Ida, lauf rüber und frag nach.«
Die Magd seufzte, fügte sich aber.
»Nimm dir etwas zu trinken und eine Scheibe Brot, meine Kleine«, sagte Grete freundlich und sofort fühlte sich Emilia besser.
Ich darf keine Fehler mehr machen, ich muss brav sein, sagte sie sich. Wenn ich brav bin, wird alles wieder gut.
Sie nahm sich eine Scheibe von dem dunklen und festen Brot, das Ida immer buk. Es schmeckte würziger, auch wenn es nicht so fein war wie das weiße Brot, das es bei ihnen gab.
Gerade als sie hineinbiss, hörte sie das Hufgetrappel eines Gespanns. Kasper kam in die Küche gestürzt.
»Sie sind zurück, Mutter. Vater ist da!«, rief er, drehte auf dem Fuß um und rannte wieder hinaus. Emilia drückte sich in die Ecke. War das Feuer gelöscht? War sie brav genug gewesen?
Johann Jörgensen taumelte in die Küche. Seine Haare waren angesengt, sein Gesicht schwarz vor Ruß, er roch nach Verbranntem.
Emilia riss erschrocken die Augen auf. Wo war ihr Vater? Sie schlüpfte an dem Lotsen vorbei in den Hof. Dort stand das Gespann ihres Vaters. Mats, der Stallbursche, saß auf dem Kutschbock, fast hätte sie ihn nicht erkannt, er sah aus wie einer der Neger, die manchmal im Hafen waren. Neben ihm hing Ole, der Knecht, mehr, als dass er saß.
»Wo ist Vater?«, fragte sie leise, doch Mats hatte sie gehört.
»Fräulein Emma, was macht Ihr denn hier?« Er grinste breit und die weißen Zähne leuchteten in seinem schwarzen Gesicht.
»Wir waren zum Kirchgang. Wo ist Vater?« Ängstlich spähte sie in die leere Kutsche.
»Er ist schon daheim.« Mats lächelte schief.
Plötzlich tauchte Ida hinter der Hecke auf. »Fräulein Emma bleibt noch ein wenig bei uns.« Sie sah Mats an. »Das ist besser so. Inken hat Suppe und Braten für euch vorbereitet. Sie wartet schon.«
Mats nickte. Emilia schaute von ihm zu Ida. Ihr schien es, als hätten die beiden einander etwas gesagt, was sie nicht gehört hatte. Eine Botschaft, die sie nicht verstand. Erwachsene waren manchmal seltsam, dachte sie und ärgerte sich. Eigentlich wollte sie jetzt nach Hause und auf die Küchenbank kriechen. So sehr es ihr bei den Jörgensens gefiel, ihr Zuhause war dort oben auf dem Hügel.
Ida zog sie in die Küche. »Komm, Emma, wir machen etwas zu essen. Inken hat mir ein schönes Stück Speck und etwas Schinken mitgegeben.«
Sie legte beides auf den Tisch und sah Grete an. Wieder schienen die Erwachsenen sich durch Blicke zu verständigen. Das machten sie oft und Emilia verstand die Botschaften nicht, sie spürte nur, dass es um sie ging, irgendwie.
»Hol Wasser«, wies Johann Kasper an. »Ich brauche ein Bad.«
Kasper eilte in den Hof zum Brunnen. Die Jörgensens hatten keinen Knecht oder Burschen, alle harte Arbeit mussten sie selbst verrichten. Die Kinder mussten mithelfen, so gut sie konnten. Das war Emilia fremd, aber meist fand sie die Aufträge lustig. Die Gänse scheuchen, die Hühner füttern, Eier einsammeln, Ziegen melken. Meistens sah sie zu, manchmal half sie auch. Wasser holen hörte sich einfach an, aber Kasper stöhnte, als er einen Eimer nach dem anderen in die kleine Kammer neben der Küche schleppte, wo der Zuber stand.
»Und?«, fragte Grete ihren Mann.
Johann schüttelte nur den Kopf. »Du kannst es dir in deinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen. Es ist ein Grauen. Kein Ende in Sicht. Wir wollen uns ein wenig ausruhen und dann wieder in die Stadt fahren.«
»Aber es gibt doch die Spritzleute und Mannschaften in der Stadt, was brauchen sie euch vom Land, Johann?«
»Nein, das Feuer ist zu mächtig, als dass die Spritzleute allein damit fertig würden. Es brennt und brennt und brennt. Wir waren am anderen Ufer der Alster, der Wind weht Funken und Flammen und er dreht ständig. Wir mussten an jeder Ecke Brandherde löschen. Es ist eine Qual. Die meisten Siele sind ausgetrocknet oder voller Schlamm durch die Trockenheit, es gibt noch nicht mal genügend Wasser im Nikolaiviertel. Sie wollen Gebäude sprengen, wenn es nicht besser wird.«
»Sprengen?« Grete sah ihn entsetzt an. »Sie wollen die Stadt sprengen?«
»Nicht doch, du Dummchen.« Lachend hob er die Hand, wollte ihr über die Wange streichen, hielt dann aber inne und ballte die dreckigen Finger zur Faust. »Nicht die Stadt, nur einzelne Gebäude, um eine Brandschneise zu schaffen. Einen Graben, der das Feuer aufhält. Das Haus der Bregartners ist jedoch verloren, so wie viele andere.« Er seufzte. »Junge, ist das Bad bereit?«
»Sogleich, Vater!«
Das Haus der Bregartners ist verloren, hallte es in Emilias Ohren. Sie huschte hinaus, packte den Rock mit beiden Händen, hob ihn an und lief, so schnell sie konnte, den Hügel hinauf. Das Haus, unser Haus. Doch dann sah sie erleichtert die weiß verputzten Wände und das Schieferdach durch die Bäume auftauchen.
In der Einfahrt stolperte sie über eine Wurzel und stürzte in den Kies. Ein scharfer Schmerz durchzuckte sie und trieb ihr Tränen in die Augen. Sie richtete sich auf und bemerkte voller Schrecken, dass der gute Leinenrock zerrissen war. Ihre Wäschehose färbte sich rot. Sie zog sie über das Knie, sah die Wunde und biss sich auf die Lippe. Was mache ich jetzt nur?, dachte sie verzweifelt. Ich habe das gute Kleid zerrissen, Mutter wird schimpfen. Sie presste ihr Schnupftuch auf die Wunde, band es dann um das Knie und humpelte zum Haus. Im Hof stand der Wagen, Mats spannte die Pferde ab. Ole füllte die Eimer am Brunnen.
»Als ob ich nicht genug Eimer heute geschleppt hätte«, knurrte er mürrisch.
Emilia öffnete die Küchentür. Auf der Bank saß Sofie und schälte mühsam Kartoffeln. Von Inken, ihrem Vater oder gar der Mutter war nichts zu sehen.
»Emma?« Sofie sah sie erstaunt an. »Du solltest doch bei Jörgensens bleiben, was machst du denn hier?«
»Der Johann hat gesagt, unser Haus sei verloren.« Sie wischte sich über die Nase. Immer noch liefen ihr die Tränen übers Gesicht.
»Komm her, mein Vögelchen«, sagte die alte Magd. »Du siehst doch, dass hier alles in Ordnung ist. Nun, nun.« Tröstend nahm sie das Kind in den Arm. Emilia schmiegte sich an sie und sog ihren Duft tief ein. Sofie roch immer ein wenig nach Kamille und Pfefferminze. Sie kümmerte sich, so gut sie es noch konnte, um den Kräutergarten hinter der Küche.
»Und …«, schluchzte Emilia nun auf, »ich habe mir das Knie aufgeschlagen und das Kleid zerrissen.«
»Zeig mir dein Knie.« Sofie zog das Mädchen auf die Küchenbank und hob den Rock an. »Oh je. Tut es sehr weh?« Sie stand auf, nahm einen Lappen und tauchte ihn in den Krug, der neben dem Ofen stand. Sie säuberte die Wunde. Emilia zuckte zusammen, versuchte dann aber ganz stillzuhalten. Sie biss die Zähne fest zusammen und schloss die Augen. Sofie nahm ein Töpfchen mit Salbe aus ihrem Kräuterkorb. »Ringelblumen helfen beim Heilen. Und das hier hilft gegen Kummer«, sagte sie und gab Emilia zwei gezuckerte Pflaumen.
Das Mädchen stieß den Atem aus, den sie angehalten hatte, und lutschte an den kandierten Früchten, schmeckte die Süße.
Ein lauter Schrei hallte durchs Haus, erschrocken fuhr Emilia auf. »Mutter …«
»Ja«, murmelte Sofie. »Es zieht sich.« Nachdenklich schaute sie auf das kleine Mädchen. »Vielleicht solltest du wieder zu Jörgensens gehen.«
»Wo ist Inken?«
»Oben. Sie richtet die Zimmer.«
»Welche Zimmer?«
Sofie seufzte. »Deine Tante wird gleich kommen. Dein Vater macht sich frisch und wird etwas essen, dann fährt er zurück in die Stadt zu deinem Onkel.«
»Tante Minna? Was will sie denn hier?« Emilia runzelte die Stirn. Sie mochte ihre Tante, auch wenn sie seit letztem Jahr immer so traurig war und oft weinte.
»Irgendwo müssen sie ja wohnen«, murmelte Sofie.
Wieder schrie die Mutter auf.
Emilia zuckte zusammen und straffte die Schultern. Sie stand auf und humpelte in die Diele, schlich sich die Treppe hoch.
Die Schreie kamen aus dem Schlafzimmer der Eltern, welches sich im linken Flügel befand. Emilias Zimmer war auf der rechten Seite des Hauses.
Sie schlüpfte in ihre Kammer und setzte sich seufzend auf das Bett. Sie war nicht brav genug gewesen, sonst würde ihre Mutter nicht solche Schmerzen erleiden müssen. Besorgt sah Emilia an sich herab, hob das Kleid an und untersuchte den Riss. Zu ihrem sechsten Geburtstag hatte die Mutter ihr ein Nähkästchen geschenkt. Sie hatte schon gelernt, ein Taschentuch zu säumen, auch wenn der Saum noch nicht gerade war.
Sie nahm das Kästchen, Nadel und Faden. Angestrengt versuchte sie, den Faden durch das Nadelöhr zu ziehen. Vor lauter Anstrengung streckte sie die Zungenspitze heraus. Endlich hatte sie es geschafft. Nun nahm sie den Rock hoch und inspizierte wiederum den Riss. Allein ausziehen konnte sie das Kleid nicht, die Schleifen und Schließen waren hinten, sie hatte es vergeblich versucht. Es musste also so gehen. Sie drehte den Rock auf links, so weit es ging, und legte die beiden Hälften aufeinander. Ob es funktionieren würde, wenn sie das einfach so zusammennähte? Es musste. Immer wieder drückte sie die Nadel durch den festen Stoff, er war viel dicker als der des Schnupftuchs, das sie gesäumt hatte. Es war mühsam, und diesmal mischten sich Tränen mit Schweiß. Ihr Zeigefinger blutete, weil sie den kleinen Fingerhut nicht gefunden hatte. Es muss gehen, dachte sie wieder und wieder. Ich muss alles richtig machen, ich muss brav sein und darf Mutter keinen Kummer bereiten. Die Schreie, die ab und an durch das Haus hallten, verdrängte sie, so gut sie konnte.
Schließlich verknotete sie den Faden, riss ihn ab und drehte den Rock um. Natürlich sah man die geflickte Stelle noch, aber Emilia fand, dass sie es ganz gut hinbekommen hatte. Erleichtert legte sie Nadel und Faden zurück in das Kästchen und stand auf. Das Knie schmerzte noch, aber die Salbe schien zu helfen. Ihr Magen knurrte. Sollte sie es wagen, nach unten zu gehen? Inzwischen war es Nachmittag, immer noch schob der Wind die dunklen Rauchwolken über den Himmel, die Sonne war nur hinter einem Schleier aus Qualm zu sehen. Der Rasen, auf den ihre Mutter so stolz war, war von einer Ascheschicht bedeckt. Grauer Schnee, dachte Emilia, seltsam sieht das aus. Irgendwie unheimlich.
3. KAPITEL
Die Hufe der Pferde knirschten weniger als sonst auf dem Kies der Einfahrt. Die dicke Ascheschicht dämpfte den Aufschlag. Als würde die Kutsche durchs Wasser gleiten, dachte Emilia verwundert. Das Fuhrwerk hielt vor dem Eingang und nicht, wie sonst, hinter dem Haus am Stall.
Wilhelmina Bregartner war eine stattliche Frau. Die Haare hatte sie normalerweise streng nach hinten zu einem Knoten gebunden, ohne die modischen Locken an den Schläfen. Doch diesmal hingen sie wild um ihren Kopf. Noch nie zuvor hatte Emilia die Tante ohne Haube gesehen. Tante Minna ließ sich von dem Knecht aus dem Wagen helfen und sah sich um, als wäre sie zum ersten Mal auf dem Familienanwesen. Dann ging sie langsam die Treppe hinauf.
Ich muss sie begrüßen, dachte das Mädchen und ging zum Spiegel, um ihre Haare zu richten. Ihre Haube, stellte sie entsetzt fest, musste sie verloren haben. Das Gesicht war von Ruß und Tränen verschmiert, ihre Haare glichen einem Vogelnest, obwohl Inken sie am Morgen frisiert hatte. Sie nahm den Lappen, tauchte ihn in das kalte Wasser der Waschschüssel und rieb sich über das Gesicht. Es wurde schlimmer statt besser. Auch die Seife, die leicht nach Lavendel duftete, half nicht viel. Schließlich gab Emilia auf, versuchte, die losen Haarsträhnen in dem Knoten im Nacken zu befestigen, aber auch das wollte ihr nicht wirklich gelingen.
Schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen und ging langsam nach unten. Tante Minna saß auf der Küchenbank und nicht, wie sonst, in der Stube. Erstaunt blieb Emilia an der Tür stehen. Auch ihr Vater saß in der Küche am Tisch und löffelte den Eintopf aus einer Schüssel. Es duftete nach fettem Speck, Erbsen, Bohnen und Kartoffeln, nach Bohnenkraut und Zwiebeln. Ein deftiger Geruch. Emilias Magen krampfte sich zusammen.
Tante Minna sah wie zerrupft aus. Auch ihr Gesicht war grau und streifig, als hätte sie nur halbherzig versucht, die Asche rasch abzuwischen. Der Kragen war grau und hob sich kaum von dem dunklen Kleid ab. Die Haare waren zerzaust und angesengt. Sie sah auf, ihr Blick traf auf Emilia.
»Kind!« Schrill klang die Stimme der Tante durch die Küche, und Inken, die am Herd stand, fuhr herum. »Sollte sie nicht bei den Nachbarn sein?«
Auch ihr Vater hob den Kopf und sah sie an. Emilia fühlte sich plötzlich ganz klein und verloren. Sie wollte doch alles gut und richtig machen. Vaters Haut glänzte rötlich, er hatte gerade gebadet. Das Haar war noch feucht. Die Koteletten viel kürzer als sonst. Emilia zog die Stirn kraus, doch dann erinnerte sie sich an die angesengten Haare von Johann Jörgensen. Ihr Vater hatte eine tiefe Schramme auf der Stirn, wie sie erschrocken feststellte.
»Vater, du hast dich verletzt!« Sie lief auf ihn zu, zögerte jedoch kurz, bevor sie ihn erreichte. Doch er öffnete die Arme und zog sie an sich.
»Mein Täubchen, du sollst doch gar nicht hier sein«, seufzte er. »Dies sind schwere Zeiten für uns. Willst du nicht lieber zu den Jörgensens gehen?«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein! Ich habe aber Hunger«, sagte sie dann leise. »Darf ich auch etwas essen?«
Ihr Vater lachte auf, auch wenn es bitter klang. »Zumindest zu essen haben wir noch reichlich.« Er sah zu seiner Schwägerin. Ihr Mund war zu einem dünnen Strich geworden.
»Das Kind sollte nicht hier sein«, zischte sie und schaute nach oben. »Sie sollte das nicht mitbekommen.«
Emilia streckte das Kinn nach vorn. »Ich weiß, dass Mutter ein Kind bekommt«, sagte sie trotzig. Dann drückte sie sich wieder an ihren Vater. Er roch nach Seife und Leder. Nach Rosmarin, weil Sofie Rosmarin zur Seife gab, nach Lavendel, weil die getrockneten Blüten in Säckchen in den Schränken lagen – aber er roch auch nach Rauch, obwohl er gerade gebadet hatte. Oder kam der Geruch von ihren eigenen ascheüberzogenen Kleidern?
»Komm, setz dich auf die Bank und lass deinen Vater essen.« Inken klang fröhlich, aber es wirkte nicht echt. Sie wich dem Blick der Tante aus und stellte eine Schüssel mit dem dampfenden Eintopf auf den Tisch, legte ein Stück Brot daneben. »Und iss. Ihr Bad sollte gleich fertig sein, gnädige Frau«, sagte sie dann zu Tante Minna.
Wieder wechselten die Erwachsenen stumme Blicke. Emilia zog fröstelnd die Schultern hoch. Langsam ging sie zur Küchenbank und setzte sich neben die Tante.
»Ich habe für alle gebetet«, sagte sie leise. »Wir waren in Ottensen in der Kirche. Alle zusammen. Die Jörgensens und ich.«
»Das ist fein, mein Kind«, sagte ihr Vater.
»Lieber Herr Jesus, ihr lasst das Kind SO in die Kirche gehen? Wer hat denn das Kleid geflickt? Etwa die alte Sofie? Die kann ja kaum mehr einen Löffel halten. Warum gebt ihr sie nicht ins Armenhaus?«
Emilia hätte in den Boden versinken mögen, doch dort tat sich kein Loch auf. Inken ging um den Tisch herum, besah sich das Kleid und grinste zu Emilias Erstaunen. »Hast du das selbst versucht?«, flüsterte sie. Emilia nickte.
»Wilhelmina, Sofie ist schon ihr Lebtag in dieser Familie. Sie hat meinen Bruder und mich großgezogen, hat unsere Mutter unterstützt«, sagte Martin Bregartner mit leiser, aber keineswegs freundlicher Stimme. So sprach er immer mit Emilia, wenn er nicht zufrieden mit ihr war. »Ich werde den Teufel tun und Sofie auf die Straße setzen oder ins Armenhaus geben, nur weil sie inzwischen alt ist und keine Familie hat, die sie aufnehmen kann. Wir sind ihre Familie.« Er räusperte sich. »Dies ist ein schwerer Tag für uns alle. Wir sollten versuchen, ihn so gut wie möglich hinter uns zu bringen.«
Mats kam in die Küche. Auch er hatte sich gewaschen und umgekleidet. »Ich habe den Badezuber gefüllt, gnädige Frau«, sagte er und verbeugte sich leicht. Sein Gesicht war grau vor Müdigkeit.
»Schön. Hilfst du mir, Inken? Ich hoffe, ihr findet unser Personal noch in dem Chaos. Vermutlich werden sie bei ihren Familien Zuflucht gesucht haben. Aber bis dahin …« Sie warf Inken einen eindringlichen Blick zu.
»Aber selbstverständlich, gnädige Frau.« Inken folgte Tante Minna in die Badestube. Sie ging nicht so forsch und schnell wie sonst, wunderte sich Emilia.
»Mats, du und Ole, ihr könnt euch noch zwei Stunden ausruhen, doch dann sollten wir wieder los.« Emilias Vater schaute durch das Fenster in den Küchenhof. Es war düster, immer noch schneite es Asche. »Wir müssen meinen Bruder unterstützen.«
»Sehr wohl, gnädiger Herr.«
»Habt ihr schon gegessen?«
Mats knüllte seine Mütze zwischen den Fäusten und blickte verlegen auf den Küchentisch, an dem sich normalerweise das Gesinde zum Essen versammelte.
»Nein. Wir wollten Euch nicht stören«, murmelte er.
Martin Bregartner sah verwundert auf, dann schien er zu begreifen. »Du lieber Himmel, hol Ole und dann setzt ihr euch und esst. Das Essen ist gut und reichhaltig.« Er überlegte kurz. »Und bring uns einen Krug Branntwein aus dem Keller. Den können wir jetzt gebrauchen.« Dann wandte er sich Emilia zu. »Was ist mit deinem Kleid geschehen?«
»Oh Vater«, sie senkte beschämt den Kopf. »Ich bin gestürzt und habe das Kleid zerrissen. Es war keine Absicht und ich hatte mir so vorgenommen, heute besonders vorsichtig zu sein. Dreckig habe ich mich auch gemacht.« Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen.
»Kind, wohl kaum einer wird an diesem Tag sauber bleiben können.« Er strich sich über die Stirn. Dann lauschte er. Oben konnte man Schritte hören, manchmal ein Wehklagen oder einen Schrei. Doch es war nicht so wie sonst, dachte Emilia. Die Schreie klangen nicht ganz so verzweifelt wie bei den Malen zuvor.
Ole und Mats setzten sich zögernd zu ihrem Herrn an den Tisch. Sie rochen nach der grünen Seife, die Inken auch für die Wäsche und den Boden benutzte. Sofie kochte immer noch die Seife für den Haushalt, auch wenn man diese Dinge auf dem Markt für ein paar Pfennige erwerben konnte. Auch buken sie ihr Brot selbst und räucherten im Herbst die beiden Schweine, die hinter dem Nutzgarten gehalten wurden und die Küchenabfälle bekamen. Tante Minna lachte oft darüber. »Die Familie ist wohlhabend«, hatte sie zu Mutter gesagt. »Aber ihr verhaltet euch wie arme Bauern.«
»Geld haben kommt von Geld halten«, hatte die Mutter geantwortet. Den Satz hatte Emilia nicht verstanden, aber sie hatte ihn sich gemerkt.
»Mats und ich fahren gleich wieder in die Stadt. Ole, du solltest besser hierbleiben, um die Frauen zu unterstützen«, sagte der Vater. »Mein Bruder und seine Frau werden eine Zeitlang bei uns wohnen müssen.«
Plötzlich wieherte eins der Pferde im Stall, ein anderes Pferd antwortete. Dann hörten sie Hufgetrappel auf dem Kies.
»Nanu?« Martin Bregartner stand auf und ging zur Küchentür. »Ole, da ist mein Bruder. Versorg sein Pferd.«
»Jawohl, gnädiger Herr«, seufzte Ole. Er sah bedauernd auf die dampfende Schüssel mit dem Eintopf, von dem er kaum drei Löffel gegessen hatte.
»Hinrich. Wir wollten gleich wieder los«, sagte Martin. »Komm rein, komm!«
Hinrich betrat die Küche. Er sah genauso müde und verdreckt aus wie die anderen Männer nach ihrer Ankunft. Der Gestank von angesengtem Haar und verbrannter Wolle breitete sich in der Küche aus. Emilia hielt die Luft an.
»Es ist alles verloren«, sagte Hinrich. »Heute Morgen noch haben sie den Gottesdienst in der Nikolaikirche abgehalten und gebetet. Heute Mittag gab es noch einen Gottesdienst, doch die Kirche war nicht mehr zu retten. Wir haben alles versucht, aber wir haben es nicht geschafft. Vor einer Stunde ist der Turm eingestürzt.« Er schaute seinen Bruder an und schüttelte den Kopf. »Die Glocken haben noch geläutet, dann fiel der Turm in sich zusammen. Ist das ein Zeichen Gottes, Bruder? Ist das ein Zeichen?«
»Das glaube ich nicht«, sagte Martin leise. »Warum sollte Gott uns so strafen wollen? Komm, setz dich.«
Hinrich schaute an sich herab. »Ich werde die ganze Küche verschmutzen.«
»Das macht nichts, das kann man wieder in Ordnung bringen. Deine Frau ist gerade in der Badestube. Mats, hol Wasser, damit wir es für meinen Bruder erwärmen können.« Er schenkte einen Becher voll mit Branntwein und reichte ihn seinem Bruder. »Trink!«
»Unsere Dienerschaft hat sich retten können«, sagte Hinrich, trank gierig und hielt seinem Bruder den Becher abermals hin. »Sie sind bei ihren Familien. Gregor hat mich noch getroffen, bevor ich losgeritten bin.«
»Immerhin«, sagte Martin. »Sie können auch hier unterkommen für die nächste Zeit. Es ist noch Platz im Gesindetrakt und im rechten Flügel.«
»Wir können dich doch jetzt nicht so belasten.« Hinrich zog die Stirn in Falten. »Wie steht es um deine Frau?«
Martin schüttelte den Kopf. »Sie ist noch in den Wehen. Die Hebamme sagt, es wird noch dauern.«
»Möge Gott geben, dass wenigstens das gutgeht«, seufzte Hinrich.
Ja, dachte Emilia, bitte, lieber Gott, lass alles wieder gut werden. Sie ging in den Keller und holte einen Krug Bier.
Inken stand am Herd, rührte in Töpfen und Pfannen. Onkel Hinrich saß zusammengesunken auf der Bank und seufzte. Er hob den Kopf, als sie den Krug abstellte, griff danach und füllte die Becher.
»Prost, Bruder.« Sein Atem roch nach Weinbrand, er lallte leicht.
Martin Bregartner nahm einen Becher und trank. Dann schaute er seinen Bruder an. »Du bist hier kein Gast, dies ist unser Elternhaus, es ist dein Haus wie meins.«
Hinrich nickte. »Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus.« Er nahm einen weiteren großen Schluck. »Ich mag nicht an unser Haus denken. Mir zerreißt es das Herz.«
Mats kam in die Küche. »Inken, die gnädige Frau verlangt nach dir. Sie ist fertig mit dem Bad, hat aber nichts zum Anziehen.« Er grinste schief.
»Du lieber Gott«, stieß die Magd hervor. »Daran habe ich ja gar nicht gedacht.« Sie nahm die Pfanne vom Feuer und stellte den Topf neben die Kohlen. »Das braucht nicht mehr lange. Es muss nur noch ziehen.« Die Pfanne mit Rührei und Speck stellte sie auf den Tisch, dazu einen großen Topf Sülze, Butter und Brot. »Nehmt euch.«
Dann eilte sie in die Diele und lief nach oben.
»Täubchen, du riechst, als wärst du ins Bierfass gefallen«, sagte der Vater zu Emilia und zwinkerte ihr zu. »Du solltest dich umziehen.«
»Ja, Vater.« Emilia blieb unschlüssig am Tisch stehen. Allein konnte sie sich nicht ausziehen, geschweige denn etwas Neues anziehen. Sofie war bei Mutter, Inken kümmerte sich um Tante Minna. Sie hatten keine Zofe oder ein Kindermädchen.
»Kind, willst du nicht auf deinen Vater hören?«, sagte Hinrich und schenkte sich wiederum ein.
»Emilia?« Martin Bregartner sah seine Tochter fragend an. »Ist noch etwas?«
»Nein, Vater.« Sie verließ die Küche, machte jedoch in der Diele kehrt. »Ich kann die Schlaufen und Schließen nicht allein lösen«, sagte sie leise, als sie wieder vor ihrem Vater stand.
»Ach je.« Er runzelte die Stirn. »Ich verstehe. Sonst macht das Inken.«
»Oder Sofie«, sagte Emilia zaghaft.
»Verstehe.« Er richtete sich auf, reckte sich, packte dann das Kind und nahm es huckepack. »Dann marschieren wir beide nach oben und ich helfe dir.«
»Martin?«, sagte sein Bruder fragend. »Was machst du?«
»Ich helfe meiner Tochter.«
»Das schickt sich nicht.«
»Mag sein, aber deine Frau will aus dem Bad und du willst rein. Meine Frau bekommt ein Kind und wir haben nur zwei Mägde.« Er zuckte mit den Schultern. »Ösen und Schlaufen öffnen kann ich.«
Dann trug er Emilia die Treppe hoch.
»Ich wollte lieb sein und alles richtig machen«, sagte sie kaum hörbar.
»Du machst alles prima. Aber du musst jetzt dieses Kleid ausziehen, bevor dich alle für einen Bierkutscher halten.« Er lachte leise und stellte sie in der Mitte ihres Zimmers auf den Boden. Der Feuerschein war deutlicher als zuvor zu sehen. Martin ging zum Fenster und schaute in Richtung Stadt. »Der Herr sei uns gütig«, murmelte er.
Emilia löste den Knoten der Schürze, legte sie auf ihr Bett und seufzte dann laut. »Mehr schaffe ich nicht allein, Vater.«
»Was?« Er drehte sich zu ihr um. »Ach je, komm her. Warum müsst ihr Weiber auch so komplizierte Kleidung tragen?« Nach und nach löste er jede Schlaufe und Öse, jedes Häkchen. Dann zog er sie aus dem Kleid.
»Das ist nur die Sonntagskleidung«, sagte Emilia ernst. »In der Woche kann ich mich fast schon allein anziehen.«
Martin lachte leise. »Dann ist es ja gut.«
In diesem Moment hörten sie wieder einen Schrei aus dem Schlafzimmer.
»Geh runter«, sagte er. »Iss etwas. Ich schau mal nach deiner Mutter.«
Ohne sie noch einmal anzusehen, verließ er das Zimmer.
Emilia stand in ihrer Unterwäsche da, zog die Schultern hoch. Das konnte er nicht so gemeint haben, sie konnte nicht so nach unten gehen. Rasch nahm sie sich eines der Kleider aus dem Schrank, das sie nur über den Kopf zu ziehen brauchte. Eine frische Schürze und gut. Strümpfe hatte sie den ganzen Tag schon nicht getragen, und dass der Saum der Wäschehose fast schwarz war, würde hoffentlich niemand bemerken. Sie strich mit der Bürste einmal kurz durch ihre Haare und sah sich im Spiegel an. Grau sah ihr Gesicht aus, dreckig und erschöpft. Und ihr Magen knurrte. Sie schaute zum Fenster hinaus und sah die dunkelroten Flammen unter den Wolken. Immer noch brannte Hamburg lichterloh.
Auf der Küchenbank saß die Hebamme und trank einen Becher Bier. »Der Krug ist leer«, sagte sie mürrisch.
Mats griff nach dem Krug und nahm einen weiteren vom großen Kasten in der Ecke. »Bei dem Wetter haben wir alle Durst.«
Erleichtert sah Emilia ihm hinterher. »Wo sind denn Tante und Onkel?«, fragte sie Inken verwundert.
»Deine Tante liegt in der Stube auf der Chaiselongue, mit einem kühlen Tuch auf der Stirn.« Inken biss die Zähne zusammen. »Und dein Onkel ist in der Badekammer und säubert sich. Sobald er fertig ist, werde ich den Ofen erneut anfeuern und die Wäsche waschen müssen.«
»Hast du noch Eier und Speck?«, fragte die Hebamme.
Inken stellte die Schüssel auf den Tisch. Auch Emilia nahm sich. Das Essen tat gut, aber sie spürte, wie ihr immer wieder die Augen zufielen.
»Das wird eine lange Nacht werden«, sagte die Hebamme.
»Eine weitere lange Nacht? Ist denn kein Ende abzusehen?« Inken seufzte laut. »Die arme Herrin.«
»Hast du eine Henne, der du den Kopf umdrehen kannst? Eine kräftige Brühe wird sie brauchen, wenn alles vorbei ist. Sie ist jetzt schon sehr geschwächt. Möge der liebe Gott seine Hände schützend über sie halten.«
»Der liebe Gott«, schnaubte Mats und stellte die Krüge mit dem würzigen Bier auf den Tisch, »scheint uns alle vergessen zu haben.«
»Mats!«, rief Inken entsetzt.
»Ist doch wahr«, sagte er wütend. »Ich hoffe, die Familie meiner Schwester ist dem Feuer entkommen. Ihr Hab und Gut werden sie nicht gerettet haben. Wie vielen anderen mag es genauso gehen? Was ist mit deiner Familie, Inken?«
»Ich habe noch nichts gehört.« Sie faltete die Hände und schien ein stilles Gebet zu sprechen.
»Bursche!«, rief der Onkel aus der Badekammer. »Bring mir etwas zum Anziehen!«
»Hier!« Martin Bregartner kam in die Küche. Über dem Arm trug er Kleidungsstücke. »Gib dies meinem Bruder.«
Inken sah ihn fragend an, doch er schüttelte den Kopf.
Die Hebamme erhob sich stöhnend. »Dann werde ich mal nach Eurer Frau schauen.«
»Gebe Gott«, murmelte Martin, »dass sie es bald überstanden hat.« Er trat zum Fenster und rieb sich über den Nacken. Die Anspannung, die von ihm ausging, war spürbar.
Ole brachte weitere Eimer mit Wasser in die Badestube. Der feuchte Dampf verteilte sich im Erdgeschoss. Die trockene Hitze hatte immer noch nicht nachgelassen und auch der Wind fegte weiterhin um das Haus.
»Hoffentlich legt sich der Wind bald, der facht doch immer wieder die Brandherde an.« Martin schaute besorgt nach draußen.
»Es sieht danach aus«, meinte Hinrich und ließ sich schwer auf die Bank fallen. »Wenn das so weitergeht, wird noch die ganze Stadt in Flammen aufgehen.«
»Da kommt jemand angeritten«, sagte Ole und brachte zwei weitere Eimer voll Wasser ins Haus. Inken war in die Badestube gegangen, wo auch die großen Waschbottiche standen. Der Geruch von grüner Seife drang in die Küche.
»Wer kann das sein?« Hinrich schenkte sich einen Becher voll Bier ein und trank mit großen Schlucken, dann seufzte er laut auf und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund.
»Es ist Gregor, dein Bursche.« Martin öffnete die Tür zum Hof. »Mats, nimm ihm das Pferd ab und versorg es. Dann lauf zum Röperhof. Inken braucht Hilfe, sie schafft das nicht allein.«
Emilia hörte das Quietschen des Pumpschwengels, hörte Wasser im Hof plätschern.
»Wo bleibt er denn?«, fragte Hinrich ungeduldig. »Martin, deine Hosen sind zu eng. Bekommst du nicht genügend zu essen?«
»Ich bewege mich wohl mehr als du.« Martin grinste schief. »Wir werden die Schneiderin bemühen müssen. Ihr braucht eine komplett neue Garderobe, so schnell es geht.«
»Die Schneider werden sich eine goldene Nase an dem Brand verdienen, ebenso wie die Zimmerleute, die Schreiner und alle anderen Gewerke auch.« Nachdenklich zog er die Stirn in Falten. »Wir haben doch auch Länder an der Este, nicht wahr?«
»Ja, mütterlicherseits haben wir dort einige Äcker und Brachland geerbt. Aber der Boden ist lehmig und zum Deich hin sandig. Dort gedeihen nur Obstbäume.«
»Lehmig. Das ist es doch, Bruder.« Hinrich stand auf und klopfte Martin auf die Schulter. »Es ist Lehmboden, dort werden wir eine Ziegelei errichten. Die zwei alten Schleppkähne an der Werft bringen wir zur Este. Sie können die Ziegel nach Hamburg bringen. Gleich morgen werde ich Brennholz ordern und Ziegelformen machen lassen.«
Martin drehte sich um. »Ist das dein Ernst, Hinrich? Du denkst jetzt ans Geschäft, willst aus dem Unglück anderer Gewinn schlagen?«
»Es ist auch mein Unglück und deines. Unser Haus ist niedergebrannt, wir werden es neu errichten müssen. Viele Häuser werden neu errichtet werden. Warum sollen wir uns nicht daran beteiligen? Schon in einigen Wochen könnten wir Ziegel produzieren. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis man bauen kann?« Seine Augen leuchteten.
»Noch brennt die Stadt und du denkst schon über den Aufbau nach. Wahrscheinlich berechnest du schon die Preise, die wir nehmen können.«
Martin schüttelte die Hand seines Bruders ab. »Ist gut, Gregor. Komm rein und berichte.«
»Nein, Herr, ich bin voller Asche und Staub«, rief der Bursche und steckte den Kopf abermals unter den Wasserstrahl.
»Lass gut sein. Wir sahen nicht anders aus. Hier wartet ein kühles Bier auf dich.«
Nur zögernd betrat der Bursche die Küche. Er hatte seine Jacke abgelegt, die Ärmel hochgekrempelt. Sein Gesicht glänzte rot, er schüttelte das Wasser aus den Haaren und fuhr sich mit den Fingern über den Kopf.
»Hier.« Martin reichte ihm einen Becher. »Trink. Und setz dich.«
»Wie sieht es aus in der Stadt?«, fragte Hinrich. »Ist das Feuer bezwungen?«
Gregor schüttelte den Kopf. »Es wütet und wütet und wütet. Wie das Fegefeuer«, sagte er leise. »Sie haben das Rathaus geräumt und dann gesprengt. Aber es hat nichts genutzt, die Flammen haben die Schneise übersprungen.«
»Großer Gott!«, rief Martin aus.
»Es sind Spritzen aus der ganzen Umgebung gekommen, um zu helfen. Die Wehren aus Altona, Wandsbek, Wedel und Uetersen. Ich habe gehört, dass weitere Spritzen kommen sollen, sogar aus Lübeck und Kiel. Aber ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht«, sagte er erschöpft.
»Es ist unglaublich«, sagte Hinrich.
»Hast du Dörte oder Inge gesehen?« Tante Minna stand plötzlich in der Küche.
»Nein, gnädige Frau. Ich denke, sie sind wohl zu ihren Familien geflohen, wenn sie nicht hier sind.«
»Siehst du sie etwa hier?«, fragte Tante Minna schnippisch. »Hinrich, wir sollten sie morgen suchen. Es ist unerträglich ohne eigene Dienstmagd.«
Inken kam in die Küche. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ihre Wangen waren gerötet, die Haare und die Kleidung feucht vom Dampf. Doch um ihre Augen herum war sie blass.
»Gregor, lass dir von Mats Anziehsachen geben, damit ich deine gleich mitwaschen kann«, sagte sie leise.
»Lass den Burschen doch erst einmal etwas essen. Es ist noch ein Rest von dem guten Eintopf da«, meinte Martin und drehte sich dann zu seiner Magd um. »Hast du schon etwas gegessen?«
»Einen Kanten Brot.«
»Dann setz du dich auch und iss. Es hat keinen Zweck, wenn wir bis zum Umfallen schuften. Die nächsten Tage wird es noch genug zu tun geben. Mats hab ich zum Röperhof um Hilfe geschickt.«
Dankbar setzte sich Inken und nahm sich eine Schale Eintopf.
»Und wir gehen in die Stube. Dort können wir in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll«, beschloss Martin.