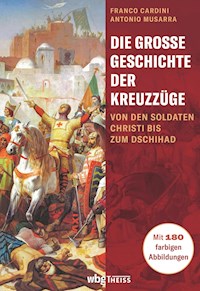
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Religionskriege, Ideologiekriege oder frühe Formen der Kolonialkriege? Die Geschichte der Kreuzzüge ist lang. Auch wenn sie im Hochmittelalter als bewaffnete Pilgerfahrten nach Jerusalem entstanden, blieben die religiös motivierten Kriege nicht allein auf das 12. und 13. Jahrhundert beschränkt. Die beiden Experten für europäische Mediävistik Franco Cardini und Antonio Musarra stellen detailliert dar, wie sich das Phänomen Kreuzzug über die Jahrhunderte entwickelte: Vom ersten Aufkommen des Kreuzzug-Gedankens über Luthers "Türkenbriefe" bis zur neuzeitlichen Verteidigung der balkanischen und mediterran-östlichen Grenzregionen. - Warum gab es Kreuzzüge? Die Rechtfertigungen für Kriege im Namen der Religion - Auf Waffen- und Bußgang ins Heilige Land: Wer waren die Kreuzritter? - Institution Kreuzzug: Militärische, kulturelle und politische Hintergründe - Das neue Standardwerk: Glänzend erzählte und reich bebilderte Gesamtdarstellung - Ein faszinierendes Geschenk für Geschichtsinteressierte Streifzug durch die europäische Geschichte vom Hochmittelalter zur Neuzeit Ob christliche Kreuzfahrer oder moderne Dschihadisten – sie alle legitimierten die Gewalt mit religiösen Argumenten. Die Autoren stellen bei der Darstellung der kriegerischen Auseinandersetzungen den Mittelmeer-Raum ins Zentrum des Geschehens. Die abschließende Betrachtung der Kreuzzüge aus Sicht der Araber vervollständigt die erste umfassende Gesamtdarstellung, die die Thematik in ihrer ganzen Breite erfasst. Über 180 Abbildungen machen die Geschehnisse greifbar und sorgen für Überblick. Das macht "Die große Geschichte der Kreuzzüge" zu einem neuen Standardwerk zu einem der Zentralthemen der Geschichte!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die italienische Originalausgabe ist 2019 bei il Mulino unter dem Titel
Il grande racconto delle crociate erschienen. © 2019 by Società editrice il Mulino, Bologna
Die deutsche Übersetzung wurde vom Centro per il libro e la lettura des italienischen Kulturministeriums gefördert.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg THEiSS ist ein Imprint der wbg.
© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Lektorat: Daphne Schadewaldt, Wiesbaden
Satz: Arnold & Domnick, Leipzig
Umschlagabbildung: Émile Signol, Die Einnahme von Jerusalem, 1847.
© incamerastock/Alamy Stock Photo
Umschlaggestaltung: www.martinveicht.de
Abb. auf Seite 2 und Seite 599: Adolfo Wildt, Il crociato, 1906.
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4419-9
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4421-2
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4422-9
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zu den Autoren
Impressum
INHALT
Einführung
ERSTER TEIL
Kapitel eins Die Kreuzzugsidee und ihre Wurzeln
Heiliger Krieg, Dschihad und Kreuzzug | Die Rechtfertigung des Krieges | Die Sakralisierung des Krieges | Der miles christianus
Kapitel zwei Europa und der Mittelmeerraum vor den Kreuzzügen
Europa erwacht | Eine Gesellschaft in Bewegung | Ein Jahrhundert der Reformen | Expansion und Eroberung | Fenster nach Osten
Kapitel drei Die Eroberung des Ostens
Der Aufruf von Clermont | Die peregrinatio der pauperes | Die Ilias der Barone | Die Odyssee der Kaufleute | Auf nach Jerusalem | Die Einnahme der Heiligen Stadt, 15. Juli 1099
Kapitel vier Das fränkische Königreich von Jerusalem und die Fürstentümer im Heiligen Land
Gesta Dei per Francos | Ein Reich errichten | Die Rolle der Seestädte | »Denn wir, die wir Abendländer waren, sind nun Orientalen geworden« | Die Ritterorden
Kapitel fünf Kurzlebige Erfolge
Der Fall von Edessa, 1144 | Bernhard und der Kreuzzug | »Nolite confidere in principibus« | Saladin | Der aussätzige König | So viel Köpfe, so viel Sinne | Die Niederlage von Hattin und der Fall Jerusalems, 1187
Kapitel sechs Der Kreuzzug der Könige
Die Rückeroberung Jerusalems | Barbarossas Kreuzzug | Ein König für ein Königreich | Weder Gewinner noch Verlierer | Der Kreuzzug der Venezianer
ZWEITER TEIL
Kapitel sieben Der Kreuzzug im 13. Jahrhundert
Der Kreuzzug als Bewegung und als Institution | Ein gerechter und legitimer Krieg? | Gelübde und Ablässe | Kreuzzug und Ketzerei | Kreuzzug und Mission
Kapitel acht Das zweite Königreich
Outremer | Eine neue Hauptstadt | Die Verteidigung des Königreichs | Ein labiles Gleichgewicht
Kapitel neun Der Kopf der Schlange
In des Sultans Land | Tod auf dem Nil | Der Kreuzzug des exkommunizierten Kaisers | Der Kreuzzug der Barone | Der Kreuzzug des heiligen Königs | Von Sklaven zu Sultanen
Kapitel zehn Der Verlust des Heiligen Landes
Der Krieg von Sankt Sabas | Zwischen Mongolen und Mamluken | Der Kreuzzug der Italiener | Akkon, 1291 | Rückeroberungsversuche
Kapitel elf Das Heilige Land zurückgewinnen?
Ein Kreuzzug mit Tinte und Feder | Vorwürfe über Vorwürfe | Deus vult? | 1300 – Kreuzzug und Jubeljahr
Kapitel zwölf Wechselnde Ziele
Heiliges Land oder Konstantinopel | Clemens V. und die Traktate zur Rückgewinnung des Heiligen Landes | Das Problem der Ritterorden | Der Kreuzzug in der Ägäis | Das Konzil von Vienne und das Ende der Templer
DRITTER TEIL
Kapitel dreizehn Die Erfindung des Feindes
Beinamen und Schmähwörter | Die Wiederkehr der Volksbewegungen | Die Kustodie des Heiligen Landes | Zwischen Smyrna und Alexandria
Kapitel vierzehn Eine europäische Leidenschaft
Die Söhne Osmans | Mahdia, 1390 | Nikopolis, 1396 | Ex Oriente lux | Boucicauts aventure
Kapitel fünfzehn Osmanischer Triumph
Auf nach Konstantinopel | Der Kreuzzug auf dem Konzil | Varna, 1444 | Rachegelüste | Konstantinopel, 1453
Kapitel sechszehn Die Verteidigung des christlichen Europas
Ein neuer Kreuzzug? | Belgrad, 1456 | Pius II. und der Kreuzzug | Otranto, 1480 | Kreuzzüge und Propaganda
Kapitel siebzehn Die zwei Mittelmeere
Kreuzzug und Kaperkrieg | Der Kreuzzug in Afrika | Algier | Karl V. und der Kreuzzug
Kapitel achtzehn Gegenangriff
Heiliger Krieg gegen die Türken | Die Barbaresken, Schrecken des Mittelmeers | Der Tod Süleymans | Neue Bündnisse | Lepanto, 1571 | Die Früchte des Sieges
VIERTER TEIL
Kapitel neunzehn Die Abrechnung
Kreuz und Halbmond | Sklaven, Renegaten, Admiräle und Wesire | Der Kreuzzug in Marokko | Schmelztiegel für Europa | Eine aus der Mode gekommene Idee? | Wien, 1683
Kapitel zwanzig Im Zeichen des Kreuzes
Exaltation und Verdammnis | Vendée-Aufständische, Sanfedisten und andere »Kreuzzügler« | Eine neue Blüte | Das romantische Gesicht der Kreuzzüge | Das Risorgimento der Kreuzzüge | Die Société de l’Orient latin
Kapitel einundzwanzig Das Mittelmeer der Gegensätze
Der kranke Mann am Bosporus | Die heiligen Stätten und die »orientalische Frage« | Die Eröffnung des Suezkanals | Mare nostrum
Kapitel zweiundzwanzig Die große Zerstückelung
Das Great Game im Mittelmeer | Nationalismen | Kriegswinde | Ein Gigant in Trümmern
Kapitel dreiundzwanzig Die Erinnerung an die Kreuzzüge
Die Kreuzzüge aus Sicht der Araber | Dschihad und Dschihadismus | Wir und sie: wo verlaufen die Grenzen? | Nicht melting pot, sondern salad bowl
Schluss
ANHANG
Belegangaben zur deutschen Übersetzung
Chronologie
Karte
Personenregister
Ortsregister
Abbildungsnachweis
Einführung
Die gesamte Menschheitsgeschichte lässt sich in vier Zeitabschnitte teilen, nämlich in die der »Verirrung«, der »Erneuerung«, der »Versöhnung« und schließlich der »Pilgerschaft […]. Die Zeit der Pilgerschaft ist der jetzige Abschnitt der Menschheitsgeschichte, in dem wir pilgern und uns in einem stetigen Kampf befinden.«
Jacobus de Voragine, Legenda aurea
Die Geschichte der Kreuzzüge ist lang. Um sie mit der nötigen Genauigkeit zu erzählen, beginnen wir mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem Begriff, der sie bezeichnet und heute allzu häufig im Munde geführt wird, und dem, was eigentlich geschah. Am Ende des 11. Jahrhunderts, also als dem üblichen historischen Narrativ zufolge 1096–1099 der sogenannte »erste Kreuzzug« stattfand, gab es keinen Kreuzzug. Es gab nicht einmal das Wort, das erst später aufkam und die gebräuchlicheren Bezeichnungen expeditio, succursus, auxilium, peregrinatio, iubilaeum, passagium, negotium crucis oder negotium Ihesu Christi ablöste, allerdings nie ganz. Schon die zugrunde liegende Idee selbst erscheint verworren, wenn man die fragmentierte Abfolge kriegerischer und religiöser Aktivitäten betrachtet, denen es an ideologischer Kohärenz fehlte: militärische Expeditionen, bewaffnete Pilgerfahrten, Volksbewegungen. Doch auch wenn es an Institutionalisierung und theoretischem Unterbau noch mangelte – sie zumindest gab es schon: die crucesignati. Als peregrini auf dem Weg nach Jerusalem trugen sie auf ihrem Gewand, auf Schulter oder Brust aufgenäht oder -gestickt, oder auch auf dem Pilgersack ein kleines Kreuz. Ihre Reise war sowohl iter als auch peregrinatio, ebenso Waffengang wie Bußgang. Der Kreuzzug, als bewaffnete Pilgerfahrt nach Jerusalem entstanden, wurde hauptsächlich auf dem Landweg durchgeführt, wobei sich der Transport über das Meer fast sofort als geeignetes Hilfsmittel erwies: zuerst bei der Eroberung des Heiligen Landes und dann bei der Versorgung jener sozialen und bürgerlichen Strukturen lateinisch-westlicher Art, die sich dort bald entwickelten. Mit der Zeit wurde das gesamte Unternehmen mit dem Begriff benannt, der ursprünglich die Überquerung des Meeres bezeichnete: das passagium.
Später, seit dem Konzil von Lyon 1274, wurde feiner unterschieden. Das passagium generale galt als allgemeine Christenpflicht. Man konnte ihr entweder durch den persönlichen Einsatz im Kampf nachkommen oder auf andere Weise seinen Beitrag dazu leisten, etwa durch Zehntzahlungen, Almosen, Geldbußen oder testamentarische Vermächtnisse. Dagegen sprach man von passagium particulare, wenn die Unternehmung genau umrissene Ziele hatte oder nur eine bestimmte Gruppe von Berufskriegern dazu aufgerufen wurde. Sogar den Fall eines passagium quasi particulare hat es gegeben, bei dem einige vornehme Genueser Damen als Wegbereiterinnen einer Expedition im großen Stil auftraten, die dann allerdings nie zustande kam.
Im Verlauf des 13. Jahrhunderts tauchten in den Werken von Chronisten wie Geoffroi de Villehardouin und Johannes von Joinville gelegentlich Wörter und Wendungen auf, die sich auf den eigentlichen Akt der Kreuznahme bezogen (firent croise oder se croizer) oder auf das ganze Unternehmen (croiserie und croisement) oder dessen Teilnehmer (croize und croisse). Doch wurden diese Begriffe eher beliebig eingesetzt. Der Terminus cruciata kam zuerst während des sogenannten Albigenserkreuzzuges und dann im iberischen Bereich in Gebrauch und wurde lange Zeit typischerweise für den wirtschaftlich-finanziellen Aspekt des Unternehmens verwendet. So machte die bulla cruciatae genaue Angaben zu den Zehnten und anderen Beiträgen in klingender Münze, die die Christen für die jeweilige Expedition zu entrichten aufgefordert waren. Erst irgendwann im Laufe des 17. oder 18. Jahrhunderts – die erste Verwendung des Begriffs in diesem Sinne scheint auf die 1638 in Lyon veröffentlichte Histoire des croisades von Archange de Clermont zurückzugehen – bekam die Bezugnahme auf das Kreuz jene allumfassende Relevanz, die wir dem Begriff heute beimessen. Nun konnte »Kreuzzug« nicht mehr nur die Gesamtheit aller Handlungen bezeichnen, die 1099 zur Eroberung Jerusalems geführt hatten und im Folgenden zur Verteidigung des lateinischen Königreichs im Heiligen Land und seiner Vasallenfürstentümer bis zu ihrem Fall im Jahr 1291 beigetragen hatten. Gemeint waren jetzt auch all jene Anstrengungen, die zur Verteidigung ganz Europas unternommen wurden, dem in den folgenden Jahrhunderten Gefahr vonseiten der Osmanen und Barbaresken drohte. Der Terminus cruciata, der in alle europäischen Sprachen Eingang fand, nahm bald weitere, übertragene Bedeutungen an. In den Jahren der Französischen Revolution bemühten ihn sowohl Jakobiner als auch Konterrevolutionäre, meinten damit aber ganz Verschiedenes: Die einen verurteilten die Entscheidung der anderen, sich den Werten der Revolution mit Waffen zu widersetzen, als fanatisch und reaktionär, während ebendiese anderen ihre religiösen und politischen Vorstellungen verherrlichend aufs Schild hoben. Die propagandistische Kreuzzugsterminologie wehte auch durch die folgenden Jahrhunderte und reicht, der Mythenbildung reichlich Stoff liefernd, von der Vendée bis ins Süditalien der Sanfedisten, von Rom unter Pius IX. bis zur mexikanischen Cristiada in den Jahren 1926–1929, vom Spanischen Bürgerkrieg 1936–1939 bis zum war against terror eines George W. Bush. Das eigentliche Bild vom Kreuzzug ist dabei mit der Zeit verblasst, obwohl er als kulturelles Phänomen weiterhin außerordentliches Bedeutungspotenzial besitzt. Wie erklärt sich eine solche semantische Anpassungsfähigkeit?
Die Gründe dafür liegen vielleicht in der Natur der Sache selbst. Ein Jahrhundert nach seinen Anfängen wurde der Kreuzzug erstmals einer gewissen Kodifizierung unterzogen. Die Kanonisten versuchten sich im Verlauf des 13. Jahrhunderts an einer genauen Bestimmung der Eigenart des Kreuzzugsgelübdes, also jenes feierlichen Versprechens, das die crucesignati vor ihrer Abreise ablegen mussten und worin sie sich zur Einhaltung der Bedingungen verpflichteten, die der Papst in der entsprechenden bulla formuliert hatte. Im Gegenzug zu diesem feierlichen Versprechen kamen die Kreuzfahrer, die diese peregrinatio sui generis auf sich nahmen, in den Genuss einiger konkreter Vorteile – zum Beispiel der Aussetzung bestimmter Strafurteile oder eines Schuldenmoratoriums für sich und ihre Familien bis zur Rückkehr von der Expedition. Dazu gab es einen hochbegehrten geistlichen Lohn, der in einem vollständigen Sündenablass bestand. Es war derselbe Ablass, den die Päpste, beginnend mit dem Jahr 1300, anlässlich eines Heiligen Jahres gewährten und der die für die jeweilige Schuld des Sünders vorgesehenen zeitlichen Sündenstrafen nach dem Tod vollständig tilgte. Es waren die Kanonisten, insbesondere Sinibaldo Fieschi, der als Papst Innozenz IV. zwischen 1243 und 1254 auf dem Heiligen Stuhl saß, und Heinrich von Susa, der ab 1262 Kardinalbischof von Ostia war, die für solche Unternehmungen die Bezeichnung crux einführten. Sie unterschieden zwischen einer crux transmarina, die über das Meer ins Heilige Land führte, aber auch gegen die Mauren auf der Iberischen Halbinsel oder die Heiden im Ostseeraum gerichtet sein konnte, und einer crux cismarina, die der Bekämpfung der religiösen oder politischen Feinde von Kirche und Papsttum galt, die im Innern der Christenheit lauerten. So wurde ab der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts das Engagement gegen die Ungläubigen praktisch mit dem gegen die mali christiani gleichgesetzt. Sache der Kirche war es, von Fall zu Fall die opportunen Ziele aufzuzeigen. Nachdem man einmal kirchenrechtlich verankert hatte, dass der spezifische Zweck der bewaffneten Pilgerfahrt ins Heilige Land weniger der Schutz der heiligen Stätten war als vielmehr die tuitio, exaltatio und dilatatio christianitatis, konnte man all jene Expeditionen, die die Kriterien der Verteidigung und Verherrlichung von Christi Namen erfüllten, dem iter hierosolymitanum dem Wesen nach gleichstellen und dafür die entsprechenden geistlichen und weltlichen Privilegien gewähren. Damit erschufen Päpste und Kanonisten ein außerordentliches Herrschaftsinstrument über den corpus christianorum, und dies obwohl sich parallel dazu eine breite Front der Ablehnung herauszubilden begann, die einem Kampf unter Christen jegliche Rechtmäßigkeit absprach. Nicht selten wurden sogar die christlichen Misserfolge im Heiligen Land auf ebendiese päpstliche Politik zurückgeführt, der man vorwarf, die Anwendung von Gewalt innerhalb der Christenheit zuzulassen.
Der solcherart institutionalisierte Kreuzzug koexistierte lange Zeit mit der Kreuzzugsbewegung, soll heißen jenem Komplex an Mythen und Vorstellungen, die mit der Praxis der peregrinatio und der Idee der Erlösung, aber auch der ritterlichen aventure verknüpft waren, dabei immer wieder apokalyptische Töne anstimmten und jedenfalls über die rein juristischen oder politischen Aspekte des Phänomens hinausgingen. In der Gedankenwelt und dem täglichen Leben des einfachen Volkes konnte der Kreuzzug lange Zeit seine außergewöhnliche Suggestionskraft bewahren. Die Päpste riefen weiterhin Kreuzzüge aus: gegen Heiden und Ketzer und ab dem 14./15. Jahrhundert gegen die Europa bedrohenden Türken. Die Praxis setzte sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts fort. War das, mit Blick auf seine ursprünglichen Ziele, eine Abweichung oder eine Erweiterung des Kreuzzugsgedankens? Ob erster Kreuzzug oder späte Nachläufer, wir haben es in allen Fällen und aus gutem Grund mit echten Kreuzzügen zu tun. Auch wenn sie verschiedene, wechselnde Ziele verfolgten, haben sie doch miteinander gemein, dass sie von derselben Autorität in derselben Absicht ausgerufen wurden, nämlich die Christenheit auszuweiten oder zu verteidigen. Abgesehen von den zahlreichen Chroniken, die sich mit den Ereignissen im Orient befassen und sich ab dem 12. Jahrhundert auf den lateinischen Osten konzentrieren, wurde der Kreuzzug wiederholt auch zum Gegenstand des humanistischen Nachdenkens vor dem Hintergrund des Türkenproblems. So spricht ein Werk wie La Gerusalemme liberata (Das befreite Jerusalem) dem Anschein nach zwar über den ersten Kreuzzug, beschäftigt sich in Wirklichkeit aber mit der eigenen Zeit: Torquato Tasso beschwört Gottfried von Bouillon und das Heilige Land herauf, meint dabei aber Don Juan de Austria und Lepanto.
Der Kreuzzug als religiöses Phänomen zog seitens der Philosophen – von Voltaire bis Gibbon, Montesquieu, Mailly und Robertson – Verachtung, ja sogar Zorn auf sich. Sie sahen darin eine der ultimativen Manifestationen jenes Fanatismus, der genau das Gegenteil zu dem von ihnen hochgehaltenen Ideal der Toleranz war. Dabei erkannten sie durchaus seine historische Geltung, die sich aus den erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen einer ständigen Konfrontation mit dem Anderen ergeben hatte. So gesehen galt der Kreuzzug im Kern als ein politisch-ökonomisches Phänomen, für das die religiöse Sphäre kaum mehr als eine formale Hülle, wenn nicht gar nur ein Vorwand war. Eine Sichtweise, die kaum in stärkerem Gegensatz stehen könnte zu der wachsenden romantischen Begeisterung, mit der die Helden und Antihelden der Kreuzzüge verherrlicht wurden: von Gottfried von Bouillon über Richard Löwenherz bis hin zum kurdischen Sultan Ṣalāḥ al-Dīn – dem Saladin der westlichen Tradition –, der mal als Ungeheuer gezeichnet wurde (wie der »feroce Saladino« auf den Sammelbildchen eines italienischen Lebensmittelkonzerns in den 1930er-Jahren), mal als großzügiger, ritterlicher und fairer Gegner, zu dem viele Kreuzfahrer dauerhafte Beziehungen pflegten. Dieser Saladin ist es, den Gotthold Ephraim Lessing, inspiriert von Boccaccios Novelle Die drei Ringe, in seinem Drama Nathan der Weise von 1779 zum Sinnbild der Toleranz machte. Ein ähnliches Bild zeichnete Walter Scott, der die geheime Freundschaft zwischen Saladin und Richard Löwenherz in den Mittelpunkt seines Romans Der Talisman (1825) stellte. War den Aufklärern der Kreuzzug nur Unwissenheit, Barbarei und Fanatismus, so bedeutete er Romantikern wie dem Historiker und Royalisten Joseph-François Michaud, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine monumentale sechsbändige Histoire des croisades, gefolgt von einer vierbändigen Bibliothèque des croisades, verfasste, nichts weniger als eine heilige Unternehmung mit dem Ziel, die Christen des Ostens aus der Tyrannei der Sarazenen zu befreien und auf diesem Weg zugleich zur Verbreitung des Christentums und der europäischen Zivilisation in der Welt beizutragen. Vor diesem Hintergrund fand letztlich eine Gleichsetzung von Kreuzzügen mit Heiligen Kriegen oder Missionskriegen statt. Beide kulturelle Haltungen haben in den vergangenen zwei Jahrhunderten die Vorstellungen vom Kreuzzug geprägt und in der Öffentlichkeit – wie eben schon angedeutet – eine ethisch-politische Polemik genährt, die in den unterschiedlichsten Situationen erneut aufflammen konnte. Das war der Fall beim katholischen Widerstand in der Vendée gegen die bewaffneten Kräfte der Französischen Revolution; bei den Freiwilligen, die aus fast ganz Europa, vor allem aber aus Frankreich herbeiströmten, um den Kirchenstaat zwischen 1860 und 1870 gegen die Eroberung durch die italienischen Nationalisten zu verteidigen (wofür sie im Übrigen eine Generalabsolution in Aussicht gestellt bekamen); bei der guerra cristera in Mexiko, als es in den Jahren 1926–1929 zum Aufstand gegen die Regierung des Präsidenten und Freimaurers Plutarco Elías Calles kam. Das galt schließlich auch für die Verwendung des Begriffs cruzada während des Spanischen Bürgerkriegs 1936–1939 durch die franquistische Propaganda, von wo er in den Sprachgebrauch der nacionales überging. Der eine oder andere übereifrige Prälat hätte es gerne gesehen, wenn die Freiwilligen, die zur Unterstützung der Nationalisten nach Spanien eilten, als Kreuzritter anerkannt worden wären, der vollkommene Ablass natürlich inklusive. Davon wollte Pius XI. allerdings nichts wissen.
In den letzten Jahren hat das Aufkommen von Fundamentalismen das Thema erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Durch die Ereignisse seit dem 11. September 2001 wurden die spätestens 1979, dem Gründungsjahr der Islamischen Republik Iran, wieder erwachten Vorurteile an die Oberfläche gespült – allen voran die Vorstellung von Europa und Islam als »historische Feinde«, geopolitisch dazu bestimmt, miteinander in Konflikt zu geraten. Sie ist einer verzerrten, oberflächlichen und rhetorisch zugespitzten Sichtweise geschuldet, die Geschichte vor allem als eine Geschichte der Kriege versteht und dabei vergisst, all diese Einzelepisoden in dem reichen und vielschichtigen Kontinuum zu kontextualisieren, das die gewinnbringenden und engen wirtschaftlichen, kulturellen und diplomatischen Beziehungen bilden. Ein weiteres zäh sich haltendes Vorurteil besagt, der Islam habe sich immer mit Gewalt durchgesetzt – eine Lüge, die manche Publizisten und Pseudohistoriker um die noch lächerlichere Behauptung haben ergänzen wollen, dass sich das Christentum (oder gar der Westen, ob christlich oder postchristlich) im Gegensatz dazu stets nur dank seiner gewaltlos propagierten positiven Modelle von Frieden und Toleranz, repräsentativer Demokratie und technischem Fortschritt ausgebreitet habe. Es waren Fundamentalismen, von denen es keineswegs nur islamische, sondern auch christliche, jüdische und laizistische gibt, die den Kreuzzug beziehungsweise etwas, das ihm ähnlich sehen möchte, wieder in Mode gebracht haben. Und wie in einem Flashback ist dadurch der echte, einer komplexen und nicht allzu bekannten historischen Vergangenheit angehörende Kreuzzug zurückgekehrt und zieht das Publikum von Neuem in seinen Bann. Bücher, Fernsehserien und Filme sind der Beweis dafür. Doch bevor auch wir uns auf die Reise in das Universum der Kreuzzüge begeben, wollen wir noch einmal kurz auf die erwähnte semantische Anpassungsfähigkeit des Begriffs zurückkommen, auf seine verschiedenen Bedeutungsschichten. Denken wir an den Gebrauch (und Missbrauch) des Wortes crusade in der amerikanischen Politpropaganda, beginnend mit den 1948 unter dem Titel Crusade in Europe veröffentlichten Kriegserinnerungen Dwight D. Eisenhowers bis hin zu den Ereignissen seit dem 11. September. Denken wir aber auch an den Ge- und Missbrauch desselben Begriffs in der islamistischen Propaganda, wofür es zahlreiche Belege gibt, so zum Beispiel in dem vom sogenannten »Islamischen Staat«, bekannt unter dem Namen ISIS oder Daesh, verbreiteten Magazin Dābiq, das nicht davor zurückscheut, seine Gegner im Westen als »Kreuzfahrer« und deren Kriege als »Kreuzzüge« zu bezeichnen. Dies geschieht im Übrigen unter Verwendung eines Ausdrucks, der dem klassischen Arabisch fremd ist, das die Kreuzzüge noch weit bis ins 19. Jahrhundert als al-hurub al-franjyya (»Kriege der Franken«, sprich: der Westeuropäer) bezeichnete, bevor sich in den Schulbüchern die eingängigere Bezeichnung al-hurub as-salibyya (»Kriege des Kreuzes«) durchsetzte. Heute hat die – dezidiert westliche – Rhetorik vom »Kampf der Kulturen« auch unter Muslimen ihre Anhänger gefunden.
Émile Signol, Reiterbildnis Gottfrieds von Bouillon, König von Jerusalem, 1844, Versailles, Musée du Château.
Der metaphorische, auch bildhafte Gebrauch des Begriffs bleibt zulässig, solange wir dabei in einer gründlichen und umfassenden Kenntnis seines immensen historischen Potenzials verankert bleiben. In Wahrheit ist der Kreuzzug so etwas wie der »weiße Wal« der europäischen Geschichte. Er ist eines und vieles. Er folgt einem strengen Regelwerk und artikuliert sich doch in einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Einzelfälle, die je nach Epoche und Kontext, in dem ein Kreuzzug ausgerufen wurde, ihre eigenen Ziele verfolgen. Eher als eine Utopie ist er eine Art Proteus der abertausend Formen: immer gleich und doch immer anders. Als juristisch-politisches Instrument und »Kraftidee«, als unerschöpfliche Quelle für Metaphern, als Mythos und, immer und immer wieder, als Anlass für Rechtfertigungen, Verdammungen, Polemiken und Missverständnisse entfaltete sich der Kreuzzug in unterschiedlichen Situationen immer wieder neu, wobei er sich einer allmählich oder auch plötzlich hereinbrechenden Abenddämmerung ebenso fügte wie dem unerwarteten Morgen, der ihn mit neuem Leben erfüllte. Er war der Protagonist zahlreicher Revivals, in denen er durch die metaphorische und propagandistische Verwendung des Begriffs seine Aktualität zurückgewann. Ziel und Zweck hat er wiederholt gewechselt, seinen Schauplatz ebenfalls. Er spielte nicht nur im Heiligen Land, sondern auch in den iberischen Königreichen, im französischen Süden, auf der italienischen Halbinsel und in Nordosteuropa. Mehrfach hat er sich neu definiert: als bewaffnete Pilgerfahrt, als Kampf gegen die Ketzerei, als Instrument politischer Kontrolle, als Verteidigungsmaßnahme an der Vormauer der europäischen Christenheit gegen die osmanischen Offensiven des 15. bis 18. Jahrhunderts, als custodia maris gegen die Barbareskenkorsaren, als Einsatz für die Christianisierung der Neuen Welt. Diese Vielschichtigkeit hat die Wasser getrübt und für zahlreiche Missverständnisse gesorgt, die selbst umsichtige Historiker in die Irre geführt haben. Und doch hätte dies nicht geschehen können, hätten wir es nicht mit einer so wandelbaren Realität zu tun, eben einer wahrhaftigen »Kraftidee« (idée-force) des europäischen Westens. Es ist die Kenntnis ihrer historischen Entwicklung, zu der dieses Buch beitragen will, um gegen die immer wieder auflebende Rhetorik vom »Kampf der Kulturen« immun zu machen. Heute ist das große Meer der internationalen Politik von allzu vielen Walfängern wie der »Pequod« bevölkert, und allzu oft erschallt aus dem Mastkorb der verhängnisvolle Ruf: »Da bläst er! Da!« Von Herman Melville stammt auch der Rat, sich vor den vielen Ahabs unter den Kapitänen in Acht zu nehmen: Wenn sie uns Zeichen geben, ihnen zu folgen, ist es besser, die Einladung nicht anzunehmen.
Hubert und Jan van Eyck, Die Ritter Christi, 1432, Gent, St.-Bavo-Kathedrale.
Kapitel eins
Die Kreuzzugsidee und ihre Wurzeln
Heiliger Krieg, Dschihad und Kreuzzug
Am Ausgang des 11. Jahrhunderts als bewaffnete Pilgerfahrt ins Leben gerufen, entwickelte sich der Kreuzzug zum Kampf um die Bewahrung oder Rückeroberung des Heiligen Landes. Er war die unmittelbare und quasi natürliche Fortsetzung jener Kriege, die gegen die Mauren auf der Iberischen Halbinsel, die Muslime auf Sizilien und die sarazenischen Freibeuter im Mittelmeer geführt worden waren und wurden. Von der Kirche institutionalisiert und instrumentalisiert, sollte er noch verschiedenen Zwecken dienen, sei es die kirchliche Expansion im Nordosten Europas, sei es die Unterdrückung von Häretikern und politischen Gegnern. Häufig trafen Kreuzzug und christliches Missionsideal zusammen, wobei sie mal im Widerspruch zueinander standen, mal einander ergänzten. In jedem Fall ging der Kreuzzug mit dem Streben nach innerem Frieden der Christenheit einher, lag darin doch die Grundvoraussetzung für ein wirksames Vorgehen gegen die Ungläubigen. Als die südöstlichen Grenzen Europas im 14. und 15. Jahrhundert zunehmend durch die osmanische Expansion bedroht wurden, änderte er erneut sein Erscheinungsbild und gab sich nun als Verteidigungskrieg eines geeinten Kontinents und »seines« Meeres gegen die neue Bedrohung durch die Barbaren. Die folgende Phase einer Politik der Bündnisse gegen den Türken, die bis ins 18. Jahrhundert andauerte, ließ neben das religiöse Element ein politisch-diplomatisches treten, wobei Ersteres nie ganz verloren ging, sondern im kollektiven Bewusstsein bis heute weiterlebt.
Es stellt sich also die Frage: Was waren die Kreuzzüge? Religionskriege, ideologische Kriege oder doch Kolonialkriege? Ein frühes Beispiel systematischer Aggression des Okzidents gegenüber dem Orient? Ein fernes Modell rassistisch motivierter Bluttaten? Im gesammelten Schrifttum – mittelalterlichem wie modernem – werden die Kreuzzüge häufig bella sacra, Heilige Kriege, genannt. Bisweilen wird das Adjektiv sacrum, nicht immer mit der gebührenden Sorgfalt gegenüber den theologischen Implikationen, durch sanctum ersetzt. Dessen ungeachtet ist es im Christentum nie zur Ausbildung einer wirklichen Theologie des Heiligen Krieges gekommen. Ebenso wenig waren die Kreuzzüge – also die von dem Wunsch, die heiligen Stätten in Besitz zu behalten oder (zurück) zu erobern, befeuerten Feldzüge, die seit dem 13. Jahrhundert kanonistisch entsprechend untermauert waren – jemals als Religionskriege konzipiert. Und noch weniger galten sie bei der Bekehrung der Ungläubigen als parallele oder gar alternative Form zum Missionsauftrag. Kam es trotz allem zu Fällen von erzwungener Konversion, sind diese von der Kirche nie als Ergebnis einer Missionsabsicht legitimiert worden.
Dies gilt im Übrigen auch für den Islam: Der Dschihad ist kein Heiliger Krieg, sondern eine absolute Bemühung (eine Anstrengung), die man im Namen einer Sache auf sich nimmt, die theologisch und rechtlich als gottgefällig gilt. Zwar kann sie unter Umständen auch in einem militärischen Akt bestehen, ist aber meist ziviler, moralischer oder humanitärer Natur. Heute scheint der Begriff des Dschihadismus die älteren Begrifflichkeiten von Fundamentalismus und Islamismus ersetzt zu haben. Tatsächlich ist er insofern besser legitimiert als diese, als muslimische Gruppierungen existieren, die sich über ihren Einsatz im Dschihad definieren. Doch wie immer sind die Dinge vielschichtiger. Das klassische islamische Recht teilt die Welt in zwei große Gebiete ein: den dār al-Islām, wo der Islam die Vorherrschaft hat, das Leben seinen Gesetzen unterliegt und Krieg nicht nur verboten, sondern völlig unmöglich und undenkbar ist; und den dār al-Harb, wo die Heiden leben (sprich die Götzenanbeter, die durch Vernichtung oder Konvertierung verschwinden müssen) und die sogenannten »Leute des Buchs« (ahl al-Kitāb). Gemeint sind Monotheisten, die den wahren, ihnen von einem heiligen Buch enthüllten Gott kennen: Juden und Christen, einigen islamischen Schulen zufolge aber auch Mazdaisten, Mandäer, Jesiden und Buddhisten. Diese »Buchbesitzer« müssen dem Islam unterworfen werden und seine Überlegenheit als »Siegel der Prophezeiung« und vollkommenen Glauben anerkennen, sollen jedoch nicht gezwungen werden, sich zum Islam zu bekehren. Unter Vorbehalt diverser zivilrechtlicher Einschränkungen dürfen sie im dār al-Islām bleiben und ihren Kult als dhimmi (»Subjekte«, aber auch »Schutzbefohlene«) privat ausüben. Im Übrigen bedeutet das Wort harb, Krieg, das genaue Gegenteil von Islam, welcher Begriff mit salam, Frieden, eng verwandt ist. Da das Arabische eine konsonantische Sprache ist, handelt es sich in letzter Konsequenz sogar um dasselbe Wort, nämlich s-l-m, und bedeutet somit ureigentlich genau das: Frieden, Eintracht, innerstes Einverständnis (soll heißen zwischen göttlichem Willen und menschlichem Wollen, das gehalten ist, jenem zu entsprechen). Islam ist damit ein Synonym von din (Glaube) und nicht zu trennen von dawla (Recht).
Der Islam stützt sich auf fünf Säulen oder Grundprinzipien (Arkan al-Islam). Es sind die fünf wesentlichen Pflichten, die ein guter Muslim zu erfüllen hat: das Glaubensbekenntnis, das tägliche rituelle Gebet, das Fasten im Ramadan, die Pilgerreise nach Mekka mindestens einmal im Leben und die »Almosensteuer« (zakāt). Viele islamische Rechtsschulen fügen diesen fünf Säulen auch den Dschihad hinzu, der buchstäblich in der verdienstvollen Anstrengung des Gläubigen besteht, der aus freiem Willen in eine gottgefällige Richtung strebt. Dies kann, wie gesagt, auch Krieg beinhalten, was in der muslimischen Welt faktisch häufig der Fall gewesen ist. Tatsächlich ist aber jedes im Namen Gottes oder in Erfüllung seines Willens eingegangene Engagement Dschihad – auch ziviles, soziales oder humanitäres. Weder der Islam noch das Juden- oder Christentum kennen einen Heiligen Krieg im eigentlichen Sinne, einen Krieg also, der allein aufgrund der bloßen Tatsache, dass eine Person daran teilnimmt, diese »heiligt«, sprich ganz und gar gottgefällig sein lässt. Ein solcher Krieg, der heiligt, nur weil er aus religiöser Absicht geführt wird, existiert in keiner der drei abrahamitischen Religionen. Der Mensch muss vielmehr vor Gott für jede einzelne seiner Taten Rechenschaft ablegen, nicht nur für den Zweck, dem sie dienen sollen. Dennoch steht fest, dass man sich im Islam oft auf jenen Aspekt des Dschihad berufen hat, der auf den von Gott gewollten, Gott wohlgefälligen Krieg abzielt. Ebenso hat der Islam, obwohl er für sich in Anspruch nimmt, ein einender, befriedender Glaube für alle Gläubigen zu sein, seit dem Tod des Propheten Spaltung und Bürgerkrieg (fitna) zwischen seinen beiden Hauptgruppen, den Sunniten und den Schiiten, erlebt. Dabei ist die unterschiedliche Konfession in gewisser Hinsicht auch Ausdruck ethnokultureller Unterschiede und Rivalitäten: Das Schiitentum hat sich vornehmlich auf persischem Gebiet durchgesetzt, während die Sunniten als größte Glaubensgruppe fast alle übrigen ethnischen Gruppen umfassen. Schiiten finden sich jedoch auch unter Arabern und ural-altaischen Völkern. Die fitna hat zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert vor allem die Form eines Konflikts zwischen Osmanischem Reich (Sunniten) und persischen Safawiden (Schiiten) angenommen. Dabei ist der Dschihadismus, so wie wir ihn heute kennen, das Ergebnis einer komplexeren Situation, die sich erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts herausgebildet hat.
Der Kreuzzug, obgleich mit dem Konzept des Heiligen Krieges ebenso wie mit dem des Dschihad verknüpft, ist etwas anderes. Seine Entstehung ist das Ergebnis eines langen, peinvollen Prozesses, der mindestens bis zu Augustinus von Hippo und seiner Idee vom »gerechten Krieg« zurückreicht, die er nach dem Modell der von Gott gewollten Kriege im Alten Testament entwickelte. Als iustum bellum konnte nur derjenige Krieg gelten, der von einer legitimen Obrigkeit befohlen wurde, deren Macht von Gott selbst verliehen worden war. Als es im Laufe des 11. Jahrhunderts dann zum Bruch zwischen Papsttum und Kaisertum kam, schwand damit zwangsläufig die Möglichkeit, diese Art von Kriegen zu erklären. Das Papsttum kompensierte dies, indem es sich zum Sprachrohr eines vermeintlich göttlichen Willens machte und eine ganze Reihe von Kriegen rechtfertigte, mit seinem Segen versah, gar heiligte. So beispielsweise Papst Alexander II. (1061–1073), der in einem Brief an den Klerus von Volterra Anweisung gab, wie mit jenen Kämpfern verfahren werden sollte, die gegen die Mauren auf der Iberischen Halbinsel ziehen wollten: Ein jeder von ihnen solle seine Sünden beichten und die dafür angemessene Buße auferlegt bekommen. »Wir für unseren Teil«, bekräftigte der Papst, »befreien sie kraft Autorität der heiligen Apostel Petrus und Paulus von dieser Buße und vergeben ihnen ihre Sünden.«
Noch handelt es sich nicht um einen Ablass, der erst gegen Mitte des 12. Jahrhunderts seine theoretische Fundierung erfuhr, sondern um eine Umwandlung: Der Feldzug trat an die Stelle der Buße. Genau dies geschah auch im Fall des ersten Kreuzzuges. Alexander II. rief noch nicht zu einem Feldzug auf, sondern beschränkte sich auf die Unterstützung jenes Vorhabens, das man später als Reconquista definieren würde. Im November des Jahres 1095 wagte sich dann Papst Urban II. in der Schlussphase des Konzils von Clermont ein ganzes Stück weiter vor, als er die christlichen Ritter zu einer Unternehmung anstachelte, die andere Ziele verfolgte. Dabei ging es um die Unterstützung der Christen im Orient und, wie zumindest eine Version seiner Rede glauben macht, womöglich sogar um die Rückeroberung Jerusalems. Der Feldzug nahm in dem Moment die ambivalenten Züge eines Heiligen Krieges an – »Deus vult!«, Gott will es!, sollen die Teilnehmer manchen Chronisten zufolge gerufen haben –, als die vereinte christianitas zur Überzeugung gelangte, dass sich der Sieg mit himmlischer Hilfe würde erringen lassen. Der Appell Urbans II. entspricht faktisch den Kriterien einer echten »Geschichtstheologie«: Unserer Sünden wegen – nostris peccatis exigentibus – habe Gott zugelassen, dass die Sarazenen die heiligen Stätten besetzten. Nun aber vergebe er seinem Volk, das so begierig auf Besserung sinne, und gewähre deshalb seine Hilfe bei der christlichen Rückeroberung, die vielerorts vorangetrieben werde, von der Iberischen Halbinsel bis nach Sizilien – und nun weiter bis in den Orient.
Der byzantinische Kaiser Alexios I. Komnenos, Istanbul, Hagia Sophia.
Doch im Vergleich zur iberischen Reconquista und zur Bekämpfung der sarazenischen Piraterie im Mittelmeer, die von den italienischen Hafenstädten aus gesteuert wurde, stellte der Jerusalem-Auftrag ein Novum dar. Nehmen wir den Feldzug nach Mahdia, der nur wenig früher, im Jahr 1087, auf Betreiben Papst Viktors III. stattfand und an dem sich Einwohner der Städte Pisa und Genua beteiligten: Er besaß alle Merkmale eines Kreuzzuges wie päpstliche Billigung, Dämonisierung des Gegners, Vergebung der Sünden für die Kämpfer, Aussicht auf die Märtyrerkrone für diejenigen, die im Kampf den Tod finden würden. Dazu kamen selbstredend die materiellen Anreize, die allgegenwärtig waren. Und doch lag Jerusalem fern. Dabei war die Vorstellung von der Befreiung der Heiligen Stadt ganz sicher nicht neu. Einen Vorboten solcher Bestrebungen kann man zu Beginn des Jahrhunderts ausmachen, nachdem der fatimidische Imam al-Hākim im Jahre 1009 die Jerusalemer Grabeskirche hatte zerstören lassen. Ein weiteres, noch deutlicheres Warnsignal bedeutete in den 1060er-Jahren die Ankunft der seldschukischen Türken in der Levante, die innerhalb kurzer Zeit die gemäßigtere arabische Dominanz ablösten, nachdem sie das byzantinische Heer in der Schlacht in der Ebene von Manzikert 1071 geschlagen und keinen geringeren als den Basileus Romanos IV. Diogenes gefangen genommen hatten. Drei Jahre später verkündete Gregor VII. unmittelbar nach der Besteigung des päpstlichen Throns in wenigstens sechs Briefen sein Vorhaben, sich höchstpersönlich an die Spitze eines Feldzuges in den Orient zu setzen und bis nach Jerusalem vorzudringen. In die Tat umgesetzt wurde dieser Plan allerdings erst gegen Ende des Jahrhunderts und man fragt sich, weshalb. Nun, sagen wir, dass der Appell von Clermont nicht nur lang gehegte Erwartungen aufgriff, sondern auch die Vorstellungswelt eines Publikums ansprach, das überaus empfänglich für eine »starke« Idee wie jene war, manu militari zur Befreiung Jerusalems zu schreiten. In dieser Idee läuft manches zusammen: Seit geraumer Zeit dienten im byzantinischen Heer auch Söldner aus dem Westen, in der Regel Normannen, die in den 1080er-Jahren allerdings auch etliche Überfälle auf die dalmatinischen Küstenregionen des Kaiserreichs verübten. Der neue Basileus Alexios I. Komnenos rief ausdrücklich den Papst um Hilfe an. Im Frühling des Jahres 1095 empfing Urban II. während eines Konzils in Piacenza mehrere griechische Gesandte, die auf Entsendung eines Kontingents »fränkischer« Krieger drängten, die als Söldner verdingt werden sollten. Möglich, dass dies die Entscheidungen des Papstes in eine bestimmte Richtung gelenkt hat. Im darauffolgenden November schilderte Urban im auvergnischen Clermont jedenfalls eindringlich die Notlage der Christen im Orient und forderte die anwesende Ritterschaft auf, sich auf Pilgerfahrt über das Meer zu begeben. »Wer die Reise nach Jerusalem allein aus Frömmigkeit unternimmt, um die Kirche Gottes zu befreien«, so liest man in den Kanones des Konzils, »und nicht um Ehre und Geld zu gewinnen, dem wird diese Reise als vollständige Buße angerechnet.«
Francesco Hayez, Papst Urban II. ruft in Clermont zum ersten Kreuzzug auf, 1835, Mailand, Gallerie di Piazza Scala.
Nun ist alles beisammen. Wir haben das Ziel des Feldzuges: Jerusalem, seinen Zweck: die Befreiung der Christen, seinen Wert: die Buße. Und das unter nur einer Bedingung: dass die Reise im Geiste der Buße und frei von weltlichen Beweggründen sei.
Wie sollen wir also den Kreuzzug verstehen, wie seine konkreten und seine verborgenen Motive deuten? Handelte es sich um einen Heiligen Krieg, eine bewaffnete Pilgerreise, um beides zusammen oder um noch etwas anderes? Alles kreist zweifelsohne um das Ziel Jerusalem, mit dem sich eine ganze apokalyptische und eschatologische Vorstellungswelt verknüpft, die es so vorher nicht gab. Allein dieser Aspekt genügt, um aus dem Kreuzzug (oder zumindest aus dem ersten Kreuzzug) auch eine Pilgerfahrt zu machen. Doch die Meinungen über das Wesen des Kreuzzugsgeschehens sind so vielfältig wie das Thema. Kurzgefasst lassen sich vier grundlegende Linien ausmachen: Die »Generalisten« wollen jegliche Form kriegerischer Handlung als Kreuzzug bezeichnen, die mit dem heiligen Willen zur Rückeroberung Jerusalems gerechtfertigt wird (das brisante Thema des Heiligen Krieges). Die »Popularisten« (abgeleitet von dem lateinischen Wort populares, das insbesondere die Chronisten des ersten Kreuzzuges gern verwenden) glauben, dass die Essenz des Kreuzzuges in seinem prophetischen und eschatologischen Charakter, in seiner kollektiven Exaltation zu finden ist. Die »Traditionalisten« hingegen wollen Kreuzzüge nur jene Feldzüge nennen, die in engerem Sinne der Eroberung, Verteidigung oder Rückgewinnung Jerusalems und des Heiligen Grabes galten. Die »Pluralisten« schließlich begreifen die Geschichte der Kreuzzüge in langen Zeiträumen und richten ihren Blick auf die mannigfaltigen Fronten, die unter dem Etikett des Kreuzzuges zum Ziel militärischer Expeditionen wurden.
Karte von Jerusalem, unten Tempelritter, Fragment eines Psalters, 12.–13. Jh., Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.
Was die Ursachen der Kreuzzüge angeht, so teilt sich das Lager in »Materialisten« unterschiedlicher kultureller Provenienz, die in den religiösen Beweggründen einen »Überbau« zur sozialen und wirtschaftlichen Realität im östlichen Mittelmeerraum lesen, und in die Vertreter eines »holistischen« Ansatzes. Diesen Letzteren zufolge sollte der lebendige, dynamische Prozess einer komplexen Realität, wie sie etwa die Kreuzzugsbewegung darstellt, unter Berücksichtigung aller ihrer Komponenten angegangen werden, vom Glauben bis zu den Praktiken der Pilgerfahrt, zu millenaristischen Erwartungen, wirtschaftlichen Interessen, diplomatischen Ereignissen, zu den Vorstellungen über den Islam und den durch Propaganda und Predigt verbreiteten Vorurteilen. In der Vielfalt dieser Ansätze ist eines gewiss: Nach dem Wenigen zu urteilen, was wir sicher wissen, ist der Kreuzzug aus einer komplizierten Gemengelage von einzelnen Elementen und Beweggründen entstanden. Um über den Kreuzzug zu sprechen, bedarf es also notgedrungen einer Vielzahl von »Zutaten«: Es bedarf des heiligen Augustinus und seines Konzepts des bellum iustum, der germanischen Krieger, Karls des Großen und seiner »Missionskriege«, eines Papsttums und einer Kirche auf der Suche nach Verteidigern, eines neuen Konzepts des miles Christi, des Sündenerlasses, der Verbreitung von Bußwallfahrten, eines Rahmens kirchlicher und spiritueller Reformen, der im 11. Jahrhundert von Genua und Pisa ausgehenden militärischen Unternehmungen im Tyrrhenischen Meer, der Reconquista auf der Iberischen Halbinsel, der morgenländischen Christen in Gefahr, eines mutigen Papstes. Und zu guter Letzt bedarf es der Heiligen Stadt Jerusalem, des ureigentlichen Ziels jener bewaffneten Pilgerreise mit den Merkmalen eines Heiligen Krieges, die wir üblicherweise Kreuzzug nennen. Der Kreuzzug besteht nicht aus alledem zugleich und doch entspringt er aus alledem.
Die Rechtfertigung des Krieges
Die Idee vom Kreuzzug als Krieg, insbesondere als »Heiliger Krieg«, fand ihren Nährboden zum einen in dem kriegerisch auftrumpfenden Christentum in Byzanz, zum anderen in der Sakralisierung jener Konflikte, mit denen die Christianisierung Ost- und Mitteleuropas zur Zeit der karolingischen und ottonischen Kaiser vorangetrieben wurde. Krieg und Mission, das war eine tragische Liaison, die im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts konkrete Formen annahm. Es handelte sich um eine mit Gewalt christianisierte Welt, die zwar in den Institutionen, nicht aber in den Strukturen, in den äußeren Riten, nicht jedoch in den Bräuchen von Grund auf überzeugt werden konnte. Seit den Kriegen, welche die Franken gegen die Sachsen und Slawen führten, war ein Thema von brisanter Aktualität, nämlich die Wahl zwischen Taufe und Tod. Es begegnet später wieder in den chansons de geste, die durchaus als Spiegel für den Kampf gegen einen als Heidentum inszenierten Islam gelten dürfen, aber auch eine dunkle Erinnerung an jene fernen Ereignisse bewahren. Das Christentum, das dieser Auffassung zugrunde lag, war eindeutig alttestamentlich und apokalyptisch geprägt. Darin verbinden sich sakrale und herrscherliche Sphäre: Reliquien werden mit in die Schlacht geführt, Waffen werden geweiht. Und Bischöfe verstehen sich besser auf die Kunst der Truppenaufstellung oder darauf, den Bär in der Höhle aufzuspüren oder dem Wildschwein nachzujagen, als auf die Lehren und Riten des Allmächtigen. Ein Christentum, ererbt von Theodosius und Justinian, geschmiedet mit der barbarischen Wucht der Söhne des Waldes und der Steppe, die sich womöglich in aller Aufrichtigkeit der Taufe unterzogen hatten, dabei jedoch ihre alten Götter, jene Gebieter über Schlachten und Stürme, niemals ganz vergaßen. Ein Christentum ohne Evangelium gewissermaßen – oder zumindest so gut wie ohne. In jedem Fall aber eines, das dem Irenismus Jesu oder den Metaphern des Paulus den brennenden Zorn des allmächtigen Gottes aus der Apokalypse (Offb 19,11–15) oder die Erbarmungslosigkeit des Herrn der Heere im Buch Jesajas (Jes 3,1) und all der Krieger wie Josua, Gideon, David oder der Makkabäer vorzog. Gemetzel und Verstümmelungen wurden als Werke Gottes gelobt, vollstreckt durch die Hand seiner Auserwählten (Ex 32,26–38; 1 Sam 15,3 oder 2 Makk 15,27–28). Aus solchen Geschehen, Visionen und Zeichen würde sich die Vorstellungswelt der ersten Kreuzfahrer nähren.
Dabei war das Christentum in seinen Ursprüngen eine Religion des Friedens. Die Worte Jesu und sein Beispiel – und noch vor ihm die Johannes’ des Täufers – lehrten, sich dem Bösen nicht mit Gewalt zu widersetzen (Mt 5,21–26, 38–48; Mt 22,21; Lk 3,14; Lk 49–53, Joh 18,10–11). Das galt vor allem für den privaten Bereich, dann aber, beginnend mit dem berühmten Satz »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist«, auch für die öffentliche Sphäre. Die neue Religion hatte im Römischen Reich außerordentliche Verbreitung erfahren und sich gegen die ebenfalls auf Erlösung und ewiges Leben ausgerichteten Mysterienkulte wie den Mithraskult durchsetzen können, indem sie ihre Loyalität gegenüber den kaiserlichen Institutionen und somit ihre Vereinbarkeit mit der pax romana unter Beweis stellte. In der langen Zeitspanne zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert, in der das römische Heer vor allem Verteidigungszwecke erfüllte, war es möglich gewesen, den christlichen Glauben und sein ausgeprägtes Friedensstreben mit dem Militärdienst in Einklang zu bringen. Wie die Acta martyrium belegen, befanden sich nicht wenige Christen in den Reihen der Legionäre. Wohl sahen einige von ihnen in der völligen Unterwerfung unter den Staat eine Form von Götzendienst, sie stellten aber eine Minderheit dar. Tatsächlich kam es unter den Christen, die im Heer dienten, nicht allzu häufig zu Gewissenskonflikten. Die Unvereinbarkeit zeigte sich eher in den möglichen Kontakten mit den für Götzendienst gehaltenen Kulten, die unter den anderen Soldaten praktiziert wurden. So berichtet beispielsweise Tertullian in De corona, wie ein christlicher Soldat unter Septimus Severus sich weigerte, als sein Haupt in der Zeremonie des donativum zur Belohnung mit Lorbeer bekränzt werden sollte. Nach dem Grund seiner Verweigerung befragt, habe der Soldat dem Tribun geantwortet, er sei Christ – »christianus sum« –, und sei daraufhin unverzüglich in den Kerker geworfen worden.
Leander Russ, Die Grabeskirche in Jerusalem, 1842, Wien, Albertina.
Bald zeigte sich, dass man der anhaltenden Gewalt in der Gesellschaft Rechnung tragen, sich zumindest vor ihr schützen musste. Einen ersten Meinungsumschwung in der Kriegsfrage erlebte die Westkirche, als sich das Kaiserreich allmählich dem Christentum öffnete. Der Einfachheit halber könnten wir Konstantins Sieg über Maxentius in der Schlacht an der Milvischen Brücke zum Symbol dieses Umschwungs erklären. Immerhin hatte er ihn nach einer himmlischen Erscheinung errungen und nachdem man das Christogramm auf dem labarum, der Heeresfahne, angebracht hatte. Ohne hier auf Konstantins sogenannte Bekehrung einzugehen, lässt sich feststellen, dass er den Christen damals eine Reihe von Vergünstigungen zugestand, die wir ideell als die Basis der künftigen Allianz zwischen Kirche und Reich ansehen dürfen. Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert begannen die Kirchenväter, systematisch über Themen wie Krieg und insbesondere über das Konzept eines gerechten Krieges nachzudenken. Es war dies ein Erbe des Aristoteles, der sich mit der Frage in seiner Politik auseinandergesetzt hatte (I, 8; VII, 14). Dem Philosophen zufolge durfte Waffengewalt kein Selbstzweck sein. Gerechtfertigt war ihr Einsatz zum Schutz des Gemeinwesens, aber auch bei Eroberungsfeldzügen und zur Unterwerfung von Bevölkerungen, die für das Sklavendasein bestimmt waren, oder, vor allem, »um des Friedens willen«. An solche Konzepte knüpften die römischen Überlegungen zum gerechten Kriegsgrund an, von Livius’ causa belli, die im Bündnisbruch verankert war, bis zu Ciceros Gegenüberstellung von bellum iustum und bellum iniustum. Aus der Begegnung der griechischen und römischen Rechtstradition mit der biblisch-jüdischen entsprang die Idee, derzufolge der Umstand, dass der Kaiser nun Christ war, in vollem Umfang legitimierte, für ihn zu kämpfen. Eine Minderheit stand dem Kriegseinsatz der Christen weiter ablehnend gegenüber, ihr Widerstand ließ jedoch mit der Zeit nach. Das christlich gewordene römische Kaiserreich fungierte als der natürliche Beschützer von Gottes Kirche und musste natürlich als solcher selbst auch verteidigt werden. Heiden und Häretiker konnten eine Bedrohung für seine Stabilität darstellen. Eusebius von Caesarea zufolge waren die Laien gehalten, sich in den gerechten Kriegen des Reiches zu engagieren. Ambrosius, Bischof von Mailand und ein ehemaliger kaiserlicher Amtsträger, säumte nicht, Ende des 4. Jahrhunderts das unauflösliche Band zwischen Kaiserreich und Christentum zu betonen: Der Krieg des einen sei der Krieg des anderen. Ihm zufolge waren alle Kriege des Kaisers gerecht, so wie es auch alle Kriege der Israeliten gewesen seien.
Es war vor allem Augustinus von Hippo, der zu Beginn des 5. Jahrhunderts mit Nachdruck auf die Bedrohung hinwies, welche die Barbaren für das Kaiserreich darstellten und die Häretiker, insbesondere die Donatisten, für die Einheit der Kirche. Diese Gefahr rechtfertige den Gebrauch von Waffengewalt, ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch sein Werk De civitate Dei zieht. Der Krieg, so betont unser Autor, sei zwar mit Sicherheit ein Übel; bisweilen stelle er aber ein notwendiges Übel dar, mit dem sich größeres Unglück abwenden oder ein Unrecht wiedergutmachen lasse. Welche Fälle aber legitimieren es, von einem iustum bellum zu sprechen? Ein Krieg ist für Augustinus dann gerecht, wenn er von einer legitimierten Autorität erklärt wird, wenn er dem Wiederherstellen von Frieden und Gerechtigkeit dient, der Verteidigung von Haus und Hof oder der Rückgewinnung unrechtmäßig entwendeten Eigentums. Schließlich muss er noch von Soldaten geführt werden, die frei sind von Hass oder persönlichen Interessen. Weit entfernt also davon, als Alibi für Kriegshandlungen jeglicher Art herzuhalten, ermöglichte die Formel des iustum bellum eine klare Abgrenzung, in welchen Fällen der Gläubige sich beim Gebrauch der Waffe im Recht fühlen durfte. Dies ließ keine anarchische Entfesselung der Gewalt zu, im Gegenteil: Der gerechte Krieg wandte sich gegen die Gewalt selbst, indem er eine ständig überwachte Ausübung von Macht einforderte, die verhindern sollte, dass die Schwachen unterdrückt werden und Unrecht über Gerechtigkeit obsiegt.
Aus augustinischer Sicht ist es ein ausdrücklicher Befehl Gottes, der den Krieg legitimiert. Obschon Krieg eine Frucht der Sünde ist, kann er zu einem Förderer der Tugend werden, nämlich sobald er zugunsten der Opfer eines Unrechts geführt wird und sich auf diese Weise in einen Akt der Nächstenliebe verwandelt. Unter allen Umständen muss der Christ immer und überall friedliebend sein und, auch wenn er Waffen benutzt, als Friedensstifter agieren.
Wilhelm Durandus der Ältere, Bischof von Mende, gab Ende des 13. Jahrhunderts in seinem Pontifikale die sakramentalisierte liturgische Form vor, in der die Zeremonie der Einkleidung zum Ritter (das sogenannte addobbamento), die wahrscheinlich vorchristlichen und auf jeden Fall weltlichen Ursprungs war, vonstattenging. Dabei legte er dem Zelebranten als Wegweiser für den neuen Ritter ein Zitat aus Augustinus auf die Lippen: »Sis miles pacificus«. Dass der christliche Krieger pacificus (ein Friedensbringer) sein solle, war nicht allein auf den Zweck des Krieges bezogen, an dem er mit dem Auftrag beteiligt sein würde, einen gerechten Frieden anzustreben. Um pacificus zu sein, war auch eine bestimmte Weise der Kriegsführung vonnöten. Es hieß, unnötige Gewalt zu vermeiden, nach dem Sieg Hassgefühle und Rachegedanken zu überwinden, keine Taten zu verüben, die nachteilige Folgen für die Schwachen haben könnten, und die Feinde nicht mehr als notwendig zu schädigen. Hier zeichnet sich die wesentliche Problematik des künftigen Kriegsrechts ab: die Unterscheidung zwischen ius ad bellum (welche Gründe zum Eintritt in den Krieg berechtigen) und ius in bello (das Verhalten der Kombattanten während eines Konflikts).
Die Sakralisierung des Krieges
Die augustinischen Ideen wurden sicher nicht von der gesamten Christenheit geteilt: Im Verlauf der christlichen Geschichte fehlte es nicht an Stimmen, die einen Rückzug aus der Welt forderten und bereit waren, sich den Irenismus auf die Fahnen zu schreiben. Ihr Erbe sollte in jedem Fall sehr lebendig bleiben.
Mit dem Aufkommen der römisch-barbarischen Reiche zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert musste die Kirche sich mit neuen Werten auseinandersetzen, die sich nicht einfach ignorieren ließen. Die germanischen Völker räumten dem Krieg einen besonderen Stellenwert ein, ja er besaß in ihren Augen regelrecht sakrale Züge. Dass es in der Kirche ein Bewusstsein dafür gab, beweist die Praxis, in den Schwertgriff Reliquien einzulassen, was mit aller Wahrscheinlichkeit dem Versuch geschuldet war, die Sitten dieser Völker zu christianisieren. Der Brauch begegnet auch im Rolandslied: Wer erinnert sich nicht an das berühmte Schwert Durendal, dessen Heft einen Zahn des Apostels Petrus, Blut des heiligen Basilius, einige Haare des heiligen Dionysius und ein Stück vom Gewand der Jungfrau Maria enthalten haben soll? Um die Neuankömmlinge, angefangen bei ihren Anführern, zu bekehren, hatte die Kirche keine andere Wahl, als ihre Werte anzuerkennen und christlich umzuformen, um im Gegenzug Schutz zu erhalten. Begünstigt wurde dies durch einen aristokratischen Episkopat, der selbst einer Welt angehörte, in der der Gebrauch von Waffen alltäglich war. Diese Verbindung von germanischer und kirchlicher Welt charakterisierte das Gallien der Franken: Sie lässt sich bereits bei den Merowingern, noch mehr bei den Pippiniden und in der Folge bei den Karolingern beobachten. Mit Letzteren schloss die Kirche eine starke Allianz, untermauert von der renovatio imperii, der Wiedergeburt des römischen Reiches im Westen, die durch die Krönung Karls des Großen in Rom am Weihnachtstag des Jahres 800 bekräftigt wurde. Diese Erneuerung wertete die Idee des »legalisierten« Krieges wieder auf, also des von einer legitimen Autorität erklärten Krieges. Die Figur des Kaisers wurde sakralisiert dank der kirchlichen Salbung nach einem Ritus, der dem biblischen Vorbild Sauls folgte und von dem Merowingerkönig Chlodwig eingeführt worden war. Die Aufgabe des Kaisers war eine doppelte: das Reich zu verteidigen und die Kirche. Die zu diesem Zweck geführten Kriege nahmen mithin einen sakralen Charakter an. Wir erinnern an die militärischen Unternehmungen gegen die zwischen Rhein und Elbe angesiedelten Sachsen, die eine dermaßen starke religiöse Komponente besaßen, dass sie als geheiligte Kriege oder Missionskriege bezeichnet worden sind. Den Feldzügen gingen Messen und Fastenzeiten voraus, begleitet wurden sie von der Verkündigung des Glaubens und von der Verpflichtung zur Annahme des Christentums gemäß der in der Diözese Rom geltenden Lehre und liturgischen Praxis. Dessen ungeachtet handelte es sich keineswegs um heilige, von Gott gewollte Kriege. Verschiedene Stimmen – wie Alkuin von York, der Berater Karls des Großen, oder Johannes Scotus Eriugena, der Lehrer seines Neffen Karl des Kahlen – beharrten weiterhin auf der moralischen Überlegenheit des mit geistigen Mitteln geführten Kampfes. Der sakrale Kern der zur Verteidigung der Kirche und, weiter gefasst, der gesamten Christenheit geführten Kriege, die pugna spiritualis der Seele gegen das Böse und die Sünde, sollte sich zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert noch stärker ausprägen. Das geschah zeitgleich mit den Einfällen von Sarazenen, Ungarn und Normannen, die sich vorwiegend gegen kirchliche Niederlassungen richteten, wo ganz offensichtlich reichere Beute zu machen war. Eine bewaffnete Verteidigung wurde nun zur Notwendigkeit. Man denke nur an die Plünderung Roms durch die Sarazenen im Jahre 846 und an den darauffolgenden Appell Papst Leos IV. an die Franken. In der kurz nach den Ereignissen verfassten Epistola ad exercitum Francorum bekräftigt der Bischof von Rom nachdrücklich, dass jene, die zur Verteidigung des Apostels Petrus herbeieilten, ohne Schwierigkeiten ins Himmelreich gelangen würden. Neu ist hieran die Idee vom Sündenerlass, die später zu einem konstituierenden Merkmal des Kreuzzuges wurde. Der gleiche Gedanke findet sich in der Antwort, die Papst Johannes VIII. in den 870er-Jahren einigen fränkischen Bischöfen gab, als diese fragten, wie es um das Schicksal derjenigen bestellt sei, die in den zur Verteidigung des Glaubens geführten Schlachten fielen. Sie würden, so erklärte der Papst, die Ruhe des ewigen Lebens finden, weil der Herr so gnädig gewesen sei, durch seinen Propheten zu verkünden: »Zu welcher Stunde auch immer er bereut, ich werde mich nicht mehr an alle seine Freveltaten erinnern.«
Labarum Kaiser Konstantins mit Christusmonogramm, Vatikanische Museen.
Obwohl Reue keineswegs die Sünde ungeschehen machen konnte, die vielmehr weiterhin schwer wog, nahm der Papst dank der ihm verliehenen Autorität für sich die Befugnis in Anspruch, zu vergeben. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung der Lehre vom Sündenablass, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts festgeschrieben wurde. Selbst das kirchliche Vokabular wurde den Umständen angepasst, indem es Jesus metaphorisch als siegreichen Krieger darstellte und immer beherzter mit Konzepten wie Loyalität und Rache hantierte. Dies war nicht zuletzt das Ergebnis der Allianz, die im Rahmen einer weiteren renovatio imperii geschmiedet worden war. Deren Protagonist war das Haus Sachsen unter der Führung von Otto I., der Geißel der Ungarn, der 962 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde.
Die Verteidigung der Kirche war auch und vor allem auf lokaler Ebene erforderlich: Kirchen und Klöster bedurften des Schutzes, nicht nur gegen Überfälle von außen, sondern auch angesichts der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Ausgehend von den Klöstern vollzog sich daher ein weiterer Schritt zu einer Sakralisierung des Krieges. Sie zeigte sich beispielsweise in der Verehrung, die man einer Reihe von heiligen Kämpfern, den sogenannten Kriegerheiligen, entgegenbrachte – Merkurios, Sebastian, Mauritius, Demetrios, Georg – oder auch ihrem Archetyp, dem Erzengel Michael, der im Verlauf des ersten Kreuzzuges häufig in Erscheinung treten sollte. Man denke aber auch an die Verehrung für Gerald von Aurillac, dessen Leben Abt Odo von Cluny in einer Vita verewigt hat. Darin entwirft er das Modell eines Ritters, der stets bereit ist, die Armen zu verteidigen. Oder man denke an Fides von Agen: Als Protagonistin zahlreicher Geschichten, in denen sie nicht vor einem grausamen Vorgehen gegen Kleriker und Laien zurückscheut, die sich des Raubes an dieser oder jener Klostergemeinschaft schuldig gemacht hatten, verkörperte die Heilige eine Form der Gewalt, die seitens der Kirche gleichsam abgesegnet wurde. Wie war das möglich? Der wesentliche Grund lag darin, dass Gewalt hier der Verteidigung kirchlicher Besitztümer galt. Diese wurden immer häufiger einem adligen Laien, dem advocatus, anvertraut, dessen Investitur eindeutig sakrale Züge trug. Das Konzept stellt eine bedeutende Etappe in den Überlegungen der Kirche zum Thema Krieg dar – es wird uns später in dem Titel wiederbegegnen, den Gottfried von Bouillon, einer der Anführer des Kreuzzuges, in Jerusalem erhielt: advocatus sancti sepulchri. Die Gewaltbereitschaft einer militarisierten Gesellschaft, an deren Spitze eine kriegerische Aristokratie stand, die von Truppen von milites umringt war, die einen eigenen Stand von Kriegern zu Pferd bildeten, wurde für die Ziele und Interessen dieser Gesellschaft selbst »kanalisiert«. Dafür setzte man seit dem 10. Jahrhundert und vor allem im 11. Jahrhundert lokale oder regionale Instrumente ein. Friedensversammlungen wurden dazu genutzt, die pax Dei (Gottesfrieden) oder die treuga Dei (Waffenruhe Gottes) zu verkünden. Man erklärte die Unverletzlichkeit bestimmter Personengruppen – insbesondere Mönche und allgemein Angehörige des Klerus, dazu die Schwachen, die Witwen, die Armen und Wehrlosen – und bestimmter Orte, in den meisten Fällen Kirchen und Abteien, aber auch Marktplätze. Darüber hinaus war entsprechend den besonderen Momenten im liturgischen Kalender zu bestimmten Zeiten des Jahres, des Monats, der Woche jegliche Form von Kampfhandlungen verboten. Es war die große Abtei von Cluny, die im Herzogtum Burgund die Initiative ergriff und entschied, die Waffenruhe auf die Zeit zwischen Mittwochabend und Montagmorgen einer jeden Woche auszudehnen sowie auf die beiden kompletten Zeitspannen zwischen dem ersten Adventssonntag und der Oktav von Epiphanias und von Aschermittwoch bis zur Osteroktav. Da die Kriege der Feudalherren strikt saisonal waren und hauptsächlich im Frühling ausgetragen wurden, gab es jetzt nur noch wenige Tage, an denen der Gebrauch von Waffen überhaupt erlaubt war – einmal abgesehen davon, dass solche Proklamationen offenbar kaum beachtet wurden.
Damals wurden regelrechte Friedensbünde gegründet, in denen bewaffnete Bürger, bisweilen auf Befehl ihres Bischofs, bisweilen unabhängig von ihm oder sogar gegen seinen Willen und seine Interessen, mit Gewalt den Frieden durchzusetzen versuchten. Dass der Sache ein starker innovatorischer Impuls innewohnte, erkannten diejenigen Prälaten am besten, die der alten Ordnung am treuesten ergeben waren. So der Bischof von Cambrai, der 1023 auf die Einladung seiner Kollegen aus Soissons und Beauvais, einer Liga zur Wahrung des Friedens beizutreten, protestierte, dass nicht einem Mann der Kirche, sondern allein dem Kaiser die Rolle zufalle, die öffentliche Ordnung zu erhalten. Die Friedensbünde, wie beispielsweise die berühmte Liga, die Erzbischof Aimon von Bourges 1038 ins Leben rief, waren dennoch alles andere als Werkzeuge des Friedens. Vielmehr boten sie in vielen Fällen einen Vorwand für Plünderungen und Verwüstungen um ihrer selbst willen. Welch grausame Ironie, dass ausgerechnet das Konzil von Narbonne, das 1054 ausdrücklich verfügt hatte, dass »kein Christ einen anderen töten [darf], da derjenige, der einen Christen tötet, ohne Zweifel Christi Blut vergießt«, ebendiese mörderischen Werkzeuge einsetzen musste, um die Einhaltung der beschlossenen Grundsätze sicherzustellen. Solcherart ist häufig das Los der Pazifisten … Friedensbünde bildeten sich in jedem Fall noch im gesamten 12. Jahrhundert, beseelt von einem mystischen Impetus einerseits und Impulsen aus dem Volk andererseits. In ihnen kommt der Zusammenhang zwischen der Idee einer inneren Befriedung der Christenheit, einer kirchlichen Erneuerung und einer kriegerischen Praxis zum Ausdruck, die darauf abzielte, den Willen Gottes und der Kirche zu erfüllen, und sich dafür, angefangen bei den auf die Fahnen gemalten Symbolen, unter göttlichen Schutz stellte.
Das Papsttum begann seinerseits, die in ganz Europa umherziehenden Ritterbanden durch ein feudales Instrument an sich zu binden: die Vergabe des vexillum sancti Petri, das seinen Träger als Vasallen des Papstes auswies. So verfuhr man beispielsweise mit den Normannen, deren kriegerische Aristokratie auf der Suche nach Ländereien und Geld quer durch den Kontinent zog. Wir finden sie als Söldner in Süditalien, in Kleinasien im Sold der byzantinischen Kaiser, im England der Sachsen. Häufig wurden sie mit Erfolg belohnt: So gelang es zum Beispiel den Hautevilles innerhalb weniger Jahrzehnte, weite Teile des italischen Südens unter ihre Herrschaft zu bringen. Der Herzog der Normandie, Wilhelm der Eroberer, errang sogar die Krone Englands. Die damalige Kirche verlieh den Kriegen einen sakralen Anstrich, indem sie den Kämpfern die Ideale des Dienstes an der christlichen Sache und am Stuhl Petri einschärfte. Von der Iberischen Halbinsel über das Land der Angeln bis nach Sizilien kamen die Eroberer mit dem vexillum in der Rechten daher. Die Petersfahne legitimierte ihre Unternehmungen – zumindest in den Augen des christlichen Westens – und begründete eine Art Lehnsverhältnis zum Bischof von Rom. Doch nicht einmal in diesem Fall handelte es sich um Heilige Kriege. So sehr die Kirche sich auch bemühte, den Berufskriegern legitime Beweggründe für ihr Tun an die Hand zu geben, und sie im Fall eines Sieges zur Demut anhielt, blieb der Krieg an sich doch eine verwerfliche Tat, für die man sich schämen musste. 1070 wurden die Krieger, die vier Jahre zuvor in Wilhelms Gefolge an der Schlacht von Hastings teilgenommen hatten, dazu angehalten, Buße zu tun. Die Vorstellung, dass die Kampfhandlung selbst als Buße dienen konnte, sollte sich erst gegen Ende des Jahrhunderts durchsetzen. Die den Kriegern zu Pferde zuteilwerdende Gunst trug jedoch dazu bei, einer neuen Art von Christuskrieger, dem miles Christi, Gestalt zu verleihen. Diese Bezeichnung, die zuerst im Kontext der psychomachia, des inneren Seelenkampfes, aufkam und für Märtyrer und Asketen verwendet wurde, diente nun zur Benennung jener bellatores, die sich bereit erklärten, ihre Kampfeskraft in den Dienst der Kirche zu stellen. Hier entstand eine neue ritterliche Ethik, die es einem ganzen Stand von Berufskämpfern erlaubte, Kampf und Lebensgefahr als Mittel zur spirituellen Erlösung zu begreifen. Und hierin lag bereits der Kern des Kreuzzuges.
Der miles christianus
Ein großer Teil der allegorisch-mystischen Literatur aus Mittelalter und Neuzeit hat Betrachtungen über jene Seelenverfassung angestellt, mit der der Christ kämpfen sollte, und vor allem zu verhindern versucht, dass Laster, Begierden und Leidenschaften sich seiner bemächtigten. Solche Gedanken sind von Bernhard von Clairvaux, Petrus Johannis Olivi, Raimundus Lullus, Caterina Benincasa (Katharina von Siena) und Bernardino degli Albizzeschi geäußert worden und durch die katholische Reform ins Christentum eingeflossen. Ihre spirituellen Grundlagen finden wir in einer berühmten Passage des heiligen Paulus über die arma lucis und im Besonderen über das gladium spiritus, quod est verbum Dei (Eph 6, 17). Dies ist eine Metapher, die im Mittelalter ein weites Feld für die allegorische Deutung von Waffen und für die Vorstellung vom Kampf zwischen Tugenden und Lastern als psychomachia, pugna spiritualis geliefert hat. Um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert hatte der Dichter Prudentius in seinem als Psychomachia betitelten Werk ein berühmtes Bild aus Aischylos’ Sieben gegen Theben (das Statius später in seinem Epos Thebaid aufgreift) in einen allegorischen Rahmen übersetzt: Die Helden, die zum Angriff auf die Stadt oder zu ihrer Verteidigung Partei ergriffen hatten, wurden in christliche Tugenden und Laster verwandelt; die Stadt selbst galt als Symbol für die menschliche Seele. Das Ganze erinnerte an den seelischen Kampf, den der Gläubige ausfechten musste, um rein zu bleiben, seine Seele zu retten und das ewige Leben zu verdienen. Das gesamte Mittelalter hindurch sollten Fresken, Skulpturen und epische Gedichte unaufhörlich das große Thema vom Kampf der Tugenden gegen die Laster durchspielen. Dies war der einzig wahre christliche Krieg, für den die materiellen Kriege nur eine Metapher sein konnten. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts griff Bernhard von Clairvaux das Bild auf und münzte es kühn auf den Kampf gegen die Ungläubigen: Ihre physische Beseitigung, die im Vergleich zur Ausbreitung des Unrechts als geringeres Übel und in letzter Konsequenz als unvermeidlich angesehen wurde, sollte nicht als homicidium, sondern als malicidium aufgefasst werden. Der Heide, der die Christenheit mit Waffengewalt zu unterdrücken versuchte, konnte nichts anderes sein als ein Verbreiter des Bösen in der Welt.





























