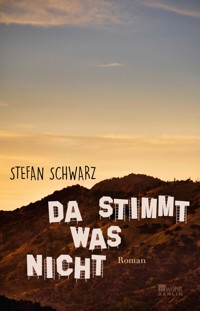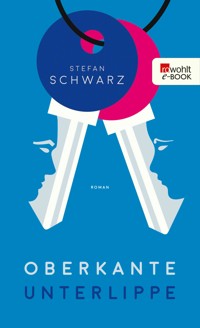9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet an seinem Geburtstag bekommt Dr. Ullrich Hasselmann Post vom Jugendamt. Das Wohl seines Kindes sei gefährdet! Seltsam: Seine beiden Töchter, allerliebste Zwillinge, sitzen gesund und munter vor ihm. Auch seine Frau Maike, eine züchtige Bibliothekarin, macht ihm nicht den Eindruck, als ob sie ihre Kinder vernachlässigen würde. Nur sehr langsam dämmert dem braven Uni-Dozenten, dass dieses Schreiben mit einer gewissen Jelena Jefimkina zu tun haben könnte, mit der er vor achtzehn Jahren gegen reichlich Geld eine Scheinehe einging. Auf der Suche nach seinem unbekannten Sohn arbeitet sich der hypochondrische Altphilologe in die Abgründe seiner völlig zu Recht verdrängten Vergangenheit vor, in der ein alkoholkranker Heiratsvermittler, eine zu allem entschlossene sibirische Volleyballerin und ein äußerst misstrauischer Ausländerbeamter eine Rolle spielen – sowie die Frage: «Kann es Liebe geben zwischen einem sehr kleinen Deutschen und einer sehr großen Russin?» Durch sein etwas pedantisches Wesen bringt Dr. Hasselmann dabei innerhalb von wenigen Stunden zwei eigentlich rivalisierende osteuropäische Mafia-Banden komplett gegen sich auf. Ja, es gibt auch Tote. Und zwar hallo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Stefan Schwarz
Die Großrussin
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ausgerechnet an seinem Geburtstag bekommt Dr. Ullrich Hasselmann Post vom Jugendamt. Das Wohl seines Kindes sei gefährdet! Seltsam: Seine beiden Töchter, allerliebste Zwillinge, sitzen gesund und munter vor ihm. Auch seine Frau Maike, eine züchtige Bibliothekarin, macht ihm nicht den Eindruck, als ob sie ihre Kinder vernachlässigen würde.
Nur sehr langsam dämmert dem braven Uni-Dozenten, dass dieses Schreiben mit einer gewissen Jelena Jefimkina zu tun haben könnte, mit der er vor achtzehn Jahren gegen reichlich Geld eine Scheinehe einging. Auf der Suche nach seinem unbekannten Sohn arbeitet sich der hypochondrische Altphilologe in die Abgründe seiner völlig zu Recht verdrängten Vergangenheit vor, in der ein alkoholkranker Heiratsvermittler, eine zu allem entschlossene sibirische Volleyballerin und ein äußerst misstrauischer Ausländerbeamter eine Rolle spielen – sowie die Frage: «Kann es Liebe geben zwischen einem sehr kleinen Deutschen und einer sehr großen Russin?» Durch sein etwas pedantisches Wesen bringt Dr. Hasselmann dabei innerhalb von wenigen Stunden zwei eigentlich rivalisierende osteuropäische Mafia-Banden komplett gegen sich auf.
Ja, es gibt auch Tote.
Und zwar hallo.
Über Stefan Schwarz
Stefan Schwarz, Jahrgang 1965, ist mehrfach erprobter Ehemann, leidenschaftlicher Vater sowie Autor von Kolumnen, für das Fernsehen und die Bühne. Seine Lesungen genießen Kultstatus. 2010 erschien «Hüftkreisen mit Nancy», 2012 «Das wird ein bisschen wehtun».
Inhaltsübersicht
I’ve always been a coward
And I don’t know what’s good for me
Kate Bush, Hounds Of Love
Auf Grund eines Sees
Das ist das Ende.
Ich rutsche mit den Füßen voran vom Bootsrand und versinke. Das kalte Wasser schießt von unten in die Hosenbeine und klebt mir die Kleidung auf meine Haut. Blasen kostbarer Luft entweichen an die Oberfläche. Meine Füße sind im Eimer. Im Eimer ist Zement. Der Eimer stößt jetzt auf Grund. Meine Knie knicken ein, und ich kippe langsam und unabwendbar vornüber. Mit dem Gesicht in den Schlamm. Meine Handgelenke auf dem Rücken winden sich schmerzend in Kabelbindern.
Aus.
Vor vierzehn Tagen war ich noch bei der Darmspiegelung. Ohne Befund. «Also an Darmkrebs sterben Sie demnächst nicht!», hatte der Doktor gelacht. Er wird recht behalten. Demnächst sterbe ich ganz sicher nicht an Darmkrebs. Demnächst liege ich aufgedunsen im Schlick, und Aale schwimmen durch meine ausgefressenen Augenhöhlen.
Vorbei.
Sie werden mich nicht finden. Und das Schlimmste ist: Maike wird niemals glauben, dass mir was zugestoßen ist. Ich bin einfach nicht der Typ, dem etwas zustößt. Ich bin immer nur der Typ gewesen, der dabei war, wenn anderen etwas zustieß. Ich bin doch immer so vorsichtig. Sie wird denken, ich habe mich davongemacht. Sie verlassen. Wegen dieser Russin! Sie wird sich ganz ernst zu Claudia und Julia setzen und sagen, dass Papa nicht wiederkommt, weil Papa jetzt eine andere Frau liebhat. Sie wird in einem so ruhigen, so verständnisvollen Ton sprechen, wie sie noch nie zu Claudia und Julia gesprochen hat, und die beiden werden ihre Mama mit großen Augen anschauen, weil sie von nun an wissen, dass Erwachsene nur dann in einem ruhigen und verständnisvollen Ton sprechen, wenn etwas wirklich Schreckliches passiert ist.
Nein. So nicht!
Ich werde sterben, wie ich gelebt habe. Aufrecht!
Ich werde nicht im Schlamm verrecken. Ich werde mich aufstellen. Jetzt!
Als ich mein Gesicht aus dem Schlamm drehe, spüre ich etwas an meiner Wange. Ein Wurzelstock, aus dem ein glatter Stängel nach oben wächst. Eine Seerose. Ich wälze mich herum. Spüre Stängel um mein Gesicht, meinen Hals. Hier ist alles voller Seerosen. Langsam, aber sicher geht mir die Luft aus. Als Kind hatte ich beim Schwimmen immer fürchterliche Angst vor Seerosen. Was, wenn ich mich mit den Beinen in den langen Stängeln verfinge? Nicht mehr freikäme? Ertrinken würde?
Irgendwann ist diese Angst vor Seerosen vergangen. Ich weiß sogar recht genau wann. In der siebten Klasse. Im Biologieunterricht. Ökologie. Gewässerkunde.
Falls das wirklich Seerosenstängel sind …
Lufthunger zieht meinen Leib zusammen.
Doch. Das müssen Seerosen sein. Was denn sonst?
Ich nutze den Luftmangel, der mich wringt, krümme mich noch mehr zusammen und stoße mich mit dem Kopf vom Grund ab. Mein Körper federt nach oben, ich pendle ein paar Mal im Wasser herum und komme dann über dem schweren Eimer ins Lot. Ich beginne mich zu strecken, mein Herz pumpt in gewaltigen Kolbenhüben um das letzte Fitzchen Sauerstoff in meinen Adern. Mir wird flau. Jetzt nicht kollabieren. Ich recke mich schwindlig auf. Über meinem Kopf, an meinem Scheitel, ein Kitzeln. Ich ahne, was das ist.
Ich liebe Seerosen!
Mein Gesicht stößt durch die Wasseroberfläche. Nicht viel. So Oberkante Unterlippe. Egal. Luft.
Ich lebe.
Ein paar Meter weiter klatschen bedächtig die Ruder ins schwarze Wasser. In meiner Kehle würgt ein Schrei herum und möchte gern raus.
Idioooot! Zu blöd, einen Mann im See zu versenken!
Ja, mein Guter, es ist ein populärer Irrtum, dass Seen in der Mitte am tiefsten sind. Der deutsche See ist keine Schüssel. Der deutsche See ist vielgestaltig. Hoho! Manchmal ist er in der Mitte tief. Manchmal ist er in der Mitte flach. So flach, dass ein Mann drin stehen kann. Sogar ein kleiner Mann. Inmitten kleiner Seerosen. Der Stängel der Kleinen Seerose ist maximal anderthalb Meter lang! Die allerliebste Kleine Seerose mit ihrer anmutigen weißen Blüte ist eine Zeigerpflanze für Verlandungszonen! Könnte man eigentlich wissen, wenn man im Biologieunterricht aufgepasst hat!
Das nenne ich Auslese nach Intelligenz. Von wegen, Schule spielt später keine Rolle mehr!
Aber gut. Nicht ausflippen. Mund halten. Ganz ruhig. Nicht schreien, nicht mal keuchen. Wenn das ginge, atemlos, wie ich bin …
Zu spät. Der Ruderer hält mit dem Rudern inne. Er lauscht. Ich hechele mit offenem Mund. Wohl nicht geräuschlos genug. Der Mann taucht die Ruder langsam wieder ins Wasser, wendet das Boot und rudert ein paar Meter zurück.
Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab kaum genug Luft, aber ich muss noch mal abtauchen. Die Wasseroberfläche schließt sich wieder über mir. Ich hocke über dem im Schlamm hin und her wackelnden Eimer. Versuche, mich mit den zusammengebundenen Händen am Eimer festzuhalten. Rutsche ab. Ratsche mir die Haut am schartigen Blechrand auf. Der Schmerz treibt mir verräterische Blasen aus dem Mund. Links oben schwebt der schwarze Schatten des Bootes heran. Doch plötzlich wird alles licht und hell und weit vor Eingebung.
Der schartige Eimerrand! Binnen Sekunden reiße ich die Kabelbinder am Eimerrand auseinander. Die Ruder drehen drei Meter entfernt das Boot im Kreis. Der Mann sucht die Stelle, wo er mich ins Wasser gestoßen hat. Aber ich habe meine Hände wieder. Langsam – langsamer, als es meine nach Luft gierenden Lungen verlangen – tauche ich aus dem Wasser. Der Mann im Boot steht auf. Das Boot schwankt. Das Licht einer Taschenlampe geht an. Das Boot treibt sachte in meine Richtung. Der Mann leuchtet auf der anderen Seite ins Wasser. Der Lichtkegel der Lampe schwenkt langsam kreisend um das Boot herum auf meine Seite. Als das Boot nur noch einen Meter von mir entfernt ist, hebe ich meine wundgescheuerten Hände aus dem Wasser.
Der Leuchtkegel der Taschenlampe leuchtet zwei Hände an, die auf den Bootsrand greifen. Der Mann sieht mich, doch wenn er glaubt, dass ich zu ihm ins Boot will, liegt er falsch.
Er liegt nicht nur falsch. Er steht auch falsch. Nämlich steif und aufrecht. In einem Boot.
Ich formuliere es mal so: In Physik hat er auch nicht aufgepasst.
Je höher der Schwerpunkt, desto geringer die Stabilität. Sechste Klasse.
Ich reiße das Boot herunter. Mit einem Fluchlaut verliert der Mann das Gleichgewicht und geht samt Taschenlampe auf der anderen Seite rücklings über Bord.
Das leere Boot macht einen Satz seitwärts. Dahinter gurgelt und schwappt das Wasser, bis der Mann nach drei Sekunden wieder auftaucht. Ohne Taschenlampe. Er macht wilde Schwimmbewegungen, was ja eigentlich unnötig ist. Er schnauft, wendet sich. Er glotzt hektisch nach allen Seiten, sucht Orientierung. Er fragt sich, wo ich bin.
Dann endlich sieht er mich. Ich stehe etwas wacklig in meinem Zementeimer zwischen Seerosen. Zwei Meter vor ihm. Wasser läuft mir von den Armen über das Gesicht.
Er fragt sich, warum ich hier so ruhig stehe.
Er fragt sich, warum ich die Arme erhoben habe.
Was ich da hochhalte.
Aber er braucht sich nicht mehr groß den Kopf zerbrechen.
Denn das tue ich jetzt!
Im Schilf weiter hinten flattern erschrockene Stockenten auf.
Die richtige Antwort war übrigens: ein Ruder!
Gut, dass es so dunkel ist. Ich will lieber nicht sehen, was hier jetzt so alles auf dem Wasser schwimmt. Es riecht ein bisschen nach Eisen. Das kommt vom Blut. Seine Eisenwerte scheinen okay gewesen zu sein. Hoffentlich hatte er nichts Übertragbares.
Mein Name ist Ullrich Hasselmann. Doktor Ullrich Hasselmann. Ich bin kein Arzt. Ich bin Altphilologe. Altphilologen beschäftigen sich mit Sprachen, die keiner mehr spricht. Mit Sprachen, die schon so lange tot sind, dass man gar nicht mehr weiß, wie die Worte richtig ausgesprochen werden. Das ist kein besonders gefährlicher Beruf. Ehefrauen von Altphilologen fragen sich nie, ob ihr Mann heute heil nach Hause kommt. Altphilologen beschäftigen sich mit Inschriften, Büchern und Pergamenten. Die tun einem nichts. Wenn man bei einer Party gefragt wird, was man so macht, und man antwortet: «Ich bin Altphilologe!», sagen viele bloß «Soso» und gehen dann gleich ins nächste Zimmer, um zu gucken, wie es da so ist. Vielleicht sollte man einfach die Bezeichnung ändern? Aber es stimmt ja: Aufregende Berufe gehen anders. Wenn im Luxushotel morgens einer tot in seinem Erbrochenen liegt, steht nie ein graustoppeliger Ermittler vor der Leiche und knurrt: «Lassen Sie mich raten. Ein Altphilologe!» Und selbstverständlich werden Altphilologen nicht in Seen versenkt.
Der Mann ist nicht untergegangen. Er schwimmt mit ausgebreiteten Armen auf dem See, als wolle er ihn irgendwie umarmen. Seine Lederjacke hat einen Buckel voll Luft, und jetzt treibt er langsam und reglos auf mich zu. Es ist das Letzte, was er treibt. Ich will ihn schon fast mit dem Ruder wegstoßen, als mir einfällt, dass mein toter Mörder im Besitz einiger Sachen ist, die ich dringend brauche. Da er kopfwärts auf mich zutreibt, sein Kopf aber nicht mehr so richtig wie ein Kopf aussieht, tippe ich ihm erst mal mit dem Ruderblatt an die Schulter, drehe ihn von mir weg und ziehe ihn an der Jacke, mit dem Rücken voran zu mir. Ich hatte recht. Über der rechten Gesäßhälfte steckt eine Pistole im Hosenbund. In der Jackentasche finde ich den Autoschlüssel. Jetzt brauche ich nur noch das Boot. Es dümpelt ein paar Meter weiter zwischen etwas dichter wachsenden Seerosen. Ich stake mit dem Ruder in den Grund, kann mich so samt dem Eimer leicht abstoßen und hüpfe vorsichtig zum Boot. Einmal wirft es mich noch um, weil ich gegen eine Wurzel gehüpft bin, aber ich komme schnell wieder auf die Beine. Dann kralle ich mir das Boot.
Leider bin ich mit meinen Zementfüßen zu schwer, um mich ins Boot hieven zu können. Wenn ich mich auf den Rand stütze, kippt es und säuft ab. Aber ranhängen geht! Ich hänge mich mit dem einen Arm hinten ans Boot und manövriere, mit der anderen Hand stakend, in Richtung Ufer.
Das Wasser wird flacher, am Uferrand lasse ich das Boot, falle mit dem Oberkörper auf die Erde, wälze mich an Land, setze mich auf. Wo ist der Jeep, mit dem wir hergekommen sind?
Ein Streifen Helligkeit am Horizont. Das muss die Stadt sein. Das Schilf und die Weiden stehen davor wie Scherenschnitte. Ein Suchbild aus Halmen und Ästen in Schwarz-Weiß. Finde das Auto. Ich habe einen kiloschweren Monofuß und kann nicht mal eben so um den See wandern. Bei genauerem Hinsehen erweist sich ein ferner Hügel rechts von mir als Autodach. Vielleicht achthundert Meter. Ich versuche zu hüpfen, aber mir fehlt der Auftrieb, den ich im Wasser hatte, zudem ist der Boden morastig. Mir bleibt nichts übrig, als mich hinzulegen und zum Auto zu rollen.
Ich wäre wirklich sehr froh gewesen, wenn ich über die Wiese hätte hüpfen können. Denn es ist eine Kuhweide. Flatsch. Roll. Flatsch. Es ist nicht unnormal, dass auf einer Kuhweide Kuhfladen liegen. Unnormal ist es, wenn sich bis zum Unterschenkel einzementierte Altphilologen über Kuhwiesen rollen.
Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Ich habe nicht etwa aus Versehen einen langweiligen Beruf gewählt. Ich habe Altphilologie studiert, weil ich mich eigentlich nur in der Vergangenheit sicher fühlte. In einer ganz und gar und unwiderruflich abgeschlossenen Vergangenheit. Einer Vergangenheit ohne Risse und Lecks, aus denen heimlich Unheil in die Gegenwart einsickern kann.
Das war schon als Kind so. Ich war ein Drinnenkind. Ein Stubenhocker. Ich habe viel gelesen. Ich wollte nicht draußen herumtoben, nicht mit anderen Jungs raufen und mir die Knie aufschlagen. Ich wollte keine Abenteuer erleben. Nicht auf Bäume klettern, nur um runterzufallen und dann querschnittsgelähmt zu sein. Oder Höhlen graben, die dann einstürzen und aus denen man erst gerettet wird, wenn das Gehirn leider schon etwas zu lange ohne Sauerstoff war. Ich wollte auch nicht mit Pfeil und Bogen hantieren und womöglich einem Spielkameraden das Auge ausschießen, um dann mein Leben lang Schuldgefühle zu haben.
Von heute aus gesehen, wirkt es fast, als hätte ich schon als Kind eine Art Vorahnung gehabt. Als hätte ich gewusst, dass das Leben nur darauf lauert, dass ich einen Fehler mache. Andere Menschen machen dauernd Fehler, absichtlich, fahrlässig, aus purer Dummheit oder Faulheit, und das Leben lässt es ihnen durchgehen. Ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Fehler gemacht, aber dieser eine Fehler hat sich zu einer unglaublichen Katastrophe ausgewachsen.
Ich erreiche den Jeep und schließe ihn auf. Schalte das Licht an, damit ich endlich was sehe: meine wundgeriebenen Handgelenke. Meine mit Kuhdreck beschmierten Schultern. Meine Füße im Eimer. Der Mann hat den Schnellzement sogar noch mit dem Spatel glattgestrichen. Ich bin beinahe gerührt. Wenn man jemanden einzementiert, dann muss das auch ordentlich aussehen. Fast schäme ich mich, ihm so laienhaft einfach den Schädel eingeschlagen zu haben. Das hätte ihm nicht gefallen. Da gibt es elegantere Möglichkeiten.
Ich rolle mich am Auto entlang zur Kofferklappe, öffne sie, hole das Radkreuz heraus und setze mich damit an den linken Hinterreifen, um den Eimer und den Zement um meine Füße zu zerschlagen. Das Zinkblech springt nach ein paar Schlägen auseinander, und ermuntert von diesem Erfolg, hämmere ich immer heftiger auf den nun in kleinen Brocken abspringenden Zement ein.
Zwei Minuten später zerreißt ein Schrei die nächtliche Stille.
Ich hatte keine …
O mein Gott, ich hatte keine Schuhe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!
Vor acht Tagen war alles noch in Ordnung. Doch vor sieben Tagen begann sich die Ordnung meines Lebens plötzlich aufzulösen. An meinem vierundvierzigsten Geburtstag. Es war gegen zehn Uhr am Vormittag, als der junge Doktor Rieke durch die Tür in mein Büro kam und mich unter dem Tisch knien sah.
«Geht es Ihnen nicht gut?»
«Doch, doch», ich erhob mich ächzend und rüttelte mit dem Zeigefinger im rechten Ohr herum, «ich dachte nur einen Augenblick, ich hätte Tinnitus.»
Doktor Rieke war erst im letzten Wintersemester ans Institut für Alte Geschichte gekommen und mit meinen Sensibilitäten noch nicht vertraut.
«Und dazu mussten Sie unter den Tisch kriechen?»
«Ich war mir nicht ganz sicher. Es war so ein leises Rauschen. Und ich dachte, bevor ich jetzt ausflippe, horche ich mal lieber erst an der Heizung!»
«Und?»
«Was heißt hier: Und? Es ist die Heizung! Hören Sie nicht dieses Rauschen?»
Doktor Rieke verzog den Mund und äugte an die Decke, um sich auf die verlangte Wahrnehmung zu konzentrieren.
«Ich höre nichts.»
«Was? Wieso? Das Rauschen ist deutlich zu vernehmen. Wo Sie stehen, vielleicht nicht so deutlich, aber hier unten …», ich kniete mich wieder hin und kroch unter dem Tisch an den alten, gusseisernen Heizkörper heran, «hier wird es richtig laut, das Rauschen. Das müssen Sie doch in jedem Fall hören können.»
Verzweiflung machte meine Stimme dünn. Was, wenn das ein pulsierender Tinnitus war, der mich mit mal lautem und dann wieder leisem Rauschen in den Wahnsinn treiben wollte?
«He, Hasselmann! Ich hab Sie verklappst. War nur Spaß! Klar höre ich die Heizung. Die alten Schrottdinger sind nicht entlüftet. Bleiben Sie mal schön relaxt.»
Ich stand auf, etwas böse.
«Was wollten Sie eigentlich von mir?»
«Hier, ich hatte mir einen Bleistift von Ihnen ausgeliehen.»
Er reichte mir den gelben Koh-i-noor Hardtmuth Härte HB herüber. Entsetzt riss ich mich herum und starrte auf die Stiftablage aus schwarzem Bakelit, wo der gelbe Koh-i-noor Hardtmuth Härte HB wahrhaftig fehlte.
«Sind Sie wahnsinnig? Sie können sich doch nicht einfach einen Bleistift bei mir nehmen!»
«Aber … Moment mal», Doktor Rieke trat etwas verstört zurück, «ich habe mir gestern einen Filzstift von Ihrem Tisch genommen, und Sie hatten überhaupt kein Problem damit!»
«Das ist doch was völlig anderes!», herrschte ich ihn an. «Nehmen Sie sich so viele Filzstifte, wie Sie wollen. Machen Sie sich von mir aus Filzlatschen aus meinen Filzstiften, aber dieser Bleistift liegt hier. Und zwar so!»
Ich nahm den Stift und legte ihn zurück an die erste Stelle der kleinen Reihe von Schreibwerkzeugen in der Bakelitschale. Ich hätte nicht sagen können, was diesen Bleistift von den anderen Stiften in meiner Stiftschale unterschied. Ich hätte nur sagen können, dass mir dieser Koh-i-noor Hardtmuth Härte HB seit Urzeiten heilig, heilig, heilig war.
«Alles klar», sagte Doktor Rieke. Für ihn war ich ab jetzt ein zwangsneurotischer Spießer, der Tinnitus kriegte, wenn sein Bleistift nicht millimetergenau am gewohnten Platz lag. Aber er irrte sich. Ich war kein Spießer. Wir haben alle unsere kleinen Heiligtümer.
Zur Mittagszeit hatte ich dann auf dem Weg über den Campus den Dekan getroffen und ihn gefragt, ob sich in Richtung meiner Bewerbung um den Lehrstuhl etwas getan hätte. Ich bin nicht sonderlich ehrgeizig, aber irgendwie denke ich, dass ich an der Reihe sein müsste. Ich bin jetzt Mitte vierzig, und irgendwann ist man für eine Professur zu alt. Es ist nämlich so, dass die Berufungskommissionen bei einem Bewerber ab einem bestimmten Alter glauben, es gäbe Gründe, weshalb man in diesem Alter noch keine Professur erhalten habe. Und ab dann kann man es wirklich vergessen.
Hinzu kommt: Es wachsen ja auch jedes Jahr gute Leute nach. Und nicht nur gute, vielleicht sogar bessere. Doktor Rieke hat gerade in den «Jahresschriften» einen vielbeachteten Aufsatz über die Panegyriken des Sidonius publiziert. Und er wird Weiteres publizieren. Man ist schon auf ihn aufmerksam geworden. Und wenn man sich die Aufmerksamkeit der bundesdeutschen Altphilologen als etwas in seiner Menge Begrenztes vorstellt, dann dürfte klar sein, dass Doktor Riekes zunehmender Beachtung eine abnehmende Beachtung meiner Person gegenüberstehen wird.
Der Dekan hörte mir also zu und nickte, aber er nickte in einer Art und Weise, die mir gar nicht gefiel.
«Ja, die Professur. Opitz hat noch nicht mit Ihnen gesprochen? Opitz wollte doch mit Ihnen sprechen!»
Er blickte sich um, als wünschte er, dass Opitz um die Ecke käme und ihm dieses Gespräch abnehme.
«Sie haben doch letztes Jahr die Gastvorlesung in Freiburg gehalten? Nun, gestern ist ein Brief gekommen. Es hat sich jemand gemeldet, der Sie damals gehört hat. Er meint, Sie hätten dort das Existenzrecht der irischen Nation bestritten.»
«Das Existenzrecht der irischen Nation? Wie käme ich dazu?»
Der Dekan hob sein rechtes Knie, um seine Aktentasche darauf abzustellen. Dann wühlte er ein bisschen in ihr herum, zog schließlich ein Stück Papier aus einem Hefter und las mit angestrengten Augen daraus vor.
«Haben Sie damals gesagt, ‹Die Kelten – das ist und bleibt zu allen Zeiten dieselbe faule und poetische, schwachmütige und leichtgläubige, politisch durch und durch unbrauchbare Nation, und darum ist ihr Schicksal immer und überall dasselbe gewesen – als Gärungsstoff aufzugehen in einer staatlich überlegenen Nationalität›?»
«Ja, schon möglich, kommt mir bekannt vor, aber es ist ein Jahr her, das ist kein Spezialgebiet von mir, und ich meinte die Gallier zur Zeit von Julius Cäsar. Wer hat diesen Brief geschrieben? Asterix?»
«Ich wollte, es wäre so witzig, aber das ist es nicht. Ein irischer Student. Es stimmt natürlich, die Gallier waren Kelten. Aber: Die Iren sind Kelten. Die Amtssprache Irlands ist Gälisch, ohne jeden Zweifel eine keltische Sprache. Das muss auch Ihnen bewusst gewesen sein.»
«Gut, in Ordnung. Ich habe etwas gegen die Kelten gesagt, aber nur gegen die untergegangenen Kelten. Nicht gegen die leibhaftigen.»
«Für Iren macht das offenbar keinen Unterschied!»
«Und ob das einen Unterschied macht. Ich habe auch schon despektierliche Bemerkungen über die Phönizier gemacht. Ich habe mich zur Kultur der Hunnen, soweit man da überhaupt von Kultur sprechen kann, außerordentlich verächtlich geäußert. Und die Geschichte gibt mir ja wohl recht. Was will der Mann denn? Den Vorsitz der Vereinten Verschwundenen Nationen?»
«Der Student deutet an, dass er den Botschafter der Republik Irland über diesen Fall informieren wird.»
Der Dekan steckte den Brief wieder ein. Dass er mir nicht sofort beipflichtete, dass er diesen lächerlichen Wisch offenbar tatsächlich zu meinen Bewerbungsakten um den Lehrstuhl legen wollte, versetzte mich in einen Zustand ohnmächtiger Wut, und in dieser Ohnmacht entfuhr es mir:
«Aber so ist der Ire!»
Dem Dekan rutschte beinahe die Tasche vom Knie.
«Wie bitte?»
«Aber so», setzte ich erbleichend dem entflohenen Wort hinterher, «ist … ist der Ihre … ist es der Ihre Auftrag, diesen Brief als das zu sehen … was er ist. Ein Missverständnis!»
Der Dekan nickte abwesend, als müsse er sich selbst bei irgendetwas zustimmen, und sagte dann mit gequälter Einfühlung:
«Doktor Hasselmann, alle wissen, dass Sie ein guter Mann sind. Ein guter Mann der Bücher. Aber mit einem solchen Lehrstuhl sind Verpflichtungen verbunden. Internationale Verpflichtungen. Repräsentanzen. Das Ansehen der Universität. Wer immer diesen Lehrstuhl innehaben wird, muss geschmeidig im Umgang mit Menschen sein, bisweilen auch sensibel formulieren können, wenn Sie verstehen …»
Ich winkte ab. Ich hatte verstanden. Der Dekan seufzte.
«Ich kann das nicht unter den Tisch fallen lassen. Was ist, wenn dieser Botschafter sich einschaltet? Ich muss diesen Brief der Berufungskommission vorlegen.»
Ich hätte damals nach Heidelberg gehen können. Vor dreizehn Jahren. Ich hatte gezögert, und Opitz hatte mich gebeten zu bleiben. Es war ein gutes Angebot, eine Dozentur. Dann habe ich Maike kennengelernt, und Maike hat mir früh bedeutet, dass sie mich nur hier und nicht in Heidelberg lieben könne.
Maike hat sowieso alles verändert.
Sogar das Jugendamt …
Als ich an jenem Nachmittag vor acht Tagen nach Hause kam, stand Maike schon im Flur und lächelte spitzbübisch. Sie nahm mir meine Jacke ab.
«Hast du deine Tablette genommen?»
Mein Herz neigt bei Aufregung zum Verstolpern, und darum nehme ich seit meinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr ein Medikament, das mein Herz in Ketten legt. Maike achtet sehr darauf, dass ich es pünktlich einnehme.
Als ich ja sagte, wirkte sie beruhigt, meinte, ich solle sie kurz vorgehen lassen und dann in die Küche kommen. Als ich die Küchentür öffnete, schlug mir Schall entgegen, dass mein Herz Purzelbäume schlug.
«Häppi börsdee tu ju, Häppi börsdee tu ju, Häppi börsdee, lieber Ulli, häppi börsdee tu juuuuuuu!»
Da stand Maike, und alle meine Freunde waren da! Genauer gesagt, es waren alle meine zwei Freunde da. Cornelius und Andy. Mehr habe ich nicht. Ich fühle mich nicht so ganz gesund, und zwei Freunde scheinen mir das Äußerste an Geselligkeit, das ich mir leisten kann. Cornelius, mit dem ich seit der dritten Klasse befreundet bin, und der stille Andy, den wir vor ein paar Jahren bei einer Fotoausstellung kennengelernt haben. Na ja, Andy war eigentlich nicht richtig mein Freund, eher ein Freund der Familie. Für mich war er eher so eine Art Reservefreund, falls Cornelius was zustoßen sollte. Außerdem konnte ich mich manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass Andy sich selbst auch eher als ein Reservefreund sah, allerdings für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte, ein Reservefreund für Maike nämlich.
Wenn man wie ich keine Hobbys hat, nicht gerne mit Leuten über Politik, Urlaub, Kindersorgen und Fernsehsendungen spricht, keinen Sport treibt und keinen Alkohol trinkt, sind zwei Freunde wahrscheinlich schon ganz gut.
«Oh Leute!», ich schnappte nach Luft. «Ihr dürft mich nicht so erschrecken.»
Der Tisch war gedeckt, im Kerzenhalter steckten drei brennende Kerzen, Streichholzduft lag noch in der Luft, und drei Blumensträuße, von jedem einer, standen hinter einem kleinen Häuflein Geburtstagspost auf dem Tisch.
Maike löste sich aus der kleinen Gruppe, um mir einen spitzen Kuss auf den Mund zu geben. Dann warf sie meinen beiden aufgeregt mit den Augenbrauen zuckenden Freunden einen verschwörerischen Blick zu und zog einen Briefumschlag hinter ihrem Rücken hervor.
«Lieber Ulli! Lieber Schatz! Wir alle wissen, wie gerne du lachst. Wir wissen aber auch, dass du ein kleines Problemchen mit deinem Lachen hast. Und darum haben wir, also ich und Cornelius und Andy, ein bisschen zusammengelegt und schenken dir zu deinem Geburtstag eine … Lachberatung bei …», sie holte tief Luft, «… Meinhard Lömmer, dem deutschen Lachpapst!»
«Eine Lachberatung!», staunte ich gezwungen, öffnete den Umschlag und zog den Gutschein heraus. «Also, das ist ja wirklich … Eine Lachberatung, ja, um Himmels willen, ihr seid ja … das hätte ich wahrscheinlich so von alleine nie …»
«Genau deswegen!», johlte Cornelius, trat an mich heran und zerdrückte mich. «Aber so was von Herzlichen, mein Kleiner. Du weißt ja, ich bin immer für dich da.»
Andy schüttelte mir nur die Hand und zwinkerte einmal kurz.
Lachberatung! Soso! Maike zufolge hatte mein Lachen etwas beunruhigend Spasmisches, auf Fremde wirkte es gar wie eine Vorstufe von Erbrechen. Es ist so: Wenn ich lache, ziehe ich den Hals ein, klemme den Kopf zwischen die Schultern und würge und presse Luft aus der hochgezogenen, gekräuselten Nase. Manchmal, bei sehr starken Lachanfällen, kommt auch etwas Luft aus dem nicht ganz zusammengepressten Mund. Es ist eine Art hinten im Hals abgehacktes Schnauben. Ich weiß schon, das wirkt verklemmt, aber ich kann nichts dagegen tun. Maike hatte schon recht. Wenn ich so richtig loslache, hören alle anderen auf zu lachen und sehen sich verwirrt nach mir um.
Ich spielte verlegen mit dem Gutschein herum.
«Meint ihr, das lohnt sich? Wisst ihr, ich lache ja sowieso nicht so viel. Manchmal lach ich die ganze Woche nicht. Nur so ein, zwei Mal am Wochenende.»
«Ja, jetzt! Aber danach! Sollst mal sehen! Danach wirst du gar nicht mehr aufhören wollen zu lachen!», rief Cornelius.
Eine Lachberatung bei Meinhard Lömmer, dem Lachpapst! Das hatte doch sicher irgendwas im dreistelligen Bereich gekostet. War meine Lache wirklich so schlimm? Und gibt es nicht auch Teile einer Persönlichkeit, die man als Partner eben mit einstecken muss? Mochte ja sein, dass Maike sich einen Mann mit dröhnendem Hohoho- oder Hahaha-Lachen wünschte. Aber wünschen kann man sich vieles, auch Maike zum Beispiel hatte, nun ja, vielleicht nicht gleich Defizite, aber sagen wir mal, Wünschbarkeiten. Zum Beispiel ziemlich unscheinbare Brüste. Nichts, was man in die Hand nehmen konnte. Da hätte ich ihr ja auch mal eine Brustvergrößerung schenken können! Na gut, das wäre deutlich teurer gekommen, und ob Cornelius und Andy was dazugegeben hätten, bliebe zu bezweifeln. Überdies war Maike eine schmale Person, sie hatte morgens bisweilen Probleme mit ihrem niedrigen Blutdruck, bekam leichte Schwindelanfälle. Mit zwei Mal fünfhundert Gramm mehr auf den Rippen würde sie wahrscheinlich völlig aus dem Lot torkeln. Außerdem war Maike Bibliothekarin, und so eine Veränderung würde nur Unruhe in den Lesesaal bringen.
Hingegen konnte mir ein besseres Lachen ja nicht schaden. Und, wer weiß, vielleicht würde es meinen Umgang mit Menschen ja «geschmeidiger» machen, wie der Dekan sich ausgedrückt hatte, wenn ich so eine Weihnachtsmann-Brustkasten-Lache erlernte. Cornelius kam noch mal zu mir und drückte mir eine DVD in die Hand. Cornelius hat ein Synchronisationsstudio und synchronisiert die angesagtesten US-amerikanischen Cartoonserien. Ab und zu reicht er eine rüber. Das ist existenzgefährdend illegal, aber wenn hier einer kein Weiterverbreiter ist, dann ich. Ich bin der am wenigsten vernetzte Mensch der Welt.
Wir setzten uns, tranken Sencha-Tee, aßen Mürbeteigkekse, und Cornelius erklärte nach drei Bissen, ich solle doch nun mal sagen, wie man sich denn mit vierundvierzig so fühle.
«Soweit ganz gut», antwortete ich, aber Maike rückte sehr symbolisch nah an meine Seite und erklärte, dass ich demnächst Professor würde. Oha und Sieh-mal-einer-an und Zeit-wird’s wehten über den Tisch.
«Gemach, gemach», bremste ich, «ich habe mich schlicht um den Lehrstuhl von Opitz beworben. Was daraus wird, kann man überhaupt noch nicht sagen. Es gibt ja auch noch andere Bewerber.» Ich wollte, das wäre nur eine Abwehr aus reiner Höflichkeit gewesen, aber wie die Dinge standen, war das Kleinhalten der Erwartungen leider mehr als berechtigt.
«Denn kannste dich ja auf was gefasst machen, Maike», rief Cornelius und sang sogleich aus voller Brust den seinerzeit sehr beliebten Chris-Doerk-Song: «Mein lieber Herr Professor / Sie küssen ja viel bessor / als man vermuten mag / und das am ersten Tag …»
Alle lachten, selbst ich schnaubte und schnoberte los, dass die Kekskrümel flogen. Freunde halt. Maike wurde sogar ein bisschen rot und erkundigte sich ablenkungshalber bei Cornelius, wie das Geschäft denn so lief.
«Hör mir auf», schwadronierte er los. «Dieser Kubicki treibt mich in den Ruin. Der ist völlig verrückt geworden. Für die vierte Staffel von «Käpt’n Schluck» will er das doppelte Honorar. Ihr habt euch nicht verhört. Das doppelte!»
Dieter Kubicki war der Cartoonsynchronsprecher-Superstar Deutschlands. Er lieh einem halben Dutzend beliebter Cartoonfiguren wie etwa besagtem Piraten-Raben «Käpt’n Schluck» seine quäkende Stimme. Cornelius produzierte seine Synchros im Paketpreis. Wenn Kubicki, der mittlerweile in Fernsehkindershows live quäkte und Autogrammpostkarten dabeihatte, mehr Geld wollte, beschnitt das Cornelius’ Gewinnmarge.
«Und dann kam er neulich und meinte: In dieser muffigen Bude spreche ich nicht mehr. Da krieg ich Asthma. Musste ich also eine neue Sprecherkabine bauen lassen! Nur für diesen eitlen Fatzke. Synchronsprecher, pah! Das waren früher so was wie Komparsen.»
Cornelius hatte mein begrenztes Mitleid. Er war nicht arm. Mümmelnd und teeschlürfend griff ich nach der Post, um die Geburtstagsgrüße durchzusehen. Mutti und Vati hatten geschrieben und die Schwiegereltern, die mich «Lieber Hans-Ullrich» nannten. Die Telekom und IKEA gratulierten ebenfalls, und, wie mir schien, eine Spur herzlicher als Maikes Eltern. Herr Fahrenbach vom Nordsächsischen Altphilologenverband schickte ein paar Zeilen vom alten Plebeius. «Tibi diem natalem felicem opto!», rezitierte ich mit Obacht von der Karte. Ich nahm den nächsten Brief und riss ihn auf. Sogar das Jugendamt, wollte ich gerade heraustönen, als mir klar wurde, dass das Jugendamt gar keinen Anlass hatte, mir zum vierundvierzigsten Geburtstag zu gratulieren. Ich schloss langsam meinen schon offenen Mund und warf stirnrunzelnd einen Blick auf das Schreiben.
«Sehr geehrter Herr Dr. Ullrich Hasselmann!
Das Jugendamt beabsichtigt, hinsichtlich ihres gemeinsamen Kindes das Sorgerecht per Gerichtsbeschluss von der Kindsmutter auf Sie übertragen zu lassen, da die Wohlfahrt und die Entwicklung des Kindes in höchstem Maße gefährdet erscheinen und von der Kindsmutter u.E. nicht ausreichend gewährleistet werden. In dieser Angelegenheit würden wir Sie gerne am Mittwoch, dem Soundsovielten, zu einem dringenden Elterngespräch einladen. Bitte nehmen Sie in dieser Angelegenheit unverzüglich mit uns Kontakt auf.
Hochachtungsvoll
Monika Beutewitz»
So weit, so gut.
Nur: Ich habe kein Kind. Genauer gesagt: Ich habe kein einzelnes Kind. Ich habe zwei Mädchen, und ich musste doch sehr bezweifeln, dass eines davon in seiner Entwicklung gefährdet ist. Denn es sind Zwillinge. Sie spielen vierhändig Klavier. Wenn eines davon gravierend in seiner Entwicklung beeinträchtigt wäre, würde das andere ebenfalls sofort in seiner Entwicklung zurückfallen, nur um nicht weniger gravierend beeinträchtigt zu sein. Denn Julia und Claudia dulden keine Unterschiede. Es ist für Nichtzwillinge nicht ganz so einfach zu verstehen: Aber Geschwisterkonkurrenz ist was für Menschen aus zwei verschiedenen Eizellen. Im Prinzip könnten meine Töchter sogar denselben Namen tragen.
Hier musste es sich also um ein Versehen handeln. Einen Computerfehler. Die hauen da die Adressen durcheinander, und unsereins kriegt die Flatter. Man muss sich nur mal vorstellen, was so ein Brief in einer weniger gefestigten Partnerschaft anrichten könnte! In einer Partnerschaft, die nicht wie die von Maike und mir auf absolutem Vertrauen fußt. Tiefstmöglichem Vertrauen, nämlich aus dem Wissen gespeist, dass wir einander im Stande der Unschuld begegnet waren. Ich bin der erste Mann in Maikes Leben gewesen, und sie hatte sich mir, nun, körperlich erst anvertraut dank der gesicherten Überzeugung, dass ich, wie sie selbst, noch nie einem anderen Menschen meine Liebe geschenkt hatte.
Und eigentlich stimmte das auch.
«Und von wem ist das?», fragte Maike fröhlich.
Die Adresse in dem Jugendamtsschreiben war handschriftlich eingetragen. Ein Stempel des Einwohnermeldeamtes prangte daneben. Wenn es sich um einen Behördenirrtum handelte, dann hatten sich gleich zwei Behörden geirrt.
Ich beschloss, Maike den Brief nicht zu zeigen. Vorerst.
«Ach», sagte ich, «ist nur Werbung!»
Das war falsch.
Aber verständlich. Ich feierte Geburtstag. Die Stimmung war gut. Wir hatten gerade gelacht. Ich wollte das alles nicht mit dem Rätselraten über einen seltsamen Brief vom Jugendamt verderben. Außerdem ging es meine Freunde nichts an. Zugegeben, nachdem Cornelius (mich drücken, Maike die Hand geben) und Andy (mir die Hand geben, Maike drücken, dann Maike an beiden Händen nehmen, ihr tief in die Augen gucken und «Du weißt, mein Angebot steht!» sagen, Maike noch mal drücken) gegangen waren, hätte ich was sagen können. Aber irgendwie erschien mir Andys seltsame Andeutung just in diesem Moment erklärungsbedürftiger als dieser ominöse Brief vom Jugendamt.
Die beiden waren gerade aus der Tür, als ich Maike mit großen Augen fragte:
«Bitte? Was steht bei Andy?»
Maike winkte ab und erklärte mit viel Ach und Quatsch und Kopfgeschüttele, dass Andy sie schon wieder mal gefragt habe, ob er sie nicht für Porträtaufnahmen gewinnen könne.
«Er meint, ich bin fotogen. Er sagt immer, ich hätte irgendwas. So eine Art Aura.»
Ich sagte, da könne ich ihm nur zustimmen, aber ich würde meine Frau ungern in einer Fotoausstellung sehen.
«Andy meinte, er mache auch Fotos, die er nicht veröffentlicht.»
Ich fuchtelte unwirsch durch die Luft. Unveröffentlichte Aufnahmen. Das könne er sich erst recht aus dem Kopf schlagen. Maike war ganz entzückt von meiner Eifersucht und kniff mich fröhlich in die Wange, was ich eingestandenermaßen hasse.
«Glaubst du im Ernst, dass ich auch nur darüber nachdenke? Schatz!»
Ja, ich kannte Maike. Sie hatte Grundsätze. Und dafür liebte ich sie.
Nur, wie bringt man einer Frau mit Grundsätzen einen rätselhaften Brief vom Jugendamt nahe?
Maike warf sich den Mantel über, um die Zwillinge vom Kiddie’s Dance abzuholen. Als sie schließlich wieder da war und Claudia und Julia mich mit ihren Geschenken heimsuchten – zwei selbstbemalten Stifthaltern aus aufgebohrten Holzklötzen, wie sie seit Jahrhunderten im deutschen Bastelunterricht als Vatergeschenke hergestellt werden –, war mir auch nicht gerade danach, die Rede auf die merkwürdige Post dieses Tages zu bringen.
Bevor mich jedoch der letzte Hauch von Pflicht verließ, sagte ich im abendlichen Wohnzimmer zu Maike, die mit der Lesebrille auf der Nase ringelbunte Stulpen für die Mädchen strickte:
«Da ist heute ein Brief gekommen …»
Aber dann wandte Maike ihren Kopf und sah mich gesenkten Hauptes über der Lesebrille an, und im Brennpunkt dieses aufmerksamen Blicks wurde mir restlos klar, dass ich es ihr nicht sagen konnte.
«Irgend so ein Student hat einen Brief an die Bewerbungskommission geschrieben. Ich sei ein Rassist. Ich hätte bei einer Vorlesung das irische Volk beleidigt.»
Maike runzelte die Stirn. Ich nahm die Fernbedienung. Es war Zeit für die Tagesschau.
«Musste dir mal vorstellen», sagte ich.
«Wichtigtuer!», meinte Maike. Sie fragte nicht mal nach.
Doch was ich wie so viele Männer nicht wusste, war eben dies: Wer in einer Partnerschaft auch nur eine Minute zögert, mit der Wahrheit herauszurücken, ist erledigt. Denn nach dieser Minute muss man nicht nur die Wahrheit, sondern auch noch die zögernde Minute erklären. Nach zwei Minuten ist es schon doppelt so schwer, und nach einer Stunde, einem Tag ist es quasi unmöglich geworden, ein Gespräch über eine erklärungsbedürftige Tatsache zu beginnen, weil man dann überhaupt nicht mehr erklären kann, warum man mit der erklärungsbedürftigen Angelegenheit so lange gewartet hat. Denn es gibt ja gar keine Erklärung. Man hat einfach nur gewartet. Aber welche Frau würde akzeptieren, dass es bei Männern grundloses Verhalten gibt? Das wäre ja ein Freibrief. Für alles.
Eigentlich wollte ich Maike nur nicht beunruhigen, und ich will es auch jetzt noch nicht, zumal das, was Maike beunruhigen könnte, mittlerweile Ausmaße angenommen hat, die sich in keinster Weise mehr kommunizieren lassen.
Ich rumple mit dem Jeep einen Sandweg entlang, der um einen Hügel herumführt. Meine bloßen Füße schmerzen von den Tritten auf die Brems- und Kupplungseisen. Links muss ich mir irgendeinen Zeh gebrochen haben. Wie spät ist es? Wie viel Zeit ist vergangen? Wie viel Zeit bleibt mir noch? Habe ich überhaupt noch Zeit? Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. Der Jeep rumpelt den Hügel hinauf, Gräser und Sträucher, Scharfgarbe und Rainfarn streifen ihn.
Als ich oben bin, sehe ich die Lichter.
Unten liegt der See. Zwei Dinge schwimmen darin, ein Boot und eine Lederjacke. In der Jacke steckt ein Mann. Früher trug er diese Lederjacke. Jetzt trägt sie ihn.
Das war ja wohl ein Mordversuch. Fast ein gelungener. Da gibt es gar nichts zu deuteln oder schönzureden. Der hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht … daran gehindert hätte.
Ich bin … ja was?
Wut ist es nicht. Verzweiflung? Angst?
Nein. Ich bin empört.
Ich bin auf eine sehr seltsame Art empört. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist kein Grund, mich umbringen zu wollen. Das wäre ja wohl ein bisschen unangemessen.
Und ich habe meine Tablette nicht genommen. Seltsamerweise schlägt mein Herz ruhig und klar. Bummbumm, bummbumm, bummbumm.
Warum tut es das?
Ich hatte erwartet, dass mich mein Herz erschlägt, noch bevor ich anderweitig zu Tode komme. Ich hatte schlicht erwartet, vor Todesangst zu sterben. Aber offensichtlich bekommt meinem Herz Todesangst gut.
Als ich mich noch vor Krankheiten und Unfällen, vor Missgunst und böser Nachrede, vor Unordnung, Frechheit, Belästigung und Dummheit, als ich mich noch vor quasi allem fürchtete, hetzte mein Herz in Stolperschritten durch das Dickicht meiner Ängste.
Langsam wird mir was klar.
Für jemanden, der stets das Schlimmste fürchtet, ist es eine Art Befreiung, wenn das Schlimmste endlich eintritt. Jemand, der stets das Schlimmste fürchtet, hofft auf der dunklen, abgewandten Seite seiner Seele vielleicht sogar, dass es geschieht. Jemand, der stets das Schlimmste fürchtet, sehnt sich womöglich nach der Ausweglosigkeit des Allerschlimmsten, weil es ihm die Entscheidung abnimmt, die er selbst nicht zu treffen vermag.
Vielleicht bin ich allem Ärger bisher nur ausgewichen, weil er es nicht wert war, ihm die Stirn zu bieten.
Dass ich vor einem pöbelnden Betrunkenen die Straßenseite wechseln musste, war lästig. Dass sich jemand in der Schlange im Supermarkt vor mich stellte, war dreist, aber die Aufregung nicht wert. Dass sie mir früher auf dem Schulhof immer die Mütze vom Kopf gerissen und in die Pfütze geworfen hatten, war auszuhalten gewesen. Es hatte mich sogar eher noch in dem Wunsch bestärkt, der Welt ein bisschen die kalte Schulter zu zeigen und meine Zeit mit Büchern zu verbringen.
Es war alles kein Problem. Solange es nur mein Problem war.
Aber dies hier ist nicht nur mein Problem. Und deswegen kann ich nicht zurück. Daran kann auch ein Mordversuch nichts ändern. Tut mir leid.
Ich weiß jetzt auch, wo ich bin.
Am Kiessee. Ein paar Kilometer östlich liegt das größte Plattenbauviertel des Landes. Direkt vor mir leuchtet die City.
Dort hinten im Osten steht ein Flachbau. Da muss ich hin. Nicht nach Hause.
Bummbumm, Bummbumm, Bummbumm.
So hört sich ein guter Herzschlag an.
Moriendum esse, sagte Oktavian vor den Ratsherren von Perusia.
Es muss gestorben werden.
Dabei ist die Zeit, als noch nicht gestorben werden musste, gerade mal ein paar Stunden her. Die Zwillinge saßen mürrisch beim Abendbrot. Ich fragte sie, was sei.
«Mama will uns vom Kiddie’s Dance abmelden», beschwerte sich Julia.
«Weil sie uns nicht mehr fahren kann», ergänzte Claudia.
Ich sah Maike fragend an.
«Ich muss langsam auch mal Abendschichten übernehmen können», erklärte sie. «Die Kolleginnen in der Bibliothek haben jahrelang Verständnis gehabt, solange die Kinder klein waren. Aber jetzt gibt es andere, die kleine Kinder haben. Kleinere Kinder. Ich habe also zugesagt, dass ich den Spätdienst im Lesesaal am Mittwoch und am Freitag übernehme. Und das heißt: Es ist keiner da, der die Kinder fährt. Deswegen muss ich sie abmelden.»
«Wir könnten einen Babysitter engagieren», schlug ich vor.
«Wir sind keine Babys», protestierten die Zwillinge.
Maike war skeptisch. Die Zwillinge seien bekanntermaßen Home-Angels, aber Street-Devils. Unter elterlicher Aufsicht fügsam, aber bei Personen, zu denen sie keine Bindung hätten, durchaus auch mal unartig, unter Umständen sogar widerborstig. Und außerdem wisse sie nicht, wie man jemanden bezahlen solle, der die Mädchen nur zum Tanzen bringe und wieder abhole. Stundenweise wäre ja wohl ein bisschen viel.
«Ich gucke mal, ob ich jemanden finde», munterte ich die Mädchen auf.