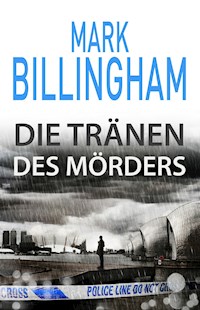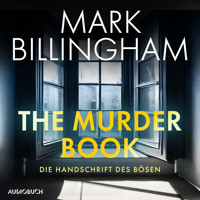Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Londoner Detective Inspector Tom Thorne hat endlich alles, wonach er sich immer gesehnt hat: gute Freunde, eine liebende Partnerin an seiner Seite und Erfolg in dem Job, dem er sein Leben verschrieben hat. Doch je mehr man hat, desto mehr kann man verlieren … Innerhalb weniger Tage werden mehrere Männer tot in ihren Betten gefunden. An allen Tatorten finden die Ermittler der Metropolitan Police zwei Weingläser, die auf einen romantischen Abend schließen lassen. Bald stellt sich heraus, dass jedes der Opfer online nach Liebe suchte – oder wenigstens nach einem Abenteuer für eine Nacht. Der Verdacht liegt nahe, dass die Polizei es mit einer Täterin zu tun hat, die ein perfides Spiel spielt. Erst als das Skalpell gefunden wird, mit dem die Leichen verstümmelt wurden, versteht Thorne: Die Fäden hat in diesem Fall ein ganz anderer in der Hand. Einer, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Eine Rechnung, die Thorne mit seinem Leben bezahlen soll …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Billingham
Die Handschrift des Bösen
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Stefan Lux
Kampa
Prolog
Er beobachtet das Tor und wartet. Fünfzehn Minuten sind vergangen, seit die alte Frau mit den anderen hineingegangen ist. Die Zeit müsste eigentlich reichen. Er raucht – was er nur selten tut – und versucht, die Ruhe zu bewahren.
Seine Gedanken kreisen um Schmerzen.
Um die vielen Dinge, die Schmerzen verursachen oder nehmen. Um Schwellenwerte und um Menschen, die glauben, sie wüssten, was Schmerzen sind – und eigentlich von Glück sagen können, dass sie nicht die geringste Ahnung haben. Seine Gedanken kreisen um ein Leben mit Schmerzen. Oder mit der Erinnerung an Schmerzen, was, wie er aus Erfahrung weiß, genauso schlimm sein kann. Aber angesichts des Ortes, an dem er sich aufhält, und dessen, was hoffentlich auf der anderen Seite des Tors passiert, denkt er vor allem an Menschen, die dafür leben, anderen solche Schmerzen zuzufügen.
An einen Mann, der das viel zu lange getan hat.
Er dreht sich um und tritt ein Stück zur Seite, als die ersten Besucher herauskommen. Durch die dramatischen Ereignisse dort drinnen wurde ihnen die kostbare Zeit mit den Liebsten beschnitten. Eine Frau quasselt in ihr Handy – »Du glaubst es nicht« –, zwei andere murmeln kopfschüttelnd vor sich hin. Auf dem Weg zu seinem Auto, mit dem gezackten Schattenriss des Gefängnisses im Rücken, hört er Gesprächsfetzen und gibt sich keine Mühe, ein Grinsen zu verbergen. Nur ein Wort hier und dort, aber es reicht, um zu wissen, dass die Sache erledigt ist. Nicht komplett erledigt vielleicht, aber bald wird alles vorbei sein.
Die alte Frau hat das Zeichen seiner Bewunderung weitergegeben.
Eine Opfergabe, die dankbar angenommen wurde.
All das knifflige Hantieren mit Nadel und Lebensmittelfarbe hat sich gelohnt …
Er weiß nicht präzise, wie lange es dauern wird, denn normalerweise spielen das Körpergewicht und der Stoffwechsel eine entscheidende Rolle. Aber angenehm ist es auf keinen Fall. Er hat im Netz ein paar rucklige Videos gesehen und Beschreibungen gelesen. Während er die Türen seines Wagens entriegelt, erinnert er sich an einige Begriffe, die ihn aus verschiedenen Artikeln angesprungen haben – Keuchen, Anfall, Koma. Er nimmt sich vor, seinen Suchverlauf zu löschen.
Aber das eilt nicht. Vorher will er mit ein paar Drinks feiern.
Er wirft den Rest seiner Zigarette zu Boden.
Enttäuschend ist einzig und allein, dass er nicht dabei sein und zusehen konnte. Immerhin kann er es sich problemlos ausmalen, in letzter Zeit hat er kaum etwas anderes getan. Die plötzliche Panik in den Augen des Mannes, bevor sie glasig wurden und die Krämpfe begannen. Wahrscheinlich Wut auf die verängstigte alte Frau, die zu diesem Zeitpunkt entsetzt aufgeschrien haben dürfte. Vor allem aber auf sich selbst, weil er ein derartiger Idiot war, viel zu gierig und zu gutgläubig.
Er dreht das Lenkrad, setzt aus der Parklücke zurück und hofft, dass es nicht zu schnell gegangen ist. Dass der Mann noch genug Zeit hatte, um zu begreifen, wer sein letzter Besucher war. Dass der Tod, nachdem er dem Drecksack auf die Schulter geklopft hatte, noch für ein paar Minuten die Füße hochgelegt und es sich bequem gemacht hat.
Vor allem hofft er, dass es nicht schmerzfrei vonstattengegangen ist.
Teil einsEin glückliches Ende
1
Detective Inspector Tom Thorne sah sich im Schlafzimmer um. Von der Leiche abgesehen machte das Haus in Gospel Oak einen bemerkenswert unauffälligen Eindruck. Er seufzte mit einem leisen Rasseln in der Kehle, sein Schutzanzug knisterte beim Drehen des Kopfes. Die Kleidung des Mannes lag unordentlich am Fußende des Bettes – Hose, Hemd, Socken und Unterwäsche –, aber ansonsten deutete das Zimmer auf Bewohner hin, die großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legten. Auf einem Nachttisch entdeckte Thorne sorgfältig gestapelte Autozeitschriften, auf dem anderen mehrere Taschenbücher, ein Schminktäschchen und eine Reihe Tablettenfläschchen. Die Schranktüren waren vermutlich von den Kollegen geöffnet worden, die als Erste am Tatort eingetroffen waren. Dahinter sah er nach Farben sortierte Hemden, sorgfältig gefaltete Pullover und blank polierte, in einer perfekten Reihe aufgestellte Schuhe. Ein kurzer Blick in den Schrank daneben reichte, um festzustellen, dass die Frau genauso penibel war. Während ein halbes Dutzend Polizisten, Fotografen und Kriminaltechniker im ganzen Haus ihrer Arbeit nachgingen, beschlich Thorne das Gefühl, dass der Mann und die Frau sich in ihrem einstmals warmen und einladenden Haus in einer eher trostlosen Routine arrangiert hatten. Vor seinem inneren Auge sah er, wie die beiden sich in sanftem Ton stritten, während sie die Kleidung aufhängten oder in den Korb für die Schmutzwäsche legten, bevor sie zu Bett gingen.
Ein geordnetes Leben, das für einen von ihnen in Chaos und einem Blutbad geendet hatte.
Ein Kriminaltechniker, der einen ähnlichen Schutzanzug trug wie Thorne, stellte sich neben ihn. Nach ein oder zwei Sekunden sagte er: »Ich hoffe wirklich, dass der arme Kerl nicht im Callcenter arbeitet.«
»Wie bitte?«
Der Kriminaltechniker deutete mit dem Kopf zum Bett hin, wo der diensthabende Rechtsmediziner sich Notizen machte. Einmal mehr starrte Thorne auf den leblosen Körper. Das Bettzeug war himmelblau und trug ein verblasstes Muster aus flauschigen Wolken, die jetzt voll dunkelroter Spritzer waren. Weiter oben sah es so aus, als hätte jemand über der Brust des Mannes eine Flasche Rotwein verschüttet. Aber es war kein Wein, der aus der klaffenden Wunde in seiner Kehle geflossen war und beiderseits des Kopfes kleine Pfützen gebildet hatte.
»Kapiert?«, fragte der Kriminaltechniker.
»Ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Thorne.
Der Kriminaltechniker hob die Arme und deutete auf beide Seiten seines Kopfes, nur für den Fall, dass Thorne eine Erklärung brauchte. »Dann wäre er seinen Job auch noch los.« Er starrte Thorne an und wartete auf ein Lachen oder wenigstens ein schiefes Grinsen. Als weder das eine noch das andere kam, zog er sich kopfschüttelnd zurück, traurig, dass sein Witz nicht auf die verdiente Resonanz gestoßen war.
Sondern auf taube Ohren.
Thorne drehte sich zu Nicola Tanner um, die gerade mit einer zweiten Kriminaltechnikerin im Schlepptau ins Zimmer trat. Sie schien Thornes fragende Miene zu bemerken und schüttelte den Kopf. »Keine Spur von ihnen.«
Die Kriminaltechnikerin mimte ein Schaudern. »Sieht aus, als hätte der Täter die Ohren mitgenommen.«
»Oh, Scheiße.«
»Einer von denen«, bemerkte Tanner.
»Eine gute Nachricht gibt es allerdings.« Die Kriminaltechnikerin – sie erinnerte auf verstörende Weise an Theresa May, wobei sie deutlich weniger furchteinflößend wirkte – hielt mehrere Beweismittelbeutel aus Plastik hoch. »An Spuren herrscht kein Mangel.« Sie nahm einen der Beutel und präsentierte ihn wie einen Schatz. »Dieses kleine Haarbüschel war nicht schwer zu finden. Es klebte auf der Brust des Opfers in getrocknetem Schweiß.« Grinsend fügte sie hinzu: »Und wir haben Wurzeln.«
Thorne beugte den Oberkörper vor, um die anscheinend blonden Haare besser sehen zu können. Ihm war klar, warum die Frau sich so freute. Aus der intakten Wurzel eines einzelnen Haares ließ sich die DNA isolieren. »Wahrscheinlich bei einem Kampf ausgerissen, was meinst du?«
»Oder bei etwas anderem«, bemerkte Tanner.
Thorne warf ihr einen Blick zu, dann sah er wieder den Toten an.
Die Kriminaltechnikerin trat einen Schritt zurück. »Ich vermute, wir sollen dem Labor Druck machen?«
»Da vermuten Sie richtig«, sagte Thorne.
Die Frau drehte sich um und machte sich wieder an die Arbeit. Als Tanner kurz darauf zu Thorne hinüberschaute, las sie in seiner Miene den unausgesprochenen Wunsch, sich etwas ungestörter zu unterhalten. Also ging sie zur Tür und wartete, dass er ihr folgte. Die beiden blieben im Treppenhaus stehen, nahmen die Kapuzen ab und drückten sich an die Wand, um zwei weitere mit Ausrüstung beladene Techniker ins Schlafzimmer zu lassen.
»Vielleicht Bandenkriminalität«, sagte Thorne.
»Wirklich?«
»Warum nicht? Wäre nicht das erste Mal.« Er hob die Hand und tat, als würde er sich die Kehle durchschneiden. »Wir haben schon schlimmere Fälle gesehen.«
»Ernsthaft?«
»Jemand will mit dem Verbrechen ein Exempel statuieren oder etwas in der Art.«
»Bandenkriminalität?« Tanner machte eine Kopfbewegung Richtung Schlafzimmertür. »Auf mich wirkt er wie jemand, der sogar seinen Schlafanzug bügelt.«
»Vielleicht hat er sich auf etwas eingelassen, wovon er die Finger hätte lassen sollen.«
»Oh, das glaube ich allerdings auch.«
»Ich sag ja nur, wir sollten nichts ausschließen.«
»Und ich sage, wir sollten nicht rumquatschen und das Offensichtliche aus den Augen verlieren.«
Der Kriminaltechniker, der sich für einen Comedian hielt, kam mit einem Plastikkoffer aus dem Zimmer. Thorne sagte: »Nette Art, das Wochenende abzuschließen.« Zur Antwort bekam er nur ein flüchtiges Nicken. Thorne fand, er habe es nicht besser verdient. Schließlich hatte er schon schlechtere Witze gehört. Krankere Witze, jede Menge. Das Geplänkel und der schräge Humor waren wichtig, sogar nötig. Er ging davon aus, dass diese Art Pfeifen im Walde in den kommenden Tagen und Wochen noch ziemlich viel Raum einnehmen würde.
Er wandte sich an Tanner und sagte: »Ja, schon …«
Er wusste selbst nicht, wem er etwas vormachen wollte, denn Nicola Tanner und er kannten sich gut genug.
Einer von denen.
Ihm war sofort klar gewesen, was sie meinte, denn er hatte dasselbe gedacht. Jeder Mord veränderte einen, aber es gab Fälle, die ein bisschen tiefer unter die Haut gingen. Die größere Schrammen hinterließen und mehr Schorf, an dem man herumspielen konnte. Manche Mörder, die meisten sogar, waren gewöhnliche Menschen, die aus gewöhnlichen Gründen töteten: Sie waren wütend, sie waren eifersüchtig, sie waren gierig, sie tickten aus.
Aber das galt nicht für alle.
Als er schwitzend in dem rechteckigen, in blassem Pink gehaltenen Zimmer gestanden und den Gestank verfaulenden Fleischs gerochen hatte, hatte Thorne auf der Stelle begriffen, dass die Person, die er würde jagen müssen, nicht aus einem Grund gemordet hatte, den er je würde nachvollziehen können. Oder nachvollziehen wollen. Der Kriminaltechniker von vorhin hatte versucht, dem Schrecken, mit dem sie alle konfrontiert waren, ein wenig die Schärfe zu nehmen, sonst nichts. Aber in Thornes Innerem hatte sich bereits eine Art lautloser Schrei angestaut, der es ihm unmöglich gemacht hatte, die gewünschte Reaktion zu zeigen.
Er hatte dem Grauen mitten ins Gesicht geschaut und gewusst, dass noch Schlimmeres kommen würde.
»Wo ist …«
Tanner trat ans Geländer und deutete nach unten. »Sie ist in der Küche. Die Kollegen bringen sie für die Nacht zu Freunden und informieren die Angehörigenbetreuung, dann können wir sie morgen befragen.«
Thorne war schon auf dem Weg nach unten. »Mal sehen, ob sie vorher zu einem kurzen Gespräch in der Lage ist.«
Andrea Sumner saß an einem langen Küchentisch, links und rechts von uniformierten Constables flankiert. Als Thorne und Tanner eintraten, standen die beiden Kollegen auf. Sie traten vom Tisch weg und boten an, Tee zu machen, aber Andrea Sumner schüttelte den Kopf. Thorne wartete, bis Tanner Platz genommen hatte, setzte sich neben sie und dachte, dass Andrea Sumner inzwischen genug Tee für den Rest ihres Lebens intus haben dürfte. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, warum so viele Menschen in Krisenzeiten instinktiv zu den kleinen Beuteln griffen. Er selbst würde sicher nicht auf diese Idee kommen.
»Etwas Stärkeres?«, fragte er.
Wieder schüttelte die Frau den Kopf, als hätte sie die Frage überhaupt nicht registriert.
»Unser herzliches Beileid zu Ihrem Verlust«, sagte Tanner.
Andrea Sumner lächelte und nickte, als ginge sie davon aus, dass Polizisten in solchen Situationen eben so redeten. Das taten sie natürlich auch, und Thorne sträubte sich innerlich jedes Mal gegen diese Worte, denn nichts, und ganz bestimmt nicht das Leben eines Mannes, war verloren gegangen. Es war ausgelöscht worden. Trotzdem hatte er bisher von keiner sinnvollen Alternative gehört. Und er wusste, dass Tanner es aufrichtig gemeint hatte. Er hatte es ihrer Stimme angemerkt. Susan, ihre Partnerin, war vor einigen Jahren vor der Tür des Hauses erstochen worden, in dem sie erst kurze Zeit zusammen gewohnt hatten. Sie trauerte noch immer, und auch wenn sie es manchmal nicht ausdrücken konnte, war sie der einzige Mensch in diesem Haus, der begriff, wie Richard Sumners Frau sich fühlte.
Richard Sumners Witwe.
Thorne schätzte sie auf Mitte fünfzig. Wegen der Entstellungen durch Leichenstarre und Totenflecken hätte er nicht sagen können, ob der Mann oben im Bett älter oder jünger gewesen war. Jedenfalls war sie groß und schlank und trug eine cremefarbene Bluse unter einem braunen Pullover mit V-Ausschnitt. Ihre Haut war blass, die rotgeränderten Augen wirkten durch die Drahtgestellbrille größer, und sie war sehr still.
Allerdings war sie nicht blond.
»Ich habe gehört, Sie waren übers Wochenende verreist«, sagte Tanner.
Wieder nickte die Frau.
»In Liverpool, richtig?«
Die ganze Zeit über hatte die Frau auf einen Punkt irgendwo zwischen ihnen oder durch die offene Tür gestarrt, aber jetzt begegnete ihr Blick langsam dem von Tanner. »Bei einer Lehrerkonferenz«, sagte sie. Ihre Stimme klang flach, ein leichter Akzent aus dem Norden schimmerte durch. »Nur für die beiden Nächte. Wir fahren jeden November mit einer kleinen Gruppe hin.«
»Und Sie sind am späten Vormittag zurückgekommen?«
»Das hab ich denen schon gesagt.« Sie machte eine Kopfbewegung Richtung Hausflur, wo die beiden Beamten warteten. »Ich hab ihnen schon alles gesagt.«
Das Wenige, was sie wussten, hatten Thorne und Tanner von den Kollegen erfahren. Aber beiden war bewusst, dass Geschichten sich häufig änderten – vielleicht nur minimal –, wenn Menschen einige Stunden mit Situationen wie dieser hatten umgehen müssen. Thorne beugte sich vor. »Es tut uns wirklich leid, dass wir Ihnen jetzt diese Fragen stellen müssen, Andrea. Wir würden es sicher nicht tun, wenn es nicht sehr wichtig wäre … Aber könnten Sie vielleicht mit dem Zeitpunkt ein bisschen genauer sein?«
Sie schüttelte den Kopf, hob die Hände vom Tisch und ließ sie wieder fallen. »Kurz nach zwölf vielleicht. Viertel nach … so ungefähr. Ich hab mir im Auto irgendeine Comedyshow angehört. Auf Radio 4.«
»Das ist großartig«, sagte Tanner. »Damit können wir die Uhrzeit ermitteln. Danke.«
»Ist das die Zeit, zu der Sie von Anfang an zurückerwartet wurden?«, fragte Thorne.
»Wie bitte?«
»Sie wurden nicht früher erwartet?«
Sie sah ihn an und schwieg einige Sekunden, als versuche sie herauszufinden, worauf er mit seiner Frage hinauswollte. »Nein. Es war von Anfang an so geplant. Ich muss morgen arbeiten …« Sie hielt inne und begriff, was sie gesagt hatte. Und dass sie wahrscheinlich für längere Zeit nicht mehr arbeiten gehen würde, wenn überhaupt.
»Gut. Wann haben Sie zuletzt mit Richard gesprochen?«
»Gestern Abend.« Andreas Mund öffnete sich, sie schien ihn nur mit Mühe wieder schließen zu können. »Er hat mich gegen sieben im Hotel angerufen. Wir haben nicht lange geredet. Er hat gesagt, er würde früh ins Bett gehen.«
»Danke«, sagte Tanner und warf Thorne einen Blick zu. Beiden war klar, dass der Rechtsmediziner nur eine grobe Schätzung für den Todeszeitpunkt abgeben würde. Jetzt hatten sie wenigstens einen ungefähren Rahmen. »Das hilft uns wirklich.«
Thorne schaute an Andrea Sumner vorbei durch die verglaste Hintertür nach draußen. Noch keine sechzehn Uhr, und es war fast schon dunkel. Trotzdem konnte er am hinteren Ende des kleinen Gartens einen Zaun mit einem schmalen Tor erkennen. Er war zu weit entfernt, um zu sehen, ob die Riegel oben und unten offen waren oder nicht. Das würde er später nachprüfen. »Das Tor da hinten führt auf eine Gasse oder so etwas, stimmt’s?«
Andrea nickte. Plötzlich drehte sie sich um und starrte selbst hinaus, als hätte Thorne dort etwas Konkretes entdeckt. Als wäre dort noch eine Spur der Person zu erkennen, die von der Polizei verdächtigt wurde, das Tor benutzt zu haben. »Die Gasse zieht sich an der Rückseite der ganzen Häuserzeile entlang. Warum? Was denken Sie?«
»Ich denke nichts«, erklärte Thorne. »Noch nicht.«
Jetzt beugte Tanner sich zu der Frau vor, streckte eine Hand aus und berührte beinahe ihre. »Andrea … Sie haben unseren Kollegen gesagt, bei Ihrer Rückkehr hätte alles ganz normal ausgesehen.«
»Genau.«
»So wie Sie es zurückgelassen hatten, haben Sie gesagt.«
»Ja, alles war wie immer.« Wieder nickte sie und fing an, mit dem Goldkettchen an ihrem Handgelenk herumzuspielen. »Jedenfalls habe ich das gedacht. Alles, wie es sein sollte … Verstehen Sie?«
»Okay.«
»Erst als ich nach oben gegangen bin …«
Tanner hörte, wie die Stimme der Frau brach, und sah, wie sie den Kopf sinken ließ. Also gab sie den Polizisten vor der Tür ein Zeichen, dass Thorne und sie fertig waren. Thorne schob seinen Stuhl zurück und verzog bei dem schaben- den Geräusch das Gesicht. Tanner sagte etwas über weitere Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten. Er ließ sie machen, denn in solchen Dingen war sie wesentlich besser als er.
»Unbedingt«, sagte er nur, als Tanner fertig war. »Zögern Sie bitte nicht.«
Thorne war nicht überrascht, dass Andrea Sumner sich einmal mehr entschieden hatte, die offene Weinflasche und die beiden Gläser nicht zu erwähnen, die von den zuerst eingetroffenen Beamten im Wohnzimmer entdeckt worden waren. Es war möglich, dass sie nichts davon bemerkt hatte, aber Thorne war vom Gegenteil überzeugt. Die Flasche und beide Gläser waren vorsichtig eingetütet und von den Kriminaltechnikern verstaut worden. Thorne war verdammt sicher, dass sie vor zwei Tagen, als Andrea Sumner aufgebrochen war, nicht dort gestanden hatten.
Zu verarbeiten, dass ihr Mann ermordet worden war, würde ihr schwer genug fallen – und wie er ermordet worden war. Sie würde nicht allzu viel darüber nachdenken wollen, was an dem Abend passiert war, an dem er früh ins Bett hatte gehen wollen.
Die Kreuzungen in beiden Richtungen der Straße waren blockiert, außerdem war links und rechts des Sumner-Hauses Absperrband gespannt worden. Ein halbes Dutzend Streifenwagen stand mitten auf den Straßen und auf den Bürgersteigen, viele Schaulustige wurden höflich auf Distanz gehalten. Während er an dem mit »Met Police« beschrifteten Verpflegungswagen auf seinen Kaffee wartete, bemerkte Thorne eine Frau, die eine Lücke zwischen den Autos und den Uniformierten gefunden hatte, nach dem Absperrband griff und zufrieden nickte.
Mit den Kaffeebechern in der Hand machten er und Tanner sich auf den Weg zu ihrem Wagen. Da entdeckte Thorne eine Frau, die ihm aus dem Garten des gegenüberliegenden Hauses zuwinkte. Er überquerte die Straße und fragte, ob er ihr helfen könne.
Die Frau musterte den Dienstausweis, den Thorne sich umgehängt hatte. »Ist mit Richard und Andrea alles in Ordnung?«
Sie würde es sowieso bald erfahren. Zwar konnte die Polizei anordnen, dass die Anwohner vorübergehend in ihren Häusern bleiben mussten, aber sie konnte kaum darauf bestehen, dass auch noch die Vorhänge zugezogen wurden.
»Ehrlich gesagt, nein«, sagte Thorne.
»O Gott«, sagte die Frau. »Das ist ja schrecklich.«
»Dann kennen Sie die beiden?«
»Na ja, wir sind Nachbarn. Ich meine … Ich kenne sie nicht gut. Nur hier und da ein paar Sätze auf der Straße oder ein kurzer Besuch auf einen Drink an Weihnachten, so etwas.« Dann sagte sie noch einmal: »O Gott.«
»Haben Sie Richard gestern Abend gesehen?«
»Geredet haben wir nicht, nein.«
»Ist jemand gekommen oder gegangen?«
Die Frau ließ sich einen Moment Zeit, als müsste sie nachdenken, aber Thorne vermutete, sie wolle einfach nicht übereifrig wirken. »Ich hab gesehen, wie sein Wagen aus der Einfahrt gefahren ist … Ich weiß nicht, so um sieben oder halb acht? Später hab ich gehört, wie er zurückgekommen ist, vielleicht zwei Stunden später. Genau genommen hab ich gehört, wie sein Garagentor aufging. Er hat so eine Fernbedienung, und das Tor ist verdammt laut.«
»Aha.«
»Ich weiß nicht, wann er es zum letzten Mal benutzt hatte, denn normalerweise parken er und Andrea auf der Einfahrt. Aber als ich gestern den Lärm gehört und rausgeschaut habe, fuhr er gerade in die Garage. Vielleicht wollte er an dem Auto arbeiten oder so etwas.«
Thorne hatte schon eine einigermaßen klare Vorstellung, warum Richard Sumner den Wagen abgestellt hatte, wo niemand ihn sah. Aber er sagte: »Ja, vielleicht.« Natürlich stand das Auto noch in der Garage. Thorne hatte schon gesehen, dass es an der Rückseite eine Tür gab, die direkt in den Garten der Sumners führte. Er bedankte sich bei der Frau für ihre Hilfe, kehrte zu Tanner zurück und berichtete ihr von den Beobachtungen der Nachbarin. Und den Schlüssen, die daraus möglicherweise zu ziehen waren.
»Wo wären wir bloß ohne neugierige Nachbarn?«, sagte Tanner.
»Genau.« Sie würden so schnell wie möglich mit einer Haustürbefragung beginnen, aber es war hilfreich, Informationen wie diese schon ganz am Anfang zu haben.
Eine Weile standen sie schweigend da und tranken Kaffee.
»Dann tippst du also auf eine Frau?«, fragte sie schließlich.
Thorne sah sie an. Vielleicht hatte es eine Zeit gegeben, in der ein durchschnittlicher Ermittler – obwohl er theoretisch wusste, dass Frauen nicht weniger mörderisch sein konnten als Männer – angesichts des Ausmaßes an Gewalt, mit dem sie es hier zu tun hatten … zumindest gezögert hätte. Thorne erinnerte sich an die letzte Mordserie, an der sie zusammengearbeitet hatten. Und an die Frau, die im Zentrum gestanden hatte.
»Es sieht danach aus«, sagte er.
»Natürlich muss es nicht unbedingt eine Frau gewesen sein«, wandte Tanner ein. »Vielleicht hat Mr Sumner eine andere Art von Doppelleben geführt.«
»Vielleicht.«
»Wir finden es heraus, wenn wir das nächste Mal mit der Ehefrau sprechen.«
Thorne kippte den Rest seines Kaffees in den Rinnstein und malte sich das extrem unangenehme Gespräch aus, das ihnen bevorstand. »Das wird ein Riesenspaß.«
»Für sie wahrscheinlich auch«, bemerkte Tanner.
Thorne wandte sich um, als ein Kollege vor der Haustür der Sumners winkte, um zu signalisieren, dass sie bereit waren, die Leiche hinauszutragen.
»Wo du recht hast …«, sagte er.
2
Auf dem Heimweg nach Kentish Town rief er Melita an.
»Ich fahre zur Wohnung zurück.«
»Wirklich? Okay …« Am Morgen hatten sie vereinbart, dass er die Nacht bei ihr in Crouch End verbringen würde. Sie klang enttäuscht.
»Wir haben einen üblen Fall erwischt, in den nächsten Tagen wird die Hölle los sein«, sagte Thorne. »Überstunden, die nicht beantragt werden müssen, das volle Programm. Morgen geht es früh los, also ist es besser …«
»Kein Problem, Tom.«
»Ich denke, ich sollte versuchen, früh ins Bett zu kommen.« Zumindest hatte er das vor. Allerdings hatte er bereits Zweifel, dass er bei allem, was ihm durch den Kopf ging und dort für ein beständiges Rauschen sorgte, tatsächlich den nötigen Schlaf finden würde.
»Willst du darüber sprechen?«
»Kann ich dich anrufen, wenn ich nach Hause komme?«
»Klar.«
»Wahrscheinlich sollte ich dich sowieso auf dem Laufenden halten, denn es würde mich nicht wundern, wenn Russell dich hinzuzieht. Falls es nicht gut läuft.«
»Oh«, sagte Melita. »Einer von denen.«
Der Timer war so programmiert, dass die Heizung am frühen Abend für einige Stunden lief. Aber als Thorne nach Hause kam, war es in der Wohnung schon wieder kühl, sodass er die Heizung noch einmal hochdrehte. Er stellte ein Fertiggericht in die Mikrowelle, öffnete die Post vom Vormittag und warf sie ins Altpapier. Dann nahm er eine Dose Lager aus dem Kühlschrank, brachte sein »Chinesisches Luxus-Chow-mein mit Hühnchen« ins Wohnzimmer und zappte beim Essen durch die Sportsender. Er entschied sich gegen Golf und Tennis, ignorierte die Formel 1 – auch wenn sie ihm vielleicht beim Einschlafen geholfen hätte – und blieb bei einer Sportart aus den USA hängen, bei der bärtige Männer mit Äxten auf hölzerne Ziele warfen.
»Mein Gott«, sagte er, schaute aber weiter zu.
»Hast du was gegessen?«, fragte Melita, als er sie anrief.
Thorne bejahte. Dann lehnte er sich mit seinem Lager zurück und erklärte, er sei dankbar, dass der Supermarkt extra »chinesisch« auf die Verpackung seines Hühnchen-Chow-mein gedruckt hatte. Ahnungslos, wie er sei, habe es für ein für ein typisch französisches Gericht gehalten.
Melita lachte. »Schade, dass du nicht vorbeikommen konntest«, sagte sie. »Ich hab ein Curry gemacht.«
»Hält es sich? Ich meine, jetzt wo ich es sage, wird mir klar, dass es vielleicht ein paar Tage dauern kann.«
»Keine Sorge. Ich bin schon in der Lage, das ganze Ding selbst aufzuessen.«
Thorne wusste sehr gut, dass seine Freundin das Essen liebte und wie viel sie verdrücken konnte. Nicht dass man es ihr angesehen hätte, was ihm natürlich besonders gut gefiel.
»Sie spielt in einer dermaßen anderen Liga, dass es schon lächerlich ist«, hatte Phil Hendricks ihm immer wieder gesagt. »Wenn wir in der ersten Runde des FA Cups wären, würde ich sagen, sie ist Arsenal, und du …«
»Ja, ich weiß schon, Wigan Athletic oder so. Echt witzig.«
»Ich dachte eher an ein Team aus dem Mittelfeld der achten Liga, Kumpel. Grantham Town vielleicht, oder Witton Albion.«
Die Erinnerung entlockte Thorne zum ersten Mal seit Stunden so etwas wie ein Lächeln. Die Amateure von Witton Albion behaupteten sich jetzt schon ein gutes Jahr lang gegenüber dem jüngeren, fitteren Arsenal, was nach Thornes Einschätzung nicht zuletzt daran lag, dass sie sich gegen das Zusammenziehen entschieden und ihre jeweiligen Wohnungen behalten hatten. Sodass sich Heim- und Auswärtsspiele abwechselten. Sie hatten sich gegenseitig ihre Hausschlüssel gegeben, aber bisher keinen Gebrauch davon gemacht.
Thornes »Heimatstadion« war die Erdgeschosswohnung, die er vor mehr als zwanzig Jahren gekauft hatte. Seitdem hatte er die meiste Zeit dort gewohnt, mit Ausnahme einer Phase, in der er längerfristig mit einer Kollegin namens Helen Weeks liiert gewesen war und seine Wohnung vermietet hatte. Als diese Beziehung dasselbe Schicksal erlitten hatte wie seine anderen längerfristigen Beziehungen und die vorangegangene Ehe, war Thorne nach Kentish Town zurückgekehrt, ehrlich erleichtert, dass er die Wohnung nicht verkauft hatte.
Er war glücklich darüber, wertvolle Zeit mit Dr Melita Perera verbringen zu können – ja, er sah sich tatsächlich als Glückspilz –, aber genauso glücklich darüber, einen Ort ganz für sich zu haben. Wo er sich so wohlfühlte, wie es eben ging, und wo er etwas Zeit ganz allein verbringen konnte.
Auch wenn er nicht immer die angenehmste Gesellschaft war.
Er erzählte Melita vom Tatort in Gospel Oak.
»Ich verstehe, was du meinst«, sagte sie. »Ihr schließt aus, dass er von einem Räuber misshandelt wurde?«
»Die Frau sagt, dass nichts fehlt.«
»Vielleicht ging es den Tätern nur um irgendwelche Informationen … finanzielle Details. Vielleicht ist das Konto des Paares leergeräumt worden.«
Thorne war nicht sicher, ob sich um diesen Punkt schon jemand gekümmert hatte. Jedenfalls würde er dafür sorgen, dass es geschah. Trotzdem bezweifelte er, dass Richard Sumner wegen seiner PIN abgeschlachtet worden war. Er erzählte Melita von dem Wein und den benutzten Gläsern. »Wer immer bei dem Opfer im Haus war, wurde eingeladen.«
»Oder zumindest willkommen geheißen.«
»Eine Frau, wie es aussieht.«
»Na ja, genau danach sieht es eigentlich nicht aus«, wandte Melita ein. »Ich sage natürlich nicht, dass du dich irrst, aber das Ausmaß an Gewalt, das du beschreibst, wäre für eine Täterin schon ziemlich ungewöhnlich.«
»Ja, aber du und ich wissen doch …«
»Ich sage ja nicht, dass du falschliegst, Tom. Es ist einfach … selten.«
Thorne warf einen Blick auf seinen stumm geschalteten Fernseher. In einer dramatischen Zuspitzung des Wettbewerbs waren die Ziele ein paar Meter weiter von den Axtwerfern weggerückt worden. Er fragte sich, ob es wohl eine Variante gab, bei der die Männer Augenbinden tragen oder – noch besser – sich gegenseitig mit den Äxten bewerfen mussten. »Was sagst du zu den Ohren?«
»Trophäen?«
»Ich hab befürchtet, dass du das sagst.«
»Komm schon, dass denkst du doch selbst.«
Das Rauschen in seinem Kopf wurde eine Spur lauter. Der von Melita geäußerte und ein Dutzend ähnlich unwillkommener Gedanken wagten sich aus der Deckung und spukten durch sein Hirn. Er trank die Dose leer und atmete tief durch. »Und wie war dein Tag?«
Sie lachte. »Ich will dir nicht die Laune verderben, aber er war herrlich. Nur Privatpatienten, ich musste nicht mal die Wohnung verlassen.«
»Glückspilz«, sagte Thorne.
Wenn sie nicht gerade als forensische Psychiaterin für verschiedene Polizeidienststellen arbeitete oder Gefängnisse und Hochsicherheitskliniken besuchte, behandelte Melita zu gleichen Teilen Privatpatienten und solche des Nationalen Gesundheitsdienstes. Die Tage, an denen sie zu Hause Patienten behandelte, finanzierten ihre sonstige Arbeit. Zwar sorgte sich Thorne, dass sie in ihrer Wohnung potenziell gefährliche Klienten empfing, aber er hatte gelernt, solche Gedanken für sich zu behalten. Als er das Thema vor einigen Monaten angesprochen hatte, war es nicht besonders gut gelaufen.
»Das ist mein Job«, hatte Melita gesagt, als spräche sie mit einem Sechsjährigen. »Klienten mit bestimmten … Neigungen oder einer gewalttätigen Vorgeschichte gehören nun mal dazu.«
»Das ist mir klar.« Thorne hatte auf der Stelle bereut, den Mund aufgemacht zu haben, schaffte es aber nicht, das Thema auf sich beruhen zu lassen. »In einem Krankenhaus mit Sicherheitspersonal ist das ja auch schön und gut, aber wenn die Typen dir einfach in die Wohnung latschen …«
»Du meinst, ich sollte ein bisschen wählerischer sein?«
»Ja, sie vielleicht vorher ein bisschen abchecken.«
»Ich checke sie ab, Tom, denn ich bin nicht blöd und muss natürlich genau wissen, mit wem ich arbeite. Wenn es sich dabei um jemanden handelt, den du als gefährlich einordnen würdest, lege ich diese Informationen dem Ausschuss vor. Wenn nötig, wird mein persönlicher und professioneller Umgang mit dem Klienten dann entsprechend angepasst. Okay?« Sie hatte ihn einige Sekunden angestarrt, um sicherzugehen, dass ihr Standpunkt angekommen war. Dann war ihr Blick eine Spur weicher geworden. »Abgesehen davon: Erzähl mir nicht, dass die gefährlichen Menschen, die du jagst, die richtig gefährlichen, nicht auch die interessantesten sind.«
Thorne hatte lieber den Mund gehalten.
Jetzt riss Melita ihn aus seinen Gedanken: »Ich glaube nicht, dass Glückspilz der richtige Begriff ist. Nicht nachdem ich eine Stunde lang einem klinisch depressiven Klismaphilen zuhören musste.«
»Einem was?«
»Jemandem, den es sexuell erregt, einen Einlauf zu bekommen oder bei anderen durchzuführen. Dieser spezielle Gentleman bevorzugt die aktive Seite.«
»Oh, da hat er sich offensichtlich für die bessere Alternative entschieden«, sagte Thorne.
Melita lachte, aber Thorne wusste, dass sie viele Klienten behandelt hatte, deren Vorlieben alles andere als witzig waren. Zwar konnte sie mit Thornes Musikgeschmack nichts anfangen – einer der Gründe, warum Phil Hendricks so begeistert von ihr war – und war viel ordentlicher als er, aber sie hatten weit Wichtigeres gemeinsam. Beide hatten oft genug gesehen und gehört, was Menschen einander Schreckliches antun konnten. Wenn sie nicht gerade zusammen an einem solchen Fall arbeiteten, sprachen sie selten darüber – über die Bilder in ihren Köpfen, über die Stimmen derjenigen, die für diese Bilder verantwortlich waren.
Auch das war eine vernünftige Entscheidung.
Wenn er an die letzten Monate dachte, konnte er die Anlässe, bei denen Melita ohne erkennbaren Grund die Beherrschung verloren oder auch nur in mieser Stimmung gewesen war, ohne dass er ihr einen Grund dafür gegeben hätte, an den Fingern einer Hand abzählen. Daher fragte er sich manchmal, wie viel sie innerlich unterdrückte.
Wie laut ihr Rauschen sein mochte.
»Ich lasse dich jetzt besser in Ruhe«, sagte sie. »Damit du ins Bett gehen kannst.«
»Also gut, aber du weißt, dass ich an dich denke.« Thorne senkte die Stimme. »Ich meine, an das, was ich tun werde, wenn ich das nächste Mal zu dir komme.«
»Gleichfalls«, sagte sie.
Er wartete ein paar Sekunden. »Dir ist klar, dass ich von dem Curry in deinem Kühlschrank spreche, oder?«
3
Wenig überraschend wirkte Andrea Sumner nicht so, als hätte sie eine auch nur annähernd erholsame Nacht hinter sich. Ihr Gesicht war blass und knittrig wie altes Papier, die Ringe unter ihren Augen sahen aus wie Blutergüsse.
»Haben Sie überhaupt ein bisschen schlafen können?«, fragte Tanner.
Andrea Sumner brauchte ein oder zwei Sekunden, bevor sie antwortete, als wäre sie per Video-Link aus einem entlegenen Winkel der Erde zugeschaltet. »Meine Schwester hat mir ein paar pflanzliche Schlaftabletten gegeben.«
»Das ist gut.«
Die Frau setzte sich ein Stück gerader auf und versuchte sich an einem Lächeln, aber es sah fast aus, als hätte sie diesen Gesichtsausdruck nicht im Repertoire. Sie gab den Versuch schnell auf. »Es hat kein bisschen geholfen.«
»Das tut mir leid«, sagte Thorne, auch wenn er nicht überrascht war. Vor seinem inneren Auge tauchte eine ungebetene und – typisch für solche Situationen – völlig unangemessene Erinnerung auf. Vor einigen Jahren hatte er selbst Schlafprobleme gehabt. Phil Hendricks, dem Insomnie nicht fremd war, hatte ihm empfohlen, zum besseren Einschlafen die Menschen aufzuzählen, mit denen er geschlafen hatte, am besten in chronologischer Reihenfolge. Hendricks hatte erklärt, das mache viel mehr Spaß als das Zählen von Schafen und habe ihm selbst immer geholfen. Thorne hatte es versucht, aber als er nach dreißig Sekunden das Ende der Liste erreicht hatte, war er immer noch hellwach – und leicht deprimiert.
Tanner beugte sich vor, um Wasser in die Gläser zu schenken. »Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie hergekommen sind, vor allen Dingen so schnell. Ich weiß, dass Sie eine schreckliche Zeit durchmachen, aber es ist wichtig, dass wir so viele Informationen wie möglich bekommen. Und so schnell wie möglich.«
Andrea nickte. »Okay.«
Es war kurz nach neun am Montagmorgen. Sie saßen in einem der informellen Befragungsräume auf dem Revier in Colindale. Ein dunkelbraunes Sofa und dazu passende Lehnstühle standen um einen niedrigen Tisch herum. Es gab einen Teller mit Keksen, einen Wasserkrug und drei Gläser. Eine Schachtel Papiertaschentücher stand in Reichweite. Im Unterschied zu den offiziellen Vernehmungsräumen lagen auf den Stühlen Kissen, und der einzige unangenehme Geruch war der eines billigen Raumsprays. Es gab weder einen Panikstreifen, noch war das Mobiliar im Fußboden verankert. Zwar wurde die Befragung für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendetwas für eine spätere Gerichtsverhandlung Relevantes gesagt wurde, auf Video aufgenommen. Als Thorne Andrea allerdings darauf aufmerksam machte, starrte sie nur für einige Sekunden zur Kamera hoch, bevor sie nickte und sich ihm wieder zuwandte.
»Wissen Sie, was passiert ist?«, fragte sie in sachlichem Ton, als säßen sie wegen eines tragischen Unglücksfalls beisammen, zu dem er ihr etwas Beruhigendes mitteilen konnte: Ich fürchte, Ihr Mann hat am Steuer einen Herzinfarkt erlitten oder Anscheinend haben die Bremsen versagt. Was Richard Sumner zugestoßen war, war auf schreckliche Weise offensichtlich, aber darum ging es bei ihrer Frage auch nicht. »Wir stehen leider noch ganz am Anfang.«
»Mit Richard, meine ich … Was ist mit Richard passiert?«
»Ich verspreche Ihnen, dass wir Sie über alle neuen Erkenntnisse auf dem Laufenden halten«, sagte Tanner.
Andrea brummte und sah sich blinzelnd im Raum um. Sekundenlang starrte sie erst die eine, dann die andere Wand an. Die Stühle, den Tisch, als würde sie etwas suchen, irgendetwas, das ihr Antworten auf die Fragen liefern konnte, zu denen diese beiden Detectives ihr nichts sagen konnten oder wollten.
»Andrea? Mrs Sumner …?«
Seufzend und schicksalsergeben wandte sich die Frau Tanner zu.
»Wir haben uns gefragt, ob Sie uns vielleicht sagen können, ob Richard davon gesprochen hat, dass er am Wochenende Besuch bekommen würde.« Tanner ließ es nett und beiläufig klingen. »Vor allem am Samstagabend.«
Sie schüttelte den Kopf. Mit dieser Antwort hatten Thorne und Tanner gerechnet, aber natürlich wurden die Fragen, die sie ihr stellen mussten, dadurch nicht leichter.
»Wie gesagt, ich habe am Samstag mit ihm gesprochen. Er wollte früh ins Bett gehen.«
»Natürlich«, sagte Thorne.
»Das hat er mir gesagt.«
»Ja, und das könnte er auch vorgehabt haben.« Ein bisschen Honig, um die Medizin nicht so bitter schmecken zu lassen. »Aber ich muss leider sagen, dass es so aussieht, als sei es anders gekommen.«
Andrea Sumner schniefte und griff nach einem Papiertaschentuch, das sie sicher bald brauchen würde.
»Es gibt Hinweise darauf, dass Richard am Samstagabend Besuch hatte.« Kaum hatte Thorne den Satz ausgesprochen, wurde ihm klar, wie dämlich er klang. Natürlich hatte der Mann Besuch bekommen, sonst wäre er nicht tot. Aber das hatte er nicht gemeint, was Andrea offensichtlich bewusst war.
»Was für Hinweise?«
»Eine halb leere Flasche Wein und zwei benutzte Gläser«, sagte Tanner.
»Sie standen in Ihrem Wohnzimmer«, fügte Thorne hinzu.
»Das habe ich nicht gesehen.«
Thorne nickte und lehnte sich zurück. Dass sie eine Frage beantwortete, die weder Tanner noch er gestellt hatten, reichte aus, um seinen Verdacht zu bestätigen. Andrea Sumner log sie eindeutig an. Aber für ihre Ermittlungen spielte das keine große Rolle, und ihr war es offenbar wichtig. Sie hatte sowieso schon jede Menge zu verarbeiten. Solange der Schmerz noch viel zu frisch war, als dass sie die Trauer auch nur an sich heranzulassen vermochte, konnte sie nicht darüber nachdenken, dass der Mann, um den sie irgendwann trauern würde, nicht ganz der Mann war, für den sie ihn gehalten hatte.
Natürlich würde sie sich der schwer erträglichen Wahrheit irgendwann stellen müssen. Thorne hatte schon früher erlebt, wie sich die nächsten Angehörigen eines Mordopfers mit Händen und Füßen wehrten, wenn die dunkleren Geheimnisse eines geliebten Menschen ans Licht kamen. Andrea Sumners Zweifel an der Treue ihres verstorbenen Mannes waren für sie sicher ein Schock, aber Thorne hatte Schlimmeres erlebt. Er dachte an den unvergesslichen Fall, bei dem sich herausgestellt hatte, dass das unschuldige Opfer einer Kneipenschlägerei – ein sanftmütiger und glücklich verheirateter Vater zweier Kinder – nicht nur eine oder zwei, sondern drei weitere, übers ganze Land verteilte Familien hatte, die nichts voneinander wussten. Ein Trio anderer Ehefrauen, ein knappes Dutzend anderer Kinder, von denen seine Witwe nichts ahnte.
Seine Witwen.
»Wissen Sie, ich bin gleich nach oben gegangen.« Andrea beugte sich vor und griff nach einem zweiten Taschentuch.
»Okay«, sagte Thorne.
»Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendetwas nicht stimmte. Das Haus wirkte wie immer.«
»Traurigerweise wissen wir, dass es nicht so war. Deshalb müssen wir jetzt diese Fragen stellen.« Tanner beugte sich vor und wartete so lange, bis Andrea sie ansah. »Haben Sie irgendeine Idee, wer Richard besucht haben könnte? Vielleicht hat er jemanden erwähnt, bevor Sie nach Liverpool aufgebrochen sind.«
»Tut mir leid«, sagte Andrea. »Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, natürlich könnte einer seiner Kumpels vorbeigekommen sein, um sich zusammen Fußball oder Rugby anzuschauen. Jemand von der Arbeit oder so. Aber das erklärt nicht, was passiert ist, stimmt’s?«
»Nein«, sagte Tanner. »Das tut es nicht.«
Natürlich war es nur ein Schuss ins Blaue gewesen. Die Art von »Besuch«, die Richard Sumner erwartet hatte, hätte er seiner Frau gegenüber wohl kaum erwähnt.
Viel Spaß in Liverpool, Schatz. Oh, übrigens, ich dachte, ich rufe an einem der Abende mal bei einer Escort-Agentur an. Ist das okay für dich?
Fünf Minuten im Haus hatten Thorne gereicht, um sicher zu sein, dass die beiden keine solche Ehe führten. Er war nicht mal sicher, ob es solche Ehen überhaupt gab, und wenn, dann hielten sie wahrscheinlich nicht lange.
Bis Sonntag dann … Viel Spaß. Mach dir um mich keine Sorgen, am Samstagabend leistet mir meine langjährige Freundin/mein langjähriger Freund/mein Sexsklave Gesellschaft. Das hab ich wohl noch nicht erwähnt …
»Wann kann ich wieder ins Haus?«, fragte Andrea.
»Das geht leider noch nicht«, antwortete Thorne.
»Aber wenn ich länger bei meiner Schwester bleibe, muss ich ein paar Sachen holen.«
»Wenn Sie jemandem von der Angehörigenbetreuung eine Liste geben, holt man Ihnen alles aus dem Haus.«
Andrea nickte resigniert und sagte »Gut«, auch wenn es das offensichtlich nicht war.
»Wo wir gerade davon sprechen: Es gibt ein oder zwei Dinge, die wir aus dem Haus brauchen. Vielleicht können Sie uns dabei helfen.« Thorne lächelte, als wäre es keine große Sache. »Richards Handy und Computer. Ich meine, wir gehen davon aus, dass er Handy und Computer hatte, weil, na ja … Heute hat jeder so etwas, aber wir konnten nichts finden.«
»Die Sachen habe ich.« Sie spielte mit dem feuchten, zum Klumpen geknüllten Papiertaschentuch in ihrer Hand, zupfte kleine Fetzen heraus und ließ sie zu Boden fallen. »Sie lagen auf dem Küchentisch, also habe ich sie in meine Tasche gesteckt, während ich auf die Polizei gewartet habe. Es war ein Reflex. Ich wollte darauf achtgeben, für ihn.«
»Okay.« Thorne sah Andrea Sumner an, dass sie, als sie am gestrigen Morgen zurück ins Haus gekommen war, sofort Bescheid gewusst hatte. Nicht über das, was sie oben erwartete, aber über das Vorspiel. Sie hatte Bescheid gewusst, sobald sie die Weinflasche und die Gläser gesehen hatte. Ihr Verhalten danach hatte der Ermittlung nicht unbedingt geholfen, sie aber auch höchstens um einige Stunden verzögert. Und sie hatte nichts Illegales getan. Das Handy und den Computer an sich zu nehmen, war ein Versuch gewesen, ein bisschen Würde zu bewahren, mehr nicht. Sie hatte genau gewusst, was sich auf ihnen befinden konnte: die Art Informationen, auf die es auch Thorne und Tanner abgesehen hatten.
»Wir müssen Sie bitten, sie uns zu übergeben«, sagte Tanner.
»Aber warum?« Eine genuschelte Bitte, aber trotzdem eine Bitte. »Ich meine, mir ist klar, dass Sie so etwas tun. Ich habe es in den Nachrichten und in Krimis gesehen, aber normalerweise durchsucht man die Computer von Verdächtigen, oder?«
»Normalerweise«, bestätigte Thorne.
»Richard war ein Opfer.«
»Es ist verrückt, oder? Ich meine, heutzutage speichern die Menschen ihr ganzes Leben auf dem Handy, stimmt’s?« Thorne warf Tanner einen Blick zu, sie brummte zustimmend. »Auf dem Laptop oder wo auch immer. Ich weiß, dass ich es selbst so mache, und ich bin sicher, dass Sie es auch tun.« Andrea schüttelte den Kopf, aber Thorne ließ nicht locker. »Wenn wir Zugriff auf diese Informationen haben, erfahren wir eine Menge mehr über Richard und sehen hoffentlich ein wenig klarer, warum ihm so etwas Schreckliches angetan wurde.«
»Wenn Sie etwas über Richard erfahren wollen, können Sie mich einfach fragen.«
»Dafür sind wir Ihnen dankbar«, sagte Tanner. »Und das werden wir auch tun, aber …«
»Ich kannte ihn am besten von allen. Ich wusste alles über ihn.«
»Natürlich«, sagte Thorne.
Tanner beugte sich vor und sprach ganz langsam. »Wir brauchen auch eine DNA-Probe von Ihnen, falls das in Ordnung ist.« Sie würden sich auch problemlos eine Haarbürste oder etwas anderes besorgen können – in den Beweismittelbeuteln würde sich schon etwas Brauchbares finden –, aber ein schneller Abstrich, wo die Frau sowieso schon im Haus war, wäre der direktere Weg. Von der DNA ihres Mannes brauchten sie ganz sicher keine weitere Probe. »Natürlich nur zum Ausschluss.« Tanner wartete. »Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Es würde uns wirklich sehr helfen.«
Es war schwer zu sagen, ob Andrea irgendetwas von ihren Worten aufgenommen hatte. Noch immer sah sie Thorne mit weit aufgerissenen Augen an. Auf ihrem Schoß und zu ihren Füßen lagen die feuchten Papierfetzen.
»Ich kannte ihn.«
Zwanzig Minuten später standen Thorne und Tanner vor dem Eingang zum Revier und sahen zu, wie eine Kollegin von der Angehörigenbetreuung Andrea Sumner zu dem Auto brachte, mit dem sie abgeholt worden war. Der starke Frost, der über Nacht gekommen war, schien sich auf einen längeren Besuch eingestellt zu haben. Anderthalb Stunden zuvor hatte Thorne gebückt und fluchend draußen vor seiner Wohnung gestanden und die Wagenscheiben mit Frostschutzmittel eingesprüht. Inzwischen sah es so aus, als wäre das die angenehmste Aufgabe des ganzen Tages gewesen.
Als ihr die Wagentür aufgehalten wurde, warf Andrea Sumner ihnen noch einen Blick zu, dann stieg sie ein. Tanner hob eine Hand, winkte und sah Thorne an. »Nach dem Mord an Susan hatte ich das Gefühl, ich wäre tot«, sagte sie. »Jedenfalls tot in jeder Hinsicht, die zählt. Ich bin wie ein Zombie herumgelaufen und wusste morgens beim Aufwachen nicht, wozu ich da war. Damals habe ich geglaubt, dass man sich wahrscheinlich nicht schlimmer fühlen kann.« Sie deutete mit dem Kinn auf den Wagen, der gerade auf die Hauptstraße bog. »Aber wie kommt man darüber hinweg?«
Thorne war sich nicht sicher, ob das überhaupt möglich war. Aber er glaubte, dass es zumindest ein Anfang sein könnte, Richard Sumners Mörder oder Mörderin zu schnappen.
Aber natürlich war auch das nur eine Vermutung.
»Keine Ahnung«, sagte er.
Sie drehten sich um, zitternd und dankbar, wieder zurück ins Warme zu dürfen. Tanner schaute auf ihr Handy. »Du legst besser einen Zahn zu.«
Thorne sah auf die Uhr, sein Atem bildete Wölkchen. Fluchend ging er zur Toilette, holte dann Mantel und Tasche aus dem Büro und machte sich eilig auf den Weg zur Obduktion.
Er konnte ein bisschen Aufheiterung gebrauchen.
4
Eine einzige Obduktion war für die meisten Menschen mehr als genug, und Thorne war bei einer ganzen Menge dabei gewesen. Bei Hunderten wahrscheinlich. Auch wenn er sich an die einzigartigen Anblicke und Gerüche und das grässliche Kreischen der Knochensäge … gewöhnt hatte, benutzte er immer noch jedes einzelne Mal Vick und Ohrstöpsel. Im Gegensatz zu dem über und über tätowierten Mann, der ihm gegenübersaß, war er auch definitiv nicht in der Lage, gleich im Anschluss ein Full English Breakfast herunterzubringen.
Full English Breakfast Nummer drei, genauer gesagt: mit zwei Eiern, doppelt Würstchen und einer Extraportion Kartoffelbrei mit Rosenkohl.
Der Mann war ein Tier.
Mit Messer und Gabel war Phil Hendricks nicht ganz so feinfühlig wie mit dem Sezierbesteck und der Rippenschere. Beim Anblick seines Freundes, der das Essen in sich hineinschaufelte, fühlte Thorne sich flauer im Magen als zwanzig Minuten zuvor, als er ihm bei der Arbeit an Richard Sumners Leiche zugesehen hatte. Mit lautem Stöhnen machte er seinen Gefühlen Luft.
Der Rechtsmediziner hob eine Gabel mit Baked Beans hoch und stieß sie in Richtung der einsamen Toastscheibe auf Thornes Teller.
»Schlappschwanz«, sagte er.
»Schwein«, erwiderte Thorne.
Angewidert schüttelte Hendricks den Kopf, wobei die an seinen Ohren baumelnden Ringe, Kreuze und Totenköpfe klimperten. »Ich schätze, es hätte schlimmer kommen können. Wenn ich Müsli bestellt hätte, könnte ich für nichts mehr garantieren.« Er drehte sich zu dem langsam kahl werdenden Koloss hinter dem Tresen um und reckte einen Daumen hoch. Grinsend erwiderte der Mann die Geste. Das Café lag fünf Minuten zu Fuß vom Leichenschauhaus in Hornsey entfernt, Hendricks war Stammkunde. Er hob die Stimme, sodass der Besitzer ihn hören konnte. »Aber wenn sie hier verdammtes Scheißmüsli anbieten würden, würde ich sowieso nicht mehr kommen.«
Die Obduktion selbst war relativ unkompliziert verlaufen. »Keine riesigen Falter, die man dem Opfer in den Rachen gestopft hätte«, hatte Hendricks nach kurzer Zeit gesagt. »Das ist schon mal ein Pluspunkt, stimmt’s?« Wie immer lieferte der trockene, für seine Heimatstadt Manchester typische Humor ein Gegengewicht zu dem Grauen. Wobei er natürlich nicht in der Lage gewesen war, sich beim Anblick der Leiche den einen oder anderen Gag zu verkneifen. »Verdammte Scheiße. Lieber ohrlos als humorlos.« Als er Thornes Miene bemerkte, hatte er hinzugefügt: »Reg dich ab, Kumpel, es ist ja nicht so, dass er uns hören könnte, oder?«
»Schlechtes Argument«, hatte Thorne gesagt. »Er ist tot, da hätte er uns sowieso nicht gehört.«
»Verdammt, du hättest Lehrer werden sollen.«
Richard Sumner war am Samstagabend irgendwann zwischen neun und Mitternacht gestorben, hatte Hendricks erklärt. Todesursache war eine einzelne Schnittwunde am Hals gewesen. »Hat ihm die Kehle aufgeschlitzt, mit einer sehr dünnen Klinge … einem Skalpell, Teppichmesser oder etwas in der Art. Er muss ziemlich schnell verblutet sein. Mit derselben Waffe wurden auch die Ohren entfernt. Glaub mir, ich würde gern sagen, dass sie post mortem abgeschnitten wurden, aber die Menge Blut auf dem Kissen lässt auf etwas anderes schließen.«
»Mein Gott.«
»Wahrscheinlich hat er sich wegen des Rotweins, der ihm aus dem Hals gesprudelt ist, genug Gedanken gemacht und sich nicht weiter daran gestört.«
Thorne kam der Gedanke, dass Richard Sumner am Ende seine eigenen Schreie nicht hatte hören können. Ob das ein Segen war oder nicht, wagte er nicht zu beurteilen. »Wie sieht es mit Drogen aus?«
»Ja, wahrscheinlich. Rohypnol, Ketamin … irgendwelche Benzos. Genau weiß ich es erst, wenn ich den toxikologischen Befund bekomme, aber ich würde darauf wetten. Vor allem, wenn du davon ausgehst, dass der Mörder eine Frau war.« Er hatte die Leiche auf dem Obduktionstisch betrachtet. »Er war ziemlich groß.«
Etwas im Wein, vermutete Thorne und hoffte, sie würden die Resultate bald bekommen.
»Oh, und dann hab ich eine ordentliche Menge halb verdaute Spaghetti im Magen gefunden«, hatte Hendricks gesagt. »Es sei denn, er hätte besonders eklige Würmer gehabt. Wie es aussieht, waren er und der Mörder beim Italiener. Wo wir gerade davon reden, hast du Lust auf ein spätes Frühstück …?«
Gerade machte sich der Cafébesitzer mit den benutzten Tellern und Bestecken davon. Kurz darauf kam er mit frischen Bechern Tee zurück.
»Und, wie geht es Melita?«
»Gut.« Thorne nickte lächelnd. Er hoffte, sie später noch sehen zu können.
»Anscheinend so gut, wie es jemandem mit niedrigen Ansprüchen und ernsthaften Sehstörungen gehen kann. Ich wundere mich immer wieder, dass die Gläser ihrer Brille nicht ein ganzes Stück dicker sind.«
Thorne spielte den Entrüsteten.
»Aber immerhin kann sie eine Brille tragen.« Hendricks wandte den Kopf Richtung Leichenhalle. »Im Gegensatz zu dem armen Kerl da drüben.«
»Das ergibt schon wieder keinen Sinn«, sagte Thorne. »Er ist tot, was sollte er mit einer Brille?«
»Du hast keinen Sinn für Humor, stimmt’s? Ich meine, Engländer, Iren und Schotten gehen selten zusammen in Bars.«
Nachdem Thornes Liebesleben abgehakt war, sprach Hendricks eine Weile über seinen eigenen Partner, Liam. »Mein Ire.« Er wirkte in dieser Hinsicht so beständig wie schon lange nicht mehr. Thorne vermutete, nur der unwahrscheinliche Fall, dass Arsenal in absehbarer Zeit irgendeinen Pokal gewinnen könnte, würde seinen Freund glücklicher machen. Hendricks’ Tätowierungen und Piercings waren zum großen Teil Kerben an seinem Bettpfosten, wie er es nannte. Inzwischen war es länger her, dass er ein Tätowierstudio von innen gesehen hatte. Thorne konnte nur hoffen, dass es so blieb. Allzu viele freie Körperstellen gab es sowieso nicht mehr.
Beim Gedanken daran, dass ein solches Hautstück seines Freundes vor Jahren gewaltsam entfernt, in einen Briefumschlag gesteckt und persönlich bei Thorne abgeliefert worden war, zuckte er zusammen.
Er versuchte möglichst selten an den Mann zu denken, der das getan hatte.
»Dann arbeitet Nicola also zusammen mit dir an dem Fall?«
Thorne musterte Hendricks, aber dessen Miene gab nichts preis.
An sich war die Frage unkompliziert, aber Thorne zögerte ein oder zwei Sekunden mit der Antwort. Ein oder zwei Sekunden, in denen ihre Blicke sich trafen und wortlos verständigten.
»Ja, klar.«
»Gut so«, sagte Hendricks, womit die vorübergehende Befangenheit sich legte.
Auch wenn Nicola Tanner, die gelegentlich zimperlich sein konnte, sich über den einen oder anderen … Exzess von Phil Hendricks mokieren konnte, hatten die drei sich immer nahegestanden. Jetzt waren sie unweigerlich durch etwas verbunden, das sie vor zwei Jahren getan hatten. Durch das, was mit einem Mann namens Graham French geschehen war, der zu Tode geprügelt worden war, nachdem er geschnappt und gefesselt worden war. Durch die Geschichte, die ein Mitglied des Trios ausgeheckt hatte, um das zweite zu schützen. Und durch die berufliche Mauschelei des dritten, die dafür sorgte, dass die beiden anderen ihre Jobs nicht verloren. Ihr gemeinsames Geheimnis wurde kaum je erwähnt oder auch nur angedeutet, stand aber immer im Raum, vor allem, wenn sie zu dritt zusammen waren. In solchen Momenten glaubten sie, Blut und feuchte Haare riechen zu können.
»Denn ich nehme an, du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst.« Hendricks schlürfte geräuschvoll an seinem Tee. »Jedenfalls wenn ich mir unseren hörgeschädigten Freund in der Leichenhalle anschaue. Sie …«
Thornes Handys summte auf dem Tisch. Er warf einen Blick aufs Display. »Wenn man vom Teufel spricht …« Dann las er die Textnachricht.
DNA-Ergebnisse aus dem Sumner-Haus sind da. XX
»Eine Sekunde.« Thorne wählte Tanners Nummer. »So zärtlich bist du sonst nicht«, sagte er, als sie sich meldete. »Gleich zwei Küsse?«
»Das sind keine Küsse, du Arsch. Sondern Chromosomen.«
»Ich verstehe nicht …«
»Zwei X-Chromosomen, was bedeutet, dass unser Täter definitiv eine Frau ist.«
Thorne sah, dass Hendricks, der eindeutig mitgehört hatte, kicherte. Dann schob er seine Zunge unter die Oberlippe und verdrehte die Augen.
»Ja, offensichtlich.« Thorne presste sich das Gerät dicht ans Ohr und wandte sich ab. »Mir war schon klar, was du gemeint hast.«
5
Als sie zurück im Becke House waren und Thorne ihr von der Obduktion berichtet hatte, leitete Tanner die erste Teamsitzung. Während sie, an einen Schreibtisch gelehnt, den bisherigen Stand zusammenfasste und an einigen Stellen auf das Whiteboard deutete, gingen die rund zwanzig im Einsatzraum versammelten Männer und Frauen die jeweils relevanten Unterlagen in den Fallakten durch, die Detective Sergeant Samir Karim vorab verteilt hatte. Einige schüttelten beim Anblick der Tatortfotos den Kopf oder holten tief Luft. Karim würde im Team auch für die Beweismittel zuständig sein, während andere sich um externe Ermittlungen, um die Koordination von Befragungen und die Analyse von Informationen kümmerten. Tanner persönlich hatte zwei zivile Mitarbeiter ausgewählt – beide fast so analfixiert wie sie – und damit beauftragt, jede Aussage, jede eingegangene Nachricht und jedes mithilfe des HOLMES-Computersystems erstellte Täterprofil zu katalogisieren.
Es gab eine Menge zu tun.
Tanner und mehrere andere hatten den Vormittag damit zugebracht, Material aus Überwachungskameras und der automatischen Nummernschilderkennung durchzugehen. Es war ein mühseliger Prozess, dessen Hauptteil sie noch vor sich hatten. In der Straße, in der die Sumners wohnten, waren die Haustürbefragungen inzwischen abgeschlossen, aber sie hatten schon entschieden, auch die benachbarten Straßen abzuklappern. Routinemäßig war in den nationalen Polizeidatenbanken eine Suche nach Einträgen über einen Richard Anthony Sumner angestoßen worden. Außerdem warfen sie einen gründlichen Blick auf die Finanzunterlagen des Paares, nahmen sich Clubs und Vereine vor, denen sie angehörten, und hatten angefangen, möglichst viele Freunde und Arbeitskollegen des Opfers aufzuspüren und zu befragen.
In diesem Stadium wurde das Netz weit ausgeworfen, aber nicht übermäßig tief.
»Wir stehen ganz am Anfang«, sagte Tanner. »Sobald die kompletten forensischen Ergebnisse vorliegen, müssen wir uns tiefer in einige Punkte einwühlen, und wenn die Techniker erst mit dem Handy und dem Computer des Opfers fertig sind, stecken wir bis über beide Ohren in Arbeit. Hoffentlich. Also werden sich alle den Arsch aufreißen, und jeder, der dazu keine Lust hat, sollte sich einen Moment fragen, ob es sich lohnt, mich richtig sauer zu machen. Keine dummen Fehler, nichts Halbgares und keine Abkürzungen, klar? Jetzt muss ich nur noch hinzufügen, dass wir uns richtig beeilen müssen …«
Sie ließ ihre Worte einen Moment wirken.
Dann nahm sie mit mehreren Kollegen Augenkontakt auf, um sicherzugehen, dass sie gewirkt hatten.
Natürlich, fuhr Tanner fort, bestand ihr Job wie der jeder Mordkommission darin, den Täter so schnell wie möglich zu schnappen. Und meistens war Tempo die entscheidende Waffe. Die ersten vierundzwanzig Stunden, heiße Eisen und so weiter … Immerhin gab es Neulinge im Team, und auch wenn Tanner deutlich weniger dramatisch – jedenfalls weniger aggressiv – sprach, als Tom Thorne es getan hätte, machte sie Druck, indem sie ihnen ganz genau erklärte, warum die Zeit in einem Fall wie diesem gegen sie arbeitete.
Zehn Minuten später schlossen Thorne und Tanner die Tür zum Büro des Detective Chief Inspector hinter sich. Russell Brigstocke, der offizielle Ermittlungsleiter in ihrem Fall, hatte das Briefing vom hinteren Teil des Raums aus verfolgt. Als sie und Thorne sich setzten, nickte er Tanner anerkennend zu.
»Sir.« Tanner wusste selbst, dass sie gut gewesen war.
»Also, wo stehen wir?« Am Schreibtisch sitzend blätterte Brigstocke die Unterlagen durch. Eine Mordakte, die bis jetzt noch ziemlich dünn war, aber, wie sie alle wussten, schnell anwachsen würde. Die einst üppige Haartolle des DCI