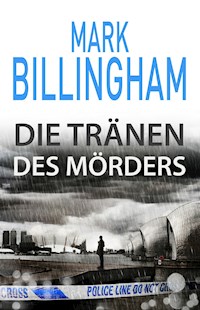5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Wahrheit schneidet tief
In einem einsamen Landstrich Englands werden zwei Schülerinnen als vermisst gemeldet – die Bewohner von Warwickshire sind erschüttert. Als der Familienvater Stephen Bates verdächtigt wird, beginnt die Presse eine gnadenlose Hetzkampagne. Dann wird im Wald eine verweste Leiche gefunden. Doch wo ist das andere Mädchen? Der legendäre Ermittler Tom Thorne und seine Partnerin Helen wollen die Wahrheit – wie schrecklich sie auch sein mag.
»Mark Billingham ist Weltklasse und sein Ermittler Tom Thorne ist eine wunderbare Figur! Holen Sie sich die Bücher, so schnell Sie können!« Karin Slaughter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
In einem einsamen Landstrich Englands werden zwei Schülerinnen als vermisst gemeldet – die Bewohner von Warwickshire sind erschüttert.
Als der Familienvater Stephen Bates verdächtigt wird, beginnt die Pressen eine gnadenlose Hetzkampagne. Dann wird im Wald eine verweste Leiche gefunden. Doch wo ist das zweite Mädchen? Der eigenwillige Ermittler Tom Thorne und seine Partnerin Helen wollen die Wahrheit – wie schrecklich sie auch sein mag
Der Autor
Mark Billingham, geboren 1961 in Birmingham, ist einer der erfolgreichsten britischen Thrillerautoren. Berühmt wurde er mit seiner Serie um den eigenwilligen Ermittler Tom Thorne, für die er mit dem Sherlock Award ausgezeichnet wurde. Mark Billingham erhielt zahlreiche Krimipreise, unter anderem den BCA-Award sowie den Theakston’s Award. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in London und in Florida.
MARK BILLINGHAM
ZEIT ZUM STERBEN
THRILLER
Aus dem Englischen
von Irene Eisenhut
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe TIME OF DEATH erschien 2015 bei Little, Brown (London)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 07/2016
Copyright © 2015 by Mark Billingham
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Tamara Rapp
Umschlagillustration: Nele Schütz Design unter Verwendung von © shutterstock/Helen Hotson
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-18716-3V001
www.heyne.de
Für Caroline Braid. Sie weiß, warum.
PROLOG
ALLE UND JEDER
Er sitzt in dem einzigen einigermaßen annehmbaren Café, trinkt Tee und zupft an einem Muffin herum, als er das Auto auf der gegenüberliegenden Seite entdeckt. Es fährt langsamer und hält am Straßenrand. Das Beifahrerfenster gleitet herunter, und ein Mädchen, genau wie das, an das er gerade denkt, tritt lächelnd heran.
Natürlich lächelt sie. Warum auch nicht? Sie kennt den Fahrer.
Sie beugt sich vor zu dem geöffneten Fenster, wirft das Haar zurück und grinst über etwas, dass der Fahrer sagt. Strafft die Schultern, streckt die Brust heraus. Sie hört zu und nickt.
Er isst den Muffin auf, schließt kurz die Augen und genießt den Rausch, den der Zucker in seinem Körper auslöst. Noch ein Rausch, der dem soeben erlebten folgt. Als er die Augen wieder öffnet, steht die Bedienung vor ihm und fragt, ob sie seinen leeren Teller wegräumen kann und ob er noch Tee haben möchte.
Er lehnt dankend ab.
Natürlich kennen sie sich mit Namen. So ist das an einem Ort wie diesem. Sie beginnt eine Unterhaltung, spricht mit hoher Stimme. Erzählt irgendwas von dem Fluss, der ein paar Meilen weiter unten über die Ufer getreten ist. Wie schrecklich es doch sein muss für die armen Anwohner, das ganze Schmutzwasser in den Wohnzimmern. Der Gestank, die Scherereien mit der Versicherung, die Kosten für neue Teppiche.
Er nickt an den passenden Stellen, erwidert etwas, behält aber die ganze Zeit den Wagen und das Mädchen im Auge. Schließlich wendet er sich der Bedienung zu und starrt sie so lange an, bis sie versteht und mit dem leeren Teller davonzieht.
Das Mädchen richtet sich jetzt auf, tritt zurück auf den Bürgersteig und blickt nach rechts und links. Der Fahrer beugt sich vor zur Beifahrertür und öffnet sie. Auch wenn sie ihn kennt und ihm vertraut, weiß sie, dass sie eigentlich nicht in sein Auto steigen sollte. Sie macht sich keine Sorgen, dass etwas Schlimmes geschehen könnte. So was gibt es hier nicht. Sie will wahrscheinlich einfach nur nicht dabei gesehen werden, hat keine Lust auf die Standpauke, die ihre Eltern ihr wohl später halten werden, mehr nicht.
Er umfasst den Becher, rückt den Stuhl noch etwas näher ans Fenster und beobachtet gebannt die Szene. Er genießt die wenigen Sekunden ihres vorsichtigen Zögerns. Die Tatsache, dass es nicht mehr als ein paar Sekunden sind und dass es für ihre Vorsicht eigentlich keinen Grund gibt, lässt ihn daran denken, wie es ist, hier zu leben, und wie lange er schon aus der Stadt weggezogen ist.
Die Gründe, die ihn an diesen Ort haben kommen lassen.
Anfangs war es zweifellos ein Kulturschock für ihn. Er, der Städter schlechthin, wachte mit einem Mal zum Geruch von Kuhmist und dem Gezwitscher von Vögeln auf. Vögel, deren Namen er nicht kannte, und Glockengeläut, das von den Feldern herüberdrang. Es dauerte ein paar Wochen, bis er begriff, dass er gar kein Gehupe von genervten und wütenden Autofahrern mehr hörte, zu denen er früher selbst einmal gehört hatte.
Die Atmosphäre dieses Orts war ausschlaggebend gewesen. Der Gemeinschaftssinn – oder wie immer man es nennen wollte. Das, was, so glaubte er, gemeinhin als Verbundenheit bezeichnet wurde … na ja, auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was er bis dahin gewöhnt gewesen war. Auch wenn die Menschen nicht unbedingt aufeinanderhockten, waren sie sich des anderen zumindest bewusst. Die Größe des Orts hatte natürlich etwas damit zu tun. Mit dieser Nähe und dem Gefühl gegenseitiger Anteilnahme. Mit dem getuschelten Tratsch und der vermeintlichen Abwesenheit von Gefahr.
Aber auch hier gibt es gelegentlich Ärger. Auch hier laufen freitagabends Betrunkene auf der Straße herum. Auch hier mangelt es nicht an Idioten. Ihm ist klar, dass ein oder zwei von ihnen durchaus ein Messer in der Tasche haben könnten oder glauben, jemanden verprügeln zu müssen, weil ihnen seine Nase nicht gefällt. Doch er hat die Namen der meisten relativ schnell in Erfahrung gebracht und weiß, wer ihre Freunde oder Eltern sind.
Das Mädchen macht die Beifahrertür zu.
Sie wirft den Kopf zurück, und er kann sehen, dass sie über etwas lacht, während der Fahrer den Blinker setzt und in den Spiegel schaut. Sie greift nach dem Gurt, so wie es sich für ein braves Mädchen wie sie gehört. Ihre Freunde, ihre Lehrer an der St. Mary’s Schule am Ende der Straße, ihre Mum, ihr Dad und ihr Bruder kennen sie so. Als das brave Mädchen.
Sie kennt den Fahrer. Er kennt den Fahrer. Der Fahrer kennt die Bedienung, und die Bedienung kennt das Mädchen.
So ist das hier. Und genau deshalb mag er diesen Ort.
Er trinkt den Becher aus. An der Tür dreht er sich um und verabschiedet sich mit einem Winken von der Bedienung. Dann tritt er hinaus in die Kälte unter das Vordach, knöpft seine Jacke zu und beobachtet, wie das Auto um die Ecke verschwindet.
An einem Ort wie diesem weiß jeder von jedem, was er macht.
Nur nicht von ihm.
ERSTER TEIL
ALLES WUNDERBAR
1
»Also, ein schöner fetter Sonntagsbraten?«, hatte Thorne gefragt. »So was in der Art?«
»Und mit etwas Glück Tee und Scones am Samstagnachmittag.«
»Kein Herumstöbern in irgendwelchen Antiquitätenläden?«
»Kein Herumstöbern.«
Sie verstummten und hielten die Luft an, als sie Alfie nebenan husten hörten. Glücklicherweise schlief er weiter.
Thorne rückte sein Kissen zurecht. Schniefte. »Ein ordentlicher Pub mit einem knisternden Kaminfeuer.«
»Na, das hoffe ich doch schwer.«
»Wir gehen auch ganz bestimmt nicht wandern?«
»Nur bis zum Pub.«
Thorne hatte leicht geseufzt, Helen näher zu sich herangezogen und über den Vorschlag nachgedacht. »Und wir bleiben nur übers Wochenende … ja?«
Jetzt, einen Monat nach diesen vorsichtigen und heiklen Verhandlungen im Bett, schlenderten sie an ihrem ersten Urlaubsabend zurück zum Hotel. Sie hatten in einem mehr als ordentlichen Pub zu Abend gegessen, und Thorne kam zu dem Schluss, dass er ziemlich glimpflich davongekommen war. Es hatte sie beide einige Mühen gekostet, ihre Urlaubszeiten aufeinander abzustimmen. Ganz zu schweigen von den diversen Gefallen, die sie bei verständnisvollen Kollegen hatten einfordern müssen. Thorne wusste, dass Helen heimlich geplant hatte, mindestens eine Woche der Ferien in den Cotswolds zu verbringen.
»Das Essen war gut, nicht?«, fragte Helen.
»Ja, ganz in Ordnung.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du erbärmlicher, alter Penner!«
Thorne konnte zwar das verschmitzte Lächeln sehen, aber nicht ahnen, dass auch Helen Weeks fand, das Beste für sich herausgeschlagen zu haben. In Thorne steckte nicht unbedingt Abenteurerblut. Er fühlte sich immer noch unwohl bei dem Gedanken, Zeit irgendwo südlich der Themse zu verbringen. Helen wusste, dass er, wenn er denn die Wahl hätte, sich lieber selbst massakrieren würde, als kostbare Freizeit auf dem Land zu verbringen. Schon die Erkennungsmelodie von The Archers genügte – einem Hörspiel, das seit Jahrzehnten im Radio lief –, um ihm eine Gänsehaut über den Rücken zu jagen.
»Selbst gemachtes Chutney und dämliches Laientheater«, hatte er einmal gesagt. »Darauf kann ich echt verzichten.«
Alles in allem entsprach ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende über den Valentinstag, Helens Vorstellung einer angemessenen Gegenleistung für die Zeit, die sie hatte aufbringen müssen, um Thorne davon zu überzeugen, dass ihnen ein paar Tage auf dem Land guttun würden. Nur sie beide. Danach würden sie eine Woche irgendwohin fahren, wo es schön und heiß war. Eine nette Ferienanlage mit angeschlossenem Kinderklub, zum Entspannen und Nichtstun, bis die Arbeit sie wieder rief. Dafür hatte sie das »Wanderverbot« gern in Kauf genommen und auch bei dem etwas strittigen Punkt des »Herumstöberns« nachgegeben. Die Wanderschuhe hatte sie trotzdem heimlich im Kofferraum untergebracht, und auf der Hauptstraße war dann doch noch wie aus heiterem Himmel ein nett aussehender Antiquitätenladen aufgetaucht. Helen zog eine behandschuhte Hand aus der Jackentasche und hakte sich bei Thorne unter. Sie war sich ziemlich sicher, dass das Himmelbett, das im Hotel auf sie wartete, eine neue Gesprächsrunde zu diesen Themen einläuten würde.
»Na gut, das erbärmlich nehme ich hin«, erklärte Thorne. »Das alt weniger.«
Sie bogen auf die gepflasterte Seitenstraße ein, die zu ihrem Hotel führte. Auf halbem Weg kam ihnen eine Frau mittleren Alters mit einem Spaniel entgegen, dem die Kälte scheinbar genauso zusetzte wie Thorne und Helen. Thorne lächelte die Frau an, die sofort wegschaute.
»Hast du das gesehen?« Thorne schüttelte den Kopf. »Ich dachte, hier auf dem Land sind die Menschen freundlicher. Ich bin schon Serienmördern begegnet, die netter gewesen sind als diese mies gelaunte Schnepfe.«
»Du hast ihr wahrscheinlich Angst eingejagt«, nahm Helen die Frau in Schutz. »Kein Wunder bei deinem furchterregenden Gesicht.«
»Wie bitte?«
»Wenn man dich nicht kennt, meine ich.«
»Na toll«, meinte Thorne. »Dann bin ich also neben erbärmlich und alt auch noch furchterregend.«
Helen grinste, als Thorne einen Schritt nach vorne trat, um die Eingangstür des Hotels mit der Schulter aufzustoßen. »Ja, und das sind deine guten Eigenschaften.«
Thorne lächelte die junge Frau hinter der Rezeption an, doch sie reagierte nicht viel liebenswürdiger als die Frau mit dem Hund. Achselzuckend nickte er in Richtung der kleinen Bar. »Trinken wir noch einen Absacker?«
»Ich finde, wir sollten hochgehen«, antwortete Helen. »Den können wir auch im Bett trinken. Danach …«
»Oh …«
»Oder davor …«
Thorne legte sich unwillkürlich eine Hand auf den Bauch. Er bedauerte mit einem Mal, ein Dessert gegessen zu haben. »Vielleicht musst du mir noch zwanzig Minuten Zeit lassen.«
»Schlappschwanz.«
»Na gut, dann fünfzehn. Aber du übernimmst die Arbeit.«
Helen spazierte zur Treppe voraus. Thorne war im Begriff ihr zu folgen, und sein Blick traf den des Mädchens hinter der Rezeption. Sie musste ihre Unterhaltung mitbekommen haben, denn plötzlich lag ein Lächeln auf ihren Lippen.
Thorne putzte sich gerade die Zähne im Bad, als Helen nach ihm rief. Beim Anblick ihrer ordentlich aufgereihten Toilettenartikel musste er unwillkürlich lächeln. Sie hatte sie gegen die kostenlosen Proben ausgetauscht, die bereits in den Tiefen ihres Koffers lagen.
»Tom …?«
Die Zahnbürste immer noch im Mund, schlenderte er zurück ins Schlafzimmer. Zahnpasta spritzte auf sein Hank-Williams-T-Shirt, als er ein gedämpftes »Was ist?« hervorbrachte.
Helen hockte auf der gepolsterten Truhe am Fußende des Betts. Sie deutete mit dem Kopf zum Fernseher. »Die Polizei hat jemanden verhaftet.«
Sie hatten beide den Fall verfolgt, seit das erste Mädchen vor drei Wochen entführt worden war. Allmählich war das Thema von fast allen Titelseiten verschwunden, und auch im Fernsehen war die Geschichte in den Hintergrund gerückt, bis sich die Geschehnisse gestern wiederholt hatten. Dieses Mal hatten Zeugen beobachtet, wie die Teenagerin, die kurz darauf als vermisst gemeldet wurde, in ein Auto gestiegen war. Mit einem Schlag war das Interesse der Medien neu entfacht worden.
Thorne eilte zurück ins Bad, spuckte die Zahnpasta aus und spülte sich den Mund mit Wasser. Mit wenigen Schritten kehrte er ins Schlafzimmer zurück und setzte sich neben Helen, die die Fernbedienung auf den Fernseher richtete, um den Ton lauter zu stellen.
»Das war zu erwarten«, murmelte Thorne.
Als Polizeibeamtin im Dezernat für Kindesmisshandlungen verfolgte Helen eine solche Ermittlung natürlich mit besonderem Interesse. Als jemand, der ganz genau wusste, wie viel Leid solche Vermisstenfälle in den wartenden, hoffenden Hinterbliebenen hervorriefen.
Als Mutter.
Doch dieser Fall war anders.
Eine junge Reporterin, eingehüllt in einen schicken Mantel und einen dicken Schal, sprach direkt in die Kamera. Auch wenn ihre Miene angemessen ernsthaft schien, war ihr die Aufregung anzusehen, als sie von der jüngsten »bedeutsamen Entwicklung« sprach. Eine kleine Gruppe Einheimischer drängte sich hinter ihr, die das Filmteam wohl aus dramaturgischen Gründen dort platziert hatte. Sie standen auf einem Marktplatz, den Helen gut kannte.
Es war die Stadt, in der sie aufgewachsen war.
Die Reporterin kommentierte soeben den Filmbericht, der bereits am Abend zuvor gezeigt worden war: Polizeibeamte in Sicherheitsjacken, die sich in einer versetzt angeordneten Reihe langsam über ein dunkles Feld bewegten; ein verzweifelt aussehendes Paar, das von Verwandten getröstet wurde; ein anderes gleichermaßen bestürztes Paar, dem ein Weg durch eine Traube von Journalisten gebahnt wurde, die ihre Kameras und Mikrofone auf sie draufhielten. Die Reporterin berichtete, dass laut Quellen aus dem Umfeld der Untersuchung ein Anwohner zwischen dreißig und vierzig als Tatverdächtiger ermittelt worden war, der sich zurzeit in Gewahrsam befand. Sie gab den Namen des Mannes preis und wiederholte ihn noch einmal. Freundlich und langsam. »Die Polizei wollte weder bestätigen noch dementieren, dass es sich bei der Person, die sie zurzeit festhält, um Stephen Bates handelt«, fügte sie hinzu.
»Autsch«, seufzte Thorne. »Jetzt reißt sicher gleich ein leitender Ermittlungsbeamter irgendeinem großmäuligen Schwätzer den Arsch auf.«
»Die undichte Stelle kann überall sein«, entgegnete Helen.
»Trotzdem übel, oder?«
»Ist aber so gut wie nicht zu ändern, auf jeden Fall nicht dort. Vermutlich hat irgendjemand gesehen, wie der Verdächtige zur Wache gebracht wurde, und es weitererzählt.« Ihr Blick war noch immer auf den Fernseher gerichtet. »An einem Ort wie diesem ist es nicht einfach, was geheim zu halten.«
Thorne wollte etwas erwidern, aber Helen brachte ihn mit einem »Psst« zum Schweigen. Auf dem Bildschirm erschien ein Foto, und die Reporterin verkündete stolz, dass dies das Bild des Mannes sei, der gerade von der Polizei verhört werde, und von einer exklusiven Quelle aus dem direkten Umfeld der Familie stamme.
»Eine exklusive Quelle«, stöhnte Thorne. »Natürlich.«
Helen bedeutete ihm noch einmal, still zu sein. Sie stand auf und trat zum Bildschirm.
Dem Anschein nach war es ein relativ neues Hochzeitsfoto, auf dem das glückliche Paar vor dem Standesamt posierte. Der Bräutigam, dessen Kopf eingekreist war, trug einen einfachen blauen Anzug und lächelte in die Kamera, eine Zigarette in der Hand. Das Kleid der Braut war im Vergleich dazu etwas zu schick.
»Der Kerl sieht aus wie ein richtiger Schwerenöter …«
»O mein Gott!«, unterbrach ihn Helen.
»Was ist?«
»Ich kenne sie.« Helen zeigte auf den Bildschirm. »Ich war mit ihr zusammen auf der Schule. Mit der Frau des Verdächtigen.«
Thorne erhob sich ebenfalls und trat neben sie. »Verdammt!«
»Linda Jackson. Na ja, so hieß sie zumindest damals.«
»Bist du dir sicher?«
Helen nickte und starrte auf den Fernseher. »Wir waren in derselben Klasse …«
Sie schauten sich die Sendung noch ein paar Minuten länger an, doch nun wurden nur noch die gleichen Nachrichten durchgekaut. Als es auch keine entsetzten Anwohner mehr gab, die man hätte interviewen können, und dieselben Bilder zum dritten Mal über den Bildschirm flimmerten, verzog sich Helen ins Bad.
Thorne stellte den Fernseher leiser und begann sich auszuziehen. »Diese Reporterin sieht total selbstzufrieden aus«, rief er. »Rechnet offensichtlich mit einer baldigen Beförderung.«
Helen antwortete nicht. Thorne kletterte gerade ins Bett, als sie kurz darauf aus dem Bad kam. »Ich will dort hinfahren«, verkündete sie.
»Was willst du?«
»Dort hinfahren. Nach Hause.«
Thorne setzte sich auf die Bettkante. »Warum?«
»Denk doch nur mal daran, was sie gerade durchmacht. Sie hat Kinder.« Helen zeigte zum Fernseher. »Haben die gesagt.«
»Moment mal, wie lange hast du sie schon nicht mehr gesehen? Fast zwanzig Jahre?
»Na und? Ich kenne den Ort. Ich weiß, wie’s da ist, Tom.«
»Tja, ich kann dich nicht davon abhalten, aber ich finde, dass das keine kluge Idee ist.«
Sie schwiegen ein paar endlose Sekunden lang. Schließlich öffnete Helen den Kleiderschrank und nahm ihren Koffer heraus.
»Warte mal, du hast ja wohl nicht vor, heute Nacht noch zu fahren?«
»Dad erwartet uns nicht vor Sonntagabend zurück«, wandte Helen ein. Sie öffnete eine Schublade, zog eine Handvoll Socken und Unterwäsche heraus und trug sie hinüber zu ihrem Koffer. »Er kümmert sich um Alfie, wir müssen uns also keine Sorgen machen.«
»Ich weiß, aber trotzdem.«
»Wir können in anderthalb Stunden da sein … oder noch früher.« Sie wanderte zurück zur Kommode. »Um diese Uhrzeit ist kein Verkehr auf den Straßen.«
Thorne stand vom Bett auf und griff nach einem der beiden Frotteebademäntel im Kleiderschrank. Er war zwar zu klein, aber er zog ihn trotzdem an. Dann positionierte er sich strategisch zwischen Helen und ihrem Koffer. »Von deiner Familie lebt niemand mehr dort, oder? Wo denkst du zu übernachten?«
»Ach, da wird sich schon was finden.«
»Dort wimmelt’s gerade von Polizisten und Reportern. Selbst wenn du heute Nacht fährst, wirst du nichts Passendes auftun.« Er ließ einen Moment verstreichen und bemerkte erleichtert, dass sie noch einmal über ihr Vorhaben nachzudenken schien. »Jetzt komm, wir entscheiden das morgen, okay?«
Sie nickte zögernd. »Ich fahre aber auf jeden Fall.«
»Wenn du unbedingt willst.«
Helen blickte noch einmal zum Fernseher. Scheinbar gab es immer noch nichts Neues zu berichten. Sie ging zurück zum Bad und blieb in der Tür stehen.
»Du musst nicht mitkommen. Das weißt du, oder?«
»Ja, weiß ich. Aber was soll ich hier allein?«
»Du könntest nach Hause fahren«, erwiderte Helen. »Ein paar Tage mit Phil verbringen.«
»Wir reden morgen drüber, okay?«, sagte Thorne.
»Du meinst, um es mir auszureden?«
»Na ja, ich halte deinen Plan tatsächlich für keine kluge Idee.«
»Ist mir egal.« Helen setzte an, noch etwas sagen, aber genau in diesem Moment klingelte ihr Handy. Sie griff danach und meldete sich auf eine Weise, an die sich Thorne mittlerweile gewöhnt hatte; ihre Stimme klang leicht angespannt. Am anderen Ende der Leitung war Jenny, Helens Schwester. Thorne gehörte nicht zum erlauchten Kreis ihrer Lieblinge, und die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Auch Helen konnte Jenny zumeist nur schwer ertragen. Die Bevormundung durch ihre zwei Jahre jüngere Schwester ließ sie oft ungeduldig werden.
»Ja«, sagte Helen. »Das hab ich gesehen. Ich weiß …« Sie verdrehte die Augen, als sie auf ihrem Weg zurück ins Bad Thorne ansah und die Tür hinter sich schloss.
Thorne legte sich aufs Bett und stellte den Fernseher wieder lauter. Die Reporterin sprach mittlerweile mit ihren Kollegen im Studio.
»Die Atmosphäre hier zu beschreiben, ist schwer«, sagte sie. »Auf jeden Fall ist viel Wut zu spüren.«
Thorne konnte Helen zwar im Bad sprechen hören, aber die Worte nicht verstehen.
Vor der mittlerweile größer gewordenen Menge kam die Reporterin gerade zum Schluss ihres Berichts. Die Enden ihres Schals flatterten im Wind. Ihre Stimme klang verhalten, auf beherrschte Weise dramatisch. »Zwei vermisste Mädchen und ein Einheimischer, der im Zusammenhang mit ihrer Entführung gerade vernommen wird, lassen die Anspannung fühlbar werden.« Sie warf einen Blick über die Schulter. »Das hier ist eine Gemeinschaft unter Schock.«
Thorne konnte sehen, dass die Frau versuchte, ihren Bericht zu beenden und Mühe hatte, über die lauten Stimmen der in der Nähe stehenden Menschen hinweg gehört zu werden. »Unsere Mädchen« und »Gerechtigkeit für unsere Kinder« riefen sie. Schließlich noch etwas, das so klang wie »der Mistkerl soll hängen«.
Er griff nach dem Kissen hinter sich und verpasste ihm einen Boxhieb.
So hatte er sich seinen Urlaub nicht vorgestellt.
2
Sie fuhren zur M40 und dann Richtung Norden durch Oxfordshire, wo ihnen auf kleinen Straßen zahlreiche schlammverkrustete noble Geländewagen begegneten. Um Branbury herum waren viele unterwegs, um ihre samstäglichen Einkäufe zu erledigen. Das schlechte Wetter war seit ihrer Abfahrt nicht besser geworden. Auf jeden Fall sah es so aus, als würden sie länger als die eineinhalb Stunden brauchen, in denen sie die Strecke gestern Abend bewältigt hätten.
»Eine Woche in der Sonne hört sich verlockender an denn je«, meinte Thorne, und blickte von der regengepeitschten Motorhaube des BMW zu Helen auf dem Beifahrersitz. »Wie wär’s mit Portugal? Oder Teneriffa?« Ein weiterer Blick. »Dave Holland redet ständig davon.«
Helen nickte nur und starrte weiter auf die vorbeiziehenden Läden, Häuser, regennassen Mauern und Hecken. Sie hatte sehr wenig gesagt, seit sie nach einem enttäuschenden Frühstück und einem gereizten Gespräch mit dem Hotelmanager abgereist waren. Zuvor hatte sie eine halbe Stunde am Telefon verbracht, um Vorkehrungen für ihre Reise zu treffen. Seitdem schien sie ihren Gedanken nachzuhängen. Sie war unvermindert entschlossen, aber eindeutig besorgt, was sie beide an ihrem Zielort erwartete.
Im Radio war die Topnachricht die jüngste Entwicklung in Polesford.
Die Polizei weigerte sich noch immer, die Identität des Mannes zu bestätigen, den sie in Gewahrsam genommen hatte, räumte aber ein, ihn weiterhin zu verhören. Ein leitender Beamter gab eine kurze Erklärung ab, in der er verkündete, dass man weitere Informationen publik machen würde, doch erst zum geeigneten Zeitpunkt. Wie bereits die Reporterin abends zuvor sprach auch die Korrespondentin ziemlich ausführlich über die Atmosphäre in der Stadt.
Über die Wut, die Angst, den tiefen Schock.
Vor allem aber, fuhr sie fort, herrsche unter den Anwohnern das überwältigende Gefühl, dass so etwas in einer Stadt wie dieser eigentlich nicht passierte.
Im Anschluss ging der Nachrichtensprecher im Studio zu den jüngsten Arbeitslosenzahlen über, woraufhin Thorne den Ton leiser drehte. »Also, was ist Polesford denn nun? Eine Kleinstadt oder ein großes Dorf?«, fragte er. »Bei dir klingt es immer so, als wäre es winzig.«
Erst nach ein paar Sekunden wandte sich Helen ihm zu, als hätte sie die Frage gar nicht richtig mitbekommen.
Thorne schüttelte den Kopf, um ihr zu verstehen zu geben, dass es nicht wichtig war. Er schaltete vom Radio auf den iPod um, und Lucinda Williams erklang. Dann stellte er den Scheibenwischer schneller. »Ja, ein bisschen Sonne wäre doch gut«, murmelte er und sprach dabei ebenso zu sich wie zu Helen.
Zehn Minuten später, sie quälten sich gerade über die volle Autobahn, rang Helen sich eine Antwort auf seine Frage ab. »Genau genommen ist Polesford eine kleine Marktstadt. Wir haben in einem kleinen Dorf etwas außerhalb gewohnt. Es gibt mehrere davon, so eine Meile um die Stadt herum«, sagte sie.
»Hört sich nett an«, erklärte Thorne.
»Ist aber nicht zu vergleichen mit dem, wo wir gestern waren.«
»Keine Antiquitätenläden zum Herumstöbern?«
Helen lachte. »Wohl kaum. Landschaftlich ähnelt es schon den Cotswolds, aber ohne Männer in knallbunten Kordhosen; dafür hat es mehr Fast-Food-Läden.«
»Na also, ist doch gar nicht so schlecht.«
Thorne setzte den Blinker und überholte einen Lastwagen, der die Mittelspur in Beschlag nahm. Als er vorbeizog, durchbohrte er den Fahrer mit seinem Blick.
»Als ich fünfzehn war, fand ich Polesford aufregend«, fuhr Helen fort. »Freitags oder samstags sind wir abends dorthin ausgegangen.«
»Aha. Ihr seid also um die Häuser gezogen, oder was?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, wir haben nur so viel Bier mit Cidre getrunken, wie wir uns leisten konnten, und in der Bushaltestelle ein bisschen Gras geraucht.«
»Du, ein wilder Teenager? Hätte ich nie von dir gedacht.«
Helen lächelte zum ersten Mal, seit sie losgefahren waren. »Zu deiner Zeit gab’s wohl nur Zigaretten, oder waren die immer noch rationiert?«
Thorne erwiderte das Lächeln.
Die Tatsache, dass er mit größeren Schritten auf die fünfzig zuging als Helen auf die vierzig, war ein Punkt, über den sie sich immer mal wieder gemeinsam lustig machten. Er tat dann so, als wäre er entsetzt, dass sie sich nicht an die Sex Pistols erinnern konnte, wohingegen sie ihn fragte, wie es war, Bill Haley and the Comets auf der Bühne gesehen zu haben. Einige von Helens Äußerungen ließen Thorne vermuten, dass die Kommentare ihrer Schwester und von ein paar ihrer Freundinnen zu ihrem Altersunterschied noch sarkastischer ausfielen.
»Die Stadt war früher mal ganz nett«, bemerkte Helen. »Und ein paar schöne Ecken gibt’s noch immer. Unter anderem eine Abtei.«
Thorne versuchte, einen ländlichen Akzent nachzuahmen. »Ach … zu viele Zugereiste, oder was? Städter, die wie Heuschrecken über den Ort herfallen und ihn ruinieren?«
»Polesford liegt nicht in Cornwall, mein Lieber«, entgegnete Helen.
»Das ist der einzige Akzent, den ich beherrsche.«
»Na, dann versprich mir bitte, es in Zukunft zu lassen.« Sie blickte aus dem Fenster hinaus. »Das hier ist Warwickshire. Wenn, dann klingt der lokale Akzent eher wie bei The Archers.«
»O Gott, steh uns bei!«, stieß Thorne hervor.
Eine Stunde später fuhren sie von der Autobahn ab. Kurz darauf rollten sie langsam über die Hauptstraße von Dorbrook, zwei Meilen südlich von Polesford. Das Dorf, in dem Helen ihre Kindheit verbracht hatte. Thorne erkannte, was Helen gemeint hatte, als sie von ihrem Heimatort gesprochen hatte. Es gab mehr Fassaden aus Stein als Dächer aus Stroh, und Thorne bezweifelte, dass im Sommer viele Rosen über den Eingängen wuchsen.
Sie verließen die Hauptstraße und fuhren an kleinen Reihenhäusern vorbei, die aus den Zwanziger- oder Dreißigerjahren zu stammen schienen. Die Autos parkten meist in der Nähe der Eingänge und halb auf dem Bürgersteig, damit schwere Fahrzeuge vorbeikamen. Auf der anderen Straßenseite gab es einen Lebensmittelladen und einen chinesischen Imbiss, daneben eine kleine asphaltierte Fläche mit einer Schaukel und einem Karussell darauf.
Helen zeigte auf ein Haus. »Das da«, sagte sie, und Thorne fuhr noch etwas langsamer. »Das war unseres.« Sie drückte auf den Fensterheber, und die Scheibe glitt bis zur Hälfte hinunter. »Als wir dort wohnten, war die Haustür rot, und es gab noch keine Doppelverglasung.«
Thorne hielt den Wagen an und vergewisserte sich, dass niemand hinter ihm war. »Willst du aussteigen und es dir ansehen?«
»Es schüttet!«
»Hinten liegt ein Regenschirm«, meinte Thorne. »Geh und klopf an die Tür! Schau nach, wer da jetzt lebt.«
Helen schüttelte den Kopf, der Blick immer noch auf das Haus gerichtet. »Nein, ich glaub nicht.«
»Dauert nicht länger als fünf Minuten.«
»Wer zum Teufel will schon, dass ein Fremder an seine Tür klopft und die Nase in sein Haus steckt?« Sie ließ das Fenster wieder hochgleiten.
»Ich dachte nur, es würde dich vielleicht interessieren.«
»Ich will zu Linda«, sagte Helen, und ein leicht scharfer Unterton schwang in ihrer Stimme mit. Sie wandte sich zu Thorne, blinzelte langsam und lächelte schwach. »Außerdem, was soll das schon bringen?«
Der Regen ließ nach, als sie die wenigen Meilen weiter nach Polesford fuhren. Die schmalen Straßen waren kurvig mit hohen Hecken oder kahlen Bäumen am Rand. Nachdem sie den Fluss zum Ort überquert hatten, entdeckte Thorne den Wegweiser zum Markplatz. Mittlerweile hatte es fast aufgehört zu regnen.
Es war zwar Samstag, doch Thorne vermutete, dass auf dem Marktplatz noch etwas mehr los war als normalerweise üblich. Nicht allzu viele Anwohner schienen gekommen zu sein, um gebrauchte Taschenbücher, Parfümimitate oder andere Angebote zu kaufen. Eine Handvoll Händler hatten dem schlechten Wetter getrotzt, doch sie wirkten nicht gerade, als müssten sie sich die Kunden mit Knüppeln vom Leib halten. Die meisten von ihnen saßen plaudernd unter Plastikvordächern, die in dem starken Wind flatterten, und tranken Tee aus Thermosflaschen.
Ihre Mienen waren steinern und enttäuscht.
Die Menschen, die sich zu dritt oder zu viert zwischen den Ständen zusammendrängten oder am Rand des Marktes herumschlenderten, schienen eher an einer angeregten Unterhaltung interessiert zu sein, als daran, etwas zu erwerben. Thorne beobachtete sie, als er langsam um den Platz fuhr. Männer drängten sich in Eingängen und rauchten. Eine Gruppe von drei Frauen schob ihre Kinderwagen auf derselben Stelle vor und zurück. Köpfe wurden geschüttelt, es wurde genickt und mit Fingern gezeigt, und selbst aus der Entfernung fühlte es sich an, als würde der gesamte Platz von Geschnatter und aufgeregtem Spekulieren brummen.
»Paula meinte, wir sollten versuchen, hinter dem Supermarkt zu parken.« Helen zeigte auf eine Abbiegung, und Thorne folgte ihren Anweisungen. »Von da aus können wir zu Fuß gehen.«
Paula. Die Frau, in deren Haus sie offenbar übernachten würden, wenngleich Thorne noch immer nicht viel über sie oder ihre Beziehung zu Helen herausgefunden hatte.
»Du hattest recht mit deiner Vermutung«, hatte Helen morgens nach einer Reihe von Anrufen gesagt, und dabei eilig Sachen in den Koffer geworfen. »Ich kann noch nicht mal ein Zimmer in Tamworth finden, geschweige denn in der Stadt. Aber ich glaube, ich hab’s geschafft, uns woanders unterzubringen …«
Als sie sich dem Supermarkt näherten, erspähten sie gegenüber der kleinen Tankstelle ein eingezäuntes unbebautes Grundstück. Ein Mann in einer nassen grünen Regenjacke stand in der Einfahrt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Er deutete mit dem Kopf zu dem Schild, das an einer behelfsmäßigen Schranke klebte. PARKGEBÜHR PRO TAG £ 7,50.
»Wahnsinn«, stieß Helen hervor. »Der zockt die Leute aber richtig ab.«
Sie starrten ihn an, als sie langsam vorbeirollten. Viele hatten ihm die Summe bereits hingeblättert.
»Er wird nicht der Einzige sein«, bemerkte Thorne.
Auf dem Parkplatz hinter dem Supermarkt angekommen, fiel ihnen auf, dass die Hälfte der verfügbaren Fläche mit Leitkegeln abgetrennt und von einer großen Zahl an Einsatzfahrzeugen belegt war. Mannschaftswagen, Streifenwagen, ein Krankenwagen, der dort zur ständigen Bereitschaft stand, wie sie wussten. Helen stieg aus und verrückte ein, zwei Kegel, sodass Thorne neben zwei Polizeimotorrädern parken konnte. Während sie nach ihrem Mantel und einem Regenschirm auf dem Rücksitz griff, stellte Thorne die Kegel wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück und legte einen Ausweis der Metropolitan Police in die Windschutzscheibe mit der Aufschrift POLIZEIEINSATZ
Sie gingen ein paar Minuten schweigend nebeneinanderher und kamen an einer Schule und einer kleinen Ladenzeile vorbei. Im Gegensatz zum Marktplatz waren die Straßen nicht besonders belebt, doch standen immer noch hier und da Menschen vor ihren Häusern, und aus einem überfüllten Pub drang Stimmengewirr.
Linda Bates, ehemals Linda Jackson, lebte in einem Reihenhaus, das dem von Helens früherem Elternhaus in Dorbrook ähnelte. Ein paar Fotografen hingen davor herum, doch die Mehrzahl der Journalisten war bereits fort, da sie wussten, dass die Familie von Stephen Bates nicht mehr hier wohnte.
Der Medienzirkus war weitergezogen.
Faktisch gehörte das Anwesen der Warwickshire Police so lange, bis die Spurenermittlung ihre sorgfältigen Arbeiten abgeschlossen hatte. Thorne und Helen bahnten sich einen Weg durch die Handvoll Schaulustiger, die mit gezückten Smartphones auf der anderen Straßenseite standen. Ein Absperrband spannte sich um das Haus. Eine geschlossene Reihe von Polizeiwagen und Fahrzeugen der Spurenermittlung verstellte die Sicht auf die Vorderfront. Rechts und links des matschigen Vorgartens stand ein uniformierter Polizist, und zwei weitere Beamte befanden sich in der Mitte der Straße, um sicherzustellen, dass keine unbefugte Person sich dem Haus nähern konnte. Die Polizisten sahen äußerst gelangweilt aus, wenngleich Thorne bemerkte, dass wenigstens einer den Anstand besaß, dies zu verbergen, als ein paar Meter vor ihm ein Fotoapparat aufblitzte.
»Ja, ja … morgen kann sich der Herr Polizeihauptwachtmeister auf der Titelseite der Daily Mail bewundern«, lautete der ironische Kommentar eines alten Mannes mit einem Drahthaarterrier.
Helen nickte, aber sie und Thorne wussten, dass die ganz großen der Medienbranche dort zu finden waren, wo die Musik spielte.
Und die spielte in dem Haus, wohin sie beide gerade auf dem Weg waren.
Es war jene Art Siedlung, über die sich die Anwohner wahrscheinlich entrüstet hatten, als sie vor zwanzig, dreißig Jahren gebaut worden war. Eine glühbirnenförmige Ansammlung identisch aussehender Häuser, die frühzeitig gealtert waren. Hässliche Garagen und rote Ziegeldächer, die vor Satellitenschüsseln nur so strotzten.
Neben der zu erwartenden Reportermeute war auch eine ziemlich große Anzahl Schaulustiger vor Ort, die sich dicht an dicht auf dem Bürgersteig gegenüber der Hausnummer sechs drängten. Mütter und Väter mit kleinen Kindern auf den Schultern. Thorne konnte hören, wie das Murmeln lauter wurde, als er auf die Absperrung zutrat, und dem uniformierten Beamten seinen Dienstausweis zeigte. Nachdem Helen ebenfalls ihren Ausweis gezückt hatte und die beiden unter dem Absperrband hindurchgeschlüpft waren, um zur Haustür zu gehen, begannen die Fotoapparate hinter ihnen zu klicken.
Die Tür öffnete sich, als sie den Eingang erreichten.
Die Kriminalbeamtin, die darin auftauchte, groß und schlank, war Ende zwanzig. Das aschblonde Haar war streng zusammengebunden, sie trug eine dunkle Hose und ein dunkles Jackett. Thorne vermutete, dass sie eine Opferschutzbeamtin war und sich noch mehr Beamte im Hause befanden, sowohl uniformierte als auch Kriminalpolizei in Zivil.
Sie musterte Thorne und Helen und prüfte ihre Ausweise und Gesichter, bevor sie sie hereinwinkte.
Sorgsam schloss sie die Haustür, drehte sich um und stellte sich als Detective Constable Sophie Carson vor. Ihr Auftreten war nicht sonderlich kollegial. Sollte sie Details auf den Ausweisen wahrgenommen haben, schien sie nicht besonders beeindruckt davon, mit zwei ranghöheren Beamten zu sprechen. Sie wartete darauf, dass Thorne und Helen etwas sagten. Nach einem Moment peinlicher Stille machte sie einen Schritt von der Tür weg.
»Sollte ich irgendwas von Ihrem Besuch wissen?«
»Da gibt’s nichts zu wissen«, erwiderte Thorne. Wenn diese Frau tatsächlich Opferschutzbeamtin war, würde ihr ein etwas freundlicherer Umgangston besser zu Gesicht stehen, ging es Thorne durch den Kopf. »Detective Sergeant Weeks ist eine alte Freundin von Linda«, sagte er, nachdem er und Helen sich noch einmal vorgestellt hatten.
»Aha«, sagte Carson. Sie nickte, sah aber mit einem Mal unsicher aus. Als sie auf die beiden zutrat, wanderte ihre Hand automatisch zum Funkgerät, das an ihrem Gürtel befestigt war.
Der Flur war so eng, dass Thorne und Helen sich gegen die Treppe drücken mussten, um DC Carson vorbeizulassen. Sie klopfte an eine Tür und öffnete sie. Nach einem flüchtigen Blick in das Zimmer steckte sie den Kopf hinein und murmelte ein paar Worte, die weder Thorne noch Helen verstanden. Mit einem weiteren Nicken bedeutete sie ihnen schließlich einzutreten. Sie folgte ihnen hinein und schloss die Tür hinter sich.
Eine Frau in Jeans und einem schlabbrigen Sweatshirt hockte vornübergebeugt auf einem abgenutzten schwarzen Ledersofa, daneben ein Mädchen im Teenageralter. Zwei uniformierte Beamte, ein Mann und eine Frau, saßen auf Stühlen auf der anderen Seite des Raums. Offenbar hatte man hier vor Kurzem Tee getrunken. Die Reste davon standen noch auf dem Couchtisch: Becher, eine Milchtüte und eine offene Packung Kekse. Der Fernseher lief, wenngleich der Ton leise gestellt war.
Thorne und Helen standen wartend nebeneinander. Das Zimmer war überheizt und ziemlich stickig aufgrund der zugezogenen Vorhänge. Thorne konnte Stimmen von oben hören; ein Radio oder einen weiteren Fernseher.
Carson wies mit dem Kopf hinüber zu Helen. »Sie sagt, sie ist eine Freundin von Ihnen.«
Die Frau auf dem Sofa starrte Helen kurz an und erhob sich dann langsam. Sie runzelte die Stirn, doch dann wich die Verwirrung aus ihrem Gesicht, und sie erkannte die Freundin von früher wieder.
»Helen?«
»Dann lassen wir Sie mal allein«, sagte Carson. Sie winkte den beiden Beamten, die einer nach dem anderen aufstanden und an ihr vorbei auf den Flur hinausmarschierten. Thorne beobachtete Carson aufmerksam, als sie ihren Kollegen nach draußen folgte. Noch während sie die Tür über den dicken Teppich zuzog, drückte sie auf ihr Funkgerät und sprach hinein. Er konnte hören, wie sie der Einsatzzentrale Bericht erstattete.
Sekunden später fiel Linda Bates weinend in Helens Arme.
3
Sie versucht zu schlafen, aber nicht, weil sie müde ist.
Wach ist ihr kalt, obwohl sie den dicken Mantel behalten durfte. Außerdem ist es stockduster, nicht das geringste Licht dringt herein. Das Klebeband sitzt immer noch fest auf ihrem Mund, und sie spürt, wie sich allmählich ein Wundschmerz zwischen den Beinen ausbreitet, da sie dem Drang ihrer Blase hat nachgeben müssen. Zuerst hat es sie etwas gewärmt, doch dann wurde es feucht und kalt. Der Boden unter ihrem Hintern ist rau und nass, und das Rohr, an das sie gekettet ist, hat zahlreiche Schrauben, die sich in ihr Rückgrat bohren, selbst durch den dicken Mantel hindurch. Sie ist schon länger hier. Ein, zwei Tage mindestens, glaubt sie. Doch das einzuschätzen ist schwer bei der Dunkelheit und der Stille, in der außer dem tropfenden Wasser nichts zu hören ist. Sie weiß, dass sie sich unter der Erde befindet. Zumindest in dem Punkt ist sie sich sicher. Er hatte ihr so viel von dem Zeug aus der Flasche gegeben, dass sie sich nicht wehren konnte, aber sie war nicht völlig bewusstlos. Sie erinnert sich, wie sie aus dem Regen in eine stinkende Stille gebracht wurde und gleich das Gefühl hatte, diesen Ort von früher zu kennen.
Wach ist ihr schlecht vor Hunger, und ihre Kehle brennt, wenn sie schluckt. Obwohl sie weiß, dass irgendwelche Tiere ihr durchs Haar krabbeln und über die Beine laufen, wenn sie schläft, kann sie damit allemal besser umgehen, als mit dem bohrenden Schmerz in ihrem Bauch und dem verzweifelten Verlangen nach Essen, das selbst durch den widerlichen Geruch dieses Ortes nicht lange in Schach gehalten werden kann.
Wach leidet sie unter jeder Sekunde, in der sie allein ist und nicht weiß, wann der Mann zurückkommt, der sie hierhergebracht hat. Anfangs war sie von dem Gedanken beherrscht, was er tun würde, wenn er zurückkäme. Mittlerweile dreht sich alles um seine Abwesenheit. Darum, dass sie an diesem Ort sich selbst überlassen ist.
Wach versucht sie, sich einzureden, dass es eine Art Machtspiel ist und er probiert, ihren Willen oder was auch immer zu brechen. Sie versucht, sich einzureden, dass es Essen geben wird, wahrscheinlich aber nur als Gegenleistung für das, wovor sie sich so entsetzlich fürchtet. Das Angebot wird jedoch erst dann erfolgen, wenn sie genug gehungert hat. Wenn sie es nicht mehr ausschlagen kann. Sie weiß, dass eine der Ratten hier unten ist, und sobald sie wieder einmal hört, wie etwas in der Dunkelheit über den Boden jagt und durchs Wasser huscht, fragt sie sich, ob der Mann zurückkommt. Ob die Ratten seine Fußschritte über ihrem Verlies hören können, ob sie sie durch das Wasser und das verfaulte Gemäuer spüren können. Doch dazu kommt es nie. Er taucht nie auf.
Wach gibt es nichts zu tun, außer dazusitzen, zu horchen, vor sich hinzusummen, zu weinen und sich angestrengt einzureden, dass es Menschen gibt, die sich verzweifelt bemühen, sie zu finden. Es gibt nichts zu tun, außer sich die Hölle vorzustellen, die ihre Eltern gerade durchleben. Sie rückt auf dem Boden herum, versucht es sich etwas bequemer zu machen. Die Kette ist gerade lang genug, um sich hinlegen zu können. So nett bin ich zu dir, hat er gemeint. Das waren seine letzten Worte. Nein, nicht ganz. Tut mir leid wegen der Duftwolke, hat er noch gesagt, bevor er die Stufen hinaufgeklettert ist.
Die Duftwolke …
Wach hält sie die Luft an und kämpft gegen den ständigen Brechreiz an, den der widerliche Gestank in ihr auslöst. Sie malt sich aus, wie sich Geruchspartikel auf ihr Gesicht legen und sie sie durch die Nase einatmet.
Sie legt sich hin, einen Arm unter dem Kopf, um das Gesicht vor der Feuchtigkeit zu schützen.
Es gibt so viel, was sie nicht weiß oder versteht. So viel, was sie nur vermuten und versuchen kann zu verstehen. Was sie aber genau weiß, ist, dass sie nicht allein ist. Zumindest nicht genau genommen.
Wach weiß sie, dass in der Nässe und der Dunkelheit ihres unteririschen Verlieses eine Leiche liegt.
4
Thorne blieb noch ein paar Minuten im Haus, obwohl es ihm unangenehm war, und er sich mehr oder weniger vorkam wie ein Voyeur. Er starrte vor sich hin und fragte sich, warum er überhaupt mitgekommen war. Er hatte geglaubt, Helen würde auf seine Gesellschaft Wert legen, doch das hatte sich schnell als Trugschluss herausgestellt. Er war so überflüssig wie ein Kropf. So erklärte er Helen, dass sie ihn anrufen solle, wenn sie abgeholt werden wollte. Sie meinte, sie würde wahrscheinlich noch eine Weile bleiben und später wieder zu ihm stoßen.
»Polesford ist klein«, sagte sie. »Ich werde dich schon finden.«
Auf dem Weg nach draußen sprach er mit niemandem. Sophie Carson hing immer noch am Funkgerät.
Die Auslöser sämtlicher Kameras wurden gedrückt, als er aus der Tür trat. Mehrere Journalisten riefen ihm die üblichen Fragen zu, als er sich duckte, um wieder unter dem Absperrband hindurchzuschlüpfen. Stumm den Blick geradeaus gerichtet, beschleunigte er seine Schritte. Er bezweifelte, dass er lange unerkannt bleiben würde. Irgendein gewiefter Polizeireporter würde ihn bestimmt bald erkennen. Er war oft genug Gegenstand von Zeitungsberichten gewesen. Erst vor wenigen Monaten hatte sein Konterfei die Titelblätter geziert.
Als ein Gefangener geflohen war, den er begleitet hatte. Als vier Menschen starben. Als Thorne beinahe seinen besten Freund verloren hätte.
Er spazierte zurück zum Ortskern und sah, dass die meisten Händler vor dem Regen kapituliert hatten, der wieder eingesetzt hatte. Sie waren gerade dabei, ihre Sachen einzupacken. Bei seinem weiteren Weg über die Hauptstraße, begriff er, dass Helen den Ort richtig eingeschätzt hatte. Er hatte sehr wenig gemein mit einer durchschnittlichen englischen Marktstadt wie jener, von der sie heute Morgen abgereist waren. Es schien, als gäbe es hier ein ausuferndes Angebot an Nagelstudios und Friseuren. Neben einem Internetcafé und einer kleinen Spielhalle zählte Thorne innerhalb von fünfzig Metern noch vier Schnellimbisse. Ein Antiquitätenladen war weit und breit nicht zu entdecken.
Er blieb vor einem Zeitungskiosk stehen, kaufte sich das örtliche Blatt und schlenderte auf die andere Straßenseite zu einem Café namens Cupz. Nachdem er einen Kaffee und ein Wurstsandwich bestellt hatte, begann er die Zeitung zu studieren. Die jüngsten Neuigkeiten über das vermisste Mädchen und das inzwischen fast überall kursierende Hochzeitsfoto von Stephen und Linda Bates nahmen die ersten vier Seiten ein. Die Titelzeile war wie immer markant und zweifelsohne schlagkräftig:
LIEBE, EHE UND ENTFÜHRUNG?
Mehrere Seiten widmeten sich der Überschwemmung der Dörfer im flacher gelegenen Norden. Es gab Bilder von dem über die Ufer getretenen Fluss Anker, von Schmutzwasser, das gegen Haustüren schwappte, von einer Familie, die in einem kleinen Schlauchboot ihre Einkäufe erledigte. Die Not werde sich noch verschlimmern, hieß es in einem Bericht, da man weiterhin schlechtes Wetter erwarte und die Helfer mit ihren Mitteln und ihrer Kraft bereits am Limit seien.
Thorne blickte aus dem Fenster und beobachtete, wie Menschen sich beeilten, Schutz vor dem Regen zu finden, der jetzt heftig auf farbige Regenschirme niederprasselte.
Eine junge Frau brachte ihm das Essen. Sie nickte in Richtung der vor ihm liegenden Zeitung. »Ist das nicht furchtbar?«
»Was?«, fragte Thorne. »Die vermissten Mädchen oder das Hochwasser?«
Die Bedienung sah etwas verunsichert aus. »Na ja, beides«, antwortete sie. »Ich meine, ich versuche natürlich nichts miteinander zu vergleichen. Nur Gott allein weiß, was diese Familien durchmachen müssen.« Ihr Gesicht färbte sich rosa. »Ich meine, die Familien dieser armen Mädchen.«
Thorne nippte an seinem Kaffee, der nicht so heiß war, wie er oder jeder andere es gern gehabt hätte. »Haben Sie sie gekannt?«
»Ich hab sie ein paarmal gesehen«, erwiderte sie. »Nach der Schule, zusammen mit ihren Freundinnen.«
Thorne blätterte zurück zur Titelseite und zeigte auf das Hochzeitsfoto von Bates. »Und ihn? Kennen Sie ihn?«
Die Bedienung verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Gott sei Dank nicht!«
»Er ist noch nicht angeklagt worden«, wandte Thorne ein.
»Wird er aber.«
Thorne biss in sein Sandwich und wartete.
»Immerhin gab’s Zeugen, nicht? Ein paar von Poppys Freundinnen haben beobachtet, wie sie in sein Auto gestiegen ist.«
Poppy Johnston. Der jüngste Entführungsfall. Ihr Name wurde immer noch häufiger in den Zeitungsberichten erwähnt als das Mädchen, das drei Wochen zuvor verschwunden war. Mittlerweile war sie aber für alle nur noch »Poppy«, selbst für diejenigen, die sie nicht persönlich gekannt hatten.
»Beweist aber trotzdem nicht, dass er sie entführt hat.« Thorne betrachtete das Mädchen, das sein Urteil offensichtlich schon getroffen hatte und jetzt mit den Schultern zuckte.
»Also, eigentlich wollte ich Sie bloß fragen, ob Sie Ketchup wollen.«
»Würzsoße«, sagte Thorne.
Nach dem Mittagessen schlenderte Thorne zurück zum Marktplatz und folgte den Schildern zu der dahinter liegenden eingeschossigen Memorial Hall. Das Gebäude, das neben einer kleinen Gemeindebücherei und einem Gesundheitszentrum lag, war zur Polizeileitstelle umfunktioniert worden. Hier am Eingang waren deutlich sichtbar Tafeln mit der Nummer der Einsatzzentrale aufgestellt worden, und ein paar Uniformierte sprachen gerade mit Bürgern. Die Leitstelle koordinierte die Suchtrupps; Freiwillige wurden von dort aus organisiert – beziehungsweise von ihrem Vorhaben zu helfen wieder abgebracht, da sie häufig unbeabsichtigt Beweise zerstörten, was den Nutzen ihres Einsatzes immens schmälerte. Anwohner kamen hierher, um Informationen oder Klatsch auszutauschen, und sich an dem kostenlosen Tee und den Keksen zu bedienen. Normalerweise versammelten sich auch die Medien dort, wenn es offizielle Pressemitteilungen gab.
Thorne spazierte hinein.
Er hatte schon oft von Journalisten gehört, die sich nach ihrer Rückkehr aus Kriegsgebieten im normalen Alltagsleben nicht mehr zurechtfanden und deshalb unbedingt wieder zurückwollten. Scheinbar gab es Menschen, die ein starkes Verlangen nach jenem Rausch verspürten, den die Gefahr mit sich brachte. Es war schlichtweg eine Droge. Auch wenn Thorne diese Begriffe nicht verwendet hätte, um seine eigenen Gefühle zu beschreiben, genügten die Aufregung und der Druck einer so großen Ermittlung wie der in Polesford, um in ihm Endorphine freizusetzen.
Als er morgens von dem auf romantisch getrimmten Hotel abgefahren war, hatte er sich selbst versichert, dass er Helen lediglich Gesellschaft leisten wollte und nichts mit dieser Sache zu tun haben würde. Das war keine Frage der Zuständigkeit. An und für sich war er gerade in Urlaub; einem Urlaub, den er seit den Ereignissen auf Bardsey Island, die erst wenige Monate zurücklagen, dringend brauchte. Doch hatte er anderen schon immer besser etwas vormachen können als sich selbst. Die langsame Fahrt um den Marktplatz hatte bereits genügt, um sein Blut in Wallung zu bringen. Das Geschnatter, das er jetzt hörte, und der Geruch bitteren Tees und feuchter Uniformen taten ihr Übriges. Auch wenn die Leitstelle nicht zu vergleichen war mit einer Haupteinsatzzentrale in London, war das geschäftige Treiben das gleiche. Das Verlangen, sich umzusehen und von allem einen Eindruck zu bekommen, war so stark wie der Impuls eines ertrinkenden Menschen, an die Wasseroberfläche zu gelangen.
Thorne konnte einfach nicht anders.
Ein stämmiger rotgesichtiger Polizist in Uniform trat auf ihn zu und fragte, ob er Hilfe bräuchte.
»Können Sie mir sagen, wo Stephen Bates in Gewahrsam gehalten wird?«, fragte Thorne.
Der junge Police Constable seufzte. »Würden Sie bitte weitergehen, Sir?«
Jetzt war Thorne an der Reihe zu seufzen. Er zückte seinen Dienstausweis.
»Oh. Entschuldigen Sie, Sir.« Ein völlig anderes »Sir«. Der Polizist trat etwas näher und senkte die Stimme. »Er befindet sich in Nuneaton, soweit ich weiß.«
»Danke.«
Thorne wollte gerade wieder gehen, als dem PC offenbar klar wurde, dass alle an der Untersuchung beteiligten Detectives die Antwort auf Thornes Frage gewusst hätten.
»Könnte ich bitte Ihren Dienstausweis noch einmal sehen, Sir?«
Thorne fischte ihn erneut heraus und hielt ihn dem Beamten vor die Nase.
»Seit wann ist die Metropolitan Police in diesen Fall eingebunden?«
»Ich bin nur in beratender Funktion hier«, antwortete Thorne.
»Aha.« Der PC blickte noch immer misstrauisch.
»Hören Sie, ich kenne den Chef, okay?«
»Und der heißt …?«
Thorne gab sich äußerste Mühe, verärgert auszusehen, während er sich den Kopf über den Namen des leitenden Detective zerbrach, der im Radio gesprochen hatte. Dann fiel es ihm ein. »Ich bin ein Freund von Tim Cornish.«
»In Ordnung.«
»Zufrieden?«
Der Polizist nickte und trat weg. »Guter Junge!«, sagte Thorne. »Dann helfen Sie mal weiter brav unseren älteren Mitbürgern dabei, über die Straße zu kommen …«
Auf dem Weg zurück zum Auto überkam Thorne ein schlechtes Gewissen, weil er dem jungen Constable gegenüber einen so überheblichen Ton angeschlagen hatte. Er hatte sich schon lange mit der Person abgefunden, in die er sich bei seinem Job mit Leichtigkeit verwandeln konnte; hatte sich an die Nebenwirkungen dieses geschäftigen Treibens gewöhnt, die aus Ungeduld, Intoleranz und der Fähigkeit bestanden, sich wie ein Riesenarschloch aufzuführen.
Er fuhr vom Parkplatz herunter, drehte die Musik auf und versuchte, den Vorfall zu vergessen.
5
Lindas Tochter war sechzehn und hieß Charli. »Sie schreibt ihren Namen so«, hatte Linda erklärt, und mit den Achseln gezuckt. Eine machtlose Mutter. Das Mädchen war größer als ihre Mom und etwas schwerer. Im Gegensatz zu Linda war sie stark geschminkt und trug ihr Haar kurz geschnitten. Außer einem gemurmelten »Hallo« hatte sie nichts gesagt, als Linda sie vorgestellt hatte. Nachdem sie ein paar Minuten vor sich hingestarrt hatte, war sie aufgestanden, und hatte wortlos das Zimmer verlassen. Helen konnte hören, dass eine der Polizistinnen sie fragte, ob alles in Ordnung war, doch sie erhielt keine Antwort. Nur das Geräusch stapfender Fußschritte entfernte sich auf dem Weg nach oben.
»Danny ist oben«, bemerkte Linda. »Ihr Bruder. Seitdem wir hier sind, ist er kaum runtergekommen. Nur, um sich etwas zu essen oder zu trinken zu holen. Dann verschwindet er gleich wieder. Ein Beamter hat den beiden netterweise einen Computer gebracht, den sie benutzen können. Das hätte er nicht tun müssen, oder?« Sie sah Helen an. »Sie haben die Laptops der beiden mitgenommen.« Sie schüttelte den Kopf und strich einen unsichtbaren Fussel vom Rock. »Sie haben alles mitgenommen.«
»Ich weiß«, sagte Helen.
»Du machst dir keine Vorstellung. CDs, DVDs, einfach alles. Tütenweise.«
»Ich weiß«, sagte Helen noch einmal. »Ich bin Polizeibeamtin.«
Linda blickte sie an, öffnete leicht den Mund und schloss ihn wieder.
»Deswegen bin ich aber nicht hier. Ich bin nicht im Einsatz. Ich bin gekommen, weil ich dein Bild in den Nachrichten gesehen habe und mir dachte, dass du vielleicht eine Freundin gebrauchen kannst.«
»Ach, dachtest du?«
Helen erkannte, wie ihre Worte geklungen haben mussten. »Ich meine, ich bin mir sicher, dass du viele Freunde hast, aber … ich dachte bloß, ich könnte vielleicht helfen.«
Linda nickte und beugte sich über den Tisch. Sie griff nach einem Keks, legte ihn aber wieder zurück. »Mir war nicht klar, das wir Freundinnen sind«, erklärte sie. »Wann bist du von hier weg?«
»Vor fast zwanzig Jahren«, antwortete Helen.
»Und seitdem warst du nicht mehr hier?«
Helen schüttelte den Kopf.
»Wir hatten ein Klassentreffen. Du hättest kommen können.«
»Wollte ich auch …«
Für einen Augenblick sah Linda aus, als könnte sie sich nicht entscheiden, ob sie Helen glauben sollte oder nicht. Dann beschloss sie anscheinend, dass es nicht weiter wichtig war, oder sie glaubte ihr wirklich. »War sogar richtig witzig.«
»Vielleicht gibt’s ja noch mal eins.«
Linda fuhr sich mit den Fingern durch das dicke krause Haar, das am Ansatz bereits viele graue Stellen aufwies. Ihr Gesicht war abgespannt, die Falten um Augen und Mund ausgeprägt. Ihre Lippen waren spröde. Helen wusste, dass auch sie sich in den letzten zwanzig Jahren ziemlich verändert hatte, doch die Frau, die neben ihr saß, war kaum noch als die lächelnde Braut auf dem erst vor Kurzem entstandenen Hochzeitsfoto wiederzuerkennen.
»Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass eine von uns hingehen würde«, wandte Linda ein. »Du etwa?«
Sie schwiegen eine Minute, vielleicht auch länger. Die Beamten draußen unterhielten sich, und plötzlich erklang Musik von oben. Kein Text, nur ein sich wiederholender Beat. Wie ein rasender Puls.
»O Gott, ich muss mich anhören wie eine undankbare Zicke«, sagte Linda.
»Schon in Ordnung.«
»Nein, wirklich, ich bin froh, dass du gekommen bist. Das hättest du nicht müssen.«
»Ich wollte aber.«
Es klopfte, und ein uniformierter Polizist steckte den Kopf herein. Er fragte, ob sie noch mehr Tee wollten, was beide bejahten.
Als die Tür wieder geschlossen war, verdrehte Linda die Augen. »Andauernd Tee. Er kommt mir schon zu den Ohren raus. Das bringt man euch wohl bei, oder?«
»Was?«
»Auf der Polizeischule, oder wo auch immer. Im Zweifelsfall den armen Schweinen immer einen Tee machen.«