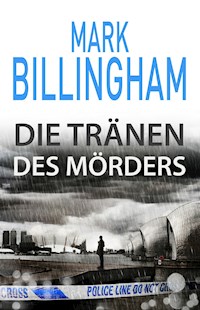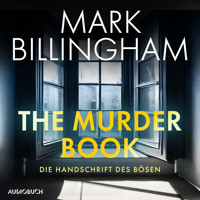Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tom Thorne
- Sprache: Deutsch
Eigentlich sieht es wie ein ganz normaler Mordfall aus — eine Frau wird in ihrer Londoner Wohnung tot aufgefunden. Doch dann findet sich der Fetzen eines Röntgenbildes in der geballten Faust der Leiche. Detective Inspector Tom Thorne ermittelt und findet bald heraus, dass die Mutter des Opfers ebenfalls ermordet wurde. Deren Mord liegt allerdings bereits fünfzehn Jahre zurück. Sie war eines der Opfer des berüchtigten Serienkillers Raymond Garvey. Die Jagd nach Garvey war eine der größten in der Geschichte der Met und endete erst, nachdem sieben Frauen ihren Tod gefunden hatten. Inzwischen ist Garvey allerdings ebenfalls tot, gestorben an einem Hirntumor. Und trotzdem scheint der Mörder von damals etwas mit den Morden von heute zu tun zu haben. Weitere Leichen werden gefunden, und jedes Mal findet sich ein weiteres Stück des Röntgenbildes. Thorne fügt das makabre Puzzle zusammen, bis er das grausame Bild erkennt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schuld des Blutes
Die Schuld des Blutes
© Mark Billingham 2009
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Serie: Tom Thorne
Titel: Die Schuld des Blutes
Teil: 8
Originaltitel: Blood Line
Übersetzer: Isabella Bruckmaier
© Übersetzung : Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-2032-2
Tom Thorne
#1 – Der Kuss des Sandmanns
#2 – Die Tränen des Mörders
#3 – Die Blumen des Todes
#4 – Blutzeichen
#5 – In der Stunde des Todes
#6 – Die Geliebte des Mörders
#7 – Das Blut der Opfer
#8 – Die Schuld des Blutes
–––
Für
David Shelley
Prolog
Debbie und Jason
»Komm, Spatz! Gehen wir Züge anpusten.« Debbie Mitchell packt ihren Sohn am Arm, aber den zieht es in die entgegengesetzte Richtung zu dem schokoladebraunen Labrador, den die alte Frau mühsam zu kontrollieren versucht. »Tsch-tsch.« Debbie bläst die Backen auf. »Komm, das magst du doch so gerne ...«
Jason zieht stärker. Wenn er will, ist er ganz schön kräftig. Das Geräusch, das er macht, liegt irgendwo zwischen einem Grunzen und einem Wimmern. Doch Debbie versteht ihn auch so.
»Hund«, meint er. »Hund, Hund!«
Die alte Frau mit dem Labrador lächelt dem Jungen zu — sie hat die beiden schon oft im Park gesehen —, um dann wie jedes Mal traurig zu seiner Mutter zu schauen.
»Armer Kleiner«, sagt sie. »Er weiß, dass ich in meiner Tasche ein paar Leckerlis für Buzz habe. Er will ihm welche geben, stimmt’s!« Der Hund hört zu und zerrt kräftiger an der Leine. Er will zu dem Jungen.
»Tut mir leid«, sagt Debbie. »Wir müssen weiter.« Sie zieht an Jasons Arm, und diesmal schreit er vor Schmerz auf. »Jetzt ...«
Sie geht schnell, sieht sich dabei alle paar Schritte um und zieht Jason hinter sich her. »Tsch-tsch«, wiederholt sie und versucht, sich ihre Angst nicht anhören zu lassen. Sie weiß, wie sensibel er darauf reagiert. Der Junge fängt an zu lächeln, den Hund hat er bereits vergessen. Er läuft neben ihr her und schnauft selbst wie eine Lokomotive.
Sie hört den Hund bellen. Die alte Frau — wie hieß sie gleich wieder, Sally! Sarah! — meinte es gut, und an jedem anderen Tag hätte Debbie mit ihr gesprochen. Um ihre Gereiztheit zu überspielen, hätte sie gelächelt und erklärt, dass Jason kein armer Kleiner sei. Dass es kein glücklicheres Kind gäbe, kein Kind mehr geliebt würde.
Ihr kleiner Schatz. Der schon neun Jahre alt wurde und bereits Haare an den Beinen und ein übergroßes ArsenalT-Shirt hatte. Der wahrscheinlich nie lernen würde, selbst zu essen oder sich anzuziehen.
»Zug«, sagt Jason. Versucht Jason zu sagen.
Sie läuft über das tiefer gelegene Gelände, an der Bank vorbei, auf der sie normalerweise eine Weile sitzen, an heißeren Tagen manchmal ein Eis essen. Dann, als sie den Fußballplatz erreichen, läuft jason voraus. Sie kommen schon seit einigen Jahren hierher, und während sie auf die vertraute Baumreihe entlang der Bahngleise zuläuft, fällt ihr auf, dass sie nicht einmal weiß, wie dieser Ort heißt. Ob er überhaupt einen Namen hat. Hampstead Heath oder Richmond Park ist es nicht — letzten Sommer trieb sich hier wochenlang ein Exhibitionist herum, und die Kids aus der Gegend machten nachts manchmal Feuer — aber das hier gehörte ihnen.
Ihr und Jason.
Sie blickt sich erneut um und marschiert weiter. Sie kämpft gegen den Wunsch an, zu rennen, weil sie fürchtet, jemand könne sie sehen und sie aufhalten. Als sie den Mann nirgends entdeckt, nach dem sie Ausschau hält, geht sie schneller, um Jason einzuholen. Er ist wie immer vor den Torpfosten stehen geblieben, um sich auszumalen, einen Elfmeter zu schießen: Das macht er, egal ob jemand spielt oder nicht. Die Jungs, die hier rumbolzen, sind es gewohnt, dass er auf ihr Spielfeld stürmt und vor dem Tor herumfuchtelt wie Ronaldo. Manchmal feuern sie ihn an, und keiner von den Jungs lacht oder grimassiert mehr. Dafür könnte Debbie die kleinen Mistkerle küssen. Sie bringt ihnen ab und zu eine kalte Limo mit oder aufgeschnittene Orangen.
Sie greift nach Jasons Hand und deutet mit einer Kopfbewegung zur Brücke, die hundert Meter links vor ihnen liegt.
Sie gehen rasch darauf zu.
Normalerweise hätten sie den anderen Weg genommen, durch den Eingang gegenüber ihrer Wohnung. Sie wären dann über die Brücke hierhergekommen und hätten nicht über die Plastikstühle und den Gartenzaun ihrer Freundin klettern müssen.
Aber das war kein normaler Tag.
Als sie sich wieder umsieht, entdeckt sie auf der anderen Seite des Fußballfelds den Mann. Er winkt, und sie muss dagegen ankämpfen, in die Hose zu pinkeln. Er könnte sie unmöglich rechtzeitig erreichen, selbst wenn er lief. Oder etwa doch! Aber die Tatsache, dass er gar nicht schnell läuft, sondern dass er selbstbewusst ausschreitet, jagt ihr mehr Angst ein, als sie für möglich gehalten hätte. Sie hatte es gewusst, bevor sie ihn am Telefon gehört hatte. Sie hatte es in seinen Augen gesehen und an dem schrecklichen roten Fleck unter seiner Jacke.
Der Mann winkt wieder und fängt an zu rennen.
Auf der Brücke bleibt Jason an der gewohnten Stelle stehen und wartet auf sie. Er weiß, dass sie ihm helfen wird, den Zug zu sehen, wenn er kommt. Er wirkt verwirrt, als sie ihn erreicht. Er bläst die Backen auf und winkt mit den Armen.
Es gab mal ein Metallgeländer als Schutz, aber im Lauf der Zeit war es stückweise herausgerissen worden, als die, die nichts Besseres zu tun hatten, jedes Stück Mauerwerk mit Graffiti besprühten.
Wer wen gefickt hatte. Wer schwul war. Wer hier gewesen war.
Sie legt Jason die Hand auf die Schulter und zieht sich hoch. Sie ignoriert die Schmerzen, als sie sich die Knie an der Mauer aufreißt, und hievt sich vorsichtig Zentimeter für Zentimeter nach oben. Dann holt sie ein paarmal schnell Luft, bevor sie langsam die Beine nacheinander über die Mauer schwingt, bis sie sitzt. Sie wagt es nicht, hinunterzuschauen, noch nicht.
Sie blickt sich um, um sicherzugehen, dass niemand sie beobachtet, und da hört sie die Stimme des echten Polizisten. Er ist irgendwo in der Nähe der anderen Brückenseite, er kommt von der anderen Richtung. Er klingt heiser und krächzend, als er ihren Namen ruft. Er muss gerannt sein. Er hört nicht auf zu rufen und zu suchen, aber Debbie wendet sich ab.
Zu spät, denkt sie. Viel zu spät.
Sie greift nach unten, um Jason heraufzuziehen. Ihr Herz macht einen Sprung, als sie sein aufgeregtes Lächeln sieht. Bisher hatte sie ihn immer nur so weit hochgehoben, dass er über die Kante sehen konnte, wie der Zug unten vorbeidonnerte.
Das ist ein ganz neues Abenteuer.
Als sie ihn hochzieht, schreit sie vor Anstrengung auf und unterdrückt die Tränen, als er sich setzt, die Beine baumeln lässt und sich an sie kuschelt. Er spürt die Vibrationen und schnappt nach Luft und ruft, um sie darauf aufmerksam zu machen.
Debbie wird mulmig zumute, und sie blickt auf. In der Ferne biegt der Zug um die Kurve. Die U-Bahn aus High Barnet. Vor der Brücke wird sie abbremsen, um in den Bahnhof von Totteridge and Whetstone einzufahren, aber noch immer schnell genug sein.
Debbie sucht nach der Hand ihres Sohns und drückt sie. Sie beugt sich zu ihm und flüstert ihm ins Ohr, ein Geheimnis — was immer die Experten sagen, sie weiß, dass er sie versteht. Er deutet und schreit, als der Zug näher kommt, lauter wird. Dieses Lächeln bricht ihr das Herz.
Debbie schließt die Augen.
»Tsch-tsch«, sagt Jason und bläst die Backen auf.
Erster Teil
Neuer Kummer
Erstes Kapitel
» ... ist nicht lebensfähig.«
Die Frau reichte Louise die dicke Küchenrolle, schaltete das Gerät aus und wartete kurz. Dann, als Louise sich das Gel vom Bauch wischte, sagte sie es ihr.
Sie schob noch ein paar statistische Fakten nach: Prozentzahlen und Wochen und wie viele von zehn Schwangerschaften. Dann noch, wie häufig das vorkam und wie viel besser es war, es passierte jetzt als später.
Thorne hatte nicht viel davon mitbekommen. Nicht wirklich.
Nicht lebensfähig.
Er sah Louise nicken. Sie blinzelte langsamer als sonst und knöpfte sich die Jeans zu, während die Frau ein, zwei Minuten über die weitere Vorgehensweise sprach. »Über die Details können wir später reden«, sagte sie. »Wenn Sie etwas Zeit für sich hatten.«
War sie eigentlich eine Ärztin? Thorne war sich nicht sicher. Vielleicht so eine Art »Ultraschalltechnikerin« oder etwas in der Richtung. Nicht dass das wirklich von Bedeutung gewesen wäre. Es war offensichtlich nicht das erste Mal, dass sie diese Worte sagte. Es hatte keine Pause oder auch nur eine Andeutung von Unsicherheit gegeben, und das erwartete er auch nicht. Wahrscheinlich war es für alle Betroffenen das Beste, solche Angelegenheiten geschäftsmäßig zu behandeln. Er vor allen anderen sollte das wissen. Am besten man sagte nur das, was gesagt werden musste, und erledigte seinen Job, vor allem wenn weitere Termine anstanden und draußen eine Menge andere glückliche Paare warteten.
Doch dieser Ausdruck ...
Danach saßen sie in einer Ecke neben dem Wasserspender, der vom großen Warteraum etwas abgetrennt war. Vier zusammengehängte Plastikstühle. Eine ganz nette zitronengelbe Wand und an ein Korkbrett gepinnte Kinderzeichnungen. Ein Korbtisch mit ein paar Zeitungen und einer Box Papiertücher.
Thorne drückte Louises Hand. Sie fühlte sich klein und kalt an. Er drückte sie noch mal, und sie sah auf, lächelte und schniefte.
»Alles okay mit dir?«, fragte sie.
Thorne nickte. Was Beschönigungen anging, war die hier kaum zu schlagen. Unverbindlich und gleichzeitig final. Wahrscheinlich machte sie die Sache für die meisten erträglicher, und darum ging es schließlich.
Nicht lebensfähig.
Tot. In dir drin tot.
Ob er die Phrase mal selbst ausprobieren und bei der nächsten Gelegenheit einsetzen sollte, wenn er in die Leichenhalle oder mitten in der Nacht bei so einem armen Teufel an die Tür klopfen musste.
Die Sache ist die, Ihr Mann stieß mit so einem besoffenen Volltrottel zusammen, der ein Messer in der Tasche stecken hatte. Ich fürchte, er ist ... nicht mehr lebensfähig.
Feine Sache, dadurch klang es so, als sei das Opfer ein Androide. Aber ein bisschen Distanz war wichtig. Man brauchte Distanz. Ohne Distanz lief es auf ein paar leere Weinflaschen mehr pro Woche in der Mülltonne hinaus.
Es machte die Sache für sie und für einen selbst erträglicher.
Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihr Mann erschossen wurde. Er ist nicht mehr lebensfähig. Er ist so wenig lebensfähig wie eine Maus, die der Katze zu nahe gekommen war.
»Tom?«
Er sah auf, als ihn Louise leicht in die Seite stieß. Die Frau, die den Ultraschall durchgeführt hatte, lief durch den Wartebereich und kam auf sie zu. Eine Inderin mit einer dicken rot gefärbten Haarsträhne. Anfang dreißig, vermutete Thorne. Ihr Lächeln war perfekt: besorgt, aber zugleich optimistisch.
»Okay, ich denke, ich hab ein Bett für Sie organisiert.«
»Danke«, sagte Louise.
»Wann hatten Sie Ihre letzte Mahlzeit?«
»Ich hab seit dem Frühstück nichts mehr gegessen.«
»Das ist gut. Dann schauen wir, dass wir die Ausschabung sofort machen.« Die Frau reichte Louise ein Blatt und erklärte ihr, wie sie in die entsprechende Abteilung gelangt. Dann wandte sie sich zu Thorne. »Sie sollten vielleicht nach Hause fahren und ein paar Sachen für sie holen. Nachthemd und was sie sonst noch braucht.«
Thorne nickte, während sie weitersprach und erklärte, dass Louise es danach ein paar Tage langsamer angehen müsse. Er nickte noch immer, als sie sagte, dass sie es beide nicht so schwer nehmen dürften, dass auf dem Blatt ein paar Telefonnummern von Leuten stünden, mit denen sie reden könnten, wenn sie das wollten.
Er sah ihr nach, als sie in ihr Zimmer zurückging, um das nächste Paar aufzurufen, sobald sie an der Tür war. An der Wand gegenüber war hoch oben ein Fernsehgerät montiert. Ein Paar mittleren Alters wurde durch eine Villa in Frankreich oder Italien geführt, die Frau sagte etwas von wegen, wie farbenprächtig die Fliesen seien.
Eine hagere Frau in einem grünen Overall schob einen mit Putzutensilien vollgeladenen Wagen den Gang entlang auf sie zu. Neben dem Korbtisch blieb sie stehen, nahm einen Lappen und ein Putzmittel von ihrem Wagen, putzte einen der leeren Stühle und sah dabei hinüber zu Thorne und Louise.
»Warum weinen Sie?«
Thorne musterte die Frau ein paar Sekunden, bevor er sich zu Louise wandte, die auf den Boden starrte und das Blatt immer kleiner zusammenfaltete. Plötzlich wurde ihm ganz heiß, die Härchen in seinem Nacken richteten sich auf und kitzelten ihn, und er spürte den Schweiß zwischen seiner und Louises Hand. Mit einem Kopfnicken deutete er kurz auf das Schild an der Tür zum Ultraschallraum für pränatale Untersuchungen und fuhr die Reinigungsfachkraft an.
»Raten Sie mal.«
Thorne brauchte fast fünfzehn Minuten für die knappen zwei Kilometer vom Whittington Hospital nach Kentish Town, aber so hatte er wenigstens Zeit, sich zu beruhigen. Und aufzuhören, daran zu denken, wie Louise die Luft angehalten hatte, als diese Putzfrau sie ansprach. Wie er diesen plötzlichen Drang in sich spürte, dieser Frau den Lappen in ihr blödes Maul zu stopfen.
Sie hatte ihn angesehen, als sei er ein Rüpel. Himmel!
In der Wohnung gab er für Elvis Katzenfutter in eine Schüssel und stopfte die Sachen, um die Louise ihn gebeten hatte, in eine Plastiktüte: ein sauberes T-Shirt, einen BH und Schlüpfer, eine Haarbürste und ein paar Make-upUtensilien. Auf dem Weg aus dem Schlafzimmer blieb er an der Tür stehen. Er musste sich kurz an die Wand lehnen, bevor er zurück ins Wohnzimmer ging. Er ließ sich auf das Sofa fallen und starrte, die Plastiktasche auf dem Schoß, vor sich hin.
Es war kalt in der Wohnung. Die dritte Septemberwoche, und man musste schon heizen. Dann wurde es wieder Zeit, sich wegen des Thermostaten zu streiten. Thorne drehte ihn hoch, und Louise drehte ihn wieder zurück, wenn sie glaubte, er sehe nicht hin. Heimliches Verstellen des Timers. Ständiges Herumfummeln an den Heizkörpern.
Diese albernen Sitcom-Spielchen, die Thorne so liebte, trotz der Sticheleien.
Sie hatten darüber gestritten — und als Louise schwanger wurde, eher mehr —, wo sie in Zukunft wohnen würden. Obwohl sie die meiste Zeit in Thornes Wohnung verbrachten, hatte Louise noch ihre Wohnung in Pimlico. Sie wollte sie nicht wirklich verkaufen oder wehrte sich zumindest gegen sämtliche Vorschläge, die in diese Richtung gingen. Sie hatten zwar vor, unbedingt zusammenziehen, aber sie konnten sich nicht einigen, welche Wohnung sie verkaufen sollten. Sie hatten deshalb auch schon erwogen, beide Wohnungen zu verkaufen und anschließend gemeinsam eine neue zu kaufen oder vielleicht auch nur ein Appartement zum Vermieten.
Thornes Augen blieben am Kamin hängen, und er fragte sich, ob sich das alles fürs Erste erledigt hatte. Ob eine Reihe dieser Themen, über die sie sich mehr oder weniger ernsthaft den Kopf zerbrochen hatten, nun stillschweigend ad acta gelegt und nie mehr erwähnt würden.
Weiter rauszuziehen.
Zu heiraten.
Sich eine andere Arbeit zu suchen.
Thorne stand auf, holte das Telefon, das auf dem Tisch neben der Tür lag, und trug es zurück zur Couch.
Diese Gespräche waren hypothetischer Natur gewesen. Vor allem die Sache mit der Hochzeit und dem Job. Nur leeres Gerede, das war alles. So wie das Geplänkel über bescheuerte Kindernamen und dass sie keine rothaarigen Kinder wollten.
»Was hältst du von Damien!«
»Eher nicht.«
»Hieß der in dem Film nicht ›Thorne‹!«
»Ohne ›e‹ am Schluss. Und wer sagt außerdem, dass er ein ›Thorne‹ wird! Warum soll er kein ›Porter‹ werden! Und wenn wir schon dabei sind, wer sagt, dass es ein ›er‹ wird!«
Thorne stach auf die Telefontasten ein. Er hatte sich vor zwei Stunden nur kurz abgemeldet und musste jetzt Bescheid geben, dass er erst im Laufe des nächsten Tages wiederkäme. Am liebsten hätte er einfach nur eine Nachricht hinterlassen, aber er wurde direkt zu Detective Sergeant Samir Karim in der Einsatzzentrale durchgestellt.
»Sie verfügen ja über hellseherische Fähigkeiten.«
»Wie bitte?«
»Der DCI ist gerade dabei, Ihnen eine Nachricht auf Ihrem Handy zu hinterlassen.«
Thorne griff in die Jackentasche. Er hatte das Handy im Krankenhaus abgestellt und vergessen, es wieder einzuschalten. Bis das Display zum Leben erwachte und das Geklingel anzeigte, dass er eine Nachricht erhalten hatte, sprach Detective Chief Inspector Russell Brigstocke bereits auf der Festleitung.
»Gutes Timing, mein Freund. Oder schlechtes.«
»Was?«
»Wir haben gerade was reinbekommen.« Brigstocke nahm einen Schluck Tee oder Kaffee. »Klingt nicht schön.«
Thorne fluchte leise, aber nicht leise genug.
»Hören Sie, ich wollte den Fall ohnehin Kitson geben.«
»Sie hatten recht«, sagte Thorne. »Schlechtes Timing.«
»Wenn Sie ihn wollen, gehört er Ihnen.«
Thorne dachte an Louise und an die Frau, die ihnen geraten hatte, es langsam anzugehen. Yvonne Kitson war absolut in der Lage, einen neuen Fall zu bearbeiten, und er war arbeitstechnisch ohnehin ausgelastet. Doch er war bereits aufgesprungen, um einen Stift und einen Zettel zu holen.
Elvis strich ihm um die Beine, während Thorne sich ein paar Notizen machte. Brigstocke hatte recht, es war wahrlich kein schöner Fall, aber Thorne war nicht übermäßig überrascht. Sie schanzten ihm meistens die weniger schönen Fälle zu.
»Der Ehemann?«, fragte Thorne. »Der Freund?«
»Der Ehemann fand die Leiche. Er rief die Polizei an, bevor er auf die Straße rannte und die Leute zusammenschrie.«
»Er rief zuerst an?«
»Richtig. Und drehte dann durch, heißt es. Hämmerte an die Türen und erklärte allen, sie sei tot, brüllte was von Blut und von Flaschen, was die guten Menschen in Finchley mit Sicherheit nicht gewohnt waren.«
»Finchley ist einfach«, sagte Thorne.
»Stimmt, praktisch um die Ecke für Sie.«
Acht oder neun Kilometer nördlich von Kentish Town. Das Whittington Hospital lag mehr oder weniger auf dem Weg. »Ich muss unterwegs noch kurz was erledigen«, sagte Thorne. »Aber in einer halben Stunde müsste ich dort sein.«
»Es eilt nicht. Die kann Ihnen nicht davonlaufen.«
Thorne brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass Brigstocke über die tote Frau sprach und nicht über Louise Porter.
»Geben Sie mir die Adresse.«
Zweites Kapitel
Es war eine ruhige Straße, rechts ab von der Hauptstraße und noch ein paarmal abbiegen. Reihenhäuser aus den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts. Viele davon waren, wie auch das Haus Nummer 48, in Wohnungen aufgeteilt. Jetzt war das Haus selbst von seinen Nachbarn abgetrennt: eine Abdeckplane hin zur Seitenstraße, in jeder Ecke des Vorgartens war ein Polizist postiert, und über den Blumenbeeten flatterte ein Absperrband.
Thorne kam kurz vor acht an, eine Stunde nach Anbruch der Dunkelheit. In der Küche unten war es hell genug, die Lichtkegel der Scheinwerfer ließen jede Staubflocke, jeden Hauch von Fingerabdruckpulver aufleuchten, sie prallten von den blauen Stühlen der CSI ab und tauchten den Linoleumboden in helles Licht. Retrodesign. Simples schwarzweißes Schachbrettmuster, in dem nur die Blutlachen störten. Und die Leiche, von der sie stammten.
»Ich denke, ich kann sie jetzt umdrehen«, sagte Phil Hendricks.
In einer Ecke schabte eine Frau von der Spurensicherung an einem Küchenschrank. Sie sah kaum auf. »Das wäre dann eine Premiere.«
Hendricks grinste und zeigte ihr den Mittelfinger. Er blickte sich um und fragte Thorne, ob er näher herankommen und sich ein Plätzchen suchen wolle, von dem aus er einen besseren Blick habe.
Das mit dem besseren Blick bezweifelte Thorne. Aber er ging hinüber und quetschte sich zwischen die Fotografen und Kameraleute und die zwei CSI-Mitarbeiter, die sich darauf vorbereiteten, Hendricks zur Hand zu gehen. Seine Sanftheit mit dem notwendigen Maß an Muskelkraft zu unterstützen.
»Okay, immer schön sachte.«
Die Frau lag mit dem Gesicht nach unten, die Arme an der Seite. Ihre Bluse war nach oben gezogen worden, vielleicht auch nur gerutscht, und gab den Blick frei auf lila Flecken an der Hüfte, wo die Totenstarre bereits einsetzte. Sie trug noch immer den BH.
»Immerhin«, meinte eine der CSI-Frauen im Vorbeigehen.
Thorne löste den Blick von der Toten und sah zu dem einzigen Fenster. Auf dem Abtropfregal neben der Spüle standen Tassen und Teller. Am Geschirrspüler blinkte ein Lämpchen, um mitzuteilen, dass der Spülgang beendet ist.
Noch immer ein Hauch von Normalität.
Wenn sie den Täter nicht in den ersten Tagen fassten, wollte er noch einmal hierherkommen. Es half ihm, Zeit dort zu verbringen, wo ein Opfer gelebt hatte, vor allem, wenn es auch der Ort war, an dem es gestorben war. Aber das musste warten, bis er nicht mehr um die Leute von der Spurensicherung herumzutanzen und sich zwischen deren deprimierenden Paraphernalia zurechtzufinden brauchte.
Und bis dieser Geruch verflogen war.
Er erinnerte sich an einen Film, in dem der Cop in den Häusern herumstand, in denen die Leute umgebracht worden waren, und sich mit dem Mörder unterhielt. Hast du sie hier umgebracht, du Dreckskerl! Hast du sie von hier aus beobachtet!
Die ganze Scheiße ...
Thorne ging es darum, etwas über die Opfer zu erfahren. Er wollte nicht nur wissen, was sie zuletzt gegessen hatten und wie viel ihre Leber zum Todeszeitpunkt gewogen hatte. Meistens reichte ihm ein einfaches, albernes Detail. Ein Bild im Schlafzimmer. Die Kekse im Küchenschrank oder das Buch, das sie nie zu Ende lesen würden. Und was das betraf, was im Kopf des Mörders vorging — Thorne reichte es vollkommen, ihn zu fassen.
Jetzt sah er zu, was von Emily Walker geblieben war, als sie umgedreht wurde. Die Hand rutschte über das Bein, als dieses angehoben und in einer langsamen, sanften Bewegung gedreht wurde. Die Haare, die nicht blutverklebt waren, glitten ihr aus dem Gesicht, als man sie auf den Rücken legte.
»Das wär’s, Freunde.«
Hendricks arbeitete mit einem guten Team. Darauf bestand er. Besonders ein CSI war Thorne im Gedächtnis geblieben, aus der Zeit, als sie noch mit der Bezeichnung Spurensicherer zufrieden waren, der den teilweise bereits verwesten Leichnam eines alten Mannes behandelte, als habe er es mit einem Sack Kartoffeln zu tun. Er hatte gesehen, wie Hendricks zu dem Mann sprang und ihm seinen tätowierten Unterarm gegen den Hals drückte, sodass der Ärmste hilflos an der Wand klebte. Thorne konnte sich nicht erinnern, die beiden jemals wieder zusammen an einem Tatort gesehen zu haben.
Die Polizeifotografen traten vor und begannen ihre Arbeit. Als sie fertig waren, sprach Hendricks ein paar einleitende Worte in sein Diktiergerät.
»Wie lange noch, Phil?«, fragte Thorne.
Hendricks hob einen Arm der Toten und bog die zu einer festen Faust geschlossenen Finger auf. »Eineinhalb Stunden.« Der träge Manchesterakzent war unüberhörbar. »Können auch zwei werden.«
Thorne sah auf die Uhr. »Okay.«
»Hast du was vor?«
Thorne legte sich ins Zeug, die richtige Miene aufzusetzen, verschwörerisch und hintertrieben zugleich, war sich aber nicht sicher, ob ihm das gelungen war. Er blickte sich nach Detective Sergeant David Holland um.
»Sie hält was in der Hand«, sagte Hendricks.
Thorne wandte sich wieder Hendricks zu und bückte sich, um genauer zu sehen, wie Hendricks mit einer Pinzette zu Werke ging und etwas aus der Faust des Opfers barg. Anscheinend ein kleines, quadratisches Plastik- oder Zelluloidplättchen, dunkel und papierdünn. Hendricks ließ es in die Asservatentüte plumpsen und hob es gegen das Licht.
»Ein Stück Film?«, fragte Thorne.
»Könnte sein.«
Sie starrten noch etwas länger auf den Inhalt der Tüte, aber ihnen war beiden klar, bis das forensische Labor damit durch war, konnten sie nur raten. Hendricks gab dem Verantwortlichen für die Beweissicherung die Tüte, um sie aufzulisten und zu beschriften, und wickelte behutsam Plastikfolie um die Hände des Opfers, bevor er sich dem Oberkörper zuwandte.
Thorne schloss kurz die Augen und atmete tief durch. »Kannst du dir vorstellen, dass ich eine Wahl hatte?«
Hendricks sah zu ihm hoch. Er kniete hinter dem Kopf des Opfers, den er nun hochhob und auf seine Beine legte.
»Brigstocke ließ mir die Wahl.«
»Umso blöder, Mann.«
»Ich hätte den Fall Kitson überlassen können.«
»Der Fall hier ist wie für dich geschaffen«, sagte Hendricks.
»Warum?«
»Schau sie dir an, Tom.«
Emily Walker war Anfang dreißig ... gewesen, dunkle Haare, darunter bereits die ersten grauen, ein kleines Sterntattoo über einem Knöchel. Sie war nur einen Meter sechzig groß, wodurch die paar zusätzlichen Kilos noch mehr auffielen, die sie nach dem Magneten am Kühlschrank — BIST DU DIR SICHER, DASS DU HUNGER HAST? — loswerden wollte. Um den Hals trug sie eine schmale Kette aus braunen Perlen und um ein Handgelenk ein Bettelarmband: ein Würfel, ein Schloss, ein Paar Fische. Bekleidet war sie mit einem Jeanshemd und einem dünnen Baumwollrock, der genauso briefkastenrot war wie ihre Zehennägel.
Thorne sah hinüber zu der Sandale beim Kühlschrank, um die ein Kreis auf das Linoleum gemalt war. Auf die dekorative Flasche, in der, wie’s aussah, Balsamico war und an deren Außenseite Blut und Haare klebten. Und an der Flasche vorbei auf das Lämpchen an der Geschirrspülmaschine, das noch immer blinkte. Er strich über die Narbe an seinem Kinn und starrte unverwandt auf das Lämpchen, bis es vor seinen Augen verschwamm. Dann wandte er sich um und ließ Hendricks zurück, der Emily Walkers Kopf in den Händen hielt, während er leise in sein Diktafon sprach.
»Die Plastiktüte um den Kopf des Opfers ist nicht fixiert. Daraus folgt, dass der Täter die Tüte mit den Händen festhielt. Nach den Blutergüssen am Hals des Opfers zu schließen, hielt er die Tüte unter großem Kraftaufwand fest, bis das Opfer zu atmen aufhörte.«
Holland stand draußen auf der Terrasse hinter dem Haus und sah einer Handvoll Polizisten beim Durchkämmen der Blumenbeete zu. Es waren zwar auch Scheinwerfer aufgebaut, trotzdem war dies hier nur eine erste Suche. Sobald es hell war, würden mehr Polizisten anrücken und alles mit der Lupe absuchen.
»Also keine Einbruchspuren«, sagte Thorne.
»Was bedeutet, dass sie ihn kannte.«
»Möglich.« Holland roch nach Zigaretten, und eine Sekunde oder zwei hätte Thorne am liebsten selbst eine geraucht. »Oder sie öffnete die Tür, er zog eine Waffe und zwang sie, ins Haus zu gehen.«
Holland nickte. »Schauen wir mal, ob wir mit der Hauszu-Haus-Befragung Glück haben. Sieht mir ganz nach der Art von Straße aus, wo die Leute viel hinterm Vorhang stehen.«
»Was ist mit dem Ehemann?«
»Ich hab ihn nur fünf Minuten gesehen, bevor sie ihn in ein Hotel brachten«, sagte Holland. »Am Boden zerstört, kann man sich vorstellen.«
»Etwas dick aufgetragen, finden Sie?«
»Wie meinen Sie das?«
»Klingt fast so, als wollte er, dass jeder in der Straße mitkriegt, wie sehr ihn das mitnimmt. Nachdem er uns angerufen hatte.«
»Haben Sie das Notrufband abgehört?«
»Nein.« Thorne zuckte die Achseln.
»Also nur Wunschdenken? Richtig?«
»Ja, vielleicht.« Es wurde etwas kühler. Thorne schob die Hände in den Plastikoverall und in die Taschen seiner Lederjacke. »Wär schön, wenn es einfach wäre.«
»Seh ich irgendwie nicht.«
Thorne ebenso wenig, wenn er ehrlich war. Er wusste nur zu gut, wie leicht häusliche Gewalt außer Kontrolle geraten konnte, hatte schon zu oft erlebt, wie ein eifersüchtiger Liebhaber oder ein tyrannischer Ehemann durchdrehte. Er blinzelte, sah den Arm zur Seite fallen, als die Leiche umgedreht wurde. Briefkastenrote Flecken auf schwarz-weißem Schachbrettmuster. Das war nicht einfach ...
»Vielleicht ist er einfach nur völlig durchgedreht?«, sagte Holland. »Wie viele solcher Fälle hatten wir schon?«
Thorne blies die Backen auf. Diese Frage musste er nicht wirklich beantworten.
»Genau. Und ich kann mir noch immer nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Nicht mal annähernd.«
Holland war fünfzehn Jahre jünger als Thorne. Seit mehr als siebzehn Jahren arbeiteten sie Seite an Seite, und auch wenn er nicht mehr der rotwangige Anfänger von damals war, freute sich Thorne über das Aufblitzen eines von diesem Job unverdorbenen Charakters. Früher mal hatte Holland zu ihm aufgesehen, hatte ein Polizist werden wollen wie er, das war Thorne klar. Ihm war auch klar, dass Holland anders reagierte als er, wenn es darauf ankam, und dass er dafür dankbar sein sollte.
»Vor allem bei einer Frau«, sagte Holland. »Wissen Sie, ich seh die Männer und Freunde und Väter, seh, wie sie das trifft. Und es spielt keine Rolle, ob sie hysterisch oder wütend sind oder einfach nur dasitzen wie Zombies. Ich hab null Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht.«
»Bleiben Sie dran, Dave«, sagte Thorne.
Beide sahen zum anderen Ende des Gartens, wo Lachen zu hören war. Einer der Beamten war anscheinend in etwas getreten, was er nun im Rasen abzustreifen versuchte.
»Und wo haben Sie vorher noch vorbeigeschaut?«, wollte Holland wissen.
»Wie bitte?«
»Als das hier über uns hereinbrach.«
Thorne räusperte sich.
Louise war einverstanden gewesen, dass er den Fall übernahm, als er im Krankenhaus vorbeigefahren war und ihr ihre Sachen gebracht hatte. Sie lag bereits im Bett und arbeitete sich gerade durch ein Magazin, heat, wobei sie sich bemühte, das ununterbrochene Geschnatter der Frau im Bett gegenüber auszublenden. Er fragte sie, ob sie sich sicher sei. Woraufhin sie ihn nur ansah, als sei er nicht ganz dicht im Kopf, und ihn fragte, warum sie das nicht sein sollte. Er bat sie, ihn anzurufen, wenn sie etwas brauche oder ihn brauche. Sie meinte, er solle sich nicht unnötig aufregen und sie könne sich ein Taxi rufen, wenn alles vorüber sei und sie nach Hause wolle.
»Beim Zahnarzt« sagte Thorne. »Eine Stunde bei dieser Nazi-Schergin von Zahnhygienikerin. Wie aus dem Marathon- Mann«.
Holland lachte. »Ist es sicher!«
»Ich sag’s Ihnen.«
»Es gibt ein Remake von dem Film, wissen Sie das.« Holland sah zu Thorne, ob dieser anbeißt. »Aber sie mussten ihn Snickers-Mann nennen, weil die Marathon-Riegel-Hersteller sonst geklagt hätten.« Wieder lachte er, vor allem da er sah, wie Thorne sich bemühte, nicht zu lachen.
»Haben Sie Sophie schon gesagt, dass Sie wieder rauchen?«, fragte Thorne.
Holland schüttelte den Kopf. »Mein Handschuhfach ist bis oben hin vollgestopft mit extrastarken Pfefferminzbonbons.« Er beugte sich vor und spuckte in den Gully. »Eigentlich blöd, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie Bescheid weiß. Wahrscheinlich will sie nur nicht streiten.«
Holland und seine Freundin waren auch so ein Paar, das mit dem Gedanken spielte, aus London hinauszuziehen, und damit, ob Holland sich einen anderen Job suchen sollte. Thorne fragte sich, ob das auch zu den Themen gehörte, die die beiden nicht ansprachen, um einen Streit zu vermeiden. Er war immer der Meinung gewesen, Holland solle bleiben, wo er war, aber er hätte das nie und nimmer gesagt. Hätte Sophie Wind davon bekommen, wie Thorne darüber dachte, hätte sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Gegenteil zu erreichen.
Also hielt er die Klappe und freute sich, dass Holland noch immer hier war.
»Die offizielle Identifizierung machen wir gleich morgen früh«, sagte Thorne. »Und dann unterhalten wir uns mit dem Ehemann.«
»Okay.«
»Man weiß nie, vielleicht haben wir ja Glück.«
Holland stieß die Luft aus und deutete mit einem Nicken hinüber zu dem Polizisten, der noch immer mit der Scheiße an seiner Schuhsohle beschäftigt war. »Die Art von Glück.«
Sie sahen beide auf, als nicht allzu hoch über ihren Köpfen ein blinkendes Flugzeug hinwegdonnerte. War wohl auf dem Weg nach Luton. Thorne sah ihm zu, wie es rasch den blauen Himmel querte, und schluckte schwer. Vor acht Wochen waren er und Louise nach Griechenland geflogen, ihr erster gemeinsamer Urlaub als Paar. Die meiste Zeit hatten sie nur faul am Pool gelegen und hatten Schund gelesen und die kulturellen Anstrengungen darauf beschränkt, herauszufinden, wie man in der Taverne am Ort Bier und Tintenfisch vom Grill bestellt. Sie hatten sich beide bemüht, nicht über die Arbeit zu reden, und hatten viel gelacht. Als Louise ihm die Schultern einrieb, da er sich einen Sonnenbrand geholt hatte, sagte sie: »Das ist das Äußerste an nicht-intimem Körperkontakt, was du von mir zu erwarten hast, klar? Ich drücke anderen Menschen keine Pickel aus und werde dir auch nicht den Hintern wischen, wenn du dir beide Arme brichst.«
Den Schwangerschaftstest hatte sie an ihrem letzten Tag dort gekauft und durchgeführt, bevor sie abends zum Essen gingen.
Thorne saß im Auto, als Hendricks herauskam.
Er hatte nachgesehen, ob er einen Anruf bekommen hatte, und es in beiden Wohnungen versucht, aber Louise hatte noch nicht zurückgerufen, und es gab auch keine Nachricht. Eine Weile hatte er Radio gehört und es dann noch einmal versucht, vergeblich. Louises Handy war ausgeschaltet, und er nahm an, dass es inzwischen zu spät war, um im Krankenhaus anzurufen.
Hendricks ging zum Beifahrersitz und stieg ein. Er hatte den Schutzoverall ausgezogen und trug nun die schwarze Jeans und den hautengen Pulli über dem weißen T-Shirt. »Sind gerade fertig geworden«, sagte er.
Thorne gab nur ein Brummen von sich.
»Alles okay mit dir?«
»Tut mir leid ... ja.« Thorne drehte sich zu ihm, nickte und lächelte.
Am Halsausschnitt war etwas rote und blaue Tinte zu erkennen, aber der Großteil von Phil Hendricks’ Tattoos war verborgen. Zur großen Erleichterung seiner Vorgesetzten waren auch seine Piercings größtenteils verborgen. Thorne war dankbar, dass ihm die Details erspart geblieben waren, aber er wusste, einige davon waren zu Ehren eines neuen Freundes gemacht worden, für jede Eroberung ein Piercing. Das letzte Piercing war schon älter.
Hendricks sah nicht gerade so aus, wie sich die Leute einen Rechtsmediziner vorstellen, aber er war der Beste, mit dem Thorne je gearbeitet hatte, und noch immer sein engster Freund.
»Hast du Lust auf ein Bier?«, fragte Thorne.
»Was ist mit Louise?«
»Kein Problem.«
»Nein, ich mein, wird sie nicht eifersüchtig?« Hendricks grinste.
»Das machen wir wieder gut.« In Wahrheit war es Thorne, den die Eifersucht plagte. Er und Louise waren nun beinahe eineinhalb Jahre zusammen. Sie hatten sich kennengelernt, als Thorne abgestellt worden war, um bei einer Kidnapping-Ermittlung auszuhelfen, an der sie arbeitete. Aber sie hatte nur ein paar Wochen gebraucht, um eine engere Beziehung zu Phil Hendricks aufzubauen, als Thorne es in zehn Jahren gelungen war. Es gab Zeiten, vor allem anfangs, die ziemlich enervierend waren, in denen ihm ihre Freundschaft ganz und gar nicht recht war.
An einem Abend, als sie zu dritt unterwegs waren, hatte Thorne zu viel getrunken und Louise Schwulenmutti genannt. Sie und Phil hatten gelacht, und Phil hatte gemeint, wie ironisch das sei, schließlich führe sich Thorne wie eine alte Queen auf.
»Ja, okay«, sagte Hendricks. Er sah zum Haus, aus dem die Polizisten in Zweier- und Dreiergrüppchen herauskamen. »Andererseits steck ich morgen früh bis zu den Ellbogen in der Ärmsten. Da belasse ich es lieber bei einem Glas.«
»Also das tu ich mit Sicherheit nicht«, sagte Thorne. »Dann gehen wir in ein Pub bei mir um die Ecke. Ich nehm dich mit.«
Hendricks nickte, ließ den Kopf nach hinten sinken und schloss die Augen. Thorne gab es auf, weiter nach ordentlicher Countrymusik zu suchen, und begnügte sich mit dem soften Pop von Magic FM. Es war fast zehn Uhr, und Iocc lieferte eine Stunde lang ununterbrochen easy listening mit Oldies.
»Er hat seine eigene Tüte mitgebracht«, sagte Hendricks. »Was?«
»Die Tüte, mit der er sie erstickt hat. Er wusste, was er tat. Man kann sich nicht einfach in der Küche irgendeine Supermarkttüte schnappen — die sind Zeitverschwendung. Die meisten haben Löcher, damit das Gemüse nicht schwitzt oder weiß der Geier. Man braucht natürlich was Luftdichtes und Stabiles, damit das Opfer es nicht zerreißt, falls es sich um eine Frau mit langen Fingernägeln handelt.« Hendricks klopfte den Takt auf dem Armaturenbrett mit. »Dazu kommt, dass man mit so einer guten, durchsichtigen Polyäthylentüte das Gesicht des Opfers sieht. Das ist wahrscheinlich wichtig.«
»Also war das geplant.«
»Er war vorbereitet.«
»Aber die Essigflasche hat er nicht mitgebracht.«
»Nein, der Teil war wohl improvisiert. Das erste Stück, dessen er habhaft wurde, um sie niederzuschlagen.«
»Sobald sie am Boden liegt, holt er die Tüte raus.«
Hendricks nickte. »Gut möglich, dass er sie hart genug traf, um die Sache zu Ende zu bringen, bevor er sie ersticken konnte.«
»Hoffen wir mal, dass es so war.«
»Ich würde nicht darauf setzen«, sagte Hendricks. »Wenn du mich fragst, schlug er sie nur mit der Flasche nieder, damit sie sich nicht mehr zu sehr zur Wehr setzt. Wie gesagt, ich glaube, er wollte sehen, wie sie erstickt.«
»Mein Gott.«
»Morgen weiß ich mehr.«
Die Fenster beschlugen, und Thorne schaltete das Gebläse ein. Sie hörten ein paar Minuten den Nachrichten zu, was auch nicht gerade aufmunternd war, der Sportbericht danach war eher uninteressant. Die Fußballsaison war erst vor einem Monat losgegangen, und da ihre Teams nicht gespielt hatten, waren die Ergebnisse nicht sonderlich relevant.
»Sechs Wochen, dann machen wir euch wieder fertig«, sagte Hendricks. Er war überzeugter Gunner und war noch immer hin und weg von Arsenals Siegen über die Spurs im Hinund Rückspiel beim Nordlondonderby der letzten Saison.
»Gut ...«
Hendricks lachte und sprach über etwas anderes, aber Thorne hörte ihm nicht mehr zu. Er war mit dem Display seines Handys beschäftigt, drückte sich durch das Menü, um sicherzugehen, dass er keine Nachricht verpasst hatte.
»Tom?«
Dass er ein Netz hatte.
»Tom? Alles okay, Kumpel?«
Thorne legte das Handy weg und wandte sich zu Hendricks.
»Ist alles in Ordnung mit Louise?« Hendricks wartete und entdeckte etwas in Thornes Miene. »Scheiße, ist was mit dem Baby?«
»Was? Woher weißt du ...?« Thorne presste sich abrupt gegen die Rückenlehne und starrte geradeaus. Er und Louise hatten vereinbart, in den ersten drei Monaten niemandem von der Schwangerschaft zu erzählen. Eine gute Freundin von ihr hatte ihr Baby früh verloren.
»Jetzt sei nicht sauer«, sagte Hendricks. »Ich hab’s aus ihr herausgepresst.«
»Klar doch.«
»Um ehrlich zu sein, ich glaube, sie war ganz heiß darauf, es loszuwerden.« Hendricks suchte in Thornes Gesicht nach einem ersten Anzeichen von Sanftmut, konnte aber keines entdecken. »Jetzt komm schon, wem hätte sie es denn sonst sagen sollen?«
Thorne sah zu ihm und stieß hervor: »Keine Ahnung, ihrer Mutter?«
»Na ja, vielleicht hat sie es der auch gesagt.«
»Scheiße noch mal.«
»Aber sonst niemandem, soviel ich weiß.«
Thorne beugte sich vor und schaltete das Radio aus. »Das war der Grund, warum wir es niemandem sagen wollten. Für den Fall, dass genau das passiert.«
»Scheiße«, sagte Hendricks. »Spuck es schon aus.«
Als Thorne fertig war, erklärte ihm Hendricks, dass so etwas meist nicht grundlos passierte und dass es besser jetzt als später passierte. Thorne fiel ihm ins Wort, das habe er bereits von der Frau gehört, die den Ultraschall gemacht hatte, und es habe ihm schon da nicht sonderlich geholfen.
Als Thorne Hendricks’ Gesicht sah, entschuldigte er sich. »Ich hab einfach nicht gewusst, was ich zu ihr sagen soll, verstehst du?«
»Da gibt es nicht viel, was du hättest sagen können.«
»Braucht wahrscheinlich Zeit«, meinte Thorne.
»Sag ihr, sie kann mich, wann immer sie will, anrufen. Wenn sie darüber reden will, weißt schon.«
Thorne nickte. »Das macht sie bestimmt.«
»Das gilt auch für dich.« Er wartete, bis Thorne zu ihm sah. »Klar?«
Eine Minute saßen sie schweigend da. Vor dem Haus war noch immer jede Menge los — alle paar Minuten traf ein Fahrzeug ein oder fuhr eines ab. Trotz der Bemühungen der Polizei, die Schaulustigen nach Hause zu schicken, drängte sich eine Handvoll auf der anderen Straßenseite.
Thorne stieß ein hohles Lachen aus und schlug mit der Hand auf das Lenkrad. »Ich hab Lou gesagt, dass ich den hier verkaufe«, sagte er.
»Deinen geliebten BMW?«, sagte Hendricks. »Verdammte Scheiße, das ist aber ein Zugeständnis.«
Thornes gelber BMW Baujahr 1971 war seit längerer Zeit ein Quell großer Freude für seine Kollegen. Thorne nannte ihn »vintage«. Dave Holland meinte, das sei nur ein Euphemismus für »kaputte alte Rostlaube«.
»Ich hab versprochen, was Praktischeres zu kaufen«, sagte Thorne. Er zupfte an seinem Jackenkragen. »Einen Familienwagen, weißt du.«
Hendricks grinste. »Du solltest ihn so oder so abstoßen.«
»Mal sehen.«
Hendricks deutete auf die Haustür, auf den Metallwagen, der darin auftauchte und die Stufen heruntergehoben wurde. »Auf geht’s ...«
Sie stiegen aus dem Auto und schlenderten zum Leichenwagen. Hendricks sprach leise mit einem der Mitarbeiter über den Plan für den nächsten Vormittag. Thorne sah zu, wie der Wagen auf seinen ausziehbaren Beinen hochgefahren und der schwarze Leichensack langsam in den Wagen geladen wurde.
Emily Walker.
Thorne sah hinüber zu den Schaulustigen: ein Teenager mit einer Basketballmütze, der von einem Bein aufs andere trat; eine alte Frau, die mit offenem Mund alles beobachtete.
Nicht lebensfähig.
Drittes Kapitel
Louise rief kurz nach acht Uhr aus einer Telefonzelle im Whittington an, gerade als er die Wohnung verließ. Thorne plagten leichte Schuldgefühle, weil er so gut geschlafen hatte. Er brauchte sie gar nicht zu fragen, wie sie ihre Nacht verbracht hatte.
Sie klang eher wütend als mitgenommen. »Sie haben es noch nicht gemacht.«
»Was!« Thorne ließ seine Tasche fallen und ging zurück ins Wohnzimmer, als suche er etwas, an dem er seine Wut auslassen konnte.
»Beim ersten Termin gab es irgendein Durcheinander, und dann meinten sie, sie würden es spät am Abend machen und es lohne sich nicht, nach Hause zu fahren.«
»Und wann ist es jetzt?«
»Jeden Augenblick.« Lautes Gebrüll war zu hören. Sie senkte die Stimme. »Ich möchte es einfach hinter mir haben.«
»Ich weiß«, sagte Thorne.
»Außerdem hab ich einen Wahnsinnshunger.«
»Ich kann dir ja erzählen, was ich heute Vormittag mache, wenn du willst. Das sollte deinen Appetit für eine Weile dämpfen.«
»Sorry, ich wollte dich schon noch danach fragen«, sagte Louise. »War es übel?«
Thorne erzählte ihr alles über Emily Walker. Als Detective Inspector bei der Kidnap Investigation Unit, der Abteilung für Entführungen, war Louise Porter schwer zu schockieren. Manchmal unterhielt sie sich mit Thorne über Mord und die Bedrohung, eines gewaltsamen Todes zu sterben, so leichthin, wie andere Paare über einen schweren Tag im Büro sprachen. Aber es gab Dinge, die mit ihrem Job zu tun hatten, die sie beide nicht nach Hause bringen wollten. Sicher, selbst die schlimmste Geschichte hatte ihre komischen Momente für Menschen mit Sinn für schwarzen Humor, aber die wirklich düsteren Details ersparten sie einander.
In diesem Fall hielt Thorne sich nicht zurück.
Als er fertig war, meinte Louise: »Ich weiß, was du machst, und das wäre wirklich nicht nötig.«
»Was wäre nicht nötig?«, fragte Thorne.
»Mich daran zu erinnern, dass es Leute gibt, die übler dran sind als ich.«
Zwei Stunden später griff Thorne so unauffällig wie möglich nach dem Handy in seiner Tasche, um zu checken, ob es auf STUMM geschaltet war.
»Wir sind so weit, denke ich.«
Es gibt Zeiten, da will man nicht wirklich, dass das Handy klingelt.
Phils Assistent zog das Tuch zurück und bat Emily Walkers Mann vorzutreten.
»Können Sie diese Leiche als Ihre Frau, Emily Walker, identifizieren?«
Der Mann nickte und wandte sich ab.
»Könnten Sie das bitte laut sagen?«
»Ja. Das ist meine Frau.«
»Danke.«
Der Mann war bereits an der Tür und wartete darauf, hinausgelassen zu werden. Es war üblich, die Verwandten nach der offiziellen Identifizierung zu fragen, ob sie noch etwas Zeit mit dem Verstorbenen verbringen möchten. Offensichtlich erübrigte sich das in diesem Fall. Ein Gesicht konnte genauso durch Ersticken übel zugerichtet werden wie durch einen stumpfen Gegenstand. Man konnte es George Walker nicht vorwerfen, dass er seine Frau lieber so in Erinnerung behielt, wie sie lebend ausgesehen hatte. Vorausgesetzt natürlich, dass nicht er für ihren Tod verantwortlich war.
Thorne sah Walker nach, der von zwei Polizisten den Gang entlanggeführt wurde — einem Mann und einer Frau. Beim Anblick der hängenden Schultern und der Polizistin, die den Arm um ihn legte, dachte er daran, was Holland gestern gesagt hatte: »Ich hab null Ahnung, was in ihrem Kopf vorgeht ...«
Wie aufs Stichwort bog Dave Holland um die Ecke. Für jemanden, der gleich einer Autopsie beiwohnen würde, wirkte er erstaunlich munter. Er trat zu Thorne, als Walker langsam die Stufen zur Straße hinunterging.
»Ich weiß, Sie wollten sich später mit ihm unterhalten«, sagte Holland. »Aber ich denke, das kann noch etwas warten.«
»Ach ja?«
»Er ist noch immer völlig fertig, und wir sollten ihm wirklich etwas Zeit mit seiner Familie lassen.«
In Momenten wie diesem wünschte sich Thorne, wie Roger Moore eine Augenbraue hochziehen zu können. Er musste sich mit Sarkasmus begnügen. »Ich höre, Sergeant.«
Holland grinste. »Wir sind bei den Vorhangspionen weitergekommen.«
»Raus damit.«
»So ein alter Typ von gegenüber behauptet, er habe etwa eine Stunde, bevor Emilys Mann heimkam jemanden aus dem Haus kommen sehen.«
»Und er ist sich sicher, dass es sich dabei nicht um Emilys Mann handelte?«
»Absolut sicher. Er weiß, wie George Walker aussieht. Der Typ, den er sah, war viel schmaler gebaut, sagte er. Und er hatte auch eine andere Haarfarbe.«
»Haben wir ein digitales Fahndungsbild von ihm?«
Holland nickte. »Wenn Sie mich fragen, ist der Ehemann damit vom Haken.«
»Hab ich aber nicht«, sagte Thorne. »Ist aber ein Punkt. Wir holen ihn uns morgen.«
Eine Tür in der Mitte des Flurs ging auf, und ein vertrauter rasierter Kopf erschien. »Alles zu seiner Zeit«, meldete sich Hendricks zu Wort.
Thorne nickte und lockerte die Krawatte, die er für die Identifizierung umgebunden hatte.
Holland wirkte nicht mehr ganz so gut gelaunt, als sie zu der offenen Tür gingen.
Die Raumanordnung war in jeder Leichenhalle anders, aber im Finchley Coroner’s Mortuary trennte ein schmaler Gang den Besucherraum vom Sektionsraum, was erlaubte, eine Leiche schnell und unauffällig von einem Raum in den anderen zu schieben. Von einem bequem möblierten und in tröstlichen Farben gehaltenen Raum in einen weiß gekachelten und mit rostfreiem Stahl ausstaffierten Raum, in dem man Bequemlichkeit und Trost vergeblich suchte.
Sosehr die Leute das dort auch hätten brauchen können.
Hendricks und Holland brachten sich gegenseitig aufs Laufende, denn am Abend zuvor hatten sie für einen Plausch keine Zeit gehabt. Hendricks erkundigte sich nach Hollands Tochter, Chloe, über die er mehr zu wissen schien als Thorne. Was Thorne deprimierend fand. Er hatte nicht gerade den Atem angehalten, als Holland und seine Freundin nach einem Paten suchten, aber es hatte durchaus eine Zeit gegeben, in der er an Geburtstagen und an Weihnachten eine Karte und Geschenke schickte.
Thorne hörte eine Weile zu, wie sich die beiden unterhielten — Holland erzählte Hendricks, wie groß seine Tochter war, obwohl sie erst vier Jahre alt wurde, und Hendricks meinte, was für ein tolles Alter das sei, während er die Schere und den Meißel zurechtlegte —, und es nagte an ihm. Er versuchte, sich an den Geburtstag der Kleinen zu erinnern, als Hendricks Emily Walker auszuziehen begann.
Mitte September?
Während er arbeitete, diktierte Hendricks seinen Befund in das Mikrofon, das über seinem Kopf hing. Holland machte Notizen. Damit würden sie sich begnügen müssen, bis sie den endgültigen Bericht erhielten. Allerdings war das für die Tom Thornes dieser Welt meist mehr als genug, bis und falls die Phil Hendricks’ dieser Welt Gelegenheit hatten, die Einzelheiten vor Gericht auszubreiten.
Die wissenschaftlichen Fakten und das ganze Latein ...
»Eine schwere Platzwunde am Hinterkopf, aber keine Schädelfraktur sowie kein Hinweis auf eine ernsthafte Hirnverletzung ...«
Wenn Thorne sich nicht konzentrieren musste, wenn es nur darum ging, bei den medizinischen Abläufen zuzusehen, die er schon viel zu oft gesehen hatte, versuchte er sich auszuklinken. An den Geruch hatte er sich schon längst gewöhnt — nach Fleisch und unangenehm süßlich —, aber die Geräusche machten ihm noch immer zu schaffen.
»Verletzung der Schild- sowie Krikoidknorpel ... Schwere petechiale Blutungen ... Am Mund des Opfers klebt blutiger Schaum.«
Und so sang Thorne in Gedanken. Hank Williams, Johnny Cash, Willie Nelson, was immer ihm in den Sinn kam. Nur ein-, zweimal den Refrain, um das Kreischen der Knochensäge und das schmatzende Geräusch beim Entfernen von Herz und Lunge aus dem Brustkorb nicht hören zu müssen.
Heute war Ray Price dran: »My shoes keep walking back to you.«
»Kein Anzeichen für eine Schwangerschaft ... Kein Anzeichen für einen Schwangerschaftsabbruch ... Todesursache manuelle Asphyxie.«
Es gibt Leute, die sind übler dran als ich.
Gegen Ende, als die Organe gewogen und die Körperflüssigkeiten gesammelt waren, fragte Thorne nach dem Todeszeitpunkt. Häufig der wichtigste Faktor bei der Suche nach dem Hauptverdächtigen.
»Am späten Nachmittag«, sagte Hendricks. »Soweit ich das jetzt sagen kann.«
»Vor fünf?«, fragte Holland.
»Wahrscheinlich zwischen drei und vier, aber zum jetzigen Zeitpunkt lege ich dafür nicht die Hand ins Feuer.«
»Das passt.« Holland machte sich Notizen. »Der Ehemann gibt an, kurz nach fünf Uhr nach Hause gekommen zu sein.«
»Dann wär er draußen?«
»Niemand ist draußen«, widersprach Thorne.
»Okay.«
Thorne sah Hendricks’ Gesichtsausdruck und Hollands Blick, als dieser sich von seinen Notizen losriss. »Sorry ...«
Er hatte die Schalen aus rostfreiem Stahl gemustert, in denen Emily Walkers wichtigste Organe lagen. Dabei schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass sie jetzt die paar Extrakilo losgeworden war, die ihr zu schaffen gemacht hatten. Sein Blick wanderte zu ihren aufgequollenen, bleichen Füßen, dem roten Nagellack und dem Stern über ihrem Knöchel. Er hatte, ohne es zu wollen, in einem schneidenden Ton gesprochen.
Holland sah zu Hendricks und flüsterte, für Thornes Ohren bestimmt: »Mit dem falschen Fuß aufgestanden.«
Thorne merkte, wie er von Minute zu Minute gereizter wurde. Er versuchte sich zu beruhigen, vergebens. Als er zehn Minuten später mit Holland hinausging, fühlte sich sein Gesicht heiß an, und es fiel es ihm schwer, ruhig zu atmen. Manchmal war er nach einer Autopsie voller Tatendrang, verwirrt und häufig einfach nur deprimiert, aber er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal so verdammt wütend gewesen war.
Auf dem Weg aus dem Sektionsraum schaltete er das Handy wieder ein. Als er durch den Haupteingang auf die Avondale Road trat, sah er, dass Louise ihn dreimal angerufen hatte. Er bat Holland vorauszugehen.
Sie hatte diese Stimme, als ob sie gerade geweint hätte. »Sie haben es noch immer nicht gemacht.«
»Mein Gott, das gibt’s doch nicht!«
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, sagte sie.
Er wandte sich ab, sah hinüber zur North Circular und wich den Blicken eines Pärchens an der Bushaltestelle aus, das ihn brüllen hörte. »Was haben sie denn gesagt?«
»Ich finde niemanden, der mir erklärt, was los ist.«
»Ich bin in fünfzehn Minuten da«, sagte Thorne.
Sie brach in Tränen aus, als sie ihn durch die Tür in die Abteilung stürmen sah. Er beruhigte sie und zog die Vorhänge um das Bett zu, bevor er sich setzte und sie in die Arme nahm.
»Ich will, dass es aus mir draußen ist«, sagte sie. »Verstehst du?«
»Ich weiß.«
Durch die Vorhänge hörten sie die Stimme der Frau aus dem Bett gegenüber. »Ist alles in Ordnung?«
»Alles bestens«, sagte Thorne.
»Soll ich jemanden holen?«
Thorne beugte sich zu Louise. »Ich hole jemanden.«
Fünf Minuten lang lief er durch die Gänge, bis er einen Stock höher einen Arzt fand. Er sagte ihm, dass es so nicht gehe. Nach ein paar Minuten Gebrüll machte er noch immer keine Anstalten, klein beizugeben, während der Arzt ein paar Anrufe erledigte. Dann kam Thorne zurück an Louises Bett — mit einer sanften schottischen Krankenschwester an der Seite, die all die richtigen Laute von sich gab, um dann zuzugeben, dass sie nichts für sie tun könne.
»Das reicht nicht«, sagte Thorne.
»Es tut mir leid, aber das ist die übliche Vorgehensweise hier.«
»Wie bitte?«
»Ihre Partnerin hatte einfach nur Pech, fürchte ich.« Die Krankenschwester sah die Unterlagen durch, die sie mitgenommen hatte. Sie hielt sie Thorne hin. »Die OP wurde angesetzt, aber im letzten Augenblick kam ein dringender Fall rein. Einfach Pech ...«
»Man hat ihr versprochen, sie am Abend noch dranzunehmen«, sagte Thorne. »Dann hieß es, sie käme gleich am Morgen dran.«
Louise hatte die Augen geschlossen. Sie wirkte erschöpft. »Vor zwei Stunden hieß es, ich sei die Nächste.«
»Das ist doch absolut lachhaft«, sagte Thorne.
Die Krankenschwester blätterte erneut in ihren Unterlagen und nickte, als sie die Erklärung fand. »Ja, da kam jemand rein mit einem bösen Armbruch, ich fürchte ...«
»Einem Armbruch!«
Die Krankenschwester sah Thorne an, als handle es sich um die einfachste Sache der Welt. »Er hatte ziemliche Schmerzen.«
Thorne erwiderte den Blick und deutete auf Louise. »Glauben Sie, für sie ist das ein Vergnügen?«
Alex stopfte sich das letzte Stück Toast in den Mund, als Greg in die Küche kam. Er nickte ihr zu, noch damit beschäftigt, sein Hemd in die Hose zu stecken. Sie brummte zurück, winkte kurz und wandte sich wieder dem Artikel im Guardian zu.
»Hoffentlich hast du noch etwas Brot übrig gelassen«, sagte Greg und schaltete den Wasserkocher ein. Er hörte ein weiteres Brummen, als er zum Brotkasten ging, und eine gebrummte Entschuldigung, als er an den Kühlschrank trat. »Okay, als ob du alles gegessen hättest ...« Er durchsuchte den Kühlschrank vergeblich nach einem Joghurt, der am Tag zuvor noch dagewesen war. Kieron, der WG-Bewohner, der Ende letzten Jahres ausgezogen war, hatte die Angewohnheit, den letzten Rest des Gemeineigentums an Brot, Milch oder was auch immer wegzuessen. Und nun entwickelte sich Alex in dieselbe Richtung. Aber Greg war geneigter, seiner Schwester zu vergeben. Außerdem roch das Bad, wenn sie es benutzt hatte, wesentlich angenehmer als bei Kieron.
Als er sich mit einem Toast und seinem Tee endlich zu ihr setzte, schob sie die Zeitung beiseite. »Du gehst früh rein.«
»Zur Zwölfuhrvorlesung«, sagte Greg. »Henry der Scheißzweite. Und das ist nicht wirklich das, was der Rest der Welt als früh bezeichnen würde.«
»Ich finde es früh.«
»Wann bist du nach Hause gekommen?«
»Keine Ahnung«, sagte Alex. »Nicht durchgeknallt spät. Aber ein paar von uns landeten am Schluss in Islington und tranken einige von diesen tödlichen Wodkas.«
»Die anderen tranken sie?«
Alex grinste. »Ist ja okay. Ich hab ein paar getrunken.« Sie stach mit dem Finger in die Luft, als Greg den Kopf schüttelte. »Den großen Bruder kannst du dir schenken. Nicht bei dem, was du manchmal so treibst.«
Greg errötete, was ihn sofort ärgerte, und er ärgerte sich gleich noch mehr, als Alex wissend kicherte. »Schau mal, du bist jetzt erst zwei Wochen hier, das ist alles, was ich sage.« Er ließ sie nicht zu Wort kommen, als sie den Mund öffnete. »Und erzähl mir jetzt bloß nicht, ich soll chillen oder so was. Du bist keine zwölf mehr.«
»Ich lerne Leute kennen«, sagte sie.
»Du musst die Sache langsam angehen. Ach ja, und du musst arbeiten.« Er schlug sich theatralisch an die Brust. »Ich weiß, klingt verrückt ...«
»Wie du gesagt hast, ich bin erst zwei Wochen hier.« Sie wollte ihm den Toast wegschnappen, was jedoch nicht klappte. »Und weißt du, ich studiere Theaterwissenschaften. Das ist nicht so heftig.«
»Wie sich unser alter Herr gefreut hat, dass du einen Platz hier bekommen und du ihm gesagt hast, dass du bei mir einziehst.«
Sie zuckte die Achseln.
»Und wie sauer wäre er, wenn er wüsste, dass du jeden zweiten Abend durch die Pubs ziehst.«
Gerade als es aussah, als würde Alex losbrüllen oder aus der Küche stürmen, setzte sie dieses Lächeln auf, das die Butter zum Schmelzen brachte und mit dem sie seit achtzehn Jahren gut durchkam. »Du bist ja nur eifersüchtig, weil du ein richtiges Studium mit richtigen Vorlesungen hast«, sagte sie. »Henry der Scheißzweite. «
»Stinklangweilig«, sagte er.
Sie lachten beide, und diesmal gelang es ihr, ihm den Toast wegzuschnappen. Greg nannte sie ein gieriges Miststück, und Alex nannte ihn einen Korinthenkacker, bevor sie aufstand, um neuen Toast zu machen.
»Gehst du heute Abend ins Rocket?«
Alex drehte sich zu ihm um und zog ein Gesicht. »Nach dem, was du gerade gesagt hast?«
»Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Ich werd wahrscheinlich hingehen.«
»Okay. Betonung auf wahrscheinlich.« Sie deutete mit dem butter- und marmitebeschmierten Messer anklagend auf ihn. Im Rocketkomplex in der Holloway Road war das Studentenwerk untergebracht. Außerdem befand sich dort einer der trendigsten Clubs der Stadt, in dem ihr Bruder bis vor kurzem nicht gerade ein häufiger Gast war. »Das wär ja schon das dritte Mal in dieser Woche.«
»Ja?«
»Wird langsam zur Gewohnheit.«
Er zuckte die Achseln. »Die Drinks sind dort billig.«
»Aha, dann liegt es also nicht daran, dass du ein Auge auf jemanden geworfen hättest?«
Wieder errötete Greg und stand auf. Er erklärte ihr, er habe keine Zeit mehr, um noch einen Toast zu essen, er müsse jetzt aufbrechen. Sie rief ihm nach, er könne den Toast ja auf dem Weg essen. Er rief zurück: »Da kann ich mich gleich umbringen ...«
Fünf Minuten später schob er sein Rad über den Bürgersteig und aß den Toast, den Alex ihm oben an der Treppe in die Hand gedrückt hatte. So lief es meistens. Sosehr ihr Vater darauf setzte, dass Greg ein Auge auf seine kleine Schwester haben würde, war es normalerweise sie, die sich um ihn kümmerte und ständig alles checkte und sich benahm wie die Mutter, die sie nicht hatten.
Als er auf sein Rad stieg und auf eine Lücke im Verkehr wartete, blickte er auf und sah, wie sie ihm aus ihrem Zimmer nachwinkte. Dabei drückte sie das Gesicht wie ein kleines Kind an die Scheibe. Er winkte zurück und fuhr los, am Emirates-Stadium vorbei, das sich fulminant vor dem grauen Himmel abhob, Richtung Hornsey Road.
Greg hob noch einmal die Hand, um zu winken, für den Fall, dass Alex noch am Fenster war.
Ohne das Augenpaar zu bemerken, das ihn beobachtete.
Das sie beide beobachtete.
Viertes Kapitel
Obwohl Dave Holland so gut wie keine Ahnung hatte, was in ihrem Kopf vorging, hatte er gesehen, wie ein gewaltsamer Tod in ihrem Umfeld die Betroffenen körperlich verändern konnte. Als ob sie davon ausgehöhlt wurden oder — im Fall von George Walker — leicht schrumpften. Walker war knappe ein Meter neunzig und stämmig, aber der Mann, der ihm im Vernehmungszimmer in der Polizeiwache Colindale gegenübersaß, wirkte beinahe schmächtig.
»Dauert nicht mehr lange«, sagte Holland. »Es ist wirklich eine Hilfe für uns, alles auf Band zu haben, wissen Sie.« Die Mordkommission befand sich fünf Minuten entfernt im Peel Centre, aber das braune, dreistöckige Gebäude mit den Büros beherbergte nur die Verwaltung. Während die Ermittlungen vom Becke House aus geleitet wurden, musste man, wenn man einen Vernehmungsraum, eine Untersuchungshaftzelle oder eine altmodische Gefängniszelle brauchte, die kurze Reise nach Colindale machen.
»Was immer ich für Sie tun kann«, sagte Walker.