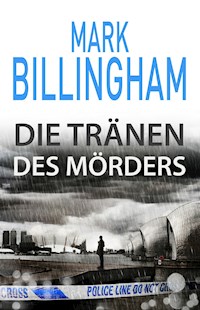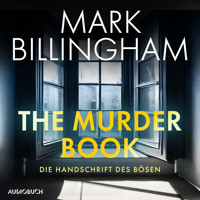Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tom Thorne
- Sprache: Deutsch
Detective Inspector Tom Thorne von der Londoner Spezialeinheit Serious Crime Group macht Urlaub. Allerdings nicht ganz freiwillig, denn in den Augen seiner Vorgesetzten hat er sich bei seinem letzten Fall endgültig zu weit vom offiziellen Leitfaden für Verbrechensaufklärung entfernt, weswegen ihm nachdrücklich eine Erholungspause verordnet wurde. Doch dann sterben in London Obdachlose. Und der makabre Abschiedsgruß in Form einer £20-Note, die jedem der Opfer mit einem Messer in die Brust gerammt wurde, macht überdeutlich, dass hier jemand eine blutige und unmissverständliche Nachricht hinterlassen will. Da das Leben auf der Straße aber seinen eigenen Regeln folgt, die sich nur dem Insider erschließen, ist Thornes Urlaub ebenso schnell zu Ende, wie er begonnen hat ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der Stunde des Todes
In der Stunde des Todes
© Mark Billingham 2005
© Deutsch: Jentas A/S 2021
Serie: Tom Thorne
Titel: In der Stunde des Todes
Teil: 5
Originaltitel: Lifeless
Übersetzer: Isabella Bruckmaier
© Übersetzung : Jentas A/S
ISBN: 978-87-428-2026-1
–––
Für Mike Gunn.
Und für seinen Sohn,
William Roan Gunn.
–––
»Ich stelle mir die Hölle als große Stadt vor,
nicht unähnlich London.«
Percy Bysshe Shelley
»Niemand sagte mir,
wie sehr sich Trauer und Angst gleichen.«
C. S. Lewis
Prolog
12. Januar
Ich werde dich nicht lang fragen, wie es dir geht. Ich weiß, wie es dir geht, und es ist mir egal. So wie es dir egal ist, wie es mir geht. Außerdem müsstest du beschränkt sein, um dir nicht denken zu können, wie beschissen es bei ein paar von uns läuft. Du müsstest dumm sein (und ich weiß, das bist du nun wirklich nicht), um nicht dahinter zu kommen, worauf ich hinauswill.
Ich glaube nicht, dass ich besser bin als du. Wie käme ich dazu? Aber ich vermute, dass es dir besser geht. Deshalb wende ich mich an dich. Ich brauche Hilfe. Mir ist nicht viel geblieben außer ein paar unangenehmen Erinnerungen. Ach ja, und dem Andenken selbst. Dem »Beweis«, den höchstwahrscheinlich jeder von uns aufgehoben hat.
Ich kann es mir nicht leisten, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, dass ich wie eine Ratte rüberkomme, weil ich mich in der Sache an dich wende. Verzweiflung macht den letzten Funken Selbstwertgefühl platt. Außerdem kannst du mich gar nicht mehr hassen, als ich mich selbst für die Sache damals hasse. Und dafür, das alles wieder hervorzuholen, nur weil ich ein paar hundert Kröten brauche.
Die reichen mir ...
Dir ist sicher aufgefallen, dass ich keine Adresse angegeben habe. Ich mache nicht auf mysteriös, ich hab im Moment nur keine. Zurzeit hält mich die Geduld meiner Verwandten und der paar Freunde am Leben, die mir noch geblieben sind.
Wegen Ort und Zeit schreibe ich dir noch einmal. Dann legen wir einen Treffpunkt fest, okay?
Anonymität ist super, ganz James Bond. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass du einen blassen Schimmer hast, wer ich bin. Welcher ich bin. Außer du hattest auf uns alle ein Auge. Na ja, du wirst es bald genug erfahren. Und ein bisschen Spannung schadet ja nicht!
Könnte jeder von uns vier sein, stimmt’s? Jeder aus der Crew. Würde mich wundern, wenn sich auch nur einer von uns nicht mit Geldsorgen herumschlägt.
Also ... bis dann.
Und ein frohes Neues.
Erster Teil
Das Frühstück und was davor war
–––
Der erste Tritt reißt ihn aus dem Schlaf. Und zerschmettert gleichzeitig seinen Schädel.
Obwohl sich die Bewusstlosigkeit wieder über ihn senkt, nimmt er die Pausen zwischen den einzelnen Tritten wahr — keine ist länger als ein oder zwei Sekunden. Sein Gehirn, das bereits anschwillt, erhält Gelegenheit für eine letzte Runde. Es sendet Gedanken und Anweisungen an sich selbst.
Zähle die Tritte. Zähle jeden Schlag in Fleisch und Knochen. Und die Pausen, seltsam und herrlich.
Zwei ...
Es ist kalt in diesen frühen Morgenstunden — und feucht. Der Versuch zu schreien tut mörderisch weh, als die vom Gehirn kommende Nachricht zwischen die Knochenfragmente hindurchtanzt, die einmal seinen Kiefer bildeten.
Drei ...
Es ist warm, das Gesicht des Babys in seinen Händen. Des Kindes, bevor es größer wurde und ihn zu verachten begann. Vergeblicher Griff nach dem zerknitterten und schmutzigen Brief in der Innentasche seiner Jacke. Die letzte Verbindung zu seinem früheren Leben. Als er danach greifen möchte, sind die kraftlosen Finger an seinem gebrochenen Arm zu nichts nutze.
Vier ...
Er versucht, den Kopf zu drehen. Weg vom Schmerz und hin zur Wand. Sein Gesicht kratzt auf dem Boden, die Bartstoppeln hören sich an wie fernes Wellenbrechen. Zwischen seiner Wange und dem kalten Karton darunter spürt er das warme, klebrige Blut. Kurz sieht er den Schatten dort, wo das Gesicht seines Angreifers sein sollte. Er ist schwärzer als schwarz. Glatt wie Teer nach einem Regen. Liegt wohl am Licht.
Fünf ...
Glaubt die Stiefelspitze zu spüren, wie sie durch die fragilen Rippenbögen stößt. In ihm herumtritt und seine Innereien malträtiert. Die Nieren — sind das seine Nieren! — werden gequetscht, als handle es sich um mit Wasser gefüllte Ballons.
Sechs, sieben, acht. Die Tritte kicken ihm das Bewusstsein aus dem Leib. Fühlen sich an, als hämmere irgendwo jemand gegen eine Tür, ein Vibrieren in seiner Schulter, seinem Rücken und seinen Oberschenkeln. Das Stöhnen und Knurren des Mannes über ihm wird leiser, entfernt sich immer mehr.
Dieser Wortschwall, die Farben- und Geräuschflut, die auf ihn einstürzen. Alles wird wirr und dunkel ...
Er denkt. Er denkt, wie schrecklich und verzweifelt dieses Denken ist, wenn man es überhaupt noch so nennen kann. Spürt, dass der Schatten sich endlich von ihm abgewandt hat. Genießt die längere Pause, bis ihm dämmert, dass Schluss ist mit den Tritten.
Alles ist so anders, so unförmig, und das Blut läuft in den Rinnstein.
Er liegt regungslos. Ihm ist klar, er muss gar nicht erst versuchen, sich zu bewegen. Er klammert sich an seinen Namen und den Namen seines einzigen Kindes. Mit jeder intakten Gehirnzelle, die ihm noch verblieben ist, klammert er sich an diese Namen. Und an den Namen des Herrn.
Bittet ihn, ihm diese wenigen wertvollen Worte zu lassen, bis der Tod ihn holt.
Erstes Kapitel
Er wachte in einem Eingang gegenüber von Planet Hollywood auf, zu seinen Füßen eine Urinpfütze, die nicht von ihm stammte. Dazu kam die unangenehme Erkenntnis, dass er nicht träumte. Es gab keine weiche Matratze. Er wechselte ein paar Worte mit dem Streifenpolizisten, der ihn wachgerüttelt hatte, und suchte seine Habseligkeiten zusammen.
Er hob die Augen zum Himmel, als er sich auf den Weg machte, und hoffte, das Wetter bliebe schön. Diese Leere in ihm war wohl doch nicht Angst, sondern einfach Hunger.
Ob Paddy Hayes schon tot war? Hatte der junge Mann, dem man die Entscheidung aufgebürdet hatte, den Stecker bereits gezogen?
Der Weg durch das Londoner West End, wenn es den Schlaf abschüttelte und langsam erwachte, war jeden Tag aufs Neue eine Entdeckung. Jeden Morgen sah er etwas, das er noch nie zuvor gesehen hatte.
Der Piccadilly Circus war herrlich und der Leicester Square besser, als es auf den ersten Blick schien. Die Oxford Street war beschissener, als er gedacht hatte.
Natürlich war noch immer einiges los. Eine Menge Leute waren unterwegs, und der Verkehr war chaotisch. Selbst um diese Zeit waren auf der Straße mehr Leute unterwegs als landesweit auf den meisten Straßen zur Hauptverkehrszeit. Er hatte mal einen Film gesehen, der in London spielte, nachdem der Großteil der Bevölkerung durch irgendeine Krankheit in durchgeknallte Zombies verwandelt worden war. Darin gab es bizarre Szenen, in denen die ganze Stadt vollkommen menschenleer zu sein schien. Er wusste bis heute nicht, wie sie das gemacht hatten. Wahrscheinlich irgendwelche Computertricks. Das hier, die Stunde, wenn die Hauptstadt sich duschte, rasierte und auf dem Klo saß, kam dem noch am nächsten. Von menschenleeren Straßen zwar keine Spur, aber durchgeknallte Zombies gab’s ’ne Menge.
Die meisten Läden öffneten erst in ein, zwei Stunden. Heutzutage machten die wenigsten ihre Türen vor zehn Uhr auf. Nur die Cafes und Snackbars hatten bereits geöffnet und lockten die Laufkunden auf eine Tasse Tee und ein Schinkensandwich herein. So wie die Burgerwagen und Kebabläden es auf die Nachteulen abgesehen hatten, die noch vor ein paar Stunden unterwegs nach Hause waren.
Eine Tasse Tee und ein Sandwich. Normalerweise kratzte er abends genug Geld zusammen, dass er sich am anderen Tag etwas zu essen kaufen konnte. Aber heute war ein anderer mit Zahlen dran.
In der Mitte der Glasshouse Street trat ein Mann in einem dunkelgrünen Anzug vor ihm aus einem Eingang und versuchte, an ihm vorbeizugehen. Beide wichen in dieselbe Richtung aus und lächelten einander verlegen zu.
»Ein wunderbarer Morgen für ein Tänzchen, was ...?«
Bei der plötzlichen Erkenntnis, dass er es offensichtlich mit einem Irren zu tun hatte, rutschten dem Mann die Mundwinkel nach unten. Er wandte sich zur Seite und senkte den Kopf. Drängte sich vorbei mit den Worten »Entschuldigen Sie ...« und »Ich kann nicht ...«
Er schulterte seinen Rucksack und ging weiter. Was das wohl war, was der Mann in dem Anzug nicht tun konnte?
Auf einen einfachen Gruß antworten? Etwas Kleingeld erübrigen? Mich zum Teufel schicken?
Er lief die Regent Street hinauf, bog rechts ab und nahm eine Abkürzung durch die Seitenstraßen Sohos zur Tottenham Court Road. Eine fremde und zugleich vertraute Gestalt, die im Gleichschritt neben ihm herlief, fesselte seinen Blick. Er wurde langsamer, bevor er ganz stehen blieb. Der Fremde tat es ihm gleich.
Er trat einen Schritt vor, um in dem Schaufenster das Spiegelbild des Mannes näher in Augenschein zu nehmen, der er in dieser kurzen Zeit geworden war. Seine Haare schienen schneller zu wachsen, das Grau hob sich stärker von dem Schwarz ab. Das gepflegte Kinnbärtchen, das er sich einmal zugelegt hatte, verlor sich in den wild wuchernden Stoppeln auf Wangen und Hals. Sein roter Nylonrucksack war der einzige Farbfleck in dem Bild, das ihm aus dem Schaufenster entgegenstarrte, so schmuddlig war er. Der schmierig graue Mantel und die dunkle Jeans waren so nichts sagend, so anonym wie das Gesicht darüber. Er beugte sich vor und schnitt Fratzen, zog die Lippen nach hinten, die Augenbrauen nach oben, blies die Backen auf. Doch die Augen blieben leer und unbewegt — und es sind die Augen, die alles über einen Menschen verraten.
So vage wie ein Vagabund. Als er sich vom Fenster abwandte, entdeckte er einen Bekannten auf der anderen Seite der Straße. Einen jungen Kerl — beinahe noch ein Kind — , der, die Arme um die Knie und den Schlafsack um die Schultern geschlungen, an eine schmutzige weiße Wand gelehnt saß. Vor ein paar Abenden hatte er mit dem Jungen gesprochen. Irgendwo beim Hippodrom. Konnte vor einem der großen Kinos am Leicester Square gewesen sein. Er war sich nicht sicher, erinnerte sich nur an den Akzent des Jungen. Er klang schwer nach Nordostengland. Newcastle oder Sunderland. Das meiste, was er sagte, war unverständlich, zähneknirschend spuckte er die Silben aus wie Maschinengewehrsalven, während er den Kopf hierhin und dorthin drehte und an seinem Kragen herumfingerte. Er war so voll gedröhnt mit Ecstasy, dass es schien, als wolle er sein eigenes Gesicht auffressen.
Er ließ ein Taxi vorbei, bevor er auf die Straße trat. Der Junge sah auf, als er näher kam, und zog seine Knie noch näher an den Körper heran.
»Alles okay?«
Der Junge drehte den Kopf zur Seite und zog den Schlafsack fester um die Schultern. Aus einem Riss neben dem Reißverschluss quoll die graue Füllung.
»Ich glaub nicht, dass es regnen wird ...«
»Gut«, entgegnete der Junge. Mehr ein Knurren als eine Antwort.
»Wird wohl trocken bleiben.«
»Bist du ein Scheißwetterfrosch oder was?«
Er zuckte die Achseln. »Ich sag’s ja nur ...«
»Ich hab dich schon mal gesehen, oder?«, fragte der Junge.
»Neulich abends.«
»Warst du mit Spike zusammen? Und Irgendwann-malCaroline?«
»Ja, die waren auch da, glaub ich ...«
»Du bist neu.« Der Junge nickte, zufrieden darüber, dass es ihm wieder einfiel. »Ich weiß noch, du hast so saublöd gefragt ...«
»Bin seit ein paar Wochen auf der Straße. Hab mir eine bescheuerte Zeit ausgesucht, was? Bei dem, was im Augenblick alles so abgeht.«
Der Junge starrte ihn eine Weile an, bis er schließlich die Augen zusammenkniff und den Kopf nach unten fallen ließ.
Er blieb stehen, wo er war, und schlug mit der Kappe eines Schuhs gegen die Ferse des anderen, bis er sich sicher war, dass der Junge nichts mehr sagen würde. Kurz überlegte er, ob er noch eine Bemerkung über das Wetter machen und die Sache sozusagen zum Witz erklären sollte. Stattdessen wandte er sich zur Straße. »Viel Glück«, verabschiedete er sich, ohne eine Antwort zu erhalten.
Während er weiter nach Norden lief, ging ihm durch den Kopf, dass die Begegnung mit dem Jungen auch nicht viel angenehmer verlaufen war als die vorhin mit dem Typen in dem grünen Anzug, der ihn so schnell wie möglich aus dem Weg haben wollte. Die Reaktion des Jungen entsprach mehr oder weniger dem, was er in der kurzen Zeit auf der Straße zu erwarten gelernt hatte. Und warum? Die meisten Londoner reagierten vorsichtig — vielleicht sogar misstrauisch, egal, wie sie dran waren. Und natürlich waren die Penner unter ihnen insgesamt noch ein Stück vorsichtiger. War ja klar, dass sie jedem, der sie nicht anmachte oder ihnen auswich, argwöhnisch begegneten, bis sie wussten, woran sie waren. Entweder oder ...
Wie im Gefängnis. So wurde das Leben hinter Gittern definiert. Und damit kannte er sich aus.
Die Leute, die im Zentrum von London Platte machten, hatten viel gemein mit denen, die in den weiß gestrichenen Zellen als Gäste Ihrer Majestät schliefen. Hier wie dort gab es eigene Regeln, eigene Hierarchien und ein nachvollziehbares Misstrauen gegenüber Außenseitern. Wer im Gefängnis überleben wollte, musste sich anpassen und tun, was nötig war. Natürlich war niemand scharf drauf, Scheiße zu fressen. Aber wenn es nicht anders ging, dann musste man eben ran an die Schüssel. Nach den Erfahrungen, die er gemacht hatte, lief es auf der Straße nicht viel anders.
Das Cafe war schmuddlig, aber der Typ im Laden meinte offenbar, ein paar billige Sandwichsorten in Plastikbehältern würden einen Feinkostladen daraus machen. Es war vorhersehbar, wie man dort auf ihn reagieren würde, wenn er in das Cafe schlurfte und sich setzte, ohne etwas zu bestellen.
»He!«
Er antwortete nicht darauf.
»Wollen Sie was bestellen?«
Er schnappte sich vom Nebentisch eine Zeitschrift und begann zu lesen.
»Das hier ist kein Obdachlosenheim, kapiert?«
Er grinste.
»Sie glauben wohl, ich mach Witze ...?«
Statt zu antworten, nickte er einer vertrauten Gestalt vor dem Fenster zu, worauf der dicke, rotgesichtige Besitzer hinter seiner Theke hervorkam. Gleichzeitig trat die Gestalt von draußen durch die Tür. Perfektes Timing, denn der Cafebesitzer baute sich gerade bedrohlich vor ihm auf.
»Ist in Ordnung, er gehört zu mir.«
Der Gesichtsausdruck des Ladenbesitzers änderte sich schlagartig, als er sich von dem Penner abwandte und sein Blick auf einen Ausweis der Metropolitan Police fiel.
Detective Sergeant Dave Holland rückte sich, nachdem er seinen Ausweis gezeigt hatte, einen Stuhl zurecht. »Zwei Tassen Tee bitte«, sagte er.
Der Mann am Tisch korrigierte ihn. »Zwei große Tassen Tee.«
Der Besitzer schlurfte zurück hinter die Theke und brachte es dabei irgendwie fertig, sich gleichzeitig zu räuspern und zu seufzen.
»Mein Held«, sagte der Penner.
Holland stellte seine Aktentasche auf den Boden und setzte sich. Er ließ den Blick schweifen. Es waren noch zwei Gäste im Lokal, eine schick gekleidete Frau und ein Postbeamter mittleren Alters in Uniform. Der Besitzer warf ihm von seinem Platz hinter seiner Theke aus einen finsteren Blick zu, während er sich zwei Tassen aus dem Regal griff.
»Der hat ausgesehen, als wirft er Sie gleich raus. Am liebsten hätte ich draußen gewartet und zugesehen, was passiert.«
»Da hätten Sie gesehen, wie ich der fetten Sau eine verpasse.«
»Worauf ich Sie hätte festnehmen müssen.«
»Eine interessante Vorstellung ...«
Holland zuckte mit den Schultern und wischte sich eine dunkelblonde Strähne aus der Stirn. »Paddy Hayes ist gestern Nacht um halb zwölf gestorben.«
»Wie geht’s dem Sohn?«
»Der war davor schon ziemlich durch den Wind. Hat mit der Entscheidung gerungen, aber als er sie dann gefällt hatte und sie die Maschinen abstellten, hat er ruhiger gewirkt.«
»Wahrscheinlich hat er nur so gewirkt.»
»Wahrscheinlich ...«
»Wann fährt er nach Hause?«
»Er nimmt heute Vormittag den Zug Richtung Norden. Wenn sie mit der Autopsie anfangen, ist er wahrscheinlich schon zu Hause.«
»Da wird es keine großen Überraschungen geben.«
Sie lehnten sich beide zurück, als ihnen ohne höfliches Geplänkel der Tee gebracht wurde. Der Dicke knallte ihnen das in Papierservietten gewickelte Besteck auf den Tisch. Dann legte er mit Nachdruck vor jeden von ihnen eine laminierte Speisekarte, bevor er den Aschenbecher vom Nebentisch leerte.
»Haben Sie Hunger?«, fragte Holland.
Sein Gegenüber blickte von der Speisekarte auf. »Nicht wirklich. Ich hatte heute schon eine riesige Portion geräucherten Lachs und Rührei.« Er wandte sich wieder der Speisekarte zu. »Klar habe ich einen Riesenkohldampf.«
»Okay ...«
»Hoffentlich haben Sie Ihre Kreditkarte dabei. Das könnte teuer werden.«
Holland griff nach seiner Tasse. Er hielt sie an sein Kinn und ließ die Wärme in sein Gesicht hochsteigen. Durch den Dampf hindurch musterte er die zerzauste Gestalt ihm gegenüber. »Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen«, sagte er.
»An was?«
»An das hier. An Sie.«
»Sie können sich nicht daran gewöhnen?«
»Sie wissen schon, was ich meine. Ich hab Sie mir einfach nie so vorgestellt. Sie waren der Letzte ... Sie sind der Letzte ...«
Tom Thorne legte die Speisekarte weg und verschränkte seine schmutzigen Hände darauf. Er hatte sich entschieden.
»Die Dinge ändern sich«, sagte er und fixierte Holland.
Zweites Kapitel
Eine Menge Dinge hatten sich geändert ...
Zum Beispiel, wie jetzt alles hieß. Als er wieder zu arbeiten anfing, kam es Thorne vor, als hätten sie in der kurzen Zeit seiner Abwesenheit beschlossen, so gut wie alle Namen zu ändern. Die Serious Crime Group, in der Thorne als Detective Inspector in einem der neun Major Investigation Teams im Murder Command (West) arbeitete, war nun Teil des Specialist Crime Directorate. Ein lachhafterer Name war ihnen wohl nicht eingefallen. Directorate. Das war doch zum Brüllen. Glaubten diese Sesselfurzer, die diese Dinge entschieden, sie änderten mit dem Namen auch nur das Geringste an dem, was tatsächlich getan wurde?
Directorate, Gruppe, Pool, Squad, Team, Einheit — Aufgebot, Trupp, wie auch immer.
Da waren einfach ein paar Leute unterschiedlichen Talents, die sich mehr oder weniger verzweifelt damit abmühten, Mörder zu fassen. Solche, die getötet hatten, und solche, die es noch tun würden.
Das Specialist Crime Directorate. Thorne fiel eine Stellenanzeige einer bekannten Supermarktkette ein, in der ein Mitarbeiter für die »Ressourcenkoordination« gesucht wurde. Irgendeiner also, der die Regale füllen sollte.
Selbstverständlich war auch die Organisation nicht mehr dieselbe, als Thorne zurückkam. Jedes Major Investigation Team der Murder Squad bestand jetzt aus drei Detective Inspectors, die jeweils einem kleineren Basisteam vorstanden und dementsprechend mehr Papierkram und Verwaltungsarbeit um die Ohren hatten und entsprechend länger hinter ihrem Schreibtisch saßen. Und die in ihrem Team die Arbeitsmoral hochhielten und den Ausfall durch Krankheit niedrig und die dafür sorgten, dass die Einsätze innerhalb der notwendigen Budget- und Zeitgrenzen stattfanden und so weiter und so fort ...
»Natürlich muss das erledigt werden, und zwar ordentlich, aber es müssen doch Prioritäten gesetzt werden. Oder? Verflucht, ich hab zwei arabische Kinder, die durch Kopfschüsse getötet wurden, und so einen Irren, dem es wahnsinnig Spaß macht, Leuten eine messerscharfe Fahrradspeiche in den Rücken zu rammen. Aber mir sind die Hände gebunden, ich kann nicht raus und was dagegen unternehmen.«
»Moment mal ...«
»Kaum setze ich auch nur einen Fuß vor die Tür, mosert einer meiner so genannten Kollegen rum, weil er jetzt meinen Papierkram miterledigen muss. Dabei will ich nur meine Arbeit machen, verstehst du? Vor allem jetzt. Du verstehst das doch? Ich bin nur ein Bulle, das ist alles. Nichts daran ist kompliziert. Ich bin weder eine Ressource noch ein Coach oder ein Scheiß-Mordpräventionsinstrument ...«
»Tom ...«
»Glaubst du, der Typ, der diese zwei Kinder abgeknallt hat, sitzt zu Hause über seinem Papierkram? Füllt dieser Irre vielleicht Formulare aus? Fertigt einen ausgefeilten Bericht, nein, mehrere Exemplare eines ausgefeilten Berichts darüber an, wie viele verschiedene Fahrradspeichen er benutzte, welche Kosten ihm dadurch entstanden und wie lange er dazu brauchte, sie so weit zu schärfen, dass er seine Opfer damit lähmen konnte? Kann ich mir nicht vorsteilen. Wirklich nicht ...«
Der Mann in dem Sessel trug wie immer einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Baggyhose. Ein Assortiment von Ringen und Piercings schmückte seine Ohren, und der Knopf an seiner Unterlippe bewegte sich mit seiner Zunge. Dr. Phil Hendricks war Pathologe und arbeitete eng mit Thornes Team zusammen. Und für Thorne kam er dem, was man einen Busenfreund nennt, am nächsten. Gewaltsame Tode und was danach kam hatten sie einander nahe gebracht.
Hendricks war sofort in ein Taxi gestiegen und zu der Wohnung in Kentish Town gefahren, als Thorne anrief.
Nun wartete er ab, bis er sicher war, dass Thorne Dampf abgelassen hatte. »Schläfst du gut?«, fragte er dann.
Thorne hatte aufgehört, auf und ab zu gehen, und sich auf die Sofalehne gesetzt. »Mache ich einen müden Eindruck?«
»Du klingst ... aufgedreht. Ist ja auch nachvollziehbar.«
Thorne sprang erneut auf und lief zum Kamin. »Verschon mich bloß mit dieser Gesenkte-Stimme-Nummer, Phil. Als ob ich krank wär oder was. Es stimmt, was ich sage.«
»Ich bin mir sicher, dass du Recht hast. Ich kann das nur nicht so beurteilen.«
»Alles ist anders.«
»Vielleicht liegt es daran, dass du anders bist ...«
»Glaub mir, Kumpel, dieser Job ist am Arsch. Manchmal hab ich das Gefühl, ich arbeite in einer Bank. In der ScheißCity!«
»Wie lief es mit Jesmond?«
Thorne holte tief Luft, legte die Hand auf seinen Brustkorb und beobachtete, wie sie sich bewegte. Einmal, zweimal, dreimal ...
»Ich musste mir einen Vortrag anhören«, erklärte er. »Offenbar sei meine Toleranz gegenüber unnötigem Ballast wesentlich geringer.«
Eine Menge hatte sich geändert ...
Hendricks rutschte in seinem Sessel herum und öffnete den Mund, um etwas zu sagen ...
»Ballast«, sagte Thorne und sprach das Wort aus, als sei es ein Fremdwort. »Und das von ihm. Diesem bornierten Wichser!«
»Okay, das stimmt ja alles ... aber vielleicht wächst dir die Arbeit wirklich über den Kopf. Was meinst du? Jetzt komm schon, im Augenblick bringst du’s nicht wirklich in der Arbeit, in keinem Bereich.«
»Genau, und warum wohl? Was habe ich dir gerade lang und breit versucht zu erklären?«
»Du hast mir gar nichts erklärt. Du hast mich angebrüllt. Und in Wirklichkeit suchst du nur nach Entschuldigungen. Ich steh auf deiner Seite, Tom, aber du musst dich ein paar Tatsachen stellen. Du hältst dich entweder vollkommen raus, oder du führst dich auf wie ein Vollidiot. So oder so stößt du die Leute vor den Kopf. Noch mehr vor den Kopf ...«
»Welche Leute?«
Jetzt gab es kein Zurück mehr. »Du warst noch nicht so weit, wieder zu arbeiten«, sagte Hendricks mit gesenkter Stimme.
»Quatsch.«
»Du bist zu früh zurück ...«
Es war noch keine neun Wochen her, dass Thornes Vater bei einem Hausbrand ums Leben gekommen war. Jim Thorne war an Alzheimer erkrankt gewesen, im fortgeschrittenen Stadium. Höchstwahrscheinlich war das Feuer ein Unfall, das Versagen einer Synapse. Die Folge einer tragischen Vergesslichkeit.
Aber sicher war das nicht, denn Thorne arbeitete damals an einem Fall, in den eine Reihe mächtiger Mafiabosse verwickelt waren. Es war denkbar, dass einer von ihnen — ein ganz bestimmter — beschlossen hatte, Thorne zu treffen, indem er den Menschen beseitigte, der ihm am nächsten stand. Ihm damit einen Schmerz zufügte, der ihm länger zu schaffen machen würde als eine Schuss- oder Stichwunde.
Nichts war sicher ...
Thorne musste mit einer Menge Dinge klarkommen, darunter auch mit der Tatsache, dass er vielleicht nie Gewissheit haben würde, ob sein Vater nicht umgebracht wurde. Was auch immer passiert war, Thorne wusste, es war seine Schuld.
»Ich hätte ihn früher besucht, wenn ich gekonnt hätte«, sagte Thorne. »Ich wollte ihn an dem Tag besuchen, an dem er beerdigt wurde. Was soll ich denn machen?«
Hendricks stand mit einem Ruck auf. »Magst du eine Tasse Tee?«
Thorne nickte und wandte sich zum Kamin. Er lehnte sich gegen das hölzerne Kaminsims und musterte sein Konterfei in dem Spiegel darüber. »Detective Chief Superintendent Jesmond spielt mit dem Gedanken, mir ein paar Wochen Urlaub zum ›Gärtnern‹ zu verordnen«, stieß er hervor.
Als er an diesem Nachmittag vor Trevor Jesmonds Schreibtisch stand, hatte Thorne das Gefühl, einen Schlag in die Magengrube zu erhalten. Er kostete ihn Kraft, etwas wie ein Lächeln zustande zu bringen. Und noch mehr Kraft, schlagfertig zu antworten: »Ich hab nur einen Blumenkasten ...«
Nun kochte die Wut aufs Neue hoch, machte dann aber schnell einer perversen Freude über den nächsten lächerlichen Euphemismus Platz. »›Urlaub zum Gärtnern‹«, sagte er. »Wie nett. Wie scheißfreundlich.«
Andererseits ergab es durchaus einen Sinn. Man konnte es ja schlecht als das bezeichnen, was es war: ein sinnloser, aus dem Arm geschüttelter Hilfsjob, um einen Problemfall loszuwerden. Eine Nervensäge, die man nicht so einfach feuern konnte. Gärtnern klang so viel besser als kaputt. So viel besser als besoffen, traumatisiert oder durchgeknallt.
Hendricks schlenderte in die Küche. »Ich finde, du solltest das Angebot annehmen.«
Am nächsten Tag merkte Thorne, wie sehr sich seine Position verschlechtert hatte.
»Ich hab mich ins Aus manövriert, richtig?«
Russell Brigstocke blickte auf seinen Schreibtisch, rückte sein Dienstbuch zurecht. »Wir finden was für Sie, was Sie nicht vollends in den Wahnsinn treibt.«
Thorne zeigte scherzhaft drohend auf seinen Detective Inspector. »Das rate ich Ihnen.«
Schwer zu sagen, wer von ihnen peinlicher berührt war, als die Tränen kamen. Plötzlich waren sie da. Thorne wischte sich schnell mit dem Handrücken über die Augen und drosch den Metallpapierkorb durch Russell Brigstockes Büro.
»Scheiße ...«
Scotland Yard.
Vielleicht der berühmteste Ort in der Geschichte der Verbrechensbekämpfung. Ein Synonym für schlaue Köpfe und modernste Technologien. Der Ort, an dem Rätsel gelöst und komplexen Verbrechen auf den Grund gegangen wird.
Der Ort, an dem Thorne nun seit drei Wochen in einer Art Abstellkammer saß und langsam verrückt wurde. Sich den Kopf darüber zermarterte, auf wie viele Arten man sich umbringen konnte, wenn man dazu nur die übliche Büroausrüstung benutzte.
Verständlicherweise hatte er geglaubt, die Demographischen Grundlagen für die Mitarbeiterwerbung könnten nicht so langweilig sein, wie der Titel nahe legte. Womit er sich irrte. Die ersten paar Tage waren gar nicht so übel. Man hatte ihm beigebracht, wie die Software funktionierte, mit deren Hilfe er mehrere hundert Seiten eines Forschungsberichts in ein präsentationsfähiges Dokument mit Balkenund Kuchendiagrammen verwandeln sollte. Sein Ausbilder war genauso interessant, wie Thorne sich ihn vorgestellt hatte. Aber immerhin hatte er jemanden, mit dem er reden konnte.
Auf sich selbst gestellt entdeckte Thorne dann schnell, wie sich die Zeit am besten rumbringen ließ, aber ebenso schnell kam man ihm auf die Schliche. Es dauerte nicht lange, und jemand fand heraus, dass die Webseiten, auf denen Thorne surfte, sehr wenig mit der Rekrutierung ethnischer Minderheiten oder der Frage zu tun hatten, warum mehr Hundeausbilder aus dem Südwesten des Landes kamen. Ohne Vorwarnung wurde ihm von einem Tag auf den anderen der Internetzugang gesperrt, und seither blieb Thorne außer der Arbeit nichts anderes, als die Zeitung auswendig zu lernen und sich Selbstmordmethoden auszudenken.
Er dachte gerade darüber nach, sich mit tausenden von Artikelausschnitten umzubringen, als ein Gesicht hinter der Tür auftauchte. Es war schmaler geworden und lächelte nervös. Vier Wochen waren vergangen, seit Thorne den Mann zuletzt gesehen hatte, der zumindest zum Teil dafür verantwortlich war, dass man ihn hierher verfrachtet hatte. Russell Brigstocke hatte Anlass genug, in Deckung zu gehen.
Er hob die Hand und ergriff das Wort, bevor Thorne Gelegenheit hatte, etwas zu sagen. »Tut mir Leid, ich lad Sie zum Essen ein.«
Thorne tat so, als denke er darüber nach. »Inklusive Bier?« Brigstocke verzog das Gesicht. »Ich mach gerade so eine Scheißdiät, aber weil’s Sie sind, okay.«
»Was machen wir dann noch hier?«
Thorne hatte nicht mal darauf geachtet, wie die Kneipe hieß, in die sie gingen. Sie verließen Scotland Yard, liefen Richtung Parliament Square und entschieden sich für das erste Pub, an dem sie vorbeikamen. Das Essen war unterste Schublade — Chili con Carne, das an manchen Stellen am Teller festgebacken, an anderen dafür noch kalt war — , aber immerhin gab es Stella vom Faß.
Eine Bedienung räumte das Geschirr weg, als Brigstocke eine weitere Runde Getränke brachte.
»Und womit hab ich das verdient?«, fragte Thorne.
Brigstocke setzte sich und beugte sich zu seinem Glas. Nippte an dem Mineralwasser. »Muss doch keinen besonderen Grund geben. Ein Essen unter Freunden.«
»Vor ein paar Wochen in Ihrem Büro hab ich nicht viel von Freundschaft gemerkt.«
Brigstocke sah ihm in die Augen, hielt den Augenkontakt, so lange es angenehm blieb. »Aber ich war Ihr Freund, Tom.«
Darauf folgte betretenes Schweigen, das erst unterbrochen wurde, als ein Schrank von einem Mann, der in der Ecke neben Thorne gesessen hatte, sich mit lautem Gemurmel an ihm vorbeidrängte.
Thorne nahm seine abgewetzte braune Lederjacke von der Stuhllehne und legte sie auf die Bank neben sich, machte es sich bequem, nachdem er mehr Platz hatte. Es war viel los in dem Pub, aber nun waren sie ungestörter.
»Entweder Sie möchten mal ordentlich jammern«, sagte Thorne, »oder es gibt einen Fall, der Ihnen unter den Nägeln brennt.«
Brigstocke schluckte und klopfte an sein Glas. »Von beidem etwas.«
»Midlife-Crisis?«, fragte Thorne.
»Was?«
Thorne deutete mit seinem Glas. »Schicke neue Brille. Eine Diät. Haben Sie was am Laufen, Russell?«
Brigstocke wurde leicht rot und fuhr sich durch die dichten schwarzen Haare. »Könnte man meinen, so wenig Zeit, wie ich zu Hause bin.«
»Die Pennermorde, stimmt’s?« Grinsend genoss Thorne Brigstockes Überraschung. »Ist ja nicht so, als wär ich in Timbuktu oder Russland gewesen. Ich hab vor ein paar Tagen mit Dave Holland telefoniert. Und davor hab ich in der Zeitung ein bisschen was darüber gelesen. Zwei Tote, oder?«
»Es waren zwei Tote ...«
»Scheiße ...«
»Allerdings. Uns steht die Scheiße bis zum Hals.«
»Die Sache wird unter Verschluss gehalten, stimmt’s? In der Zeitung war nur wenig drüber zu lesen.«
»Bis gestern Abend. Für morgen Nachmittag ist eine Pressekonferenz anberaumt.«
»Schießen Sie los ...«
Brigstocke beugte sich über den Tisch und fing an zu reden, gerade laut genug, dass Thorne ihn über Dido hinweg hören konnte, die aus den Lautsprechern über der Bar wimmerte.
Drei Tote bislang.
Die erste Leiche war vor fast einem Monat entdeckt worden. Ein Obdachloser Mitte vierzig, der in einer Seitenstraße in der Nähe des Golden Square aufgefunden wurde. Vier Wochen waren seither vergangen, und seine Identität war noch immer nicht bekannt.
»Wir haben mit anderen Pennern in der Gegend gesprochen und haben nicht mal so was wie einen Spitznamen. Sie meinen, er war neu. Jedenfalls hatte er sich noch nicht bei den Hilfsorganisationen in der Gegend gemeldet. Einige von diesen Leuten machen sofort auf Kumpel, und andere wollen ihre Ruhe. Wie überall.«
»Sozialamt?«
»Überprüfen wir noch. Verpasste Termine etc. Aber ich erwarte nicht zu viel. Nicht alle melden sich. Es gibt genug auf der Straße, die wollen gar nicht gefunden werden.«
»Von jedem gibt es irgendwo irgendwelche Dokumente, oder? Eine Geburtsurkunde, irgendwas.«
»Vielleicht hat er seine Sachen irgendwo hinterlegt, wo sie sicher sind. In dem Fall bleiben sie dort auch die nächste Zeit. Wir müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er sie bei sich trug und der Mörder sie ihm abnahm.«
»Wie auch immer, ihr wisst nichts.«
»Er hat ein Tattoo, das ist alles. Ein ziemlich ungewöhnliches Tattoo. Das ist das Einzige, was wir im Augenblick wissen ...«
Weniger schwierig war es, den Namen des zweiten Obdachlosen herauszufinden, der vierzehn Tage später ein paar Straßen weiter entdeckt wurde. Raymond Mannion war ein bekannter Drogenabhängiger und bereits vorbestraft. Er war vor ein paar Jahren wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Zwar wurden keine Papiere bei der Leiche gefunden, aber seine DNS war gespeichert.
Die Männer waren so lange getreten worden, bis sie tot waren. Beide hatten in etwa das gleiche Alter und waren in den frühen Morgenstunden umgebracht worden. Sowohl Mannion wie auch dem unbekannten ersten Opfer war eine Zwanzig-Pfund-Note an die Brust geheftet worden.
Thorne trank einen Schluck Bier. »Eine Serie?«
»Sieht so aus.«
»Und jetzt hat es einen weiteren Mord gegeben?«
»Vorletzte Nacht. Dieselbe Gegend, dasselbe Alter, aber diesmal wurde kein Geldschein gefunden.«
»Noch etwas?«
»Er atmet noch«, antwortete Brigstocke. Thorne hob die Augenbrauen. »Nicht dass der arme Teufel was davon mitkriegt. Heißt Paddy Hayes. Liegt im Middlesex auf der Intensivstation ...«
Ein Schauer lief Thorne über den Rücken, als strichen ihm kalte Finger über die Härchen am Nacken. Er erinnerte sich an ein Mädchen, das er vor ein paar Jahren kennen gelernt hatte: Sie war von einem Mann verletzt und am Rand des Todes zurückgelassen worden, der zuvor bereits drei Frauen umgebracht hatte. Sie war völlig hilflos, wurde von Maschinen am Leben gehalten. Als sie gefunden wurde, glaubte die Polizei, der Mann, hinter dem sie her war, habe seinen ersten Fehler begangen. Bis Thorne herausfand, dass dieser Mörder es gar nicht darauf anlegte zu morden. Dass er das, was er diesem Mädchen angetan hatte, bei seinen anderen Opfern ebenfalls versucht hatte. In solchen Momenten wurde Thorne klar, mit welchen Monstren er es zu tun hatte.
Er hatte schon zu viele dieser Momente erlebt.
»Glaubt ihr, dass Hayes da reinpasst, oder nicht?«
»Wär ein ziemlicher Zufall, wenn nicht.«
»Wie habt ihr seinen Namen rausgefunden?«
»Es gab wieder keine Papiere, aber wir fanden einen Brief in seiner Tasche. Jemand aus dem Obdachlosenheim warf einen Blick auf ihn und bestätigte den Namen. Musste allerdings ziemlich genau hinsehen. Der Kopf sah aus wie ein verfaultes Stück Obst.«
»Was war das für ein Brief?«
»Der Brief stammte von seinem Sohn. Der seinem Vater schrieb, was für ein widerlicher, nutzloser Säufer er ist. Wie absolut egal es ihm sei, ob er ihn je wieder sehe.« Brigstocke stieß mit dem Finger gegen die Überreste eines Eiswürfels in seinem Glas. »Jetzt muss der Sohn darüber entscheiden, ob der Stecker gezogen wird ...«
Thorne verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Aus alldem schließe ich, das ihr nicht kurz vor einer Verhaftung steht?«
»Es lief von Anfang an hundsmiserabel«, erklärte Brigstocke. »Als wir beim ersten Fall nach einer Woche nicht von der Stelle gekommen sind, wurde die Sache unangenehm. Und als dann die zweite Leiche aufgetaucht ist, haben sie den Fall herumgeschoben wie einen Haufen Scheiße. Und dann hat es uns erwischt, und der Haufen ist auf unserem Schreibtisch gelandet. Übrigens kurz nachdem du dich in deinen Garten verabschiedet hast.«
»Die Strafe Gottes.«
»Und ob mich jemand straft. Seit drei Wochen schieben meine Leute jetzt Vierzehn-Stunden-Schichten, und wir sind keinen Schritt weiter.«
»Druck von oben?«
»Druck von allen Seiten. Der Commissioner sitzt uns im Nacken, weil ihm sämtliche Hilfsorganisationen und Interessenverbände die Hölle heiß machen. Weil wir nicht vorankommen, glauben sie wohl, dass wir auf der faulen Haut liegen und uns einen Dreck darum scheren.«
»Und stimmt das?«
Brigstocke ignorierte die Frage. »Damit ist es nun eine politische Angelegenheit, und wir sind am Arsch, weil die Obdachlosen selbst glauben, dass wir uns nicht genug reinhängen. Und deshalb mehr oder weniger aufgehört haben, mit uns zu reden.«
»Das kann man ihnen aber schlecht zum Vorwurf machen.«
»Ich werfe ihnen das doch nicht vor. Sie haben jedes Recht dazu, misstrauisch zu sein. Man darf nicht vergessen, diese Leute können keine Tür hinter sich zusperren.«
Einen Augenblick schwiegen beide. Dido war Norah Jones gewichen. Thorne überlegte kurz, ob es wohl ein Album mit dem Titel »Jazz zum Sushi« gab.
»Es gibt noch einen Grund, warum sie nicht mit uns reden«, fuhr Brigstocke fort. Thorne sah auf. »Zu Beginn der Ermittlung hat ein junger Kerl von der Straße eine Aussage gemacht. Er meinte, ein Polizist habe Fragen gestellt.«
Thorne stützte das Kinn auf die Faust. »Tut mir Leid, ich steh wohl auf der Leitung, aber ...«
»Vor dem ersten Mord. Er behauptete, ein Polizist habe einen Tag, bevor die erste Leiche auftauchte, Fragen gestellt. Ein Bild herumgezeigt. Als ob er nach jemandem sucht.«
»Nach wem sucht? Wenn ich Sie recht verstehe, geht es hier um das Opfer, das bisher noch nicht identifiziert wurde, oder?« Brigstocke nickte. »Hat derjenige, der angeblich nach ihm suchte, nicht seinen Namen genannt?«
»Wir könnten das überprüfen, wenn wir so was wie Namen und Adresse des Jungen hätten, von dem die Aussage stammt. Aber ehrlich gesagt, an der ganzen Sache ist nichts einfach, Tom.«
Thorne sah zu, wie Brigstocke trank, und genehmigte sich dann selbst einen Schluck. »Ein Bulle?«
»Wir müssen verdammt vorsichtig vorgehen.«
»Sie meinen, wegen der Presse?«
Brigstocke war gereizt und wurde etwas lauter. »Men- schenskinder, Sie wissen genau, das ist nicht der einzige Grund, warum wir das nicht überall lesen wollen ...«
»›Bewusst Details über die Vorgehensweise des Täters zurückhalten entspricht der gängigen Praxis und ist zu empfehlen.‹« Thorne gähnte theatralisch, als er aus der neuesten Ausgabe des Murder Investigation Manual zitierte, der Bibel der Kriminalbeamten.
»Genau. Zum Beispiel die Banknote, die der Mörder an die Leichen heftete. Dadurch können wir sichergehen, dass die anderen Morde nicht von Trittbrettfahrern stammten.«
»Bei Paddy Hayes steht das nicht fest«, warf Thorne ein.
»Okay ...«
Thorne war klar, dass es jede Menge vernünftige Gründe gab, nicht alles an die große Glocke zu hängen. Aber ihm war ebenso klar, dass der Anflug eines Verdachts, ein Polizist könne in einen derartigen Fall verwickelt sein, den Leuten in den Chefetagen auf den Nägeln brennen würde.
Ihm leuchtete ein, dass die Pressekonferenz morgen sinnvoll war. Der dritte Tote hatte einen raschen und radikalen Kurswechsel im Umgang mit den Medien nötig gemacht. Nun musste die Öffentlichkeit erfahren, was los war — wenn auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Es war alles im Murder Investigation Manual nachzulesen: Die Öffentlichkeit musste informiert, beruhigt und um Mithilfe gebeten werden.
Die Met musste sich natürlich absichern. Nicht auszudenken, wenn noch mehr Tote auftauchten und sie sich vorwerfen lassen müsste, die Öffentlichkeit nicht gewarnt zu haben.
»Was denken Sie?«, fragte Brigstocke. »Irgendeine Idee?«
»Ich denke, Sie sollten das mit dem Mineralwasser sein lassen und sich was Ordentliches zu trinken holen. Ein Bierbauch ist Ihre geringste Sorge.«
»Im Ernst ...«
»Im Ernst!« Thorne schwenkte den Rest Bier im Glas. »Sie hätten mich löchern sollen, bevor Sie mich auf drei Glas Stella eingeladen haben.« Er blies die Backen auf und atmete langsam aus. »Wie’s aussieht, ist wieder ein Nachmittag Rekrutierungsdemographie im Eimer.«
Drittes Kapitel
Die U-Bahn-Fahrt vom St. James Park nach Hause dauerte vierzig Minuten. Kaum war er in seiner Wohnung, machte er die Anlage an. Er wählte eine CD mit raren Studioaufnahmen und Demos aus der Zeit der American Recordings, die 2003, ein paar Monate nach dem Tod Johnny Cashs, veröffentlicht wurde. Thornes Lieblingsstück war Redemption Song, eine Coverversion des Bob-Marley-Klassikers, den Cash mit Joe Strummer aufgenommen hatte.
Thorne machte sich eine Tasse Tee und dachte darüber nach, warum Marley und Strummer so jung gestorben waren, während Mick Hucknall und Phil Collins noch immer draußen herumliefen.
Trotz seiner flapsigen Bemerkung gegenüber Brigstocke hatte er an diesem Nachmittag nicht viel geschafft. Er hatte die Zahlenkolonnen angestarrt und ab und zu auf seiner Tastatur herumgehackt, dabei aber die ganze Zeit über Paddy Hayes und die Maschinen nachgedacht, die ihn am Leben hielten. Über den Brief, den der Tote in seiner Tasche herumgetragen hatte. Wie genau der hinsehen musste, der ihn kannte, bevor er ihn identifizieren konnte.
Thorne nahm die Tasse Tee mit ins Wohnzimmer. Er setzte sich und ließ sich alles durch den Kopf gehen, was Brigstocke ihm erzählt hatte. Und warum er es ihm erzählt hatte. Nachdem diejenigen, auf die der Mörder es anscheinend abgesehen hatte, nicht mehr mit der Polizei sprachen, würden die Ermittlungen verdammt schnell ins Stocken geraten. Und schließlich auf spektakuläre Weise scheitern.
Russell Brigstocke musste schon ziemlich verzweifelt sein, wenn er sich ausgerechnet bei ihm Rat holte. Nach dem, was Thorne über den Fall gehört hatte, war seine Verzweiflung nicht unbegründet.
Was denken Sie!
In den Pausen zwischen den einzelnen Nummern konnte Thorne den Verkehrslärm von der Kentish Town Road drüben hören, das Rattern eines Zugs, der nach Camden Town oder Gospel Oak fuhr. Er sehnte sich plötzlich zurück nach den ersten paar Monaten des Jahres, als Phil Hendricks bei ihm wohnte, weil seine eigene Wohnung wegen Feuchtigkeit renoviert wurde. Es war eng und chaotisch zugegangen, Hendricks hatte auf der Schlafcouch gepennt, und sie waren mehr als einmal aneinander geraten. Ihm fiel ein, wie sie sich an dem Tag, bevor Hendricks auszog, betrunken und über Fußball gestritten hatten. Das müsste ein paar Wochen vor dem Brand gewesen ...
Vor dem Brand. Nicht »bevor mein Vater starb«.
So tickte er inzwischen: den Weg des geringsten Widerstands, immer schön abstrahieren. Es gab einen Brand. Der Brand war Tatsache. Der Tod seines Vaters natürlich auch. Aber allein die Formulierung dieses Satzes öffnete selbstquälerischen Zweifeln Tür und Tor. Machte ihn fertig. Sprengte den Panzer des Alltagseinerleis und weitete diesen Riss, bis er weit aufklaffte. Bis Thorne nichts anderes übrig blieb, als sich in sich zurückzuziehen und darauf zu warten, dass das Brennen in seinem Bauch und das Dröhnen in seinem Kopf nachließen.
Vermutlich hatte Hendricks die Autopsie an Mannion und dem ersten Opfer durchgeführt. Und führte wohl auch die Autopsie an Hayes durch, wenn es so weit war. Hendricks hatte bei ihrem Gespräch den Fall nicht erwähnt, andererseits hatte Holland sich ebenfalls bedeckt gehalten. Thorne war klar, dass die beiden ihn schützen wollten. Sie fanden, er war besser dran, so wie es war. Wenn er außen vor war.
Trauerarbeit und Arbeit schlossen einander aus, zumindest glaubten das die meisten.
Irgendeine Idee!
Vielleicht, allerdings war er sich nicht sicher, wie schlau sie war.
Als er ans Fenster trat, spürte Thorne den Luftzug, der durch den Rahmen kroch. Es war noch nicht so lange her, da war das ganze Land lahm gelegt, weil die Temperaturen weit über 30 Grad stiegen. Jetzt, in der dritten Augustwoche, lag der Sommer in den letzten Zügen. Für die Leute, denen nichts anderes übrig blieb, als auf der Straße zu leben, bedeutete ein strenger Winter mehr als die Angst vor geplatzten Rohren oder Glatteis.
Es war noch nicht so lange her ...
Thorne blinzelte, spürte wieder den Kirchenstuhl unter sich. Erinnerte sich an seinen eigenen Körpergeruch, als er in dem schwarzen Anzug schwitzte. Nicht mehr als ein Dutzend Leute, und davon waren die meisten gekommen, um ihm Beistand zu leisten. Die Schweißperle, die ihm hinter dem Ohr in den engen weißen Hemdkragen lief. Das Wissen, gleich aufstehen und etwas sagen zu müssen ...
So wie jetzt konnte er nicht weitermachen. Und er war noch nicht so weit, seinen alten Job zu machen. Er sollte sich auf seine Trauerarbeit konzentrieren, aber die Schuldgefühle erstickten alles Leben.
Er hastete ans Telefon und wählte.
»Überlegt doch mal, ob ihr nicht einen von uns zu den Obdachlosen schickt, der verdeckt ermittelt.« Thorne war sich nicht sicher, ob Brigstocke über seinen Vorschlag nachdachte oder ob es ihm die Sprache verschlagen hatte. »Das macht Sinn«, fuhr er fort. »Keiner redet mit euch. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.«
»Das würde zu lange dauern.«
»Warum denn? Es ist nicht kompliziert. Ihr schickt einen Beamten auf die Straße, zu den Obdachlosen. Wir brauchen nur eine einfache Möglichkeit, ihn zu kontaktieren.«
»Ich rede mit Jesmond, mal sehen, was er dazu meint. Ob er einen geeigneten Mann dafür finden kann. Danke für den Anruf, Tom ...«
»Überlegt es euch.«
Wieder Schweigen, wenn auch kürzer. Und dann, nach einem Räuspern: »Wie viel haben Sie nach dem Lunch noch getrunken?«
»Ich kann das machen, Russell. Ich hab die Ausbildung dazu ...«
»Lassen Sie den Blödsinn. Einen Undercover Two Course?«
»Genau ...«
»Und vor wie vielen Jahren war das?«
Thorne blendete Brigstocke kurz aus. Elvis rieb sich an seinem Bein. Wer ihn wohl fütterte, wenn er eine Weile weg war? Vielleicht die Frau in der Wohnung über ihm, wenn er sie freundlich darum bat. Sie hatte selbst ein paar Katzen ...
»Ich tauche ja nicht gerade in eine Mafiaorganisation ein«, sagte Thorne. »Ich sehe nicht, wo das Risiko sein könnte. Ein paar Infos sammeln, das ist alles.«
»Das ist alles!«
»Ja.«
»Da draußen ist ein Typ, der Leute tottritt, spielt das etwa keine Rolle für Sie?«
»Doch, ich will diesen Arsch dingfest machen.«
»Und wie? Glauben Sie, Sie können ihn ... aus der Reserve locken, oder was?«
»Ich weiß nicht, wie ich ...«
»Wie soll es irgendjemandem helfen, wenn Sie sich selbst in Gefahr bringen, Tom? Wie soll es Ihnen helfen?«
»Ich will doch nur auf der Straße schlafen, verdammt noch mal. Angenommen, dieser Mörder läuft noch immer da draußen rum, wie kann er mir gefährlich werden, wenn er gar nicht weiß, dass ich da draußen bin?«
Er hörte am anderen Ende der Leitung ein Feuerzeug klicken. Eine kurze Pause, und dann wurde lautstark Rauch ausgeblasen.
»Die Maus weiß nichts von dem Käse in der Falle«, sagte Brigstocke. »Und trotzdem nennen wir es Köder ...«
Viertes Kapitel
Wenn plötzlich ein Mann vor seine Füße springen würde, einen bluttriefenden Schädel in der einen Hand und ein blutverschmiertes Hackebeil in der anderen, und dabei stammelte, die Stimmen in seinem Kopf hätten ihn dazu getrieben, dann wäre Detective Superintendent Trevor Jesmond wohl etwas von der Rolle. Aber das Murder Investigation Manual kannte er auswendig. Und was das Kapitel über »Kommunikationsstrategien« — siebtes Kapitel, siebter Teil, zweiter Abschnitt (Umgang mit den Medien) — anging, konnte ihm niemand das Wasser reichen.
»Lassen Sie mich noch einmal darauf hinweisen, dass das Opfer dieses verabscheuungswürdigen Verbrechens zu den verwundbarsten Mitgliedern unserer Gesellschaft gehört. Wir gehen davon aus, dass der Angreifer bereits zwei Menschen umgebracht hat. Verstehen Sie uns nicht falsch, wir werden alles tun, was nötig ist, um den Täter zu fassen, bevor er erneut Gelegenheit hat zu töten.«
Sie waren im Presseraum der Colindale Police Station zusammengekommen, fünf Minuten entfernt vom Peel Centre, wo die Murder Squad im Becke House untergebracht war. Thorne sah sich die Sache von hinten aus an, über die Köpfe von mehreren Dutzend Schreiberlingen hinweg. Beugte sich mal in die eine, dann in die andere Richtung, um zwischen den Kamerastativen hindurch auf die Bühne zu spähen.
»Geht man davon aus, dass sein letztes Opfer überlebt?«
»Mr. Hayes befindet sich in einem kritischen Zustand. Er liegt auf der Intensivstation des Middlesex Hospital und wird künstlich am Leben erhalten. Ohne Rücksprache mit den verantwortlichen Ärzten ist es mir leider unmöglich, Ihnen darüber hinaus Auskunft zu geben.«
Nicht allzu vielen Leuten im Raum konnte verborgen geblieben sein, dass Paddy Hayes so gut wie hinüber war.
»Sie deuteten an, zwischen dem versuchten Mord an Mr. Hayes und den zwei anderen Morden an Obdachlosen bestehe möglicherweise ein Zusammenhang. Es handle sich dabei um den letzten Fall einer Serie ...«
Jesmond hob die Hand, nickte. Er gab zu verstehen, dass der Journalist richtig lag, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Außerdem wollte er ihn in seiner Fragewut bremsen. Natürlich waren sie mit dem Eingeständnis an die Öffentlichkeit gegangen, dass die Morde zusammenhingen. Die Boulevardpresse würde eins und eins zusammenzählen, und die Met konnte es sich nicht leisten, dumm daneben zu stehen und so zu tun, als wäre sie selbst nicht darauf gekommen.
»Wir müssen von einem Zusammenhang ausgehen, ja«, sagte Jesmond.
»Haben wir es dann mit willkürlichen Morden zu tun? Keine Motive, nur sinnlose Gewalt?«
Die grimmige Andeutung eines Lächelns. »Detective Inspector Brigstocke und sein Team denken, sie haben es mit einem Mörder zu tun, der nicht zum ersten Mal zuschlug. Die Ermittlung geht in diese Richtung, und auf diesem Weg werden wir wohl weiterkommen.«
Er machte das hervorragend. Diese Gratwanderung zwischen Zuversicht an den Tag legen und übertriebene Hoffnungen dämpfen. Entscheidend war natürlich, jede öffentliche Panik zu vermeiden.
Thorne war, wie Jesmond, klar, dass nichts von dem, was hier gesagt wurde, die Presse davon abhalten konnte, mit einer großen Story über einen Serienmörder aufzumachen. Damit ließen sich mehr Zeitungen verkaufen als mit Posh oder Beckham, und die Herausgeber in der Fleet Street hatten keine Skrupel, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen.
Ein Ausdruck, den Thorne hasste. Er hatte eine ganze Reihe dieser Typen gefasst — oder eben auch nicht gefasst — , die Menschen umbrachten, die sie nicht kannten, und keiner hatte auch nur die geringste Ähnlichkeit mit diesem Monster gehabt, das man sich unter einem »Serienmörder« vorstellte. Die Männer und Frauen, die er kennen lernte und die mehr als einen Mord begangen hatten, hatten ihrer Meinung nach gute Gründe für ihr Handeln. Keiner hatte sich für einen Übermenschen gehalten oder seine Opfer gejagt, wenn der Vollmond am Himmel stand. Ihre Motive hatten nichts damit zu tun, dass sie als Kind in den Keller gesperrt oder gezwungen wurden, die Kleider ihrer Mutter zu tragen ...
»Wie immer ersuchen wir die Öffentlichkeit, uns mit Hinweisen zu helfen, diesen abscheulichen Übergriffen ein Ende zu setzen.«
Ein Aufruf wie aus dem Lehrbuch. Jesmond nannte die wichtigen Fakten und forderte jeden, der über sachdienliche Informationen verfügte oder sich in der Nähe des Tatorts befand, auf, seiner Pflicht nachzukommen und sich bei der Polizei zu melden. Wahrscheinlich war das Ganze umsonst. Wer trieb sich schon mitten in der Nacht in finsteren Seitenstraßen herum? Und falls sich doch jemand dort aufhielt, sprach einiges dagegen, dass er sich melden würde. Dennoch musste man die Öffentlichkeit mit einbeziehen und die entsprechenden Details bekannt geben: exakte Zeitangaben und Örtlichkeiten. Das Letzte, was sie brauchten, war ein vage gehaltener, allgemeiner Aufruf, der die falsche Botschaft vermittelte.
Wir haben keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber irgendwer da draußen weiß mehr. Bitte helft uns ...
»Wir werden den Täter fassen«, bekräftigte Jesmond, als er zum Schluss kam. Das Vertrauen der Öffentlichkeit war wichtig, und es hing entscheidend von seiner eigenen Zuversicht ab, die er nun ganz bewusst zur Schau stellte. Herz und Verstand des Publikums gewann man nicht, indem man um den heißen Brei herumredete. Seine Körpersprache war dynamisch, und sein Gesichtsausdruck wirkte entschlossen. Thorne konnte sich gut vorstellen, wie er auf einem Wochenendlehrgang in einem Hotel auf dem Land gelernt hatte, diese Wirkung zu erzielen. Er erweckte den Eindruck, als wolle er den Anwesenden das Motto einbläuen, das in Riesenlettern auf dem schicken blauen Metropolitan-Police-Plakat hinter ihm prangte: »Für ein sichereres London«.
Natürlich war alles nur Mambojambo.
Die Pressekonferenz sollte vor allem den Eindruck von Zuversicht und Effektivität vermitteln, aber Thorne war klar, dass die Ermittlung feststeckte. Es war nicht sonderlich schwer, Ressourcen aufzufahren, Polizisten aufmarschieren zu lassen und so zu tun, als sei der Mörder so gut wie hinter Gittern, wenn es mit einer Fünfundvierzig-Minuten-Show für die Medien getan war.
Thorne fragte sich nur, wie jemand darauf hereinfallen konnte.
Er wartete auf dem Parkplatz auf Jesmond und überlegte, wie er ihm sein Vorhaben am besten schmackhaft machte.
Als er die Tür hörte, blickte Thorne auf und sah zwei Männer herauskommen. Einen kannte er, und er versuchte sofort, sich wegzudrehen, um nicht entdeckt zu werden. Aber es war schon zu spät. Ihm blieb nichts übrig, als zu lächeln und freundlich zu nicken. Der Mann, dem er nicht hatte begegnen wollen, erwiderte seinen Gruß und kam zu Thornes Entsetzen in Begleitung des zweiten Mannes, der Thorne irgendwie bekannt vorkam, auf ihn zu.
Steve Norman arbeitete als Pressesprecher bei der Polizei, war also nicht selbst Polizist. Er war klein und drahtig, hatte dichtes schwarzes Haar und ein aufgeblasenes Ego. Er und Thorne hatten vor ein paar Jahren wegen eines Falles die Klingen gekreuzt.
»Tom ...« Norman war noch zwei Meter entfernt und streckte ihm bereits die Hand entgegen.
Thorne schüttelte sie. Dabei fiel ihm eine unerfreuliche Begegnung ein, bei der Norman ihm den Zeigefinger in die Brust gerammt und er selbst ihm gedroht hatte, ihm den Finger zu brechen ...
»Ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu treffen«, fuhr Norman fort.
Der Gärtnerurlaub hatte sich also herumgesprochen. Mit einem Blick auf das Hauptgebäude meinte Thorne: »Die Konferenz lief ganz gut.« Natürlich war Norman entscheidend daran beteiligt gewesen. Thorne hatte ihn mit einem selbstzufriedenen Gesichtsausdruck am Rand stehen sehen. Einmal war er sogar zu Russell Brigstocke gegangen und hatte ihm etwas ins Ohr geflüstert.
Norman legte seinem Freund die Hand auf den Arm und sah zu Thorne. »Kennt ihr beiden euch ...?«
Thorne streckte die Hand aus. »Entschuldigen Sie, Tom Thorne ...«
Der Mann, den Norman selbstgefällig als »Alan Ward, von Sky« vorstellte, machte einen Schritt auf Thorne zu und schüttelte ihm die Hand. Er war Mitte vierzig, kräftig gebaut und einen Kopf größer als Thorne und Norman.
»Freut mich, Sie kennen zu lernen«, sagte Ward. Er trug eine große Nickelbrille unter einem dichten grauen Lockenschopf. Er steckte die Hand zurück in die Tasche seines — wie Thorne es genannt hätte — Baumwollsakkos.
»Ebenfalls ...«
Die typisch britische Verlegenheit folgte. Thorne wäre am liebsten gegangen, ließ es aber, weil er nicht wusste, wohin, und nicht unhöflich erscheinen wollte. Auch Norman und Ward, die sich gerade unterhalten hatten, waren zu höflich, um sich sofort auf den Weg zu machen. Sie blieben stehen und fuhren in ihrem Gespräch fort, während Thorne von einem Fuß auf den anderen trat und zuhörte und dabei so tat, als wären sie alte Freupde.
»Ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal auf einer Pressekonferenz gesehen zu haben, Alan«, sagte Norman.
»Es handelt sich um eine Meldung, also bringen wir sie.«
»Aber doch nicht ganz in Ihrem Bereich?«
Ward schaute über Normans Kopf hinweg, während er antwortete, als habe er eine atemberaubende Aussicht vor sich. »Gott sei Dank bomben wir gerade im Augenblick niemanden in Grund und Boden, ich kann also die Crew moralisch unterstützen und auf ein, zwei Neue ein Auge haben.«
Man grinste und schwieg wieder. Thorne fand, er müsse etwas sagen, um seine Anwesenheit zu rechtfertigen. »Was machen Sie denn beruflich, Alan?«
Stolz antwortete Norman für Ward. »Alan arbeitet beim Fernsehen. Er ist Journalist, und normalerweise berichtet er von Schauplätzen, wo ein bisschen mehr los ist als in Colindale.«
»Tottenham?«, fragte Thorne.
Ward lachte und wollte etwas sagen, aber wieder war Norman schneller. »Bosnien, Afghanistan, Nordirland.« Mit geschwellter Brust zählte Norman die Namen auf. Thorne fand, dass er angab wie ein kleiner Junge mit seinem neuen Fahrrad. Dass es ihn geradezu aufgeilte, jemanden wie Ward zu kennen, wobei es nicht wichtig war, wie eng die Freundschaft tatsächlich war.
Ein Blick auf Ward, und Thorne wusste, wie peinlich diesem das war und dass die beiden nicht wirklich gute Freunde waren. Das diskrete Augenverdrehen, das Thorne bemerkte, genügte, um ihm zu sagen, dass auch Ward Norman für ein ausgemachtes Arschloch hielt. Sofort fand er Alan Ward ungemein sympathisch.
Und nun war es an Thorne, den Fuß aus dem Fettnapf zu ziehen. »Sie kamen mir irgendwie bekannt vor«, erklärte er. »Es hat nur etwas gedauert, bis mir klar wurde, woher. Ich hab Sie im Fernsehen gesehen, stimmt’s?«
Norman wirkte, als mache er sich jeden Moment vor Aufregung in die Hose.
»Sie empfangen Sky?«, fragte Ward.
»Hauptsächlich wegen des Fußballs, muss ich gestehen.«
»Sind Sie Arsenal-Fan?«
»Gott, nein!«
In diesem Moment sah Thorne über Normans Schulter hinweg Trevor Jesmond durch die Tür kommen. Jesmond blickte herüber, erstarrte und versuchte rasch — wie Thorne ein paar Minuten früher — , sich unentdeckt aus dem Staub zu machen. Entsetzt, dass es überhaupt etwas gab, das er mit Jesmond gemein hatte, hob Thorne die Hand.
»Also dann ...«, sagte Norman.
Zur offensichtlichen Freude des Pressesprechers verabschiedete sich Thorne hastig. Ward schüttelte ihm noch einmal die Hand und gab ihm eine Visitenkarte. Als Thorne ging, rief ihm der Journalist noch etwas nach, das er nicht ganz verstand. Über Freikarten für Fußballspiele.
Er holte Jesmond ein, als der Detective Superintendent seinen Wagen erreichte.
»Sollten Sie nicht bei Scotland Yard sitzen?«
»Ich wollte gerne wissen, ob DCI Brigstocke etwas zu Ihnen gesagt hat, Sir.«
Jesmond drückte den Knopf auf seinem Autoschlüssel, um das Auto zu entriegeln. Er öffnete die Tür des Rover und warf seine Mütze und seine Aktentasche auf den Beifahrersitz.
»Mein Beileid habe ich Ihnen bereits ausgesprochen ...«
»Sir ...«
»Doch wenn dieses Ereignis Sie derart emotional belastet, dass Sie vorübergehend nicht in meinem Team mitarbeiten können, wie kommen Sie dann in drei Teufels Namen auf die Idee, Sie könnten als verdeckter Mitarbeiter gute Arbeit leisten?«
»Ich glaube nicht, dass mein Vorschlag ... sonderlich kompliziert ist«, erklärte Thorne. »Ich denke, ich bin absolut dazu in der Lage ...«
Jesmond unterbrach ihn und blinzelte langsam. »Womöglich liegt es genau daran.« Seine Wimpern waren rotblond, hoben sich kaum ab von seiner trockenen Haut. Er legte es vielleicht darauf an, klug und nachdenklich zu wirken. Doch Thorne entging nicht, wie sich die schmalen Lippen zu einem — wie er fand — affektierten Grinsen verzogen. »Womöglich liegt es gerade an Ihrem Gemütszustand, dass Sie glauben, dies tun zu müssen. Dass Sie sich dafür geeignet halten. Und diesen Job als geeignet für Sie halten. Hab ich ins Schwarze getroffen, Tom? Wollen Sie das härene Büßergewand überstreifen und auf der Platte pennen?« Darauf wusste Thorne nichts zu entgegnen. Er wich Jesmonds Blick aus und beobachtete, wie das Licht von der Chromeinfassung des Blinklichts reflektiert wurde und auf die Knöpfe von Jesmonds makelloser Uniform fiel.
»Hören Sie, ich behaupte ja nicht, dass die Idee komplett blöd ist«, fuhr Jesmond fort. »Sie hatten schon blödere Einfälle.«
Thorne grinste und sah einen Funken Hoffnung. »Die kommt nicht mal in die Top Ten.«
»Und was dafür spricht ... Selbst wenn Sie es vergeigen, haben wir nicht viel zu verlieren.«
»Wir haben nichts zu verlieren.«
»Geben Sie mir ein, zwei Tage Zeit, ja?« Jesmond trat zwischen Thorne und die Autotür. »Es ist nicht allein meine Entscheidung. Ich muss mit den Leuten von SO10 reden.«
»Ich bin mir sicher, das könnte uns weiterbringen«, beharrte Thorne.
»Wie gesagt, ein, zwei Tage.«
»Und wir könnten es schnell über die Bühne bringen. Ohne lange Anlaufzeit. Wir machen’s einfach.« Er sah Jesmond in die Augen und versuchte, gelassen zu wirken, während sein Magen sich verkrampfte. »Kommen Sie schon. Sie haben diese kaputten Typen gesehen. Wie sie mit einer Dose billigem Bier in der Hand durch die Gegend torkeln und auf Gott und die Welt schimpfen. Sie kennen mich. Wo liegt da das Problem für mich?«
Fünftes Kapitel
Die Laune des Besitzers hatte sich offensichtlich nicht gebessert, als er den Tisch abräumte. Holland hatte zu Hause bereits gefrühstückt, gab sich jedoch Mühe mit seinem Schinkensandwich. Thorne hatte in Rekordzeit das größte aller großen englischen Frühstücke verdrückt.
»Die Eier waren hart«, bemerkte Thorne.
»So? Aber gegessen haben Sie sie. Wenn’s Ihnen hier nicht passt, dann verschwinden Sie.«
»Wir hätten gerne noch zwei große Tassen Tee.«
Der Besitzer verdrückte sich wieder hinter seinen Tresen. Inzwischen war wesentlich mehr los in dem Cafe, und er hatte alle Hände voll zu tun. Es ließ sich daher nur schwer sagen, ob er ihnen den Tee tatsächlich bringen würde.
»Könnten Sie nicht einen Grund finden, den Typen einzusperren?«, fragte Thorne. »Zum Beispiel, weil er innerhalb einer geschlossenen Ortschaft mit einer Riesenwampe und einer fiesen Laune herumläuft?«
»Ich bin mir nicht sicher, wen er mehr hasst, Bullen oder Penner. Anscheinend sind wir schlecht fürs Ambiente.«
»Scheiß auf den Typen. Ist ja nicht das Ritz hier.«
»Auf dem Weg hierher hab ich ein paar Zeitungen gekauft«, sagte Holland. Er zog einen Stapel aus seiner Tasche und legte sie auf den Tisch. »Unser Bild von dem ersten Opfer ist heute so gut wie auf allen Titelseiten.«
Thorne griff nach den Zeitungen. »Fernsehen?«
Holland nickte. »Läuft auf allen Kanälen. Und ist der Aufmacher von London Tonight. Schwer zu übersehen ...«
Thorne blickte gebannt auf die Seite vor ihm. Das erste Opfer hatte lange Haare und einen Bart. Die Augen mit ihren schweren Säcken wirkten lebendig, dunkel und zusammengekniffen, Aufmerksamkeit einfordernd: Erkenn mich.
»Was halten Sie davon?«, fragte Holland.
Thorne überflog den Text neben den Bildern. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Fakten: grotesk, wie viel man über den Tod dieses Mannes wusste und wie wenig über das Leben, das man ihm genommen hatte.
Und dann das Tattoo. Die seltsame Buchstabenkombination, die man auf der Schulter des Opfers entdeckt hatte. Von Anfang an hatte man große Hoffnung darauf gesetzt — wie Thorne im Pub von Brigstocke erfahren hatte — , damit die Leiche identifizieren zu können. Doch die Hoffnung hatte sich als ebenso flüchtig erwiesen, wie das Tattoo dauerhaft war.
AB—
S.O.F.A.
Die Entscheidung, auf den Abdruck eines Fotos zu verzichten, war eine Frage des Geschmacks gewesen, die sich beim Gesicht des Opfers nicht gestellt hatte: Hier hatten sie keine andere Wahl, als ein computergeneriertes Bild zu nehmen. Und das nicht nur, weil Einzelheiten nicht mehr zu erkennen waren. Es war nicht einmal als Gesicht zu erkennen: Jeder Gesichtszug war in den Kopf des Opfers getreten oder gestampft worden. Der unbeschädigte Kopf, den nun tausende von Leuten über ihr Müsli hinweg anstarrten, war von einem Mikrochip auf Basis der Knochen und Blutergüsse erstellt worden.
»Wie in King’s Cross«, sagte Thorne. »Das haben sie mit dem Toten damals auch gemacht, den sie nicht identifizieren konnten.«