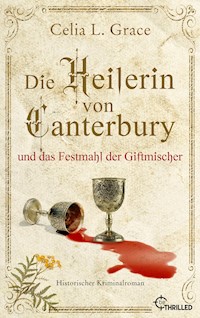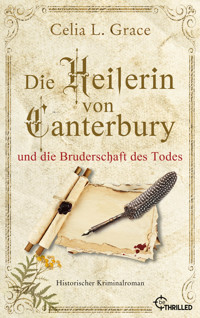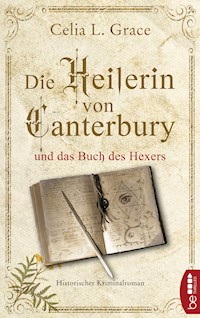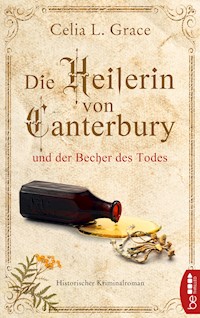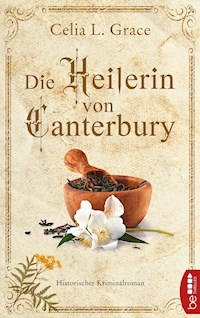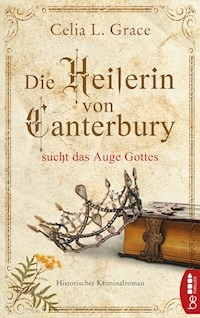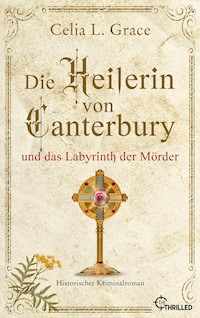
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für die Ärztin
- Sprache: Deutsch
Canterbury 1472: Der Bischof von Canterbury ruft einmal mehr die Ärztin und Heilerin Kathryn Swinbrooke zu Hilfe: Aus dem Kloster wurde die heilige Reliquie »Lacrima Christi« gestohlen! Kathryn soll den überaus wertvollen Rubin wiederfinden. Doch dann wird auch noch Sir Walter Maltravers, der Eigentümer und Leihgeber der Reliquie, kurz darauf brutal ermordet! Hängen die beiden Verbrechen gar zusammen? Als bald noch ein weiterer Mord geschieht, wird Kathryn klar, dass sie schnell handeln muss, um weitere Tote zu verhindern - oder gar selbst zur Zielscheibe zu werden!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Historische Anmerkung
Historische Personen
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Anmerkungen der Autorin
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Canterbury 1472: Der Bischof von Canterbury ruft einmal mehr die Ärztin und Heilerin Kathryn Swinbrooke zu Hilfe: Aus dem Kloster wurde die heilige Reliquie »Lacrima Christi« gestohlen! Kathryn soll den überaus wertvollen Rubin wiederfinden. Doch dann wird auch noch Sir Walter Maltravers, der Eigentümer und Leihgeber der Reliquie, kurz darauf brutal ermordet! Hängen die beiden Verbrechen gar zusammen? Als bald noch ein weiterer Mord geschieht, wird Kathryn klar, dass sie schnell handeln muss, um weitere Tote zu verhindern – oder gar selbst zur Zielscheibe zu werden!
Celia L. Grace
Die Heilerin von Canterbury und das Labyrinth der Mörder
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marion Balkenhol
»Und nach seinem Tod hat ein Tier keine weiteren
Qualen; doch der Mensch muss nach seinem Tod
weinen und klagen, ...«
GEOFFREY CHAUCER, DIE CANTERBURY-ERZÄHLUNGEN
»Im Mittelalter gab es Ärztinnen, die auch in
Kriegswirren und während großer Epidemien unbeirrt
praktizierten, wie sie es immer schon getan hatten,
einfach weil man sie brauchte.«
KATE CAMPBELLTON HURD-MEAD,GESCHICHTE DER FRAUEN IN DER MEDIZIN
Historische Anmerkung
Im Jahr des Herrn 1453 fiel die Stadt Konstantinopel an die Türken – damit endete das Byzantinische Zeitalter. Der Fall dieser erhabenen Stadt sandte Schockwellen durch ganz Europa. Viele Legenden rankten sich um diese Niederlage, obwohl die Stadt durch ständige Angriffe bereits geschwächt war und der Westen nur wenig Unterstützung geleistet hatte. Der letzte Kaiser von Konstantinopel starb, das Schwert noch in der Hand, im Kreise seiner Warägergarde, und eintausend ruhmreiche Jahre gingen zu Ende. Der Untergang der Byzantiner hatte kulturelle Folgen für das gesamte Abendland. Ein Teil der prächtigen Schätze und gut ausgestatteten Bibliotheken flutete nach Europa und förderte das Aufkommen des Neuen Denkens, das man später die Renaissance nannte.
Nur zwei Jahre später fiel der Samen der Gewalt auch in England auf fruchtbaren Boden: Die sogenannten Rosenkriege begannen, als Richard, der Herzog von York, zum »Beschützer Englands« ausgerufen wurde, weil Henry VI., der König aus dem Hause Lancaster, angeblich dem Wahn verfallen war. Henry VI. erholte sich am Ende wieder, Richard wurde entmachtet und durch die Beauforts unter Herzog von Somerset ersetzt, der die Anhänger des Hauses Lancaster in ihrem blutigen Kampf gegen das Haus York angeführt hatte. Somerset und die Königin, Margaret von Anjou, wurden in England in eine Reihe verzweifelter Schlachten verwickelt, um ein für alle Mal zu klären, ob die Krone dem Hause Lancaster oder dem Hause York gebührt.
Richard von York fand in der Schlacht zu Wakefield im Jahre 1460 den Tod. Ein Jahr später errang sein Sohn Edward einen entscheidenden Sieg bei Towton in Yorkshire. In den nächsten zehn Jahren pendelte das Glück zwischen beiden Häusern. 1471 brachte Edward dem Hause Lancaster zwei entscheidende Niederlagen bei: in Barnet beim Anmarsch auf London und bei Tewkesbury im West County. Edward von York ernannte sich selbst als Edward IV. zum König, während Henry VI. im Dunkel der Geschichte verschwand. So war der einzige überlebende Thron-Anwärter des Hauses Lancaster der mittellose Henry Tudor, der sich auf den Höfen in ganz Europa herumtrieb ...
Historische Personen
DAS HAUS LANCASTER
Henry VI.: Henry von Lancaster, Sohn des großen Henry V.; manche hielten ihn für einen Narren, andere verehrten ihn als Heiligen, für einige war er beides. Unter seiner schwachen, unfähigen Herrschaft brach der grausame Bürgerkrieg zwischen den Häusern York und Lancaster aus.
Margaret von Anjou: französische Gemahlin von Henry VI. und die eigentliche Macht hinter dem Thron; ihre Hoffnungen auf einen Sieg wurden endgültig zunichte gemacht durch herausragende Siege der gegnerischen Truppen bei Barnet und Tewkesbury in den ersten Monaten des Jahres 1471.
Beaufort von Somerset: führender General und Politiker des Hauses Lancaster; angeblich Geliebter Margarets von Anjou, bei Tewkesbury gefallen.
Henry Tudor: der letzte Thronanwärter des Hauses Lancaster; etwa um 1473 an den Höfen Frankreichs und in der Bretagne im Exil.
DAS HAUS YORK
Richard von York: Vater Edwards IV.; Richards schrankenlose Machtgier führte zum Ausbruch der Feindlichkeiten zwischen den Häusern York und Lancaster. In der Schlacht bei Wakefield im Jahre 1460 wurde er in einen Hinterhalt gelockt und getötet.
Cecily von York (geb. Neville): »Die Rose von Raby«; Witwe Richards von York. Sie hatte vier Söhne: Edward IV., Edmund von Rutland, George von Clarence und Richard von Gloucester.
Edward IV.: erfolgreicher General der Yorkisten und späterer König.
Edmund von Rutland: Edwards Bruder, fand wie sein Bruder den Tod bei Wakefield.
George von Clarence: der gut aussehende, aber heimtückische Bruder Edwards IV.; wechselte im Bürgerkrieg die Seiten.
Richard von Gloucester: jüngster Bruder Edwards IV.; spielte beim Sieg der Yorkisten 1471 eine führende Rolle.
ENGLISCHE POLITIKER
Thomas Bourchier: betagter Erzbischof von Canterbury.
William Hastings: Gefolgsmann von Edward IV.
Prolog
Hüte deine Zunge wohl und denke an die Krähe.
GEOFFREY CHAUCER
Die Votivkapelle St. Michael and All the Angels in der Franziskanerkirche Greyfriars zu Canterbury, der Stadt des Königs, wurde von einem Chronisten als »ein Juwel in einem Juwel« beschrieben. Greyfriars mit den honigfarbenen Ziegeln und dem dunkelroten Schieferdach war eine schöne Kirche. Die Fenster waren verbreitert und mit buntem Glas gefüllt worden, auf dem Szenen aus der Bibel dargestellt waren. Im Hochsommer, flimmernd in der starken Sonne, entwickelten diese Bilder ein Eigenleben und tauchten das Kircheninnere in ein lebhaftes, prächtiges Farbenspiel. Greyfriars war im Laufe der Jahrhunderte vergrößert und ausgebaut worden, man hatte Querschiffe hinzugefügt und Dächer ersetzt. Die weiß getünchten Wände waren jetzt mit atemberaubenden Bildern und Mosaiken bedeckt. An einem milden Sommerabend fiel es leicht zu glauben, dass eine solche Kirche wahrhaftig das Haus Gottes und das Tor zum Himmel war. Der marmorne Hochaltar mit den goldenen Kerzenständern war durch die Tür des kunstvoll geschnitzten Lettners zu erahnen, der die Kreuzigung Jesu Christi und andere Szenen aus seinem Leidensweg darstellte. An jenem Donnerstagabend im August 1473 war es im Kirchenschiff ruhig, ein paar Kerzen blakten schwach in der Marienkapelle zur Linken des Hochaltars; auf der anderen Seite leuchteten in einem Schrein, der dem Heiligen Franziskus gewidmet war, zwei große Kerzen in ihren Windlichtern aus rotem Glas. Ein Hort des Friedens, bis auf den Taschendieb, der den Gnadenstuhl im Allerheiligsten besetzte. Unruhig und unbehaglich krallte er sich an die Armlehnen und starrte zum Hochaltar hinauf, die Augen starr auf das Kruzifix gerichtet, als bäte er den Herrn um Hilfe.
Der Taschendieb, den Bütteln von Canterbury bekannt als Laus Tibi, wörtlich übersetzt »Gelobet seist du«, hatte seinen richtigen Namen vergessen. Er erinnerte sich noch vage daran, dass er in Gravesend aufgewachsen war, doch die meiste Zeit war er auf den staubigen Landstraßen Englands unterwegs gewesen und hatte sich seinen dürftigen Lebensunterhalt als Langfinger zusammengestohlen. Laus Tibi hatte fettiges Haar, ein Rattengesicht, war dürr wie eine Bohnenstange, ein Mann mit pockennarbigen Wangen und dunklen, glitzernden Augen. Er hatte sich den Pilgern angeschlossen, die jetzt, da der Sommer auf dem Höhepunkt war, in hellen Scharen nach Canterbury kamen, um vor den gesegneten Gebeinen des heiligen Märtyrers Thomas Becket in der Kathedrale zu beten.
Laus Tibi war es nicht um Reliquien gegangen, nicht um die Gebeine des heiligen Thomas oder darum, einen Ablass zu erwirken, der ihn nach dem Tod vor den Qualen des Fegefeuers bewahren würde. Laus Tibi hatte sich wie ein Wolf in den Schafstall durch die Tore von Canterbury geschlichen. Er war gekommen, um zu stehlen, lange Finger zu machen, von den Marktbuden zu stibitzen und die Ernte einzufahren, ehe der Winter Einzug hielt. Er brauchte Geld, um sich in einer Schänke auszuruhen, bis das Frühjahr einsetzte: Pilger waren wie Kaninchen im Heu – man musste sie nur aufscheuchen und fangen. Das war nicht schwer. Pilger waren erpicht, eine Schänke oder ein Gästehaus zu finden, oder sie starrten mit offenem Mund auf die Kirchen und die schönen Gebäude von Canterbury, sodass sie oft ihre Bündel vergaßen, die sie bei sich trugen, oder, noch wichtiger, ihre Geldbörsen, Brieftaschen oder Manteltaschen. Zunächst konnte Laus Tibi sein Glück kaum fassen. Auf dem Markt nahm er den Geldbeutel eines Priesters an sich, dann die Brieftasche eines Schneiders in einer Schänke, nachdem der Mann zu tief in sein Glas mit starkem Ale aus Kent geschaut hatte. Die Frau eines jungen Kaufmanns, die einen bestickten Beutel am verzierten Gürtel um die schlanke Taille hängen hatte, war eine leichte Beute gewesen: Der Beutel hatte ihm eine Goldmünze eingebracht, frisch geprägt vom königlichen Schatzamt in London, ein paar Silberpennys und einen Rosenkranz. Letzteren hatte Laus Tibi als heilige Reliquie an einen Gemeindevorsteher aus Devon verkauft. Schließlich war es Laus Tibi gelungen, sich eine Mansarde in der Schänke Zum Grauen Wiesel gleich am Marktplatz zu sichern: Bett und Tisch, Krüge voller Ale und die Bedienung eines hübschen Zimmermädchens obendrein.
Am Ende war Laus Tibi indes zu lange geblieben; es herrschte erhöhte Wachsamkeit, und der Marktplatz wurde überwacht. Laus Tibi schloss die Augen und knirschte wütend mit den gelblichen Zähnen, wobei er mit der Zunge den Abszess hinter den oberen Schneidezähnen suchte.
»Ich hätte besser aufpassen sollen.«
Er schlug die Augen auf und richtete den Blick starr auf das Kruzifix; Schuldgefühle versetzten ihm einen Stich. Doch was blieb einem Mann wie ihm anderes übrig? Er hatte kein Geschäft, kein Zuhause, keine Familie; für ihn hieß es stehlen oder verhungern.»Ich hätte vorsichtiger sein sollen«, wiederholte er. Verstohlen fuhr Laus Tibi mit der Hand unter das verdreckte Leinenhemd, das er in einem Garten stibitzt hatte, wo es über einem Zaun zum Trocknen gehangen hatte. Die schmutzigen Finger des Taschendiebs ertasteten die Narbe des Brandzeichens »V« für Verbrecher, vor drei Jahren in seine rechte Schulter eingebrannt, als man ihn in der Nähe von Smithfield Market in London beim Stehlen erwischt hatte. Sollte der Büttel des Königs das sehen, dann hätte er wenig Gnade zu erwarten: Laus Tibi würde an der Kreuzung hängen! Er war an solchen Galgen mit geteerten, grässlichen menschlichen Überresten vorbeigekommen, eine schauerliche Warnung für Gesetzesbrecher. Trotzdem war Laus Tibi, die Spielernatur, davon ausgegangen, dass der Würfel immer zu seinen Gunsten fallen würde – bis vor einer Woche. Laus Tibi hatte den dicken Priester beobachtet, der sich zwischen den Ständen auf dem Markt von Canterbury wie ein aufgedunsener Karpfen bewegte, einen pelzbesetzten Umhang über einem Arm, eine schwere Geldbörse baumelte wie eine Glocke vom Ledergürtel um die stattliche Taille. Laus Tibi war ihm gefolgt wie ein hungriger Fuchs einer fetten Gans. Er hatte seine übliche vorsichtige Gerissenheit über Bord geworfen. Priester hatte er noch nie leiden können. Sie hatten keine Zeit für ihn. Nur sehr wenige zeigten sich ihm gegenüber besorgt, noch weniger hatten Mitleid mit ihm. Laus Tibi war entschlossen, sowohl den Umhang als auch den Beutel an sich zu nehmen, eine herausragende Leistung! Er muss seinem Opfer mindestens eine Stunde lang gefolgt sein. Der Priester blieb immer wieder an bestimmten Ständen stehen, die kostbare Tapeten und Wandbehänge aus dem Ausland feilboten. Einige hingen vor dem Stand, andere wiederum waren aufgerollt und unter einem Leinentuch geschützt. Der Priester war sehr wählerisch. Er ließ den Stoff prüfend zwischen den Fingern hindurchlaufen und fragte den dienstbeflissenen Händler Löcher in den Bauch.
»War das echter Silberfaden?« – »Aus welcher Mühle?« Der Priester konnte sich nicht entscheiden. Er ging weiter und kam zurück. Laus Tibi schob sich näher heran. An einem Stand mit Stoff von den Webstühlen in Brabant legte der Priester den Umhang ab und verschob den Gürtel ein Stück, sodass der Geldbeutel, der an der Seite gehangen hatte, nun nach hinten gerutscht war. Laus Tibi zog ein nadelartiges Messer aus der Lederscheide, die er unter dem abgenutzten Wams an den Arm gebunden hatte. Der Priester feilschte mit dem Standbesitzer. Jetzt! Der Priester schickte sich an, etwas zu kaufen, und hatte alles um sich herum vergessen, da er den Händler auf seinen Preis drücken wollte.
Laus Tibi hörte das Gezeter und Geschnatter des Marktplatzes nicht mehr, das heisere Gebrüll der Lehrburschen, roch die Misthaufen nicht mehr, die Düfte aus den Garküchen und Bäckereien, vernahm weder Glockengeläut noch die fernen Klänge des Gesangs aus einer nahe gelegenen Kirche. Wie ein schwebender Falke beobachtete er seine Beute. Rasch warf er einen Blick in die Runde: Niemand hatte ihn im Auge, er konnte keinen Büttel sehen. Laus Tibi beschloss, auf sein Opfer herabzustoßen. Verstohlen überquerte er die schlammigen Pflastersteine, das Messer in der Hand. Ein schneller Schnitt, um die Riemen zu durchtrennen, an denen der Geldbeutel hing; den würde er an sich nehmen, dann den Umhang grapschen und in Windeseile in der Menge verschwinden ...
Laus Tibi erhob sich vom Gnadenstuhl, ging zum Eingang des Lettners und blickte starr durch das Kirchenschiff. Er sah noch immer die beiden Franziskaner auf ihren Betstühlen vor der Kapelle »St. Michael and All the Angels«. Einer der Brüder hatte ihn mit hinuntergenommen, damit er sich die Kapelle ansehen sollte, und Laus Tibi hatte ihre Schönheit bewundert. Die Votivkapelle war eigentlich eine Kirche in einer Kirche. An die Mauer des nördlichen Querschiffs gebaut, wurde sie vom Hauptschiff durch drei kunstfertig geschnitzte Lettner aus Eichenholz abgeschirmt, die zu beiden Seiten kleine Fenster hatten. Die Front der Votivkapelle schwang sich zum Dach des Querschiffs empor; sie hatte zwei ovale Fenster über einer schmalen Holztür, die jetzt verschlossen und verriegelt war. Bruder Simon, der Sakristan, hatte ihn durch das Gitter auf die heilige Reliquie spähen lassen, die in einem Gefäß an einer Silberkette hing.
»Der Legende zufolge«, hatte Bruder Simon ihm zugeflüstert, »ist dies der Lacrima Christi, ein prächtiger Rubin, der entstand, als der Herr, unser Retter, von den Römern gegeißelt wurde: Tränen aus Blut fielen zu Boden, die sich auf wunderbare Weise zu diesem glänzenden Stein verbanden.«
Laus Tibi hatte nur genickt und mit offenem Mund hineingestarrt. Oh, was für eine hübsche Beute das abgäbe! Der Rubin war so groß wie ein Taubenei. Die guten Brüder hatten ihn in ein blutrotes, vergoldetes Gefäß gelegt; dieses wiederum war am Ende einer langen Silberkette befestigt, die vom gewölbten Dach der Votivkapelle herabhing, sodass das Gefäß genau zwischen der Tür der Votivkapelle und dem Altar an der gegenüberliegenden Wand zu hängen kam. Es hatte eine Rückwand und war nach drei Seiten offen, damit möglichst viel von der Reliquie zu sehen war; ein Metallring oben auf dem Gefäß diente dazu, es in dem starken Silberhaken am Ende der Kette einzuhängen.
»Warum ist es hier?«, hatte Laus Tibi geflüstert.
»Es gehört Walter Maltravers.«
Beim Reden kaute der geschwätzige Sakristan auf seinen zahnlosen Kiefern; ihm hatte dieser arme Verbrecher leidgetan, der in seiner Kirche Zuflucht gesucht hatte. Als Bruder Simon ihn so einsam und verlassen am Eingang zum Lettner hatte stehen sehen, hatte er ihn hereingebeten.
Der andere Franziskaner war nicht so freundlich gewesen, doch er war gegangen und hatte sich in seinen Betstuhl gekniet, das hagere Gesicht in die Hände vergraben, als wollte er Laus Tibi aus seinem Gesichtsfeld verbannen.
»Kennt Ihr Sir Walter Maltravers?«, flüsterte der Sakristan. Der flüchtige Dieb schüttelte den Kopf.
»Ihm gehört Ingoldby Hall im Süden von Canterbury, ein sehr reicher Herr und enger Freund des Königs. Als junger Mann«, plapperte der Sakristan weiter, »gehörte Sir Walter zur Leibgarde des Kaisers in Konstantinopel.« Laus Tibi verdrehte die Augen und nickte, als habe er verstanden, obwohl er keine Ahnung von einem Kaiser oder der Stadt mit dem langen Namen hatte.
»Lacrima Christi?«, krächzte er. »Wie ist er denn hierhergekommen?«
»Oh, Kaiserin Helena«, hatte Bruder Simon weiter geplappert, »die Mutter des großen Konstantin, fand den Rubin Lacrima Christi in Palästina und nahm ihn mit in die Stadt ihres Sohnes. Als jedoch die Türken vor zwanzig Jahren die Stadt eroberten, war Sir Walter gezwungen, zu fliehen. Und bevor er eine so kostbare Reliquie in die Hände von Ungläubigen fallen ließ, hat er sie lieber mitgenommen.«
»Aber was macht sie denn hier?«, hatte Laus Tibi nachgehakt.
»Sir Walter hat Ingoldby Hall vor gut drei Jahren gekauft. Prior Barnabas hörte von der Reliquie und bat Sir Walter, sie der Priorei zum Zwecke der öffentlichen Verehrung zu leihen.«
Aha, überlegte Laus Tibi, und somit die Pilger noch mehr zu schröpfen als ich!
»Ist sie denn hier sicher?«
»Seht Euch nur um.«
Bruder Simons scharfe Antwort machte deutlich, dass er gelinde bedauerte, Laus Tibi zur Besichtigung des Schatzes aufgefordert zu haben. Das Juwel war eine Versuchung, aber gut bewacht. Die Kapelle war gut abgesichert, hohe Holzlettner aus dicker polierter Eiche, das Dach ohne Öffnung, Zugang hatte man nur durch die schwere Eichentür mit Schloss und Riegel. Ein verzweifelter Dieb mochte durch das bleiverglaste Fenster direkt über dem Altar einzudringen versuchen, das den Heiligen Michael darstellte, wie er Satan ins Höllenfeuer hinabstößt, doch das Fensterblei war noch zusätzlich verstärkt, und wer würde schon so schönes Glas zerbrechen? Der Lärm würde bestimmt die Priorei alarmieren, und der Dieb käme vielleicht hinein, hätte aber Schwierigkeiten, wieder hinauszugelangen. Stämmige Laienbrüder, mit dicken Knütteln bewaffnet, drehten im Garten unterhalb des Fensters ihre Runden; nicht einmal eine Maus könnte in die Votivkapelle eindringen. Zwei Angehörige der Gemeinschaft waren ständig in der Nähe auf Wache, entweder knieten sie im Betstuhl nicht weit von der Kapellentür, oder sie standen davor und ließen die Pilger vorbeidefilieren, wobei sie ihre Münzen für einen kurzen Blick durch das schmale Gitter entgegennahmen. Gewiss! Der Lacrima Christi war sicher ...
Laus Tibi seufzte und lehnte sich an die Tür des Lettners. Es war kurz vor Sonnenuntergang, die Vesper war gesungen worden, und die Kirche schloss für heute ihre Türen. Dessen ungeachtet würden die Brüder ihre Wache weiterführen, bis die Glocke sie zur Komplet rief. Laus Tibi schnaubte. Zwei Mönche knieten noch auf ihren Betstühlen. Der Verbrecher blinzelte durch das Kirchenschiff und erkannte in einem von ihnen Prior Barnabas, einen zähen, strengen Mann mit den Augen einer jagenden Dogge. Der zweite war Ralph, der Krankenpfleger. Sie würden bis zur festgesetzten Stunde bleiben, in der die Reliquie sicher unter Verschluss gebracht wurde. Laus Tibi war versucht, noch einmal hinzugehen und einen Blick auf das Juwel zu werfen. Die Brüder hatten die Votivkapelle in einen prächtigen Schrein verwandelt: Dicke rote Türkenteppiche bedeckten jeden Zoll des Kapellenbodens. Selbst das Altartuch, die Kerzenhalter und Kerzen waren rubinrot, sodass die gesamte Kapelle in überirdisches Licht getaucht war. Laus Tibi war stolz darauf, ein Auge für Schönheit zu haben, und hätte so lange durch das Gitter starren können, wie die Brüder es zuließen. Die Votivkapelle St. Michael repräsentierte alles, was Laus Tibi bisher gefehlt hatte: Bequemlichkeit, Überfluss und Luxus. Überall duftete es nach Weihrauch, den Kerzen aus Bienenwachs und dem kräuterhaltigen Öl, das zum Polieren des schimmernden Holzwerks verwendet wurde.
»Wie viel ist der Rubin wohl wert?«, flüsterte Laus Tibi vor sich hin. »Aber wo könnte man ein solches Juwel schon verkaufen?«
Bruder Simon hatte ihm erklärt, dass der Lacrima Christi für die Dauer der Pilgerzeit in Greyfriars bleiben würde. Laus Tibi schaute starr auf seine abgenutzten Schuhe und stöhnte. Die Pilgerzeit! Er spürte das Brandmal auf seiner Schulter. Wo er wohl am Ende der Pilgerzeit wäre? Er ging wieder zum Gnadenstuhl in der Nische des Heiligtums, setzte sich, nahm die Holzplatte in die Hand und schob gedankenverloren die Krümel zusammen. Wenn dieser Priester nicht gewesen wäre – nein, nein, das stimmte nicht: Der Dieb war aus purer Habsucht in eine Falle gelaufen! ...
Laus Tibis auserwähltes Opfer war kein Priester, sondern ein verdeckter Marktbüttel gewesen. Er und seine Gefährten hatten Laus Tibi tagelang beobachtet, und so kam es, dass der Jäger zum Gejagten wurde. Laus Tibi hatte sich gerade angeschickt, den Geldbeutel vom Gürtel seiner Beute zu schneiden, als er hinter sich das Horn hörte, das zum Alarm blies.
»Zu Hilfe! Zu Hilfe!«, ertönte eine Stimme. »Ein Dieb! Ein Dieb!«
Der falsche Priester war herumgefahren, ein Lächeln auf den Lippen, und hatte Laus Tibi am Arm gepackt, sodass er gezwungen war, das Messer fallen zu lassen. »Habe ich Euch«, schnarrte er, das aufgedunsene, gerötete Gesicht in Schweiß gebadet. »Ich verhafte Euch im Namen des Königs!«
Laus Tibi versetzte ihm einen gemeinen Tritt gegen das Schienbein. Der Mann lockerte den Griff, und Laus Tibi war flink wie ein Wiesel nicht aus der Menge hinaus-, sondern ins Gewühl hineingelaufen. Überall wurden Hörner geblasen, der Ruf »Zu Hilfe! Zu Hilfe!« wurde laut. Laus Tibi hatte Menschen beiseitegestoßen. Vom Stand eines Fleischers hatte er ein Hackmesser gegrapscht und damit jeden bedroht, der sich ihm in den Weg zu stellen versuchte. Wie der Wind war er gerannt, über die Pflastersteine geschlittert und gerutscht, während ihn eine Schar Büttel verfolgte wie ein Rudel kläffender Hunde. Keuchend und schnaufend, mit wild klopfendem Herzen und in Schweiß gebadet hatte Laus Tibi sich vom Marktplatz abgesetzt, doch er war ein gebranntes Kind. Er hatte diese Tortur schon einmal durchgemacht und kannte die Anzeichen. Die Menschen wichen instinktiv vor ihm zurück und stempelten ihn als Gesetzesbrecher ab. Ein paar Lehrburschen kamen aus einer Seitenstraße gestürmt, doch der Anblick des erhobenen Hackbeils und des wahnsinnigen, starren Blicks von Laus Tibi zwang sie, sich zurückzuziehen.
»Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ein Dieb! Ein Dieb!«
Laus Tibi war weiter durch Gassen und Rinnsteine geflüchtet; Schweiß vernebelte seine Sicht, immer stechender wurde der Schmerz auf seiner linken Seite. Sie konnten ihn nicht kriegen! Die Fahrt im Henkerskarren zu den Galgen vor der Stadt – nicht mit ihm! Blindlings bog er in eine Gasse ein und rannte durch ein halb offenes Tor in einen duftenden Garten. Zuerst dachte Laus Tibi, es sei das Haus eines Kaufmanns, doch als er auf die Knie sank und sich umschaute, erkannte er, dass er sich auf dem Grundstück einer Priorei oder eines Klosters befand. Laus Tibi kannte das Gesetz. Vier Jahre zuvor hatte man ihn in York aufgegriffen, und er hatte Zeilen aus dem einundfünfzigsten Psalm aufsagen können:
»Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.« Es war ihm gelungen, dieses Zitat wiederzugeben, den berüchtigten »Hinrichtungsvers«, der es ihm ermöglichte, sich unter den Schutz des Klerus zu stellen. Laus Tibi war dem Kirchengericht zur Bestrafung überstellt worden. Wenn man ihn jetzt inhaftierte, würden die Büttel dieser großen Stadt sorgfältige Nachforschungen in Gang setzen. Er hatte bereits einmal die Gunst des Klerus in Anspruch genommen und war ungeschoren davongekommen; ein zweites Mal würde ihm das nicht gelingen. Bis an den Rand der Verzweiflung erschöpft, hatte sich Laus Tibi wieder aufgerappelt und war weitergelaufen. Ihm wurde leicht im Kopf, ihn schwindelte. Er hatte einen Laienbruder beiseitegestoßen, die Kirchentür aufgerissen und sich in die kühle, freundliche Dunkelheit gestürzt. Pilger wandelten umher; eine Hand legte sich auf seine Schulter, doch Laus Tibi schob sie fort und taumelte durch das Kirchenschiff hinter den Lettner ins Allerheiligste. Vor Erleichterung hätte er weinen können. An der gegenüberliegenden Seite des Allerheiligsten war ein schwerer Gnadenstuhl in eine Wandnische gebaut. Auf allen vieren war Laus Tibi darauf zu gekrochen, hatte sich daran in die Höhe gezogen und die heiße Wange an den kalten Stein des Alkovens gelegt. Der Sakristan Simon war aufgetaucht, die Augen weit aufgerissen, den zahnlosen Mund vor Verwunderung aufgesperrt.
»Bittet Ihr um Asyl?«, hatte er auf lateinisch gefragt. Laus Tibi hatte den Kopf geschüttelt.
»Bittet Ihr um Asyl?« Bruder Simon beugte sich über ihn, sodass der Dieb den Altarwein riechen konnte.
»Ich bitte um Asyl«, stotterte Laus Tibi. »Ich ersuche die Heilige Mutter Kirche um ihren Schutz!«
Er hatte das Ritual gerade noch rechtzeitig geschafft. Im Türrahmen des Lettners drängten sich wütende Büttel, Stöcke in den Händen; einer ließ sogar Handschellen klirren. Sie drohten Laus Tibi mit erhobenen Fäusten, doch keiner wagte, das Heiligtum zu durchqueren und Hand an ihn zu legen. Laus Tibi hatte sich ausgestreckt wie ein Hund, bis Prior Barnabas auftauchte. Streng und hochmütig, die Schultern nach hinten gezogen, war der Prior aus der Sakristei gestürmt, begleitet von einem Kreuzträger, und hatte sich vor den Bütteln aufgebaut. »Ihr kennt das Gesetz!«, hob Prior Barnabas mit tiefer Stimme an. »Dieser Mann ...«
»Dieser Dieb!«, gab der Oberbüttel knurrig zurück. »Dieses Kind Gottes«, unterbrach Prior Barnabas ihn, »hat nach dem Gesetz und dem Recht der Heiligen Mutter Kirche um Asyl gebeten. Wenn Ihr dieses Gesetz brecht, werdet Ihr nicht nur die Wut des Königs auf Euch ziehen, sondern auch den Zorn der Heiligen Mutter Kirche. Exkommunikation mit allen Verwünschungen, die Euch beim Essen, beim Trinken, Tag und Nacht verfolgen werden!«
»Ich kenne das Gesetz!«, krächzte der Oberbüttel.
»Dann haltet Euch daran!«, fuhr Prior Barnabas ihn an. Er zog sich die Kapuze seiner braunen Kutte über das schüttere Haar und ließ die Hände in den weiten Ärmeln verschwinden. So erschöpft er auch war, Laus Tibi sah sehr wohl, dass der gute Prior seine Macht genoss und dass dieser stolze Kirchenmann und die Büttel der Stadt sich nicht ausstehen konnten.
»Haltet Euch an das Gesetz!«, wiederholte Prior Barnabas. »Dieser Mann kann vierzig Tage hierbleiben. Dann hat er die Wahl: Entweder er überantwortet sich Eurer Macht, oder er entsagt dem Reich. Ich bezweifle«, fügte er sarkastisch hinzu, »dass er sich ergeben wird, daher werde ich ihm ein Kruzifix, zwei Münzen, ein Fläschchen Wein, etwas Brot und Fleisch in Leinen wickeln, dann wird er sicheres Geleit nach Dover haben.«
»So er denn jemals dort ankommt!«, schrie ein Büttel.
»Das geht mich nichts an«, entgegnete Prior Barnabas. »Nun, meine Herren, das hier ist das Haus Gottes. Wir haben Pilger, die darauf warten, den Lacrima Christi zu sehen.«
»Das wissen wir doch!«, spottete der Oberbüttel.
»Gut!«, stellte der Prior fest. »Wenn dem so ist, wird Euch bekannt sein, mit welcher Großzügigkeit Sir Walter Maltravers, der Herr von Ingoldby Hall und enger Freund unseres Königs, diese Kirche bedacht hat.«
Die Büttel entschieden sich, klein beizugeben. Laus Tibi trafen ein paar finstere Blicke, doch die Meute zog sich zurück. Der Dieb wusste, dass er sicher war, und machte sich daran zu überlegen, was er als Nächstes unternehmen könnte ...
Laus Tibi erwachte aus seinen Tagträumen, drehte sich um und schaute starr auf den Stuhl des Heiligtums. Sieben Tage waren vergangen. Man hatte ihm eine saubere Tuchhose gegeben, und die Mönche waren auch recht freundlich gewesen, wenngleich Laus Tibi den Verdacht hatte, dass der Quell dieser Großzügigkeit eher Antipathie gegenüber den Bütteln der Stadt denn Mitleid mit ihm war. Er rieb sich die Augen. Prior Barnabas hatte recht. Er müsste von hier verschwinden. Doch wie sollte er nach Dover gelangen? Welche Garantie hatte er, dass die Büttel ihn sicher passieren ließen? Laus Tibi ging wieder zurück durch das Heiligtum, das jetzt ganz in Goldrot getaucht war, da das Licht der untergehenden Sonne funkelnde Strahlen durch die bunten Fensterscheiben warf. Die Marmorstufen des Altars schimmerten im Licht, das sich in der goldenen Monstranz spiegelte. Doch das spendete Laus Tibi nur wenig Trost. Bald schon wäre es Nacht. Der Verbrecher schauderte und rieb sich die Arme. Dunkelheit kroch bereits wie Nebel herein. Die Gesichter der Scheusale am oberen Ende der Säulen schienen zum Leben zu erwachen, groteske Bilder, die sich im Zwielicht bewegten. Laus Tibi schaute zum mittleren Fenster auf, das Jesus Christus beim Jüngsten Gericht zeigte; die Brise am späten Abend, die durch eine Spalte oder ein Loch drang, ließ die Kerzenflammen tanzen.
Laus Tibi ging wieder auf seinen Posten neben der Tür des Lettners. Die beiden Mönche knieten noch immer in ihren Betstühlen. Bald wäre die Wache vorbei, der Lacrima Christi würde heruntergeholt und feierlich in seine Eisentruhe gelegt. Prior Barnabas veränderte seine Haltung im Betstuhl und flüsterte Bruder Ralph, dem Krankenpfleger, etwas zu; dieser machte daraufhin eine dünne Wachskerze am Ende eines langen Stabs an, mit der er die Fackeln in den Wandhalterungen anzündete. Laus Tibi war froh um dieses Licht. So schön die Kirche bei Tageslicht auch war, in der Nacht verwandelte sie sich in einen Ort, an dem sich Schatten bewegten und schlurfende Schritte zu hören waren. Hatte der Sakristan ihm nicht erzählt, dass im Kirchenschiff ein Mönch spuke, der Selbstmord begangen und sich an einem Eisenträger neben der Leichentür erhängt habe? Bruder Ralph, noch immer die brennende Wachskerze in Händen, warf ihm wütende Blicke zu und bedeutete dem Verbrecher mit der Hand, sich zurückzuziehen. Der Prior wollte, dass Laus Tibi sich von der Tür entfernte; also ging er zurück durch das Heiligtum und sah eine Weile zur Monstranz mit ihren merkwürdigen Symbolen empor. Laus Tibi war des Griechischen nicht mächtig. Bruder Simon sagte, es heiße so viel wie: »Ich bin der Anfang und das Ende aller Dinge.« Er war im Begriff, die Hand auszustrecken und das herrliche Gold zu streicheln, als ein Schrei aus der Tiefe des Kirchenschiffs ihn zusammenfahren ließ. Er eilte wieder zur Tür des Lettners. Bruder Ralph starrte durch das Gitter und winkte Prior Barnabas mit beiden Händen zu sich.
»Der Lacrima Christi!«, rief er. »Der Rubin ist verschwunden!«
Laus Tibi packte das blanke Entsetzen.
»Unsinn!«, höhnte Prior Barnabas. Er eilte zu seinem Bruder, und Laus Tibi hörte sogar dort, wo er stand, wie der Mönch verzweifelt aufstöhnte.
»Schnell! Schnell!«, rief Prior Barnabas und stieß Bruder Ralph förmlich fort. »Weck die Gemeinschaft!«
Der Krankenpfleger eilte davon. Prior Barnabas warf einen raschen Blick durch das Kirchenschiff.
»Und Ihr«, sagte er wild gestikulierend zu Laus Tibi. »Geht wieder zu Eurem Stuhl. Ihr seid im Asyl. Dann bleibt auch dort!«
Laus Tibi zog sich in den Schatten zurück. Irgendwo in der Priorei begann eine Glocke zu läuten, dann waren auf dem harten Steinboden tapsende Schritte zu hören; Türen flogen auf. Mönche drängten ins Kirchenschiff. Laus Tibi kehrte zum Gnadenstuhl im Heiligtum zurück. Er vernahm ungläubige Rufe, Prior Barnabas erteilte Befehle, dann ließ der Lärm nach.
»Ich hoffe nur, dass sie mich nicht verdächtigen«, stöhnte Laus Tibi still vor sich hin. »Damit hatte ich nichts zu tun. Wie konnte der Rubin an einer solchen Stelle entwendet werden?«
Die Votivkapelle war versiegelt; der einzige Weg hinein führte durch die Tür, doch die war verschlossen und verriegelt. Laus Tibi konnte es kaum erwarten, bis Bruder Simon kam und ihm seine Abendmahlzeit brachte: Brot, Käse, einige Streifen geräucherten Speck und einen Lederkrug Ale. Der Sakristan war völlig außer sich und sprudelte vor Neuigkeiten nur so über, auch wenn er Laus Tibi misstrauisch ansah.
»Der Lacrima Christi«, flüsterte er, »ist wirklich und wahrhaftig verschwunden!«
»Verschwunden?«, rief Laus Tibi aus.
»Vom Haken genommen«, flüsterte Bruder Simon, Furcht in den Augen. »Der Rubin mitsamt seinem Gefäß.« Er schnippte mit den Fingern. »Einfach so, ohne ein Anzeichen für gewaltsames Eindringen.« Er kam näher. »Es heißt, Jesus Christus sei gekommen, sein Eigentum zu fordern!«
Am darauffolgenden Nachmittag, einem Freitag, war Sir Walter Maltravers, der Herr von Ingoldby Hall, im Begriff, seinen allwöchentlichen Bußgang zu beginnen. Er hatte den großen Irrgarten betreten. Im Schatten der dichten, hohen Hecken kniete er nieder und bekreuzigte sich. Sir Walter war ein tatkräftiger Mann Anfang sechzig, der sich damit brüstete, den Verstand und die körperliche Beschaffenheit eines dreißig Jahre Jüngeren zu besitzen. Ein stolzer Mann, dieser Sir Walter, Grundbesitzer, Vertrauter und Freund König Edwards IV., an dessen Seite er vor Kurzem gegen das Haus Lancaster gekämpft hatte. Maltravers war der Herr über Ingoldby und die angrenzenden Ländereien, Weiden, Wälder, Bäche voll dicker Fische, Ackerland, kleine Gutshöfe und Scheunen. Außerdem gehörten ihm Wohnungen in Canterbury und einige Häuser in der Paternoster Row im Schatten von St. Paul’s in London. Ingoldby Hall rühmte sich einer Bibliothek, um die sie jedes Kloster oder jede Abtei beneidet hätte. Oh ja, Sir Walter war reich an weltlichen Gütern und hatte Geld in die Merchant Adventurers und andere Unternehmen gesteckt, die in den nördlichen Breiten durch die Meere pflügten. Die Krone schuldete ihm Geld, und selbst in Rom wurde Sir Walters Name mit großem Respekt genannt: ein Mann mit Besitz und ein guter Freund der Kirche. Sir Walters zerfurchte, grimmige Züge verwandelten sich in ein sardonisches Lächeln.
»Doch was hülfe es dem Menschen«, betete er, »wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre doch seine unsterbliche Seele?«
Sir Walter hatte dem Wein des Lebens kräftig zugesprochen. Seine junge Frau, Lady Elizabeth, Tochter der mächtigen Kaufmannsfamilie Redvers, galt allgemein mit ihren kornblumenblauen Augen, dem vollkommenen Gesicht und dem üppigen goldblonden Haar als Schönheit. Sir Walter seufzte. Lady Elizabeth setzte ihm ständig zu, diese Buße sei nicht vonnöten. Sir Walter indes kannte die Wahrheit: Er hatte seine Seele an jenem Tag vor etwa neunzehn Jahren verloren, Tausende von Meilen entfernt, als er in der Warägergarde an der Seite des letzten Kaisers von Konstantinopel gekämpft hatte. Sir Walter bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. Diesen Tag würde er nie vergessen! Die Türken hatten Breschen in die Mauern geschlagen; die Janitscharen in ihren gelben Umhängen und weißen Turbanen strömten in die Stadt und breiteten sich in den schmalen, holperigen Straßen und den breiten, mit Basalt gepflasterten Alleen aus. Kirchen wurden angezündet. Schwarze Rauchwolken hingen über den Palästen, und doch hatten der Kaiser und seine Garde, die Rüstung in Blut und Schweiß getränkt, versucht, die Bresche zu schließen. Es war ein hoffnungsloser Fall. Die Trompeten ihrer Feinde schallten wie Dämonen, und selbst von seinem Standpunkt auf einem der Türme aus konnte Sir Walter sehen, wie die grüngoldenen Banner immer weiter in die Stadt vordrangen. Die Waräger, Söldner aus allen Nationen unter der Sonne, hatten einen feierlichen Eid abgelegt, bei ihrem Herrn und Meister zu bleiben, mit dem Schwert in der Hand zu sterben und wie Soldaten vor ihren Gott zu treten. Letzten Endes war der türkische Angriff zu heftig gewesen. Die kaiserlichen Haustruppen waren zusammengebrochen. Sir Walter war ein paar Stufen herabgefegt worden und hatte erkannt, dass die Sache des Kaisers verloren war. Die Stadt war bereits dem Gemetzel preisgegeben. Noch mehr Tore waren geöffnet worden, und die leichte Kavallerie der Türken klapperte über das Pflaster. Ein Sipahi-Krieger mit schwarzem Turban griff ihn mit gesenkter Lanze an. Sir Walter hatte sowohl das Pferd als auch den Reiter niedergemacht, doch dabei war ihm der Helm vom Kopf geschlagen worden, und ein harter Streich an die Schläfe hatte ihn ins Taumeln gebracht. Er war die Treppe zu einer Kirche hinaufgewankt, einer schönen byzantinischen Kapelle, die der Jungfrau Maria geweiht war. Pater John, ein englischer Priester, dem kaiserlichen Hof bekannt, hatte dort Zuflucht gesucht. Er hatte in der Stille der Krypta, verborgen vor dem Gemetzel, das ringsum stattfand, Sir Walters Wunde versorgt. Pater John hatte ihm zugeraunt, die Stadt sei verloren, der Kaiser tot, und sie könnten nicht zulassen, dass die Schätze der Kapelle in die Hände der Türken fielen. Gemeinsam hatten sie eine Truhe mit Beutegut gefüllt: Goldmünzen, Juwelen und die heilige Reliquie der Kapelle, den Rubin Lacrima Christi. Danach waren sie durch unterirdische Geheimgänge und dunkle Höhlen geflohen, die aus der Stadt hinausführten. Sie hatten Glück gehabt, waren an die Küste gelangt und hatten sich die Überfahrt nach Italien auf einer Kaufmannskogge gesichert. Seither waren Pater John und Sir Walter unzertrennlich. Der Priester hatte Sir Walter eingeredet, er verdiene es, den von ihnen eroberten Schatz zu behalten, und so hatte sein neues Leben begonnen. Sir Walter gab nur wenig von seiner Zeit in Konstantinopel preis, und wenn er doch Auskunft erteilen musste, dann nur sehr ausweichend.
Nun kniete er gleich hinter dem einzigen Zugang zu seinem ausgedehnten, geheimnisvollen Irrgarten. Die Ligusterhecken sperrten die Sonne aus; der Weg, der sich vor ihm auftat, war wie die enge Gasse, durch die er vor so vielen Jahren gelaufen war, als er mit Pater John aus der verlorenen Stadt entkommen war. Das hätte er niemals tun sollen! Er hätte neben seinem Kaiser stehen bleiben und sterben sollen. Nun verfolgten ihn die Furien. Am Abend zuvor war der Lacrima Christi aus der Kirche Greyfriars gestohlen worden. War es das Werk der Athanatoi – der Unsterblichen? Sir Walter hob den Kopf und blickte starr in den hellblauen Himmel. Es war noch nicht Mittag. Er würde seinen Bußgang erst antreten, wenn Pater John käme, um ihm, wie an jedem Freitag, die Beichte abzunehmen. Sir Walter, nur mit einem härenen Hemd und einem Strick um den Hals bekleidet, rutschte auf den Knien zur Marmorbank und legte die klamme Hand dankbar auf den kalten Stein. Er hielt den Kopf schräg und lauschte auf die lieblichen Klänge aus der Blumenlaube, in der seine Frau, Lady Elizabeth, und ihre ständige Begleiterin und Zofe Eleanora saßen und mit Rebec und Flöte musizierten. Sie, Elizabeth, hatte schon immer ein Ohr für Musik gehabt und Stunden damit verbracht, Eleanora zu unterrichten. Andere Stimmen ließen ihn aufhorchen – der aufgeregte Tonfall seines Verwalters Thurston, dann die tiefere Stimme von Gurnell, dem Hauptmann seiner Wache, der mit seinen Diensthabenden stets den Eingang zum Irrgarten beaufsichtigte. Eine weitere Stimme ertönte, und Sir Walter seufzte erleichtert auf. Pater John war gekommen! Sir Walter hockte sich auf die Fersen. Schnaufend und prustend stürmte Pater John auf ihn zu, setzte sich auf die Marmorbank und starrte seinen Meister an.
»Tut mir leid, wenn ich zu spät komme.« Er lächelte. Sir Walter war immer verblüfft, wie freundlich Pater John nach außen hin war. Der Priester hatte sich in Konstantinopel versteckt gehalten und dort die Pfründe der Kirche der Heiligen Jungfrau beschützt. In den vergangenen neunzehn Jahren war er Sir Walters ständiger Begleiter gewesen und hatte nicht viel verlangt, außer Maltravers’ Gesellschaft, ein Dach über dem Kopf und drei ordentliche Mahlzeiten am Tag. So zumindest war es bis vor Kurzem gewesen. Sir Walter blinzelte. Er wollte nicht daran denken!
Pater John trug wie üblich eine staubige, etwas fadenscheinige Kutte, darunter ein weißes Batisthemd; sein Gesicht war grau und zerfurcht, wenn auch Augen und Mund von Lachfältchen zerknittert waren. Der Priester kratzte sich das schüttere schwarze Haar und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er zog die purpurne Stola um den Hals zurecht und beugte sich zu Sir Walter.
»Ich habe geschlafen, mein Herr. Ich habe geträumt.«
»Ihr habt zu tief ins Rotweinglas geschaut«, spottete Sir Walter und senkte die Stimme zum Flüsterton.
»Habt keine Angst«, erwiderte Pater John, »niemand kann Euch hören.«
Der Priester blickte in die hellgrünen Augen des Mannes, dem er in den vergangenen zwanzig Jahren verlässlich gedient hatte.
»Walter, Ihr seid nicht im Frieden mit Euch.«
»Das bin ich nie.«
»Die Morde?«, hakte Pater John nach.
Maltravers wandte den Blick ab. Er rief sich das große Blutvergießen bei Towton vor elf Jahren ins Gedächtnis, den blutigen Nahkampf zwischen den frostigen Hecken von Yorkshire, als Edward IV. und seine kriegerischen Mannen das Haus Lancaster entmachteten. Das Massaker an den Gefangenen, die raschen, blutigen Exekutionen ...
»Zuweilen«, erwiderte Sir Walter, »bereitet mir das Sorge, so wie meine Flucht aus Konstantinopel. Die Athanatoi ...«
Pater John rückte noch näher an ihn heran.
»Sir Walter, das ist Unsinn, ein grausamer Scherz!«
»Ach ja?«, krächzte Sir Walter. »Die Athanatoi waren die Unsterblichen, Angehörige des kaiserlichen Haushalts. Sie zumindest sind an der Seite ihres Herrn geblieben.
Sie haben Gefangenschaft erlitten, Sklaverei ...«
»Und einer dummen Mär zufolge machen sie nun Jagd auf alle, die ihren Herrn im Stich gelassen haben ...«
»Ich habe ihn nicht im Stich gelassen!«, entgegnete Sir Walter.
»Das weiß ich doch«, erwiderte Pater John beschwichtigend. »Also lasst diese Torheit.«
»Sie verfolgen mich.«
»Lächerlich!«, fuhr Pater John ihn an.
»Gestern Abend haben sie den Lacrima Christi aus Greyfriars gestohlen!«
»Das stimmt nicht ganz.« Pater John war nur noch wenige Zentimeter von Sir Walters Ohr entfernt. »Der Lacrima Christi ist von einem schlauen Verbrecher entwendet worden, eine der Gaunereien und Teufeleien in Greyfriars.«
Sir Walter hörte nicht zu, kniend schüttelte er den Kopf. »Ihr müsst Euch mit Euch selbst aussöhnen«, fuhr Pater John fort. Er berührte Sir Walters härenes Hemd und den Strick. »Ihr habt um Absolution gebeten, die Euch gewährt wurde. Trotzdem kommt ihr jeden Freitag in diesen Irrgarten und besteht darauf, auf Knien in die Mitte zu kriechen, um vor dem Weinenden Kreuz zu beten.«
»Das ist nur rechtens«, erwiderte Sir Walter, »in den drei Stunden der Leiden Christi. Für mich ist es ein Akt der Sühne.«
»Habt Ihr Ingoldby deswegen gekauft?«, spottete Pater John, um einen leichten Ton bemüht. »Wegen dieses Irrgartens und des Weinenden Kreuzes? Mir wäre es viel lieber, wenn Ihr vor einem Kruzifix in einer Kappelle niederknietet.«
Sir Walter hob den Kopf und versuchte, den fernen Wortwechsel zwischen Thurston und Gurnell mitzubekommen, das Lachen seiner Gemahlin und Eleanoras, den Klang der Flöte.
»Ihr solltet bei ihnen sein«, drängte Pater John. »Seid glücklich mit Eurer Gemahlin, genießt Euer Leben. Lasst diese düsteren Gedanken beiseite.« Der Priester legte die Fingerspitzen aneinander. »Ihr musstet aus Konstantinopel fliehen, desgleichen war das Massaker an den Provençalen bei Towton nicht Eure Schuld. Konstantinopel ist vor neunzehn Jahren gefallen, Towton liegt gut zehn Jahre zurück. Vergesst das alles.«
»Und die Athanatoi?« Sir Walter funkelte seinen Geistlichen an.
»Die Athanatoi mögen sich so nennen.« Pater John lächelte. »Doch sie existieren in Wirklichkeit nicht. Ich bezweifle, dass sie von Konstantinopel hierherkommen. Es ist ein grausamer Scherz, den sich diejenigen ausgedacht haben, die sich mit Eurer Vergangenheit beschäftigen. Der Herr allein weiß, wie viele Euch um Euren Erfolg beneiden.«
»Und was ist mit den Aufrufen?«, protestierte Sir Walter. »Angebracht am Marktkreuz in Canterbury, ganz zu schweigen von denen, die an die Tür zur Kathedrale genagelt wurden!«
»Grausamkeiten«, sagte Pater John. »Der überzogene Scherz eines böswilligen Spaßvogels. Und nun, Sir Walter, will ich Eure Beichte anhören, obwohl ich weiß, dass sie nicht anders lauten wird als am vergangenen Freitag. In nomine patris et filii ...« Der Priester schlug das Kreuz, und Sir Walter tat es ihm gleich.
»Segnet mich, Pater, denn ich habe gesündigt. Seit meiner letzten Beichte ist eine Woche vergangen.«
Pater John legte sanft eine Hand auf Sir Walters gesenkten Kopf und schaute verzweifelt auf den grünen Liguster auf der anderen Seite des schmalen Wegs. Allmählich verabscheute er diesen Ort. Am liebsten würde er gehen, doch er hatte tatsächlich Angst um die geistige Gesundheit seines Herrn. Sir Walter war in vieler Hinsicht ein sehr berechenbarer Charakter: ein großzügiger, mitfühlender Mann, ein tapferer Krieger, geschickt in der Ratsversammlung, doch wenn es um seine Vergangenheit ging ...
Pater John hörte sich die Litanei kleiner Sünden an und lächelte beinahe. Ingoldby Hall war ein Paradies, Marmorfußböden in den Zimmern, ergiebige Felder und duftende Gärten. Sir Walter war gleich nach dem Krieg hierhergekommen und hatte das Anwesen sofort gekauft. Ob dieser Irrgarten der Grund war? Diese verschlungenen schmalen Pfade, die sich durch endlos lange Ligusterhecken wanden? Sir Walter war der Einzige, der den Weg kannte. Einmal hatte Sir Walter ihn um Ecken und Kurven herum in die Mitte mitgenommen. Für Pater John war es verwirrend gewesen; die Pfade führten anscheinend nirgendwo hin, die Hecken waren wie eine Falle.
»Hier könnte man sich glatt verlaufen«, hatte er festgestellt.
Sir Walter hatte nur schwach gelächelt. Am Ende kamen sie zum Weinenden Kreuz, einem hohen Holzkruzifix, eingelassen in einen dreistufigen Steinsockel und von einem Kieselpfad umgeben. Sir Walter hatte sich auf die Stufe gekniet wie ein Pilger vor dem Heiligen Grab in Jerusalem. Pater John war der Überzeugung, dass der Irrgarten Sir Walters Seele darstellte, die verzweifelte Suche nach Frieden.
»Pater, ich bin fertig.«
»Ja, natürlich.« Der Priester lächelte.
»Und meine Buße?«
Pater John war versucht, ihn ins Haus zurückzuschicken, um sich an einer Wanne voll heißem Wasser und einem Glas eiskaltem Rheinwein zu laben, um sich zu seiner Frau zu gesellen und einen Lobgesang anzustimmen, doch Sir Walter war stur.
»Betet drei Ave Maria«, flüsterte der Priester, »und das Salve Regina, aber schließt um Himmels willen Frieden mit Euch! So spreche ich Euch los von Euren Sünden.« Pater John schlug das Kreuz zum Segen. Er hoffte, Sir Walter würde noch bleiben und reden, doch der Ritter war erpicht auf das Ritual.
»Es muss Mittag sein«, murmelte er. »Ich muss zum Weinenden Kreuz. Heute Abend, Pater, werden wir, weil morgen das Fest der Verklärung ist, ordentlich feiern. Vielleicht wird Lady Elizabeth uns etwas vorsingen.«
»Das hoffe ich doch.«
Der Priester war im Begriff, Sir Walter eine Hand auf die Schulter zu legen, doch der Ritter hatte bereits seinen Rosenkranz gepackt und rutschte auf den Knien über den grasbewachsenen Pfad. Pater John sah ihm nach, wie er sich mit bloßen Füßen und dem verfluchten Strick um den Hals entfernte. Der Priester bekreuzigte sich, wischte sich eine Träne aus dem Auge und ging zum Eingang zurück. Er wollte hier nicht verweilen. Er fürchtete stets, eine falsche Richtung einzuschlagen und sich am Ende im dunklen Grün zu verlaufen, auch wenn die Entfernung noch so kurz war. Noch einmal warf er einen Blick auf seinen Herrn, der nunmehr auf seiner eigenen Via Dolorosa gefangen war. Woher kannte Sir Walter den Weg? Hatte er eine Karte? Pater John hatte in der Bibliothek nachgesehen, jedoch keine Spur gefunden, weder dort noch in Sir Walters privaten Unterlagen. Der Priester zuckte mit den Schultern und trat aus dem Labyrinth hervor. Gurnell hockte auf dem Rasen, bekleidet nur mit einem weißen Leinenhemd und dunkelgrüner Tuchhose, dazu Reitstiefel, an denen Sporen klirrten; den Kriegsgurt hatte er neben sich auf den Boden gelegt. Ein Stück weiter entfernt standen die vier Bewaffneten in der dunkelblauen, mit Gold besetzten Uniform von Maltravers. Thurston, der Verwalter, watschelte bereits zum Haus zurück. Er wirkte in seiner braunen Robe wie ein Mönch. Pater John streckte sich und sah über die weite grüne Wiese hinweg zur rechten Seite des Labyrinths, wo Lady Elizabeth und Eleanora in der Blumenlaube saßen, die am Rande der von Bäumen gesäumten Wiese stand. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt, plauderten und tuschelten miteinander. Pater John kniff die Augen zusammen. Eleanora hatte Lady Elizabeth ein Leben lang begleitet.
»Sie ist eher eine Schwester denn eine Zofe«, hatte die Hausdame sie beschrieben.
Pater John fand Eleanora recht sympathisch, wenn er sich auch oft fragte, was sie mit ihrer Herrin ständig zu bereden hatte.
»Geht es Sir Walter gut?«, rief Gurnell ihm zu.
Pater John trat zu dem Hauptmann des Gefolges. Gurnell war ein ziemlich junger Mann, der behauptete, von Schotten abzustammen; er war untersetzt, hatte schütteres blondes Haar und ein rundliches, glänzendes Gesicht, einen lachenden Mund, Stupsnase und kecke dunkle Augen. Pater John mochte ihn; aus Unterhaltungen mit Sir Walter wusste er, dass man Gurnell nicht nach seinem Äußeren beurteilen durfte. »Ein geborener Meister der Waffenkunst«, so beschrieb Sir Walter ihn. »Ein Kämpfer, der nichts lieber hat als Blutgeruch und Schlachtlärm.« Ein Söldner, der in den französischen Kriegen im Ausland gedient hatte. Gurnell war zwei Jahre zuvor in den Haushalt eingetreten und hatte sich als getreuer Gefolgsmann erwiesen.
»Dem Herrn geht es gut.« Pater John lächelte. »Doch ich wünschte, er fände seinen inneren Frieden.« Er nahm die goldbestickte Stola ab, küsste sie und legte sie sorgfältig zusammen. »Ich glaube nicht, dass er in der Mitte dieses Labyrinths Frieden findet.«
Während Pater John in seine geliebte Bibliothek zurückkehrte, setzte Sir Walter seinen selbst auferlegten Bußgang fort. Er ließ sich Zeit, hielt immer wieder an, um Verse aus dem Evangelium vor sich hin zu flüstern: »Und Jesus fiel zum ersten Mal«. Er kroch weiter, die Wege wurden schmaler. Die Hecken erhoben sich wie Mauern und sperrten die Sonne und den Himmel aus, doch Sir Walter kümmerte es nicht.
»Miserere mei domine«, betete er.
Heute schien der Weg eine Ewigkeit zu dauern, während die Geräusche von der Wiese immer leiser wurden. Sir Walter war nicht nur zum Kreuz unterwegs, sondern ging im Geiste zurück bis zu jener Gruppe blutdurchtränkter Männer, die neben ihrem Kaiser unter dem kaiserlichen Banner standen. Das Bild verwandelte sich in das gefrorene Waldstück auf dem blutigen Schlachtfeld zu Towton. Sir Walter nahm seine Gebete wieder auf. Er dachte kaum darüber nach, wohin er ging; er kannte den Plan dieses Labyrinths so gut, dass es ihn immer wieder überraschte, wenn er ins Freie trat und zum Weinenden Kreuz hinaufschaute. Sir Walter bekreuzigte sich und taumelte auf die untere Stufe zu, wobei die Kiesel seine Knie aufrissen. Zuerst wollte er für all jene beten, die in Konstantinopel gestorben waren.
»Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr!«
Aus unerfindlichen Gründen hielt er inne, als er an den Lacrima Christi dachte. War sein Verschwinden ein Zeichen für den Zorn Gottes? Er vernahm ein Geräusch und blickte auf.
»Das kann nicht sein!«
Er drehte sich um und erblickte die unter einer Kapuze vermummte Gestalt, doch Sir Walter blieben nur noch wenige Sekunden. Die scharfe, zweischneidige Axt fuhr durch seinen Hals und trennte ihm den Kopf so leicht ab, als knickte ein Mädchen eine Blume.
Eins
Und an einem Freitag ereignete sichdieses ganze Unglück.
GEOFFREY CHAUCER
Fasziniert stand Kathryn Swinbrooke vor dem Wandgemälde gleich neben der Leichentür von Greyfriars: Gelbe Gänse scharten sich um einen Galgen, bereit, einen rotschwarzen Fuchs zu hängen. Der Wandermaler hatte die Szene mit kühnen Pinselstrichen in leuchtenden Farben dargestellt. Je genauer Kathryn die Gänse betrachtete, umso mehr ähnelten sie fetten, aufgeblasenen Bürgern, die sich anschickten, einen ziemlich unglücklich wirkenden Verbrecher zu hängen. Wer dieses Gemälde in Auftrag gegeben hatte, war der Ansicht, dass man die Welt auf den Kopf stellen konnte, und nichts so war, wie es zu sein schien.
»Wohl wahr«, murmelte Kathryn vor sich hin. »Und das wird sich auch nie ändern.«
»Meinst du, die Gänse werden den Fuchs je hängen? In diesem Tal der Tränen?«
Kathryn drehte sich um und blickte in das braune, wettergegerbte Gesicht von Colum Murtagh, dem Bevollmächtigten des Königs in Canterbury und Verwalter der königlichen Stallungen in King’s Mead. Colum Murtagh, ein irischer Kämpfer und Höfling, der Mann, den sie liebte! Sie hatten sich einander versprochen, der Ring war gekauft und der Tag festgesetzt; am Samstag, dem Fest des Heiligen Bernhard, würden sie ihre Gelübde vor der Kirche bekräftigen und somit Mann und Frau werden. »Wir sollten heute Morgen den Markt besuchen.« Sanft berührte er ihr Gesicht.
Kathryn legte eine Hand auf Colums braunes Lederwams und fuhr mit den Fingern bis auf die Schnalle seines Kriegsgurts. Sie spähte auf das weiße Leinenhemd, das am Hals offen stand und ein silbernes Kreuz an einer goldenen Kette bloßlegte.
»Für ein silbernes Kreuz solltest du eine silberne Kette haben«, murmelte sie. »Aber so ist er nun mal, mein Ire, nie passt alles zusammen.« Sie blickte an ihm hinab: Seine flaschengrüne Kniehose aus Leder war dreckverkrustet. Sie lachte und trat zurück. »Die Stiefel passen nicht zusammen.«