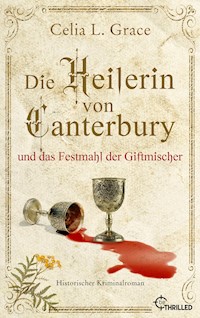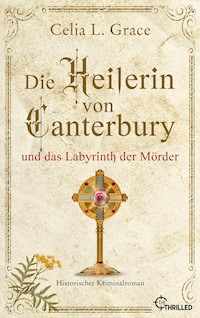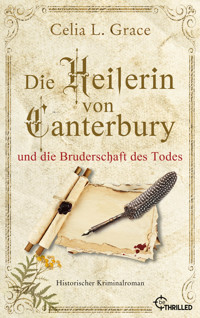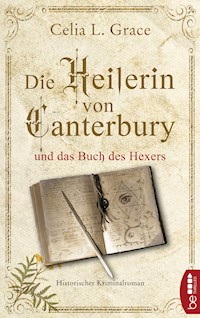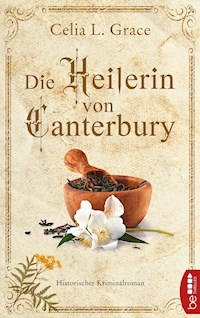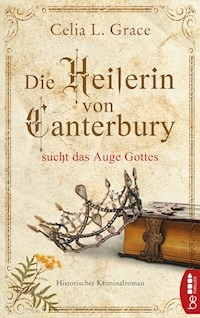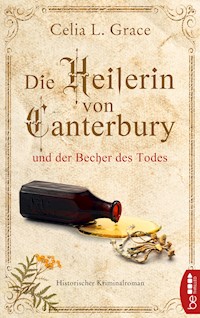
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für die Ärztin
- Sprache: Deutsch
Ein Schneesturm tobt im Dezember des Jahres 1471 über Canterbury und zwingt die Leute, für mehrere Tage in ihren Häusern zu bleiben. Am Morgen des dritten Tages wird jedoch in einem Gasthof der verhasste Steuereintreiber gefunden - ermordet. Das für den König eingenommene Geld ist verschwunden. Die Heilerin Kathryn Swinbrooke und Colum Murtagh, Sonderbeauftragter des Königs, sollen den Täter ausfindig machen. Doch dann geschieht ein weiterer Mord, und Kathryn und ihr Begleiter geraten unter Druck - denn alle Spuren führen zu Colum! Offenbar will der Mörder Colums Ruf zerstören und ihm die Morde anhängen ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zur Geschichte
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Weitere Titel der Autorin
Die Heilerin von Canterbury
Die Heilerin von Canterbury sucht das Auge Gottes
Die Heilerin von Canterbury und das Buch des Hexers
Über dieses Buch
Ein Schneesturm tobt im Dezember des Jahres 1471 über Canterbury und zwingt die Leute, für mehrere Tage in ihren Häusern zu bleiben. Am Morgen des dritten Tages wird jedoch in einem Gasthof der verhasste Steuereintreiber gefunden – ermordet. Das für den König eingenommene Geld ist verschwunden. Die Heilerin Kathryn Swinbrooke und Colum Murtagh, Sonderbeauftragter des Königs, sollen den Täter ausfindig machen. Doch dann geschieht ein weiterer Mord, und Kathryn und ihr Begleiter geraten unter Druck – denn alle Spuren führen zu Colum! Offenbar will der Mörder Colums Ruf zerstören und ihm die Morde anhängen ...
Über die Autorin
Celia L. Grace ist eines der zahlreichen Pseudonyme von Paul Doherty. Er wurde 1946 in Middlesbrough als viertes von neun Kindern geboren. Seine Schulzeit absolvierte er in einem katholischen Internat. Anschließend jobbte er mit geringem Erfolg als Müllmann, Straßenkehrer, Busfahrer, Kellner und Knecht Ruprecht. Danach wollte er Priester werden, verwarf dies aber nach drei Jahren und studierte dann Geschichte in Liverpool und Oxford. Er war lange Jahre Leiter der Trinity Catholic Highschool. Paul Doherty hat sechs Kinder und lebt in London.
Celia L. Grace
Die Heilerin von Canterbury und der Becher des Todes
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marion Balkenhol
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1995 by P. C. Doherty
Titel der britischen Originalausgabe: »The Merchant of Death«
Originalverlag: Headline Publishing Group Limited, London
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1996 by Vito von Eichborn GmbH + Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Thomas Krämer
unter Verwendung von Motiven © LiliGraphie/shutterstock
© EKramar/shutterstock © KaReb/shutterstock © Dmytro Tyshchenko/shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0732-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Grace
»Habt Ihr nicht ein fahles Antlitz in der Menge gesehen ... so offensichtlich, das blanke Entsetzen.«
Chaucer: Die Erzählung des Rechtsgelehrten
»Im Mittelalter praktizierten Ärztinnen auch in Kriegswirren und während großer Epidemien weiter wie immer, einfach weil man sie brauchte.«
Kate Campbellton Hurd-Mead: Geschichte der Frauen in der Medizin
Zur Geschichte
Im Jahre 1471 fand der blutige Bürgerkrieg zwischen den Häusern York und Lancaster durch die beiden Siege, die Edward von York bei Barnet und Tewkesbury errang, plötzlich ein Ende. Der König kam zu seinem Recht und schickte, als der Herbst dem Winter wich, seine Steuereintreiber aus, um zu erheben, was ihm gehörte.
Im fünfzehnten Jahrhundert war die Steuererhebung im Wesentlichen Sache von mächtigen Einzelpersonen, die als Steuereintreiber fungierten. Sie mussten einen festgelegten Betrag sammeln; das, was sie in die eigene Tasche wirtschafteten, wurde von der Krone toleriert, sofern es sich in vertretbarem Rahmen bewegte. Demzufolge waren die Steuereintreiber des fünfzehnten Jahrhunderts mächtige Männer. Erpingham, um den es hier geht, war Ritter, Kaufmann und Rechtsgelehrter zugleich. Die Angst vor dem Steuereintreiber saß damals ebenso tief wie heutzutage vor dem Finanzamt: die Befugnisse der Steuereintreiber waren weitreichend. In der Tat waren Steuereintreiber die Auslöser jeder größeren Revolte in der englischen Geschichte – sei es beim Bauernaufstand von 1381 oder im Bürgerkrieg des siebzehnten Jahrhunderts.
Prolog
Der Schnee kam überraschend: dicke, graue Wolken türmten sich bedrohlich über der Ostküste Englands, als habe der Herrgott höchstpersönlich die Hand gegen die Erde erhoben. Am achten Tag nach dem Fest der Unbefleckten Empfängnis begann es zu schneien; Felder und Wege in Kent wurden unter einem dicken Teppich begraben, der an der Oberfläche vereiste. Kalter Nordostwind kam auf und trieb den Schnee in heftigem Sturm vor sich her. Weiler, Dörfer und einsame Gehöfte wurden von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst des Königs große Stadt Canterbury belagerte er. Auf den Türmen, Zinnen und Dächern der Kathedrale, die den Gebeinen des seligen Märtyrers Thomas als letzte Ruhestatt diente, lag so viel Schnee, dass die großen Glocken nicht geläutet wurden, aus Angst, die dröhnenden Eisenschläge könnten Schneelawinen auslösen und Nichtsahnende unter sich begraben. Die Einwohner von Canterbury zogen es vor, zu Hause zu bleiben und sich um das Feuer zu scharen. Die Marktstände blieben leer. Weder Kesselflicker noch Huren oder Büttel zogen durch die Straßen. Alle Welt bibberte und betete, der Schnee möge noch vor Weihnachten verschwinden.
Die Chronisten im Kloster von Christchurch hauchten in die eiskalten Hände und fluchten im Stillen über die gefrorene blaugrüne Tinte in den Tintenfässern. Wie sollten sie diese Zeiten beschreiben? Verrückte und alle, die von Visionen heimgesucht wurden, behaupteten, der Schneesturm sei eine Strafe Gottes, weil die Welt nach Höllenschwefel und Teufelskot stinke. Solcherlei Sprüche gefielen den Schreibern, und sie kritzelten ihre Anmerkungen an den Rand der Klosterchronik: es sei so weit gekommen, dass die Bösen jetzt schwarze Wachskerzen anzündeten und an dunklen, dumpfen Orten Jungfrauen überfielen, sie in enge Zellen sperrten, wo das Talgfett Gehenkter die einzige Lichtquelle war. In Wahrheit fanden diese Chronisten in Mönchskutte Gefallen daran, sich selbst und ihre Leser in Angst und Schrecken zu versetzen. Deshalb malten sie sich eine andere Welt aus, in der alles auf dem Kopf stand, in der Hasen Hunde jagten und Panther mit Bernsteinaugen und Samtfell vor Hirschen Reißaus nahmen. Tiere mit Menschenhänden auf dem Rücken gingen ebenso auf Raubzug aus wie rot gestreifte Drachen, bizarre Kreaturen mit langen vieltausendfach verknoteten Hälsen. Affen mit Nonnengesichtern und Bockshörnern auf dem Kopf krakeelten auf Bäumen, während Menschen ohne Arme geflügelte Fische oder geschuppte Monster mit Eidechsenmaul fingen. Die Chronisten in Mönchskutte genossen es, diese albtraumhaften Bilder auszuschmücken, während sie aus den Fenstern starrten und sich fragten, was ihnen dieser lange, kalte Winter wohl bringen würde.
An einer Wegkreuzung viele Meilen hinter Canterbury durchlebte der Ire Colum Murtagh, der Königliche Sonderbeauftragte in Canterbury und Verwalter der Königlichen Stallungen in Kingsmead, seinen ganz persönlichen Albtraum. Er wickelte die steif gefrorenen Zügel um die Hände und starrte trübsinnig über die schneebedeckten Felder. Die Zugpferde vor seinem Karren schnaubten vor Schmerz. Ihre Mähnen waren gefroren, und um Augen und Mäuler hatten sich Eisklumpen gebildet. Colum warf einen verzweifelten Blick über die Schulter zu den Vorräten auf dem Karren und wandte sich dann dem drahtigen Pferdeknecht Henry Frenland zu, der sonst stets zu lächeln pflegte. Er hatte Colum zu den Mühlen in Chilham begleitet.
»Wir hätten gar nicht erst aufbrechen sollen«, murmelte Colum und deutete auf die Pferde. »Sie schaffen es bald nicht mehr.«
Colum zog sich die große Kapuze tiefer ins Gesicht. Seine Ohren waren eiskalt, und seine Nasenspitze fühlte sich an, als hielte ein unsichtbarer Kobold sie mit einer eisigen Zange umklammert. Traurig erwiderte Henry Frenland seinen Blick.
»Himmelherrgott, Mann!«, fluchte Colum. »Was ist los? Seit wir Chilham verlassen haben, bist du nicht zu gebrauchen.« Er lachte kurz auf. »Ich weiß. Wir fahren durch die Wildnis von Kent, ein Schneesturm wütet, wir sind mutterseelenallein und haben uns verfahren. Was sollen wir tun? Umkehren oder auf einem Gehöft Unterschlupf suchen?« Er schüttelte seinen Gefährten. »Henry!«, rief er. »Ist dir der Verstand eingefroren? Ich hätte dich in Kingsmead lassen und Holbech mitnehmen sollen.«
»Alles hat seinen Beginn«, sagte Frenland mit so klangvoller Stimme, als nähme er weder das Schneetreiben, noch die Eiseskälte, noch Murtaghs Frage wahr.
Colum hielt die Pferde an.
»Henry, was ist los mit dir?«
Frenland blinzelte und schaute Colum unverwandt an.
»Tut mir leid, Master Murtagh«, stammelte er. »Tut mir wirklich leid.«
Colums Augen verengten sich zu Schlitzen. »Wie lange bist du schon bei mir, Frenland?«
»Sechs Monate, Master.«
Colum nickte; sein grimmiger Blick fiel auf die Kreuzung, wo neben dem Wegweiser ein schneebedecktes Schafott seine eisernen Galgenarme reckte.
»Stimmt«, murmelte er. »Sechs Monate.«
Frenland war ein guter Knecht gewesen, ein Mann, der mit Pferden umgehen und hart arbeiten konnte, der fleißig war und sich mit niemandem anlegte. Niemand wusste, woher er kam. Doch in den Wintermonaten des Jahres 1471, als die königlichen Truppen nach dem Krieg gegen das Haus Lancaster entlassen worden waren, zogen viele ehemalige Soldaten und Heimatlose auf der Suche nach Arbeit durch das Land.
»Du bist doch freiwillig mitgekommen?«, fragte Colum. »Du hast keine Angst vor dem Schneesturm?«
Frenland schüttelte den Kopf. »Nein, Master.«
»Aber ich«, entgegnete Colum. »Ich weiß nicht, wo um des Allmächtigen willen wir jetzt sind; mir ist kalt, und die Pferde halten auch nicht mehr lange durch.«
Wie ein Echo seiner Ängste unterbrach lang gezogenes Heulen die grauweiße Lautlosigkeit.
»Ein Wolf«, vermutete Frenland.
Colum packte die Zügel fester, um seine Furcht zu verbergen.
»Verdammt, das ist kein Wolf!«, zischte er. »Das sind wilde Hunde, Henry.«
Vielstimmiges Geheul zerriss von Neuem die Stille.
»Sie jagen in Rudeln«, sagte Colum. »Mastiffs, größer als ein Wolf und bärenstark. Streunende Tiere von geplünderten Höfen, die während des Bürgerkriegs in Scharen hinter den Soldaten herliefen. Inzwischen haben sie sich zu Rudeln zusammengeschlossen und sind gefährlicher als Wölfe. Vorwärts!«, rief Colum und schnalzte mit der Zunge. »Komm, Henry, mach nicht so ein unglückliches Gesicht. Habe ich dir schon die Geschichte von dem fetten Abt erzählt und der Jungfrau mit den rosaroten Lippen und den lilienweißen Händen?« Er setzte an, da riss Frenland am Zügel.
»Tut mir leid, Master.«
»Was in drei Teufels Namen ...!«
Frenland sprang vom Karren und breitete die Arme aus. »Master Murtagh, es tut mir wirklich leid.«
»Hör um Himmels willen auf, immer dasselbe zu sagen!«, brüllte Colum. »Was tut dir denn leid?«
Frenland wich zurück. Colum starrte dem Knecht verwundert nach, als dieser auf dem Absatz kehrtmachte und, immer wieder stolpernd und auf dem Schnee ausrutschend, davonlief.
»Henry!«, rief Colum ihm nach. »Komm zurück! Um der Liebe Christi willen, das kostet dich das Leben!«
Als Frenland in den wirbelnden Flocken entschwand, fluchte Colum vor sich hin. Zu seiner Rechten hörte er das Bellen der Hunde.
»Ich kann nicht hinter ihm herlaufen. Ich muss einen Unterschlupf suchen«, murmelte Colum und schüttelte die Zügel, trieb die großen Zugpferde vorwärts.
Das Schneegestöber wurde dichter. Frierend blickte Colum zum Himmel empor; der gepflasterte Weg vor ihm verschwand rasch unter den herabfallenden Schneemassen. Es wurde dunkel, und das Geheul der Hunde kam näher und näher.
Eins
Auch die Ärztin von Canterbury, Kathryn Swinbrooke, betrachtete mit sorgenvollem Blick den Schnee, der die ganze Nacht hindurch gefallen war und jetzt auf dem roten Ziegeldach ihres Hauses in der Ottemelle Lane ins Rutschen geriet.
»Thomasina«, rief sie und trat an die Küchentür, »Thomasina, gib acht!«
»Keine Bange«, erwiderte ihre alte Amme vom Garten her, »vor herabfallendem Schnee mache ich mir nicht in die Hose. Da muss schon was anderes passieren.«
Kathryn vernahm ein Krachen, als erneut Schneeberge vom Dach glitten, und anschließend einen deftigen Fluch aus Thomasinas Mund.
»Versündige dich nicht an Gott, Thomasina!«, warnte Kathryn und schaute in die weiße Wildnis hinaus, die einst ihr Garten gewesen war: alle Kräuterhügel und Blumenbeete, selbst der künstliche Teich lagen unter einer eisigen Schneedecke begraben. Die niedrigen Bänke waren fast nicht mehr zu sehen, und die beiden Lauben hatten sich in schneeweiße Zelte verwandelt.
»Thomasina, was machst du denn?«, rief Kathryn nun lauter; ein großes Schneebrett hatte sich von der Dachrinne gelöst.
»Das Wasserfass ist zugefroren«, erwiderte Thomasina.
Kathryn schloss die Augen und hatte Mühe, nicht die Geduld zu verlieren. Thomasina ließ ihrer angestauten Wut freien Lauf und schlug auf die Eisschicht ein, bis diese brach und das Wasser in den großen, eisenbeschlagenen Bottich schwappte. Kathryn ging zurück in die Küche. Die Binsen auf dem Boden wurden schon schwarz und feucht. Sie schürzte ihren Wollrock und half ihrer Magd Agnes, sie aufzusammeln und in den Garten zu tragen.
»Warum darf ich sie nicht einfach auf die Straße werfen?«, fragte Agnes und schaute Kathryn mit ihren hellen Augen an. »Das machen doch alle so.«
Kathryn schnürte ein paar Binsen zu einem Bündel. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Agnes, die Straßen sind so voller Unrat, und die Binsen geben guten Kompost für den Garten ab. Der Schnee weicht sie auf, und sie verrotten.« Sie lächelte. »Und im Frühling sind die Blumen und Kräuter umso köstlicher und kräftiger.«
Thomasina rauschte in die Küche, das runde, freundliche Gesicht hochrot und verschwitzt von der Anstrengung.
»Der verfluchte Schnee!«, grummelte sie vor sich hin. »Das vermaledeite Wasser!« Sie warf einen Blick auf den Berg von Binsen. »Und wo bleibt der verdammte Ire? Er sollte uns beim Hausputz helfen. Schließlich wohnt er ja hier, oder?«
Kathryn hob ein Binsenbündel auf und schmunzelte. »Colum Murtagh ist unser Gast und unser Freund, Thomasina«, erwiderte sie. »Und tu nicht so, als wärst du wütend. Du machst dir ebenso große Sorgen wie ich.«
Thomasina bückte sich und half Agnes beim nächsten Bündel.
»Er ist ein Dummkopf«, ereiferte sich Thomasina. »Gestern hätte er schon wieder in Kingsmead sein sollen. Es schneit immer noch.« Als sie nun aufschaute, lag Besorgnis in ihrem Blick. »Habt Ihr die Gerüchte von Rawnose gehört – von dem Rudel wilder Hunde, die durch Kent streifen? Die königlichen Forstmeister sind untätige Strolche!«
»Du sollst nicht fluchen, Thomasina«, erhob Agnes vorwurfsvoll die Stimme und ahmte ihre Herrin nach, die für gewöhnlich Thomasina keine Gotteslästerung durchgehen ließ.
»Und doch sind die königlichen Forstmeister nutzlose Schufte«, wiederholte Thomasina bedeutungsvoll, »die hätten schon im Herbst ihre Arbeit tun und diese armen Viecher jagen sollen. Jetzt streunen sie herum wie Wölfe, und Master Murtagh ist ganz allein da draußen.«
»Nein, Henry Frenland ist bei ihm«, warf Kathryn ein, sich selbst und allen anderen zur Beruhigung.
Thomasina wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Ich war dreimal verheiratet«, setzte sie zu ihrer altbekannten Rede an, »und kenne noch immer keinen wirklich mutigen Mann. Die Leute von Master Murtagh draußen in Kingsmead sind genauso faule Lümmel wie die königlichen Jagdmeister!«
Thomasina hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen. Kathryns gewohnte Ausgeglichenheit war dahin. Die alte Amme betrachtete ihre Herrin eingehend. Sie sah unordentlich aus, trug weder Brusttuch noch Schleier auf dem schwarzen Haar, das sie stramm nach hinten gekämmt hatte; unter den Augen lagen dunkle Ringe, und das sonst so frische Gesicht war aschfahl.
»Verzeiht«, sagte Thomasina. »Ja, natürlich mache ich mir Sorgen um Colum. Warum musste er auch da rausgehen?«
Kathryn trug die Binsengarben in den Garten. Als sie zurückkam, flüsterte Thomasina der Magd zu, sie solle weitermachen. Dann trat sie auf ihre Herrin zu, ergriff ihre Hand und schaute ihr in die graugrünen Augen, bemerkte dabei die Falten auf der Stirn und um den Mund. »Als Ihr klein wart«, raunte Thomasina ihr zu, »habe ich Euch immer gesagt, Ihr solltet nicht die Stirn runzeln. Schöne Menschen lächeln immer.«
Kathryn zwang sich zu einem schiefen Lächeln. »Ich mache mir Sorgen, Thomasina. Colum musste gehen. Die Vorräte in den Ställen werden knapp, und die Händler in Canterbury sind einfach zu teuer.«
»Noch so eine Bande diebischer Nichtsnutze!«, grummelte Thomasina. Sie drückte Kathryn die Hand. »Aber Ihr kennt doch den Iren! Er ist schon in größerer Gefahr gewesen und hat sie immer gemeistert.« Sie lächelte. »Die meisten irischen Hinterwäldler sind so! Noch vor Mittag ist er wieder zurück, schimpft, flucht und trällert ein Lied, oder, noch schlimmer, zitiert Chaucer, um zu beweisen, dass er kein Sumpfnomade ist. Nun kommt, hier ist es zu kalt.«
Dank Thomasinas gutem Zureden entwickelte Kathryn rege Betriebsamkeit. Die Binsen wurden eingesammelt, zusammengebunden und nach draußen geschafft, der Boden gefegt und gescheuert. Bald schon loderte ein helles Feuer in der Feuerstelle; in den Kohlebecken, die in allen Ecken aufgestellt waren, knisterte und flackerte es, und Thomasina legte glühende Kohlen in die im Haus verteilten Wärmepfannen, die wegen der Brandgefahr sorgfältig abgedeckt wurden. Es dauerte nicht lange und die Küche, das kleine Sonnenzimmer dahinter und Kathryns Schreibkammer strahlten wohlige Wärme aus. Als Kathryn kleine Kräutersäckchen an Haken über die Feuerstelle hing, duftete das ganze Haus nach Sommerblumen. Der kleine blonde Wuf, das Findelkind, das Kathryn bei sich aufgenommen hatte, polterte die Treppe hinunter. Er wäre jetzt ein Ritter, behauptete er, und Agnes wäre die Prinzessin und Thomasina der Drache. Er wurde bald in sein Zimmer zurückgeschickt. Agnes begann, Haferküchlein zu backen und einen Eintopf aufzuwärmen, damit sie wie echte Christen – so Thomasina – das nächtliche Fasten brechen konnten.
Nach dem Frühstück ging Kathryn hinauf in ihr Zimmer, um sich umzuziehen. Sie schloss die Tür ihres Schlafgemachs hinter sich, ließ sich auf das große Himmelbett fallen und deckte sich mit einer Wolldecke zu. Sie stützte sich auf einen Ellenbogen und schaute zur Stundenkerze hinüber. Sie wusste nicht genau, wie spät es war, denn die Kerze war erloschen, und die grauen Wolken am Himmel hüllten alles in mattes Licht. Zudem hatten die heftigen Schneefälle die Glocken der Kathedrale und der Stadtkirchen, die tagsüber die Stunden anzeigten, zum Verstummen gebracht. Ob der Vormittag bereits vorüber war?
»Oh, Ire«, flüsterte sie, »wo bist du?«
Sie sank wieder in die Kissen, schloss die Augen und dachte an das weite, öde Land von Kent: an die riesigen, offenen Felder und die gewundenen Wege. Sie sank in einen kurzen, unruhigen Schlaf und wurde von einem Albtraum geplagt, in dem Colum auf seinem Karren erfror oder von einem tollwütigen, rotäugigen Hund angegriffen und zerfleischt wurde. Nach einer Stunde wachte sie wieder auf. Aus der Küche drang das muntere Geschwätz von Thomasina und Agnes zu ihr herauf. Sie schlug die Decke zurück und trat an die Tür, öffnete sie einen Spalt und lauschte. Von Colum noch immer nichts zu sehen und zu hören. Sie glitt über den Flur zu seinem Zimmer und trat ein. Es war kalt und dunkel, weil die Fensterläden fest geschlossen waren. Kathryn nahm eine Kerze, zündete sie im Wärmebecken auf dem Flur an und stellte sie in einen eisernen Ständer. Dann schaute sie sich um.
Für Kathryn war dieser Raum stets »das Soldatenzimmer«, und trotz ihrer gut gemeinten Vorschläge wollte Colum es unverändert lassen: Wollteppiche auf dem Boden, ein einfaches Feldbett und eine eisenbeschlagene Kiste, die er stets verschlossen hielt. Die Schlüssel trug er immer an einer Kordel um den Hals. An der Wand hing neben ledernen Satteltaschen Colums großer Kriegsgürtel. Als Kathryn ihn mit einem flüchtigen Blick streifte, krampfte sich ihr der Magen zusammen.
»Den hättest du mitnehmen sollen«, flüsterte sie.
Doch dann fiel ihr die Armbrust ein, die Colum bei sich hatte, und sie versuchte, die Angst zu besänftigen. Sie durchquerte den Raum, der nach Pferden und Leder roch, und starrte auf den Tisch neben Colums Bett. Sie nahm die arg abgegriffene Holzstatue der Jungfrau mit dem Kinde in die Hand. Das hohe Alter und die starke Abnutzung der Figur hatten dem heiteren Lächeln, mit dem die Jungfrau auf das Kind in ihren Armen hinabblickte, nichts anhaben können. Kathryn fühlte sich ertappt und stellte sie rasch wieder auf den Tisch. Ihr Blick fiel auf das farbenprächtige keltische Kreuz, das an einem Nagel über dem Bett hing. »Es sind die einzigen Sachen, die meine Mutter mir gegeben hat«, hatte Colum ihr einmal erzählt, »mehr besaß sie nicht. Beide haben mich überallhin begleitet, Kathryn; ins Feldlager und in meine Kammer, als ich noch Marschall des Königs war.«
Kathryn beugte sich über das Bett, berührte das Kruzifix und schloss die Augen.
»Komm gesund wieder«, betete sie. »Du dummer Ire, komm zurück!«
Sie trat ans Fußende des Bettes und hockte sich neben die Truhe. Was mochte Colum darin aufbewahren?, fragte sich Kathryn und musste unwillkürlich lächeln, denn ihr fiel einer von Thomasinas zahlreichen Sprüchen ein: »Neugier wirft die Katz’ aufs Totenbett.«
»Ja, ja«, murmelte Kathryn. »Und Zufriedenheit macht sie fett!«
Als sie die Kerze neben der Tür ausblasen wollte, fiel ihr Blick zufällig auf eine Pergamentrolle neben einem in Leder gebundenen Buch im Regal. Kathryn nahm die Rolle herunter, löste die rote Kordel und las die unbeholfenen Buchstaben: es war Colums Sammlung alter irischer Märchen, über Cu Chulainn, Königin Maeve und das Feenland Tir-nan-og. Sie legte die Rolle wieder neben Chaucers Werke, die sie Colum zur Mittsommernacht geschenkt hatte, und blies die Kerze aus.
»Swinbrooke, du wirst sentimental«, stellte sie mit einem Schuss Selbstironie fest. »Der Ire wird schon zurückkommen. Dann fängt er wieder an, mich zu ärgern, und ich wünsche ihn über alle Berge.«
Schnell kehrte Kathryn in ihr Zimmer zurück, wo sie sich wusch und ankleidete. Da klopfte es laut an der Haustür. Rasch schlüpfte Kathryn in weiche Schnürstiefel. Wer mochte wohl den Elementen getrotzt haben, um sie zu besuchen? Im Stillen betete sie, es möge kein Notfall sein. Dann vernahm sie eine männliche Stimme.
»Colum!« Hastig verließ sie ihr Zimmer, doch schon an der Treppe erkannte sie die sanfte Stimme des wichtigtuerischen, aber freundlichen Schreibers der Stadtversammlung, Simon Luberon. Sie eilte die Treppe hinunter. Luberon saß an der Feuerstelle, hatte die Kapuze seines Umhangs zurückgeschlagen und wärmte sich die dicklichen Finger. Als Kathryn eintrat, erhob er sich; das fröhliche, runde Gesicht strahlte vor Freude. Luberon würde es nie offen zugeben, aber insgeheim mochte er die stets ausgeglichene, dunkelhaarige Ärztin, sehr sogar.
»Kathryn.« Er streckte ihr beide Hände entgegen, ließ sie jedoch schnell und verschämt wieder in den weiten Ärmeln seines Umhangs verschwinden. »Ich gebe Euch lieber nicht die Hand«, lachte er und trat einen Schritt auf sie zu. »Meine sind die reinsten Eisklumpen.«
Kathryn nahm ihn bei den Schultern und hauchte ihm einen Kuss auf die eisigen Wangen.
»Simon, habt Ihr denn keine Handschuhe?«
Der kleine Schreiber trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. »Ich hatte welche«, stammelte er. »Aber ich habe sie verloren.«
Kathryn trat an den Leinenschrank, der in die Wand neben der Feuerstelle eingelassen war. Sie kam mit einem Paar dunkelblauer Handschuhe wieder zurück.
»Simon, die möchte ich Euch schenken. Ihr habt etwa die gleiche Größe wie ich.«
Luberon wurde rot vor Verlegenheit, streifte sie aber schnell über und spreizte stolz die Finger.
»Wundervoll!«, hauchte er. »Und so warm!«
»Ein Mann sollte immer warm sein«, ließ sich Thomasina vernehmen. »Im Haus und außer Haus, wenn Ihr wisst, was ich meine, Master Schreiber.« Luberon schaute rasch zu ihr hinüber. Die alte Amme betrachtete ihn mit unschuldigem Augenaufschlag.
»Kommt, Simon, setzt Euch!« Kathryn winkte ihn zu einem Stuhl an der Feuerstelle. Agnes schob einen zweiten Stuhl daneben. »Thomasina wird Euch einen Würztrank geben«, sagte Kathryn. »Und nun sagt mir, was Euch herführt.«
»Mord«, erwiderte Luberon beiläufig und öffnete die Schnallen seines Umhangs. Er zog ihn aus und warf ihn über die Stuhllehne. »Man sollte doch meinen, dass der eisige Winter die Wut der Menschen etwas abkühlt, aber dem ist nicht so.«
Er verstummte, als Thomasina ihm einen Zinnbecher mit gewürztem Wein brachte. Sie wickelte das Gefäß in Tücher ein, nahm einen rot glühenden Schürhaken aus dem Feuer und tauchte ihn in den Wein. Erst als das Zischen aufgehört hatte, nahm sie ihn wieder heraus.
»Hier«, brummte Thomasina und drückte dem kleinen Schreiber den Weinbecher vorsichtig in beide Hände. »Trinkt das, Master Simon, und Ihr werdet munter wie ein Jüngling unterm Maibaum.«
Luberon nippte vorsichtig an dem Wein. Kathryn verschränkte die Arme, ihre Hände waren in ständiger Bewegung.
»Nun mal raus mit der Sprache«, konnte sie nicht länger an sich halten. »Was für ein Mord, Simon?«
Genüsslich sog Luberon den Duft von Rosmarin und Thymian ein, der von seinem Weinbecher aufstieg.
»Kennt Ihr Richard Blunt?«
»Ja, er wohnt in der Reeking Alley hinter der Kirche von St. Mildred.«
Kathryn erinnerte sich an das freundliche, sonnengebräunte Gesicht des alten Malers, an die struppigen grauen Haare, die scharfen blauen Augen und vor allem an sein Talent, lebendige Szenen auf die grauen Wände der Pfarrkirche zu malen. »Er ist doch nicht etwa tot?«
Luberon schüttelte den Kopf. »Nein, er hat seine Frau umgebracht.«
Kathryn fröstelte und starrte ins Feuer. »Im letzten Frühjahr hat er Alisoun, die Tochter eines Händlers, geheiratet.«
»Stimmt«, bestätigte Luberon. »Die Leute nannten es eine Ehe zwischen Mai und Dezember. Er war dreißig Jahre älter als sie.«
Kathryn fuhr sich über das Gesicht, während Thomasina und Agnes unauffällig näher kamen, begierig, die Unterhaltung zu verfolgen.
»Alisoun war groß und gertenschlank, hatte ein hübsches Gesicht und blonde Haare«, erinnerte sich Kathryn laut, ohne zu erwähnen, was Colum einmal gesagt hatte: sie mache jedem schöne Augen und habe ein loses Mundwerk. Kathryn kannte Richard Blunt schon seit ihrer Kindheit und mochte ihn, Alisoun indessen hielt sie für verwöhnt und launenhaft.
»Was ist passiert?«
»Nun ja, Richard kam gestern Abend nach Hause. Wie Ihr wisst, war er gerade dabei, ein Gemälde in St. Mildred zu beenden.« Luberon stellte den Becher auf dem Kaminsims ab. »In Blunts Haus ist die Wohnstube nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Stockwerk. Richard und sein Sohn Peter ... Ihr kennt doch den Jungen? Er ist ein bisschen einfältig. Er reinigt häufig den Untergrund, bevor sein Vater ein Gemälde beginnt.«
»Weiter, weiter!«, unterbrach Thomasina ihn scharf. »So sagt doch um Himmels willen endlich, was passiert ist!«
»Ich weiß es ja selbst nicht genau«, fuhr Luberon sie an. »Der alte Blunt kam nach Hause und fand zwei junge Männer vor, die mit seiner Frau schäkerten: ein Student namens Nicholas aus Cambridge und sein Freund, der Schreiber Absolon, der bei einem Kornhändler arbeitet.« Luberon zwinkerte. »Ihr kennt die Sorte Mann, Mistress Kathryn, für die ist jede Frau willkommene Beute, und sie machen sich einen Sport daraus, einem Ehemann Hörner aufzusetzen. Jedenfalls waren die beiden jungen Männer halb entkleidet und Alisoun ebenfalls. Zumindest fanden wir ihre Leichen so vor.«
»Alle drei?«, rief Kathryn erschrocken aus.
»So ist es. Gott allein weiß, was geschehen ist. Aber als Blunt die Tür öffnete, hatte er bereits seinen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen griffbereit.« Luberon zuckte die Achseln. »Sekunden später war alles vorüber. Ein Pfeil erwischte Nicholas in der Halsschlagader. Alisoun ebenfalls. Absolon versuchte, ein Fenster zu öffnen und hinauszuspringen, aber Richards dritter Pfeil traf ihn in den Rücken.«
Kathryn vergaß ihre eigenen Sorgen und verbarg das Gesicht in den Händen. Sie konnte sich die Szene vorstellen; die gemütliche Wohnstube, das Flackern des Feuers, die Weinbecher und das leise Gelächter. Blunt war ein Meisterschütze – was hatte Colum ihr einmal erzählt? Ein guter Bogenschütze konnte in einer Minute mindestens sechs Pfeile abschießen, und alle trafen ins Ziel.
»Was geschah dann?«
»Tja, Absolon fiel auf die Straße, der Witwe Gumple praktisch vor die Füße. Sie rief die Wachen, die die beiden anderen Leichen fanden und Richard, der ruhig auf seinem Stuhl saß und ins Feuer starrte. Er machte keinen Versuch, das Verbrechen zu leugnen. Peter, der von einer Besorgung später zurückgekommen war, stand neben ihm und schaute mit leerem Blick in die Runde.«
»Und wo sind sie jetzt?«
»Tja, Peter ist noch zu Hause, aber Richard hat man in eine Zelle im Rathaus gesperrt. Er wird vor das Königliche Gericht gestellt und bestimmt zum Tode durch den Strang verurteilt.« Luberon zählte die Punkte an seinen dicken Fingern ab. »Die Morde waren kaltblütig. Wir haben die Leichen, und wir haben den Mörder.«
»Wie geht es Richard?«, fragte Kathryn.
»Oh, der ist die Ruhe selbst. Er hat ein lückenloses Geständnis abgelegt und unterwirft sich dem Gesetz.«
Kathryn dachte an Blunts einzigen Sohn aus erster Ehe: ein hoch aufgeschossener, schmächtiger junger Mann mit ständig offenem Mund.
»Und Peter ist nicht als Komplize festgenommen worden?«
»Oh nein. Witwe Gumple kann sich genau erinnern, dass Peter die Straße entlangkam, nachdem Absolons Leiche aus dem Fenster gefallen war.«
Thomasina nahm auf einem Stuhl am Feuer Platz. »Wenn Witwe Gumple mit der Sache zu tun hat«, verkündete sie düster, »dann weiß gegen Mittag ganz Canterbury Bescheid und morgen ganz Kent. Die alte Gumple hat ein Schandmaul!«
Kathryn warf ihrer Amme einen neugierigen Blick zu. Witwe Gumple war führendes Mitglied des Gemeinderats, eine boshafte Klatschbase, eingebildet und hochmütig, und in ihrem reich verzierten Kopfputz und den mit Volants besetzten Kleidern eher lächerlich. Kathryn fragte sich oft, ob Thomasina das alte Tratschweib aus einem geheimen Grund so wenig mochte, ja geradezu hasste.
»Simon, das sind furchtbare Neuigkeiten. Aber was kann ich tun?«
Luberon spielte mit seinen neuen Handschuhen. »Die Leichen müssen untersucht werden, und Ihr, Mistress Swinbrooke, seid Stadtärztin. Ich wäre Euch auch sehr verbunden, wenn Ihr in Blunts Haus nach dem Rechten sehen könntet. Vielleicht braucht Peter Hilfe. Außerdem hat Richard Blunt um eine Unterredung mit Euch gebeten.«
»Mit mir!«, rief Kathryn überrascht. »Er war seit über vierzehn Monaten nicht mehr bei mir!«
»Und doch wünscht er Euch zu sehen«, sagte Luberon und blickte sich um. »Trotzdem ist das nicht der eigentliche Grund meines Besuchs. Ist Master Murtagh wieder da?«
»Nein.« Kathryn seufzte. »Und wir machen uns langsam Sorgen, wo er bleibt.«
»Wenn das so ist, Mistress, dann müsst Ihr allein kommen. Es gibt noch einen Toten.«
Kathryn stöhnte.
»Das ist eine offiziellere Sache«, erklärte Luberon. »Kennt Ihr das Wirtshaus ›Zum Weidenmann‹, gleich hinter der Burg in der Nähe von Worthgate?«
Kathryn nickte.
»Tja, diese geräumige, gemütliche Herberge war vergangene Nacht bis auf das letzte Zimmer von Reisenden belegt, die von dem schlechten Wetter überrascht worden waren. Einer von ihnen war ein königlicher Steuereintreiber, Sir Reginald Erpingham.« Luberon seufzte, griff nach seinem Becher, trank ihn leer und erhob sich. »Um es kurz zu machen, Mistress, heute Morgen fand man Erpingham tot im Bett.«
»Und der Grund?«
Achselzuckend warf Luberon sich den Umhang über. »Mausetot, der gemeine Bastard.« Er lächelte Kathryn schuldbewusst an. »Tut mir leid, Mistress, aber das war er wirklich. Um Erpingham ist’s nicht schade, aber die vielen Hundert Pfund Sterling Steuergelder, die er bei sich hatte, die wird man bestimmt vermissen.«
»Gestohlen?«, rief Kathryn verblüfft.
»Verschwunden, als hätten sie nie existiert. Ich komme gerade von dort. Ihr schaut es Euch am besten selbst an, Mistress, bitte kommt mit!«
Kathryn wusste, dass sie keine andere Wahl hatte. Colum war der königliche Leichenbeschauer der Stadt, und sie hatte ein Abkommen mit der Ratsversammlung, die sie als Stadtärztin beschäftigte. Demnach war es ihre Pflicht, jeden mysteriösen Todesfall zu untersuchen, besonders, wenn so wichtige Leute wie Erpingham ermordet wurden.
»Ich komme auch mit«, schlug Thomasina vor und stand auf.
»Nein, Thomasina, du bleibst hier!« Kathryn sah sich um. »Wo steckt eigentlich Wuf? Er ist so auffallend leise.«
»Der ist oben«, sagte Thomasina. »Er schnitzt bestimmt wieder.« Die Züge der alten Frau wurden sanft. »Mistress, das müsst Ihr Euch anschauen. Er ist wirklich begabt. Seid Ihr sicher, dass ich nicht mitkommen soll?«
»Ja«, wiederholte Kathryn. »Und nun hör auf, anderer Leute Gespräche zu belauschen und hol mir meine Satteltaschen von oben. Ich brauche eine Rolle Pergament und das Ledermäppchen mit meinen Federn. Das Wirtshaus wird mir Tinte zur Verfügung stellen.« Sie dachte an den völlig verängstigten Peter Blunt und an seinen Vater Richard, der in einem einsamen, kalten Verlies eingesperrt war. »Oh, und noch einen kleinen Topf Salbe, einen ganz kleinen. Sollte Master Murtagh zurückkommen, so sag ihm, wohin wir gegangen sind. Zuerst zum ›Weidenmann‹, dann zu Blunts Haus, dann ins Rathaus.«
Thomasina nickte widerstrebend. Sie brachte Kathryn ein Paar Lederstiefel und ein zweites Paar Wollsocken. Kathryn trug alles in ihre kleine Schreibkammer und zog sich dort an. Als sie wieder in die Küche trat, war Luberon zum Aufbruch bereit.
»Es ist nicht weit«, verkündete er. »Wir können zu Fuß gehen – das ist vielleicht sicherer.«
Kathryn war einverstanden. Sie bat Thomasina, auf Wuf aufzupassen und folgte Luberon hinaus in die schneidende Kälte. Die Ottemelle Lane und alle Zufahrtsstraßen waren menschenleer. Der Sturm hatte aufgehört, aber noch immer fielen weiche, leichte Schneeflocken herab, die die schrägen Dächer dick verhüllten oder als gefrorene Klumpen über Dachrinnen hingen. Luberon und Kathryn mussten sich vorsichtig einen Weg bahnen, denn der Schnee hatte auch die Gossen und den Unrat, der für gewöhnlich in den Straßen lag, zugedeckt. Behutsam setzten sie einen Fuß vor den anderen und hatten zugleich ein Auge auf die Schneebretter, die sich immer wieder von den Dächern lösten. Ab und an wurde ein Fenster aufgerissen, eine Magd leerte den Inhalt des Nachtgeschirrs aus und verwandelte so den Schnee vor dem Haus zu schmutzigem stinkendem Matsch. Kathryn nahm Luberons Arm; der Schreiber strahlte und tätschelte ihre Hand.
»Danke, Kathryn«, murmelte er.
»Wofür?«, fragte sie verwirrt.
Luberon lugte rotwangig aus den Tiefen seiner Kapuze hervor. »Für die Handschuhe«, erwiderte er. »Und dafür, dass Ihr mitkommt.«
»Ich werde Euch noch ein zweites Paar stricken«, sagte Kathryn. »Simon, es wird Zeit, dass Ihr eine gute Frau findet.«
»So eine wie Thomasina zum Beispiel?«, scherzte Luberon.
»Thomasina ist vielleicht ein bisschen anstrengend«, lachte Kathryn.
An der Ecke der Ottemelle Lane blieben sie stehen. Eine freundliche Bürgerin hatte Holz aufgestapelt und mitten in der Durchfahrt ein Feuer angezündet, an dem die Bettler und die Armen der Stadt sich wärmen konnten. Die von Kopf bis Fuß in Lumpen gekleideten Gestalten standen dicht gedrängt um das Feuer und redeten leise miteinander. Als Kathryn der beißende Geruch brennenden ranzigen Fetts in die Nase stieg, drehte sich ihr der Magen um. Die Bettler versuchten, Fleischstücke, die sie stibitzt oder erbettelt hatten, zu braten. Neben dem Feuer lag ein ausgemergelter Hund, sein schäbiger Kadaver war steif gefroren. Zwei Bengel tanzten um ihn herum und bohrten mit einem Stock in dem Tier. Kathryn langte in ihre Geldbörse und zog Luberon am Arm, damit er stehen blieb. Sie hielt eine Münze hoch.
»Lasst das!«, sagte sie zu den beiden mageren Kindern. »Hier, nehmt das und kommt mit!«
Sie grapschten nach der Münze und folgten Kathryn und Luberon in die Hethenman Lane.
»Schaut her«, sagte Kathryn und deutete auf die Menschenschlange vor dem Bäckerladen. »Geht zu Master Bernhard und sagt ihm, Mistress Swinbrooke schickt euch.« Sie ließ sich von den Kindern den Namen wiederholen. »Sagt ihm, Mistress Swinbrooke will, dass ihr heißen Ingwer bekommt.«
Wie der Blitz waren die beiden Jungen auf und davon.
»Wir müssen was unternehmen«, grummelte Luberon. »Die verdammten Mönche im Kloster könnten ruhig mehr tun. Canterbury ist voller Bettler, und so mancher von ihnen wird das Frühjahr nicht mehr erleben.«
Zwei an Händen und Füßen zusammengekettete Schuldner, die aus dem Stadtgefängnis entlassen worden waren, humpelten mit ausgestreckten Händen auf sie zu und bettelten um Almosen für sich und ihre Mithäftlinge. Kathryn und Luberon gaben jedem eine Münze.
»Es ist doch immer dasselbe«, murmelte Kathryn. »Der Schnee verbirgt die Krankheit in der Stadt, aber die Schwachen und Hilflosen fallen umso mehr ins Auge.«
Sie schaute sich um. Außer der Bäckerei waren alle Läden geschlossen; die Marktstände standen verlassen, und an den Häusern waren die Fensterläden geschlossen wegen der klirrenden Kälte. Nicht einmal Kinder spielten auf der Straße. Kathryn musste hin und wieder stehen bleiben und fest aufstampfen, um die Füße warm zu halten.
Endlich bogen sie in die Worthgate Lane, die an den mächtigen Mauern der Burg von Canterbury entlangführte, und erreichten gleich hinter dem Winchepe Gate den großen, gepflasterten Hof des Wirtshauses ›Zum Weidenmann‹. Kathryn atmete erleichtert auf: der Hof rund um das Wirtshaus war vom Schnee befreit und mit einer Mischung aus Salz und Erde bestreut, damit die Gäste nicht ausrutschten. Als ein junger Bursche auf sie zukam und nach ihrem Anliegen fragte, stellte sich Luberon in knappen Worten vor. Kathryn schaute sich derweil um. Der ›Weidenmann‹ war ein gut gehendes Wirtshaus in günstiger Lage direkt am Rande der Stadt. Die Außenmauern waren mit grauen Bruchsteinen verkleidet, das Pflaster im Hof war glatt und sauber verlegt, das frisch gestrichene Holzwerk an Stallungen und Außengebäuden zeugte von guter Pflege. Kathryn stieg angenehmer Küchenduft in die Nase. Sie blickte hoch und sah, dass die Fenster im obersten Stockwerk Schießscharten ähnelten. Im Erdgeschoss und im ersten Stock waren die Fensteröffnungen breit und mit bunten Butzenscheiben verglast. Der Bursche führte sie in die leere, weiß getünchte Küche, in der eine unheimliche Stille herrschte. Nur in dem kleinen Backofen neben der Feuerstelle, der Quelle des köstlichen Duftes, brannte ein Feuer. Tische und Gesimse waren so sauber, dass selbst Thomasina die blank gescheuerten Flächen gelobt hätte. Auf den Regalen an den Wänden glänzten Krüge, Töpfe, Schüsseln und Kannen.