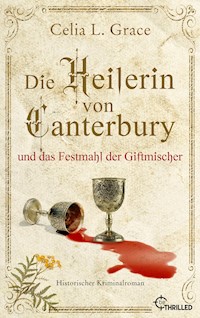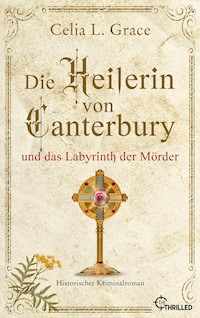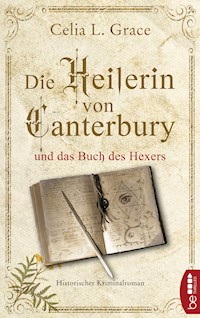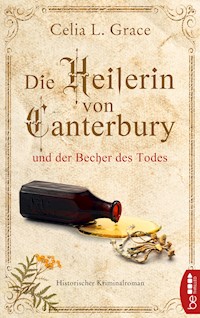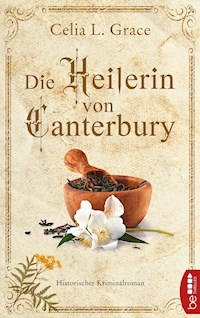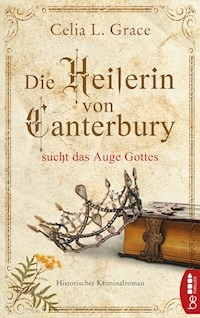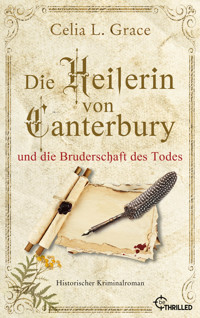
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für die Ärztin
- Sprache: Deutsch
England 1472: Der Beichtvater der Königinmutter Cecily von York stirbt unter mysteriösen Umständen. Cecily treibt dessen Heiligsprechung mit Nachdruck voran, doch der Erzbischof von Canterbury zeigt sich zögerlich. Er beauftragt die Heilerin Kathryn Swinbrooke, herauszufinden, warum Cecily ein solches Interesse an einer Heiligsprechung des Geistlichen hat und wie er wirklich gestorben ist. Kathryn stößt bei ihren Nachforschungen schließlich auf Briefe, die Hinweise auf eine dunkle Vergangenheit des Verstorbenen liefern - und bald schwebt sie selbst in höchster Gefahr ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Historische Anmerkung
Historische Figuren
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
ANMERKUNG DER AUTORIN
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
England 1472: Der Beichtvater der Königinmutter Cecily von York stirbt unter mysteriösen Umständen. Cecily treibt dessen Heiligsprechung mit Nachdruck voran, doch der Erzbischof von Canterbury zeigt sich zögerlich. Er beauftragt die Heilerin Kathryn Swinbrooke, herauszufinden, warum Cecily ein solches Interesse an einer Heiligsprechung des Geistlichen hat und wie er wirklich gestorben ist. Kathryn stößt bei ihren Nachforschungen schließlich auf Briefe, die Hinweise auf eine dunkle Vergangenheit des Verstorbenen liefern – und bald schwebt sie selbst in höchster Gefahr ...
Celia L. Grace
Die Heilerin von Canterbury und die Bruderschaft des Todes
Historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marion Balkenhol
»Mein Text ist seit jeher schon derselbe:
Habsucht ist die Wurzel allen Übels.«
Geoffrey Chaucer, Die Canterbury-Erzählungen,
»Prolog des Ablasskrämers«
»Im Mittelalter praktizierten Ärztinnen auch in Kriegswirren und während großer Epidemien weiter wie immer, einfach weil man sie brauchte.«
Kate Campbellton Hurd-Mead, Geschichte der Frauen in der Medizin
Historische Anmerkung
Im Mai 1471 war der Bürgerkrieg zwischen den Herrscherhäusern York und Lancaster zu Ende gegangen. Edward von York hatte bei Tewkesbury den endgültigen Sieg errungen. Der König aus dem Hause Lancaster, Heinrich VI, wurde später von Anhängern des Hauses York im Tower ermordet, woraufhin Edward von York mit Freuden den königlichen Titel Edward IV annahm und die Macht vollends ergriff. Edward wurde von Elizabeth Woodville, seiner schönen Gemahlin, unterstützt sowie von seinen beiden einflussreichen Brüdern, George von Clarence und Richard von Gloucester, und deren Anhängerschaft. Die Yorkisten kamen zur Ruhe und genossen die Früchte des Friedens, wenngleich noch immer alter Groll und Hass schwelten und oftmals an die Oberfläche drangen.
Angstvoll blickte Frankreichs schlauer, gerissener König Ludwig XI, der »Spinnenkönig«, auf den alten Feind seines Landes, der immer mehr an Stärke gewann. Ludwig konnte es kaum erwarten, sich einzumischen und Englands Überlegenheit zu bremsen, koste es, was es wolle ...
Historische Figuren
Heinrich VI: Heinrich von Lancaster, Sohn des großen Heinrichs V. Manche hielten ihn für einen Narren, andere verehrten ihn als Heiligen, für einige war er beides. Unter seiner schwachen, unfähigen Herrschaft brach der grausame Bürgerkrieg zwischen den Häusern York und Lancaster aus.
Margaret von Anjou: französische Gemahlin Heinrichs VI und die eigentliche Macht hinter dem Thron; ihre Hoffnungen auf einen Sieg wurden endgültig zunichte gemacht durch herausragende Siege der gegnerischen Truppen bei Barnet und Tewkesbury in den ersten Monaten des Jahres 1471.
Beaufort von Somerset: führender General und Politiker des Hauses Lancaster; angeblicher Geliebter Margarets von Anjou, bei Tewkesbury gefallen.
Heinrich Tudor: der letzte Thronanwärter des Hauses Lancaster. Etwa um 1473 an den Höfen Frankreichs und in der Bretagne im Exil.
Nicholas Faunte: lancastertreuer Bürgermeister von Canterbury; wurde später gefangengenommen und in seiner eigenen Stadt hingerichtet.
DAS HAUS YORK
Richard von York: Vater Edwards IV. Richards schrankenlose Machtgier führte zum Ausbruch der Feindlichkeiten zwischen den Häusern York und Lancaster. In der Schlacht bei Wakefield im Jahre 1461 wurde er in einen Hinterhalt gelockt und getötet.
Cecily von York (geb. Neville): »Die Rose von Raby«; Witwe Richards von York. Sie hatte drei Söhne: Edward, Richard von Gloucester und George von Clarence.
Edward IV: erfolgreicher General der Yorkisten und späterer König.
George von Clarence: der gutaussehende, aber heimtückische Bruder Edwards IV; wechselte im Bürgerkrieg die Seiten.
Richard von Gloucester: jüngster Bruder Edwards IV; spielte beim Sieg der Yorkisten 1471 eine führende Rolle.
FRANKREICH
Ludwig XI: der »Spinnenkönig«; stärkte und zentralisierte die französische Monarchie im letzten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts.
Jeanne d’Arc: »Jungfrau von Orléans«; Visionärin und Anführerin des französischen Widerstands gegen England, bis die Engländer sie im Jahre 1431 gefangen nahmen und in Rouen verbrannten.
ENGLISCHE POLITIKER
Thomas Bourchier: betagter Erzbischof von Canterbury.
William Hastings: Gefolgsmann Edwards IV.
Francis Lovell: Gefolgsmann Richards von Gloucester.
PROLOG
»O verfluchte Sünde aller Schändlichkeit!
O mörderischer Verräter! O Niedertracht!«
Chaucer, Die Erzählung des Ablasskrämers
Roger Atworth, der ehemalige Soldat, der jetzt den Bußbrüdern Jesu Christi angehörte, einem Bettelmönchorden in Canterbury, fühlte den Tod nahen.
»O Jesus miserere!«, murmelte der alte Mann vor sich hin.
Wie gebannt starrte er auf das Licht, das unter der schmalen Tür hindurchdrang. Der Tod hatte sich gleich einem Meuchelmörder angeschlichen, war hastig auf leisen Sohlen über einen Korridor getappt und hatte blitzschnell aus dem Schatten eines Durchgangs zugeschlagen. Der Tod hatte seine Falle zuschnappen lassen. Atworth kannte sich im Leid aus. Die Schmerzen, die von der Brust aus über die linke Körperhälfte liefen, waren wie eine Sturmglocke, die ihn gemahnte, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hatte. Atworth versuchte sich zu bewegen, doch Beine, Hände und Arme waren wie mit Blei gefüllt. Seine Gedanken wanderten. Welcher Wochentag war heute? Jegliches Zeitgefühl war ihm abhandengekommen. Er erinnerte sich, dass die guten Brüder sich auf das Fest Mariä Verkündigung vorbereitet hatten, das neun Monate vor Weihnachten begangen wurde. Atworth hustete röchelnd und leckte sich den Schleim aus dem Mundwinkel. Die Weihnachtszeit in diesem Jahr würde er nicht mehr erleben. Er würde nicht in Ehrfurcht vor der Krippe niederknien und beim Schmücken mit Stechpalme und Efeu zur Hand gehen. Atworth versuchte sich zu konzentrieren. Er wusste genug über Heilkunde und erkannte die Symptome des Delirium tremens. Hatte Bruder Simon, der Krankenpfleger, es nicht genau so geschildert? Am ganzen Körper litt er unsägliche Schmerzen. Seine Kehle war wie ausgedörrt. Atworth war nicht einmal imstande gewesen, die dürftigen Happen zu essen, die ihm die seltsam verhüllte Gestalt gebracht hatte.
»Wer war es?«, murmelte Atworth ins Dunkle hinein. Doch was spielte das schon für eine Rolle? Er würde sterben, und er war dazu bereit, wie es sich für einen rechtschaffenen Soldaten ziemte. Er versuchte, sich die Worte des Totenpsalms ins Gedächtnis zu rufen, das »De Profundis«. Welcher war es noch, Psalm 130?
»Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf
die Stimme meines Flehens!
So du willst, Herr, Sünden zurechnen ...«
Atworth hustete. Vergeblich versuchte er, den Kopf zu heben. Er starrte in die zunehmende Dunkelheit. Schuld! Oh, Atworth fühlte sich wahrhaft schuldig! Er vermochte den Alpträumen keinen Einhalt zu gebieten, die gleich schwarzem, fauligem Wasser seine Seele überschwemmten. Alpträume aus seiner Jugend, als er noch bei den Söldnerheeren und unter gold-rotem Banner in Nordfrankreich gekämpft hatte. Das war eine Zeit des Raubens und Plünderns gewesen, in der ganze Dörfer in Flammen aufgingen! Wie die Lilien auf dem Felde wurden Männer, Frauen und Kinder niedergemäht.
Roger Atworth schüttelte den Kopf. Er erinnerte sich an eine junge Frau, die er genommen hatte. Wo war es noch? Nördlich von Agincourt, wo König Heinrich seinen großen Sieg errungen hatte. Sie war auf der Flucht, trug ein Kleiderbündel über der Schulter und stolperte auf die Lichtung, wo Atworth mit seinen Männern rastete. Er hatte sie vergewaltigt und anschließend seinen Männern überlassen. Zuletzt ließen sie die unglückselige, nackte, blutende Frau liegen, die an Geist, Körper und Seele Schaden genommen hatte.
»O, Jesus miserere!«, bat Atworth um die Gnade, die er so verzweifelt brauchte und doch nicht verdiente. Er und seine Männer waren dafür verflucht worden. Ein altes Weib, das im Wald lebte, hatte die Schreie des Mädchens vernommen und kam herbeigelaufen, um nachzusehen, was da vor sich ging. Die Alte hatte am Rande der Lichtung gestanden, die grauen Haare fielen ihr über die Schultern, Abscheu und Wut waren ihr ins Gesicht geschrieben. Damals schon hatte Atworth ihren Mut bewundert. Sie war hervorgetreten wie ein alter Prophet, den knochigen Finger hoch erhoben. Zunächst redete sie in einem Dialekt auf die Männer ein, den sie nicht verstanden, doch dann verfiel sie überraschend ins Englische.
»Verflucht sollt Ihr sein«, kreischte sie, »möge Euch Essen und Trinken im Halse stecken bleiben! Verflucht sollt Ihr sein, ob Ihr wacht oder schlaft! Ob Ihr reitet oder geht! Verflucht sollt Ihr sein. Im Morgengrauen und mitten in der Nacht! Verflucht sollt Ihr sein bei meinem Tod!«
Atworth schloss die Augen. Er erinnerte sich an den Vorfall, als wäre es erst vor einer Stunde gewesen. Er hatte sein Schwert gezogen und es der Alten in den Bauch gestoßen, hatte sie aufgespießt wie ein Kaninchen oder ein Schwein. Anschließend hatten sie die Frau mit dem Kopf nach unten an einer Ulme aufgehängt. Sie hatten dagestanden und über ihren blau geäderten, mageren Körper gelacht, der am Baum baumelte wie ein Tierkadaver am Verkaufsstand eines Metzgers. Dann hatten sie ihre Stiefel eingesammelt, die Pferde gesattelt und die blutüberströmte Leiche hängen lassen, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen. Wie hatte einer seiner Männer Atworth beschrieben? »Ein Unhold, der weder Gott noch Menschen fürchtet«. Die Alte indes hatte recht behalten. Von jenem Tag an war er vom Pech verfolgt. Zwei Tage darauf gerieten sie in einen Hinterhalt von Söldnern aus der Lorraine, die sechs von Atworths Männern töteten und den Großteil ihrer Beute raubten.
Atworth schlug die Augen auf. Der Schmerz hatte nachgelassen. Vielleicht würde ihm jemand zu Hilfe kommen. Er lauschte angestrengt. Das Licht, das unter der Tür hereindrang, wurde schwächer. Niemand würde kommen! Wieder fiel Atworth in Tagträume. Alle, die seiner Truppe angehörten, waren zwischen Hecken und Gräben in Nordfrankreich eines gewaltsamen Todes gestorben. Sie waren während des schrecklichen Unheils gefangengenommen worden, welches über die englischen Streitkräfte hereinbrach, als die Armeen Frankreichs, angeführt von dieser unheimlichen Jungfrau von Orléans, die Gottverfluchten aus Frankreich vertrieben. Atworth war auf dem Marktplatz von Rouen zugegen gewesen, als sie die Jungfrau verbrannten. Er hatte gesehen, wie ihr dünner, ausgemergelter Körper in der Hitze Blasen schlug, doch ihre Stimme blieb stark und betete auch dann noch laut, als ihr feines Antlitz hinter einem Flammenvorhang verschwand. Und danach? Jene trostlosen Tage in der Burg von Rouen als Leibwächter der Gräfin Cecily von York. Damals war ein Band geschmiedet worden, das auch jetzt noch hielt. Nichts hatte sich daran geändert, auch als Atworth vom unbarmherzigen Vicomte de Sanglier gefangengenommen wurde, einem jungen, gottlosen Mann. In de Sanglier hatte Atworth seine eigene Seele erkannt, und abermals entstand eine Bindung, eine Kette wurde geschmiedet und die Glieder miteinander verbunden; sie erstreckte sich über Jahre, und de Sanglier hielt sie noch immer fest in der Hand.
Nach der Flucht aus Frankreich war Atworth in sein kleines Dorf in der Nähe von Canterbury zurückgekehrt. Fortan war er ein von Dämonen verfolgter Mann. Atworth hatte reichlich Beute mitgebracht und sich als wohlhabender Gutspächter niedergelassen. Er heiratete die Tochter eines Gutsbesitzers, doch alles wendete sich zum Schlechten. Seine Frau starb bei einer der plötzlich auftretenden Fieberepidemien. Atworths Geschäfte florierten nicht. Schlimmer noch, wohin Atworth auch ging, die Geister verfolgten ihn: die Alte, die ihn in einer Taverne plötzlich vom anderen Ende des Raumes anschaute. Oder er sah in dunkler Nachtstunde, wenn er einen Blick aus seinem Flügelfenster warf, das Gesicht der alten Vettel, umrahmt von eisengrauem Haar. Sie funkelte ihn mit seelenlosen Augen an, wirkte mit ihrem rot umrandeten Mund furchterregend auf dem mondhellen Rasen vor seinem Fachwerkhaus. Atworth fand keinen Frieden.
»Ich war wie ein Schlauch im Rauch«, murmelte er.
Nach Trost suchend war er nach Canterbury geeilt. Er hatte gebetet und gefastet. Ein Mitglied der Bruderschaft hatte ihm die Beichte abgenommen. Der Mönch hatte geweint, als er Atworths Sündenregister vernahm: Mord, Vergewaltigung, Raub und Brandstiftung. Er wollte Atworth erst dann die Absolution erteilen, wenn dieser eine Pilgerfahrt unternommen hätte. Atworth reiste nach Outremer, erlebte die sengende Hitze Palästinas und kehrte über Rom zurück, wo er von einem der Beichtväter des Papstes die Absolution erhoffte. Der Priester hatte ihm ein Leben nach strengsten Ordensregeln auferlegt.
Atworth war nach Canterbury zurückgekehrt. Er hatte sich dem Bettelorden der Bußbrüder Jesu Christi angeschlossen und sich einem Leben unterworfen, das nur aus Gebet, Fasten und Buße bestand. Doch auch hier entließ ihn die Vergangenheit nicht aus ihrem eisernen Griff. Er wurde zum Priester geweiht, und ihm ging der Ruf voraus, besonders fromm und ein kluger Beichtvater zu sein.
Cecily von York, die Mutter des Königs, hatte sich an die frühere Bindung erinnert und nichts Eiligeres zu tun, als ihre Seele in seine Hände zu legen. Atworth biss die Zähne zusammen. Hatte sie doch allen Grund, ihn aufzusuchen und um Absolution zu bitten. Leise murmelte er ein Gebet. Er war zu hart! Jetzt war er ein Gefangener, heimlich gefangengenommen und über die Vergangenheit befragt! Die Briefe in seiner Tasche waren verschwunden, doch er hatte seine Herzogin nicht verraten; das hatte sie nicht verdient. Atworth fragte sich, was nun geschehen würde. Er schauderte, als seine Brust von einer neuen Woge des Schmerzes erfasst wurde. Das Atmen fiel ihm schwer. Er hörte ein Geräusch und schaute sich um, atmete zittrig ein und zuckte unwillkürlich zusammen, weil es so faulig roch. Sein Blick fiel auf einen Schatten. Stand jemand an der Tür?
»Wer ist da?« krächzte er.
Vielleicht war es Jonquil, der nach ihm suchte. Die Gestalt kam auf ihn zu. Atworth versuchte zu schreien, doch es gelang ihm nicht. War es eine Wahnvorstellung? Er schloss die Augen, aber selbst sein schmerzgeplagter Geist erkannte jene mit Eiter durchtränkten Lumpen, die Holzschuhe, das Gesicht der alten Vettel, das stahlgraue Haar und die schwarzen, seelenlosen Augen.
»Oh, Jesus!«
Atworths Kopf sank nach hinten, Todesröcheln drang aus seiner Kehle. Er rang nach Atem, hatte jedoch seinen letzten Kampf verloren. Bruder Roger Atworth, Angehöriger der Bußbrüder Jesu Christi, erschauderte und starb.
»Von plötzlichem Tod.
Herr erlöse uns.
Von Hungersnot.
Herr, erlöse uns.
Von Pest.
Herr, erlöse uns.
Von dem Bösen, das am Tage lauert.
Herr, erlöse uns.
Von Feuer und Schwert.
Herr, erlöse uns.
Von der Geißel des Teufels.
Herr, erlöse uns.«
Am Vorabend des Fests der Heiligen Perpetua und Felicitas verließ eine feierliche Prozession der Bußbrüder Jesu Christi das Kloster und zog durch das Haupttor in die Straßen von Canterbury. Die Bettelmönche gingen gebeugten Hauptes hintereinander her, ihnen voran ein Kreuzträger und zwei Rauchfassträger, die ihre Weihrauchgefäße schwenkten.
Sie veranstalteten eine Bittprozession und flehten Gott um Hilfe an in der großen Not, welche die Stadt befallen hatte. Anfangs verhallte ihr Gebet in den geschäftigen, überfüllten Straßen und Gassen Canterburys ungehört. Doch schon bald machte sich das eintönige Auf und Ab ihres Gesangs wie feierlicher Trommelschlag bemerkbar: eine Mahnung an die guten Bürger, dass man wahrlich in bösen Zeiten lebte. Die Händler, die Hausierer, die Höker, aber auch die Pilger auf ihrem Weg zu Beckets berühmtem Schrein hielten in ihrer Tätigkeit inne und traten zur Seite. Einige knieten auf dem schmutzigen Straßenpflaster nieder und bekreuzigten sich. Gespannt betrachteten sie einen Mönch mit Weihwasserbecken, der eifrig mit dem Weihwedel nach beiden Seiten spritzte, als würde sie dies vor der Plage bewahren, die so plötzlich in ihrer schönen Stadt aufgetaucht war.
Gerade als ein Seiler niederkniete, warf er einen kurzen Blick auf die andere Straßenseite und sah das kleine, schwarze, pelzige Tier aus einem schmalen Durchgang schießen und in den Schutz einer Spalte unter dem Fachwerkbalken eines Hauses huschen. Der Seiler packte den Holzgriff des Dolches, der in seinem Gürtel steckte. Wären die guten Mönche nicht gewesen, hätte er das Tier verfolgt! Ratten, schwarz und glitschig, mit struppigem Fell und zuckenden Nasen suchten anscheinend die Stadt heim. Es war doch schon fast Ende März. Bald würde der April anbrechen, Zeit für frische Frühlingsluft. Die Feldwege und Straßen würden aushärten, und die Pilger würden sich gleich einem Strom in die Stadt ergießen. Sie alle wollten vor Beckets juwelenbesetztem Schrein niederknien, ihre heißen Gesichter an den Stein drücken und Canterburys großem Heiligen ihre Bitten vortragen. Doch was würde jetzt geschehen? In den vergangenen drei Wochen schien die Stadt von einer Rattenplage heimgesucht, die Chaos und Verwirrung stiftete.
Die Prozession der Bettelmönche zog vorüber, und der Seiler erhob sich. Er ging in die kleine Schänke an der Ecke zur Black Griffin Alley. Hinter sich hörte er ein Kind kreischen: »Ratte! Ratte!«
Der Seiler schüttelte nur den Kopf. Er schaute sich in dem schmuddeligen Schankraum um, warf einen angewiderten Blick auf die fleckigen Tische und dreckigen Hocker. Die Wirtin, die hinter dem Fass stand, winkte ihn zu sich, verzog ihr ungewaschenes Gesicht zu einem Lächeln und wischte sich die Hände an einer schmutzigen Schürze ab. Der Seiler hätte dankend abgelehnt, doch er hatte Durst. Er setzte sich auf einen Hocker, und die Wirtin brachte ihm einen ledernen Trinkkrug mit weißem Schaum obenauf. Der Seiler wollte ihr das Gefäß schon aus der Hand nehmen, doch sie trat einen Schritt zurück.
»Erst das Geld, dann die Ware!«
Der Seiler angelte eine Münze aus seinem Geldbeutel.
»Ich nehme zwei«, sagte er.
Da lächelte die Wirtin wieder und stellte den Trinkkrug auf den Tisch. Sie trat an die Tür und schaute die Straße hinunter, als wollte sie noch einen Blick auf die Prozession werfen.
»Als ob das etwas nützte.«
Mit einem Ruck drehte sich der Seiler zu der Stimme um, die aus einer dunklen Ecke kam. Der Mann, der dort gesessen hatte, stand auf und kam gespenstisch leise näher. Unaufgefordert nahm er gegenüber dem Seiler auf einem Hocker Platz. Er sah in der Tat wie ein Geist aus: bleiches Gesicht, graue Haare, tiefliegende blaue Augen, faltige Wangen, spitze Nase und blutleere Lippen. Der Mann trug ein nicht gerade sauberes Hemd unter einer Jacke aus Englischleder, die mit einer Kordel zusammengehalten wurde. Seine Kniehose war aus Kammgarn und steckte in schlammigen Lederstiefeln. Seine Finger und sein Gesicht indes waren sauber. Der Seiler, der sich seines scharfen Blickes rühmte, bemerkte, dass der Kriegsgurt über der Schulter des Fremden aus feinem Leder mit engen, purpurnen Stichen gefertigt war; Schwert und Dolch in den Scheiden waren allem Anschein nach aus glänzendem, grauem Stahl.
»Glaubt Ihr nicht an Gebete, Bruder?«, fragte der Seiler.
Der ungebetene Gast griente, zeigte schöne, scharfe und ebenmäßige Zähne. Er streckte die Hand aus. »Ich heiße Monksbane.«
Der Seiler drückte ihm die Hand.
»Seid Ihr ein Gelehrter?«
Monksbanes Lächeln wurde noch breiter. »Das gefällt mir«, murmelte er. »Ich war ein Mitglied der Advokatenkammer in London, bevor ich Rattenfänger wurde.«
Der Seiler prostete ihm freundlich zu.
»Demnach ist Euch alles über diese Plage bekannt?«
»Es gibt zwei Arten von Ratten« – Monksbane hielt sein Gefäß zwischen den Händen und richtete den Blick in die Ferne –, »schwarze und braune. Keine hat das Recht, im Königreich zu sein. O nein.« Er achtete nicht auf den fragenden Blick des Seilers, sondern tippte sich an die Nase. »Die Menschen sind so schlau. Wusstet Ihr, dass es hier nicht einmal Kaninchen gab, bis der Eroberer kam? Dasselbe gilt für die Ratten! Mit Schiffen kamen sie herüber. Die braunen sind nicht so schlimm, aber die schwarzen ...« Er verzog das Gesicht. »Manche behaupten, sie bringen die Pest und vermehren sich schlimmer als die Fliegen. Zwei Ratten können in einem Jahr eine Unmenge Nachkommen zeugen.«
Der Seiler trank einen Schluck Ale. Jetzt schätzte er sich glücklich, dass er diese Schänke aufgesucht und einen so interessanten Geschichtenerzähler kennengelernt hatte. Hatte der Mann recht, oder war er ein Lügner? Ein Betrüger? Trotz seines düsteren Aussehens waren sein Kriegsgurt, das Schwert und der Dolch offenbar von guter Qualität, und wenn der Mann sich bewegte, vernahm der Seiler das Klirren von Münzen.
»Seid Ihr wirklich ein Rattenfänger?«
»Ich war einer«, erwiderte Monksbane.
»Tragt Ihr Euren richtigen Namen?«
Das Lächeln verschwand.
»Seid Ihr hier, um Ratten zu fangen?«
Das Lächeln war wieder da.
»Heutzutage jage ich andere Beute.«
»Und was Ihr über die Ratten gesagt habt?« Der Seiler wollte seinen rätselhaften Gast nicht verärgern.
»Ach ja. Vor Jahren war ich hauptamtlicher Rattenfänger im Stadtteil Farringdon in London.« Er streckte die Hand aus und deutete auf die Narben auf seinem Handgelenk. »Rattenbisse«, prahlte er. »Oh, Wirtin, bringt doch noch zwei frische Krüge! Das geht auf meine Rechnung!«
»Dann hätte ich meine Münze gern zurück«, rief der Seiler.
Die Wirtin drehte sich im Türrahmen um, kam zurück und warf die Münze in die ausgestreckte Hand des Seilers. Neckisch lächelte sie Monksbane zu und watschelte wieder zu dem großen Fass an der gegenüberliegenden Wand.
»Ratten«, wiederholte Monksbane, »vermehren sich wie die Fliegen, besonders die schwarzen. Sie schwärmen überallhin aus.« Er senkte die Stimme und beugte sich über den Tisch. »Wisst Ihr, ich habe Geschichten gehört, wonach sie auf See die Planken fraßen und damit ganze Schiffe versenkten!«
»Und was können sie hier anrichten?«, fragte der Seiler.
»Schlimmeres als die Heuschreckenplage in Ägypten«, erklärte Monksbane. »Sie werden in die Keller eindringen. Sie werden alles fressen! Je mehr sie fressen, desto dreister werden sie, und sie vermehren sich noch stärker.«
»Was ist mit Gift?«, fragte der Seiler.
Monksbane breitete die Arme aus. »Der Himmel weiß warum, aber sie gewöhnen sich daran.«
»Und Katzen?«
Monksbane trank einen Schluck aus dem frischen Becher, den die Wirtin vor ihn hingestellt hatte.
»Ob Ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe drei Ratten eine Katze angreifen sehen. Hunde sind gut, ein Rudel, das auf Ratten losgeht, aber« – er seufzte – »es gibt davon nur sehr wenige in Canterbury.«
»Ist es eine Plage?«, fragte der Seiler.
»Nein, es ist eine Seuche. Noch dazu eine rätselhafte. Seht« – Monksbane beugte sich über den Tisch und fuhr mit leiser Stimme fort –, »ich bin seit dem Fest der Reinigung in Canterbury. Im Auftrag des Erzbischofs, obwohl ich immer auch ein Auge auf die Ratten habe. Ich rieche sie, auch wenn es so stinkt wie hier! Seht Ihr den Tisch da drüben?« Er deutete auf die andere Seite des Raumes. Der Seiler folgte seinem Blick. »Die Wirtin weiß es nicht, aber darunter sind zwei.«
»Ihr sagtet, es sei rätselhaft?«
»Genau.« Monksbane warf sich in die Brust. »Ende Februar ...« Er verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Nichts. Oh, nur die Üblichen. Jetzt schwärmen Ratten in der Mercery, auf dem Marktplatz, selbst auf dem Gelände der Kathedrale aus, als wären sie dem Erdboden entsprungen!«
»Dann beten die guten Brüder also zu Recht?«
»Ja«, antwortete Monksbane, »obwohl man die Ratten durch Gebete nicht los wird. Etwas anderes muss getan werden. Gewiss, wenn die Brüder lange genug kräftig beten, dann enthüllt Gott in seiner grenzenlosen Güte vielleicht die Quelle dieser ›teuflischen Verseuchung‹, wie ich sie nenne.« Monksbane trank seinen Krug leer und erhob sich, schnallte den Kriegsgurt auf und legte ihn sich um die Taille. »Des Teufels Kinder. Sie kommen von Satan; zu Satan können sie zurückkehren! Aber wie, wann?« Er klopfte dem Seiler auf die Schulter. »Das weiß nur der Herrgott im Himmel.«
Monksbane griff nach seinem Mantel und ließ den verängstigten Seiler zurück, der auf die beiden dunklen, unter dem Tisch im Hintergrund lauernden Schatten starrte.
Im Wirtshaus »Falstaff«, am Westtor von Canterbury, fuhr der königliche Spion Robin Goodfellow auf dem Bett hoch und rieb sich das Gesicht. Er vernahm ein lautes Klopfen an der Tür. Dieses Geräusch hatte ihn geweckt. Er fuhr mit der Hand unter das Kissen, zog sein italienisches Stilett hervor, verbarg es hinter dem Rücken, ging zur Tür und entriegelte sie.
»Wer ist da?«, rief er.
»Meister Goodfellow, Euer Abendessen.«
Der Spion drehte den Schlüssel herum. Er zog die Tür einen Spaltbreit auf und betrachtete die junge Dienstmagd. Sie war ganz hübsch, hatte lange, blonde Haare, die beinahe ihr verschmutztes Gesicht verbargen. Ihr gelbbraunes Gewand war am Hals offen, und der ausgefranste Saum reichte ihr bis knapp über die bloßen Füße. Auf dem Tablett standen ein Kelch, ein großer Weinkrug und eine Holzschale mit dampfendem, würzigem Eintopf. Darüber lag eine Weißbrotscheibe. Robin Goodfellow musterte das Mädchen eingehend. Sie lächelte.
»Euer Essen, Herr.«
Goodfellow hielt die Tür auf und winkte das Mädchen herein. Die Magd stellte das Tablett auf den Tisch, nahm den Krug zur Hand und füllte den Kelch. Sie drehte sich um, die Hände aufreizend in die Hüften gestemmt, und tippte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden.
»Hat der Herr noch einen Wunsch?«
»Der Herr hat keinen Wunsch mehr.« Goodfellow wies auf die geöffnete Tür. »Aber wenn, dann sollst du es als Erste erfahren. Sag dem Meister Schankwirt, es sei nett von ihm, dass er mich nicht vergessen hat.«
Das Mädchen stolzierte hinaus. Goodfellow verschloss und verriegelte die Tür hinter ihr, blieb eine Weile stehen und lauschte den sich entfernenden Schritten. Dann trat er ans Fenster, hob den Riegel der Fensterläden, öffnete sie und schaute hinaus. Es muss so gegen sechs Uhr sein, dachte er; es wurde bereits dunkel. Er hatte ein Zimmer zum Hof hinter der Taverne genommen. Goodfellow schloss die Augen und sog genüsslich die Frühlingsluft ein, den herrlichen Duft der Kräutergärten, das Aroma der ersten Blumen. Er warf einen Blick nach links, dann nach rechts. Die Fensterläden der Zimmer zu beiden Seiten waren geschlossen, ebenso wie die Fensterläden im Stockwerk über ihm. Er schaute hinauf, bemerkte, dass die Wände der Taverne, eines sehr alten Gebäudes, leicht rissig waren. Verglaste Fenster wären ihm lieber gewesen.
Goodfellow grinste. Er verweichlichte! Schließlich befand er sich hier nicht in einem prächtigen Herrenhaus in Kent oder in einem Schloss an der Loire. Die Fensterläden waren recht stabil. Die Lederscharniere waren dick, kräftig und sicher, der Holzriegel hart wie Eisen. Dem Spion knurrte der Magen. Er setzte sich auf den Hocker, nahm seinen Hornlöffel aus der Tasche und begann, den Eintopf zu essen. Genüsslich leckte er sich die Lippen. Das Fleisch war frisch und kräftig gewürzt, die dicke Soße war mit Kräutern und kleingeschnittenem Gemüse angereichert. In der Zimmerecke vernahm er ein Geräusch. Rasch nahm er seinen Stiefel und warf ihn in die Richtung. Quieken und hastiges Getrippel waren die einzige Antwort. Der Spion widmete sich wieder seiner Mahlzeit. Die Ratten störten ihn nicht, er hatte schon an schlimmeren Orten gegessen und geschlafen. Er legte den Hornlöffel zur Seite und griff nach dem Weinkelch, roch daran und trank einen Schluck.
»Robin Goodfellow!«, murmelte er und lachte in sich hinein.
Dieser Name gehörte ebenso wenig zu ihm wie zu der Ratte, die ihn gestört hatte. Er aß weiter. Als Padraig Mafiach war er in Clontarf in der Nähe von Dublin geboren. Er war als Bogenschütze in den Dienst des Herzogs von York getreten, wo sich schon bald seine besondere Begabung für Sprachen und Tarnung herausstellte. Jetzt arbeitete er für England und trug wichtige Meldungen für das Haus der Geheimnisse in London bei sich. Der König war unterdessen zu einer Pilgerreise nach Canterbury unterwegs und hielt sich in seinem Palast in Islip nahe der Stadt auf. Padraig sollte am nächsten Morgen Colum Murtagh treffen, den Aufseher der königlichen Stallungen. Dieser sollte ihn mitnehmen, damit er dem König die Botschaft übermitteln konnte.
Mafiach vernahm ein Geräusch auf dem Korridor. Er legte den Löffel nieder und griff nach dem Stilett, doch das Geräusch entfernte sich. Der Spion aß weiter. Er war erschöpft und zerschlagen, seine Nerven zum Zerreißen gespannt. War er hier in Sicherheit? Nur sehr wenige wussten von seiner Ankunft, und er hatte alle Vorsicht walten lassen, damit ihm nichts zustieß. Abermals hörte er ein Geräusch, diesmal im Freien. Padraig legte den Hornlöffel aus der Hand, öffnete seine Tasche, entrollte das schmierige Stück Pergament und betrachtete seine Schrift. Ein Zitat aus dem Propheten Zephanja.
Unseres Vaters großer Tag ist nahe; er ist nahe und eilt sehr ...
Denn dieser Tag ist ein Tag des Zornes,
ein Tag der Trübsal, Verzagtheit und Sorge,
ein Tag des Wetters und Ungestüms,
ein Tag der Finsternis und der Schwärze,
ein Tag der Wolken und Nebel,
an dem vergehen wird die Liebe des weiblichen Geschlechts
und der Kampf der Männer und die Lust dieser Welt.
Mafiach las es sorgfältig, ebenso wie die lateinische Version darunter:
Regis regnum rectissimi prope est dies domini
Dies irae et vindicatae tenebrarum et nebulae
Diesque mirabilium tonitruorum fortium
Dies quoque angustiae meroris ac tristitiae
In quo cessabit mulierum amor ac desiderium
Hominumque contentio mundi huius et cupide.
Niemand außer ihm würde diese Geheimbotschaft oder den Entschlüsselungskode verstehen, den er darunter gekritzelt hatte: »Recto et verso«, von vorn und von hinten, oder »Veritas continet veritatem«, die Wahrheit enthält die Wahrheit.
Padraig lächelte in sich hinein. Sein Blick fiel auf den Satz »Ein Tag des Zorns und der Rache«. Obwohl er es nicht wusste, war dieser Tag sehr nah für Robin Goodfellow, getauft auf den Namen Padraig Mafiach.
EINS
»O weh«, sprach sie, »zu dir, Fortuna, klage ich,
die du mich unversehens in deine Ketten geschlagen hast.«
Chaucer, Die Erzählung des Gutsbesitzers
Die große Empfangshalle im Palast des Erzbischofs von Canterbury war ein düsteres Gemäuer mit Kreuzgewölben über hoch aufragenden Wänden. Selbst die purpurnen Stoffbahnen vor dem Mauerwerk vermochten die Düsternis kaum zu vertreiben. Die Fenster waren bloße Löcher. An jenem Aprilabend am Fest des Heiligen Isidor waren alle Kerzen, Öllampen und Wärmepfannen angezündet worden, um das eisige Dunkel zu vertreiben. Der Boden an den breiten Doppeltüren war mit grünen Binsen bedeckt, die nach frischen Lilien, Frühlingsrosen, Minze und Lavendel dufteten. Am anderen Ende, wo der große Kamin in den Raum hineinragte, hatte man Sarazenerteppiche ausgelegt, welche die Kälte abwehren sollten, die durch die Fliesen drang. An diesem Raum verzweifelte der Kammerherr des Erzbischofs, der große Scheite Kiefernholz hatte anzünden lassen. Das Feuer verbreitete Licht und Wärme und ließ die Schatten tanzen. Selbst die Hühnerhabichte, die wie Wächter auf ihren Holzständern thronten und den Kopf unter kleinen ledernen Hauben mit dem leuchtenden Wappen des Erzbischofs verborgen hatten, spürten die Kälte und bewegten sich unruhig hin und her, so dass die Glocken an ihren Fußriemen bimmelten. Die große Dogge, die ausgestreckt vor dem Kamin lag und die rote Zunge aus dem Maul hängen ließ, veränderte gelegentlich ihre Lage, um die Wärme einzufangen, verhielt sich jedoch ebenso ruhig wie die drei Personen, die am Feuer saßen.
Auf einem Prunkstuhl in der Mitte saß der alternde Bourchier, Erzbischof von Canterbury, Prälat und Politiker. Seine mit weichen Pantoffeln bekleideten Füße ruhten auf einem Schemel aus rotem Satin. Seinem Beichtvater hatte er insgeheim anvertraut, dass er sich jetzt, da er die Achtzig überschritten hatte, auf den Tod vorbereitete. Bourchiers Gesicht war das Alter anzusehen: dunkle Leberflecken, fahle, eingesunkene Wangen und ein schlaffer Mund mit eitrigem Zahnfleisch. Der Kopf war bis auf ein paar Haarsträhnen kahl, nur seine Augen waren hell und scharf wie die eines jungen Mannes. »Ein echter Falke«, lautete der Kommentar eines Kritikers. Bourchiers Verstand war rege, und sein behänder Geist konnte es mit jedem höheren Anwalt in der Advokatenkammer aufnehmen. Nun starrte er mit tränenden Augen ins Feuer. Er spitzte die Ohren, ob er jenes schreckliche Geräusch vernahm, auf das er und seine Gefährten warteten. Seine geäderte Hand war erhoben. Der herrliche Bischofsring, dereinst von Thomas Becket getragen, schimmerte im Licht. Die andere Hand streckte Bourchier ans Feuer. Er trug ein härenes Hemd direkt auf der Haut, das war Strafe genug! Die Kälte war es, die ihm zu schaffen machte, und er hatte sich zwei dicke Houppelanden übergeworfen, über die er noch eine Cotehardie mit rundem, pelzbesetztem Halsausschnitt gestreift hatte. Über den mageren Schultern hing ein mit Hermelin gefütterter Militärmantel.
Zu seiner Linken hockte Luberon, Schreiber der Ratsversammlung von Canterbury, wie eine kleine Taube auf der Stuhlkante. In Luberons rotem, fröhlichem Gesicht leuchteten helle Augen, und die Lippen hatte er affektiert geschürzt. Durch sein langes, graues Gewand mit dem weißen Pelzkragen spürte Luberon die Kälte nicht und betete im Stillen, dass diese Zusammenkunft nicht allzu lange dauern möge, denn der Kamin strahlte eine beträchtliche Hitze aus.
Auf einem Stuhl mit hoher Lehne zur Rechten des Erzbischofs saß Kathryn Swinbrooke und teilte Luberons Unbehagen. Anfangs war das Feuer ganz angenehm gewesen, doch sie trug ein Kleid aus dickem, braunrotem Wollstoff. Der oberste Knopf war bereits geöffnet, und sie hatte den Mantel ausgezogen, der jetzt auf ihrem Schoß lag. Sie zog die Füße, die in schweren Halbstiefeln steckten, unter den Stuhl und versuchte sich zu entspannen. Kathryn Swinbrooke, Apothekerin und Ärztin der Ratsversammlung der Stadt, beschloss, sich von Luberon ablenken zu lassen. Der kleine Mann belustigte sie immer wieder. So gutherzig und großzügig Luberon war, er war auch stolz wie ein Gockel und versuchte hartnäckig zu verbergen, dass sein Augenlicht allmählich nachließ. Nur wenn Kathryn ihn drängte, ließ Luberon sich überreden, die Brille zu tragen, die sie ihm eigens aus London mitgebracht hatte.
Kathryn war eine Stunde zuvor eingetroffen und hatte sich zunächst im Vorzimmer gedulden müssen. Zum wiederholten Mal fragte sie sich nun, warum sowohl die Ratsversammlung als auch der Erzbischof um ihre Anwesenheit gebeten hatten. Zu Hause und im Laden in der Ottemelle Lane wartete eine ganze Reihe von Aufgaben auf sie, derweil Thomasina – erst recht Alice und Wulf – sich Sorgen machen würde, wo sie steckte und was geschehen sein mochte. Sie lehnte sich zurück und zwinkerte Luberon zu. Errötend schaute der Stadtschreiber zur Seite.
Ihr seid schön, dachte er. Die Ärztin war so elegant gekleidet, und der weiße, hochgeschlossene Pelzkragen passte ausgezeichnet zu ihrem olivfarbenen Teint. Die kapuzenförmige Haube versteckte diskret ihr rabenschwarzes Haar, obwohl das leichte Grau an den Schläfen zu sehen war – die Folge der Gewalt, der sie damals durch ihren Gatten ausgesetzt war, dachte der Schreiber. Luberon wurde vor Verlegenheit rot. Alexander Wyville, Kathryn Swinbrookes Mann, war einer der Gründe für diese Zusammenkunft. Bourchier würde darauf zu sprechen kommen, sobald er seinen Standpunkt dargelegt hatte. Wie würde Kathryn es aufnehmen? Luberon warf seiner Freundin einen kurzen Blick zu. Ihr junges Gesicht war ernst, die dunklen, großen Augen ruhig, ihr üppiger Mund lächelte über Bourchiers dramatisches Gebaren. Luberon kannte Kathryn. Trotz der kecken Nase und des Lächelns konnte sie aus der Haut fahren, wenn man sie provozierte. Sie war leidenschaftlich und dachte nicht daran, ihre Zunge im Zaum zu halten. Kathryn bewegte die Finger, befreite sich von den perlenbesetzten Handschuhen aus golddurchwirkter Seide und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie zuckte zusammen, als Bourchier plötzlich ausrief: »Da! Da! Hört Ihr es, Kathryn, Simon?« Er warf Luberon einen Blick zu.
Sie hatten es beide gehört und nickten.
»Ratten!«, rief Bourchier. »Ratten in ganz Canterbury und in meinem Palast!«
Er drehte sich um und musterte wütend die Empfangshalle, als könne er allein mit seinem Blick diese plötzliche Plage exkommunizieren und sowohl aus der Stadt als auch aus der Kirche vertreiben.
»Grabschänder und Menschenfresser!«, verkündete der Erzbischof.
Kathryn fand, dass er übertrieb, hielt jedoch den Mund. Der Erzbischof wies auf Luberon. »Kommt, Simon. Gebt mir Euren Bericht.«
»Wir haben jetzt Anfang April.« Der Schreiber legte die Fingerspitzen aneinander. »Bis zum Ende des Monats wird Canterbury voller Pilger sein, Eure Eminenz. Seine Königliche Hoheit ist bereits in Islip.«
»Ja, ja, das weiß ich.« Mit einer wedelnden Handbewegung trieb Bourchier den Schreiber an, fortzufahren. »Diese Plage? Was ist mit dieser Plage?«
»In Canterbury hat es immer Ratten gegeben«, erklärte Luberon mit sonorer Stimme.
»Das weiß ich!«, versetzte Bourchier spöttisch. »Einige haben zwei Beine!«
Luberon warf dem Erzbischof einen bösen Blick zu. Kathryn biss sich auf die Unterlippe.
»Kommt endlich zur Sache, Simon!«, knurrte der Erzbischof.
»Die Ratten«, fuhr Luberon fort, »tauchten Anfang März auf, etwa um das Fest des Heiligen David von Wales. Zunächst wurde uns die Verseuchung jenseits der Stadtmauern am Stour gemeldet. Dann folgten ähnliche Berichte über Verseuchungen in den Stadtvierteln Westgate und Northgate.« Er hob die Schultern. »Da war es schon zu spät. Sie sind überall. Wie Ihr wisst, Eure Eminenz, führen uralte Abwasserkanäle und Tunnel unter der Stadt hindurch. Die Ratten benutzen sie. Sobald sie auf den Straßen auftauchen« – er streckte die Hände aus –, »haben sie genug Nahrung, Berge von Abfällen, Innereien im Schlachthaus, bei den Geflügelhändlern, der Unrat, der alle Gassen verdreckt. In Vorratslagern richten sie großen Schaden an, besonders beim Weizen – bei allem eigentlich, was in den Kellern gelagert wird. Wenn sie Hunger haben, stürzen sie sich auf alles. Weinhändler und Wirte beklagen sich, dass die Ratten sogar an Holz nagen: Fässer, Tonnen und Bottiche werden zerstört.«
»Ist das möglich?« Bourchier wandte sich an Kathryn.
»Eure Eminenz, ich bin Ärztin, keine Rattenfängerin.«
»Ich weiß, ich weiß, aber ...«
»Ratten fressen alles«, fuhr Kathryn hastig fort. »In der Regel nagen sie nicht an Holz oder Korbgeflecht. Doch wenn das Holz durchweicht ist von Nahrungsmitteln oder Getränken, wie ein Weinfass, ja, dann fressen sie es. Sie sind unersättlich. Sie leben, um zu fressen und sich zu vermehren ...«
»Wie viele Nachfahren Adams«, unterbrach Bourchier sie trocken.
»Ein jedes Paar kann mindestens vier Würfe im Jahr hervorbringen«, erklärte Kathryn. »Wir haben es hier mit einer Verseuchung zu tun, wie die Stadt sie noch nie erlebt hat. Ratten können überall leben und gelangen überallhin. Sie können schwimmen, sie fressen alles. Manche Ärzte behaupten, sie übertrügen bösartige Krankheiten.«
»Warum?«, fragte Bourchier.
Kathryn hatte die Hitze im Raum vergessen. Sie beugte sich vor und zählte die Punkte an den Fingern auf.
»Erstens, dort, wo es Schmutz und Abfall gibt, verbreiten sich Krankheiten und Ratten immer. Wir kennen weder Ursache noch Wirkung. Zweitens, ihr Urin und ihre Fäkalien müssen unrein sein.«
Luberon schluckte und legte die Hand vor den Mund. Ihm war übel.
»Und weiter?«, wollte Bourchier wissen.
»Mein Vater – der Herr schenke ihm die ewige Ruhe, Eure Eminenz – sprach gern mit Besuchern aus Italien, besonders mit Ärzten. Er lernte einige kennen, die behaupteten, dass schon der stinkende Atem von Ratten verunreinigt sei.«
»Worin besteht also die Gefahr für uns?«, wollte Bourchier wissen.
»Sobald der Sommer kommt, tauchen vermehrt Krankheiten auf; das ist bei heißer Witterung immer so. Die Ratten werden das alles noch verschlimmern. Zweitens sind die Nahrungsmittel durch die Ratten in Mitleidenschaft gezogen, obwohl die Ernte des letzten Jahres ertragreich war ...«
»Und was noch?«
Kathryn bedeutete Luberon, mit den Erläuterungen fortzufahren.
»Canterbury, Eure Eminenz, ist das Zentrum für Pilgerreisen im gesamten Königreich. Wenn sich die Meldungen im Ausland verbreiten, wird die Zahl der Pilger zurückgehen. Und die Auswirkungen auf den Handel«, fügte Luberon hinzu, »werden vernichtend sein.«
»Und was empfehlt Ihr?«, fragte Bourchier.
Luberon hatte den Blick gesenkt. Kathryn spielte mit ihren Handschuhen. Die Ratten bereiteten ihr Kummer. Erst in dieser Woche hatte sie drei Kinder behandelt, die gebissen worden waren. Selbst in Kathryns Haus und dem Laden, die stets rein gehalten wurden, tauchten die Tiere auf, von Thomasina »verfluchte Schleicher in der Nacht« genannt. Kathryn hatte mit Colum Murtagh, der bei ihr Unterkunft gefunden hatte, über das Problem gesprochen. Murtagh, der Aufseher der königlichen Stallungen, hatte in den Rosenkriegen gedient und wusste sehr viel über Ratten. Er war überrascht, wie weit die Verseuchung bereits fortgeschritten war.
»Wie konnten so viele Ratten in so kurzer Zeit nach Canterbury gelangen?«, hatte er gefragt.
Thomasinas Antwort lautete, es sei ein Gottesurteil. Kathryn hatte dazu keine Meinung, doch das Thema war in aller Munde, besonders bei anderen Mitgliedern der Apothekergilde, die kostbare Vorräte zu hüten hatten.
»Wir haben Rattenfänger«, unterbrach Luberon das Schweigen. »Und bei der Ratsversammlung ist ein gewisser Malachi Smallbones vorstellig geworden.«
»Wer?«, fragte Bourchier.
»Hauptamtlicher Rattenfänger der Stadt Oxford«, erklärte Luberon. »Er behauptete, im vergangenen Jahr sei dort eine ähnliche Plage aufgetreten. Sowohl die Stadt als auch die Universität hätten seine Dienste in Anspruch genommen. Offenbar war er sehr erfolgreich.«
»Habt Ihr dafür Beweise?«
»Er hat Empfehlungsschreiben vorgelegt, Eure Eminenz.«
»Und wie lautet sein Rat?«
»Die Ratsversammlung möge mit Hilfe der Kathedrale«, Luberon warf dem Erzbischof einen schrägen Blick zu, »Gelder freigeben, um eine veritable Armee von Rattenfängern unter Malachis Kommando einzustellen. Man solle ihm die Genehmigung erteilen, Gift und Pulver zu kaufen, dazu kleine Jagdhunde. Man solle ihm freien Zutritt zu allen Wohnungen gewähren und ihm die Vollmacht ausstellen, nach Belieben überall hinzugehen, um dieses Höllengeschmeiß auszurotten.«
»Das wird sehr kostspielig«, grummelte Bourchier.
»Malachi ist seinen Preis wert«, antwortete Luberon.
»Kathryn, schließt Ihr Euch dieser Meinung an?« Bourchier streckte seine Finger.
»Wenn dieser Malachi so systematisch vorgeht und so erfahren ist, wie er vorgibt«, Kathryn zuckte mit den Schultern, »dann habe ich nichts dagegen. Canterbury ist in Stadtviertel gegliedert. Jeder Bürger sollte sich angesprochen fühlen, und man sollte eine kleine Belohnung« – sie hob die Hand – »auf zwei Dutzend Ratten ausstellen, die zur Strecke gebracht werden. Erlaubt Malachi und seinen Helfershelfern, durch die Straßen zu ziehen und nach Belieben Ratten zu töten. Aber das giftige Gebräu?« Sie warf Luberon einen Blick zu.
»Gift, Bilsenkraut, Tollkirsche, Fingerhut.«
»Er muss vorsichtig sein«, sagte Kathryn. »Haustiere, ganz zu schweigen von Kindern, dürfen solcher Köder nicht habhaft werden. Er sollte auch Besonnenheit walten lassen.«
»Wie das?«, fauchte Luberon.
»Vergiftete Köder können von Menschen gegessen werden«, erklärte Kathryn. »Doch ich besitze ein paar Kenntnisse über Ratten. Wenn sie bestimmte Gifte fressen, werden sie schließlich unempfindlich dagegen.«
»Unmöglich!«, höhnte Luberon.
»Nein, nein. Ich habe bei Männern und Frauen ähnliches erlebt. Pulver und Arzneien, die anderen helfen, zeigen bei ihnen nur wenig Wirkung.«
Der Erzbischof wirkte noch immer misstrauisch.
»Eure Eminenz, ich kann nur berichten, was ich weiß. Es ist wichtig«, Kathryn begeisterte sich für ihr Thema, »dass man Malachi jegliche Hilfe angedeihen lässt. Das Töten der Ratten reicht nicht.« Sie lächelte. »Ihr wisst, was ich sagen will, Simon? Die Stadt muss mehr Straßenkehrer einstellen, der Unrat muss von den Straßen verschwinden, die Abwasserkanäle müssen gereinigt werden. Die Gilden der Metzger und Geflügelhändler müssen mitmachen. Innereien sollten gesammelt und draußen vor der Stadt verbrannt werden. Alle, die Abfälle hinauswerfen oder die Latrinen oder Senkgruben nicht reinigen, müssen mit hohen Strafen belegt werden.«
»Das gefällt Euch, nicht wahr?« Luberon warf Kathryn einen wütenden Blick zu.
»Ihr wisst, warum, Simon. Gäbe die Ratsversammlung mehr Geld für die Beseitigung von Abfällen und die Reinhaltung des Trinkwassers aus ...«
»Das wird so kostspielig«, erklärte Luberon düster. »Vielleicht wenden sich Eure Eminenz an den König und bitten um Stundung der Steuern und Erhebungen? Vielleicht unterstützt der König in seiner grenzenlosen Güte die Stadt Canterbury mit einer Beihilfe ...?« Luberon verstummte.
Grenzenlose Güte!, dachte Kathryn. Edward IV und seine beiden Brüder, George von Clarence und Richard von Gloucester, waren Kriegstreiber. »Wölfisch« nannte Colum sie. Diese Männer hatten mehr Sünden auf ihre Seelen geladen, als Frauen Haare auf dem Kopf haben. Kathryn hatte sie alle kennengelernt: Edward, über sechs Fuß groß, schönes Gesicht, blaue Augen, blondes Haar, das seinen wohlgeformten Kopf wie ein goldener Schein umrahmte. George von Clarence sah ebenso gut aus, bis auf das hämische Grinsen, das seinen gehässigen, ja sogar mörderischen Charakter verriet. Schließlich Richard von Gloucester, ein Zwerg neben seinen Brüdern, mit rötlichem Haar und bleichem, verkniffenem Gesicht. Er war ein Mann, der nie still halten konnte. Richard war die rechte Hand des Königs, und wenn man Colum Glauben schenken wollte, war er ein grausamer Krieger, der beim letzten Sieg seines Bruders bei Tewkesbury eine entscheidende Rolle gespielt hatte.
»Grenzenlose Güte.« Bourchier lächelte Kathryn zu, als könnte er ihre Gedanken lesen. »Ich will sehen, was ich tun kann. Die Mutter des Königs, Herzogin Cecily, hat eine Schwäche für diese Stadt. Dennoch hat es den Anschein«, er seufzte, »als könnte einzig und allein Gold diese Pest heilen. Gold muss also ausgegeben werden, Kathryn?«
»Eure Eminenz, entweder das oder Feuer.«
»Wie das?«
»Feuer.« Kathryn rückte ihren Stuhl weiter vom Kamin ab. »Ein Feuer würde die Nester und die Schleichwege der Ratten ausräuchern.«
»Wir können doch nicht die ganze Stadt abbrennen!«, kreischte Luberon.
»Das will ich damit auch nicht sagen. Trotzdem darf Malachi nicht nur Ratten töten, er muss auch ihre Nester suchen ...«
»Es ist merkwürdig«, überlegte Bourchier laut. »Ist Euch bekannt, Kathryn, dass die Ratten zuerst auf dem Gelände der Kathedrale gesehen wurden?«
»Manche halten es für eine Heimsuchung Gottes«, schaltete Luberon sich ein, »für die Geißel Seines Zorns.«
»Wieso?« Bourchier schaute Luberon wütend an.
»Ganz unter uns, Eminenz. Ich vertraue Euch und Mistress Swinbrooke.«
»Spuckt es aus, Mann!«, knurrte Bourchier.
»Der König« – Luberon schaute sich um, als befürchtete er, dass die Wände Ohren hätten oder die Lauscher des Königs hinter den Wandteppichen lauerten – »der König kommt nach Canterbury«, Luberon wählte seine Worte sorgfältig, »um für seinen großen Sieg zu danken. Dafür, dass Gott ihm die Krone gegeben und seinen Herrschaftsanspruch bestätigt hat.« Luberon hielt inne.
Bourchier spielte an seinem Bischofsring. Er warf Kathryn einen raschen Blick zu und schaute dann in die Flammen. »Ich glaube, Ihr habt genug gesagt«, flüsterte Bourchier.
Kathryn schaute zu Luberon und schüttelte den Kopf als Zeichen, dass der Schreiber nicht weiterreden sollte. Dennoch hatte Luberon nur ausgesprochen, was andere Menschen dachten. Das Haus von York hatte bei Tewkesbury gesiegt, und ein grausames Blutbad war die Folge gewesen. Ihre großen Rivalen, die Kriegsherren des Hauses Lancaster, waren ermordet oder auf barbarische Weise auf Marktplätzen überall im Königreich hingerichtet worden. Hier in Canterbury war Nicholas Faunte, der Bürgermeister, der sich auf die Seite der Lancastrianer geschlagen hatte, eines schrecklichen Todes am Galgen neben dem Kreuz auf dem Marktplatz gestorben. Noch schlimmere Nachrichten waren aus London eingetroffen: Der fromme König des Hauses Lancaster, Heinrich VI, war gefangengenommen und in den dunklen, engen Tower geworfen worden. Edward und seine Brüder hatten heilige Eide geschworen, dass ihm kein Haar gekrümmt werden solle. Doch kaum waren die Anführer des Hauses York in London eingetroffen, war Heinrich plötzlich unter mysteriösen Umständen gestorben. Manche behaupteten, er sei gestürzt; andere, er sei von Anhängern des Hauses York brutal erstochen worden. Seine Leiche hatte man nach Chertsey gebracht, und schon besuchten Pilger sein Grab und berichteten von wundersamen Heilungen. Bourchier selbst war schriftlich ersucht worden, Heinrich VI heiligzusprechen, da er den Tod eines Märtyrers gestorben sei.
»Wenn Gott ein Königshaus zu strafen wünschte«, antwortete Bourchier bedächtig, »hätte er andere, subtilere Methoden, als unsere Stadt zu strafen. Meint Ihr nicht, Kathryn?«
Die Ärztin hielt sich zurück.
»Wie auch immer.« Bourchier rutschte auf seinem Stuhl nach vorn und streckte die Hände zum Feuer. »Kathryn, Mistress Swinbrooke« – er lächelte –, »Ihr werdet diesem Malachi jede nur denkbare Hilfe und Unterstützung gewähren.«
Er hielt inne und schaute zu dem schwarzen, hölzernen Kruzifix auf, das an der Wand über dem Kamin hing.
»Märtyrer und Heilige«, murmelte er. »Wir wollen die Ratten jetzt ihrem Rattenfänger überlassen. Malachi Smallbones hat drei Wochen Zeit, das, worauf er sich so viel einbildet, unter Beweis zu stellen.« Er trommelte mit den Fingern auf seinem Oberschenkel. »Glaubt Ihr an Wunder, Mistress Swinbrooke?«
»Die Wege des Herrn sind unerforschlich.«
Bourchier beugte sich zu Kathryn hinüber und drückte ihre Hand. »An Euch ist ein guter Theologe verlorengegangen, Mistress. Kennt Ihr die Bußbrüder Jesu Christi?«
Luberon zwinkerte ihr rasch zu. Jetzt war es an ihm, Kathryn zu warnen.
»Sie hatten einen Bruder, ein Mitglied ihres Bettelordens«, fuhr Bourchier fort, »einen gewissen Roger Atworth, der die fünfundsiebzig längst überschritten hatte. Er war früher einmal Soldat und wurde dann Kaufmann. Am Ende gab er seinen gesamten Wohlstand auf und trat in den Orden ein. Atworth ging schon bald der Ruf eines frommen, enthaltsamen und in Gebete versunkenen Mannes voraus. Die Menschen wunderten sich über den Wandel, besonders jene, die ihn aus Frankreich kannten, einschließlich Cecily, die Witwe Richards, des Herzogs von York, und Mutter unseres Königs.« Bourchier hielt inne.
Kathryn warf einen Blick auf das kleine Wandbrett unter dem Kruzifix, auf dem eine Reliquie stand. Murtagh hatte einst für Richard von York gekämpft. Der Ire hatte häufig über die Herzogin Cecily gesprochen, eine hochmütige, aber sehr schöne Frau. In ihrer Jugend war sie unter dem Namen »die Rose von Raby« bekannt gewesen.
»Das erklärt«, murmelte Luberon, »warum Herzogin Cecily so oft nach Canterbury kam.«
»Atworth wurde ihr Beichtvater, ja sogar ihr Ratgeber«, sagte Bourchier.
»War er ein Scharlatan?«, fragte Kathryn.
»O nein! Prior Anselm hielt ihn für einen sehr guten, frommen Mann, der trotz seiner strengen Selbstdisziplin Erbarmen für andere hatte. Atworths Leben in der Bruderschaft war enthaltsam. Er trug ein härenes Hemd, fastete und betete. Dennoch musste Prior Anselm einräumen, dass Atworth von seiner Vergangenheit heimgesucht wurde. Schreckliche Taten wurden in Frankreich begangen«, murmelte Bourchier. »Habt Ihr je von den ›Écorcheurs‹ gehört, Kathryn?«
»Wer hat das nicht?«, erwiderte sie. »Homo lupus homini: Der Mensch ist des Menschen Wolf.«
»Ja, das denke ich auch.« Bourchier räusperte sich. »Simon, Kathryn, darf ich Euch etwas Wein anbieten?«
Die beiden schüttelten den Kopf und lächelten sich zu. Ein einziger Weinkelch in Verbindung mit der Hitze vom Kamin hätte sie unweigerlich einschlafen lassen. Bourchier tätschelte sich den Bauch.
»Ich hätte gern ein Glas Wein, doch meine Ärztin hat mir geraten« – schmunzelnd schaute er zu Kathryn hinüber –, »bis nach der Abendandacht zu warten. Ach ja, die ›Écorcheurs‹«, fuhr er fort. »Das waren Söldnertruppen, die unter dem Banner großer englischer Lords kämpften. Sie erhielten den Namen, weil sie die Franzosen angeblich bei lebendigem Leib häuteten. Kein Wunder, dass die Engländer ›Gottverfluchte‹ oder ›Schwanzlose Teufel‹ hießen! Wie auch immer, Atworth gehörte zu ihnen. Doch wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus erkannte er seinen Irrtum und kehrte heim zu Gott. Um es kurz zu machen, Atworth starb am Fest der Verkündigung.«
»Wie alt war er?«, fragte Kathryn.
»Um die achtundsiebzig, beinahe so alt wie ich«, scherzte Bourchier. »Man fand ihn tot in seiner Zelle. Die Tür war von innen verschlossen und verriegelt, so dass sein Diener, der Laienbruder Jonquil, um Hilfe rief. Die Tür wurde aufgebrochen. Atworth lag auf dem Bett, war offenbar im Schlaf gestorben.«
»War er bei guter Gesundheit?«
»Kränklich«, erwiderte Bourchier, »aber von sehr robuster Konstitution.«
Er neigte den Kopf. Kathryn bemerkte, dass der Erzbischof einen Rosenkranz aus Perlmuttperlen aus der Tasche gezogen hatte und sacht durch die Finger gleiten ließ.
»Prior Anselm und Bruder Simon, der Krankenpfleger, sahen die Leiche als Erste. Sie trug keine Anzeichen von Gewaltanwendung, außer« – Bourchier kratzte sich am Kinn – »hier.« Er tippte sich auf die Handgelenke, beugte sich vor und zeigte auf sein Fußgelenk. »Die Stigmata.«
»Wie bitte?«, rief Kathryn.
»Die fünf Wunden Christi«, erklärte Bourchier. »Löcher, groß wie ein Nagel, in seinen Handgelenken und im Rist der Füße direkt unterhalb des Knöchels. Eine ähnliche Wunde klaffte in seiner linken Seite.«
»Unmöglich!«, hauchte Kathryn. »Dieselben Merkmale wie bei der Kreuzigung? Christus wurde an Händen und Füßen ans Kreuz geschlagen, und ein Speer wurde in seine Seite getrieben.«
»Haben die Wunden geblutet?«, fragte Luberon.
»Nein, sie waren nur mit Blut gefüllt. Prior Anselm hat sie als ›heilige Rubine‹ beschrieben, das Blut habe an den Rändern eine Kruste gebildet, sei aber nicht geflossen. Da ist noch mehr. Wie Ihr wisst, hatten die Heiden unserem Retter eine Dornenkrone auf das Haupt gedrückt. Ähnliche Male fand man an Atworths Schädel.«