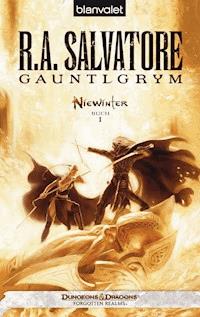9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE HEIMKEHR
- Sprache: Deutsch
Er wählte ein Leben im Licht, doch sein Weg führt zurück in die Dunkelheit.
Ein unsicherer Waffenstillstand hat in das Unterreich Einzug gefunden. Die Dämonenhorden sind zurückgewichen, und jetzt streiten sich die Matriarchinnen der Dunkelelfen über das Schicksal von Drizzt Do'Urden. Währenddessen wird einer Matriarchin nach der anderen klar, dass Menzoberranzan, die Stadt der Spinnen, für immer herrschen wird - mit oder ohne den abtrünnigen Drow. Und so kann Drizzt noch einmal in seine wahre Heimat zurückkehren. Für den einsamen Dunkelelf gibt es nur eine einzige letzte Aufgabe: eine Suche nach Frieden, nach Familie, nach Heimat – nach einer Zukunft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ein unsicherer Waffenstillstand hat in das Unterreich Einzug gehalten. Die Dämonenhorden sind zurückgewichen, und jetzt streiten sich die Matriarchinnen der Dunkelelfen über das Schicksal von Drizzt Do’Urden. Währenddessen wird einer Matriarchin nach der anderen klar, dass Menzoberranzan, die Stadt der Spinnen, für immer herrschen wird – mit oder ohne den abtrünnigen Drow. Und so kann Drizzt noch einmal in seine wahre Heimat zurückkehren. Für den einsamen Dunkelelfen gibt es nur eine einzige letzte Aufgabe: eine Suche nach Frieden, nach Familie, nach Heimat – nach einer Zukunft …
R. A. Salvatore wurde 1959 in Massachusetts geboren, wo er auch heute noch lebt. Bereits sein erster Roman »Der gesprungene Kristall« machte ihn bekannt und legte den Grundstein zu seiner weltweit beliebten Romanserie um den Dunkelelf Drizzt Do’Urden. Die Fans lieben Salvatores Bücher vor allem wegen seiner plastischen Schilderungen von Kampfhandlungen und seiner farbigen Erzählweise.
Die Legende von Drizzt bei Blanvalet:
Menzoberranzan
Die Dunkelelfen · Die Rache der Dunkelelfen · Der Fluch der Dunkelelfen
Das Eiswindtal
Der gesprungene Kristall · Die silbernen Ströme · Der magische Stein
Das Vermächtnis des Dunkelelfen
Das Vermächtnis · Nacht ohne Sterne · Brüder des Dunkels · Die Küste der Schwerter
Pfade der Dunkelheit
Kristall der Finsternis · Schattenzeit · Die Rückkehr der Hoffnung
Die Söldner
Der schwarze Zauber · Der Hexenkönig · Die Drachen der Blutsteinlande
Die Klingen des Jägers
Die Invasion der Orks · Kampf der Kreaturen · Die zwei Schwerter
Übergänge
Der König der Orks · Der Piratenkönig · Der König der Geister
Niewinter
Gauntlgrym · Niewinter · Charons Klaue · Die letzte Grenze
The Sundering – Die Gefährten
Das Buch der Gefährten
Die Nacht des Jägers · Der Aufstieg des Königs · Die Vergeltung des Eisernen Zwerges
Die Heimkehr
Meister der Magie · Meister der Intrige · Meister des Kampfes
Außerdem: Erzählungen vom Dunkelelf
R.A. SALVATORE
MEISTERDES KAMPFES
Die Heimkehr
III
Roman
Aus dem Englischen von Imke Brodersen
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Hero (Legend of Drizzt 30, Homecoming 3)« bei Wizards of the Coast, Renton, USA. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2017 by Wizards of the Coast LLC 2014 FORGOTTEN REALMS, NEVERWINTER, DUNGEONS & DRAGONS, D&D, WIZARDS OF THE COAST and their respective logos are trademarks of Wizards of the Coast LLC in the U.S.A. and other countries. © 2019 Wizards of the Coast LLC. Licensed by Hasbro. Published in the Federal Republic of Germany by Blanvalet Verlag, München Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Alexander Groß Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft nach einer Originalvorlage von Wizards of the Coast LLC Umschlagillustration: Aleksi Briclot HK · Herstellung: sam Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23683-0V001 www.blanvalet.de
Prolog
»Vor allem Banditen, um ehrlich zu sein«, sagte Regis zu Wulfgar.
Die beiden ruhten auf der Ladefläche eines Wagens, der an dem Spätfrühlingstag im Jahr 1486 der Zeitrechnung der Täler, dem Jahr der Schriftrollen aus den Nesserbergen, von Dolchfurt aus die Handelsstraße entlang nach Südosten rumpelte. »Man möchte meinen, es wären mehr Monster hier unterwegs. Schließlich ist das Land so spärlich besiedelt. Aber Ärger gab es zumeist mit Menschen.« Der Halbling seufzte.
Wulfgar nickte neben ihm und blickte über seinen Arm hinweg, der bequem auf der Holzbrüstung des Wagens ruhte, auf die Hügel im Norden. Irgendwo dort oben marschierten vermutlich seine Freunde an der Spitze einer gewaltigen Zwergenarmee ostwärts in Richtung Schwertküste. Erst später würden sie nach Süden abbiegen und auf die alte Zwergenheimat Gauntlgrym zuhalten.
Wulfgar wusste, dass Bruenor Gauntlgrym zurückerobern würde. Mit Drizzt und Catti-brie an seiner Seite würde der entschlossene Zwerg nicht lockerlassen. Bestimmt würden sie gefährliche Gegner vorfinden, und ebenso sicher würden sie sich ihren Weg bahnen. Auch ohne ihn.
Dieser Gedanke beschäftigte ihn, und was Wulfgar am meisten verwunderte, wenn er an die Gefahren dachte, die seinen Freunden bevorstanden, war, dass er keinerlei Schuldgefühle empfand, weil er nicht bei ihnen war.
Er wollte noch so viel von der Welt entdecken!
Schließlich war er nicht ins Leben zurückgekehrt, um lediglich die Ereignisse seiner ersten Existenz nachzuspielen. Aus diesem Grund war er von Mithril-Halle aus zuerst nach Silbrigmond gezogen und dann nach Tiefwasser, wo er mit Regis’ und dem ungewöhnlichen Mönch Afafrenfere den Winter verbracht hatte. Nun fuhren sie über die Handelsstraße in die Hafenstadt Suzail am westlichsten Ausläufer der See des Sternenregens, wo sie sich nach Aglarond zur Stadt Delthuntle einschiffen konnten. Dort lebte Regis geliebte Donnola Topolino, die das bekannte Haus Topolino führte, welches in alle krummen Geschäfte der Stadt verstrickt war.
»Oh, Monster gibt es hier reichlich, keine Sorge«, rief der alte Fahrer zurück. »Wenn es bloß um Menschen ginge, hätte ich euch nicht so gut für euren Schutz bezahlt.«
»Bezahlt?«, wiederholte Wulfgar schmunzelnd. Ihre einzige Bezahlung bestand darin, dass sie hier auf dem Wagen saßen.
»Ja, aber die Menschen finde ich unterwegs am schlimmsten. Ihr nicht?«, sagte Regis zu dem Mann. »Zumindest zwischen Dolchfurt und der Boareskyr-Brücke.«
Mit skeptischer Miene sah der Fahrer sich zu ihnen um. Er sollte sich dringend mal wieder rasieren, dachte Wulfgar angesichts der grauen Stoppeln, die aus den zahlreichen Warzen auf seinem Gesicht stakten. Der Mann machte den Eindruck, als hätte er seinen grauen Bart – und seine Haare insgesamt – ewig nicht gepflegt. Die längsten Haare in seinem breiten, rundlichen Gesicht waren jedoch diejenigen, die aus seinen großen Nasenlöchern lugten.
»Pah! Bist du etwa der Herold der Handelsstraße?«, sagte der Fahrer zu dem sorgfältig frisierten, höchst eleganten Halbling. Tatsächlich war Regis mit seinem ausladenden blauen Barett, dem schwarzen Reisemantel mit dem steifen Kragen und seinen feinen Kleidern modisch auf dem neuesten Stand. Zudem war an seiner linken Hüfte der prächtige Knauf seines schmalen Degens erkennbar.
»Früher gehörte ich zu den Ponys«, antwortete Regis mit einigem Stolz.
Wulfgar wartete geradezu darauf, dass sein kleiner Freund sich zufrieden den Schnurrbart zwirbelte.
»Den Ponys?«, wiederholte der Kutscher, dessen Stimme jetzt einen anderen Klang annahm und tiefer wurde, als er Regis genauer ins Auge fasste. Wenn er sich diese Mühe bereits in Dolchfurt gemacht hätte, wäre ihm gewiss längst klar gewesen, was für ein Mann der kultivierte Halbling war. Sein sauber gestutztes Bärtchen, die langen braunen Locken und die hochwertige Kleidung zeigten überdeutlich, dass Regis ein erfahrener, bedeutender Abenteurer war. Und den Drei-Klingen-Dolch an seiner rechten Hüfte, den fabelhaften Degen links und die Handarmbrust gleich unter den Falten seines feinen Mantels trug der Halbling offenkundig nicht aus Angeberei, sondern weil er damit bestens umzugehen wusste.
Wulfgar beobachtete erst den Fahrer und dann Regis, der sich mit ihrem Begleiter ein Blickduell lieferte.
»Ja, die Grinsenden Ponys«, betonte Regis. »Vielleicht hast du von ihnen gehört.«
Der Fahrer drehte sich wieder um, was Wulfgar ziemlich unhöflich fand. »Stimmt, die sind hier irgendwo«, sagte er ohne einen weiteren Blick nach hinten. »Auch wenn man mehr von ihnen hört als sieht. Aber, ja, die Kleinen sind hier irgendwo.« Worauf er so leise vor sich hin murmelte, dass Wulfgar es kaum hören konnte: »Machen mehr Ärger, als sie verhindern, so viel steht fest.«
Wulfgar warf Regis einen fragenden Blick zu, doch der bedeutete ihm wortlos, nichts weiter zu sagen.
»Stimmt«, sagte Regis zu dem Fahrer. »Sie sagen, sie ›grinsen‹, aber ich sag immer bei mir, sie giggeln! Die giggelnden Ponys! Prächtige Reiter, ja, aber keine großen Kämpfer. Deshalb bin ich nicht mehr dabei. Sie wollten unbedingt die großen Helden sein, aber verdient hatten sie diesen Titel nie, und sie haben jeden Kerl getötet, der es ihnen leicht machte.«
Der Fahrer knurrte etwas Unverständliches.
Regis zwinkerte Wulfgar zu. »Männer, die so etwas nicht verdient hatten«, fuhr der Halbling mit dramatischer Geste fort. »Männer, die bloß ihre Familien ernähren wollten, weiter nichts.«
Bei diesen Worten verzog Wulfgar das Gesicht, denn er hatte Regis immer in den höchsten Tönen von den Grinsenden Ponys schwärmen hören. Dann jedoch wunderte er sich noch mehr, denn inzwischen hatte sein Halbling-Freund den Dialekt der Landbevölkerung dieser Gegend angeschlagen, den Wulfgar von Regis noch nie gehört hatte.
»Bandit«, hauchte Regis Wulfgar tonlos zu und deutete dabei auf den Fahrer, der sie als Eskorte mitgenommen hatte.
»Ein räuberischer Haufen, allerdings, aber alles ganz legal, und so drohen die hohen Damen und Herren jedem, der sich nimmt, was er braucht, und die Seinen versorgen will, mit dem Tod«, grollte der Fahrer.
»Der sich mit dem Schwert nimmt, was er braucht. Was mit dem Schwert beantwortet wird«, sagte Wulfgar.
»Pah!«, schnaubte der Fahrer. »Ach, ob Schwert oder Hammer, wenn diese Banditen über andere herfallen, was soll’s? Hauptsache, ihr wisst, wer euch bezahlt!«
Keiner der beiden ging davon aus, dass der Fahrer seine Worte so meinte, wie er sie sagte, oder dass er Angst hatte, dass sie bald überfallen werden könnten.
Der Halbling und der Barbar nickten sich vielsagend zu. Offenbar waren sie von einem Banditen angeheuert worden, der sie mitten ins Hornissennest seiner Bande brachte. Was nicht mehr lange dauern würde, wie sie glaubten. Sie befanden sich bereits ein ganzes Stück außerhalb des Bereichs um Dolchfurt, wo regelmäßig Patrouillen unterwegs waren.
Wulfgar deutete auf den Weg vor ihnen, und Regis nickte.
»Wie lange fahren wir heute?«, erkundigte sich der Halbling.
»Bis Sonnenuntergang. Ich will in einem Zehntag an der Boareskyr-Brücke sein, und das bedeutet mindestens fünfundzwanzig Meilen pro Tag.«
Regis sah Wulfgar an und schüttelte den Kopf. Mit diesem Fahrer würden sie garantiert nicht einmal in die Nähe der Brücke gelangen.
»Das heißt, dass wir die halbe Nacht Wache halten. Da schlafe ich lieber jetzt eine Runde«, kündigte Regis an. Er schob ein paar Kisten zurecht und holte eine dicke Decke aus seinem magischen Beutel.
»Klar. Der Weg ist schließlich frei«, sagte der Fahrer, ohne sich umzusehen. »Ihr könnt ruhig beide ein Nickerchen halten.«
»Afafrenfere?«, flüsterte Regis.
Wulfgar zuckte mit den Schultern. Der Mönch war in Dolchfurt zurückgeblieben, um einem Hinweis auf seinen früheren Begleiter Effron nachzugehen, hatte aber zugesagt, ihnen zu folgen. Sie würden ihn vermutlich bald brauchen. Afafrenfere war ein guter Kämpfer, und der Überfall würde schon bald stattfinden.
Während Wulfgar einen Sack Äpfel unter die Decke zwischen zwei Kisten schob, schlüpfte Regis hinten vom Wagen und tauchte so rasch im hohen Gras unter, dass Wulfgar ihn schon nach wenigen Schritten aus den Augen verlor.
Etwas später begann Wulfgar, demonstrativ zu gähnen, lehnte sich zurück und verdeckte so einen Großteil des Schlafplatzes des Halblings.
»Gut, aber wenn sich irgendwo Ärger abzeichnet, schreist du sofort los«, wies er den Fahrer an. »Mein kleiner Freund hier schnarcht verdammt laut.«
»Die Kleinsten sind immer die Lautesten«, erklärte der Mann grinsend, der bald darauf auffällig zu pfeifen begann.
Und Wulfgar fing an zu schnarchen.
Schon bald stellte der Barbar fest, dass Regis richtiggelegen hatte, denn der Wagen wurde langsamer und bog ruckelnd vom Weg ab. Wulfgar blinzelte leicht und bemerkte, dass sie auf ein Wäldchen zuhielten.
Er hörte, wie andere näher kamen und der Fahrer plötzlich vom Bock kletterte.
Als Wulfgar hochfuhr, war er von drei Banditen umzingelt, von denen der mittlere ein gut gearbeitetes Schwert in der Hand hielt. Rechts von ihm stand eine Frau mit einem kurzen, dicken Speer, auf der linken Seite ein weiterer Mann mit dickem Bauch und einer so schweren Axt, dass Wulfgar sich fragte, wie er sie mit seinen schlaffen Armen überhaupt halten konnte, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren. Der Fahrer hatte sich seitlich neben den Wagen geduckt. Von oben starrte ein Bogenschütze auf Wulfgar herab, und ein zweiter lauerte mit gespanntem Bogen hinter einer Bretterwand, die durch Blattwerk getarnt zwischen zwei Eichen stand.
»Immer langsam, alter Freund«, sagte der Mann mit dem Schwert. Er war groß und schlank und hatte lange blonde Locken. »Kein Grund zur Aufregung. Ihr sitzt in der Falle, das wisst ihr. Deshalb haben wir keinen Grund, hier euer Blut zu vergießen.«
»Auch wenn uns das Spaß machen würde«, meinte die Frau neben ihm, deren Speer auf Wulfgar gerichtet war.
»In der Falle?«, wiederholte Wulfgar, als hätte er keine Ahnung, was sie meinten. Er drehte den Kopf nach rechts und warf einen Blick nach unten. »Fahrer?«
Der Mann wimmerte nur.
»Bleib du, wo du bist, und Kopf runter! Sonst bekommst du mein Schwert zu spüren«, fuhr ihn der mutmaßliche Anführer an.
Wulfgar wusste es besser.
»Dein Beutel«, verlangte der Anführer und streckte die freie Hand aus.
»Ihr wollt mir die letzten Kupferstücke nehmen?«, fragte Wulfgar.
»Genau. Und den hübschen Hammer auch«, sagte der Mann mit der Axt. Er war der dreckigste Kerl, den Wulfgar je gesehen hatte. Er war nicht so groß wie der Anführer, aber ein ganzes Stück schwerer, und als er mit seiner Axt auf Aegisfang wies, staunte Wulfgar über die Schwerfälligkeit seiner Bewegung. Von den dreien, die hier vor ihm standen, schien nur der Schwertkämpfer seine Waffe einigermaßen zu beherrschen.
Und der Bogenschütze über ihm stützte sich so weit vorgebeugt an einen Ast, dass er unmöglich rasch zur einen oder anderen Seite neu zielen konnte.
Wulfgar griff an seinen Gürtel, löste die Schnalle seines kleinen Beutels und warf ihn dem Mann mit dem Schwert zu.
»Und den Streithammer«, forderte dieser.
Wulfgar betrachtete Aegisfang. »Den hat mein Vater für mich gemacht«, antwortete er.
Der Mann mit der Axt kicherte höhnisch.
»Dann macht er dir vielleicht noch einen«, meinte der Anführer. »Wir sind schließlich keine Mörder.«
»Wenn es sich vermeiden lässt«, fügte die Frau hinzu und rollte den Speer zwischen den Fingern.
Mit bedauernder Miene sah Wulfgar erneut Aegisfang an.
»Wird’s bald?«, rief der Anführer in dem Versuch, ihn zu erschrecken, damit er den Hammer übergab, ohne es sich anders zu überlegen. Also gehorchte Wulfgar und warf ihm den Hammer vor die Füße.
Der Kerl mit der Axt war sofort zur Stelle, ließ bereitwillig seine eigene Waffe fallen und hob den fantastisch ausbalancierten Aegisfang auf.
»Gute Entscheidung«, lobte der Schwertkämpfer.
Wulfgar zuckte mit den Schultern.
»Stimmt, aber töten müssen wir ihn trotzdem, oder?«, fragte die Frau.
»Nein. Fesselt ihn und lasst ihn hier«, entschied der Anführer.
Der Mann mit Aegisfang war einen Schritt zur Seite getreten, zum Fahrer hinüber, und schwang jetzt probehalber einige Male die neue Waffe. Wulfgar registrierte, dass der Fahrer zu dem Banditen hochblinzelte, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Dabei flüsterte er etwas wie: »… sein kleiner Freund.«
»Und deinen schönen Hut bitte auch«, sagte der Mann mit dem Schwert höflich.
Wulfgar wandte sich nach links, wo das modische blaue Barett des Halblings auf der Decke zwischen den Kisten ruhte.
»Das ist nicht mein Hut.«
»Wessen dann …?«, begann der Anführer, doch da rief der Mann mit Aegisfang: »Passt auf! Da drunter versteckt sich sein Freund, die kleine Ratte!«
Die Frau riss erschrocken die Augen auf und stieß prompt mit dem Speer zu.
»Nein!«, schrie der Anführer, doch es war zu spät.
Neben ihr fiel ein Pfeil zu Boden, und als Wulfgar dem Stoß auswich und den Speer dicht unter der Spitze packte, gelang ihm ein Blick in den Baum, wo der Schütze jetzt schlaff über dem Ast hing, ein Arm und ein Bein auf jeder Seite.
Während Wulfgar den Speer auch mit der zweiten Hand umfasste und mit einem Ruck an der Seite der Frau entlang zurückschob, dankte er im Stillen seinem Freund. Dann warf er den Speer mitsamt der Frau mit erschreckender Kraft kurzerhand in die Höhe. Die Frau fiel gegen den Schwertkämpfer und stieß ihn um.
Wulfgar vollführte einen Überschlag nach hinten, setzte beide Hände auf, stieß sich ab und landete rechts vom Wagen unmittelbar neben dem kauernden Fahrer, dem er ins Gesicht trat. Der Mann brach zusammen.
Da kam der Räuber mit Aegisfang auf Wulfgar zu.
»Was sollte das denn?«, schrie der Anführer die Frau an, während er sich wieder aufrappelte. Beide wollten ihrem Kumpan zur Seite springen, aber noch ehe sie einen Schritt machen konnten, hielt eine Stimme von hinten sie zurück.
»Keine gute Idee!«
Die zwei fuhren herum und wollten Verteidigungshaltung annehmen, doch Regis griff sofort an. Er bohrte der Frau seinen Degen mitten durch die Handfläche, während diese noch den Speer vor ihre Brust schwingen wollte. Mit einem Aufschrei ließ sie mit der getroffenen Hand los und wich zurück. Der Speer baumelte nach unten.
Gleichzeitig nutzte der Anführer diesen Moment, um selbst zuzuschlagen. Aber Regis fing den Angriff mit seinem Dolch ab und schob die Klinge weit zur Seite. Der Bandit löste sich geschickt aus dieser Position und drehte sich einmal um sich selbst, um unmittelbar vor seinem kleinen Gegner zu landen. Diesmal streckte ihm der Halbling seinen Dolch entgegen. Allerdings war jetzt nur noch eine der beiden schlangenförmigen Seitenklingen zu sehen.
»Ich fürchte, du hast mein schönes Messer kaputt gemacht«, stellte der Halbling fest.
Sein Gegner lächelte – aber nur bis der Halbling ihm die abgebrochene »Klinge« entgegenwarf. Das Metallstück traf ihn am erhobenen Unterarm, ohne ihn zu verletzen, verwandelte sich dort jedoch augenblicklich in eine kleine, lebendige Schlange. Noch ehe der überraschte Räuber reagieren konnte, schlängelte sich das Tier unglaublich schnell seinen Arm hinauf, wand sich um seinen Hals und zog die Schlinge zu. Mit der freien Hand griff sich der Mann an die Kehle, hielt aber weiter sein Schwert erhoben, um den Halbling auf Abstand zu halten.
Doch hier ging es nicht nur um eine kleine Zauberschlange. Es war eine Garrotte, die hinter ihrem Opfer ein grauenvolles Schreckgespenst beschwor, ein untotes Wesen, das mit derartiger Gewalt an der Schlinge zog, dass der Kämpfer nach hinten gerissen wurde und ungebremst zu Boden fiel.
Wo er verzweifelt gegen das Ersticken kämpfte. Er ließ sein Schwert los, um vergeblich mit beiden Händen an der Schlange zu zerren.
Da brüllte der kleinere, dicke Mann auf, hob seinen schönen neuen Hammer mit beiden Händen über den Kopf und rannte auf den unbewaffneten Wulfgar zu, um dem Dummkopf mit einem einzigen mächtigen Hieb den Schädel zu spalten.
Erst nach einigen Schritten wurde ihm bewusst, dass er keinen Hammer mehr hielt, und nachdem er abrupt abgebremst hatte, stellte er fest, dass inzwischen der Barbar die Waffe in der Hand hatte.
Zu diesem Zeitpunkt stand der behäbige Räuber allerdings bereits unmittelbar vor dem breitschultrigen, bewaffneten Wulfgar.
»Häh?«, sagte er noch verdutzt.
Wulfgar stieß ihm den Kopf von Aegisfang in sein breites Gesicht, schlug ihm damit die Zähne und die Nase ein und brachte ihn endgültig zum Stehen. Der dicke Räuber taumelte ungläubig einen Schritt zurück. Wie konnte der Streithammer ihm einfach so abhandengekommen sein? Aus mehreren Schritten Entfernung?
Er konnte nicht ahnen, welche Verbindung zwischen Aegisfang und Wulfgar, Sohn des Beornegar und Sohn von Bruenor, bestand und dass ein geflüstertes »Tempus« den Hammer auf magische Weise wieder in Wulfgars Hand zurückteleportierte.
Der Bandit wankte. Er schüttelte den Kopf. Dann brach er vornüber zusammen.
Wulfgar konnte nicht lange dabei zusehen, denn ein Sirren von dem Verschlag her warnte ihn vor der Gefahr. Er warf sich nach hinten, drehte den Kopf und schlug die Arme vor Gesicht und Brust. Zum Glück! Als er sich auf dem Boden abrollte, ragte ein Pfeil aus seinem kräftigen Unterarm.
Doch Wulfgar achtete nicht darauf, sondern kam wieder hoch, drehte sich halb zurück und warf mit derselben Bewegung Aegisfang nach dem versteckten Schützen.
Der Hammer durchdrang die Deckung und schlug dabei die Bretter in tausend Splitter. Wulfgar hörte einen Aufschrei. Es war eine weibliche Stimme, und die Schützin flog rückwärts aus dem Schutz ihres Hinterhalts.
»Tempus!«, brüllte Wulfgar, obwohl er nicht davon überzeugt war, dass dieser Name ihm noch viel bedeutete.
Dennoch landete der Hammer wieder in seiner Hand, sodass sein Schlachtruf wohl passte.
Die Frau langte wieder nach ihrem Speer, obwohl sie dabei vor Schmerz zusammenzuckte. Sie stieß die Waffe nach vorn, um den Halbling zumindest auf Abstand zu halten, doch selbst dafür war Regis viel zu schnell.
Perfekt ausbalanciert, verließ er sich beim Zurückweichen ganz auf den quer gestellten hinteren Fuß, ehe er wieder vorstürmte. Als die Frau ihren Fehler erkannte, versuchte sie, noch einmal zuzustechen, aber Regis war schon an ihrem Zielpunkt vorbei und fegte den Speer beiseite, indem er seinen Degen erst abwärts und dann seitwärts führte.
Im nächsten Moment flitzte er an der Frau vorbei und stach ihr zweimal zwischen die Schultern.
Danach sprang Regis auf den Mann zu, der noch immer von der geisterhaften Erscheinung gewürgt wurde.
Ein schneller Stich seines wunderbaren Degens beendete das Drama – ein einfacher Schlag auf die Erscheinung ließ diese verpuffen. Der Mann blieb keuchend liegen.
»Bleib, wo du bist«, warnte ihn Regis, eilte wieder zurück und drehte seinen Degen mehrfach um die Speerspitze der Frau. Als sich ihre Augen schließlich mitdrehten, weil sie versuchte, seine Bewegungen im Blick zu behalten, kehrte Regis die Bewegung um, zog den Degen nach unten und vor seinen Körper und nahm dabei den Speer mit, als er auswärts nach vorne trat.
Jetzt kam sein Dolch erneut zum Einsatz und fing den Speer ab. Regis hob die Waffe in die Höhe, stapfte unter ihrer Spitze vor und hielt der Frau seinen Degen unters Kinn.
»Meine Liebe, ich möchte dir nicht das Leben nehmen«, sagte er großzügig. »Also lass bitte den hässlichen Speer fallen.«
Mit dem Kopf im Nacken und ohne Fluchtmöglichkeit blinzelte die Frau zu ihm herunter, schluckte einmal und ließ tatsächlich den Speer los.
Regis warf ihn mit einem Ruck seines Dolches ein ganzes Stück zur Seite und wandte sich dann an den Schwertkämpfer, der störrisch aufzustehen versuchte. »Ich weiß genau, dass ich gesagt habe, du sollst da liegen bleiben«, warnte er.
Der Mann zögerte, wollte aber dennoch hochkommen.
»Ich habe noch eine …«, begann Regis, doch dann warf er nur seufzend die zweite magische Schlange seines Dolches auf den Mann.
Diesmal sah er sich das Drama nicht an. Das war nicht nötig.
Stattdessen wandte er sich wieder der Frau am Ende seines Degens zu, deren Augen ihm genug verrieten. Er hörte das verzweifelte Japsen des Anführers, als hinter der neuen Garrotte ein weiteres Schreckgespenst auftauchte und ihn zu würgen begann.
Erst als der Mann bewusstlos war, ging Regis gelassen hinüber, stach nach dem Untoten und brach damit die tödliche Magie.
Er seufzte abgrundtief. »Manchmal sind sie derart stur!«, beklagte er sich bei Wulfgar, wurde jedoch abrupt unterbrochen, als über ihnen der Ast brach. Der Schütze, der nach wie vor dem Schlafgift ausgeliefert war, das der vergiftete Bolzen aus Regis’ Armbrust ihm eingeflößt hatte, stürzte unsanft zwischen den Barbaren und die Frau.
Kopfschüttelnd blickte Regis von dem stöhnenden Mann, der sich ein paar Knochen gebrochen hatte, zu Wulfgar.
Der Barbar deutete auf Regis’ magischen Beutel, in dem der Halbling seine Tränke, Salben und Verbände aufbewahrte. Wulfgar hob seinen Hammer auf eine Schulter und trat leicht gegen den Mann, der vor ihm lag. »Wenn ihr aufsteht«, warnte er den behäbigen Banditen und schloss den Fahrer in die Warnung mit ein, »schlage ich euch die Köpfe ein.«
Um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, knallte er seinen Hammer unmittelbar vor dem Gesicht des liegenden Banditen auf den Boden.
»Bleibt genau, wo ihr seid«, brummte Wulfgar. Dann hielt er mit langen Schritten auf den Verschlag zu, durchbrach die verbliebene Sperre zwischen den Eichen und verschwand im Gebüsch, um den zweiten Schützen aufzuspüren. Kurz darauf kehrte er mit einer Frau über der Schulter zurück, die bei jedem seiner Schritte vor Schmerzen stöhnte. Einer ihrer Arme war zerschmettert und hing schlaff herunter. Ihr Atem ging stoßweise. Der Hammer hatte den Arm und einige Rippen durchschlagen und einen Lungenflügel zusammenfallen lassen.
Ohne Magie würde sie bald sterben. Zum Glück für beide Schützen waren Wulfgar und Regis jedoch mit ausreichend Magie ausgestattet. Noch während Wulfgar zum Wagen ging, um die Verletzte darauf abzulegen, baute Regis sein tragbares Alchemistenlabor auf und ließ die besiegte Speerwerferin von einem zum anderen gehen, um ihnen Heiltränke einzuflößen.
»Diese Salben und Tränke sind ein teurer Spaß«, knurrte Regis an Wulfgar gewandt. Er griff nach einem Fläschchen, doch als er sah, wie schwer die Frau verwundet war, wählte er zunächst einen Tiegel Salbe.
»Muss man denn alles mit Gold aufwiegen?«, erwiderte Wulfgar.
Lächelnd begann Regis, die heilende Salbe aufzutragen.
Es raschelte, und als sie sich umdrehten, sahen sie die zweite Frau, die Regis gefangen genommen hatte, durch das Unterholz davonlaufen.
Der Halbling blickte zu Wulfgar auf. »Glaubst du, sie hat noch mehr Freunde?«
Wulfgar betrachtete den abgerissenen Haufen um sie herum. Das waren Bauern oder einfache Handwerker, bettelarm und verzweifelt.
»Soll ich ihr nach, damit wir sie alle zusammen aufknüpfen können?«, fragte er.
Regis’ entsetzte Miene entspannte sich erst, nachdem ihm klar geworden war, dass sein Freund scherzte. Dennoch hatte Wulfgar mit seiner Bemerkung eine offene Frage angeschnitten. Was sollten sie mit der Gruppe anstellen? Sie hatten nicht vor, sie hinzurichten, denn dies waren keineswegs hartgesottene Diebe und Mörder.
Andererseits konnten sie die Bande auch nicht frei herumlaufen lassen, wo sie bald weiteres Unheil anrichten würde. Wie mochte es den nächsten unbedarften Reisenden ergehen, die auf der Ladefläche des verräterischen Fahrers mitfuhren?
»Auf der Handelsstraße wird kurzer Prozess gemacht«, stellte Regis fest.
»Würden die Ponys sie hinrichten?«
»Nur wenn sie nachweislich jemanden getötet hätten.«
»Und was gibt es sonst für Möglichkeiten?«, fragte Wulfgar. Da kam der Mann, den Regis’ Garrotte gewürgt hatte, wieder zu sich. Hustend und keuchend versuchte er, sich aufzusetzen. Wulfgar ging zu ihm und half ihm, indem er ihn mit einem Arm vorn an der Tunika packte und auf die Füße stellte.
»Diebe müssen in der Regel für Kaufleute oder Meister arbeiten«, erklärte Regis. »So lange, bis sie den Schaden abgearbeitet haben, den sie verursacht haben. Oder ihre Schulden.«
»Ich … Wir … wir … wir hätten euch töten können«, stammelte der Anführer der Bande.
»Nein, hättet ihr nicht«, erwiderte Wulfgar, während er den Mann zum Wagen führte. »Aber du wolltest es auch nicht, als du dachtest, ich wäre euch ausgeliefert. Das ist der einzige Grund, warum ihr noch am Leben seid.«
»Und was habt ihr jetzt mit uns vor?«, fragte der Mann.
»Wir wollten auf einem Wagen zur Boareskyr-Brücke«, teilte Wulfgar ihm mit. »Und genau dorthin bringt ihr uns jetzt. Alle zusammen.« Er stieß den Mann von sich. »Geh und such die Frau, die mich angegriffen hat«, wies Wulfgar ihn an und nickte zu den Büschen hinüber, in denen die Frau verschwunden war. »Hol sie zurück. Wenn ihr zusammen wiederkommt, begleitet ihr uns zur Brücke. Ansonsten sind deine vier Freunde hier tot, und wir ziehen mit dem Wagen alleine los. Und wenn du nicht sehr bald zurückkehrst, bist du bei unserer nächsten Begegnung ein toter Mann.«
»Glaubst du, der kommt zurück?«, fragte Regis, als der Mann im Wald verschwand.
»Wollen wir wetten?«
Der Halbling grinste.
Als die Sonne bald danach im Westen zu sinken begann, rollte der Wagen wieder die Handelsstraße in Richtung Brücke entlang. Wulfgar saß neben dem verletzten, erschütterten Fahrer auf dem Bock. Regis hockte direkt hinter ihnen, um die beiden Schützen im Auge zu behalten, die es unter den Banditen am schlimmsten erwischt hatte.
Der vierschrötige Mann, der dumm genug gewesen war, Wulfgar mit seinem eigenen Hammer anzugreifen, saß im hinteren Teil des Wagens und ließ die Füße über den Rand baumeln.
Kaum waren sie aufgebrochen, da tauchten hinter ihnen die beiden übrigen Räuber auf und rannten ihnen nach. Allerdings nicht ganz freiwillig, denn sie wurden von einer Gestalt in einer Mönchsrobe gescheucht, die den beiden bekannt vorkam.
»Na gut, ein Goldstück für Wulfgar«, knurrte Regis.
Aber er war froh, dass sein Freund recht behalten hatte, und noch froher, dass Bruder Afafrenfere endlich aufgetaucht war.
»Aber schon der Versuch wäre blöd, oder?«, meinte Adelard Arras aus Tiefwasser, der Schwertkämpfer, am nächsten Morgen nach dem erneuten Aufbruch zu Wulfgar.
»Ja«, bestätigte Wulfgar.
»Und weil ich das weiß, versuche ich es gar nicht erst!«
Wulfgar sah ihn skeptisch an.
»So dumm bin ich nicht!«, protestierte Adelard.
»Aber du bist ein Wegelagerer. Und nicht gerade der beste.«
Adelard schüttelte seufzend den Kopf. »Die Straße ist gefährlich, mein Freund.«
»Freund? Da täuschst du dich aber«, warnte Wulfgar.
»Du hast mich nicht umgebracht. Und meine Begleiter auch nicht«, erwiderte Adelard. »Dabei bist du ein mächtiger Krieger, und ihr habt selbst gesagt, dass ihr für unsere Rettung ein wahres Vermögen in Form von Tränken und Salben aufgewendet habt!«
»Sie hat auf mich geschossen«, erinnerte ihn Wulfgar, wobei er zu der Schützin im Wagen hinübernickte, der es inzwischen deutlich besser ging.
»Und trotzdem sind wir am Leben! Wir alle. Weil ihr uns als …«
»Ihr bekommt eure Waffen nicht zurück.« Das war Wulfgars letztes Wort zu diesem Thema. »Bis zur Brücke könnt ihr mir beweisen, dass ihr niemand anderen überfallt. Dann lasse ich vielleicht Gnade walten. Vielleicht lasse ich euch sogar gehen, wenn andere euch im Auge behalten.«
Adelard wollte protestieren, doch Wulfgar redete einfach weiter.
»Du bekommst dein Schwert nicht zurück. Egal mit welcher List«, sagte er.
»List?« Adelard gab sich ehrlich verletzt, aber Wulfgar schnaubte nur.
Im nächsten Moment sagte Regis scharf: »Ruhe!«
Alle schauten zu ihm hinüber.
»Was ist?«, flüsterte Wulfgar, der bemerkt hatte, wie konzentriert sein kleiner Freund wirkte.
Regis wies auf Afafrenfere, der hinter dem Wagen niedergekniet war und ein Ohr auf den Boden legte.
Wulfgar hielt den Wagen an. Alle Augen hingen an dem Mönch.
»Pferde«, erklärte Afafrenfere. »Sie kommen von hinten, und sie laufen schnell.«
Da schwiegen die übrigen acht und lauschten angestrengt. Tatsächlich verriet eine leichte Veränderung der Windrichtung, dass hinter ihnen eine ganze Gruppe Pferde auf der Straße galoppierte.
Wulfgar sah sich um. Sie waren gerade durch ein Wäldchen gefahren, hatten aber keine Zeit mehr, hinter der Biegung zu verschwinden und in Deckung zu gehen.
»Unsere Waffen«, flüsterte Adelard.
Mit einem warnenden Blick gebot ihm Wulfgar zu schweigen. Nachdem der Barbar die Zügel befestigt hatte, sprang er vom Bock und winkte Regis zu sich an die hintere Seite des Wagens, wo Afafrenfere bereits wartete.
»Banditen?«, fragte der Mönch.
»Wahrscheinlich«, antwortete Regis.
»Sollen wir die anderen bewaffnen, falls es zu viele sind?«, fragte Wulfgar, der den zerlumpten Haufen Gefangener betrachtete.
»Nur ihr Anführer ist ein anständiger Kämpfer«, erinnerte ihn Regis. »Und wenn er die kennt, die da kommen, wechselt er womöglich die Seite.«
»Das würde er nicht überleben.«
Regis zuckte mit den Schultern.
Inzwischen war das Hufgetrappel deutlich zu hören. Die Reiter näherten sich dem Wäldchen, das unten an der Biegung noch gut zu sehen war.
»Los, versteckt euch«, forderte Wulfgar die sechs Gefangenen auf. »Im hohen Gras.«
Die Banditen stoben auseinander, waren aber nicht schnell genug. Ein Dutzend Reiter bog um die Kurve der Handelsstraße und donnerte auf sie zu. Sobald der Trupp den Wagen entdeckte, zückten alle ihre Schwerter. Der Stahl glänzte im Morgenlicht, und auf Regis’ Gesicht zeichnete sich ein breites Lächeln ab.
»Sind das …?«, begann Wulfgar.
Die Reiter wirkten sehr selbstsicher, als wären sie schon viele, viele Monate unterwegs und hätten viele, viele Meilen hinter sich. Und sie waren alle ziemlich klein.
Der Barbar legte Bruder Afafrenfere eine Hand auf die Schulter, um ihn aus seiner Verteidigungshaltung zu lösen.
Wulfgar hörte ein paar der Banditen stöhnen.
Die Grinsenden Ponys waren gekommen.
»Halt, Wagen, halt!«, rief der Reiter in der Mitte der vorderen Reihe. Er war ein gut gekleideter Mann, dessen breitkrempiger Lederhut auf einer Seite hochgesteckt und mit einer Feder geschmückt war.
»Wenn wir noch mehr anhalten, Meister Doregardo, rollt der Wagen euch gleich rückwärts entgegen!«, rief Regis zurück. Er trat aus Wulfgars Schatten, zog seinen schmalen Degen und verneigte sich graziös.
»Spinne!«, rief der Halbling neben Doregardo.
Die Truppe donnerte zu ihnen herauf und brachte die Ponys aufbäumend zum Stehen. Kaum hatten die Vorderhufe seines Reittiers den Boden berührt, da schwang Doregardo sich auch schon geschmeidig aus dem Sattel.
»Das ist ja Meister Topolino! Ewig nicht gesehen!«, rief Doregardo aus, lief herbei und schloss Regis fest in die Arme. »Aber, mein Lieber«, fügte er hinzu, als er Regis auf Armeslänge von sich schob, »mir scheint, du hast dein Pony eingebüßt.«
»Es waren ereignisreiche Jahre, alter Freund«, erwiderte Regis. »Voller Krieg und Abenteuer.«
»Dann hast du uns ja einiges zu erzählen«, sagte Showithal Terdidy, der Halbling, der zuerst Regis’ Namen gerufen hatte. Auch er schwang sich vom Pferd und eilte zu Regis, um ihn zu umarmen.
»Wir waren auf der Jagd nach einer Bande Wegelagerer, die in dieser Gegend ihr Unwesen treiben«, erklärte Doregardo.
»Die haben wir gefunden«, sagte Wulfgar mit einer Geste zu den sechs Banditen, von denen sich keiner so schnell hatte verstecken können.
»Bei den Göttern«, hörten sie Adelard knurren, ehe er dem zerknirschten Fahrer zuflüsterte: »Du hast ein Grinsendes Pony mitgenommen?«
»Eher haben sie uns gefunden«, stellte Regis klar.
Doregardo sah sich um und gab seinen Männern dann ein Zeichen. Die noch berittenen Halblinge bewegten sich nach links und rechts, um die Gruppe einzukreisen.
»Die sind außer Gefecht«, versicherte Regis Doregardo. »Wir wollten sie bis zur Boareskyr-Brücke mitnehmen, damit sie uns überzeugen können, dass sie in Zukunft ein anderes Handwerk anstreben.«
»Oder euch im Schlaf ermorden«, murmelte Showithal.
»Ich schlafe nicht«, erklärte Afafrenfere, was ihm einen kritischen Blick von Showithal eintrug.
»Darf ich vorstellen? Bruder Afafrenfere vom Kloster der Gelben Rose«, warf Regis rasch ein. »Bruder Afafrenfere, der Drachentöter. Und das ist mein alter Freund Wulfgar aus dem Eiswindtal«, fuhr er fort, um die Situation angesichts des immer noch misstrauischen Ausdrucks von Showithal zu entschärfen.
Dieser Mann war nie einem Kampf aus dem Weg gegangen, denn er wollte die Grinsenden Ponys berühmter machen als seine ehemalige Patrouille aus Damara, die Kniebrecher. Regis konnte sich gut ausmalen, wie Showithal mit dem Schwert auf Wulfgar losging und sie dann alle zusammen überlegen würden, wie sie den armen Showithal aus der Krone des höchsten Baumes holen sollten, in die der Hüne ihn bedenkenlos schleudern würde.
Doregardo lachte auf und verbeugte sich prompt vor Wulfgar. »Es ist uns eine Ehre, werter Herr«, sagte er höflich, ehe er sich wieder Regis zuwandte. »Und was, bitte sehr, wolltet ihr machen, falls ihr diese Grobiane nicht auf den Weg der Besserung schicken könnt?«
»Das Problem ein für alle Mal lösen«, erwiderte Wulfgar grimmig und unmissverständlich.
Doregardo fasste ihn gründlich ins Auge. »Dann betrachtet euer Problem hiermit als gelöst.« Auf sein Zeichen trieben die Reiter die Gruppe zusammen.
»Nun, das hängt ganz von euren Absichten ab«, entgegnete Wulfgar.
»Du meinst, sie könnten sich bessern?«
»Sonst lägen sie alle längst tot am Wegesrand.«
»Dann begleiten wir euch gern zur Boareskyr-Brücke«, bot Doregardo an, »und helfen euch bei der Bewachung der Gefangenen. Und an der Brücke werden wir euer Urteil hören.«
»Und es achten?«, hakte Wulfgar nach.
Doregardo zuckte unverbindlich mit den Schultern. »Ich habe Partner, die weitere Informationen zu dieser Bande sammeln. Falls Blut an ihren Händen klebt …«
Wulfgar hob die Hand, um zu zeigen, dass er verstanden hatte. Er nickte zufrieden.
Die Handelsstraße führte auf weiten Strecken durch die Wildnis. Hier war ständig wertvolle Ware unterwegs, und daher lauerten auch ständig Banditen. Gefängnisse gab es kaum, und insbesondere mangelte es an Patrouillen wie den Grinsenden Ponys, welche die lange Straße abritten. Daher mussten sich diejenigen, die diese Gegend durchquerten, zumeist auf ihr eigenes scharfes Schwert verlassen. Im Eiswindtal, wo in der Regel schnell und fast immer brutal für Gerechtigkeit gesorgt wurde, galten ähnliche Gesetze.
Doregardo gab einer jungen Halbling-Frau mit großen Augen einen Wink. Regis kannte sie nicht. Sie wendete sofort ihr Pony, galoppierte die Straße hinunter und kehrte nach einer Weile, als der Wagen schon wieder weiterrollte, mit zwei reiterlosen Ponys im Schlepptau zurück.
»Willst du wieder mit uns ziehen, mein alter Freund?«, wandte sich Doregardo an Regis, als die Ersatztiere nahten.
Regis grinste sowohl über die Wortwahl – wie alt war schon die Freundschaft mit Doregardo im Vergleich zu der mit dem breitschultrigen Barbaren auf dem Kutschbock? – als auch über das verlockende Angebot. Er nickte, reihte sich unbefangen zwischen Doregardo und Showithal ein und machte sie auf die Geschichten neugierig, die er ihnen am Lagerfeuer erzählen würde.
Und was für Geschichten er mitbrachte!
Am Abend berichtete Regis von den Ereignissen im Silbermarken-Krieg und der bedeutenden Schlacht um die Zitadelle Todespfeil mit dem endgültigen Sieg von König Bruenor und seinen Verbündeten. Die Grinsenden Ponys und auch ein paar der Banditen brachen dabei immer wieder in Beifall aus.
Regis erzählte auch von den Drachen über den Bergen und drängte Afafrenfere, seinen Kampf mit dem weißen Wyrm an der Bergflanke zu schildern, und obwohl der Mönch dieses Ereignis mit großer Bescheidenheit herunterspielte, wurde doch jeder Satz von ihm staunend zur Kenntnis genommen.
Es war schon sehr spät, als Regis fertig wurde, aber niemand hatte sich vorzeitig zurückgezogen, nicht einmal Adelard und seine Bande. Alle flüsterten und lachten vor sich hin und bejubelten die Zwergenkönige Bruenor, Harnoth und Emerus Kriegerkron.
»Und jetzt seid ihr auf dem Weg zur Boareskyr-Brücke«, sagte Doregardo, als das Geflüster sich legte und Halblinge, Banditen und der Barbar ihre Schlafplätze aufsuchten.
»Und weiter nach Suzail«, erwiderte Regis.
Doregardo und Showithal wechselten einen neugierigen Blick.
»Moradi Topolino?«, fragte Showithal, und Regis’ Lächeln bestätigte seine Vermutung.
»Ich habe Herrin Donnola versprochen, dass ich zurückkomme. Und dieses Versprechen gedenke ich zu halten.«
Showithal Terdidy, der sich an die bezaubernde Donnola gut erinnerte, nickte und erwiderte sein Lächeln.
»Und du?«, wandte sich Doregardo an Wulfgar.
»Mein tollkühner kleiner Freund braucht gelegentlich Schutz«, antwortete der Barbar.
»Genau wie Wulfgar, der sich in dunklen Tunneln gern mal den Kopf anstößt«, gab Regis frech zurück.
»Noch eine Geschichte?«, fragte Doregardo, worauf sich Regis bereitwillig zum Erzählen anschickte.
Aber da löste sich Showithal von den anderen und ging zu der einsamen Gestalt, die auf einem flachen Stein hockte und ins Dunkel spähte. Regis hielt inne, und alle drei horchten hinüber.
»Das Kloster der Gelben Rose, sagte Spinne. Damara?«, erkundigte sich Showithal sichtlich fasziniert. Showithal stammte aus diesem fernen Land, wo er einst mit den Kniebrechern auf Patrouille ausgezogen war, einer anderen berittenen Halbling-Truppe.
Der Mönch nickte. »Und dorthin kehre ich zurück.«
»Oh, dann haben wir uns viel zu erzählen! Ich habe Freunde in jenem Land und war viel zu lange nicht mehr dort.«
Er kletterte zu dem Mönch auf den Felsen und begann ein Gespräch.
»Ein Glück, dass euer Freund sich sicher war, dass er nicht schläft«, sagte Doregardo zu Wulfgar und Regis. »Wenn Showithal Terdidy von seinen Abenteuern erzählt, fasst er sich selten kurz.«
Regis nickte, denn das wusste er nur zu gut.
»So«, sagte Doregardo und klatschte in die Hände. »Und jetzt erzähl mir diese neue Geschichte. Jemand von meiner Statur hört nur zu gern, wie große Menschen im Dunkeln gegen tiefhängende Felsen rennen.«
Sein breites Lächeln bei diesen Worten verflog, als er den Blickwechsel zwischen Regis und Wulfgar bemerkte. Auf die unausgesprochene Frage des Halblings folgte nach kurzer Pause ein Nicken von Wulfgar.
»Ich habe tatsächlich noch eine andere Geschichte zu erzählen«, sagte Regis deutlich leiser und ernster zu Doregardo. »Aber ich fürchte, du wirst sie schwer glauben können, und sie reicht weit zurück, bis in eine Zeit vor deiner Geburt.«
Doregardo musterte erst den Halbling, der höchstens halb so alt wirkte wie er, dann Wulfgar.
Als der Wagen am nächsten Morgen in aller Frühe wieder die Handelsstraße entlangrollte, hatten weder Regis noch Doregardo noch Wulfgar geschlafen. Insbesondere Doregardo schwirrte noch immer der Kopf nach der unglaublichsten Geschichte, die er je gehört hatte, von Wiedergeburt und einer zweiten Chance, und das Verrückteste daran war, dass er überraschenderweise jedes Wort glaubte.
Einen Zehntag später erreichte die Gruppe ohne Zwischenfälle die Boareskyr-Brücke. Dort stießen sie auf eine weitere Gruppe Grinsende Ponys, die Doregardo genauere Nachrichten über die Räuberbande überbrachten. Für fünf der sechs Gefangenen waren das gute Neuigkeiten – sie kamen noch einmal davon. Der sechste hingegen, der Dicke mit der Axt, hatte tatsächlich Blut an den Händen.
Noch am selben Tag knüpften sie ihn an einem Baum unweit westlich der Brücke auf.
In der Wildnis war die Gerechtigkeit schnell und brutal.
Zur großen Überraschung der beiden Freunde aus den Silbermarken teilte Doregardo ihnen mit, dass er und einige aus seinem Trupp sie bis nach Suzail begleiten wollten.
»Ich kenne schließlich viele Kapitäne und kann euch bestimmt helfen, eine Überfahrt nach Aglarond zu bekommen«, erklärte er.
»Bis Suzail sind es ein paar Hundert Meilen«, gab Regis zu bedenken.
»Die Strecke bin ich viel zu lange nicht mehr geritten«, sagte Doregardo. »Showithal und ich hatten sowieso schon darüber geredet, kurz bevor wir euch trafen. Nach den Ereignissen bei der Teilung und den großen Umwälzungen, die sich seither überall zugetragen haben, ist es längst überfällig, dass das Banner der Grinsenden Ponys mal wieder in Cormyr weht.«
»Eure Gesellschaft ist uns willkommen«, erwiderte Regis.
»Ganz unsererseits! Aber erst müssen wir deinen Freunden zwei gute Pferde besorgen«, sagte Doregardo.
Wulfgar nickte, doch Afafrenfere schüttelte den Kopf. »Ich brauche kein Pferd.«
»Wir schlagen ein rasches Tempo an«, warnte Doregardo, aber Afafrenfere lehnte erneut ab. Bald nach ihrem Aufbruch fragte niemand mehr nach. Afafrenfere rannte leichtfüßig neben der Gruppe her und hatte auch in den folgenden Zehntagen keine Probleme, mit ihnen Schritt zu halten.
Sie hatten gehofft, Suzail bis zum Beginn des Sommers zu erreichen, aber die Westlichen Herzlande waren nach den vielen Kriegen und Aufständen der unruhigen letzten Jahre noch nicht wieder sehr friedlich, sodass die Reise immer wieder Anlass zu Abstechern und kleineren Abenteuern bot, zumal sie wiederholt um Hilfe für brave Bürger gebeten wurden. Erst deutlich nach Mittsommer kamen schließlich die hohen Masten in Sicht, die sich sanft im Hafen von Suzail wiegten.
Dort nahmen sie Abschied von Bruder Afafrenfere, der auf der Mondsee nach Mulmaster segelte – das war der direkteste Weg zu seinem Heimatkloster.
Schiffe nach Aglarond waren zu diesem Zeitpunkt jedoch schwer zu finden, und so konnten Wulfgar und Regis erst am letzten Tag des Eleasis ein Handelsschiff besteigen, das sie als Matrosen und Söldner in die Hafenstadt Delthuntle in Aglarond mitnehmen wollte.
»Lebe wohl, mein Freund Doregardo«, sagte Regis im Hafen. »Ich rate dir, auf Nachrichten aus den Felsklüften zu achten, im Norden von Niewinter. Dort wird König Bruenor Heldenhammer bald Anspruch auf die alte Zwergenheimat von Delzoun erheben.«
»Lebe wohl, mein Freund Regis«, antwortete Doregardo.
»Spinne Topolino«, ergänzte Showithal augenzwinkernd von hinten, was alle zum Lachen brachte.
»Regis«, stellte Doregardo richtig. »Held des Nordens. Und du ebenfalls, Meister Wulfgar. Ich wünschte, ich könnte dich dreiteilen und aus dir drei Neuzugänge für die Grinsenden Ponys machen.«
»Dann auf Wiedersehen«, sagte Regis.
»Vielleicht auf der Schwelle von Gauntlgrym«, erwiderte Doregardo. »Da kannst du uns dann diesem Zwergenkönig vorstellen, den du zu deinen Freunden zählst.«
Regis verbeugte sich, Wulfgar nickte respektvoll, und dann bestiegen die beiden die Karavelle.
Keiner von ihnen konnte es damals wissen, doch genau an diesem Tag schlugen Bruenor, Drizzt, Catti-brie und die Zwergenarmee aus den Silbermarken vor den Nordtoren der Stadt Niewinter ihr Lager auf.
Teil 1
Dein Wille
Wieder blicke ich zu den Sternen empor, und sie erscheinen mir so fremd und fern wie damals, als ich dem Unterreich zum ersten Mal entstieg.
Aller Logik und Vernunft zufolge müsste mir meine Reise nach Menzoberranzan wie ein einziger Triumph erscheinen.
Demogorgon wurde vernichtet. Damit wurde die Gefahr für Menzoberranzan und vielleicht auch weitere Teile der Welt gebannt. Ich habe überlebt und meine Gefährten ebenfalls, und wir konnten sogar Dahlia aus dem Spinnennetz der Oberinmutter Baenre retten. Tiago ist tot, und ich muss nicht mehr befürchten, dass er je wieder andere anstachelt, mir und meinen Freunden nachzusetzen. Selbst wenn die Drow ihn wiederbeleben, ist dieses Kapitel endgültig abgeschlossen. Weder Tiago noch andere Drow dürften je wieder dem Kopf von Drizzt Do’Urden nachjagen.
Deshalb hat meine Reise ins Unterreich aller Vernunft nach den größtmöglichen Erfolg erzielt, mehr, als wir je zu hoffen gewagt hätten, und ist in doppelter Weise unerwartet glücklich ausgegangen.
Ich müsste außer mir vor Freude sein, die Sterne wiederzusehen.
Aber jetzt weiß ich Bescheid, und dieses Wissen ist eine Wahrheit, die ich nicht mehr abschütteln kann. Angesichts dieser Erkenntnis ist sie vielleicht die einzige Wahrheit.
Und das finde ich entsetzlich.
Die einzige Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt? Dieses Leben, jedwedes Leben, ist lediglich ein Spiel, ein großer Betrug, und abgesehen von der Realität, die wir selbst ihm verleihen, bedeutungslos?
In den Tiefen der Hölle wurde Wulfgar von Errtu getäuscht. Errtu erschuf sein ganzes Leben neu und gaukelte ihm dabei die Erfüllung seiner größten Träume vor – nur um ihm diese anschließend wieder zu entreißen.
Wie weit reicht eine solche Lüge? Wie weit ist das, was wir sehen, das, was wir wissen, alles, was wir glauben, von Dämonen oder Göttern geschaffen?
Oder sind auch diese Wesen nur Auswüchse meiner eigenen Fantasie? Bin ich ein Gott? Der einzige Gott? Ist alles, was mich umgibt, nichts weiter als meine eigene Schöpfung, der meine Augen Gestalt geben, der meine Nase Geruch verleiht und meine Ohren den Ton, aus der meine Launen die Geschichte stricken?
Ach, das befürchte ich, doch ich will nicht der Gott meines Universums sein! Gibt es einen schlimmeren Fluch?
Aber ja, doch, den gibt es. Es wäre wohl noch schlimmer zu erkennen, dass ich nicht der Meister bin, sondern das Opfer eines Meisters, der mich mit seinen eigenen boshaften Plänen narrt.
Oder nein, nicht schlimmer. Nein, denn wenn ich eine Art Gott bin und mit meiner eigenen Wahrnehmung die Realität erschaffe, bin ich dann nicht in Wahrheit allein?
Ich finde keinen Ansatz, das Dilemma zu lösen. Heute sehe ich zu den Sternen auf, denselben Sternen, die mir seit Jahrzehnten die Nacht erhellen, und sie erscheinen mir fremd und fern.
Weil ich befürchte, dass alles nur eine große Lüge ist.
Und deshalb erscheint jeder Sieg mir schal. Jede Wahrheit, an die ich mich einst geklammert habe, entgleitet meinen schwachen Händen.
Jene seltsame Priesterin, Yvonnel, hat mich als Held der Lolth bezeichnet, doch ich spüre genau, dass sie da völlig falschliegt. Ich habe für Menzoberranzan gekämpft, das stimmt, aber das war ein gerechter Kampf gegen einen entsetzlichen Dämon, und nicht etwa für Lolth, sondern für jene Dunkelelfen, die eine Chance haben, die Wahrheit zu erkennen und ein Leben zu führen, das sich lohnt.
Oder?
Auf meiner Reise bin ich durch die Hallen von Haus Do’Urden gelaufen, so, wie es einst war, nicht, wie es jetzt ist. Ich habe den Tod von Zaknafein mit angesehen – wie man mich glauben machte –, aber auch das weiß ich nicht sicher.
Die einzige Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt … keine Realität, nur Wahrnehmung.
Denn wenn die Wahrnehmung real ist, was zählt dann noch? Wenn dies alles ein Traum ist, dann ist alles bloß ich …
Allein.
Und der einzige Sinn ist Unterhaltung.
Und die einzige Moral meine Launen.
Und die einzige Bedeutung ist Abwechslung.
Allein.
Ich hebe meine Klingen, Blaues Licht und Eisiger Tod, und betrachte sie als Paddel im großen Spiel. Mit welcher Überzeugung kann ich solche Waffen führen, wenn ich jetzt weiß, dass es nur darum geht, einen Dämon – oder einen Gott oder meine eigene Fantasie – zu unterhalten?
Und so bin ich in dieser klaren, sternenhellen Nacht auf dem Weg nach Luskan.
Ohne Sinn.
Ohne Moral.
Ohne Bedeutung.
Allein.
Drizzt Do’Urden
Kapitel 1
Widrige Winde und stürmische Wogen
»Das macht wirklich keinen Spaß mehr«, sagte Regis kläglich zu Wulfgar. Ihre rahgetakelte Karavelle,Puddy’s Skipper, rollte unsanft über die zwanzig Fuß hohen Wellen. Die Mannschaft hatte alle Hände voll zu tun, um das stampfende Schiff ausgeglichen zum Seegang zu halten. Ständig bestand die Gefahr, dass eine Woge von der Seite sie umwerfen könnte.
»Zu viel Ladung unter Deck«, erklärte Wulfgar, der nicht annähernd so grün im Gesicht war wie sein kleiner Freund. »Und nicht anständig vertäut. Jede Welle bringt die Kisten ins Rutschen.«
Wieder überquerten sie einen hohen Wellenkamm, der dahinter diesmal so steil abfiel, dass die beiden vom Schiffskastell aus senkrecht über den Bug ins dunkle Wasser starrten. Beide hielten sich noch besser fest, und das war auch gut so, denn jetzt brach das Wasser über den Bug herein und strömte über das Hauptdeck.
Wulfgar lachte.
Regis übergab sich.
So ging es den ganzen Nachmittag weiter. Erst zur Nacht hin beruhigte sich das Meer. Doch der sternenlose Himmel versprach für den folgenden Tag noch mehr Regen und Wind.
»Haha! Ich dachte, du wärst keine Landratte!«, lachte der erste Offizier, als Wulfgar Regis über die Leiter zum Hauptdeck begleitete.
»Wir sind viele Male zur See gefahren«, antwortete Wulfgar.
»Mit Deudermont auf derSeekobold!«, ergänzte Regis, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Aber der erste Offizier und auch die Kapitänin, Mallabie Pudwinker, zuckten nur mit den Schultern.
»Das hier ist nicht die Schwertküste«, erinnerte Wulfgar seinen Freund leise, als sie weitergingen. »Wir sind auf einem Binnenmeer.«
»Bloß ein großer See«, antwortete der grüngesichtige Regis sarkastisch.
»Aye, und deshalb können die Wellen noch gemeiner sein«, erklärte Mallabie Pudwinker, die den Wortwechsel mitbekommen hatte. Dabei trat die kräftige, gut aussehende Frau auf die beiden zu, und das Funkeln in Wulfgars Augen bei ihrem Anblick war schwer zu übersehen. Regis konnte seine Gefühle gut nachvollziehen. Mit ihrer ganzen Haltung und Gestalt strahlte Kapitänin Mallabie Kompetenz und Kraft aus. Eine Frau, die weiter spucken, härter kämpfen und noch leidenschaftlicher lieben konnte als jeder Mann. Ihre dunkelbraunen Augen konnten sowohl teilnahmslos durch einen hindurchblicken als auch mitten ins Herz. Das schwarze Haar wippte um ihre Schultern und schien das einzige Ungebändigte an dieser Frau zu sein. Ihre Kleider saßen perfekt und straff, und über dem engen Wams saß ein Bandelier voller Medaillen und Hafennadeln. An der linken Hüfte trug sie ein Entermesser, das sie bisher zwar nie gezogen hatte, aber zweifellos bestens einzusetzen wusste.
»Es ist nicht so tief hier in der abgeschirmten Fahrrinne zwischen Sembia und der Drachenküste. Deshalb kann die See ein bisschen unruhig werden, wenn sie über die Riffe und Untiefen hinwegrauscht.«
»Ein bisschen unruhig?«, erwiderte der Halbling ungläubig.
»Du sagtest doch, du wärst aus Aglarond und auf der See des Sternenregens gesegelt?«
»Das bin ich, und das stimmt. Aber nur einmal.«
»Delthuntle, sagtest du!«, protestierte Mallabie. »Ein Leben auf dem Wasser, sagtest du!«
»In einem Ruderboot oder einer Jolle. Nichts Größeres«, gab Regis zu.
Die Kapitänin seufzte. »Na, da hätte ich dir für die Überfahrt aber ruhig mehr abnehmen können, hm?«
Regis wollte antworten, aber Wulfgar legte ihm einen Arm um die Schultern, um ihn zum Schweigen zu bringen.
»Was ist?«, fragten Regis und Mallabie gleichzeitig.
»Schlagseite«, sagte Wulfgar.
»Sie rollt«, widersprach Regis, doch Wulfgar schüttelte den Kopf.
»Sie krängt nach Backbord«, stellte er fest. Er stand absolut still und starrte nach vorn auf die Linie vom Hauptmast zum Bug.
»Unter Deck. Sofort!«, schrie Kapitänin Mallabie einen nahen Matrosen an. »Untersucht den unteren Laderaum!«
Noch ehe der Mann die Leiter hinunter war, drang auch schon ein Schrei herauf, dass sie tatsächlich Wasser aufnahmen. Der harte Seegang hatte den Hauptmast abwärts gedrückt, und dabei hatte er die Planken angeschlagen. Und jetzt, wo so viel von der Ladung nach Backbord gerutscht war, strömte auf dieser Seite Wasser herein, das die Karavelle weiter aus dem Gleichgewicht brachte.
»Refft die Segel!«, schrie Kapitänin Mallabie, sobald sie das Problem erkannt hatte. Die Segel, die sich unter der Wucht des Windes spannten, setzten den beschädigten Bereich noch mehr unter Druck und verschlimmerten so das Problem.
»Eine Gruppe nach unten zum Schöpfen!«, befahl sie, und sofort ging die Mannschaft an die Arbeit. Wulfgar lief ebenfalls zur Leiter, aber Mallabie hielt ihn zurück. »Bist du so stark, wie du aussiehst?«
»Stärker«, versicherte Regis.
»Gut. Dann ab an die Pinne, alle beide«, befahl Mallabie. »Das Steuerruder ist ohne die Segel nicht präzise genug, deshalb müssen wir direkt ans Ruder.« Auf ihr Zeichen vertäute der Mann am Steuer das Rad und nickte. »Bricker macht die Pinne für euch bereit, und dann kommt alles auf dich an, Barbar. Halte direkt auf die Wellen zu, sonst ist es um uns geschehen.«
Wulfgar nickte. Er hatte schon einmal eine derart dramatische Aufgabe übernommen und mit seiner ungeheuren Kraft inmitten einer Piratenschlacht größere Schiffe als dieses gewendet.
»Sobald sich der Seegang legt und meine Crew den Rumpf ausgeschöpft hat und ihn repariert, gehst du runter und balancierst die Ladung aus«, fügte sie hinzu. »Ich werde nichts davon verlieren!«
»Aber wenn wir sinken …«, begann Regis.
»Eher werfe ich Mann für Mann über Bord, bis nur noch die paar übrig sind, die ich brauche, um meine Ladung nach Osten zu bringen«, unterbrach ihn Kapitänin Mallabie. »Und da könnte ich mit dir gleich anfangen.«
Regis’ grünes Gesicht wurde kreideweiß, und Mallabie konnte sich gerade noch wegdrehen und Wulfgar verstohlen zuzwinkern. Der Barbar musste grinsen.
»Das war ein Scherz, oder?«, vergewisserte sich Regis, während er mit Wulfgar hinter Bricker her nach achtern eilte.
»Kann dir doch einerlei sein, oder?«, erwiderte Wulfgar. »Ich dachte, du hättest dein Genasi-Blut und könntest so lange schwimmen, wie du willst.«
Regis zuckte mit den Schultern. »Tja, im Wasser gibt es auch anderes, weißt du. Große Wesen … hungrige Wesen …«
»Ach was, du bist doch bloß ein Happs, also brauchst du dich nicht zu fürchten«, erklärte Wulfgar.
Sie arbeiteten die ganze Nacht hindurch, wobei Wulfgar die Anweisungen von Bricker und Regis getreulich befolgte, um das Schiff auf jede nahende Woge auszurichten. Zu ihrem Glück wurden die Wellen allmählich kleiner, und schließlich rissen über ihnen die Wolken auf. Das Sternenlicht strahlte auf sie herab.
Auf dem Deck hatten die Matrosen eine Eimerkette gebildet, und unten am Rumpf hörte man das gleichmäßige Hämmern der Zimmerleute, die sich bemühten, den Mast zu sichern und die gebrochenen Stellen mit Teer und Holz zu verschließen.
Doch einige Stunden vor Sonnenaufgang wurden die Männer langsamer, und Wulfgars Arbeit war beinahe getan. Da die See sich beruhigt hatte, vertäuten er und Regis die Ruderpinne. Nachdem sie Bricker geholfen hatten, das Steuer wieder mit dem Ruder zu verbinden, versuchten die drei, eine Runde zu schlafen.
»Dafür haben wir keine Zeit!«, ertönte bald darauf Kapitänin Mallabies Stimme – so bald, dass Regis sich nicht sicher war, ob er schon geschlafen hatte oder nicht. Müde blinzelte er zum strahlend blauen Himmel empor. Es war heller Tag, und die Sonne schien. Wulfgar gähnte, und Bricker sprang auf.
»Zurück an die Eimer«, sagte Mallabie.
»Ich dachte, sie sei geflickt«, sagte Bricker.
»Teilweise, ja, aber der Schaden ist unten am Kiel. Wir können es hinauszögern. Vielleicht reicht es, vielleicht auch nicht.« Ihr Kopfschütteln stimmte die drei nicht gerade zuversichtlich.
Nun erhob sich auch Wulfgar, und Mallabie betrachtete ihn dabei forschend.
»Kannst du schwimmen?«, fragte sie.
Der Hüne zuckte mit den Schultern.
»Willst du die Jungs unterPuddy’s Skipperschicken?«, fragte Bricker erstaunt.
Mallabie gab sich gleichgültig. »Kann sein.«
»Warum nicht?«, fragte Wulfgar. DiePuddy’s Skipperwar schließlich kein Riesenschiff, und er war ziemlich sicher, dass er den Kiel erreichen konnte.
»Einer oben, einer unten, wieder runter, wieder hoch«, erklärte Bricker. »Man wäre nicht lange genug da unten, um etwas auszurichten. Nicht in der Dunkelheit. Das bringt einfach nichts! Man müsste die Keile exakt anpassen, nicht nur schnell eine Planke festklopfen und das Beste hoffen!«
»Besser als nichts«, sagte Kapitänin Mallabie.
»Man kann es nicht teeren«, hielt Bricker dagegen.
»Und ich kann sie nicht mitten auf dem verdammten Meer aufs Trockendock packen, richtig?«, fuhr ihn Mallabie an und erinnerte damit nachdrücklich an die Hierarchie hier draußen.
»Verzeihung«, sagte der Mann respektvoll und zog den Kopf ein.
»Vielleicht musst du viele Male tauchen«, sagte sie zu Wulfgar. »Aber ich möchte, dass du es versuchst.«
»Er muss also da runter und die Keile so anpassen, dass sie die Risse verschließen?«, fragte Regis.
Mallabie zuckte wieder mit den Schultern. »Darauf gibt es keine leichte Antwort, und nichts ist sicher«, gestand sie. »Aber alles, was wir tun können, um das Leck ein Stück weit zu schließen, hilft uns, die Küste zu erreichen …«
Sie brach ab, weil Regis bereits Wams und Hemd ablegte. Auch seinen Degen schnallte er ab, aber den Dolch behielt er bei sich. Er nickte, packte sein famoses blaues Barett auf den Stapel, sprang dann über die Reling und verschwand.
»Mann über Bord!«, rief Kapitänin Mallabie schockiert und lief zur Reling.
»Auf den könnt ihr lange warten«, erklärte Wulfgar, der dem erstaunten Blick der anderen mit einem wissenden Grinsen begegnete.
Regis wusste natürlich, dass es Grund zur Angst gab. Er befand sich auf dem offenen Meer, in der See des Sternenregens, unter Wasser. Hier gab es Monster und Seeteufel, gefährliche Kreaturen unterschiedlichster Art. In diesem Binnenmeer hatte der Halbling den schlimmsten Moment seines Lebens – seiner beiden Leben! – hinter sich gebracht, denn hier hatte er den Sarg von Schwarze Seele geöffnet und war in den Tiefen dem Schreckgespenst begegnet.
Dennoch hatte er keine Angst. Es hatte etwas Befreiendes, im Wasser zu sein. Für ihn war das ganz natürlich und angenehm, etwas, das ihn mit seinen Vorfahren verband, der Lebensweise, der er seine jetzige Existenz verdankte.
Obwohl es erst Mitte Eleint war, der neunte Monat, und entlang der Drachenküste, in Gulthander und den anderen Reichen südlich der See noch Sommer herrschte, nahte der Herbst mit großen Schritten. Von den Blutsteinlanden bliesen zunehmend kalte Winde herab, sodass das Wasser hier draußen nicht sonderlich warm war. Aber das spielte keine Rolle. Dank seines Genasi-Erbes störte Regis das kalte Wasser nicht sonderlich, zumal es ihm auch in seinem ersten Leben wenig ausgemacht hatte. Er erinnerte sich gut daran, wie er einst in dieser Jahreszeit ausgerutscht und in den Maer Dualdon gefallen war. Hätte ihn nicht ein Fischer mit seinem Netz herausgezogen, so wäre er damals in aller Stille ertrunken. Dort oben war das Wasser natürlich viel kälter als hier, aber Regis wusste, dass er heute auch in jenem See im Eiswindtal schwimmen könnte. Die Kälte würde ihm ebenso wenig ausmachen wie vor seiner Wiedergeburt. Sie würde seinen kleinen Körper nicht völlig auskühlen und immer langsamer werden lassen, bis sein Herz aussetzte.
Über die Herkunft seiner Mutter hatte er eine wunderbare Gabe erhalten.
Und deshalb hatte er keine Angst.
Sein Körper bewegte sich instinktsicher, und bei jedem Schwimmzug arbeiteten seine Glieder harmonisch zusammen, um ihn vorwärtszutreiben. Natürlich hatte er auch früher schwimmen können, wenn es unbedingt sein musste, aber nicht so wie heute. Jetzt glich er eher einem Wasserwesen, denn er bewegte sich unter Wasser ebenso anmutig und ebenso schnell.
Und er konnte hier sogar besser sehen! Vielleicht lag es an den vielen Stunden, die er als Kind tief unter der Oberfläche in den Austernbänken verbracht hatte, doch es kam ihm so vor, als wäre seine Fähigkeit, als Halbling auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch viel zu sehen, unter Wasser noch schärfer und hilfreicher.
Woran das lag, wusste er allerdings nicht, und das musste er auch nicht. Er musste diese Augen, diese wunderbare Lunge und seine Finger, die so empfindsam auf die Strömungen reagierten, nur einsetzen, als er den Kiel erreichte und den Schiffsrumpf unter dem Hauptmast untersuchte.
Binnen kurzem hatte er den Spalt gefunden, durch den das Wasser eindrang. Er hörte das Gurgeln und spürte den Sog, mit dem das Meer nach dem Schiff langte.
Als er mittschiffs wieder auftauchte und tief durchatmete, starrten Wulfgar und Kapitänin Mallabie über die Reling auf ihn herab. Mallabies Erleichterung und Wulfgars Grinsen entnahm er, worüber sie während seines übermäßig langen Tauchgangs gesprochen hatten.
»Ein Seil!«, rief Mallabie nach hinten, aber Wulfgar berührte sie an der Schulter, schüttelte den Kopf und drehte sie zu dem Halbling zurück.
Spinne Paraffin brauchte kein Seil. Er kletterte bereits geschickt an der Seite derPuddy’s Skipperhinauf.
»Du warst ewig weg …«
»Zu lange. Ja, ich weiß«, unterbrach Regis sie.
»Also bist du ein Priester und kannst unter Wasser atmen?«
»Nein«, sagte Wulfgar, während Regis gleichzeitig antwortete: »So ungefähr.«
Kapitänin Mallabie blickte vom einen zum anderen, und beide lachten.
»Ich habe den Riss im Schiff gefunden. Ich glaube, da kann ich etwas ausrichten«, erklärte Regis. »Ich brauche einen Keil, schön flach, ungefähr so lang.« Er hielt die Hände etwa eine Elle auseinander. »Und einen Hammer. Wenn ich fertig bin, hole ich mir eine Portion Teer.«
Mallabie sah ihn zweifelnd an.
»Eine abgekühlte Portion«, ergänzte Regis. »Ich klopfe sie einfach um den Keil.« Er zuckte mit den Schultern. »Jeglicher Pfropfen, den ich in das Loch bekomme, dürfte helfen.«
Kapitänin Mallabie schienen die Fragen auszugehen. Oder vielleicht hatte sie auch nur verstanden, dass diese ganze Abfolge unerwarteter und offenbar unerklärlicher Ereignisse im Augenblick besser unbeantwortet blieb. Deshalb nickte sie und ging davon, um den Hammer und einen Keil zu holen.
»Du bist jetzt also auch Schiffsbauer?«, fragte Wulfgar, als er mit dem Halbling allein war.
»Keine Ahnung«, antwortete Regis ebenso ehrlich wie überfordert. »Ich stopfe einfach so viel wie möglich in den Riss und hoffe, dass das Wasser dadurch langsamer strömt.«
»Und wenn nicht?«