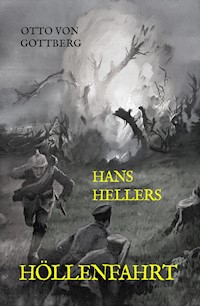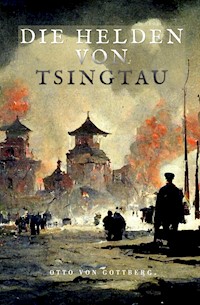
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als das Ultimatum am 28. August 1914 mittags endete, begann der Kampf um Tsingtau. Trotz überwältigender zehnfacher japanisch-britischer Übermacht stellten sich die deutschen Soldaten dem aussichtslosen Kampf. Tapfer hielten die Verteidiger den erbitterten Angriffen stand, bis schließlich die letzte Kugel den Lauf verließ. So wurde der 7. November 1914 zum schwarzen Tag für die deutschen Einwohner Tsingtaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Helden von Tsingtau
von
Otto von Gottberg
______
Erstmals erschienen im:
Verlag Ullstein & Co, Berlin-Wien, 1915
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-061-8
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Geschichte des Schutzgebiets
Vorwort
uch die Niederlage kann Lorbeer, ja Gewinn bringen und Stolz wecken. Aus dem düsteren Schatten ihres Ungemachs tritt Heldenstreiten strahlender als aus dem lichten Glanz des Sieges heraus. Darum hat sie der Sage wie Geschichte uns liebe Gestalten geschenkt. — Wir sind versöhnt mit dem Hagen von Tronje, der als letzter der bezwungenen Nibelungen gefesselt, aber ungebeugt, die drohend nach dem Hort fragende Siegerin höhnt: „Das weiß nur Gott und ich allein und soll dir Teufelsweibe ewig verborgen sein!“
König Friedrich, wie er in der Nacht von Hochkirch war, ist uns teurer als der Sieger von Leuthen. Preußenstolz sieht ihn noch lieber als vor der Fahnenbeute von Hohenfriedberg im Dunkel des Unglücks von Kunersdorf, am Rande des Abgrunds, vom Wettern der sieben langen Jahre umtost, aber den Degen in der Faust, aufrecht und furchtlos Europa die Stirne bieten. Königlicher Stolz auf den unglücklichen, aber ruhmreichen letzten Waffengang einer geschlagenen Truppe lieh Preußens Generalen nach hundert Jahren die Tressen, die Regiment Alt Larisch am schwarzen Tag von Jena trug. —
„Wir hatten gebauet ein stattliches Haus“, aber Feindeshand schlug es in Trümmer. Tsingtau fiel. Seine Helden kosteten, wie bitter die Niederlage schmeckt, und brachen das harte Brot der Gefangenschaft. Aber noch Kinder und Kindeskinder werden mit frohem Stolz erzählen, wie die viertausend Tapferen auf verlorenem Posten gegen ein Heer und eine Flotte, gegen eine Nation stritten.
Sie mehrten unserer Waffen Ruhm, lehrten der Fremde, dass ein Deutscher gegen zehn Feinde kämpfen und stehen kann, und entschleierten ihr den Geist Alldeutschlands: den furchtlos festen Glauben an unser Recht und unsern Sieg, ohne den wir vor dem Drohen einer Welt die Waffen strecken mussten.
Das kleine Deutschland über See bot im Weltenwettern nicht nur dem Asiaten ein getreues Bild des großen in Europa. Von Feindeshand ungestört, trug aus China der elektrische Funke die Kunde vom unverzagten deutschen Kampfeswillen über Amerika in die Welt und sang ihr des Krieges erstes wahres Lied von deutschem Heldentum. Sie las, wie auf des Kaisers Ruf zu den Fahnen die Deutschen Asiens aus den fernsten Winkeln des Kontinents, aus China, Japan, Indien und Korea, jauchzend auf den verlorenen Posten in Tsingtau und zu den Waffen eilten. Dort wehte die Flagge mit dem Adler, der auch der Sonne nicht weicht. Um ihn wollten — gerufen oder nicht — alle Deutschen Asiens sich scharen.
Wohl kamen Jünglinge, von des Krieges Freuden wie ihre gleichaltrigen Brüder in der Heimat gelockt, und wir lasen mit brennenden Augen von draußen Geborenen, die nie das Vaterland gesehen hatten und doch ihm ihr Leben boten.
Aber meist schwellten Bejahrte, in Wohlstand lebend, klug und erfahren in Handel und Geschäften der großen Welt, den Strom von Männern, der dünn und leise, aber stetig und schnell durch den wachsamen Feind in die Werke unserer asiatischen Festung rann. Grauhaarig und reif, wussten sie, dass die Flagge nicht lange wehen konnte und der Ansturm eines ganzen kriegerischen Volkes gar bald die der Heimat fernen, auf sich allein gestellten Verteidiger überrennen würde.
Sie fuhren nicht zum frohen Fest eines auch nur möglichen Sieges, sondern zum trüben Tag gewisser Niederlage und wahrscheinlichen Todes. Doch ging‘s um Deutschlands Ehre, um Deutschlands Ansehen in der fremden Welt!
Darum betraten sie eine Festung in Tagen, da sonst sogar die Angesessenen den Werken und Soldaten mit sorgenvollem Segenswunsch den Rücken kehren.
Über den Wällen von Tsingtau war unser Fähnlein an die Stange gebunden. Nur in Ehren sollte es niedergehen. Dafür zu sorgen und zu streiten ward aller Deutschen heilige Pflicht. Dann traten sie in Reih und Glied der Besatzung.
Die Welt sah zu und glaubte, bald werde die kleine Schar nach kurzem, die Waffenehre währendem Widerstand der zehnfachen Übermacht die Tore öffnen. Doch vom Gouverneur des Schutzgebietes gerufen, stand auf Asiens Erde der Geist des alten Courbiére, der Soldatenstolz Gneisenaus, die Bürgertreue Nettelbecks, die Erinnerung an Kolberg und Graudenz auf und hielt die Wälle, bis die letzte Patrone verschossen war. Einen Gewinn buchten Kaiser und Reich, als der in die nun wehrlose Feste eindringende Feind die Verteidiger zählte.
Mit den Siegern staunten die Völker Asiens: jeder Deutsche der Viertausend von Tsingtau hatte gegen mehr als zehn Feinde gestritten und gestanden! Ein Lächeln unsagbarer Geringschätzung glitt über des Orients Rätselgesicht.
Um viertausend Deutsche zu bezwingen, hatte Britannien Japans Hilfe erbettelt und mit Demütigung bezahlt! Der Verlust an englischem Ansehen auf asiatischer Erde machte den Fall von Tsingtau fast zum deutschen Sieg. —
Erstes Kapitel
hinas Kehrichtwinkel, dem das Land der Mitte naserümpfend den Rücken kehrte, schien das elende Fischerdorf unsauberer Lehmhütten am südlichen Gestade der Halbinsel Schantung, als wir vor siebzehn Jahren Tsingtau erwarben. Unter der Leitung der Marine schuf die ordnende, bauende Hand deutscher Beamten und der Fleiß deutscher Bürger auf dem Schutt von tausend Jahren eine schmucke Stadt mit vielbesuchtem Badestrand, einen Stapelplatz des Welthandels und einen Terminus neuer Schienenstränge, die des Orients Waren bis in die Güterbahnhöft von Berlin und Hamburg trugen. Baum, bepflanzte breite Straßen, Türme und rotbedachte Giebel über hellen Häusern mit blanken Fensteraugen, dieser Heimat weiße Gardine schloß, boten den Unseren das Bild des Vaterlandes. Sie pflegten seine Bräuche, ohne sie rechthaberisch dem Chinesen aufzudrängen. Weil er sich in der jungen Kolonie auf seine Art des Lebens freuen durfte, schätzte er die Stätte sicheren Verdienstes und gesetzlicher Ordnung. Wenn Revolutionen mit den Säulen seines Reiches die Fremden in ihren Niederlassungen zittern ließen, störte nichts die Ruhe behaglichen Friedens im deutschen Pachtgebiet. Namentlich begüterte Zopfträger siedelten sich darum unter den vierzigtausend Bewohnern von Tsingtaus Chinesenstadt an. Hinter dem weißsandigen flachen Strand im Osten der Stadt aber wuchsen aus dem Grün wohlgehegter deutscher Gärten von Jahr zu Jahr neue Villen, und Gasthäuser boten von Jahr zu Jahr mehr Fremden ein Sommerheim. Mit Vorliebe von den Engländern und Amerikanern, aber auch von Franzosen Chinas besucht, wurde Tsingtau Asiens Norderney. Wenn über südlicheren Küsten tropische Hitze lag, ging an dem von nordisch kühlem Seewind gefächelten Strand jene Gesellschaft, die der Deutsche bis zum Weltkrieg als „internationale“ anbetend bewunderte, ihrem Vergnügen bei Konzerten, Wasserfesten, Wettrennen und bei Ausflügen in die von deutschen Forstbeamten mit heimischen Bäumen bepflanzten Berge nach.
Doch das wahre Tsingtau war die Stätte deutscher Arbeit im Norden und Süden der Chinesenstadt. Nördlich von Tsingtau stand am neuen großen Hafen das Kontor unseres Kaufmanns und südlich das Tsingtau, von dem nach dem Fall der Festung einer der heute Heimatlosen an seine Lieben schrieb:
„Der 7. November 1914 ist der schwärzeste Kalendertag in meinem Leben. Da habe ich die zweite Heimat verloren.
„Wer nie in Tsingtau lebte, kann nicht fühlen, was das schmucke Städtchen war für mich und andere Obdachlose, die jetzt den Verlust ihrer Heimat betrauern. Denkt Euch, Ihr habt einen blühenden Garten! Mit Eurem Sparpfennig und Eurer Hände Arbeit habt Ihr den steinigen Boden gerodet, die gelockerte Erde gedüngt, dann Blumen ausgesät, Bäumchen gesteckt und jedes Pflänzchen mit Liebe und Sorgfalt gepflegt. Ihr freut Euch an dem Knospen und Blühen und seid schon in Sorge, wenn leichter Nachtfrost die Pracht zu vernichten droht. Da braust über die prangenden Blüten ein Gewittersturm und zerknickt, verwüstet, fegt weg, was Fleiß und Liebe mühsam schufen. Dann beschattet Ihr wohl die Augen mit müder Hand, zerdrückt eine Träne und setzt Euch entmutigt ins wüste Feld. — So trauern wir Deutsche um Tsingtau. Die schöne Stadt liegt in Trümmern, und wir meinen, wenn morgen die Sonne aufgeht, müsse sie bestürzt ins Wolkenmeer zurückflüchten.
„Wer dich nie in Sonnenschein sah, Tsingtau, der kennt dich nicht. Wie oft lag ich auf den grünen Hügeln der Stadt und ließ nach Jungenart die Beine in der Luft schlenkern. Waldblumen dufteten zwischen den jungen deutschen Tannen, die erst in Mannshöhe um mich nickten. Unter mir lag wie ein Kinderspielzeug das Städtchen mit Türmen und Zinnen, roten Dächern und Häusern, weiß wie aus Zuckerguß, mit geradlinigen Straßen und blühenden Gärten. Der frische Seewind wehte den Klang von Militärmusik in meine Hügelwelt. „Ich bin ein Preuße“ jubelten die Instrumente, und drunten auf meerbespülten Weiten grünen Wiesenflächen blinkte der Stahl unserer schimmernden Waffenwehr. Vom Hafen riefen die Dampfpfeifen flinker Boote. Dort stampften Maschinen, dort dröhnte im Fallen der Eisenhammer. Ozeanriesen durch, furchten mit Kaufmannsgut die See und — über allem lag der Sonnenschein.
„Die Faust des Krieges schlug vernichtend darein. Wie der Gewittersturm den blühenden Garten, hat sie verwüstet und geknickt, was uns lieb und teuer war. Ohne Heimat sind wir, denn Tsingtau konnte die Heimat ersetzen. Ein echtes Stück Heimat hatten die Bewohner an die Küste von Schantung getragen. Deutsch bis zum innersten Wesenskern, waren sie deutsch in Wort und Lied, in Tracht und Empfinden. In Tsingtau zeigte der Deutsche, dass er in der Fremde deutsche Art und Sitte wahren kann. Da schlug die derbe Faust auf das Holz des Stammtisches, um den Männer zum Skat oder politischer Erörterung saßen. Da jagten sich die Vereinstagungen. Hin und her flogen die Einladungen zum guten deutschen Abendessen, aber nicht „Dinner“, wie es sonst in Asien heißt. Der behäbige deutsche Mittelstand war in Tsingtau heimisch. Es gab wenige Kolonisten, die nicht ihr Haus mit Garten hatten. Drinnen waltete ordnend und wehrend die züchtige Hausfrau als Mutter einer fröhlichen Kinderschar. Sie griff beim Kochen, Waschen und Scheuern, beim Nähen ober Schneidern zu und ließ die rührigen Hände erst sinken, wenn am Sonnabend das Heim gesäubert war.
„Deutsche jedes Standes lebten in Tsingtau: der straffe Offizier und Soldat, der weltkluge Kaufmann, der gewissenhafte Beamte, der fleißige Gelehrte, der Ladner und der Vertreter des Handwerks, das in Tsingtau goldenen Boden hatte. Da stand der Meister unter den Gesellen, — der berußte Schmied, der nachdenkliche Schuhmacher und der beleibte Metzger mit weißer Schürze. Tagsüber arbeiteten sie getrennt, doch der Abend führte sie am Stammtisch zusammen, und Sonntags gingen sie mit den Ihren zum Tanzkränzchen. Dann siegte der deutsche Walzer, oft mit mehr Liebe als Anmut getanzt, über Tango und Two-step, denn die Tänzerinnen waren blauäugige Mädchen, mit blondem Gretchenzopf im Nacken und deutschem Ringlein am Finger — deutsch von Denken wie von Gestalt! Weißt Du noch, Trudchen, als wir Schokolade naschend am Waldrand lagen und Mama mit misstrauisch ängstlicher Stimme ‚Tru—deh‘ rief, aber uns nicht finden konnte? Weißt Du noch, wie an einem Sonntagabend bei der Heimkehr von der Bergwanderung Tsingtau im Purpurglanz der sinkenden Sonne unter uns leuchtete und Du mit leisem ‚Ist‘s nicht herrlich?‘ und leichtem Druck auf meinen Arm zum Stehenbleiben einludst?
„Ja, Tsingtau! Allen, die dich kannten, warst du ans Herz gewachsen. Mit dir haben wir das uns Teuerste auf fremder Erde verloren. Du warst ein nie versiegender Brunnen deutscher Kraft, unser Hort und Halt in dem großen Kampf, den wir mit der Arbeit deutscher Hände, mit den Waffen deutschen Geistes gewinnen wollten. Das Schicksal hat es nicht gewollt.
Du liegst in Trümmern. Doch nur deine Schale, nicht den Kern konnte der Feind zerschmettern. Der goldene Kern war deutsche Art, die auch auf Asiens Erde wieder triumphieren soll und wird!
„Und doch bleibt der 7. November 1914 der schwärzeste Kalendertag in meinem Leben. Da habe ich die zweite Heimat verloren.“
So unser Landsmann! Seine Worte wecken in allen Deutschen das gleiche Empfinden. „Wir hatten gebauet ein stattliches Haus“, das Feindeshand in Trümmer schlug. Aber nicht erst „aus unseren Gebeinen werden die Rächer erstehen“.