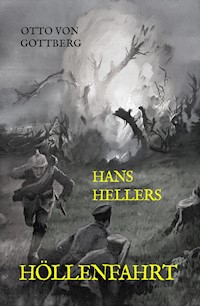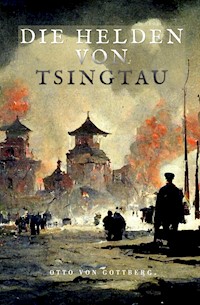Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Admiral Barenheim wird von seinem Burschen unsanft aus dem Schlaf gerüttelt. "Herr Admiral, mit Herrn Kapitänleutnant von Heidebreeg ist was los!" Schnell stellt sich heraus, dass der Bursche nicht betrunken ist, wie der Admiral zunächst mutmaßt, sondern dass mit Heidebreeg in der Tat etwas los ist. Genauer: Er ist tot, hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen – und das auch noch in der weißen Villa Admiral Barenheims. Der Admiral begreift nicht: Wie kann sich Kapitänleutnant von Heidebreeg als guter Soldat das Leben nehmen, wo doch gerade die große Mobilmachung bevorsteht? Hätte er nicht einfach noch etwas warten und sich auf dem Feld der Ehre opfern können, wenn er wirklich lebensmüde war? Doch bald ergeben sich Indizien, die die ganze Sache in einem anderen Licht erscheinen lassen. Eine kleine Kassette mit wichtigen Geheimdokumenten ist verschwunden, Heidebreeg kann sich, wie es sich herausstellt, gar nicht selbst erschossen haben, und dann ist da die Sache mit dem bei ihm gefundenen Taschentuch, das Ada Harder, der Schwägerin des Admirals, gehört, deren Ehe in Trümmern liegt und die im Verdacht steht, mit Heidebreeg Liebeshändel gehabt zu haben. Doch steckt sie vielleicht sogar noch tiefer in der Sache mit drin – eine Affäre, die sich bald als klarer Fall von Spionage herausstellt? Kommissar Vorot beginnt zu ermitteln. Auch Kapitänleutnant Rießthal will unbedingt die Wahrheit wissen, auch wenn sie schmerzhaft werden dürfte: Fühlte er sich doch stark zu Ada hingezogen, träumte schon von einer Ehe mit ihr, und muss nun erkennen, dass er nur ein Tor war, der sich von einer Neigung hinreißen ließ, und Ada "eine Kokette wie allen Frauen" ist und, schlimmer noch, darüber hinaus die mutmaßliche Verbündete einen Spions. Aber ist sie das auch wirklich? Und was ist mit Adas ehemaligem Diener, dem verdächtigen Holländer Carl Hentjen? Ein spannender Militär-Krimi, wie man sie nur selten findet!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto von Gottberg
Die weiße Villa
Roman
Saga
Die weiße Villa
© 1919 Otto von Gottberg
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711529980
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1
Herr Admiral, Herr Admiral!“
Da der Schläfer unbeweglich blieb, beugte Matrose Kirn sich über das Bett und rief noch lauter:
„Herr Admiral!“
Barenheim blinzelte mit den Augen und runzelte die Stirn in Aerger, denn sein Bursche hob gar schon die Hand zum Wachrütteln.
„Herr Admiral, mit Herrn Kapitänleutnant von Heidebreeg ist was los.“
Barenheims Blick glitt von der auf dem Nachttisch stehenden Uhr wieder zum erregten Gesicht des Matrosen. Hatte die Aussicht auf Krieg den Mann um den Verstand gebracht oder ermutigt, über den Durst zu trinken? Warum weckte er vor der befohlenen Zeit? Und was sollte mit dem Ersten Admiralstabsoffizier des Geschwaders „los“ sein? Freilich konnte der Tag kaum früh genug beginnen. Seit dem gestrigen Einlaufen von der Nordlandfahrt war „drohende Kriegsgefahr“ erklärt und bald der Befehl zur Mobilmachung zu erwarten. Mehr ironisch als ärgerlich fragte er:
„Was denn, mein Sohn?“
„Er hat sich erschossen!“
Da richtete Admiral Barenheim sich auf und griff mit unsicherer Hand nach den Kleidern. Während des hastigen Anziehens beobachtete er den Matrosen argwöhnisch. Doch Kirn stand gerade und schritt sicher. Der Bursche war wirklich nicht betrunken, nur erregt. Aber warum sollte Heidebreeg sich am Vorabend einer Mobilmachung erschiessen? Der Kapitänleutnant war als Soldat geschätzt, als Mensch beliebt und sprach gestern, während der letzten Mahlzeit an Bord, noch in froher Ungeduld von seinem Hoffen auf Krieg und die erwartete Beförderung zum Stabsoffizier. Nachmittags hatte Barenheim mit ihm und dem Zweiten Admiralstabsoffizier Riessthal über Mobilmachungsvorschriften gesessen, bis das Flaggschiff zum Kohlen in den Heinrichshafen fuhr. Da nahm er den Stab in seine weisse Villa am Kanalufer mit, um den Behörden an Land und namentlich dem Telegraphenamt nahe zu sein. Um zwei Uhr morgens ging Riessthal an Bord. Heidebreeg bat um Erlaubnis, sich bis fünf Uhr unten im Arbeitszimmer auf dem Ledersofa ausstrecken zu dürfen. Jetzt schloss der Admiral die Knöpfe des blauen Bordjacketts und fragte: „In meinem Zimmer?“
Der Matrose stand straff:
„Jawoll, Herr Admiral. Wie ich eben um Fünfe zum Wecken in die Stube komme, liegt er mit ’ne Kugel im Kopf aufs Sofa und daneben der Revolver!“
Kopfschüttelnd hastete Barenheim mit dem Burschen über die Treppe ins Erdgeschoss. Durch die noch offene Tür zum Arbeitszimmer sah er an der Wand gegenüber Heidebreeg auf dem Ledersofa mit dem Gesicht zur Rückenlehne liegen. Schnell trat er hinter das linke Seitenpolster und beugte sich über des Kapitänleutnants Kopf. Die Stirn trug eine runde kleine Wunde, um die nur wenig Blut geronnen war. Ein Revolver lag neben der linken Hand und schien der auf leicht angezogenen Knien ruhenden rechten entfallen. Im Zimmer hing mit des Vorabends schwüler Hitze muffiger Tabaksgeruch. Die Fenster waren über Nacht geschlossen geblieben.
Barenheim legte die Finger auf Heidebreegs Stirn. Sie war kalt, und die Berührung brachte ein Erschauern. Gewiss begann bald eine Zeit grossen Sterbens, doch erschütterte der Verlust eines treu ergebenen und befreundeten jungen Offiziers in elfter Stunde vor der grossen Fahrt. Damit regten sich Zorn und Aerger. Warum hatte der Tote nicht gewartet, bis der Kampf ihm Gelegenheit zu einem soldatischen Ende bot? Auch kleinliche Gedanken huschten durch das Hirn. Konnte Heidebreeg zum Sterben keinen anderen Ort als das Haus der Frau eines stets wohlwollenden Vorgesetzten wählen? Dann dachte er nur noch als Befehlshaber, hiess den Matrosen die Fenster öffnen und wies ihn aus dem Zimmer. Im Korridor schloss er die Tür ab, steckte den Schlüssel in die Tasche und befahl: „Sie laufen schleunigst zum Schiff und holen Kapitänleutnant Riessthal. Er soll den Oberstabsarzt und den Kriegsgerichtsrat rufen lassen!“
„Zu befehlen, Herr Admiral.“ Der Mann machte kehrt und wollte die Haustür aufklinken. Doch war von innen abgeschlossen. Der Admiral sah ihn den Schlüssel drehen, kam nach und ging als erster über die drei Stufen in den Garten. Ein Matrose auf Posten präsentierte das Seitengewehr.
„Haben Sie während der Nacht einen Schuss gehört?“
„Nein, Herr Admiral!“ Dachte der Geschwaderchef, der Feind könne über Nacht bei Emden gelandet sein?
„Nichts, gar nichts Ungewöhnliches, mein Sohn?“
Der Verblüffte schüttelte den Kopf: „Nein, Herr Admiral, nur viel Donnern. Es hat gewittert.“
„Weiss ich.“ Auch ihn hatte das Wettern geweckt. Noch hing in der Luft feuchte Schwüle, die einen neuen heissen Tag ahnen liess. Er ging um das Haus und befragte den zweiten Posten. Auch der Obermatrose hatte keinen Schuss gehört und keinen Menschen im Garten gesehen. Wenn Heidebreeg sich wirklich erschossen hatte, musste er den Revolver während eines Donnerschlages abgedrückt haben. Doch Barenheim mochte an Selbstmord nicht mehr glauben. Um dem Klatsch den Weg in die Stadt zu sperren, schärfte er beiden Posten ein, niemand aus dem Haus zu lassen, und mahnte sie, auch auf die nur von innen zu öffnende Tür des Eiskellers im Gebüsch neben der rechten Seitenmauer des Hauses zu achten.
Dann ging er wieder nach oben und war für den Tag angekleidet, als Kirn das Kommen Riessthals meldete. Schon von der Treppe sah der Admiral den Kapitänleutnant mit dem Oberstabsarzt Doktor Kundrich und Kriegsgerichtsrat Lund in der Halle flüstern. Ihre ernsten Mienen erzählten, dass der Bursche von dem traurigen Geschehen gesprochen hatte. Verstört standen auch des Hauses Dienstboten in der offenen Tür vor den Stufen zu Küche und Eiskeller. Barenheim befahl ihnen, die Damen zu wecken und bat die drei Herren ins Arbeitszimmer. Seine Hand wies zum Sofa. Doktor Kundrich beugte sich über Heidebreeg und griff nach den Schultern, als wolle er die Leiche auf den Rücken betten.
„Verzeihung, Herr Stabsarzt,“ wehrte der Kriegsgerichtsrat, „ehe Sie ihn berühren, sind Tatbestand und Befund aufzunehmen!“
Kundrich legte die Finger auf die Stirn des Toten und zuckte die Achseln:
„Zu helfen wäre auch nicht. Er muss über zwei Stunden tot sein, denn das Blut ist geronnen.“
Riessthal trat auf Fussspitzen an das Sofa und schüttelte in schmerzlichem Staunen den Kopf. Der Tote war ihm ein lieber Freund und Kamerad langer Jahre gewesen, aber hatte neuerdings oft seine Eifersucht geweckt. Den Groll darüber bat er ihm ab und verschlang die Hände zu kurzem Gebet. Das Gesicht wieder ins Zimmer kehrend, sah er auch den Geschwaderchef auf die Leiche starren. Barenheims sonst glatte weisse Stirn über dem wetterbraunen Gesicht trug Furchen von Unmut. Jetzt straffte er zu voller Höhe die schmale Gestalt, die in der knappen blauen Uniform mit breiten goldenen Aermeltressen noch jugendlich schlank und biegsam aussah. Seine schmale Hand strich über des Scheitels gepflegtes Dunkelblond, das ein erstes Grau über den Ohren nur zu verjüngen schien, und die Stimme schnitt mir scharfer Helle in das Schweigen: „Meine Herren, ich glaube nicht an Selbstmord. Heidebreeg war zu guter Soldat, um sich vor der Mobilmachung zu erschiessen.“
Riessthal nickte überzeugt. Im dienstlichen Verkehr zweier Jahre hatte er gelernt, sich des verehrten Vorgesetzten Anschauungen blindlings zueigen zu machen. Doch der Kriegsgerichtsrat wiegte den Kopf, als wolle er sagen, Heidebreeg könne nur durch einen Schuss von eigener Hand gestorben sein. Er öffnete schon die Lippen, als der Bursche ins Zimmer trat:
„Die Damen sind geweckt, Herr Admiral!“
Barenheim überhörte die Meldung. Sein nachdenklicher Blick folgte dem Zeigefinger des über die Leiche gebeugten Kriegsgerichtsrats, der auf das Sofa wies.
„Hier liegt doch der Revolver!“ Lund nahm die Waffe und sah hinein: „Fünf Kammern sind noch geladen. Eine Patrone ist abgeschoffen. Festzustellen bleibt, ob die Waffe dem Toten gehörte.“
Der Matrose reckte den Hals. Der von Erregung, Laufen und schwüler Hitze glühende Kopf nickte lebhaft. Seine Hand wies auf einen Koffer, eine Ledertasche und einen Mantel zwischen allerhand Ausrüstungsstücken auf dem Fussboden bei der Tür: „Die Sachen brachte der Bursche von Herrn Kapitänleutnant von Heidebreeg nachts aus der Stadtwohnung her, weil es schon zu spät war, sie an Bord zu tragen. Ich half dabei und legte auf den kleinen Eisenkasten den Revolver, den Herr Kriegsgerichtsrat jetzt in der Hand hält!“
Riessthal konnte bestätigen: „Auch ich war zugegen. Heidebreeg meinte noch, es sei ihm peinlich, dass er den Kram ins Haus des Herrn Admiral schleppen müsse. Dann fragte ich nach dem Inhalt der kleinen Kassette.“
Vier Augenpaare suchten den Kasten vergeblich. Der Bursche schien zu erschrecken, kniete nieder und kramte zwischen des Toten Habe. Kopfschüttelnd richtete er sich wieder auf und stammelte verstört:
„Herr Admiral, ich habe wahrhaftig nichts angefasst und genommen!“
„Behauptet niemand, mein Sohn!“ Barenheim sah jetzt Riessthal in die Augen: „Was war in dem Kasten?“
Der Admiralstabsoffizier nahm Haltung: „Heidebreeg sprach von ein paar Schmucksachen, etwas Bargeld und mehreren tausend Mark in preussischer Staatsanleihe, die er heute vor dem Einschiffen zur Bank schicken wollte.“
„Na also,“ kam mit einem Aufatmen der Erleichterung von den bartlosen Lippen des Geschwaderchefs. Jetzt sah er mit dem Blick wehmütiger Trauer auf den toten Untergebenen. Selbstmord am Vorabend des Krieges hätte er einem Offizier nicht verziehen. Nun zürnte er sich, dass Heidebreegs Tod ihn nicht mehr erschütterte. Doch die Gedanken waren schon bei der grossen Fahrt. Ein Menschenleben galt wenig, wenn die Knöchel zum Würfeln um Völkerlos rollten.
Der Kriegsgerichtsrat griff unter des Toten linken Ellbogen und drehte sich mit einem blutdurchsickerten Taschentuch zwischen den Fingerspitzen zum Geschwaderchef: „Das ist allerdings ein Fund, der Herrn Admirals Ansicht bestätigen könnte!“
Der Oberstabsarzt nickte:
„Erklärt auch die geringe Blutung, die nach dem Schuss wahrscheinlich mit dem Taschentuch gestillt wurde.“
Also konnte von Selbstmord keine Rede mehr sein. Der Admiral warf sich in einen der Ledersessel. Grübelnd sah er auf die Linien im Muster des dunklen Perserteppichs vor dem Sofa: „Sehe ich da Flecken?“
Der Oberstabsarzt liess sich auf die Knie herab, stützte die Linke auf den Fussboden und rieb mit dem rechten Zeigefinger auf dem Teppich. Kurz atmend, stand er wieder auf:
„Blutflecken, Herr Admiral!“
Fast schien es, als freue er sich der Entdeckung. Die drei anderen sahen einander in die Augen. Der tödliche Schuss war also nicht gefallen, während Heidebreeg auf dem Sofa lag. Wahrscheinlich während eines Donnerschlages traf ihn die Kugel, als er auf dem Teppich stand. Dann hemmte der Mörder die Blutung mit dem Taschentuch, schleppte die Leiche auf das Lager und bettete sie mit dem Revolver neben der Hand wie die eines Selbstmörders. — —
Barenheim sah auf Lund, als erwarte er eine Frage.
„Befehlen Herr Admiral, dass ich die Hausbewohner vernehme?“
„Allerdings, Herr Kriegsgerichtsrat!“ Niemand wusste leider besser als er, dass der Mörder in seinem eigenen Haus zu suchen war. Um es noch zu betonen, erklärte er, dass beide Haustüren über Nacht von innen verriegelt gewesen waren, dass er ferner mit Heidebreeg vor dem Schlafengehen die Fenster im Erdgeschoss geschlossen und endlich gegen sonstigen Brauch zwei Posten vom Flaggschiff in den Garten befohlen hatte. Da er von früherer Tätigkeit im Admiralstab die Rührigkeit des fremden Nachrichtendienstes kannte, hielt er erhöhte Vorsicht während der Mobilmachungsvorarbeiten für geboten und hatte nach zwei Uhr früh vor den Augen von Heidebreeg und Riessthal die vom Flaggschiff „Tirpitz“ mitgebrachten Geheimpapiere im obersten Schubfach des Schreibtisches mit eigenen Händen verschlossen.
Unwillkürlich griff er nach dem Schlüssel in seiner Tasche, als er dem Burschen befahl, die Dienstboten zu rufen und die Damen zu bitten.
Dann lehnte er sich im Sessel zurück:
„Einstweilen nehmen Sie wohl meine Angaben zu Protokoll!“
Der Kriegsgerichtsrat sah sich nach Schreibzeug um. Riessthal trat an des Admirals Diplomatentisch, nahm Kanzleipapier und legte die Bogen auf eine Unterlage von weissen Löschblättern. Plötzlich warf er den Kopf zurück und hob die Unterlage zu staunenden Augen. Seine Stimme bebte leicht, als er mit dem Zeigefinger auf dem obersten Löschblatt zum Admiral hastete:
„Ich weiss, dass ich, um keine Vorsicht zu versäumen, nach dem Niederschreiben der letzten Befehle durch Heidebreeg ein Blatt von der Unterlage riss, weil beim Abdrücken die Tinte einiger Buchstaben oder Worte haften geblieben war. Jetzt trägt das oberste Blatt neue Abdrücke, und zwar nicht von Heidebreegs eckiger, sondern einer runden, mehr flüssigen Hand. Ueber Nacht hat hier jemand geschrieben, Herr Admiral!“
Barenheim riss ihm die Unterlage aus der Hand und ging zum Fenster:
„Mein Vergrösserungsglas!“
Der Bursche brachte die Lupe vom Schreibtisch. Der Geschwaderchef hielt sie vor die Augen und erkannte halbe Worte. „Molt ..“ konnte nur „Moltke“ heissen, „. . . . . linger“ war „Derfflinger“ und „Seydlitz“ ganz und gar zu lesen. Auch die Zahlentabelle oben in der rechten Ecke musste aus den Mobilmachungsakten abgeschrieben sein.
Er glaubte ein Rinnen von eisigem Wasser in den Adern zu spüren. Mit den Papieren waren dem Verbrecher wichtige Geheimnisse der deutschen Seekriegführung in die Hände gefallen. Seine Schlüssel aus der Tasche nehmend, schritt er durch das Zimmer und öffnete den Schreibtisch. Im oberen Mittelfach lagen die Akten, aber nicht geordnet wie beim Verschliessen. Hastende Hände hatten die Papiere durcheinander geworfen. Er riss das Bündel heraus und blätterte.
„Einen Augenblick, Herr Admiral.“
Riessthals unsicherer Finger wies auf einen Tintenfleck:
„Der war nicht hier!“
Barenheim nickte, liess die Papiere auf die Platte fallen und starrte vor sich hin. Endlich drehte er ein ernstes Gesicht ins Zimmer. Seine Stimme war streng wie immer, aber die Haltung müde: „Herr Kriegsgerichtsrat, wir haben in meinem Hause einen Spion zu suchen.“
Dann ging er zum Sessel zurück. Der Kriegsgerichtsrat setzte sich an den Schreibtisch. Der Geschwaderchef gab an, wie er seinen Ersten Admiralstabsoffizier nachts verliess und morgens fand, und erzählte, er habe natürlich einen Selbstmord für möglich gehalten, bis das Fehlen der Kassette Raub und Totschlag vermuten liess. Jetzt wäre leider mit einem Spion zu rechnen. Wahrscheinlich hatte der Verbrecher sich schon vor längerer Zeit einen zweiten Schlüssel zum Schreibtisch verschafft. Als er nachts ins Zimmer schlich, erwachte der Kapitänleutnant gewiss und sprang auf. Das Unheil wollte wohl, dass gerade ein Donnerschlag fiel. Ungehört verhallte darum der Schuss, der Heidebreeg niederstreckte. Dann drückte der Mörder das Taschentuch auf die Stirnwunde und schleppte den Toten auf das Sofa, um einen Selbstmord vorzutäuschen.
Der Kriegsgerichtsrat schrieb und der Admiral setzte seinen Namen auf das Protokoll. Der Bursche, Matrose Kirn, zitterte wieder, als er auf einen Wink neben den Schreibtisch trat: „Ich weiss nichts und kann nichts sagen, un hab’ in meine Kammer unterm Dach fest geschlafen, bis ich zwanzig Minuten vor Fünf das Schnarren von de Weckuhr hörte!“
„Was Sie später erlebten, wollen wir wissen,“ mahnte Lund.
„Nu, Herr Kriegsgerichtsrat, zieh’ ich mir schnell an un lauf’ die Treppe runter. Wie ich hier dreimal feste ankloppe un nichts höre, mach’ ich die Tür auf un sehe Herrn Kapitänleutnant schlafen. Da ruf’ un ruf’ ich denn, un wie er immer noch nichts sagt, will ich ihn bei de Schulter rütteln un geh’ ans Sofa. Da krieg’ ich ’n Schreck, weil doch die Stirn blutet und neben der linken Hand der Revolver liegt. Da mach’ ich schnell nach oben zu Herrn Admiral!“
Die Frage, ob das Knallen eines Schusses zu hören gewesen sei, verneinte wie Kirn auch die Köchin Berta Walter, als nächste Zeugin. Die Redeflut der dicken Vierzigerin konnte Lund kaum hemmen. Sie schilderte, wann und wie sie zur Ruhe gegangen war. Bald habe ein Donnerschlag sie wieder aus dem Schlaf geschreckt und dann das Lärmen des Gewitters ihren Schlummer bis in den hellen Morgen gestört. Geärgert hatte sie sich oft über das ununterbrochene Schnarchen des Dieners der Schwägerin des Admirals in der Kammer neben der ihren.
Das stete laute Sägen Carl Hentjens war auch das einzige Geräusch, von dem Emma Kirlitz und Anna Berliner, die jenseits der anderen Wand des Dienerzimmers schlafenden Stubenmädchen, berichten konnten. Noch beim Ankleiden um sechs Uhr früh hatten sie darüber gelacht.
Die Jungfer der Schwägerin des Admirals gab nur an, die Stubenmädchen hätten sie mit der Nachricht vom Selbstmord des Kapitänleutnants aus ungestörtem Schlummer geweckt.
Endlich trat Carl Hentjen an den Schreibtisch. Verbeugung und Erscheinung waren die eines gutgeschulten, selbstsicheren, aber bescheidenen herrschaftlichen Dieners. Der stattliche Dreissiger mit kahlen Lippen und kurzen semmelblonden Bartstreifen neben beiden Ohren stand stramm wie ein Soldat, aber neigte artig das rechte Ohr, als könne er nicht früh genug die erste Frage hören. Ehe Lund sie stellte, sprach der Admiral:
„Ich mache darauf aufmerksam, dass der Mann nicht Deutscher, sondern Holländer ist!“
Es klang, als wollte er einen Verdacht wecken. Doch das kluge Gesicht des Zeugen blieb