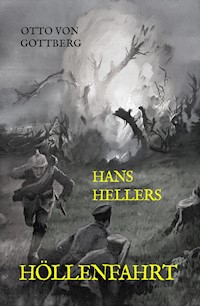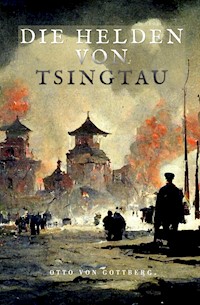Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Detailliert und mit viel Pathos erhält der Leser einen Einblick in den Kriegsalltag der kaiserlichen Marine. Eine neue Waffe gewinnt zunehmend an Bedeutung und zeigt die Verwundbarkeit ehemals mächtiger Panzerkreuzer. U-Boote, auch als "Schwarze Waffe" bezeichnet, versetzen die Kriegs- und Handelsschiffahrt mit lautlosen Torpedos in Furcht und Schrecken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kreuzerfahrten und U-Bootstaten
von
Otto von Gottberg
______
Erstmals erschienen bei:
Ullstein & Co, Berlin / Wien, 1915
_____________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2016 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-015-1
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Graf Spee
S. M. S. „Karlsruhe“
S. M. S. „Ayesha“
Unsere Kreuzer im Mittelmeer
Der Kampf um die Dardanellen
Unsere Kreuzer im Schwarzen Meer
Das Kreuzergefecht vom 24. Januar
Unsere Vorposten auf der Nordsee
Die schwarze Waffe im Kampf
Die Marine in Feldgrau
U-Boots-Fahrt an den Feind
„U 21“
Die saubere Arbeit von „U 16“
Neue U-Boots-Beute
Graf Spee
Die Schiffe, die schon im Frieden den eigenen überseeischen Handel und Besitzschirmen, sollen im Krieg feindlichen Besitz und Handel schädigen. Unser Kreuzergeschwader und wenige Stationäre erfüllten die Aufgabe weit über menschliches Erwarten und deutsches Hoffen, obwohl sie zu wenig Stützpunkte fanden, um dauernd ihrem Kriegszweck zu leben. Sie vollbrachten und vollbringen Wunder auf Fahrten, die, ob nach Nord oder Süd, nach Ost oder West, doch früher oder später zum Ende führen. Bewusst fuhren die Männer auf ihren Planken zum Grab, aber auch zum Ruhm, denn laut und der Mannschaft jubelnde Begeisterung weckend sagte der Kommandant der „Nürnberg“: „Unser Schiff mag unser Sarg werden!“ Wohl nie, seit Menschen in Schiffen zu Wasser gingen, hat ein seefahrendes Volk freudiger und fester das navigare necesse est mit Taten bejaht. Als gehetztes Wild endlich von feindlicher Übermacht gestellt, hat kein noch so kleines Schiff „die weiße Flagge“ gezeigt. Auf allen fand der Gegner das Adlertuch an den Mast genagelt, und bis die Mäuler der Geschütze Wasser tranken, rief deutsches Eisen ihm das harte vivere non est necesse ins Gesicht. So sank, kämpfend und Flaggen geheißt, auch der Führer des Kreuzergeschwaders.
Graf Spee war Kind eines die Söhne gern dem Klerus gehenden rheinischen Geschlechts und nach Herkunft wie Erziehung der See und dem Dienen noch fremd, als er im Jahre 1878 die Reise zur Kadettenprüfung in der alten Kieler Marineschule machte. Weder dem Seekadetten noch dem jungen Offizier sprach berufenes Urteil soldatisches oder seemännisches Genie zu. Er galt nicht als von Natur sonderlich begabt, wohl aber früh als Mann von Charakter. Sein Charakter setzte sich durch und ertrotzte sich durch hartnäckigen Fleiß und ernste Arbeitsfreude beim Studium die Gaben, die Glücklichere in der Wiege gefunden hatten, bis endlich das dienstliche Urteil den gereiften Mann und Seeoffizier „zu den höchsten Führerstellen befähigt“ nannte. Ein ganzer Mann, tat er Begonnenes stets so sehr ganz, dass die äußere Gestaltung seines Schicksals, ja sein Ende, schließlich des Charakters Eigenart bejahen und bestätigen muss. Nicht nur für seine Person verschreibt er sich dem Dienst und der See. Sein ganzes Haus muss Königsgesinde werden, und beide Söhne folgen ihm — ein in der Marine seltener Fall — in den neuen fremden Beruf. Sie begleiten ihn auf dem Wege, der nur zum Ende führen kann, und als er fällt, fällt mit ihm sein Haus. Mit Maus und Mann sinkt sein Schiff. Zwei Söhne sinken mit. Ein Geschlecht erlischt. Vom Stammbaum bricht der ganze Ast. Der Zweig, der zur See gegangen, gehört ihr ganz und liegt auf ihrem Grund. Voll und ganz, ein wahrer Seeoffizier, hatte Graf Spee schon bei Lebzeiten sich der See gegeben. Den von geliebter Lebensgefährtin auch mit einer Tochter Beschenkten brachte jede Heimkehr in ein Haus schönen Familienglücks, aber sein Dienstleben war eine Kette von Bordkommandos, um die er sich oft bewarb. In Stunden, die er nicht dem Dienst oder Studium widmete, segelte er gern. An eine Jacht hätte der Arbeitsfreudige Zeit und Geld wohl auch als Millionär nicht verschwendet, aber wenn draußen in fremder Welt ein catboat zur Hand lag, saß er bald drin und spürte in den derbknochigen, vierkantigen Händen gern das Zerren geblähter Leinwand am Tau. Er liebte wohl die See, wie der wahre Seemann sie liebt, nämlich oft mit Leidenschaft, aber stets auch Misstrauen oder gar etwas Verachtung. Schön ist sie mit dem blanken, wogenden Busen und darum begehrt. Aber allen feil, muss sie viele tragen und hegt darum Dirnenhass gegen den Mann. Sie wiegt und kost ihn und singt ihm allabendlich das Schlummerlied, aber unter ihrer glatten Stirn lauert verräterisch der Wunsch nach Rache und Mord. Die Treulose nimmt Liebe, ohne Liebe zurückzugeben. Darum traut ihr am wenigsten der Seemann, der sie kennt.
Wie wenige Seeoffiziere kannte Graf Spee die Treulose, die sein Leben nahm. Fast immer war er draußen und dabei, wenn über afrikanischem oder asiatischem Land zum ersten Mal der schwarze Adler in weißem Flaggentuch den scharfen Schnabel hob. So schenkte er den jungen Kolonien das Herz und galt schon bei jungen Jahren ihren Bewohnern als Mann von Verständnis für unseren Überseehandel.
Der gereifte Soldat und befahrene Seemann befehligt im Jahre 1905 als Flaggkapitän des ersten Geschwaders das Linienschiff „Wittelsbach“, wird bald Admiral und nun der Graf Spee, den die Marine einen ihrer Besten nannte und betrauert mit den Worten: „Es hat mancher viel Gutes, aber nie einer Schlechtes von ihm gesagt!“
Hochaufgeschossen, breitschulterig und derbknochig geht er hallenden Schrittes über sein Schiff, in einer Haltung, die glauben lässt, er habe einen Ellenstock verschluckt. Die blauen Augen blicken heiter, denn in einer tiefen, gern zum Glauben sich bekennenden Religiosität wurzelt des Charakters heiter frohsinnige Weltanschauung. Sie macht ihn zu einem fröhlichen, aber doch Feste und Gastereien gern meidenden Gesellschafter und bringt Kameraden wie Untergebenen Wohlwollen dar. Er hat die freie, gern lächelnde Würde und das schlicht natürliche, sichere Auftreten, das neben naiven Kindern der Wildnis oft gebotenen großen Herren eigen. Als solchen fühlt Graf Spee sich ohne Dünkel, aber auch mit der Überzeugung, dass die Welt und Menschheit eine kleine ist. Er muss ihr oft freundlich oder aufmunternd auf die Schultern klopfen.
Doch die blauen Augen unter voll und vierkantig um die breite Stirn wucherndem, dunkelblondem Haar können scharf, streng und stahlgrau funkeln. Wenn dann mit jähem Ruck und lautem Wort der Graf sich nach rechts oder links wendet, oder das kantige Kinn mit dem Spitzbart hebt, ist mit ihm nicht zu spaßen. Auch das Kinn hebt er mit einem Ruck, und jede seiner Bewegungen ist ein Ruck. Die weiche, gefällige Geste fehlt dem Derben und Harten, an dem Knochen, Glieder und Kopf eckig und vierkantig sind. Auch dem Wesen ist biegsame Geschmeidigkeit fremd. Niemals ein Jasager, ist er für Vorgesetzte ein bequemer Untergebener nur insofern, als er auch den entschiedensten Widerspruch in die guten Formen des Mannes bester Kinderstube kleidet.
Wenn er zu dienstlicher Beratung als Führer oder Untergebener am grünen Tisch sitzt oder auf der Brücke sieht, ist oft schwer mit ihm rechten. Berufserfahrung und Diensteifer haben ihn jetzt zu scharfem, klarem und klugem Denken geschult. Ist es zu einem Entschluss gekommen, dann legt der Hartwillige auf Widerspruch die geballte vierkantige Faust auf die Platte. Es ist, als hielte sie die eigenen Gedanken mit dem fast trotzigen Vorsatz, sie nicht zu lassen. Doch der leicht gegen die Hand gesenkte derbknochige Kopf bleibt Erwägungen offen, und wenn der Chef des Stabes des Admirals Gedanken mit wirklich zwingenden Einwänden begegnet, löst sich die Faust. Der Graf lässt sich überzeugen, hebt ohne Unwillen den Kopf und spricht ehrlich sein freundliches: „Sie haben recht!“
Ehrlichkeit und Gerechtigkeitsliebe, „ruum Hart un‘ klar Kimming“1, gewannen dem Toten ein Vertrauen, das ihn oft zum Vermittler in Konflikten wählte. Als solcher gern gesehen war der Chef des Stabes der Marinestation der Nordsee namentlich, wenn in Wilhelmshaven die Anschauung von Garnison und Bevölkerung auseinanderplatzte.
Weltmann und weltkundig, ein liebenswürdiger Gesellschafter, der Menschen und ihre Neigung gewann, ein strenger Soldat, der Schiff oder Geschwader mit eiserner Hand hielt, und ein Seemann von Verständnis für Handel und Geschäft, wurde er als Berufener der Führer unseres Kreuzergeschwaders und namentlich von den Deutschen am selben Meer als alter Bekannter mit viel Freude begrüßt. Kein Zinnsoldat, hielt er seine Schiffe nicht dauernd für Drill und Exerzieren beisammen, sondern stellte sie klug in den Dienst unseres Überseehandels bis zum großen Krieg, den die Legende ihn ahnen ließ mit den Worten: „Dann kann ich nur versuchen, möglichst viel Briten auf dem Grund des Meeres zu treffen!“
Den Befehl zur Mobilmachung las der Vizeadmiral auf hoher See, während er mit „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ auf der Reise zu unseren Kolonien in der Südsee war. Seine Fahrzeuge waren über die Meere zerstreut. Die Zeit, da der Wind Großen wie Kleinen wehte und der Ozean verschwiegen war, ist nicht mehr, weil von den Masken aller Kriegsschiffe geschwätzige Funken knattern. Trotzdem gelang ihm das Meisterstück, fünf unserer von Feinden gesagten Kreuzer unter seiner Flagge zu vereinigen und mit ihrer vier vor Santa Maria das Geschwader des Admirals Craddock vernichtend zu schlagen.
Als da, zwischen Nachmittag und Abend des 1. November 1914, der Sieger von Santa Maria den Namen der Grafen v. Spee in die Ehrentafel der großen Kapitäne der Weltgeschichte grub, schrieb die derbknochige Hand zugleich das eigene Todesurteil. Er wusste, wie wir daheim, das durch eine Niederlage auf See vor der Welt gedemütigte Britannien werde alle verfügbaren eigenen und verbündeten Schiffe aufbieten, um jede Straße zu verlegen und ihm mit unbezwingbarer Übermacht ein Ende zu bereiten. Wenn Graf Spee leben, sich retten und seines Ruhmes freuen wollte, bot sich ihm nur der eine und einzige Weg, der mit hoher Fahrt in einen neutralen Hafen und zur Internierung für die Dauer des Krieges führte. Aber vivere non est necesse, dachte auch der harte vierkantige Mann, der nun zum Helden wird durch den hochgemuten Entschluss, bis zum gewissen, bitteren, nein schönen Ende dem Gegner Wunden zu schlagen. So fährt er dem Löwen in den Rachen, nämlich dem Feind vor einer seiner Kolonien zu neuem Kampf entgegen. Zwei Dreadnoughtkreuzer, deren jeder sein ganzes Geschwader vernichten kann, überraschen ihn im Gefecht. Da ist das Lied zu Ende. Er schickt die Kleinen seiner Schiffe davon. Ihn aber sehen wir aufrecht auf der Brücke von „Scharnhorst“ — hochaufgeschossen, vierkantig und derbknochig, als ob er die Elle verschluckt habe, aber doch ein großer Herr und ein großes Herz, das vornehm und freudig das Leben von „Scharnhorst“ und „Gneisenau“ für die Brüder auf „Leipzig“, „Dresden“ und „Nürnberg“ gibt. Ganz wie er alles tat, genügt er soldatischer Ehre und Pflicht und sinkt wohl heiter, wie er im Leben war. Er glaubte sich himmlischen Lohnes gewiss, war eben von der Göttin des Sieges geküsst, und noch frisch grünte der Lorbeer, den er pflücken durfte. So sterben Soldaten leicht, denn Herrlicheres als den ersten Sieg haben Schicksal und Dasein ihnen nicht mehr zu bieten. Gern nehmen sie auch ihre Söhne und Erben auf so große Fahrt, weil Name und Haus nun unsterblich sind.
„Ist es nicht schön, dass der eigene Vater meine lieben Kinder erst zum Sieg und dann in den Tod führen durfte?“ schrieb mit deutschen: Frauenstolz die Gräfin einer Freundin. Ja, sie war schön, wunderbar schön, obwohl tragisch, die letzte Fahrt der Grafen v. Spee, die zur See gegangen!
Mit stolzem, eines Admirals gar würdigem Gefolge trat der Tote droben vor unsere hochseligen Herren und ihre Helden. Steif und eckig, als habe er eine Elle verschluckt, aber auch ein unbefangener großer Herr, meldete er: „Majestäten, der erste Seesieg unter der neuen Flagge gewonnen“, und hörte die Generale Scharnhorst und Gneisenau ihrem König Friedrich Wilhelm III. berichten, Vater Blücher werde nicht warten lassen. Jetzt ist er droben, und die Schiffe, die den Namen und Geist von Helden der Befreiungszeit trugen, liegen drunten. Die drei gaben bei Lebzeiten keinen Kampf auf, aber waren auch sonst Soldaten von Anstand und Ehre, die den Verbündeten von Leipzig und Belle-Alliance ein Stück ihrer treuen Herzen schenkten. In redlichem Kampf um ehrliche Sache hätten sie trotzdem mit den Freunden von damals freudig Klingen gekreuzt. Aber weil die Heere des Königs von England und des Zaren für die Sache von Fürstenmördern im Felde stehen, sind die Helden unserer Befreiungszeit in Scham über die Waffengefährten von einst auf den tiefsten Grund des Meeres gegangen.
1 Altes deutsches Seemannswort: Offenes Herz und klarer Verstand.
S. M. S. „Karlsruhe“
Es schien ein Festtag. Zum Fest der Weltausstellung in San Franzisco und der Kanaleröffnung in Panama geschickt, glitt als schmuckes Schiff der neueste Kreuzer „Karlsruhe“ im Juni vorigen Jahres von Brunsbüttel durch die Hochseeflotte auf die Nordsee. Dreiundsechzig Hurras gab, beneidet und beglückwünscht, die Besatzung aus bald heiseren Kehlen zurück. Lustig spielte die Bordkapelle, und über blanken Instrumenten wippten gar die bunten Haarschweife eines Schellenbaumes. Das blütenweiße Sonnensegel über dem Achterdeck war der Stolz eines Ersten Offiziers, der sein Schiff zu putzen, aber auch einzukaufen, ja, zu handeln verstand. Zehn Pfennig forderte acht Tage früher der Amtsbruder auf „Hohenzollern“ für jeden abgelegten Strohhut der Kaiserjacht, der draußen auf dem Pazifik, wo morgens der Tradewind — frisch wie Quellwasser und würzig wie Wein — pünktlicher als in Berlin der Bollejunge kommt, den Kopf eines Matrosen der „Karlsruhe“ bedachen sollte. Doch nur fünfeinviertel Pfennig gab es für den Hut, als das Geschäftchen richtig war, und der verlorene viertel Pfennig dürfte den ersten Offizier der „Karlsruhe“ noch heute dauern, denn er wollte nicht mehr als einen halben Groschen für den Deckel opfern. Weil über dem Handeln jedoch die Stunde der Ausreise kam, zahlte er unter Protest, den er in einem letzten vor Brunsbüttel ins Postboot geworfenen Brief einlegte. Die Antwort stand bis Aschermittwoch noch aus. Die „Karlsruhe“ kam nie nach Veracruz, ihrer nächsten Poststation. Der Krieg brach aus. Das Schiff lief keinen bewohnten Hafen an. Bis zum Abgehen der Briefe, die es am Tage nach Fastnacht schickte, hatte niemand an Bord von den Seinen gehört. Das wirft ein Schlaglicht auf den Kreuzerkrieg.
Die Sommersonne schien warm. Aus faltenlos glattem Gesicht lachte der Atlantik friedlich wie selten, und schöne Tage kamen auf den Azoren mit Ausflug, Bordfest und Fußballspiel. Bei flinker Fahrt quer über den Ozean nach St. Thomas ging der Ölvorrat auf die Neige. Dort trug während des Kohlens am 16. Juli ein Funkspruch Kunde von der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand ins Schiff. Die Musik brach ab, und: „Bald tut sich was“, rannten die politisch Weisen an Bord. Aber der stille Abend brachte eine kleine Freude mit der Nachricht, in Port au Prince sei Revolution ausgebrochen und das Erscheinen des Kreuzers nötig. „Karlsruhe“ dampfte hin, aber fand auf Haiti Friedhofsruhe. überrascht hat‘s niemand, denn nach Erfahrung vertagen Revolutionäre von Negerstaaten ihre Umwälzungen, wenn ein Kriegsschiff seine Schornsteine zeigt. Immerhin lag allabendlich das Landungskorps klar, und während kurzer Tropennacht fegte der silberne Strahlenbesen des Scheinwerfers — ein Rätsel und Schrecken aller Schwarzen — die flachen Strohdächer von Port au Prince und die hohen Palmenkronen der Nachbarschaft ab. Bei Tage wanderten Matrosen im weißen Päckchen hinter wippendem Schellenbaum und dröhnender Musik singend zu schattigen Wäldern, in denen es einmal gar ein Tänzchen gab. Die Offiziere plauderten auf der Veranda des Konsulats mit dem Konsul und seiner Schwester, saßen im deutschen Klub und waren den Gastgebern namentlich dankbar, weil sie auch der Mannschaft ihre Räume öffneten. Als schließlich Scheinwerfer und Landungskorps ruhen konnten, lief die „Karlsruhe“ Kingston auf Jamaika an. Unweit ankerte der englische Kreuzer „Berwick“, und von Bord zu Bord ging ein reger kameradschaftlicher Verkehr zwischen den Offizieren zweier Schiffe, die bald durch Kanonenmund miteinander sprechen und sich auf hoher See als Feinde begegnen sollten. Unerwartet kürzte den Aufenthalt ein die „Karlsruhe“ nach Mexiko schickender Befehl. Sie traf dort „Dresden“, wechselte die Besatzung aus und fuhr auf neue Weisung nochmals nach Port au Prince, weil die Revolution wieder bei Wege und ein gottlob fehlender Schuss auf die Schwester des Konsuls gefeuert war. Natürlich fand der Kommandant — jetzt Fregattenkapitän Köhler — Haiti wieder im Behagen tiefen Friedens. Bald hätte er die Rückreise nach Mexiko antreten können. Aber die schwüle, heiße Tropenluft der Julitage schien Drohenderes als Sturm zu brüten. Ohne Verbindung mit der Heimat, hörte er doch Gerüchte, die dem Kommandanten eines Stationärs Sorge schaffen mussten. Freilich wäre es ein seltener und eigener Wind, der Kapitän Köhler Sorgen wehte. Der gern und vernehmlich lachende Blonde mit Augen blank und blau wie das glitzernde Meer, in dem die Sonne sich spiegelt, scheint für seinen Posten geboren. Ihm gibt‘s auf weiter Welt und freier See nichts Schöneres als das stolze Herrentum eines Kreuzerkommandanten. Er ist gern auf sich und sein Können allein gestellt. Der unabhängigen Stellung schon im Frieden froh, will er sie auch im Krieg nicht missen, wenn der Feind sein Schiff mit Übermacht jagt. Als Gegner ihn wie Jäger das umstellte Wild hetzten, hätte er Anschluss an andere Schiffe oder gar das Kreuzergeschwader suchen können, und die Geschichte der Seekriege lehrt, dass auf Führern von Kreuzern oder Fregatten in Kampftagen nichts drückender und entmutigender als das Bewusstsein des Alleinseins lastete. Doch der fröhlich Verwegene, der daheim gern Gesellschaft und Freunde guter Tropfen um sich sah, ist in Sturmzeit kühn und selbstbewusst ein Einsamer geblieben. Eine Strippe, die ihn mit der Heimat verbände, hätte er wohl gar durchschnitten. Für Wochen, ja Monate haben seine Oberen von ihm nichts gehört. Immer wieder aber tauchten die Namen Köhler und „Karlsruhe“ in Meldungen von Diplomaten oder Kapitänen auf. Sie erzählten, wie er dem Gegner in die Zähne lachte, durch List und Flinkheit vielen Jägern entschlüpfte und als Schrecken des feindlichen Handels Dampfer auf Dampfer pflückte. Einstweilen spürt er vor Port au Prince Hunger nach Nachrichten über die politische Lage, gibt auf eigene Verantwortung die befohlene Reise nach Mexiko auf und fährt nach Havana, um mit dem Gesandten zusprechen. Der Diplomat muss die Frage, ob Krieg oder Frieden, noch offen lassen, aber Köhler horcht herum und kommt zu Urteil wie Entschluss.
Es ist der 30. Juli, und für den Abend hat S. M. S. „Karlsruhe“ zum Bordfest geladen. Um ihr Vergnügen sollen die Havanesen nicht kommen, denn der Kommandant will Aufsehen vermeiden. Als es dunkelt, lässt er vorn tanzen und achtern kohlen. Der erste Offizier hat drüben wie hüben Pflichten und geht ihnen bald in weißem, bald schwarzem Päckchen nach. Um Mitternacht wird der legte Schwarm lachend plappernder Amerikanerinnen und Havanesinnen von Bord geleitet. Der Kommandant lässt Anker aufgehen und schleicht sich aus dem Hafen, denn draußen stehen englische Panzerkreuzer, und er will bei Eintreffen des Mobilmachungsbefehls auf freiem Meer freier Herr seiner Lage und Entschlüsse sein. In der Stunde, die ihm nahe dünkt, soll namentlich kein Gegner ihn an der Ausführung eines wichtigen Auftrags hindern.
Köhler kreuzt nördlich von Kuba, als der Adjutant mit einer eben in der Funkenbude eingegangenen, in Hast entzifferten Depesche in seine Kajüte tritt: „Krieg mit Frankreich und Russland, Haltung Englands noch zweifelhaft.“ Oben sieht gerade die Mannschaft zur Musterung. Der Kommandant geht auf Deck und schreitet die Reihen entlang: „Nun spuckt mal in die Hände, Leute; wir haben Krieg mit den Russen und Franzosen, und die anderen werden wohl nicht warten lassen“
Ein donnerndes Hurra gibt Antwort, aber der Kommandant winkt kopfschüttelnd ab. Noch ist ja nichts los, und auf dem Schiff bleibt alles beim Alten. Erst als knatternde Funken die Nachricht von der Kriegserklärung Englands bringen, ruft er die Besatzung zu einer Aussprache auf dem Vorderdeck zusammen. Mit der Einleitung: „Ich kann euch nun die erfreuliche Mitteilung machen“ weckt er in drei knappen Sätzen den stürmischen, kaum wieder zu beschwichtigenden Jubel der Seinen, bringt dem Kaiser drei Hurras und lässt nach Verklingen des letzten die Bassstimme dröhnend über das Schiff hallen: „Ran an die Kanonen und losgemacht; was Splitterwirkung hat, fliegt über Bord!“
Da stürzen mit neuen, nicht endenden Hurras die Leute an die befohlene Arbeit und packen zu, dass die Knochen knacken. Vom „Heil dir im Siegerkranz“ geht die Musik zur „Wacht am Rhein“ und spielt dann fröhliche Lieder. Das schweißheischende Hantieren wird zum Fest. Traurig steht nur einer. Er möchte die Hände ringen und blickt aus umflorten Augen seinem Stolz und Augapfel, dem im Wasser versinkenden Sonnensegel mit Bambusstöcken nach. Aber wenigstens die feuergefährlichen Rossschweife am Schellenbaum hat der erste Offizier vor dem Übereifer seiner Matrosen gerettet.
„Dampf aus in allen Kesseln“, heißt‘s, und in fliegender Fahrt saust die „Karlsruhe“ nordwärts, um den aus New York abgefahrenen Lloyddampfer „Kronprinz Wilhelm“ zu treffen und als Hilfskreuzer auszurüsten. Die Rauchfahne, die am Morgen des zweiten Tages den Horizont über glattem Atlantik verdunkelt, scheint fast dem Schornstein eines Kriegsschiffes zu entsteigen. Aber dann zeigt der „Kronprinz“ seine Silhouette, und mit äußerster Kraft hält „Karlsruhe“ auf ihn zu. Das Kriegsglück will, dass die Luft windstill und die See ohne Falte ist. Längsseits gehen beide Schiffe und ihre Matrosen an schwere Arbeit, die Stunden währen wird. Geschütze, Munition, Offiziere und Leute sind auf den Dampfer zu schicken. Von ihm steigen in der Reserve dienende Schiffsoffiziere zur Beförderung in die Heimat um. Auch soll der „Kronprinz“ Proviant und einen kleinen Vorrat an Kohlen abgeben. Leider bekennt er sich zu einer Havarie, die später in See behoben ward, aber vorläufig die Fahrtgeschwindigkeit mindert.