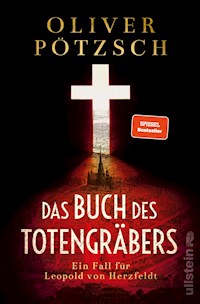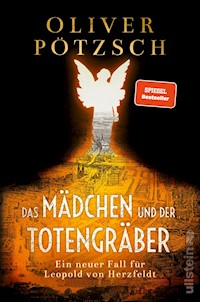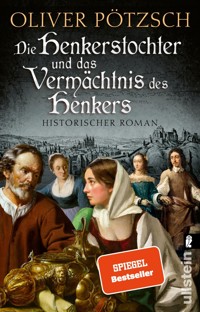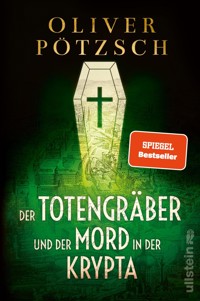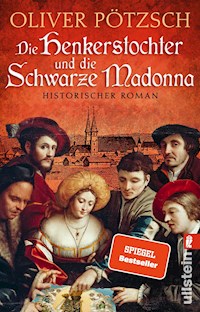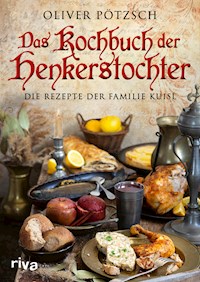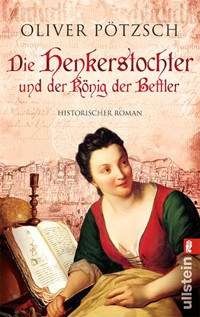
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Schongauer Henker Jakob Kuisl ist in eine Falle getappt: Bei einem Besuch in Regensburg findet er seine Schwester und den Schwager tot in der Badestube. Die Stadtwache verhaftet ihn als Verdächtigen und wirft ihn in den Kerker. Nun drohen ihm, dem Henker, selbst Folter und Hinrichtung. Fieberhaft suchen seine Tochter Magdalena und der Medicus Simon Fronwieser nach dem wahren Täter und stoßen dabei auf ein Komplott, bei dem die Zukunft des Kaiserreichs auf dem Spiel steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Buch
Regensburg im August 1662. Ein neuer Reichstag wird in wenigen Monaten einberufen, schon sind die ersten Gesandten in der großen Stadt, um die Versammlung vorzubereiten. Da kommt der Schongauer Henker Jakob Kuisl nach Regensburg, um seine kranke Schwester zu besuchen. In ihrem Haus erwartet ihn ein grausiger Anblick: Schwester und Schwager liegen mit durchgeschnittener Kehle in ihrem Blut. Die Stadtwache, die Jakob Kuisl neben den Leichen entdeckt, verhaftet ihn vom Fleck weg als den mutmaßlichen Mörder. In einer peinlichen Befragung will der Regensburger Rat ein Geständnis erzwingen. Nun bekommt der Henker von seinem Regensburger Kollegen die Instrumente zu spüren, die er selbst stets angewendet hat: Streckbank, Stachelwalze, Daumenschrauben … Jakob Kuisl sinnt verzweifelt auf einen Ausweg. Er ahnt, dass sich jemand an ihm persönlich auf grausame Weise rächen will.
Unterdessen werden seine Tochter Magdalena und der Medicus Simon Fronwieser in Schongau unter Druck gesetzt, ihre unziemliche Liebe aufzugeben. Nach einem Haberfeldtreiben, bei dem beinahe das Henkerhaus abbrennt, fliehen die beiden nach Regensburg. Als sie erfahren, dass Jakob Kuisl unschuldig verhaftet wurde und ihm die Hinrichtung droht, machen sie sich auf die Suche nach dem wahren Mörder. Wie lange wird der Henker die Folter ertragen? Magdalena und Simon haben nur wenige Tage Zeit. Bald begreifen sie, dass hinter der falschen Anschuldigung mehr steckt als der Wunsch eines Einzelnen nach persönlicher Rache: Jemand verfolgt einen Plan, der das gesamte Kaiserreich in Bedrängnis bringen kann.
Der Autor
Oliver Pötzsch, Jahrgang 1970, arbeitet seit Jahren als Filmautor für den Bayerischen Rundfunk, vor allem für die Kultsendung »quer«. Er ist selbst ein Nachfahre der Kuisls, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert die berühmteste Henker-Dynastie Bayerns waren. Oliver Pötzsch lebt mit seiner Familie in München.
Von Oliver Pötzsch sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Henkerstochter
Die Henkerstochter und der schwarze Mönch
Oliver Pötzsch
Die Henkerstochter und
der König der Bettler
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage September 2010
3. Auflage 2010
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2010
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Titelabbildung: Frau: © The Cook, Jean Baptiste Santerre/
Musée des Beaux-Arts, Nantes/Lauros/Giraudon/
The Bridgeman Art Library; Stillleben: © Vanitas Still Life,
Edwaert Colyer/Alan Jacobs Gallery, London, UK/The Bridge-
man Art Library; Stadtansicht: © akg-images
Karte im Inntenteil: Peter Palm
Satz: LVD GmbH, Berlin
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-548-92021-4
Für Katrin, in Liebe.
Es braucht eine starke Frau, um es mit
einem Kuisl auszuhalten.
»Sobald ein Soldat wird geboren,
sind ihm drei Bauern auserkoren.
Der erste, der ihn ernährt, der andere,
der ihm ein schön Weib beschert,
Der dritte, der für ihn zur Hölle fährt.«
(Vers aus dem Dreißigjährigen Krieg)
Dramatis Personae
Jakob Kuisl, Schongauer Scharfrichter
Simon Fronwieser, Sohn des Stadtmedicus
Magdalena Kuisl, Henkerstochter
Anna-Maria Kuisl, Frau des Scharfrichters
Die Kuisl-Zwillinge Georg und Barbara
Personen in Schongau
Martha Stechlin, Hebamme
Johann Lechner, Gerichtsschreiber
Bonifaz Fronwieser, Schongauer Stadtmedicus
Michael Berchtholdt, Bäcker und Ratsherr
Maria Berchtholdt, Bäckersfrau
Resl Kirchlechner, Magd des Bäckermeisters
Personen in Regensburg
Elisabeth Hofmann, Badersfrau und Schwester
Jakob Kuisls
Andreas Hofmann, Regensburger Bader
Philipp Teuber, Regensburger Scharfrichter
Caroline Teuber, Frau des Regensburger Scharfrichters
Silvio Contarini, venezianischer Gesandter
Nathan der Weise, Regensburger Bettlerkönig
Paulus Mämminger, Regensburger Stadtkämmerer
Karl Gessner, Regensburger Floßmeister
Dorothea Bächlein, Hurenwirtin
Pater Hubertus, bischöflicher Braumeister
Hieronymus Rheiner, Schultheiß und Ratsherr
Joachim Kerscher, Vorsitzender des Regensburger
Ungeltamts
Dominik Elsperger, Wundarzt Die Bettler Hans Reiser, Bruder Paulus,
Verrückter Johannes
Prolog
November 1637, irgendwo im Dreißigjährigen Krieg
Die Reiter der Apokalypse trugen blutrote Beinkleider, zerfetzte Waffenröcke und Mäntel, die wie Fahnen im Wind hinter ihnen herflatterten. Ihre Waffen waren rostig und schartig vom vielen Morden, die Pferde räudige alte Klepper mit dreckverkrustetem Fell. Die Männer warteten schweigend hinter den dichten Bäumen und starrten hinüber zu dem Dorf, dem sie in der nächsten Stunde den Tod bringen würden.
Sie waren zwölf. Ein vom Krieg ausgezehrtes, hungriges Dutzend. Sie hatten geraubt, getötet und vergewaltigt, immer und immer wieder. Vor Jahren waren sie vielleicht Menschen gewesen, doch jetzt waren sie nur noch leere Hüllen; der Wahnsinn hatte sich von innen durch sie hindurchgefressen, bis er schließlich hinter ihren Augen hervorleuchtete. Ihr Anführer, ein sehniger junger Franke in bunter Söldnertracht, kaute auf einem zerfaserten Strohhalm und saugte Speichel durch eine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Als er den Rauch sah, der aus Kaminen der an den Waldrand geschmiegten Häuser aufstieg, nickte er befriedigt.
»Sieht so aus, als wär noch was zu holen.«
Er warf den Strohhalm weg und griff nach dem mit Blut- und Rostflecken übersäten Säbel an seiner Seite. Das Lachen von Frauen und Kindern drang zu ihm herauf. Der Mann grinste. »Und Weiber hat’s auch.«
Der picklige Jüngling an seiner rechten Seite kicherte. Er sah aus wie ein menschgewordenes Frettchen, leicht gebückt hielt er sich mit langen Fingern am Zügel seines dürren Kleppers fest. Seine Augen huschten hin und her, als könnten sie niemals stillstehen. Er war nicht älter als sechzehn, doch der Krieg hatte aus ihm einen alten Mann gemacht.
»Bist ein echter Sauhund, Philipp«, krächzte er und fuhr sich mit der Zunge über die spröden Lippen. »Denkst nur an das eine.«
»Halt’s Maul, Karl!«, ertönte eine Stimme von links. Sie gehörte einem grobschlächtigen, bärtigen Fettwanst. Er hatte die gleichen fransigen tiefschwarzen Haare wie der Franke und der Jüngling neben ihm. Alle drei waren sie Brüder, mit dem gleichen leeren Blick, verbittert und kalt wie ein Hagelsturm im Sommer. »Hat dir unser Vater nicht beigebracht, nur zu sprechen, wenn du gefragt wirst?«, knurrte der Dicke. »Kusch!«
»Scheiß auf den Vater«, murrte der Junge. »Und scheiß auf dich, Friedrich.«
Der fette Friedrich wollte zu einer Antwort ansetzen, doch der Anführer der Söldnertruppe kam ihm zuvor. Seine Hand schnellte vor und krallte sich um Karls Kehle, so dass dessen schwarze Knopfaugen wie riesige Stecknadelköpfe hervortraten.
»Beleidige nie wieder unsere Familie!«, flüsterte Philipp Lettner, der älteste Bruder. »Nie wieder, hörst du? Oder ich zieh dir die Haut in Streifen ab, bis du nach unserer toten Mutter schreist. Verstanden?«
Karl Lettner nickte, während sein pickliges Gesicht puterrot anschwoll. Der Ältere ließ ihn los, hustend fiel Karl in sich zusammen.
Philipps Miene änderte sich plötzlich, fast mitleidig blickte er nun auf das keuchende Bündel Mensch. »Karlchen, Karlchen«, murmelte er und saugte weiter an seinem Strohhalm. »Was soll ich nur mit dir anfangen? Disziplin, verstehst du? Disziplin ist alles im Krieg. Disziplin und Respekt!« Er beugte sich zu seinem kleinen Bruder hinunter und tätschelte ihm die picklige Wange. »Ich liebe dich, als wärst du ein Teil von mir. Aber wenn du noch mal die Ehre unseres Vaters besudelst, muss ich dir leider ein Ohr abschneiden, klar?«
Karl schwieg, er kaute an seinen schmutzigen Fingernägeln und sah zu Boden.
»Ob das klar ist?«, fragte Philipp Lettner noch einmal.
»Ist … klar.« Sein kleiner Bruder neigte demütig das Haupt, die Fäuste geballt zu harten Kugeln.
Philipp grinste. »Dann können wir ja endlich los und ein wenig Spaß haben.«
Die anderen Reiter hatten dem Schauspiel interessiert zugesehen. Philipp Lettner war ihr unangefochtener Anführer. Mit seinen nicht mal dreißig Jahren war er der skrupelloseste der drei Lettner-Brüder, und er besaß die nötige Bauernschläue, um in diesem Haufen an der Spitze zu bleiben. Schon letztes Jahr hatten die Männer begonnen, während der Feldzüge ihre eigenen kleinen Ausflüge zu unternehmen. Philipp Lettner hatte es bislang immer geschafft, dass der junge Feldweibel nichts davon mitbekam. Auch jetzt während des Winterlagers überfielen sie die umliegenden Weiler und Dörfer, obwohl der Feldweibel das ausdrücklich verboten hatte. Sie verkauften die Beute an die Marketenderinnen, die mit ihren Wagen dem Heertross folgten, und hatten so immer etwas zum Beißen, Huren und Saufen.
Heute sah es nach einem besonders guten Fang aus. Das Dorf auf der Lichtung, verborgen hinter dichten Tannen und Buchen, schien von den Wirren des langen Krieges noch fast unberührt. Im Licht der Abendsonne erblickten die Söldner frisch gezimmerte Scheunen und Ställe, Kühe grasten auf den feuchten Wiesen unweit des Waldrands, von irgendwoher ertönte das Lied einer Kinderpfeife. Philipp Lettner schlug seinem Pferd die Stiefel in die Seiten. Wiehernd stellte es sich auf die Hinterbeine, dann galoppierte es zwischen den blutrot gefärbten Buchen hervor. Die anderen folgten ihrem Anführer, und das Morden begann.
Ein krummgebeugter weißhaariger Greis sah sie als Erster. Er hatte zwischen den Sträuchern gekauert, um seine Notdurft zu verrichten. Anstatt ins Unterholz zu fliehen, stolperte er nun mit heruntergelassenen Hosen den Weg entlang aufs Dorf zu. Philipp Lettner überholte ihn, im Vorbeigaloppieren holte er mit dem Säbel aus und trennte dem Mann mit einem einzigen Hieb den rechten Arm ab. Johlend ritten die Übrigen über den zuckenden Leib hinweg.
Mittlerweile hatten die Menschen, die vor den Häusern ihren Geschäften nachgingen, die Landsknechte entdeckt. Laut schreiend ließen die Frauen Krüge und Bündel fallen und liefen in alle Richtungen davon, hinaus auf die Felder und weiter auf den Wald zu. Der junge Karl zielte mit seiner Armbrust kichernd auf einen etwa zwölfjährigen Jungen, der versuchte, sich zwischen den niedrigen Stoppeln eines abgemähten Getreidefelds zu verstecken. Der Bolzen traf den Knaben in die Schulter, und er fiel lautlos in den Dreck.
Friedrich Lettner war inzwischen mit einigen anderen Söldnern ausgeschwärmt, um die Frauen, die auf den Waldrand zurannten, wie eine Herde wildgewordener Kühe wieder einzufangen. Die Männer lachten und hoben ihre Beute zu sich aufs Pferd oder schleiften sie an den Haaren hinter sich her. Philipp widmete sich unterdessen den verängstigten Bauern, die aus den Häusern gelaufen kamen, um ihr armseliges Leben und das Leben ihrer Weiber und Kinder zu verteidigen. Sie trugen Dreschflegel und Sensen, der eine oder andere führte sogar einen Säbel bei sich, aber allesamt waren sie im Kampf unerfahrene, von Krankheit und dünnem Hirsebrei geschwächte Hungerleider, die vielleicht einem Huhn den Kopf abschlagen, aber einem berittenen Landser nichts anhaben konnten.
Schon nach wenigen Minuten war das Gemetzel vorüber. Die Dorfbewohner lagen in ihrem Blut, hingestreckt in ihren Häusern zwischen zerschlagenen Tischen, Betten und Schemeln oder draußen auf der Straße, wo Philipp Lettner den wenigen, die noch stöhnten, einem nach dem anderen die Kehle durchschnitt. Einen der toten Bauern warfen zwei Söldner in den Brunnen am Dorfplatz. Das verwesende Fleisch würde das Wasser vergiften und den Ort so für viele Jahre unbewohnbar machen. Die anderen Männer durchsuchten währenddessen die Häuser nach Essbarem und möglichen Schätzen. Viel war nicht zu holen, ein paar fleckige Münzen, zwei Silberlöffel, einige billige Ketten und Rosenkränze. Der junge Karl Lettner zog sich ein weißes Brautkleid über, das er in einer Truhe gefunden hatte, und tanzte einige Bocksprünge, während er mit fistelnder Stimme einen Hochzeitslandler sang. Unter dem gellenden Gelächter der Übrigen fiel er kopfüber in den Morast; das Kleid riss und hing in Fetzen an ihm, verschmiert von Blutflecken und Schlammspritzern.
Das Wertvollste im Dorf war das Vieh. Acht Kühe, drei Schweine, einige Ziegen und ein Dutzend Hühner. Bei den Marketenderinnen würden sie dafür einen guten Preis erzielen.
Und dann waren da natürlich noch die Frauen.
Es ging bereits auf den Abend zu, eine feuchte Kühle breitete sich auf der Lichtung aus. Um für die nötige Wärme zu sorgen, warfen die Söldner brennende Fackeln in die zerstörten Häuser. Die trockenen Binsen und die mit Ried gedeckten Dächer fingen innerhalb von Sekunden Feuer, schon bald leckten die Flammen an den Fenstern und Türen. Ein gewaltiges Knistern und Prasseln war zu hören, das nur vom Weinen und Schreien der Frauen übertönt wurde.
Sie hatten die Weiber auf dem Dorfplatz zusammengetrieben. Etwa zwanzig waren es. Der fette Hüne Friedrich Lettner ging von einer zur anderen. Die alten und hässlichen Frauen stieß er zur Seite. Eine Greisin schlug wild um sich, Friedrich packte sie wie eine Puppe und warf sie in eines der brennenden Häuser. Schon bald hörte das Schreien auf. Danach kehrte Ruhe ein, von den Bäuerinnen war nur noch ein gelegentliches Wimmern zu vernehmen.
Schließlich hatten die Männer ein gutes Dutzend Frauen aussortiert, die jüngste von ihnen ein etwa zehnjähriges Mädchen, das mit offenem Mund und weiten Augen in die Ferne starrte. Ihr Verstand schien sie bereits verlassen zu haben.
»So ist’s recht«, knurrte Philipp Lettner und ging die Reihe der zitternden Bäuerinnen ab. »Wer kuscht, sieht morgen die Sonne noch. Ist kein schlechtes Leben als Landserbraut. Gibt einen besseren Fraß als das, was euch eure Böcke hier vorgesetzt haben.« Die anderen Söldner lachten; das Kichern des jungen Karl klang hoch und schrill, wie die falsche zweite Stimme in einem Chor von Wahnsinnigen.
Plötzlich blieb Philipp Lettner vor einem gefangenen Mädchen stehen. Es hatte zerzaustes schwarzes Haar, das wohl sonst zu einem Dutt hochgebunden war, nun aber fast bis zur Hüfte reichte. Das Mädchen mochte vielleicht siebzehn, achtzehn Jahre alt sein. Mit seinen buschigen Augenbrauen und dem funkelnden Blick darunter erinnerte es Lettner an eine kleine zornige Katze. Die junge Frau zitterte, doch ihren Kopf hielt sie aufrecht. Das grobe braune Bauernkleid war eingerissen, so dass eine der Brüste freilag. Lettner starrte auf die kleine feste Brustwarze, die durch die Kälte hart geworden war. Ein feines Lächeln zog sich über sein Gesicht, er deutete auf das Mädchen.
»Die dort ist meine«, sagte er. »Um den Rest könnt ihr euch meinethalben die Köpfe einschlagen.«
Schon wollte er nach der jungen Bäuerin greifen, als sich hinter ihm mit einem Räuspern sein Bruder Friedrich bemerkbar machte. »So geht das nicht, Philipp«, murrte er. »Ich hab sie zwischen den Ähren gefunden, sie gehört mir.«
»Ach ja?« Philipps Stimme war kalt und schneidend. »Du hast sie also gefunden. Mag sein, aber du hast sie offenbar wieder laufen lassen …«
Er näherte sich seinem Bruder, bis er direkt vor ihm stand. Friedrich war wesentlich stärker und breit wie ein Weinfass, trotzdem wich er leicht zurück. Wenn Philipp in Wut geriet, spielte Körperkraft keine Rolle mehr. Das war schon als Kind so gewesen. Auch jetzt schien er kurz davor zu explodieren, seine Wimpern zuckten leicht, seine Lippen bildeten einen schmalen, blutleeren Strich.
»Ich hab die Kleine in einer Truhe drüben in dem großen Haus aufgestöbert«, flüsterte Philipp. »Hat wohl geglaubt, sie könnte sich dort verkriechen wie eine Maus.
Nun, wir hatten schon ein bisschen Spaß. Doch sie ist störrisch. Man muss ihr erst noch Manieren beibringen. Ich glaube, dass ich das am besten kann …«
Von einem Augenblick auf den anderen wich die Härte aus Philipps Augen. Er lächelte wieder und schlug seinem Bruder versöhnlich auf die Schulter.
»Aber du hast recht. Warum soll der Anführer das beste Stück Weib bekommen? Wo ich mir doch schon drei der Kühe und die beiden Schweine nehm, nicht wahr?« Philipps Blick wanderte an den übrigen Söldnern entlang, doch keiner wagte zu widersprechen. »Weißt du was, Friedrich?«, sagte er schließlich. »Wir machen es wie früher, wie damals bei uns in Leutkirchen beim Müller-Wirt. Wir würfeln um das Weib.«
»Wir … würfeln?« Friedrich stockte. »Wir zwei? Jetzt?«
Philipp Lettner schüttelte den Kopf. Er runzelte die Stirn, als würde er über etwas Schwieriges nachdenken. »Nein, ich denk, das wär nicht gerecht«, fuhr er fort. »Wir alle würfeln.« Er blickte in die Runde. »Nicht wahr? Wir alle haben ein Recht auf dieses pralle, schmucke Weibsbild!«
Die anderen lachten und ließen ihn hochleben. Philipp Lettner war ein Anführer ganz nach ihrem Geschmack. Vor ihm waren alle gleich, Brüder wie Kameraden. Ein dreimal verfluchter Satansbraten, mit einem Herz so schwarz wie der Arsch des Teufels! Der junge Karl hüpfte wie ein Derwisch im Kreis und klatschte in die Hände. »Ein Spiel! Ein Spiel!«, rief er. »So wie früher!«
Philipp Lettner nickte und ließ sich auf dem Boden nieder. Aus seiner Rocktasche holte er zwei knöcherne, abgeschabte Würfel, die ihn schon den ganzen langen Krieg begleiteten. Er warf sie in die Luft und fing sie geschickt wieder auf.
»Nun, wer macht ein Spielchen mit mir?«, rief er. »Wer? Um das Weib und die Kühe. Lasst sehen, was ihr zu bieten habt.«
Sie trieben das schwarzhaarige Mädchen wie ein Stück Vieh in die Mitte des Dorfplatzes und ließen sich um sie herum in einem Kreis nieder. Mit einem Schrei der Verzweiflung versuchte die junge Bäuerin zu fliehen, doch Philipp Lettner schlug ihr zweimal ins Gesicht.
»Kusch, Hure! Oder wir fallen gemeinsam über dich her und schneiden dir die Zitzen ab.«
Das Mädchen kauerte sich nieder, die Arme um seine Beine geschlungen, den Kopf wie im Mutterleib nah an den Körper gedrückt. Durch eine Wolke von Trauer und Schmerz hörte es wie von fern das Rasseln der Würfel im Becher, das Klirren von Münzen und das Gelächter der Männer.
Plötzlich stimmten die Söldner ein Lied an, das das Mädchen gut kannte. Früher, als die Mutter noch lebte, war es eines der Lieder gewesen, die sie gemeinsam auf dem Feld sangen. Und später auf dem Sterbebett hatte Mama es ein letztes Mal leise vor sich hin gesummt, kurz bevor sie für immer heimgegangen war. Es war schon immer ein trauriges Lied gewesen. Doch nun, da die Männer es betrunken in den dunklen Abendhimmel grölten, wirkte es auf einmal so fremd und grauenvoll, dass das Mädchen kalte Finger an seiner Kehle zu spüren glaubte. Wie Nebelschleier wehten die Zeilen zu der jungen Bäuerin herüber.
Es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Hat G’walt vom großen Gott. Heut wetzt er das Messer, es schneid’t schon viel besser … Hüt dich, schön’s Blümelein …
Die Männer lachten, und Philipp Lettner ließ den ledernen Becher kreisen. Einmal, zweimal, dreimal.
Mit einem leisen Klicken fielen die Würfel in den Sand.
1
Im Donaudurchbruch hinter Weltenburg, den 13. August anno domini 1662, 25 Jahre später …
Die Woge erwischte Jakob Kuisl von vorne und spülte ihn wie ein Stück Treibholz von der Bank.
Der Henker schlitterte über die rutschigen Balken, griff wild um sich auf der Suche nach irgendeinem Halt, bis er plötzlich spürte, wie seine Füße in die gurgelnden Strudel des Flusses tauchten. Langsam, aber unerbittlich zog ihn sein eigenes Gewicht von fast zwei Zentnern ins kalte Wasser. Seine Fingernägel schabten über die Planken, ganz aus der Nähe konnte er wie durch eine Wand hindurch aufgeregte Schreie vernehmen. Endlich bekam er mit der rechten Hand einen ins Holz geschlagenen Zimmermannsnagel zu fassen. Kuisl hievte sich daran hoch, als ein weiterer Körper an ihm vorbei auf den Fluss zurutschte. Mit seiner freien Hand griff er danach und erwischte einen etwa zehnjährigen Jungen am Kragen, der wild zappelte und nach Luft japste. Der Henker schob ihn zurück in die Mitte des Floßes, wo ein erleichterter Vater den Knaben in die Arme schloss.
Keuchend kroch Jakob Kuisl hinterher und nahm wieder auf der Bank vorne am Bug Platz. Sein Leinenhemd und der Lederkoller klebten ihm am Oberkörper, Wasser rann über Gesicht, Bart und Augenbrauen. Als er den Blick nach vorne richtete, erkannte er, dass ihnen das Schlimmste noch bevorstand. Zu ihrer Linken ragte eine gewaltige, bestimmt vierzig Schritt hohe Wand auf, der die Reisenden nun hilflos entgegentrudelten. Hier, in der Weltenburger Enge, war die Donau so schmal wie fast nirgendwo sonst. Ein vor allem bei Hochwasser brodelnder Hexenkessel, der schon so manchen Flößer das Leben gekostet hatte.
»Bei Gott, festhalten! Haltet’s euch fest, um Himmels willen!«
Der vordere Steuermann stemmte sich gegen das Ruder, als das Floß in einen weiteren Strudel tauchte. Muskelstränge traten an seinen Armen hervor wie knorrige Wurzeln, doch die lange Stange in seinen Händen bewegte sich keinen Zentimeter. Die schweren Gewitterregen der letzten Tage hatten den Fluss stark anschwellen lassen, so dass die sonst so lauschigen Kiesbänke am Ufer vollkommen verschwunden waren. Äste und entwurzelte Bäume trieben in der weißen Gischt vorüber. Schneller, immer schneller schoss das breite Floß auf die Felswand zu. Jakob Kuisl hörte neben sich ein hässliches Geräusch, als die Fichtenstämme am Kalkstein entlangschrammten. Die Wand war nun direkt über ihnen, ein steinerner Gigant, der seinen Schatten auf die kleine Gruppe Menschen warf. Scharfe Kanten gruben sich in die linke Floßseite und schnitten den äußersten Fichtenstamm der Länge nach auf wie einen Laib Brot.
»Heiliger Nepomuk, steh uns bei! Gütige Jungfrau Maria, hilf uns in unserer Not! Seliger Nikolaus, verschone uns …«
Kuisl blickte mürrisch zur Seite, wo eine Klosterschwester sich an einen elfenbeinernen Rosenkranz klammerte und unablässig ihre Gebete in den wolkenlosen Himmel greinte. Auch die anderen Reisenden auf den Holzbänken murmelten mit kreidebleichen Gesichtern Fürbitten und bekreuzigten sich. Ein fetter Großbauer wartete mit geschlossenen Augen und Schweißperlen auf der Stirn auf sein sicheres Ende, ein Franziskanermönch rief mit sich überschlagender Fistelstimme die vierzehn Notheiligen an. Der kleine Junge, den Jakob Kuisl soeben vor dem Ertrinken bewahrt hatte, klammerte sich an seinen Vater und weinte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fels die zusammengeschnürten Stämme zermalmt haben würde. Die wenigsten der Menschen auf dem Floß konnten schwimmen, aber es war ohnehin fraglich, ob ihnen das in den reißenden Strudeln geholfen hätte.
»Dreckswasser, vermaledeites!«
Kuisl spuckte aus und warf sich nach vorne, wo der Steuermann noch immer versuchte, das mit Tauen am Bug befestigte Ruder herumzureißen. Der Schongauer Henker stellte sich breitbeinig neben den Flößer und drückte mit seinem stämmigen Oberkörper gegen die Stange. Es fühlte sich an, als hätte sich das Steuerruder in irgendetwas tief unten im eiskalten Flusswasser verfangen. Kuisl gingen die Schauergeschichten der Flößer durch den Kopf, die von schleimigen, bösartigen Ungeheuern am Grunde des Flusses zu berichten wussten. Erst gestern hatten ihm Fischer von einem fünf Schritt langen Waller erzählt, der im Donaudurchbruch in einer Höhle hausen sollte. Was in Dreiteufelsnamen drückte dort unten gegen die Stange?
Mit einem Mal spürte er, wie das Ruder sich ein winziges Stück bewegen ließ. Ächzend stemmte er weiter, er hatte das Gefühl, dass seine Knochen jeden Moment brechen müssten. Ein letztes Knirschen, und plötzlich gab das Ruder nach, das Floß drehte sich gegen den Strudel und wurde mit einer letzten schaukelnden Bewegung von der Felswand förmlich wegkatapultiert.
Nur Augenblicke später trieben sie pfeilschnell auf drei kleine felsige Inseln auf der rechten Uferseite zu, wieder schrien einige der Reisenden auf, doch der Flößer hatte mittlerweile wieder die Kontrolle über sein Gefährt. Das Floß rauschte an den von Gischt umspülten Felskuppen vorbei, noch einmal tauchte es mit dem Bug tief in das Wasser ein; dann hatten sie die gefährliche Flussenge passiert.
»Einen schönen Dank auch!« Der Steuermann wischte sich Schweiß und Wasser aus den Augen und reichte Kuisl seine schwielige Hand. »Um ein Haar hätt sich die Lange Wand uns alle zur Vesper schmecken lassen. Magst ned auch Flößer werden?« Er griente Kuisl an, während er gleichzeitig dessen Bizeps abtastete. »Kraft hast wie zwei Ochsen und fluchen kannst auch schon wie unsereins. Also, wie wär’s?«
Jakob Kuisl schüttelte den Kopf. »Vergelt’s Gott. Aber ihr hättet keine Freud mit mir. Noch so ein Strudel, und ich speib euch ins Wasser. Ich brauch die Erde unter den Füßen.«
Der Flößer lachte, und Kuisl schüttelte die nassen zottigen Haare, so dass die Tropfen in alle Richtungen spritzten.
»Wie lang wird’s noch bis Regensburg sein?«, fragte er den Steuermann. »Dieser Fluss macht mich noch ganz damisch. War bestimmt das zehnte Mal, dass ich gedacht hab, um uns ist’s geschehen.«
Jakob Kuisl blickte zurück, wo noch immer die Felswände links und rechts des Flusses emporragten. Manche von ihnen erinnerten ihn an versteinerte Untiere oder an Köpfe von Riesen, die auf das Gewusel der winzigen Sterblichen tief unter ihnen hinabstarrten. Kurz davor hatten sie das Weltenburger Kloster passiert, eine von Krieg und Hochwasser zerfressene Ruine. Trotz ihres traurigen Zustands suchte sie noch so mancher Donaureisende für ein stilles Gebet auf. Die darauffolgende Flussenge galt gerade nach starken Regenfällen als echte Herausforderung für jeden Flößer – ein paar Vaterunser vorher konnten da sicher nicht schaden.
»Die Lange Wand ist bei Gott die schlimmste Stelle«, sagte der Steuermann und schlug ein Kreuz. »Besonders bei Hochwasser. Aber jetzt geht’s friedlich dahin, mein Wort. In ein paar Stunden sollten wir ankommen.«
»Ich hoff, du hast recht«, knurrte der Henker. »Sonst zieh ich dir dein gottverdammtes Ruder über den Rücken.«
Jakob Kuisl wandte sich ab und tapste mit vorsichtigen Schritten den schmalen, glitschigen Gang zwischen den Bankreihen entlang nach hinten, wo die Ladung in Fässern und Kisten verstaut war. Das Reisen auf dem Floß war ihm zuwider, auch wenn es sicherlich die schnellste und immer noch sicherste Art war, in eine andere Stadt zu kommen. Der Henker liebte es, festen Waldboden unter seinen Füßen zu spüren. Aus Holzstämmen baute man Häuser, Tische und meinetwegen Galgen, aber man stolperte nicht über sie, während sie durch reißendes Wasser schaukelten. Kuisl war froh, wenn das Geschaukel bald ein Ende hatte.
Dankbar musterten ihn die Reisenden, die mittlerweile wieder etwas Farbe im Gesicht hatten und vor Erleichterung beteten oder laut lachten. Der Vater des geretteten Jungen wollte Kuisl an die Brust drücken, doch der Henker wischte den Mann beiseite und verschwand brummend zwischen den verzurrten Kisten.
Hier, auf der Donau, vier Tagesreisen von seiner Heimat entfernt, wussten weder Passagiere noch Mannschaft, dass Jakob Kuisl der Schongauer Scharfrichter war. Für den vorderen Steuermann war dies ein Glücksfall. Hätte sich herumgesprochen, dass ein Henker dem Flößer beim Rudern geholfen hatte, der Mann wäre vermutlich aus seiner Zunft verstoßen worden. Kuisl hatte davon gehört, dass in manchen Gegenden die Berührung, ja allein schon der Blick eines Scharfrichters ehrlos machen konnte.
Jakob Kuisl kletterte auf ein Fass gepökelter Heringe im hinteren Teil der Ladung und steckte sich seine Pfeife an. Jetzt, hinter der berüchtigten Weltenburger Enge, wurde die Donau wieder breiter. Das Städtchen Kelheim tauchte linker Hand auf, schwer bepackte Kähne glitten so nah am Floß vorbei, dass Kuisl ihre Ladung fast berühren konnte. Von einem weiter entfernten Schiff war das Lied einer Fiedel zu hören, begleitet vom Klirren eines Schellenkranzes. Gleich dahinter pflügte sich ein Floß, breit wie ein Haus, gemächlich durch die Strömung. Es war beladen mit Kalk, Eibenholz und Ziegeln und hing so tief im Wasser, dass immer wieder kleine Wellen über die Stämme spülten. Der Floßmeister, der vor seiner notdürftig gezimmerten Hütte in der Mitte des behäbigen Gefährts stand, schlug eine Glocke, als ihm einige kleinere Fischerboote gefährlich nahe kamen.
Der Henker ließ ein paar Tabakswolken in den blauen, fast wolkenlosen Sommerhimmel steigen und versuchte für einige Minuten, den traurigen Grund seiner Reise zu vergessen. Sechs Tage war es nun her, dass ihn in seinem Haus in Schongau ein Brief aus dem fernen Regensburg erreicht hatte. Der Inhalt des Schreibens hatte ihn mehr getroffen, als Kuisl seiner Familie gegenüber hatte zeigen wollen. Seine jüngere Schwester Lisbeth, die seit Jahren als Ehefrau eines Baders in der fernen Reichsstadt lebte, war schwer krank. Von einer Geschwulst im Bauch war die Rede, von schrecklichen Schmerzen und schwarzem Ausfluss. In dem mit krakeligen Zeilen beschriebenen Pergament bat ihn sein Schwager, so bald wie möglich nach Regensburg zu kommen, da nicht sicher sei, wie lange Lisbeth noch lebte. Also hatte der Schongauer Henker den Arzneischrank in seiner Stube ausgeräumt, Schlafmohn, Arnika und Johanniskraut in seinen Leinensack gepackt und war auf das nächste Floß Richtung Donau gestiegen. Als Scharfrichter war es ihm eigentlich nicht gestattet, ohne Genehmigung des Rates die Stadt zu verlassen, aber Kuisl hatte sich über das Verbot einfach hinweggesetzt. Sollte ihn der Gerichtsschreiber Johann Lechner nach seiner Rückkehr doch vierteilen lassen! Das Schicksal seiner Schwester war ihm wichtiger. Kuisl traute den studierten Quacksalbern nicht, die Lisbeth vermutlich nur Blut abzapften, bis sie weiß war wie eine Wasserleiche. Wenn jemand seiner Schwester helfen konnte, dann nur er selbst und kein anderer.
Der Schongauer Scharfrichter tötete und heilte. In beidem war er ein Meister.
»He, Großer! Trinkst auch einen Schluck mit?«
Jäh aus seinen Gedanken gerissen sah Jakob Kuisl nach vorne, wo einer der Flößer ihm mit einem Glas zuprostete. Der Henker schüttelte den Kopf und schob seinen schwarzen Schlapphut in die Stirn, um sich vor der blendenden Sonne zu schützen. Seine große Hakennase ragte unter der Krempe hervor, darunter steckte die dampfende Stielpfeife. Verdeckt vom Hut musterte er Reisende und Flößer, die nun in der Mitte zwischen den Kisten standen und mit einem Schluck Branntwein auf den überstandenen Schrecken anstießen. Kuisl plagte ein Gedanke, der kam und ging wie eine lästige Schnake und der nur kurzzeitig durch die Strudel an der Langen Wand verdrängt worden war.
Seit seiner Abreise hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden.
Es war keine Gewissheit, nur ein Zusammenspiel aus Instinkt und jahrelanger Erfahrung, die er sich in seiner Zeit als Söldner im Großen Krieg erworben hatte. Ein leichtes Jucken zwischen den Schulterblättern. Er wusste nicht, wer ihn beobachtete und warum, aber das Jucken blieb.
Kuisl sah sich um. Unter den Passagieren befanden sich zwei Franziskanermönche und eine Nonne, ansonsten gab es fahrende Handwerker, Wandergesellen und einige einfache Kaufleute. Gemeinsam mit dem Henker waren sie eine Gruppe von etwa zwei Dutzend, die sich dem Konvoi der fünf Flöße angeschlossen hatten. Hier auf der Donau war es möglich, in nur einer Woche bis nach Wien, in drei Wochen sogar bis zum Schwarzen Meer zu reisen. Abends, wenn die Flöße gemeinsam am Ufer anlegten, traf man sich am Feuer, wechselte das eine oder andere Wort miteinander und erzählte von früheren Reisen und Gefahren. Nur Kuisl kannte niemanden und saß deshalb meist allein, was ihm nur recht war, hielt er doch die meisten Menschen ohnehin für tratschsüchtige Einfaltspinsel. Von seinem Platz am Rand aus beobachtete der Henker jeden Abend die Männer und Frauen, wie sie um das Feuer saßen, lachten, billigen Wein tranken und an ihren Hammelkeulen nagten. Und immer wieder glaubte er einen Blick zu spüren, der unentwegt auf ihn gerichtet war. Auch jetzt zur Mittagszeit juckte es ihn wie von einem kleinen Käfer zwischen den Schulterblättern.
Jakob Kuisl ließ die Beine vom Holzfass baumeln und tat gelangweilt. Er stopfte seine Pfeife neu und blickte hin zum fernen Ufer, als würde er dort die Horde von Kindern mustern, die ihm von der Böschung aus zuwinkten.
Ganz plötzlich jedoch wendete er seinen Kopf Richtung Heck.
Für den Bruchteil einer Sekunde bemerkte er, wie eine Gestalt zu ihm herüberstarrte. Es war der zweite Steuermann, der das Ruder am hinteren Teil des Floßes führte. Soweit sich Kuisl erinnern konnte, war er in Schongau zugestiegen. Der Mann war beleibt und fast so groß wie der Henker, an der Seite seines blauen Jankers baumelte ein unterarmlanger Hirschfänger. Seine Schultern waren breit, ein mächtiger Bauch wölbte sich über den kupfernen Gürtel und die Kniehose, die in groben, hohen Lederstiefeln steckte. Auf dem Kopf trug er den bei Flößern üblichen Stopselhut. Am auffälligsten aber war das Gesicht des Mannes. Die gesamte rechte Hälfte war ein zerfurchter Acker von kleinen Kratern und Narben, die vermutlich von starken Verbrennungen herrührten. Über einer Augenhöhle hatte der Mann eine schwarze Klappe; hinzu kam ein rötlich schimmernder Narbenwulst, der von der Stirn bis zum Kinn reichte und wie ein fetter Wurm hin und her zu zucken schien.
Kurz hatte Jakob Kuisl das Gefühl, kein Gesicht, sondern eine Fratze vor sich zu sehen.
Eine Fratze des Hasses.
Der Augenblick verging, und der Steuermann beugte sich wieder über sein Ruder. Er hatte sich vom Henker abgewandt, als hätte ihr kurzer Blickkontakt nie existiert.
Ein Bild aus der Vergangenheit huschte durch Kuisls Kopf, doch er konnte es nicht fassen. Träge floss die Donau an ihm vorüber und nahm die Erinnerung mit. Was blieb, war eine vage Ahnung.
Wo um alles in der Welt …?
Jakob Kuisl kannte diesen Mann. Er wusste nicht woher, aber sein Instinkt warnte ihn. Der Schongauer Scharfrichter hatte als Söldner im Großen Krieg die verschiedensten Menschen kennengelernt, Feige und Tapfere, Aufrechte und Verschlagene, Opfer und Mörder, darunter viele, die der Krieg wahnsinnig gemacht hatte. Eins konnte Kuisl mit Sicherheit sagen: Der Mann, der nur wenige Schritte von ihm entfernt gemächlich die Ruderstange durch das Wasser zog, war gefährlich. Gerissen und gefährlich.
Behäbig rückte der Henker den Knüppel aus Lärchenholz an seinem Gürtel zurecht. Alles in allem kein Grund zur Sorge. Es gab genügend Menschen, die das Gleiche von ihm behaupteten.
Jakob Kuisl verließ das Floß in dem kleinen Dorf Prüfening, bereits einige Meilen vor Regensburg.
Der Henker grinste, während er seinen Sack mit den Arzneien schulterte und den Rottflößern, Händlern und Handwerkern noch einmal zuwinkte. Wenn dieser Fremde mit dem verbrannten Gesicht wirklich hinter ihm her war, hatte er jetzt ein Problem. Als Steuermann konnte er schlecht von Bord gehen, bevor das Floß in Regensburg anlandete. Tatsächlich starrte der Flößer mit seinem gesunden Auge zu ihm herüber, fast schien es, als wollte auch er auf die kleine Mole springen – doch dann besann er sich offenbar eines Besseren. Ein letzter hasserfüllter Blick, nur einen Augenblick lang, so dass kein anderer es bemerkte, dann wandte er sich wieder seiner Arbeit zu und wickelte glitschige, armdicke Taue um den Molenpfosten.
Das Floß blieb vertäut, bis einige wenige Reisende für die kurze Passage nach Regensburg eingestiegen waren, dann legte es ab und glitt gemächlich auf die Reichshauptstadt zu, deren höchste Türme bereits am Horizont zu sehen waren.
Jakob Kuisl blickte dem Floß kurz nach, dann pfiff er einen Landsermarsch und schritt auf der schmalen Straße Richtung Norden. Schon bald hatte er das kleine Dorf verlassen, links und rechts breiteten sich im Wind wogende Kornfelder aus. Ein Grenzstein markierte die Linie, wo Kuisl bayerisches Territorium verließ und die Gefilde der freien Reichsstadt Regensburg betrat. Bislang kannte er den berühmten Ort nur aus Erzählungen. Er wusste, dass Regensburg zu den größten Städten im Reich zählte und direkt dem Kaiser unterstellt war. Und er hatte gehört, dass sich hier auf sogenannten Reichstagen die Kurfürsten, Bischöfe und Herzöge trafen, um über die Geschicke des Reiches zu verhandeln.
Als Kuisl jetzt in der Ferne die hohen Stadtmauern und Türme aufragen sah, überfiel ihn ein Gefühl von Heimweh. Der Schongauer Henker war für die große Welt nicht gemacht, ihm reichten das Sonnenbräu-Wirtshaus gleich hinter der Kirche, der grüne Lech und die tiefen bayerischen Wälder.
Es war ein heißer Mittag im August, die Sonne stand direkt über ihm am Himmel und ließ das Getreide gelb aufleuchten. Weiter hinten am Horizont ballten sich die ersten schwarzen Gewitterwolken. Rechts ragte aus den Feldern ein Galgenhügel auf, auf dem einige Gestalten sanft hin- und herschaukelten. Verfallene Schanzanlagen zeugten davon, dass der Große Krieg noch nicht lange vorüber war. Längst war der Henker nicht mehr allein auf der Straße. Kutschen und einzelne Reiter preschten an ihm vorbei, Ochsen zogen gemächlich die Karren der Bauern aus dem Umland. Ein breiter Strom von Menschen wälzte sich lärmend und schreiend auf Regensburg zu und staute sich schließlich vor einem hohen Tor in der westlichen Stadtmauer. Zwischen den ärmlich in Wolle und grobes Tuch gekleideten Bauern, den Pilgern, Bettlern und Fuhrleuten konnte Jakob Kuisl auch immer wieder einen Blick auf prächtig ausstaffierte Edelleute erhaschen, die sich auf hohem Ross einen Weg durch die Menge bahnten.
Stirnrunzelnd beobachtete der Schongauer Henker diesen seltsamen Aufmarsch. Offenbar stand schon bald wieder einer dieser Reichstage an. Er reihte sich ein in die Schlange von Menschen, die vor dem Tor darauf warteten, eingelassen zu werden. Dem Schimpfen und Fluchen nach zu urteilen, schien es länger zu dauern als üblich.
»He, Großer! Wie ist der Wind dort oben?«
Jakob Kuisl beugte sich hinunter zu dem Bauern, der ihn offenbar angesprochen hatte. Als der kleine Mann das grimmige Gesicht des Henkers nun direkt vor sich erblickte, musste er kurz schlucken, bevor er weitersprach.
»Kannst du sehen, was dort vorne los ist?«, fragte er mit einem schmalen Lächeln. »Zweimal die Woche bring ich meine Rüben auf den Markt, immer dienstags und samstags. Aber so ein Gedränge habe ich noch nicht erlebt.«
Der Henker stellte sich auf die Zehen. Auf diese Weise überragte er alle Umstehenden um fast zwei Köpfe. Kuisl konnte erkennen, dass am Tor gleich ein halbes Dutzend Wachen stand. Mit ihren blechernen Torgeldbüchsen sammelten die bewaffneten Männer von jedem einzelnen Passanten den Wegzoll ein. Immer wieder stießen die Wachleute unter den wütenden Protesten der Bauern mit Schwertern in die Ladungen von Korn, Heu und Kohlköpfen, ganz so, als würden sie jemanden suchen.
»Jeder einzelne Wagen wird kontrolliert«, murmelte der Henker und sah spöttisch auf den Bauern hinunter. »Habt’s den Kaiser in der Stadt oder macht’s ihr immer so einen Zinnober?«
Der Mann seufzte. »Wahrscheinlich ist bloß wieder irgendein wichtiger Gesandter eingetroffen. Dabei ist der Reichstag doch erst nächstes Jahr! Wenn das so weitergeht, sind alle Marktstände weg, bevor ich am Haidplatz bin. Zefix!« Er fluchte und biss zornig in eine seiner Rüben, die er in einem Korb vor sich hertrug. »Drecksgesandte! Eine Plage wie die Muselmanen! Nichts als Ärger bringen die in die Stadt. Rühren keinen Finger und halten den Verkehr auf.«
»Weshalb sind’s denn da?«, fragte Jakob Kuisl.
Der Bauer lachte. »Weshalb? Um uns die Haare vom Kopf zu fressen, darum! Zahlen keine Steuern und bringen ihre eigenen Handwerker mit, die den unseren die Arbeit wegnehmen! Angeblich wollen sie gemeinsam beraten, wie man die gottverfluchten Türken davon abhält, ins Deutsche Reich einzufallen. Aber wenn du mich fragst, ist das nichts als leeres Gerede!« Er seufzte tief. »Warum kann der Kaiser seinen Reichstag nicht auch mal in einer anderen Stadt abhalten? Aber nein, alle paar Jahre trifft’s uns aufs Neue. Man glaubt schon fast, diese Gesandten sind immer hier!«
Jakob Kuisl nickte, ohne wirklich zugehört zu haben. Was kümmerte ihn dieser Reichstag? Alles, was er wollte, war seine kleine Lisbeth sehen. Sollten die hohen Herren ruhig währenddessen den nächsten Krieg beschließen. Sie würden schon genug finden, die sich für Geld und Ruhm umbringen ließen. Er jedenfalls hatte mit dem großen Hauen und Stechen nichts mehr zu schaffen.
»Und du? Warum bist du hier«, fragte der Bauer weiter. »Hast du schon eine Bleibe?«
Jakob Kuisl schloss die Augen. Offensichtlich war er an den gesprächigsten Bauern im gesamten Regensburger Umland geraten.
»Ich komm bei meiner Schwester unter«, knurrte er und hoffte, dass ihn das kleine Männlein endlich in Ruhe ließ.
Währenddessen waren der Henker und sein Nachbar in der Schlange immer weiter aufgerückt. Nur noch zwei Heukarren trennten sie vom sogenannten Jakobstor. Die Wächter schauten unter das Fahrwerk und stachen ins Heu, dann winkten sie die Wagen durch und widmeten sich den nächsten Passanten. Von fern war erstes Donnergrollen zu hören, das Gewitter würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Schließlich war die Reihe an ihnen. Der Bauer durfte ohne weitere Untersuchung passieren, doch Jakob Kuisl wurde herausgewinkt.
»He, du! Ja, du!« Eine Wache in Helm und Brustharnisch deutete auf den Henker und bedeutete ihm, näherzukommen. »Wo kommst du her?«
»Aus Schongau unten bei Augsburg«, brummte der Henker und sah sein Gegenüber an, als würde er einen Stein betrachten.
»So, aus Augsburg …«, begann der Wächter und zwirbelte seinen kunstvollen Schnauzbart.
»Nicht aus Augsburg, aus Schongau«, knurrte der Henker. »Ich bin kein dreckiger Schwab, ich bin Bayer.«
»Wie auch immer«, sagte der Wächter und warf seinen Kameraden hinter ihm einen zwinkernden Blick zu. Dann musterte er Kuisl, als würde er ihn mit einem inneren Bild abgleichen. »Und was willst du hier, Bayer?«
»Meine Schwester wohnt bei euch«, antwortete der Henker knapp, ohne auf den spöttischen Unterton einzugehen. »Sie ist schwer krank, und ich statte ihr einen Besuch ab, wenn’s erlaubt ist.«
Der Wachmann grinste selbstgefällig. »Deine Schwester, soso. Na, wenn die genauso ausschaut wie du, wirst du sie schnell gefunden haben.« Er lachte und wandte sich wieder feixend seinen Kameraden zu. »Wandelnde Felsbrocken mit Hakennase haben wir hier eher selten, nicht wahr?«
Gelächter ertönte um sie herum. Jakob Kuisl schwieg, während der Wachmann weiter stichelte: »Hab schon gehört, dass sie euch Schwaben mit Kasspatzen füttern, bis es euch zu den Ohren rauskommt. Du bist der beste Beweis dafür, dass dieses Zeug fett und dumm macht.«
Ohne seine Miene zu verändern, trat der Henker einen Schritt auf den Mann zu und fasste ihn beim Kragen. Die Augen der Wache traten wie Glasmurmeln hervor, während Jakob Kuisl ihn zu sich hochzog.
»Hör zu, Bursch«, knurrte er. »Wenn du was von mir willst, dann red gradaus mit mir. Ansonsten halt dein Maul und lass mich durch.«
Plötzlich spürte der Henker eine Schwertspitze in seinem Rücken.
»Lass ihn runter«, ertönte eine Stimme hinter ihm. »Ganz langsam, Großer. Sonst ramm ich dir das Schwert in die Gedärme, dass es vorne wieder rauskommt. Hast du mich verstanden?«
Der Henker nickte langsam und setzte den verängstigten Mann auf dem Boden ab. Als Jakob Kuisl sich umdrehte, sah er einen groß gewachsenen Wachtmeister in blank poliertem Kürass vor sich stehen. Wie sein Kollege trug er einen gezwirbelten Schnauzer, aus dem in der Sonne funkelnden Helm ragte eine blonde Mähne hervor. Sein Schwert hielt er jetzt direkt vor Jakob Kuisls Halsbeuge. Mittlerweile hatte sich eine kleine Menge Schaulustiger um sie versammelt, die gespannt darauf warteten, was als Nächstes passierte.
»So ist’s gut«, sagte der Hauptmann mit einem schmalen Lächeln. »Du wirst dich jetzt umdrehen, und wir gehen gemeinsam die Treppe hoch in den Torturm. Dort haben wir für Leute aus Bayern ein feines Quartier zum Nachdenken.«
Der oberste Torwächter schob seine Schwertspitze nur wenige Zentimeter an den Hals des Henkers heran, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Kurz war Kuisl versucht, das Schwert zu packen, den Mann zu sich herzuziehen und ihm den Lärchenholzknüppel zwischen die Hosenbeine zu schieben. Aber dann bemerkte er die anderen Wachen, die mit erhobenen Lanzen und Hellebarden um ihn herumstanden und sich tuschelnd unterhielten. Warum hatte er sich nur reizen lassen! Fast schien ihm, als ob der Wachmann es darauf angelegt hätte, ihn zu provozieren. Gingen die Regensburger etwa mit allen Fremden so um?
Jakob Kuisl drehte sich um und marschierte auf den Turm zu. Er konnte nur hoffen, dass sie ihn freiließen, bevor seine Schwester den lieben Herrgott traf.
Als sich die Tür hinter dem Henker schloss, platschten draußen die ersten Regentropfen aufs Pflaster. Schon bald darauf prasselte der Regen so dicht, dass die Wartenden vor dem Tor ihre Mäntel über sich hielten oder in den umliegenden Heustadeln Schutz suchten. Hagelkörner, groß wie Taubeneier, fielen vom Himmel, und so mancher Bauer fluchte, dass er die Ernte nicht früher eingebracht hatte. Es war bereits das dritte große Gewitter in dieser Woche, die Leute beteten und rückten unter dem Herrgottswinkel in der Stube eng zusammen. Nicht wenige Bewohner der umliegenden Dörfer erkannten in der Sintflut den gerechten Zorn Gottes. So strafte er das zügellose Treiben der verfluchten Städter! Die bunten Kleider, das Schachern, den Besuch bei den Dirnen und den Hochmut, immer noch höhere Häuser bauen zu wollen. Waren Sodom und Gomorra nicht auf ganz ähnliche Weise zugrunde gegangen? Mit dem Reichstag im nächsten Januar würden wieder all die aufgeblasenen hohen Herren kommen, sie würden saufen und huren und statt der Messe ihre eigene Macht zelebrieren – wo doch der Herrgott allein über das Wohl und Wehe des Deutschen Reichs entschied!
Unter lautem Krachen schlug ein Blitz oben im Wehrgang ein. Ein Donnern folgte, das die Kinder noch bis zum Emmeransplatz weinen ließ. In dem kurzen Flackern des darauffolgenden Blitzes sah man nun, wie eine Gestalt sich vom Jakobstor Richtung Stadt kämpfte. Der Mann ging gebückt, Hagel und Regen schlugen ihm ins Gesicht. Kein anderer wagte sich bei solch einem Wetter auf die Straße. Doch der Mann musste Meldung machen.
Die Narbe in seinem Gesicht schmerzte, wie so oft, wenn sich das Wetter änderte. Fast wäre ihm der Henker entkommen, doch der Mann hatte gewusst, dass sein Feind durch das Jakobstor musste. Kein anderer Weg führte vom Westen her in die Stadt hinein. Also war er von der Floßlände auf dem schnellsten Weg zum Tor gerannt und hatte die Wachen benachrichtigt. Mit ein bisschen Geld war nun die nötige Zeit gewonnen, die sie brauchten, um ihren Plan in die Tat umzusetzen.
Rache … Wie lange hatten sie beide darauf gewartet!
Der Mann grinste, und die Narbe in seinem Gesicht begann nervös zu zucken.
2
Schongau, den 13. August anno domini 1662
Der Sommer lag wie eine alte muffige Decke über Schongau.
Mit wehendem Kleid lief Magdalena Kuisl den schmalen, eingewachsenen Pfad vom Gerberviertel hinunter zum Lech. Ihre Mutter hatte ihr für heute freigegeben, der strenge Vater war weit weg, und so stürmte sie durch die kühlen, schattigen Auen, froh, der Schwüle und dem Gestank entfliehen zu können.
Magdalena freute sich auf ein Bad im Fluss, denn in ihren verfilzten schwarzen Haaren hing noch immer der Geruch von Mist, Kot und Moder. Den ganzen Vormittag hatten ihre Mutter und sie den städtischen Unrat mit Schaufeln auf den Karren geladen, sogar die neunjährigen Zwillinge Georg und Barbara hatten mithelfen müssen. Eine Arbeit, die schwerer fiel als sonst, weil Magdalenas Vater vor einigen Tagen nach Regensburg aufgebrochen war. Als Henkersfamilie hatten die Kuisls dafür zu sorgen, dass die Schongauer Gassen frei von Unrat und Tierkadavern waren. Jede Woche türmten sich an den Ecken und Kreuzungen der Stadt Berge von Dreck, die in der heißen Sonne vor sich hin dampften. Ratten mit langen, glatten Schwänzen huschten darüber hinweg und glotzten die Vorübergehenden mit bösen Knopfaugen an. Wenigstens der Nachmittag sollte nun Magdalena allein gehören.
Schon nach wenigen Minuten war die Henkerstochter am Ufer des Lechs angekommen. Sie wandte sich nach links, abseits der Floßlände, wo um diese Zeit bereits ein halbes Dutzend Flöße vertäut lagen. Magdalena hörte das Rufen und Lachen der Rottflößer, die Fässer, Kisten und Ballen entluden und zu dem neu gebauten Zimmerstadel an der Mole schleppten. Sie bog vom Treidelpfad ab und schlug sich durch das grüne Unterholz, das ihr jetzt im Hochsommer bis zu den Schultern reichte. Der Untergrund war sumpfig und glitschig, ihre nackten Füße sanken bei jedem Schritt mit einem Schmatzen ein.
Endlich hatte Magdalena ihre Lieblingsstelle erreicht, eine kleine flache Bucht, die durch die umstehenden Weiden von außen nicht einsehbar war. Die Henkerstochter kletterte über eine gewaltige abgestorbene Wurzel hinunter und entledigte sich ihrer schmutzigen Kleider. Ausgiebig wusch sie Rock, Schürze und Mieder, indem sie die Gewänder über die scharfen, nassen Kiesel schabte, und legte sie anschließend zum Trocknen auf einen von der Sonne aufgeheizten Felsen.
Als Magdalena ins Wasser stieg, spürte sie die sanfte Strömung des Flusses um ihre Knöchel spülen, sie sank ein in Matsch und Morast. Noch ein paar Schritte weiter, dann ließ sie sich in den Fluss fallen. Hier in der vor Urzeiten ausgewaschenen Bucht war die Strömung nicht ganz so stark. Die Henkerstochter schwamm hinaus und achtete darauf, nicht zu nahe an die Strudel in der Mitte des Lechs zu geraten. Das Wasser wusch den Dreck von ihrer Haut und aus ihren Haaren. Schon nach wenigen Minuten fühlte sie sich wieder frisch und ausgeruht, die stinkende Stadt war weit, weit entfernt.
Als sie zum Ufer zurückschwamm, merkte sie, dass ihre Kleider verschwunden waren.
Magdalena sah sich ratlos um. Dort, auf dem Felsen, hatte sie die nassen Sachen abgelegt. Nun war an dieser Stelle nur noch ein feuchter Fleck zu sehen, der langsam verblasste.
War ihr etwa jemand gefolgt?
Sie suchte das Ufer ab, konnte die Kleider aber nirgends finden. Magdalena versuchte sich zu beruhigen. Es mussten Kinder gewesen sein, die ihr einen Streich spielten, nichts weiter. Sie setzte sich auf die Wurzel und ließ sich die braune Haut von der Sonne trocknen. Die Augen geschlossen, den Kopf in den Nacken gelegt, wartete sie darauf, dass die Lausbuben sich durch ein Kichern verrieten.
Plötzlich war hinter ihr ein Rascheln zu hören.
Bevor Magdalena aufspringen konnte, hatte ihr jemand einen sehnigen, haarigen Arm um den Hals gelegt. Eine Hand verdeckte ihren Mund. Sie wollte schreien, brachte aber keinen Laut hervor.
»Keinen Mucks! Sonst küss ich dich, bis dein Hals voller roter Flecken ist und dein Vater dir den Hintern versohlt.«
Hinter der vorgehaltenen Hand musste Magdalena losprusten.
»Simon! Mein Gott, was hast du mir für einen Schrecken eingejagt! Ich dachte, Räuber und Halsabschneider …«
Simon küsste sie sanft in die Halsbeuge. »Wer weiß, vielleicht bin ich ja einer …« Verschwörerisch zwinkerte er ihr zu.
»Du bist ein windiger, zwergenwüchsiger Quacksalber, mehr nicht. Eher dreh ich dir den Hals um, als dass du mich auch nur kratzt. Weiß der Teufel, warum ich dich so lieb hab.«
Sie entwand sich seinem Griff und warf sich auf ihn. Eng umschlungen rollten sie über den nassen Kies der Bucht. Es dauerte nicht lange, und sie hatte Simon mit ihren Oberschenkeln am Boden festgeklemmt. Der Medicus war schmal und eher sehnig als muskulös. Mit seinen gerade mal fünf Fuß gehörte er zu den kleinsten Männern, die Magdalena kannte. Sein Gesicht war fein geschnitten, mit hellen, wachen Augen darin, die immer spöttisch zu funkeln schienen, darunter prangte ein fein gestutzter schwarzer Knebelbart. Das leicht geölte dunkle Haar trug er der neuesten Mode entsprechend schulterlang. Auch sonst achtete Simon auf ein gepflegtes Äußeres, das gerade arg in Mitleidenschaft geriet.
»Ich … ich ergebe mich«, ächzte er.
»Nichts da, zuerst versprichst du mir, dass es keine andere gibt!«
Simon schüttelte mühsam den Kopf. »Keine … andere.«
Magdalena verpasste ihm eine Kopfnuss und rollte sich neben ihn. Die Affäre mit der rothaarigen Händlerin vor über zwei Jahren hatte die Henkerstochter ihm noch immer nicht ganz verziehen, auch wenn Simon schon ein Dutzend Mal geschworen hatte, dass nichts geschehen war. Doch der Tag heute war zu schön, um ihn mit Streit zu verbringen. Gemeinsam blickten die beiden in die Äste der Weiden, die im sanften Wind über ihren Köpfen hin und her schaukelten. Lange schwiegen sie und hörten dem Rauschen zu. Nach einer Weile ergriff Magdalena das Wort.
»Mein Vater wird wohl für eine Weile fortbleiben.«
Der Medicus nickte und blickte zwei Enten nach, die sich flügelschlagend vom Wasser erhoben. Magdalena hatte ihm bereits von Kuisls Reise zu seiner kranken Schwester erzählt. »Was hat eigentlich der Lechner dazu gesagt?«, fragte er schließlich. »Ich mein, als Gerichtsschreiber hätte er deinem Vater doch einfach verbieten können, die Stadt zu verlassen. Gerade jetzt im Sommer, wo der Dreck zum Himmel stinkt.«
Magdalena lachte. »Was hätt er denn machen sollen? Der Vater ist einfach gegangen. Der Lechner hat geflucht und geschworen, dass er ihn aufhängen lässt, wenn er zurückkommt. Erst dann ist ihm aufgefallen, dass mein Vater sich ja schlecht selber aufhängen kann.« Sie seufzte. »Eine saftige Geldstrafe wird’s vermutlich hageln. Und bis er zurückkommt, müssen die Mutter und ich eben doppelt so viel schuften.« Plötzlich bekamen ihre Augen etwas Träumendes.
»Wie weit ist dieses Regensburg eigentlich weg?«, fragte sie.
»Sehr weit.« Simon grinste und fuhr mit seiner Hand spielerisch um ihren Bauchnabel. Noch immer war Magdalena nackt, auf ihrer vom täglichen Kräutersammeln im Freien gebräunten Haut funkelten einzelne Wassertropfen in der Sonne.
»Weit genug jedenfalls, dass er uns nicht mit seinen Strafpredigten quälen kann«, sagte der Medicus schließlich und gähnte ausgiebig.
Magdalena fuhr hoch. »Wenn, dann ist es doch dein alter Herr, der ständig gegen uns hetzt. Außerdem ist der Anlass seiner Reise ein ernster. Also hör auf, so blöd zu grinsen.«
Die Henkerstochter dachte an den Brief aus Regensburg, der ihren Vater so betrübt hatte. Sie hatte zwar gewusst, dass ihr Vater eine jüngere Schwester in Regensburg hatte, doch ihr war nicht klar gewesen, dass die beiden sich offenbar immer noch so nahe standen. Gerade zwei Jahre alt war Magdalena gewesen, als die Tante vor der großen Pest, aber auch vor den täglichen Anfeindungen und Sticheleien im Ort mit einem Bader nach Regensburg geflohen war. Diesen Mut hatte Magdalena immer an ihr bewundert.
Schweigend warf sie Kiesel ins Wasser, die einige Male aufschlugen, bevor sie schließlich von den Fluten verschluckt wurden.
»Wer allerdings in den nächsten schwülen Wochen den Mist wegräumen soll, ist mir schleierhaft«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu Simon. »Wenn der Rat meint, ich mach das, hat er sich gehörig getäuscht. Lieber zieh ich den Sommer über in ein Erdloch.«
Simon klatschte in die Hände. »Ein grandioser Einfall! Oder wir bleiben einfach hier in der Bucht!« Er fing an, ihr Gesicht zu küssen. Magdalena wehrte sich, wenn auch nur zaghaft.
»Simon, lass das. Wenn uns einer sieht …«
»Wer soll uns schon sehen?« Er fuhr durch ihr schwarzes nasses Haar. »Die Weiden werden schon nicht petzen.«
Magdalena lachte. Diese wenigen Stunden unten am Lech oder in den Scheunen der Umgebung waren alles, was sie von ihrer Liebe hatten. Immer wieder träumten sie von einer Heirat, doch die strengen Statuten der Stadt ließen das nicht zu. Seit Jahren führten sie nun eine Beziehung, die mehr einem verzweifelten Versteckspiel glich. Als Tochter eines Henkers war es Magdalena eigentlich nicht gestattet, sich mit den höheren Ständen einzulassen. Scharfrichter waren ehrlos, ebenso wie Totengräber, Bader, Barbiere und Gaukler. Eine Heirat mit einem Medicus kam für Magdalena demnach nicht in Frage. Das hielt Simon aber nicht davon ab, sich mit ihr in den Auen und den Scheunen des Umlands zu treffen. Im Frühjahr vor zwei Jahren hatten sie sogar eine gemeinsame Wallfahrt nach Altötting unternommen. Es war im Grunde die einzige Zeit, in der sie wirklich für sich gewesen waren. Auf den Märkten und in den Wirtsstuben von Schongau war die Affäre zwischen dem Medicus und der Henkerstochter mittlerweile ein beliebtes Gesprächsthema. Zudem drängte Simons Vater, der alte Bonifaz Fronwieser, seinen Sohn immer eindringlicher, endlich eine Bürgerstochter zu ehelichen. Für Simons Weiterkommen als Arzt war das eigentlich unvermeidlich. Doch der Sohn wich dem Alten immer wieder aus – und traf sich weiterhin heimlich mit Magdalena.
»Vielleicht sollten wir auch nach Regensburg gehen«, flüsterte Simon zwischen den Küssen. »Stadtluft macht frei. Wir könnten ein neues Leben beginnen …«
»Ach, Simon.« Magdalena schob ihn weg. »Wie oft hast du mir so etwas schon versprochen! Aber was wird dann aus mir? Ich bin ehrlos, vergiss das nicht. Am End’ werd ich doch nur wieder den Mist wegräumen, egal wo.«
»Keiner kennt dich dort!«
Magdalena zuckte mit den Schultern. »Und was soll ich arbeiten? Die Städte sind voll mit hungrigen Tagelöhnern, und …«
Simon hielt ihr den Finger vor die Lippen. »Sag jetzt nichts. Lass uns das alles kurz vergessen.« Mit geschlossenen Augen beugte er sich zu ihr hinunter und bedeckte ihren Körper mit Küssen.
»Simon … nicht …«, flüsterte Magdalena, aber ihr Widerstand war bereits gebrochen.
In diesem Augenblick ertönte ein Knacksen in der Weide über ihnen.
Magdalena blickte nach oben. Dort zwischen den Ästen schien sich etwas zu bewegen. Plötzlich spürte sie einen warmen Klecks in ihrem Gesicht, eine schleimige Flüssigkeit rann ihr langsam über die Stirn. Sie griff danach und spürte, dass es Spucke war.
Ein Kichern ertönte, dann sah Magdalena, wie zwei etwa zwölfjährige Burschen geschwind am Stamm der Weide hinunterkletterten. Einer von ihnen war der jüngste Sohn des Ratsherren und Bäckermeisters Michael Berchtholdt, mit dem Magdalena schon des Öfteren aneinandergeraten war.
»Der Medicus, der Medicus, gibt seiner Henkersdirn an Kuss!«, sang der zweite Bub im Weglaufen. Angeekelt wischte sich Magdalena den restlichen Speichel von der Stirn. Simon war in der Zwischenzeit aufgesprungen und drohte den feixenden Jungen mit der Faust.
»Freche Drecksbälger!«, schrie er. »Dafür brech ich euch sämtliche Knochen!«
»Das kann die Henkerstochter aber besser!«, krächzte der zweite Junge und verschwand im Gebüsch. »Treibt’s doch auf einer Streckbank, ihr Saupack!«
Der kleine Berchtholdt war währenddessen merkwürdigerweise stehengeblieben. Leicht zitternd, mit trotzigem Gesichtsausdruck und zusammengebissenen Lippen blickte er Simon entgegen, der nun mit herausgerutschtem Hemd und aufgeknöpftem Rock wie ein Berserker auf ihn zurauschte.
»Ich war das nicht!«, kiekste er, als Simon mit der Hand ausholte. »Das war der Benedikt! Ehrenwort! Eigentlich haben wir euch nur gesucht, nun, weil, äh …«
Simons Hand verharrte über dem Kopf des Jungen. Erst jetzt bemerkte er, dass der junge Berchtholdt mit offenem Mund die halbnackte Henkerstochter anstarrte, die sich gerade, nur notdürftig hinter einem Felsen verborgen, das Mieder zuknöpfte. Der Medicus gab dem Buben einen Nasenstüber, der ihn rücklings in den Schlamm fallen ließ.
»Hat dich der Pfarrer keinen Anstand gelehrt?«, knurrte Simon. »Wenn du weiter so starrst, wird dich Gott mit Blindheit strafen. Also, was gibt’s?«
»Mein Vater schickt mich«, murmelte der Junge. »Ich soll die Kuisltochter zu ihm bringen.«
»Der alte Berchtholdt?«, fragte Magdalena, die nun angezogen hinter dem Felsen hervortrat. »Was kann der von mir schon wollen? Oder hockt er vielleicht auch irgendwo auf einem Ast und glotzt sich die Augen raus?«
Tatsächlich galt der Schongauer Bäckermeister im Ort als in die Jahre gekommener Schürzenjäger und geiler Bock. Auch bei Magdalena hatte er es in früheren Jahren versucht und eine saftige Abfuhr erhalten. Seitdem tratschte Berchtholdt herum, die Henkerstochter sei mit dem Teufel im Bunde und habe den jungen Medicus verzaubert. Vor drei Jahren war es dem abergläubischen Bäcker beinahe gelungen, die Hebamme Martha Stechlin wegen angeblicher Hexerei verbrennen zu lassen. Ein Vorhaben, das Magdalenas Vater damals gerade noch hatte verhindern können. Seit dieser Zeit hasste Berchtholdt die Kuisls abgrundtief und machte ihnen, wo immer es ging, das Leben schwer.
»Es ist wegen seiner Magd, der Resl«, sagte der Junge, während er weiter auf Magdalenas tief ausgeschnittenes Dekolleté starrte. »Sie hat einen dicken Bauch und schreit wie ein abgestochenes Schwein.«
»Trägt sie denn ein Kind im Leib?«, fragte Magdalena.
Der Bub bohrte in der Nase und machte ein ratloses Gesicht. »Weiß nicht. Die Leut meinen, in die Resl ist der Teufel gefahren. Du sollst dir das anschauen, sagt mein Vater.«
»Ach, dafür bin ich ihm gut genug.« Magdalena sah den Buben skeptisch an. »Zur Stechlin will er wohl nicht gehen?«
»Lieber schneidet der Berchtholdt sich selbst unten auf, als dass er nach der Hebamme schickt«, warf Simon ein, der sich mittlerweile auch angezogen hatte. »Du weißt, er hält die Stechlin immer noch für eine Hexe und würd sie gerne brennen sehen. Außerdem glauben viele im Ort, dass du eine ebenso gute Hebamme bist wie sie. Vielleicht sogar eine bessere.«
»Red keinen Schmarren.« Magdalena band sich die nassen Haare zu einem Dutt, während sie weitersprach. »Ich kann nur hoffen, dass es mit der Magd vom Berchtholdt nichts Ernstes ist. Und jetzt red nicht, komm!«
Die Henkerstochter rannte bereits den schmalen Treidelpfad hoch zum Lechtor. Im Laufen wandte sie sich noch einmal zu Simon um.
»Mag sein, dass wir einen studierten Medicus brauchen können. Und sei’s auch nur zum Wasserholen.«
Schon als sie die Zänkgasse betraten, merkte Magdalena, dass sie es nicht mit einer herkömmlichen Geburt zu tun hatten. Aus den schmalen, verriegelten Fenstern des Bäckers drangen Schreie heraus, die mehr an ein Vieh auf der Schlachtbank als an einen Menschen erinnerten. Bauern und Handwerker waren vor der Backstube zusammengelaufen und tuschelten ängstlich miteinander. Als sich Simon und Magdalena der Gruppe näherten, machten sie nur widerwillig Platz.
»Jetzt kommt das Henkersmädchen und treibt der Bäckersmagd den Satan aus«, zischte jemand.
»Ach was, Hexenschwestern sind’s, alle beide«, flüsterte ein altes Weib. »Pass auf, wir werden noch sehen, wie sie durch den Schornstein davonfliegen.«
Magdalena schob sich an den tratschenden Frauen vorbei und versuchte, das Gerede nicht ernst zu nehmen. Als Henkerstochter war sie es gewohnt, dass nicht wenige sie für eine Ausgeburt des Satans hielten. Seit Magdalena bei der Hebamme arbeitete, war ihr Ruf sogar noch schlechter geworden. Vor allem die Männer waren sich sicher, dass die Henkerstochter Zauber- und Liebestränke mischte, und tatsächlich hatte der eine oder andere Ratsherr schon ein solches Mittel bei ihrem Vater erworben. Magdalena dagegen hatte sich bislang immer geweigert, den Leuten einen Bären aufzubinden, vor allem, um nicht noch mehr als Höllenweib verdächtigt zu werden. Vergebens, wie sie sich jetzt wieder seufzend eingestehen musste.
Unter Getuschel und Getratsche betrat sie gemeinsam mit Simon die Bäckersstube, wo die beiden ein kreidebleicher Michael Berchtholdt empfing. Der kleine dürre Mann roch wie so oft nach Branntwein, seine Augen waren rotgerändert, als hätte er eine schlaflose Nacht hinter sich. Zwischen den Fingern rieb er ein trockenes Sträußlein Beifuß, das gegen böse Geister schützen sollte. Seine ebenso magere Frau kniete vor dem Herrgottswinkel in der Ecke der Stube und murmelte Gebete, die jedoch vom Schreien der Magd übertönt wurden.
Resl Kirchlechner lag auf der mit schmutzigem Stroh bedeckten Ofenbank und wand sich, als würde sie innerlich verbrennen. Gesicht, Hände und Beine waren von roten Pusteln überzogen, die Fingerkuppen glänzten schwarz verfärbt. Ihr Bauch war aufgebläht, eine kleine runde Kugel, die an dem sonst spindeldürren Leib wie ein Fremdkörper wirkte. Magdalena vermutete, dass die Magd das Kleid bislang fest zugeschnürt hatte, um die Schwangerschaft zu verbergen.
Gerade eben richtete sich die junge Frau ruckartig auf, als hätte ihr jemand einen Besenstiel in den Rücken gerammt. Ihre Augen gingen ins Leere, die trockenen Lippen öffneten sich zu einem langgezogenen Schrei.