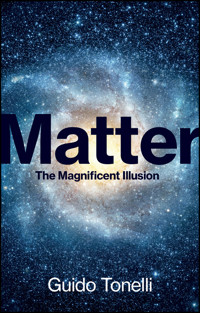17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, gibt die moderne Naturwissenschaft eine eindeutige Antwort: Materie. Aus Materie sind wir gemacht, wir bewegen uns auf ihr, wir formen sie zu Tausenden von Objekten. Doch was, wenn sich die Stabilität von Materie als Illusion erweist, wie jüngste Erkenntnisse nahelegen? In seiner unnachahmlichen Mischung aus avancierter Physik, Geschichten und Popkultur vergegenwärtigt Tonellis so kurzes wie atemberaubendes Buch diesen für das Denken unserer Zeit konstitutiven Zusammenbruch vermeintlich bewährter Grundlagen. Als es Guido Tonelli und anderen führenden Physikern im Jahr 2012 gelang, das Higgs-Boson nachzuweisen, war das mit der Hoffnung verbunden, endlich das Teilchen gefunden zu haben, das allen anderen Teilchen Masse verleiht. Wenn Materie stabil ist und dem Vergehen widersteht, so sollten wir das diesem Teilchen verdanken. Doch das Gegenteil trat ein. Wie schon im Fall der fortschrittlichsten physikalischen Theorie, der Quantenmechanik, ohne deren Annahmen es kein einziges Smartphone gäbe, löste sich die Materie buchstäblich auf: als sei alles, aber auch wirklich alles, nichts weiter als das Ergebnis eines Spiels zufälliger Fluktuationen. Tonellis so kurzes wie atemberaubendes Buch bringt uns dieses Ergebnis der modernen Physik mit einer Fülle auch außerphysikalischer Beispiele nahe: vom Tod seines Großvaters, der mitten im Krieg Opfer eines Verkehrsunfalls in einer menschenleeren Gegend wurde, bis zur Entstehung von «Money», dem berühmten Song von Pink Floyds LP mit dem sprechenden Titel «The Dark Side of the Moon».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Guido Tonelli
DIE ILLUSION DER MATERIE
Was die moderne Physik über unsere Welt verrät
Aus dem Italienischen von Enrico Heinemann
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Motto
Prolog – Posara, Toskana, 11. August 1945
1. Die Mutter von allem
Ein Wort mit tiefen Wurzeln
Trauer- und Fürsorgerituale um die Toten
Die Materie im Denken der großen Gelehrten
Das Vorurteil der Stabilität und Dauerhaftigkeit des materiellen Universums
2. Atome und Leere
Die Geburt der Atomlehre
Epikur und Lukrez
Die unglaubliche Entdeckung des Sekretärs eines Gegenpapstes
Venus, Zephyr und die Käsewürmer
Die Geburt der modernen Wissenschaft und der Atomismus
3. Es sind nur Teilchen
Die dunkle Seite des Mondes
Teilchenjäger
Teilchen, die sich mit anderen Teilchen verbinden
Die unwiderstehliche Kraft des Eros
Das Reich der schüchternsten und verschämtesten Teilchen
Fünf kleine Phänomene
4. Wolken, weiches Material und die letzten Schamanen
Zustände der Materie
Die seltsame Welt der weichen Materialien
Das fast ewige Leben der großen materiellen Strukturen
Die flüchtige Welt der ephemersten Formen der Materie
5. Triumph und Fall eines jahrtausendealten Vorurteils
Geschichten von Fermionen und Bosonen
Aber was ist eigentlich Masse?
Die Jungs von 1964
Genf, 8. November 2011
Ein seltsames Feld, das das gesamte Universum besetzt
Die Seltsamkeit des Higgs und die vielen in ihm verborgenen Geheimnisse
6. Leuchtende und schwarze Sterne
Was Sterne sind
Die turbulente Seite der Sonne
Das spektakuläre Ende eines stillen Sterns
Supernovae und Neutronensterne
Schwarze Löcher
7. Dunkle Gestalten bevölkern das Universum
Vor allem Gas und eine Prise Staub
Milkomeda und die Blackeye-Galaxie
Die dunkle Seite der Materie
Das Licht, das die Dunkle Materie zum Vorschein bringt
Das rätselhafte Reich der Finsternis
Die sanftmütigen und freundlichen Boten
8. Was gibt dem Wasser Halt, in dem der Bahamut schwimmt?
Kritische Dichte des Universums
Was das Vakuum ist
Woher die Materie stammt
Welches Ende die Materie nimmt
9. Die wunderbare Illusion
Die große Begeisterung für den mechanistischen Materialismus
Der staatlich verordnete Materialismus
Der moderne Materialismus
Aber was ist Materie eigentlich?
Und wenn uns die Teilchen noch nicht alle Geheimnisse verraten hätten?
Epilog – Biella, 23. November 2021
Danksagung
Zum Buch
Vita
Impressum
Dem süßen Leon
Die Materie ist eine große Illusion. Die Materie manifestiert sich nämlich in der Form, und die Form ist ein Gespenst.
Jack London
Wir sind aus solchem Stoff wie der zu Träumen, und dies kleine Leben umfasst ein Schlaf.
William Shakespeare
Prolog
Posara, Toskana, 11. August 1945
Jetzt hatte er die Steigungen hinter sich. Blieb nur noch die abschüssige Strecke, die von Moncigoli ins Dorf hinabführte. Er konnte es kaum erwarten, allen die große Neuigkeit zu verkünden. Er und sein Schwager Attilio, der beste Mechaniker der Stadt, hatten eine Wohnung gefunden und sogar schon eine Miete vereinbart.
Sie lag im Zentrum von La Spezia, in einem Bürgerhaus an der Ecke zwischen dem Corso Cavour und der Via di Monale. Schön und ausreichend groß, bot sie zwei Familien Platz: neun Personen insgesamt und dazu das Baby, das seine Frau Anita erwartete. Irgendwie mussten alle in den drei Schlafzimmern unterkommen: Das Wohnzimmer würde als Schneideratelier dienen. Jetzt, da der Krieg zu Ende war, ging es wieder an die Arbeit. Wenn alles gut lief, würden sie bald einige Näherinnen einstellen müssen.
Auf der Fahrt ins Tal trat er nur leicht in die Pedale, und die Backenbremsen seiner robusten Atala, die ihn durch diese schwierigen Jahre getragen hatte, funktionierten absolut zuverlässig in jeder Kurve. Er war auf dem Rückweg nach Posara, dem Ortsteil von Fivizzano, in den sich die Familie zurückgezogen hatte, um den Krieg zu überleben. Die rund vierzig Kilometer von La Spezia, wohin er am frühen Morgen aufgebrochen war, hatte er zügig hinter sich gebracht. So oft, wie er die Strecke gefahren war, kannte er jede Biegung auswendig.
Dieses schwarze Fahrrad mit dem Kettenschutzblech, der Klingel mit dem Wappen im Druckguss und dem Dynamo, der Fahrten auch bei Dunkelheit ermöglichte, hatte entscheidend dazu beigetragen, die Familie wirtschaftlich über Wasser zu halten. In den umliegenden Dörfern musste immer wieder ein Bauer einen zerschlissenen Mantel umändern oder ein Loch in einem Jackett für eine Hochzeit stopfen lassen. Dann eilte er los und kam mit Eiern oder einer Flasche Milch zurück. Alle kannten den Schneider, der durch die Dörfer radelte.
Rasch dienten seine Fahrten auch als ideale Tarnung, um für die in der Gegend operierenden Partisaneneinheiten Kurierdienste zu leisten. Wenn er am Abend vor einer Übergabe einen Zettel überreicht bekam, musste er nur seinen Fahrradsattel abmontieren und die Nachricht tief ins Stützrohr hineinstopfen. Bei Gelegenheit las er die Mitteilung, verstand aber nichts: manchmal chiffrierte Sätze, die meldeten, dass Kolonnen von Nazis oder Faschisten aus Massa anrollten, um Razzien durchzuführen, oder nur Daten und Zahlen, also Koordinaten von bewaffneten Stützpunkten und Versorgungslinien der Alliierten für die Partisanen.
Der Schneider hatte Glück. Er wurde nie verraten oder entdeckt. Bei mehreren Gelegenheiten konnte er sogar seinen Bruder Giuseppe in die Arme schließen, der in einer Partisanenabteilung der Garibaldi-Brigade «Apuania» als politischer Kommissar diente. Giuseppe schenkte ihm eine Luger P08 mit Projektilen des Kalibers 9 Parabellum. Er hatte sie einem Wehrmachtssoldaten abgenommen, der in einem Feuergefecht umgekommen war. Der Schneider hasste Waffen: Als er nach Posara zurückradelte, verfolgte ihn die panische Angst, an der ersten Straßensperre von den Schwarzen Brigaden angehalten und erschossen zu werden. Aber alles lief glatt. Wieder zu Hause, suchte er für die Pistole ein sicheres Versteck. Er wickelte sie in einen ölverschmierten Lappen, ließ sie im Stall unter dem Fresstrog der Kühe verschwinden, wo das meiste Stroh lag, und rührte sie nie wieder an.
Nach Posara war er mit der gesamten Familie Anfang 1942 geflohen, nachdem klar geworden war, dass die Schneidergeschäfte endgültig zum Erliegen kamen. Im Krieg bestellte niemand mehr ein neues Kleidungsstück. In La Spezia war nichts Essbares mehr aufzutreiben, und falls doch, war es zu teuer. Er hatte fünf Mäuler zu stopfen und durfte kein Risiko eingehen. So verschlug es die Familie aufs Land, ins Heimatdorf seines Vaters, der wenige Jahre zuvor gestorben war, und wo seine Brüder mit ihren Familien noch lebten. Sie luden ein paar brauchbare Dinge aus dem Haushalt auf einen Karren und zogen los, um sich allesamt in einem hergerichteten Raum über dem Stall einzuquartieren: In dieser Art Schober brachten sie den wuchtigen Schneidertisch, ein mobiles Waschbecken und drei Betten für je zwei Personen unter. Ein Kaminofen in der Mitte diente zum Kochen und Aufwärmen. Um ihre Notdurft zu verrichten, gingen sie zu der kleinen Holzbaracke im Freien, in der Jauche zum Düngen des Gemüsegartens gesammelt wurde.
Das Bauernhaus war armselig, im Winter herrschten am Fuß des Apennins eisige Temperaturen, aber die Eichenwälder ums Dorf boten reichlich Brennholz. In höheren Lagen wurden im Herbst Kastanien gesammelt, um sie zu trocknen und zu Mehl zu verarbeiten. Was noch fehlte, lieferte das Vieh: drei Kühe und eine Schweinefamilie, Hasen und Hühner. Auf den Feldern und in den Gärten wuchsen Kartoffeln, Mais, Bohnen, Kohl und anderes Gemüse. In der Erntezeit kam viel Obst auf den Tisch. Alle hatten insgesamt ein hartes Leben, aber hungern musste niemand.
Ungefähr einmal im Monat kehrte der Schneider nach La Spezia zurück. Er holte die Lebensmittelkarten für die Familie ab und tauschte Erzeugnisse vom Land gegen Pakete mit Mehl oder Nudeln ein. Bei der Gelegenheit brachte er seiner Schwiegermutter Giulia einen Vorrat an Lebensmitteln vorbei. Durchsetzungsstark und stur, hatte Giulia nichts davon wissen wollen, mit der Familie nach Posara zu fliehen.
Alle Mühen, sie zu überreden, waren vergebens. Sie blieb allein in einem lichtlosen, tristen Keller in der Via Napoli zurück, überzeugt, dass einer alten Frau wie ihr eigentlich nichts Schlimmes widerfahren könne. Sie war seit vielen Jahren Witwe und hatte sich an ein völlig unabhängiges Leben gewöhnt. In ihren welken Gesichtszügen spiegelten sich noch letzte Reste ihrer einstigen Schönheit. Immer lächelnd, verließ sie ihr Haus nur perfekt geschminkt. Vor der Ausgangssperre kehrte sie manchmal in Begleitung eines älteren Verehrers zurück. Giulia verzichtete lieber auf Essen als auf ihren Lippenstift.
Wenn ihr Schwiegersohn kam, war sie immer in Feierlaune, weil er Käse und frische Eier mitbrachte oder ihr sogar aus alten Leintüchern eine neue Bluse genäht hatte. Und er erzählte Neuigkeiten von Anita, Giuliano, Marisa und den anderen Kindern.
Nicht einmal der 19. April 1943, an dem über La Spezia die Hölle hereinbrach, brachte Giulia aus der Fassung. In diesen Tagen warfen britische Bomber – 173 Lancaster und 5 Halifax – mehr als 1300 Tonnen Sprengkörper ab, um die Marinebasis und die große Reparaturwerft für die Militärflotte zu zerstören. Stattdessen verwüsteten sie vor allem die Altstadt. Über einhundertzwanzig Menschen starben, und fast tausend wurden verletzt.
Getroffen wurde auch das Gebäude, in dem Giulia wohnte, aber sie kam auf wundersame Weise davon. Rettungsmannschaften bargen sie aus ihrem Keller, mitsamt einem alten Freund. Als die Sirenen losgeheult hatten, waren sie nicht zum Bunker gerannt. Viele Jahre später sollte Giulia gestehen, dass sie den Alarm nicht gehört hatten, weil ihr Freund mit einer Flasche Wein gekommen war, der letzten, die er in seinem Keller gefunden hatte, obwohl er doch gedacht hatte, alle seien längst weg …
All dies ging dem Schneider durch den Kopf, als er durch die letzten Kurven fuhr. Beim Gedanken an Giulias Extravaganz lächelte er in sich hinein. Dass die Familie jetzt in die Stadt, seine Stadt, zurückkehren würde, machte ihn glücklich. Anita und die Kinder würden es mit Freuden aufnehmen. Für alle begann ein neues Leben.
Die fünf Kriegsjahre waren entsetzlich gewesen. Vor allem in der Endphase hatten überall in der Gegend die blutrünstigen SS-Truppen Walter Reders und die Schwarzen Brigaden aus Massa Massaker verübt. Im Sommer 1944 hatten sie erst in Sant’Anna di Stazzema, dann in Vinca und in Dutzenden weiteren umliegenden Dörfern über achthundert Alte, Frauen und Kinder ermordet. Für seinen ältesten Sohn Giuliano war die Lage zu gefährlich geworden. An Weihnachten 1944 überquerte er in der Dunkelheit die Frontlinie und schloss sich den Amerikanern an.
Auch er, der Schneider, sollte zum Glück mit heiler Haut davonkommen, als ihn Soldaten der X. MAS-Flottille, einer Spezialeinheit der italienischen Marine, anhielten: Am 20. Januar war er auf dem Rückweg mit dem Fahrrad von einer Fahrt nach La Spezia, als er in eine mobile Straßensperre geriet. Partisanen der Aktionsgruppen GAP hatten in der Stadt eine Straßenbahn angegriffen, in der Offiziere und Milizionäre der X. MAS saßen. Mehrere wurden getötet und Dutzende verletzt. An den Ausgängen der Stadt wurden Sperren errichtet, um alle Männer zusammenzutreiben, die sich auf der Straße blicken ließen. Der Schneider wurde sofort festgenommen und sein Fahrrad beschlagnahmt. Mit einem Dutzend weiterer Verzweifelter wurde er in einen großen Raum hinter einer Kasematte geführt, die dem Posten als Stützpunkt diente. Blutjunge Milizionäre, die ständig herumbrüllten, behielten ihn mit dem Finger am Abzug ihrer Maschinenpistolen im Auge. Der Schneider war in Panik. Vielleicht würden sie ihn sofort oder erst nach Folterungen erschießen. Wenn es gut ginge, landete er in einem Gefängnis und würde nach Deutschland in ein Lager verschleppt. Er verzweifelte beim Gedanken, seine Familie nie wiederzusehen.
Nach Stunden bangen Wartens kam ein junger Offizier herein, rief kurzerhand seinen Namen auf und trieb ihn mit der Waffe nach draußen. Der Schneider stand schon zur Erschießung bereit, als er seinen Namen rufen hörte. «Wie denn? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin’s, Antenore, Nives’ Son, dein Neffe.»
Die Familie des Schneiders waren Kommunisten und Regimegegner. Um einer Verhaftung zu entgehen, hatte sich einer seiner Brüder nach Frankreich abgesetzt: Er hatte während der ersten Aktionen der faschistischen italienischen Kampfbünde Widerstand geleistet. Die übrige Familie bestand aus Gewerkschaftlern, Handwerkern und Arbeitern, die verdeckt bei der Kommunistischen Partei und im Widerstand eingeschrieben waren. Einzige Ausnahme war der Sohn seiner Cousine Nives, ein Hitzkopf, aber ein hübscher Kerl, intelligent und zu Späßen aufgelegt. Er erinnerte sich noch gut an ihn, wie er als Kind mit seiner Mutter in die Schneiderei gekommen war, um einen Matrosenanzug genäht zu bekommen. Antenore hatte sich den Faschisten und der Republik von Salò freiwillig angeschlossen, in einer rebellischen Anwandlung oder vielleicht aus falsch verstandener Vaterlandsliebe. Die Familie hatte ihn aus dem Gedächtnis getilgt. Seitdem sie ihn in Uniform mit den Milizionären von Junio Valerio Borghese durch die Straßen ziehen gesehen hatten – sie waren für die blutigsten Vergeltungsakte an Partisanen verantwortlich –, wurde er totgeschwiegen. Und nun wollte es der Zufall, dass Antenore dieser Patrouille angehörte. Ehe er wusste, wie ihm geschah, wurde der Schneider von ihm im Schutz der hereingebrochenen Dunkelheit von der Kasematte weggeführt, auf sein Fahrrad gesetzt und zur abfallenden Straße geschoben. «Viel Glück, Onkel», rief er ihm warmherzig hinterher.
Der Schneider biegt in die letzte Kurve ein und hat das Gefühl, dass dies alles nun hinter ihm liegt. Er kann es kaum erwarten, seine Familie wiederzutreffen. Die ersten Häuser des Dorfs tauchen auf. Schluss mit den Tragödien. Schluss mit den Toten. Er will einfach nur noch feiern, die Treppen hochsteigen, Anita in die Arme schließen und sie vor den Kindern im Raum herumwirbeln …
Der Lastwagen, der nach Moncigoli hochfährt, hat Möbel geladen. Er ist als Einziger auf der Straße unterwegs. Der Fahrer ist ausgelassen. Mit einem Lied auf den Lippen schlägt er das Lenkrad ein, um die erste Kurve zu nehmen. Er ahnt nicht, dass der Radfahrer, der von oben her plötzlich auf der Straße auftaucht, einen Augenblick später unter seinen Rädern liegt und nicht mehr zu retten ist.
Der Schneider stirbt mit 44 Jahren. Sein tragisches Ende zeichnet seine ganze Familie für immer. Sofort macht in dem kleinen Tal die Nachricht vom Unglück die Runde. Der älteste Sohn läuft wie besessen zu der verfluchten Kurve, die nur wenige hundert Meter vom Dorf entfernt liegt. Am Unfallort kann er nichts mehr tun, als den leblosen Körper des Vaters mit dem entstellten Gesicht an sich zu drücken und seine Verzweiflung hinauszuschreien.
Mit einem Schlag waren alle Träume, alle Hoffnungen auf ein besseres Leben verflogen. Dem Sohn, noch keine zwanzig Jahre alt, blieb zur Bewältigung seiner Trauer keine Zeit. Er musste sich um die Familie, seine Mutter und die vier jüngeren Geschwister kümmern und um das Kind, das in wenigen Monaten zur Welt kommen würde.
Jahre vergingen, bis wieder ein Lächeln auf seinem Gesicht erschien – als er das Neugeborene in den Armen hielt, das seine Frau Lea soeben zur Welt gebracht hatte. Fünf Jahre lag das Unglück zurück, als Giuliano beschloss, dem Kleinen den Namen seines Vaters, des Schneiders, zu geben: Guido Tonelli.
1.
Die Mutter von allem
Dass im Begriff «Materie» das lateinische mater – «Mutter» – steckt, scheint auf deren Rolle als das Urelement zu verweisen, aus dem alles hervorgegangen ist. In Wahrheit zeigt seine Etymologie zahlreiche Facetten und gibt ihm eine Vielfalt an Bedeutungen.
Bei «Materie» denkt man vor allem an anorganisches Material, also an etwas Regloses und eher Festes. Hier tappt man in eine Falle: Wir bewerten Materie als etwas von uns Verschiedenes, weil wir als Menschen uns immer etwas überheblich als Wesen sehen, die aus einer ganz besonderen Substanz bestehen. Fast scheint es so, als betreffe uns die Frage der Materie nicht näher, als bestünden wir aus einem weitaus erhabeneren Stoff, der sogenannten belebten Materie.
Dieses jahrtausendealte Vorurteil ließ gewaltige Gedankengebäude entstehen, rief aber auch vermessene Anwandlungen hervor, die immer wieder zu Missverständnissen führten, die einen näheren Blick lohnen. Unser Körper, also die Materie, aus der wir bestehen, spielt in unserem Leben und unserer Weltanschauung eine alles entscheidende Rolle, auch wenn wir dies gerne übersehen oder es nicht wahrhaben wollen.
Ein Wort mit tiefen Wurzeln
Dem lateinischen materia entspricht der griechische Ausdruck ὕλη(hyle), der unter anderem auch «Holz» oder «Hölzernes» bedeutet. Er leitet sich aus der gleichen etymologischen Wurzel wie der lateinische Ausdruck silva für «Wald» her, der aber auch für «Materie» oder «Substanz» steht und zugleich mit dem rabbinischen hiiuli für «Urstoff» zusammenhängt.
Davon redet Giacomo Leopardi auf diffuse Weise in seinem Werk Zibaldone, einer Sammlung von Aphorismen zur Literatur und Philosophie. Dass hyle ursprünglich das Holz des Waldes bezeichnete, erinnert uns daran, dass dieser Rohstoff in frühen Gesellschaften das wichtigste Baumaterial war. Nach einer Bedeutungsverschiebung bezeichnete der Begriff eine gestaltlose Ursubstanz, aus der dank eines Ordnungsprinzips die Vielfalt der realen Welt hervorgeht. Diese weibliche Kennzeichnung blieb im Wort «Materie» als ein passives, formbares Element erhalten. In anderen romanischen Sprachen, so dem Spanischen oder Portugiesischen, blieb dieser «mütterliche» Aspekt in der Bezeichnung für Holz erhalten: madera beziehungsweise madeira.
Im Italienischen bezeichnet madre – wieder für «Mutter» – in der bäuerlichen Sprache auch den Wurzelstock oder den Baumstumpf, aus dem neue Sprosse hervorgehen, also einen pflanzlichen Schoß, der das neue, das biegbare und bearbeitbare Holz hervorbringt. Hier steht die Materie für das allergeschmeidigste und vielseitigste Material, das sich zu allen möglichen Zwecken verarbeiten lässt.
Diese enge Verbindung zur Zeugung klingt im Mythos des Hylas (in dem hyle steckt) an, des schönen Jünglings, in den Herakles sich unsterblich verliebt und den er zu seinem Gespielen macht. Beide begeben sich mit Jason und den Argonauten auf die Suche nach dem Goldenen Vlies. Auf einem Landgang wird Hylas losgeschickt, um Wasser aus einer Quelle zu schöpfen, und trifft dort auf die Nymphe Dryope und ihre Schwestern. Sie verlieben sich ebenfalls in ihn und entführen ihn in eine Unterwasserhöhle, aus der er nie wieder auftauchen wird.
Bei den weiblichen Naturgeistern, dem Wasser und der Grotte denken wir unweigerlich an das lebenspendende Prinzip, an den Bauch, in dessen Dunkelheit und Feuchtigkeit das embryonale Leben heranreift, behütet und genährt wird. Und so führt der Mythos den Begriff der Materie, der im Sprachgebrauch paradoxerweise deren leblosen, kalten und unbeseelten Bestandteil bezeichnet, wieder auf seine ursprüngliche Bedeutung des Mütterlichen zurück, der des ersten lebenden Materials, zu dem wir über Monate einen vielschichtigen Kontakt unterhielten: Der weibliche Körper hat uns geboren.
Der Rest der Geschichte ist einfacher: Das Holz steht mit seinem Namen für den ersten Urstoff, für die allgemeinste körperliche Substanz, die jede Masseverteilung im Raum auszeichnet. Aber mit dieser umfassenden Benennung, die ihr etwas greifbar Konkretes und Körperliches gibt, wird diese Substanz Gegenstand der Spekulation, einer philosophischen Beschäftigung, die sich durch die Menschheitsgeschichte zieht: Denn auch wir, die wir uns als bewusst denkende Wesen, als edle beseelte Materie begreifen, bestehen aus gewöhnlichem Material, und noch dazu aus einem besonders verletzlichen.
Weil wir Sapiens sind, eine besondere Art Menschenaffen, liegt der Fall bei uns noch komplizierter. Unser Sein als soziale Wesen beruht auf etwas Tieferem und Grundlegenderem als auf der schlichten Tatsache, dass wir in organisierten Gruppen leben. Vermittelt über Blicke und Sprache, über den Körperkontakt, über ein Geben und Nehmen von Nahrung, über Akte der Fürsorge und affektive Beziehungen, stehen wir mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft in einem Austausch, der als Prozess für das Heranreifen des Individuums grundlegend ist. Kurzum, erst der Blick und die Gefühle, die wir uns in der sozialen Gemeinschaft wechselseitig entgegenbringen, machen uns zu Menschen.
Das plastische und vielseitige Gehirn des Neugeborenen entwickelt sich in der Beziehung mit der Welt, vermittelt über die Erwachsenen, die sich seiner annehmen, ausgehend vom Blick der nährenden Mutter. Das Kind, das in ihre Augen schaut, passt seine Synapsen aufgrund der Reaktionen an, die im Verlauf dieser Beziehung entstehen.
Der Antrieb, unsere Kinder zu ernähren und zu beschützen, ist biologischen Ursprungs, ein notwendiges Verhalten für den Fortbestand der Spezies. Wir gehören der Klasse der Säugetiere an, der die Evolution mit einer genialen Erfindung einen enormen Vorteil in der natürlichen Auslese beschert hat: Die weiblichen Individuen können ihren Nachwuchs mit Milch ernähren, im Fall von uns Menschen sogar über viele Jahre. Diesem Merkmal, das sich in urtümlichen Lebensformen vor ungefähr zweihundert Millionen Jahren herausgebildet hat, soll es zu verdanken gewesen sein, dass die Säugetiere den gesamten Planeten erobert haben. Tatsächlich haben sie rasant alle ökologischen Nischen besetzt, die mit dem Verschwinden der Dinosaurier frei wurden.
Entsprechendes gilt für die Hominiden, von denen wir abstammen. Dieses uranfängliche mütterliche Spenden von Nahrung an den Nachwuchs, der Austausch von Blicken in einem stummen Dialog, der von Beschützen und Dankbarkeit geprägt ist, bildet wohl die Grundlage jeder sozialen Bindung und einer Sprache, die sich in den kommenden Millionen Jahren weiterentwickeln wird. Das Staunen angesichts der aus der prallen Mutterbrust hervorquellenden Nahrung für alle – auch für Erwachsene der Sippe, wenn Mangel das Überleben der Gruppe gefährdete – spiegelt sich in den ersten künstlerischen Zeugnissen der Sapiens wider: Die Dutzenden prähistorischer Venus-Figuren, die bei Ausgrabungen zum Vorschein kamen, diese Muttergottheiten, die für die archetypische Fülle stehen, sind allesamt mit prallen Brüsten und eindrucksvollen Gesäßen dargestellt.
Aber der materielle Körper von uns allen, der eine so bedeutende Rolle dabei spielt, erste identitätsstiftende soziale Beziehungen aufzubauen, ist auch am anderen Ende der Existenz, im Augenblick des Todes, mit symbolischer Bedeutung aufgeladen.
Trauer- und Fürsorgerituale um die Toten
Nach einem Unglück, wie es die Familie meines Vaters erschütterte, durchlebt die gesamte kleine Gemeinschaft des Opfers wieder das allerälteste Trauma. Der Körper eines jungen Mannes, robust und voller Lebenskraft, erschlafft von einem Augenblick zum anderen zu einer leblosen Masse.
Die äußerste Zerbrechlichkeit des menschlichen Daseins hallt bereits in den Worten des Achilles wider, des bedeutendsten Helden der griechischen Antike, der so über das Leben spricht: «Nichts sind gegen das Leben die Schätze […] Aber des Menschen Geist kehrt niemals, weder erbeutet, [n]och erlangt, [zurück,] nachdem er des Sterbenden Lippen entflohn ist.» Über das Schicksal aller Sterblichen entscheiden die drei Moiren, Töchter des Zeus und der Ananke, der Göttin der Notwendigkeit. Aus dem uranfänglichen Chaos mit Chronos, der Zeit, geboren, hält sie diesen zum Zeichen eines unauflöslichen Bandes wie eine Schlange umschlungen.
Wenn Atropos, die Unabwendbare, den von Klotho gesponnenen und von Lachesis bemessenen feinen Faden durchschneidet, ist das Schicksal besiegelt: Selbst der stärkste Held sackt wie eine Marionette zu Boden und bleibt als ein Häuflein verrenkter Glieder liegen. In den schrecklichen Gefechten, die unter den prachtvollen Mauern Ilions toben, verwandeln sich die kraftstrotzenden Körper der jungen Helden, die einen Augenblick zuvor noch unsterblich erschienen, in zerschmetterte Knochen, entstellte Gesichter, Blut und Eingeweide. Alle ihre Träume, Gefühle und Leidenschaften lösen sich in nichts auf.
Trotz der unglaublichen Fortschritte, die uns ein Leben bescheren, das deutlich länger und komfortabler ist als das unserer Vorfahren, begleitet uns nach Jahrtausenden immer noch das Bewusstsein unserer inhärenten Zerbrechlichkeit. Eine fatale Unaufmerksamkeit, ein winziges Virus, eine Gruppe von Zellen, die bei ihrer endlosen Replikation Amok laufen, oder ein jäh geplatztes Blutäderchen genügen, damit wir auch heute noch das Trauma eines Todesfalls verarbeiten müssen. Jeden Tag hallt auf unseren Straßen oder auf den Intensivstationen der Krankenhäuser der verzweifelte Schrei meines Vaters Giuliano wider, als er den zerschmetterten Leichnam seines Vaters Guido, des Schneiders, an sich drückte: «Papa! Papa! Atme! Sag was! Verlass mich nicht!»
Um das Trauma des Verlusts zu lindern, entwickelten menschliche Gemeinschaften von Anbeginn an Trauer- und Bestattungsrituale: Sie erwiesen dem gemarterten Körper Achtung, wuschen ihn, balsamierten ihn mit duftenden Essenzen ein, bemalten ihn mit rotem Ocker, überschminkten seine entstellten Züge, schmückten ihn mit kostbaren Ornamenten, bekleideten ihn mit den Lieblingsgewändern, bedeckten das Gesicht mit einer Totenmaske aus Edelmetall oder gaben der oder dem Verstorbenen geliebtes Spielzeug, besonderen Schmuck, Insignien der Herrschaft oder bescheidene Werkzeuge aus dem Berufsleben mit. Und in monumentalen Grabstätten begleiteten Inschriften, Porträts, Wandfresken und gesungene Hymnen den Toten auf seiner Reise ins Jenseits.
Im Zentrum jedes Bestattungsrituals steht der Körper des Verstorbenen, den uralte Tabus davor bewahren sollen, von wilden Tieren gefressen zu werden.
Die Lanze des Achilles, des stärksten Achäers, hat Hektors Kehle durchbohrt. Dem trojanischen Helden bleibt gerade noch Zeit für letzte Worte. Noch rasend vor Zorn, zieht Achilles, der Sohn des Peleus, die blutige Waffe aus seinem Hals und reißt ihm die prachtvolle Bronzerüstung vom Leib, die er seinem geliebten Freund Patroklos geraubt hat. Mit dem Vorsatz, den Leichnam des Sterbenden den Hunden zum Fraß vorzuwerfen und ihn von Vögeln zerhacken zu lassen, durchbohrt er seine Füße, zieht ein Seil durch die Löcher und bindet es an seinen Streitwagen an. Mit dem noch warmen Leichnam im Schlepptau peitscht er die Pferde zu einem Galopp an, der bis vor die Mauern der feindlichen Stadt führt. Entsetzt schauen die Trojaner dabei zu, wie Achilles Hektors Leichnam schändet.
Tagelang bleibt der Körper des Feindes sich selbst überlassen in einigem Abstand zu Achilles’ Zelt bei den angelandeten achaiischen Schiffen liegen. Durch ein göttliches Eingreifen wagen sich kein Hund und kein Vogel heran, um von seinem Fleisch zu fressen. Im Gegenteil, es verheilen seine Wunden, auch jene, die Achilles dem Toten beigebracht hat. Kein Leichengeruch wird den Leib des in der Schlacht gefallenen Helden entweihen.
Endlose zwölf Tage hält sich dieses Wunder, worauf mitten in der Nacht Hektors alter Vater Priamos zum Zelt des Achilles eilt, mit einem Wagen voller Schätze, um die Herausgabe seines gefallenen Sohnes zu erflehen. Der Alte erniedrigt sich vor dem Feind, umklammert seine Knie, küsst die Hände, die ihn hingeschlachtet haben, um ihn wenigstens tot zurückzubekommen. Er möchte sich um seine sterblichen Überreste kümmern, wie Brauch und Anstand es verlangen. An diesem Punkt gibt der rachsüchtige Achilles, der gnadenlos zwölf junge Trojaner niedermetzeln und auf Patroklos’ Scheiterhaufen verbrennen ließ, dem Flehen des alten Königs nach.
Für die alten Griechen war die Unverletzlichkeit des Leichnams ein so hochheiliges Gut, dass die Episode aus der Ilias für alle nachfolgenden Waffenstillstände zu einem idealen Bezugspunkt wurde. Selbst in den blutigsten Konflikten halten Heere einen Augenblick inne, um die Gefallenen auszutauschen. Beeindruckenderweise hält sich diese Praxis bis in unsere Zeit: Man blicke nur auf die Chronik des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Selbst in den schrecklichsten Konflikten des 21. Jahrhunderts, trotz der mit Raketen und Satellitentechnologie ausgetragenen Gefechte, gibt es im Anschluss an ein antikes Ritual einen Augenblick der Gnade. Dann schweigen die Waffen, und Soldaten laden sich die sterblichen Überreste der in Feindeshand verbliebenen Kameraden auf die Schultern.