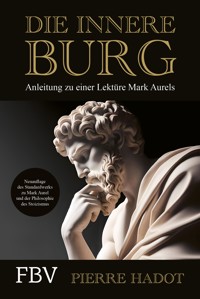
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Selbstbetrachtungen Mark Aurels werden heute – wie schon seit Jahrhunderten – als eine unerschöpfliche Quelle der Weisheit geschätzt. Sie sind eine der wichtigsten Ausdrucksformen des Stoizismus und damit ein unverzichtbarer Text für jeden, der sich für die antike Philosophie interessiert. Pierre Hadot, ein herausragender Kenner des antiken Denkens, lehrte als Professor für Philosophie am berühmten Collège de France in Paris. Er hat hier ein Standardwerk geschaffen – nicht nur zum Verständnis von Leben und Werk Mark Aurels, sondern auch der stoischen Philosophie allgemein. Daher kann diese Einführung in die Selbstbetrachtungen auch als eine Einführung in den antiken Stoizismus gelesen werden. Pierre Hadots Buch ist eine fesselnde Studie des Philosophenkaisers. Zudem vermittelt es ein umfassendes Verständnis der Tradition und der Lehren des Stoizismus und gibt einen verständlichen Einblick in die Kultur des römischen Reiches im zweiten Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Pierre Hadot
Die innere Burg
Anleitung zu einer Lektüre Mark Aurels
Pierre Hadot
Die innere Burg
Anleitung zu einer Lektüre Mark Aurels
Die Übersetzung wurde vom Autor durchgesehen und autorisiert.
Für die vorliegende Neuauflage wurde der Text redaktionell überarbeitet.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2025
© 2025 by Finanzbuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Copyright der Originalausgabe © Librairie Arthème Fayard, 1992 et 1997. Die französische Originalausgabe erschien 1992 und 1997 bei Librairie Arthème Fayard unter dem Titel La Citadelle Intérieure. Die deutsche Übersetzung erschien zum ersten Mal 1997 bei Vito von Eichhorn GmbH & Co. Verlag KG
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Beate von der Osten, Makoto Ozaki
Redaktion: Kerstin Brömer
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: Aobe Stock/Von David
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-809-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-582-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorrede
I Der Kaiser-Philosoph
1. Eine glückliche Jugend, eine stürmische Regierungszeit
2. Die Entwicklung zur Philosophie
3. Sorglosigkeit eines jungen Prinzen – Träume von strengem Leben
4. Junius Rusticus
5. »Ariston« oder »Aristo«?
6. Lehrer und Freunde
7. Der Kaiser-Philosoph
II Erste Annäherung an die Selbstbetrachtungen
1. Schicksal eines Textes
2. Der Titel
3. Hypothesen über die literarische Gattung des Werkes
4. Ein befremdliches Werk
5. Die Selbstbetrachtungen als persönliche Notizen (hypomnémata)
III Die Selbstbetrachtungen als geistige Übungen
1. Die »Praxis« und die »Theorie«
2. Die Dogmen und ihre Formulierung
3. Die drei Lebensregeln
4. Übungen in Einbildungskraft
5. Die Niederschrift als geistige Übung
6. »Griechische« Übungen
IV Der Sklaven-Philosoph und der Kaiser-Philosoph Epiktet und die Selbstbetrachtungen
1. Reminiszenzen an philosophische Lektüren
2. Die Lehre Epiktets
3. Epiktet-Zitate in den Selbstbetrachtungen
4. Die drei Lebensregeln nach Epiktet
5. Ein Einfluss von Ariston?
V Der Stoizismus des Epiktet
1. Allgemeine Charakteristika des Stoizismus
2. Die Teile der Philosophie nach den Stoikern
3. Die drei Tätigkeiten der Seele und die drei Übungsthemen nach Epiktet
4. Die drei Übungsthemen und die drei Teile der Philosophie
5. Die Kohärenz des Ganzen
VI Der Stoizismus der Selbstbetrachtungen Die innere Burg oder die Disziplinierung der Zustimmung
1. Die Disziplinierung der Zustimmung
2. Die innere Burg
VII Der Stoizismus der Selbstbetrachtungen Die Disziplinierung des Begehrens oder Amor Fati
1. Disziplinierung des Begehrens und Disziplinierung des Handelns
2. Die Gegenwart begrenzen
3. Die Gegenwart, das Ereignis und das kosmische Bewusstsein
4. Amor fati
5. Vorsehung oder Atome?
6. Pessimismus?
7. Die Ebenen des kosmischen Bewusstseins
VIII Der Stoizismus der Selbstbetrachtungen Die Disziplinierung des Handelns oder die Handlung im Dienst der Menschen
1. Die Disziplinierung des Handelns
2. Der Ernst der Handlung
3. Die »angemessenen Handlungen« (kathékonta)
4. Die Ungewissheit und die Sorge
5. Die moralische Absicht oder das Feuer, das jeder Stoff nährt
6. Die innere Freiheit gegenüber den Handlungen: Reinheit und Einfachheit der Absicht
7. Die »Vorbehaltsklausel« und die Übungen zur Vorbereitung darauf, Schwierigkeiten zu begegnen
8. Verzicht?
9. Der Altruismus
10. Handlung und Wert, Gerechtigkeit und Unparteilichkeit
11. Mitleid, Sanftmut und Wohlwollen
12. Die Liebe zum Mitmenschen
IX Der Stoizismus der Selbstbetrachtungen Die Tugenden und die Freude
1. Die drei Tugenden und die drei Disziplinierungen
2. Die Freude
X Mark Aurel in seinen Selbstbetrachtungen
1. Der Autor und sein Werk
2. Die Grenzen der psychologischen Geschichtsschreibung
3. Das stilistische Bemühen
4. Chronologische Hinweise
5. Die Bücher II bis XII
6. Das Andenken an die Dahingeschiedenen
7. Die »Bekenntnisse« des Mark Aurel
8. Verus oder Fictus – »Aufrichtiger« oder »Heuchler«
9. Die Einsamkeit des Kaisers, die Einsamkeit des Philosophen
10. Politische Vorbilder
11. »Hoffe nicht auf Platons Staat«
Schlussbetrachtung
Anhang
Anmerkungen
Literatur
Register der Zitate aus Mark Aurels Selbstbetrachtungen
Register der Zitate aus den Unterredungen des Epiktet
Vorrede
»Nah ist die Zeit, dass du alle vergisst,
nah die Zeit, dass alle dich vergessen.«
(Selbstbetrachtungen, VII,21)
In diesem Punkt hat sich Mark Aurel getäuscht. Achtzehn Jahrhunderte (fast zweitausend Jahre!) sind vergangen, und seine Selbstbetrachtungen sind noch immer gegenwärtig. Jene Seiten blieben nicht nur einigen Geistesaristokraten wie Shaftesbury, Friedrich II. oder Goethe vorbehalten, sondern haben jahrhundertelang zahllosen Unbekannten, die sie in den vielen, rund um den Erdball entstandenen Übersetzungen lesen konnten, einen Lebenssinn gegeben und tun dies bis heute.
Unerschöpfliche Quelle der Weisheit, »ewiges Evangelium«, wird Renan sie nennen. Anscheinend bereiten die Selbstbetrachtungen des Mark Aurel ihrem Leser keine besonderen Schwierigkeiten. Scheinbar beziehungslos folgen Aphorismen oder kurze Abhandlungen aufeinander, und beim Blättern wird der Leser mit Sicherheit auf die eine oder andere eindrucksvolle oder bewegende Formel stoßen, die für sich selbst zu sprechen und keinerlei Exegese zu bedürfen scheint. Es ist zudem ein Buch, welches man nicht in einem Zuge lesen kann. Man muss oft zu ihm zurückkehren, um, je nach Tagesstimmung, darin etwas zu entdecken, das den augenblicklichen Seelenzustand nähren kann. Auch heute noch können die Leser diesen oder jenen Aphorismus Mark Aurels – so wie zum Beispiel den eingangs als Epigraf zitierten – vollkommen verstehen. Und genau das wird uns an den Selbstbetrachtungen stets anziehen: jene Sentenzen, deren Klarheit alterslos ist.
Eine gleichwohl trügerische Klarheit! Denn daneben stehen andere, weit weniger klare Formeln, die von den Historikern in sehr unterschiedlicher Weise verstanden worden sind. Der eigentliche Sinn des Buches, sein Zweck, manche seiner Aussagen sind für uns schwer zu erfassen. Dies liegt nicht an Mark Aurel selbst. Unser Verständnis der antiken Werke hat sich aus den verschiedensten Gründen, wobei die zeitliche Entfernung nicht der wichtigste ist, immer mehr getrübt. Um erneut Zugang zu ihnen zu finden, müssen wir eine Art geistiger Übung, eine intellektuelle Askese betreiben, um uns von einer Anzahl vorgefasster Meinungen zu befreien und etwas zu entdecken, was für uns fast eine andere Art des Denkens ist. Dies soll in dem vorliegenden Werk durchgängig versucht werden. Doch bevor wir uns auf diese Reise begeben, mag es vielleicht nützlich sein, uns der Vorurteile und Illusionen bewusst zu werden, die den modernen Leser in die Irre zu führen drohen, wenn er ein Werk der Antike in Angriff nimmt.
Zunächst wird er vielleicht glauben, jener Text sei seit der fernen Zeit, in der er erschienen ist, stets derselbe geblieben, so wie unsere heutigen gedruckten Werke. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die antiken Texte nicht gedruckt vorlagen: Jahrhundertelang wurden sie handschriftlich kopiert und beim Abschreiben ständig Fehler eingefügt. Dem Schreiber wird man dies allerdings kaum übelnehmen können, wenn man bedenkt, dass unsere heutigen Bücher, obgleich gedruckt, nicht selten von Druckfehlern wimmeln, die zuweilen die Gedanken des Autors sinnentstellen oder unverständlich machen. Doch das ist eine andere Geschichte. Wie dem auch sei, eines jedenfalls wird man nicht oft genug sagen können: Den Anstrengungen der Gelehrten, die die uns überlieferten Handschriften der antiken Werke sammeln und klassifizieren und mittels einer kritischen Methode zur Fehleraufschlüsselung versuchen, den Urzustand des Textes wiederherzustellen, ist es zu verdanken, dass wir heute die Werke der Antike in einem Zustand lesen können, der beinahe zufriedenstellend ist und der im Übrigen auch nie absolut vollkommen sein kann. Ich erlaube mir, diesen Punkt zu betonen, der zuweilen von gewissen Instanzen der Wissenschaft beziehungsweise Philosophiehistorikern ignoriert wird, die glauben, man könne die Theorien eines antiken Autors erörtern, ohne zu wissen, was er tatsächlich geschrieben hat. Im Falle Mark Aurels herrscht jedenfalls größte Ungewissheit über einige Wörter seines Textes, worauf noch zurückzukommen sein wird. Auch wenn dies nicht für das gesamte Werk gilt, stellen uns doch einige Passagen auch weiterhin vor fast unlösbare Schwierigkeiten, und es ist nicht verwunderlich, dass wir diese Probleme auch in den Übersetzungen wiederfinden.
Denn der moderne Leser könnte glauben, es gäbe nur eine mögliche Übersetzung des griechischen Textes, und er wird überrascht sein, welch beträchtliche Divergenzen häufig festzustellen sind. Diese Tatsache sollte ihm jedoch bewusst machen, wie weit wir von der Antike entfernt sind. Tatsächlich setzt die Übersetzung zuerst die Wahl der Lesarten des griechischen Textes voraus, in den Fällen nämlich, wo dieser, wie wir gesehen haben, nicht verlässlich ist. Das Zögern des Übersetzers hat jedoch auch mit den Schwierigkeiten des Textverständnisses und den vorliegenden, zuweilen radikal verschiedenen Interpretationen zu tun. Im Falle Mark Aurels beispielsweise wussten viele die dem stoischen System eigenen Termini technici, denen man auf jeder Seite der Selbstbetrachtungen begegnet, nicht genau wiederzugeben. Überdies ist bei Mark Aurel die Einteilung der Kapitel stets sehr unsicher, und oft kann man die Grenzen der einzelnen Selbstbetrachtungen nicht mit absoluter Sicherheit ziehen. Die Unterteilung des Textes kann daher sehr unterschiedlich sein.
Und schließlich mag der moderne Leser sich vorstellen (und niemand ist gefeit gegen diesen Irrtum), der antike Autor lebe in derselben intellektuellen Welt wie er. Er wird seine Behauptungen behandeln, als wären sie die eines heutigen Autors. Er glaubt, unmittelbar verstehen zu können, was jener sagen wollte, versteht ihn jedoch in anachronistischer Weise und läuft häufig Gefahr, groben Widersinn hineinzudeuten. Gewiss gehört es heutzutage zum guten Ton zu behaupten, dass wir ohnehin nicht wissen können, was ein Autor sagen wollte, und dass dies im Übrigen auch gar nicht wichtig sei, dürfen wir doch den Werken den Sinn geben, der uns gefällt. Für meinen Teil würde ich, ohne auf diese Polemik einzugehen, sagen, dass es mir möglich und notwendig scheint, vor dem »ungewollten« zunächst den »gewollten« Sinn des Autors zu entdecken. Es ist absolut unabdingbar, die Wiederherstellung eines ursprünglichen Sinnes anzustreben, auf den man sich anschließend berufen kann, um, wenn man will, die Sinngehalte aufzudecken, derer sich der Autor vielleicht nicht bewusst war. Aber diese Wiederherstellung fällt uns ohne Frage schwer, projizieren wir doch Haltungen und Absichten in die Vergangenheit hinein, die unserer Zeit zu eigen sind. Um die antiken Werke zu verstehen, ist es erforderlich, sie in ihren Kontext – im weitesten Sinne des Wortes – zurückzustellen, das heißt in die materielle, soziale und politische Situation ebenso wie in die rhetorische und philosophische Gedankenwelt. Vor allem muss man sich ins Gedächtnis rufen, dass sich die Mechanismen der literarischen Komposition grundlegend geändert haben. In der Antike waren die Regeln der Rede streng kodifiziert: Um zu sagen, was er sagen wollte, musste der Autor es auf eine bestimmte Art und Weise, entsprechend den traditionellen Modellen und gemäß den von Rhetorik und Philosophie vorgeschriebenen Regeln sagen. Die Selbstbetrachtungen des Mark Aurel beispielsweise sind kein spontaner Erguss einer Seele, die ihre Gefühle unmittelbar ausdrücken möchte, sondern eine nach bestimmten Regeln ausgeführte Übung; sie setzen, wie sich noch zeigen wird, Grundmodelle voraus, an die sich der Kaiser-Philosoph zu halten hat. Oft sagt er gewisse Dinge, weil er sie kraft der ihm auferlegten Modelle und Vorschriften sagen muss. Man wird die Bedeutung dieses Werkes also nur verstehen können, wenn man die vorgefertigten Schemata kennt, die ihm vorgeschrieben sind.
Unser Vorhaben, dem modernen Leser eine Einführung in die Lektüre der Selbstbetrachtungen vorzulegen, wird also vielleicht nicht nutzlos sein. Wir wollen herausfinden, was Mark Aurel bezweckte, indem er sie schrieb, ferner die Literaturgattung bestimmen, der sie angehören, vor allem ihr Verhältnis zu dem philosophischen System definieren, das sie inspiriert hat, und schließlich, ohne eine Biografie des Kaisers zu schreiben, enthüllen, was von seiner Persönlichkeit in seinem Werk in Erscheinung tritt.
Ich habe Wert darauf gelegt, umfangreich aus den Selbstbetrachtungen zu zitieren, denn ich habe etwas gegen Monografien, die mit dem Anspruch daherkommen, den Text zu entschlüsseln und das Nicht-Gesagte zu offenbaren, ohne dem Leser auch nur die leiseste Idee zu vermitteln, was der Philosoph wirklich »gesagt« hat, und sich dabei in verworrene Hirngespinste verwickeln, statt dem Autor das Wort zu erteilen und nah am Text zu bleiben. Eine solche Methode erlaubt bedauerlicherweise jede beliebige Sinnentstellung, jede Deformation. Unsere Zeit ist aus vielerlei Gründen fesselnd, allzu oft jedoch könnte man sie, unter dem philosophischen und literarischen Gesichtspunkt, als Zeitalter des Widersinns, wenn nicht gar des Wortspiels, definieren: alles Mögliche und Unmögliche über Mögliches und Unmögliches sagen! Wenn ich Mark Aurel zitiere, wünsche ich mir, der Leser möge Kontakt mit dem Text selbst aufnehmen, der allen Kommentaren überlegen ist, und sehen, wie die Interpretation versucht, sich auf den Text zu gründen, damit er meine Behauptungen direkt und unmittelbar überprüfen kann. Seit mehr als zwanzig Jahren arbeite ich über Mark Aurel, insbesondere an einer neuen Ausgabe und Übersetzung der Selbstbetrachtungen, die in den nächsten Jahren erscheinen wird1; im Laufe dieser Arbeit gingen Interpretation und Übersetzung Hand in Hand, und die ausgezeichnete Textausgabe und Übersetzung von W. Theiler sowie neuerdings die interessante Übersetzung von R. Nickel haben mir dabei sehr geholfen. Im Unterschied zu der französischen Fassung, die eine völlig neue, originale Übersetzung darbietet, übernimmt daher die deutsche Fassung gelegentlich die Übersetzungen von W. Theiler und R. Nickel oder lehnt sich an diese an, enthält aber vorwiegend gänzlich neue Übertragungen. Deshalb konnte ich den Leser, um meine Überlegungen zu illustrieren, kaum auf bestehende Übertragungen verweisen, die nicht immer genau der Idee entsprochen hätten, die ich mir von dem Werk des Kaisers und Philosophen gemacht habe.
Anmerkung zur Umschrift der griechischen Wörter und zu den Zitaten aus den Selbstbetrachtungen des Mark Aurel sowie den Unterredungen des Epiktet:
Es war zuweilen nützlich, auf einzelne griechische Termini hinzuweisen, die der stoischen Philosophie zu eigen sind. Ich habe versucht, die Umschrift so einfach wie möglich zu halten, indem ich é für den Buchstaben Eta und ô für den Buchstaben Omega verwendet habe.
Um die Zahl der Fußnoten nicht unnötig zu vermehren, wird auf die Zitate Mark Aurels und aus den Unterredungen des Epiktet im Text durch Klammern verwiesen. In beiden Fällen entspricht die erste Zahl der Nummer des Buches, die zweite der des Kapitels und die dritte der Nummer des Paragrafen in dem jeweiligen Kapitel. Sofern nicht anders vermerkt, beziehen sich die auf den Seiten 404 bis 405 angegebenen Verweise auf den Text der Unterredungen von Epiktet.
Die Übersetzungen legen die Textedition von J. Dalfen (Leipzig [Teubner] 19872), gelegentlich auch die von W. Theiler (Marc Aurel, Wege zu sich selbst [Zürich, Artemis-Verlag] 1974) zugrunde.
I Der Kaiser-Philosoph
1. Eine glückliche Jugend, eine stürmische Regierungszeit
Der künftige Mark Aurel, der diesen Namen später bei seiner Adoption durch den Kaiser Aurelius Antoninus Pius erhalten sollte, wurde im Jahre 121 in Rom geboren und trug zunächst den Namen Marcus Annius Verus. Die Familien seines Vaters und seiner Mutter besaßen zahlreiche Ziegeleien,1 was ein unermessliches Vermögen und eine beträchtliche Kapitalanlage darstellte. Überdies erlaubte dieser Reichtum den Fabrikbesitzern politische Einflussnahme, führte er sie doch oft zu Ämtern, durch die sie, wie im Fall des Großvaters von Mark Aurel, die Bauplanung beeinflussen konnten.
Nach dem Tod des Vaters, der sich in Marcus’ früher Kindheit ereignete, zog der Junge die Aufmerksamkeit Kaiser Hadrians auf sich, der ihn protegierte und begünstigte. Um seine Nachfolge zu sichern, adoptierte dieser kurz vor seinem Tod im Jahre 138 Antoninus, den angeheirateten Onkel des zukünftigen Marc Aurel, und bat ihn, seinerseits sowohl Marcus als auch Lucius Verus, den Sohn des jüngst verstorbenen Aelius Caesar, an Sohnes statt anzunehmen. Hadrian hatte zunächst Aelius Caesar zu seinem Nachfolger erkoren.
Am 10. Juli 138 tritt Antoninus die Nachfolge Hadrians an. Ein Jahr später, im Alter von achtzehn Jahren, wird der künftige Mark Aurel zum Thronfolger erhoben und heiratet 145 Faustina, die Tochter des Antoninus. Aus dieser Ehe gingen dreizehn Kinder hervor, von denen jedoch nur sechs das Kindesalter überlebten: fünf Töchter und ein Sohn – der spätere Kaiser Commodus.2
Der sich über fast drei Jahrzehnte, von 139 bis 166 oder 167 (dem Todesjahr Frontos3), erstreckende Briefwechsel zwischen Mark Aurel und Fronto, seinem Rhetoriklehrer, vermittelt uns wertvolle Einzelheiten über diesen Abschnitt im Leben Marc Aurels und über die Atmosphäre am Hofe des Antoninus: das Familienleben, die Krankheiten der Kinder, Jagd, Weinernte, Studien und Lektüre des zukünftigen Kaisers, die Rhetorikaufgaben, die er pünktlich an Fronto sendet, die liebevolle Freundschaft, die nicht nur Lehrer und Schüler, sondern auch deren Familien miteinander verbindet. Als Antoninus im Jahre 161 stirbt, wird Mark Aurel im Alter von 39 Jahren Kaiser und teilt sich das Regierungsamt sofort mit Lucius Verus, seinem Adoptivbruder.
Noch im Jahr ihrer gemeinsamen Thronbesteigung fallen die Parther in die Ostprovinzen des Imperiums ein. Der Feldzug beginnt mit einem Desaster für die römische Armee. Lucius wird daraufhin gen Osten entsandt, wo die römischen Truppen unter Führung zweier kriegserfahrener Generäle, Statius Priscus und Avidius Cassius, die Oberhand zurückgewinnen (163–166), ihrerseits ins Partherreich einfallen und sich der Städte Ktesiphon und Seleukeia bemächtigen.
Kaum waren die Triumphfeiern zu Ehren der beiden Kaiser nach ihrem Sieg (166) beendet, wurden neue, höchst alarmierende Nachrichten aus einer anderen Grenzprovinz des Reiches gemeldet: Germanische Stämme der Donauregion, die Markomannen und die Quaden, bedrohten Norditalien. Die zwei Kaiser mussten sich persönlich vor Ort begeben, um die Lage wieder in die Hand zu bekommen, und so verbrachten sie den Winter in Aquileia. Doch zu Beginn des Jahres 169 starb Lucius in dem Reisewagen, in dem er mit Mark Aurel fuhr. Die vom Kaiser geleiteten Militäroperationen in den Donaugebieten sollten sich noch bis in das Jahr 175 hinziehen.
In dem Augenblick, als er sich des Sieges sicher sein konnte (175), erreichte ihn die Nachricht vom Aufstand des Avidius Cassius, welcher sich eine Verschwörung, die verschiedene Ostprovinzen und Ägypten durchzog, zunutze gemacht hatte, um sich zum Kaiser proklamieren zu lassen. Wahrscheinlich war es die Treue des Statthalters von Kappadokien, Martius Verus, die Mark Aurel rettete. Auf jeden Fall erfuhr der Kaiser in dem Moment, da er sich anschickte, gen Osten aufzubrechen, von der Ermordung des Avidius Cassius, die dieser tragischen Episode ein Ende setzte.
Nichtsdestoweniger entschloss sich Mark Aurel zu einer Reise in die Ostprovinzen – in Begleitung Faustinas und ihres Sohnes Commodus. Sie führte ihn nach Ägypten, Syrien und Kilikien, wo seine Frau starb. Die antiken Geschichtsschreiber erinnern mit Vorliebe an die zahlreichen Ehebrüche Faustinas. Doch was es mit diesen üblen Gerüchten auch immer auf sich haben mag: Der Kaiser wurde durch diesen Verlust tief getroffen, und in seinen Selbstbetrachtungen (I,17,18) ruft er sich mit Rührung seine »so fügsame, so liebevolle, so aufrichtige« Frau in Erinnerung. Die Rückreise nach Rom führte ihn über Smyrna und Athen, wo er mit Commodus in die Eleusinischen Mysterien eingeweiht wurde. Am 23. Dezember 176 fanden in Rom die Feierlichkeiten anlässlich des Sieges über die Germanen und Sarmaten statt, doch kaum zwei Jahre später sollte Mark Aurel erneut zur Donaugrenze aufbrechen. Er starb am 17. März 180 in Sirmium oder Vindobona, dem heutigen Wien.
Mehr noch als durch die Kriege wurde das Imperium durch die Naturkatastrophen verwüstet: die Überschwemmungen des Tibers (161), die Erdbeben von Kyzikos (161) und Smyrna (178), vor allem jedoch durch die schreckliche Pestepidemie, die von den römischen Truppen durch den Partherkrieg (166) aus Asien eingeschleppt worden war. Wie J. F. Gilliam4 gezeigt hat, hat sie vielleicht nicht zu der von gewissen Historikern beschriebenen Entvölkerung geführt, die von diesen als entscheidende Ursache für den Untergang Roms angesehen wurde – ohne Frage zeitigte die Epidemie jedoch schwerwiegende Folgen für das soziale und politische Leben des Reiches.
Eine stürmische Regierungszeit: Von dem Augenblick, da Mark Aurel zur Kaiserwürde gelangte, brachen Naturkatastrophen, militärische und politische Schwierigkeiten, Sorgen und Trauerfälle in der Familie über ihn herein und zwangen ihn, sich täglich dem Kampf zu stellen.
Das nüchterne, doch begründete Urteil des Historikers Cassius Dio5 ist eines der genauesten, die je über ihn gefällt wurden: »Ihm war nicht das Glück vergönnt, das er verdient hätte […], sondern er fand sich zeit seiner Regierung mit einer Vielzahl von Unglücksfällen konfrontiert. Aus diesem Grund bewundere ich ihn mehr denn jeden anderen, gelang es ihm doch inmitten jener außerordentlichen und unvergleichlichen Schwierigkeiten, zu überleben und das Imperium zu retten.«
»Die römische Welt«, schrieb Ferdinand Lot,6 »hat eine Reihe von Herrschern einander auf den Thron folgen sehen, wie die Geschichte später nie wieder ihresgleichen hervorbringen sollte, und dies gerade seit der Zeit des Stillstands und anschließend des Verfalls der antiken Welt.« Und nachdem er als Beispiele unter anderem Mark Aurel, Septimius Severus, Diokletian, Julian und Theodosius aufgezählt hat, fährt er fort: »Als Staatsmänner, Gesetzesgeber und Krieger eilen sie von der Bretagne zum Rhein, vom Rhein zur Donau, von der Donau zum Euphrat, um die römische Welt und die Zivilisation gegen die germanischen oder sarmatischen Barbaren, gegen die Parther und später gegen die Perser zu verteidigen. Sie alle wissen, dass ihre Tage ständig bedroht sind. […] Und sie geben sich furchtlos ihrem tragischen Schicksal als Übermenschen hin. Denn wenn es jemals Übermenschen gegeben hat, so sind sie wohl unter den römischen Kaisern des 2. bis 4. Jahrhunderts zu suchen.« Die Persönlichkeit Mark Aurels muss unter dieser Perspektive betrachtet werden, wenn man sie auch nur ansatzweise verstehen will.
2. Die Entwicklung zur Philosophie
Ziel der vorliegenden Arbeit soll es indessen nicht sein, die Biografie eines jener »Übermenschen«7 zu verfassen, sondern wir wollen uns lediglich fragen, was Mark Aurel dazu geführt hat, die Selbstbetrachtungen zu schreiben, das heißt, wie er Philosoph geworden ist, und wie dieses Werk für ihn einen Teil seiner philosophischen Tätigkeit repräsentieren konnte.
Ein Philosoph in der Antike ist – und dies sei hier noch einmal betont – in erster Linie nicht notwendigerweise ein Theoretiker der Philosophie, wie man gerne annimmt. Ein Philosoph in der Antike ist jemand, der als Philosoph lebt, der ein philosophisches Leben führt. Cato der Jüngere, ein Staatsmann des 1. Jahrhunderts v. Chr., ist ein stoischer Philosoph und hat dennoch keine philosophische Schrift verfasst. Rogatianus, ein Staatsmann des 3. Jahrhunderts n. Chr., ist ein platonischer Philosoph, ein Schüler Plotins, und hat ebenfalls keine philosophische Schrift verfasst. Beide aber betrachten sich selbst als Philosophen, weil sie sich die philosophische Lebensweise zu eigen gemacht haben. Und es ließe sich wohl kaum behaupten, sie seien bloß Amateure auf dem Gebiet der Philosophie gewesen. In den Augen der Meister der antiken Philosophie ist der echte Philosoph nicht derjenige, der sich mit Theorien auseinandersetzt und Autoren kommentiert. Wie Epiktet, der Stoiker, der einen beträchtlichen Einfluss auf Mark Aurel ausgeübt hat, sagte (III,21,5–6): »Iss wie ein Mensch, trink wie ein Mensch, kleide dich, heirate, zeuge Kinder, führe ein bürgerliches Leben. […] Zeige uns das, damit wir wissen, ob du wahrhaftig etwas von den Philosophen gelernt hast.«8
Für den antiken Philosophen besteht also keine Notwendigkeit zu schreiben. Und wenn er sich doch dazu entschließt, muss er weder eine neue Theorie erfinden, noch diesen oder jenen Teil eines Systems entwickeln. Es genügt ihm, die Grundprinzipien der Schule zu formulieren, zugunsten derer er sich in seiner Lebensführung entschieden hat. Indem Mark Aurel die Selbstbetrachtungen schreibt, hat er nichts Neues erdacht, hat auch die stoische Doktrin nicht weiterentwickelt. Deshalb lässt sich jedoch nicht behaupten, er sei kein Philosoph, und schon gar nicht, er sei kein stoischer Philosoph gewesen.9
Umgekehrt bedeutete die Tatsache, Philosophieunterricht genommen zu haben, nicht unbedingt, dass man ein Philosoph war. Lucius Verus, der Adoptivbruder Mark Aurels, wurde von denselben Philosophielehrern wie dieser unterrichtet, und doch käme niemand auf den Gedanken, ihn als Philosophen zu betrachten.10 Der lateinische Schriftsteller Aulus Gellius, ein Zeitgenosse Mark Aurels, ist in Athen Schüler des platonischen Philosophen Taurus gewesen. Unbestreitbar hat er ein Interesse an der Philosophie, wie die zahlreichen in seinem Werk zitierten philosophischen Texte belegen – zu einer philosophischen Lebensführung bekennt er sich indes nicht. Den Rednern und Staatsmännern boten die Philosophiekurse eine Ausbildung in Dialektik, einen Stoff, um Gemeinplätze in ihren Reden zu entwickeln. Wie Fronto an Mark Aurel schrieb: »Die Philosophie wird dir die Grundlage, die Rhetorik die Form deiner Rede vermitteln.«11 Jedoch fühlen sie sich nicht verpflichtet, als Philosophen zu leben. Eben deshalb mahnen die von Arrian überlieferten Unterredungen des Epiktet die Hörerschaft des Philosophen fortwährend daran, dass die Philosophie nicht in der dialektischen Gewandtheit oder der Schönheit der Sprache bestehe, sondern in der Art und Weise, wie man sein alltägliches Leben lebe. Philosoph zu sein heißt nicht, eine theoretische philosophische Ausbildung erfahren zu haben oder Philosophielehrer zu sein, sondern bedeutet, sich nach einer Umkehr, die eine radikale Veränderung des Lebens bewirkt, zu einer Lebensweise zu bekennen, die sich von der anderer Menschen unterscheidet.
Es wäre äußerst interessant, die Art und Weise, in der sich Mark Aurels Hinwendung zur Philosophie vollzogen hat, in all ihren Einzelheiten zu kennen. Viele Punkte sind jedoch bis heute unklar geblieben. Über die Entwicklung Mark Aurels besitzen wir im Wesentlichen zwei Zeugnisse, deren erstes der bereits erwähnte Briefwechsel zwischen Mark Aurel und seinem Rhetoriklehrer Fronto ist. Leider ist er uns nur in einem im 19. Jahrhundert entdeckten Palimpsest überliefert worden. Die Briefsammlung ist also von einer anderen Schrift überdeckt, und die Chemikalien, die angewandt wurden, um die Lektüre zu erleichtern, haben das Dokument endgültig zerstört, sodass es häufig unleserlich und lückenhaft ist. Das zweite Zeugnis stammt vom Kaiser selbst, der sich im ersten Buch der Selbstbetrachtungen all das wieder ins Gedächtnis ruft, was er seinen Eltern, seinen Lehrern und seinen Freunden verdankt: ein äußerst kurzgefasster Text, der uns überaus unbefriedigt lässt. Wie dem auch sei: Dank der spärlichen Hinweise, die wir hier und da auflesen können, lässt sich eine gewisse Anzahl von Phasen in Mark Aurels Entwicklung zur Philosophie bestimmen. Gleichwohl die spätere Hagiografie versichert hat, er sei seit seiner Kindheit »ernsthaft«12 gewesen, lässt sich zunächst eine Periode jugendlicher Sorglosigkeit feststellen, die sich bis ins Alter von zwanzig Jahren zu erstrecken scheint, also bis in die Zeit hinein, da er bereits zum Thronfolger ernannt worden war. Denkbar ist jedoch, dass unter dem Einfluss des Diognetos, eines seiner Lehrer, von denen Mark Aurel in den Selbstbetrachtungen spricht (I,6), der Wunsch, als Philosoph zu leben, schon während dieser Periode heranreifte.
Die Bekehrung Mark Aurels zur Philosophie scheint das Werk des Junius Rusticus gewesen zu sein, der ihm die Lehre Epiktets offenbarte, und lässt sich wahrscheinlich auf die Jahre 144–147 datieren. Jedenfalls schreibt Mark Aurel 146/147 im Alter von fünfundzwanzig Jahren einen Brief an Fronto, der über seine nunmehrige Geisteshaltung keinen Zweifel lässt. Darüber hinaus spielt Fronto in den ersten Jahren nach der Thronbesteigung fast ständig auf die philosophische Lebensweise seines kaiserlichen Schülers an.
3. Sorglosigkeit eines jungen Prinzen – Träume von strengem Leben
Mark Aurels Briefe an Fronto, vor allem jene, die er als junger Thronfolger von achtzehn oder zwanzig Jahren schrieb, gestatten uns einen flüchtigen Blick auf die schlichte Art des Familienlebens, welche am Hof seines Adoptivvaters Antoninus gepflegt wurde, vor allem in den kaiserlichen Villen fernab von Rom, in die dieser sich oft und gern zurückzog. Man beteiligte sich an der Traubenlese, es gab keinerlei Luxus, weder üppige Mahlzeiten noch geheizte Räume. Der zukünftige Kaiser liebte die körperliche Betätigung, vor allem die Jagd, der er offenbar ohne große Rücksicht auf seine Untertanen nachging. Dies verrät uns zumindest ein Brief, dessen Anfang uns nicht erhalten geblieben ist und der sich auf die Jahre 140–143 datieren lässt.
»[…] Als mein Vater aus den Weinbergen heimkehrte, bestieg ich wie gewohnt das Pferd; ich machte mich auf den Weg, und wir entfernten uns allmählich. Und da, mitten auf der Straße, befand sich eine große Herde Schafe. Der Ort war fast verlassen: vier Hunde und zwei Schäfer und weiter nichts. Als er den Trupp Reiter herankommen sah, sagte der eine Schäfer zum anderen: ›Siehst du die Reiter dort? Das sind jene, die die schlimmsten Raubzüge zu veranstalten pflegen.‹ Kaum habe ich das gehört, gebe ich meinem Pferd die Sporen und stürme mitten in die Herde. Die aufgeschreckten Tiere stieben blökend in alle Himmelsrichtungen wild durcheinander davon. Der Hirte wirft seinen Stock in meine Richtung. Er trifft den Reiter hinter mir. Wir fliehen. So verlor einer, der befürchtete, ein Schaf zu verlieren, seinen Stock. Du glaubst, diese Geschichte ist erfunden? Nein, sie ist wahr. Es gäbe noch mehr darüber zu berichten, aber man kommt, um mich zum Bade abzuholen.«13
Bei diesem Bubenstreich ertappen wir den zukünftigen Kaiser in flagranti bei seiner Gedanken- und Sorglosigkeit. Wir sind noch weit entfernt von dem Philosophen, der sich später bemühen wird, die Gerechtigkeit peinlich genau walten zu lassen. Der Ton dieser Briefe an Fronto ist übrigens zumeist sehr heiter und spielerisch. Es scheint, als denke der junge Thronfolger, ein leidenschaftlicher Leser, der aller Wahrscheinlichkeit nach jede Anstrengung unternimmt, um seine Redekunst zu vervollkommnen, an nichts anderes.
Gleichwohl scheint Mark Aurel schon seit seiner Kindheit geahnt zu haben, worin das Ideal eines philosophischen Lebens bestehen könnte. Im ersten Buch der Selbstbetrachtungen (I,6) schreibt er dieses Streben nach einer strengen Lebensführung dem Einfluss eines gewissen Diognetos14 zu – einem seiner ersten Lehrer: Er lehrte ihn, »das Kind, das er noch war«, Dialoge zu schreiben, und er brachte ihn von einem Spiel ab, welches unter jungen Griechen wohl eine lange Tradition hatte – findet es doch bei Aristophanes und Platon Erwähnung – und welches im Wesentlichen darin bestand, als Zeitvertreib Wachteln einen leichten Schlag auf den Kopf zu versetzen.15 Dieser Diognetos, sagt er, weckte in ihm die Liebe zur Philosophie und den »Wunsch, auf einem Schragen und einem schlichten Fell zu schlafen und nach anderen Dingen, die zu der Art ›hellenischer‹ Lebensweise gehören«. Auf diese letzte Formulierung werden wir noch zurückkommen müssen. Doch halten wir zunächst die Übereinstimmung zwischen dieser Bemerkung in den Selbstbetrachtungen und den Hinweisen, die uns »Das Leben des Mark Aurel« in der Historia Augusta16 gibt, fest: »Im Alter von zwölf Jahren übernahm er die Kleidung und wenig später das asketische Leben eines Philosophen, indem er in das pallium, den Philosophenumhang, gehüllt studierte und auf dem Boden schlief. Nur mit Mühe gelang es seiner Mutter, ihn dazu zu bewegen, auf einem mit Fellen bedeckten Lager zu schlafen.«
Der kurze Mantel und die Härte des Bettes waren Symbole des stoischen, philosophischen Lebens. Man findet sie nicht nur bei Seneca, der seinem Schüler Lucius rät, von Zeit zu Zeit jene Askese zu betreiben, und ihm den Kyniker Demetrius ins Gedächtnis ruft, der auf einem Schragen zu schlafen pflegte. Sie werden auch von Plinius dem Jüngeren erwähnt, als er vom Juristen Titius Aristo spricht, der mehr Philosoph als die angeblichen Philosophen war und dessen Bett an die schlichte Lebensweise der »Alten« mahnte. Auch der Stoiker Musonius, der Lehrer Epiktets, erklärte, dass ein Schragen und ein schlichtes Fell zum Schlafen ausreichen.17
Im Übrigen lässt sich in diesem Zusammenhang fragen, ob man die Lesart »hellenische Lebensweise« (agôgé), die sich in den Handschriften der Selbstbetrachtungen findet, beibehalten soll, oder ob es nicht besser wäre, sie in »lakonische Lebensweise« (agôgé) abzuändern. Denn »hellenische Lebensweise« bezeichnete in der damaligen Zeit vielmehr die griechische Kultur und Zivilisation zugleich in ihren spirituellen wie materiellen Formen: die Literatur, die philosophische Rede, aber auch die Leibesübungen, die Art des gesellschaftlichen Lebens.18 Demgegenüber war mit dem Ausdruck »lakonische Lebensweise« traditionell das »harte Leben« gemeint, welches sowohl die spartanische Erziehung als auch die philosophische Askese kennzeichnete. Darüber hinaus wurde das Wort agôgé19 auch häufig für sich allein als Bezeichnung der Lebensweise der Lakedämonier verwendet. In seinem Leben des Lykurg,20 des Gesetzgebers von Sparta, erzählt Plutarch im Zusammenhang mit der Erziehung der spartanischen Kinder, dass sie ab ihrem dreizehnten Lebensjahr keine Tunika mehr trugen, mit nur einem Umhang das ganze Jahr auskommen mussten und auf Strohlagern schliefen, die sie selbst aus Schilf angefertigt hatten.
Die Philosophen, vor allem die Kyniker und Stoiker, haben dieses Modell einer Lebensweise stark idealisiert. Es war das »spartanische Trugbild«, um den Ausdruck F. Olliers21 wiederaufzunehmen – um so mehr, als Sparta ein kriegerischer und totalitärer Staat war, »der die Bürger zu fügsamen Werkzeugen seines Willens formte«, wohingegen die Kyniker und Stoiker den persönlichen moralischen Wert als einzigen Zweck des Lebens betrachteten. Von der spartanischen Erziehung übernahmen sie lediglich die Zucht zur Anstrengung, die Rückkehr zu einer natürlichen Lebensweise, die Verachtung der gesellschaftlichen Konventionen. Um nur ein Beispiel zu zitieren: Der Stoiker Musonius, von dem bereits die Rede war, glaubte, dass ein »auf spartanische Art erzogener« Schüler besser auf die philosophische Unterweisung vorbereitet sei, und pries das frugale Leben der Lakedämonier in aller Ausführlichkeit.22 Fügen wir hinzu, dass der Philosophenumhang (tribôn auf Griechisch, pallium auf Latein), den der junge Mark Aurel trug, eben jener aus grobem Stoff gefertigte spartanische Umhang war, den Sokrates, Antisthenes, Diogenes und die Philosophen der kynischen und stoischen Tradition übernommen hatten.23
Wie hatte Diognetos in Mark Aurel den Wunsch nach dem strengen Leben der Philosophen und Spartaner geweckt? Wir wissen es nicht. Hat er das freie Leben der kynischen oder stoischen Philosophen gepriesen? Hat er ihm in Anlehnung an Plutarch von dem Leben des Lykurg oder des Kleomenes erzählt? Wie dem auch sei: Er bewirkte in seinem Schüler das, was man eine erste Bekehrung zur Philosophie nennen könnte.
Allerdings findet sich in den aus den Jahren vor 146/147 stammenden Briefen Mark Aurels an Fronto nicht die geringste Spur dieser jugendlichen oder vielmehr kindlichen Schwärmerei für diese spartanisch-philosophische Lebensweise. Zweifelsohne war sie nur von kurzer Dauer. Doch dieses Feuer, welches bereits erloschen schien, schwelte weiter und sollte bald aufs Neue entfacht werden.
4. Junius Rusticus
Die antiken Historiker erkennen übereinstimmend die zentrale Rolle an, die Junius Rusticus in der Entwicklung Mark Aurels zur Philosophie hin gespielt hat. »Sein Lieblingslehrer«, berichtet die Historia Augusta,24 »war Junius Rusticus, der von ihm sehr geschätzt wurde und dessen Schüler er war. Dieser Rusticus war im Krieg ebenso erfolgreich wie im Frieden und zudem ein großer Praktiker der stoischen Lebensweise. Mark Aurel holte seinen Rat in allen öffentlichen oder privaten Angelegenheiten ein. Er grüßte ihn mit einem Kuss sogar noch vor dem Prätorianerpräfekten, er ehrte ihn mit einem zweiten Konsulat, und nach dessen Tod bat er den Senat, ihm Standbilder zu errichten.« Die Historia Augusta hätte noch hinzufügen können, dass das erste Konsulat, welches Rusticus 162, ein Jahr nach der Thronbesteigung Mark Aurels, übernommen hatte, zweifelsohne die Dankbarkeit ausdrücken sollte, die der Schüler gegenüber seinem Lehrer empfand. Und der Historiker Cassius Dio25 führt, wenn er von den Philosophielehrern Mark Aurels spricht, nur Junius Rusticus und Apollonius von Chalkedon an, die er beide als Stoiker beschreibt. Später, im 4. Jahrhundert, wird Themistius erneut auf die besondere Beziehung zwischen Junius Rusticus und dem Kaiser eingehen.26
Man darf sich nicht darüber wundern, dass ein Staatsmann, der zwischen 162 und 168 das Amt des Präfekten von Rom bekleidete, gleichzeitig ein Philosophielehrer war. Dies war in der Antike nichts Außergewöhnliches: Cicero und Seneca waren ebenfalls Staatsmänner und zögerten ebenso wenig, sich als Lehrer der Philosophie zu zeigen. Hierfür gibt es zwei Gründe: Zunächst einmal ist die antike Philosophie, wie wir gesehen haben, keine Angelegenheit von Spezialisten und Fachleuten. Ein Staatsmann kann demnach sehr wohl als Philosoph leben und die philosophische Sprache beherrschen. Andererseits bestand in Rom, wie I. Hadot27 gezeigt hat, eine alte Tradition, nach der sich die Jugend älteren und erfahreneren Persönlichkeiten anschloss, die sie in das politische, aber auch in das moralische Leben einführten. Auf diese Weise eigneten sie sich die Rechtswissenschaft an, wie Cicero bei Scaevola, konnten sich aber auch in das philosophische Leben einweihen lassen. Aus dieser Perspektive lässt sich also sagen, dass Junius Rusticus Mark Aurel Privatunterricht in Philosophie erteilte und dass er gleichzeitig sein Freund und Seelenleiter gewesen ist.
Das erste Buch der Selbstbetrachtungen enthält eine nachdrückliche Würdigung seiner Person, sie ist, abgesehen von der dem Adoptivvater Kaiser Antoninus gewidmeten, die längste von allen:
»Von Rusticus (ist mir zuteilgeworden) die Einsicht zu erlangen, dass meine innere Verfassung der Korrektur und Pflege bedürfe, mich nicht von sophistischem Ehrgeiz leiten zu lassen noch Abhandlungen über philosophische Lehrsätze zu verfassen oder Mahnreden vorzutragen, den Asketen oder Wohltäter auffällig hervorzukehren, auf rhetorische und dichterische Betätigung, auf Stilisierung des Ausdrucks verzichtet zu haben; nicht zu Hause im Staatsgewand herumzuspazieren oder desgleichen zu tun; die Briefe so schlicht abzufassen wie jenen, den er selbst aus Sinuessa meiner Mutter schrieb; gegenüber den Übelwollenden oder sich schlecht Betragenden sich so zu verhalten, dass man bereit ist, auf das erste Zeichen einer Annäherung zu reagieren und zur Versöhnung bereit zu sein, sobald sie zur Umkehr bereit sind; die Texte mit Genauigkeit zu lesen und nicht damit zufrieden zu sein, sie oberflächlich zu überfliegen, und nicht ohne Weiteres den Schwätzern zuzustimmen; auf die Aufzeichnungen aus dem Unterricht des Epiktet gestoßen zu sein, die er mir aus seiner eigenen Bibliothek zukommen ließ.« (I,7)
Was Mark Aurel von Rusticus lernt, ist also in gewisser Weise das Gegenteil dessen, was ihn Diognetos gelehrt hat. Wie Epiktet28 sagte, ist es nicht der Zweck der Philosophie, einen Umhang zu tragen, sondern über die »aufrechte Vernunft« zu verfügen. Es geht nicht darum, sich hart zu betten oder Dialoge zu schreiben, sondern den eigenen Charakter zu verbessern. Die Philosophie besteht weder in sophistischer Aufgeblasenheit noch papiernen Abhandlungen, weder in auf Effekt berechneten Deklamationen noch in der Prahlerei: Sie besteht im Gegenteil in der Schlichtheit. In diesem Text wird der Konflikt zwischen Fronto und Rusticus über die Ausrichtung der Erziehung Mark Aurels erkennbar: »auf rhetorische und dichterische Betätigung […] verzichtet zu haben«. Fronto selbst spielt auf diesen Gegensatz an. Erfreut darüber, dass der neue Kaiser, der sich seit einigen Jahren geweigert hatte, seine Rhetorikstudien fortzusetzen, in der Öffentlichkeit beredt das Wort ergreift, schreibt er: »Unter all jenen, die ich kennengelernt habe, findet sich keiner, der mit einer größeren natürlichen Fähigkeit zur Redekunst begabt wäre. […] Und widerwillig und mit mürrischer Miene musste auch mein lieber Rusticus, unser Römer, der sein Leben freudig für deinen kleinen Finger hingeben und opfern würde, dem zustimmen, was ich über deine Redebegabung sagte.«29
Die Rolle des Seelenleiters dürfte Rusticus nicht immer leichtgefallen sein. Wenn Mark Aurel auf Rusticus’ Haltung gegenüber denjenigen anspielt, die über ihn verärgert waren, so bezieht er sich wohl selbst mit ein, denn er dankt im ersten Buch der Selbstbetrachtungen den Göttern, dass sie ihn, obwohl er oft in Zorn gegen Rusticus geraten sei, davon abgehalten hätten, je etwas zu tun, was er später bereut hätte (I,17,14). Die Beziehung zwischen den beiden Männern gestaltete sich ohne Frage recht stürmisch, und zwar sowohl in Mark Aurels Jugend, als Rusticus seinen Schüler spüren ließ, dass sein Charakter verbesserungsbedürftig sei (I,7,1), als auch während der Zeit, in der Rusticus einer der kaiserlichen Berater war. Durch seine Nachsicht und seinen Sanftmut zeigte ihm Rusticus die Haltung, die er seinerseits gegenüber denen bewahren sollte, die sich über ihn entrüsteten. Offenbar war einer der Hauptcharakterfehler des Kaisers seine Neigung zur Gereiztheit.
Mark Aurel verliert kein Wort über die stoischen Dogmen, die Junius Rusticus ihn gelehrt hat. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn wenn das erste Buch der Selbstbetrachtungen die Bilanz dessen zieht, was der Kaiser seinen Eltern und seinen Lehrern, seinen Freunden und den Göttern verdankt, so handelt es sich um eine Bilanz der Vorbilder und praktischen Ratschläge, mit denen er großzügig bedacht wurde, nicht um eine Beschreibung eines rein intellektuellen Werdegangs. Aus dieser Perspektive jedoch genügt die Erwähnung der während des Epiktet-Unterrichts niedergeschriebenen Notizen. Verglichen mit Epiktet sind alle stoischen Lehrer jener Zeit lediglich Epigonen. Seine Gestalt beherrscht, was den Stoizismus angeht, das gesamte 2. Jahrhundert. Dass er ihm dies vermittelt hat, ist in den Augen Mark Aurels die größte Wohltat, die er von Rusticus erfahren hat. Die Selbstbetrachtungen an sich sind lediglich oft herausragend abgefasste Variationen der Themen, die der Sklaven-Philosoph entwickelt hatte.
5. »Ariston« oder »Aristo«?
Eine radikale Umkehr wird häufig als ein Ereignis betrachtet, dass durch unerwartete Umstände plötzlich hervorgerufen wird. Und die Geschichte ist reich an Anekdoten dieser Art: Polemon, der nach einer ausschweifenden Nacht zufällig in eine Unterrichtsstunde des platonischen Philosophen Xenokrates gerät; Augustinus, der eine Kinderstimme sagen hörte: »Nimm und lies!«, Saulus-Paulus, der in Damaskus zu Boden geworfen wird. Auch beim Kaiser-Philosophen möchte man gern auf eindeutige Spuren einer plötzlichen Bekehrung zur Philosophie stoßen. Lange Zeit meinte man, sie in einem Brief Mark Aurels an seinen Lehrer Fronto30 entdeckt zu haben, in welchem er schreibt, er sei so erschüttert, dass er, in Traurigkeit versunken, nicht mehr esse.
Zu Beginn dieses Briefes bezieht er sich, ohne auf die Einzelheiten näher einzugehen und in heiterem Ton, auf eine Diskussion mit seinem Freund Aufidius Victorinus, dem Schwiegersohn Frontos. Dieser Aufidius, voller Stolz, Richter in einem Schiedsgerichtsverfahren gewesen zu sein, prahlt gewiss zum Scherz damit, der gerechteste Mann aus Umbrien zu sein, der je nach Rom gekommen sei. Er betrachtet sich Mark Aurel als überlegen, sei dieser doch bloß ein Beisitzer, der sich damit zufriedengebe, an der Seite des Richters zu gähnen. Als Thronfolger (wie wir aus dem weiteren Verlauf des Briefes wissen, war er zu diesem Zeitpunkt fünfundzwanzig Jahre alt) hatte Mark Aurel die Pflicht, dem Kaiser Antoninus bei seiner juristischen Tätigkeit zur Seite zu stehen. Aufidius’ Anspielung bezieht sich wahrscheinlich auf diese Funktion.31
Nach der Schilderung dieser Geschichte geht Mark Aurel zu einem anderen Thema über. Fronto werde bald nach Rom kommen, um, wie gewohnt, die literarischen Hausarbeiten, die er seinem Schüler aufgegeben hat, zu kontrollieren. Dieser freue sich zweifelsohne auf den Besuch seines Lehrers, unangenehm sei ihm jedoch, dass er die von Fronto ausgewählten Texte – Plautus, scheint es, und Cicero – nicht gelesen, vor allem aber keine rhetorische Argumentation verfasst habe, in der er das Für und Wider darlegen sollte.
Der Grund für seinen Verzug liege, so sagt er, in der Lektüre Aristons:
»Die Bücher des Ariston bereiten mir Freude, aber auch Qualen. Sie erfreuen mich in dem Maße, wie ich durch sie eines Besseren belehrt werde. Doch wenn sie mir vor Augen halten, wie weit meine innere Verfassung [ingenium] von jenem Besseren entfernt ist, passiert es nur allzu oft, dass dein Schüler errötet und auf sich selbst zornig wird, weil er sich im Alter von fünfundzwanzig Jahren in seiner Seele noch nichts von den heilsamen Dogmen und reinen Gedankengängen angeeignet hat. Und eben das quält mich, erzürnt mich, lässt mich in Traurigkeit versinken, macht mich eifersüchtig und raubt mir den Appetit.«
Im dritten Teil des Briefes kündigt Mark Aurel Fronto an, er werde dem Rat eines Redners aus der Antike folgen: Unter gewissen Umständen müsse es den Gesetzen vergönnt sein zu schlafen. Er werde also die Bücher des Ariston ein wenig ruhen lassen und sich den Rhetorikaufgaben widmen, die er seinem Lehrer versprochen hatte. Dennoch werde es ihm angesichts seiner derzeitigen geistigen Verfassung unmöglich sein, gleichzeitig zugunsten des Für oder des Wider Beweis zu führen, das heißt, so zu tun, als wären ihm Recht oder Unrecht in der fraglichen Sache gleichgültig.
In diesem Brief hat man traditionell den Bericht über die Umkehr Mark Aurels gesehen, die sich folglich im Alter von fünfundzwanzig Jahren vollzogen hätte, und den hier erwähnten Ariston mit Ariston von Chios gleichgesetzt, einem Stoiker des 3. Jahrhunderts v. Chr. Demnach hätte die Lektüre dieses Autors jene plötzliche Wandlung bewirkt.
Vor Kurzem hat E. Champlin32 diese Interpretation bestritten. Er stellt fest, dass Anfang und Ende des Briefes Anspielungen auf die Rechtswissenschaft enthalten, zu Beginn ist vom Richterstolz des jungen Aufidius die Rede, am Schluss, wenn er von den Büchern des Ariston spricht, davon, »die Gesetze schlafen zu lassen«. Er zieht den Schluss, dass der mittlere Teil ebenfalls im Zusammenhang mit der Rechtswissenschaft zu interpretieren sei. Die Bücher, von denen Mark Aurel spricht, seien also nicht die des Ariston von Chios, sondern diejenigen des Titius Aristo, eines Rechtsberaters aus der Zeit Trajans, dessen asketische Gestalt Plinius der Jüngere in einem seiner Briefe, wie bereits erwähnt,33 heraufbeschwört. Wo er die Wirkung beschreibt, die jene Werke hervorrufen, äußere der Schüler Frontos also nicht sein Bedauern, noch kein Philosoph zu sein, sondern seinen Kummer, die Rechtswissenschaft bislang nicht ausreichend studiert zu haben. Deshalb würden die Bücher des Aristo am Ende des Briefes den Gesetzen gleichgesetzt, die man bisweilen schlafen lassen müsse.
R. B. Rutherford, H. Görgemanns und ich selbst34 haben diese Interpretation von Champlin kritisiert. Zunächst einmal erscheint es doch ganz und gar unwahrscheinlich, dass Mark Aurel im Hinblick auf die Jurisprudenz ausrufen könne, dass er »sich im Alter von fünfundzwanzig Jahren in seiner Seele noch nichts von den heilsamen Dogmen und reinen Gedankengängen angeeignet« habe und anschließend von der Kluft spricht, die sich zwischen seiner »inneren Verfassung« und dem Ideal, dessen er gewahr wird, auftut. Und der Zorn, der Kummer, der Verlust des Appetits,35 scheinen, selbst wenn man die rhetorische Übersteigerung in Rechnung stellt, stark übertrieben, sollten sie von einer Schwärmerei für die Rechtswissenschaft herrühren.
Sodann ist es recht gewollt, den Brief so zu interpretieren, als handle er nur von einem Thema: der Rechtswissenschaft. Die Geschichte des Aufidius Victorinus stellt einen vom Fortgang unabhängigen Teil dar. Und die Schlussformel, »die Gesetze schlafen zu lassen«, war ein sprichwörtlicher Ausdruck,36 welcher letztendlich meinte: Man muss sich manchmal damit abfinden, die eigenen Moralprinzipien zum Schweigen zu bringen, nämlich im Falle einer schweren Krise.
E. Champlin macht die Tatsache geltend, dass alle Werke des Ariston von Chios bereits in der Antike als apokryph betrachtet wurden. In der Tat besteht kaum ein Zweifel darüber, dass dieser Philosoph ebenso wie viele andere – von Sokrates bis Epiktet – lediglich mündlich gelehrt und nichts Schriftliches hinterlassen hat. Doch gerade die Liste seiner »Werke«, wie sie sich in der Antike darstellte, enthält größtenteils Titel wie hypomnémata, scholai, diatribai, mit denen man die von den Schülern während des Unterrichts angefertigten Notizen bezeichnete.37 Auf eben diese Weise, dank der Notizen Arrians, eines Staatsmannes vom Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr., kennen wir die Lehre Epiktets. Es wäre durchaus möglich, dass Mark Aurel jene während Aristons Unterricht angefertigten Notizen vor sich hatte, oder zumindest Auszüge davon, die in den Schulen der Stoa aufbewahrt wurden. Denkbar wäre auch, dass er eine Sammlung der Gleichnisse (Homoiômata) des besagten Ariston gelesen hat, die bis zum Ausgang der Antike in Ehren gehalten worden ist und im Übrigen authentisch zu sein scheint, stimmt sie doch mit dem überein, was wir aus anderen Zeugnissen von der Lehre Aristons wissen. So weiß man zum Beispiel, dass er die Dialektik als nutzlos betrachtete, und tatsächlich finden sich in jener Sammlung Sentenzen, die diese Position veranschaulichen. Die Schlussfolgerungen der Dialektiker sind wie Spinngewebe: vollkommen nutzlos, doch kunstreich. Jene, die sich in die Dialektik vertiefen, ähneln denen, die Krebse essen: Sie mühen sich mit vielen Schalen um einen mageren Bissen Nahrung. Die Dialektik gleicht dem Schlamm der Wege: Ganz und gar nutzlos bringt er diejenigen, die in ihm laufen, zu Fall. Oder auch die Bemerkung über die Kürze des Lebens: Die Zeit und das Leben, die den Menschen gewährt werden, sind gar kurz, der Schlaf, wie der Steuereinnehmer, nimmt uns davon die Hälfte.38 Erinnern wir uns außerdem daran, dass Mark Aurel vermittels Cicero und Seneca, welche von Ariston gesprochen hatten, Kenntnis von ihm gehabt haben könnte.39
Letztendlich kommt es jedoch gar nicht darauf an zu wissen, ob Mark Aurel Ariston oder Titius Aristo gelesen hat. Dem Zeugnis des Plinius zufolge lebte der Rechtsberater Titius Aristo als Philosoph und mag schließlich ebenfalls philosophische Werke verfasst haben. Das Einzige, was sich mit Gewissheit sagen lässt, ist, dass der Brief die Erschütterung offenbart, die die Lektüre philosophischer Bücher bei Mark Aurel bewirkt hat.
Gleichwohl ist es schwer vorstellbar, dass einzig und allein die Lektüre des Ariston von Chios – so es sich um diesen handelt – die Umkehr Mark Aurels ausgelöst und einen so beträchtlichen Einfluss auf sein Denken gehabt haben soll. Denn die Charakteristika, die nach der antiken Tradition die Lehre dieses Philosophen auszeichnen, finden keinen Niederschlag in den Selbstbetrachtungen des Mark Aurel. In diesem Punkt muss ich die Interpretation berichtigen, die ich in einer früheren Studie vorgeschlagen hatte, und werde später noch einmal auf dieses Problem der Doktrin zurückkommen.40
Im ersten Buch der Selbstbetrachtungen sagt Mark Aurel mit hinreichender Klarheit, dass die Lektüre der Unterredungen des Epiktet, die Junius Rusticus ihm hatte zukommen lassen, den entscheidenden Einfluss ausgeübt habe. Die Bekehrung Mark Aurels zur Philosophie lässt sich also vielmehr als eine langsame Entwicklung vorstellen, die durch den regen Umgang mit Junius Rusticus und anderen Philosophen, auf die noch zurückzukommen sein wird, ausgelöst wurde. Man darf im Übrigen nicht vergessen, dass viele Briefe Mark Aurels an Fronto verlorengegangen sind. Wahrscheinlich gab der Schüler seinem Lehrer in anderen Schreiben zu verstehen, dass er sich mehr und mehr von der Rhetorik entferne und sich der Verbesserung seiner inneren Verfassung widmen wolle. Er wird sich bemüht haben, dies, wie in dem vorliegenden Brief, mit Feingefühl und einer Spur Selbstironie zu bewerkstelligen. Die Lektüre dieses Ariston oder Aristo, gleich um welchen es sich handelt, stellt somit nur ein Moment, einen Anhaltspunkt in einem langen Prozess dar. Ohne Frage hat Mark Aurel viele andere Autoren gelesen – ebenso wie er verschiedene Philosophielehrer gehört hat. Doch es ist interessant festzustellen, dass sich das erste Zeugnis seiner Verbundenheit mit der Philosophie auf sein sechsundzwanzigstes Lebensjahr datieren lässt.
6. Lehrer und Freunde
Neben Junius Rusticus erwähnen die antiken Geschichtsschreiber – und auch Mark Aurel selbst – andere Philosophielehrer, namentlich Apollonius von Chalkedon und Sextus von Chaironeia. Junius Rusticus ist der Seelenleiter, der seinem Schüler sehr nahesteht; Apollonius und Sextus unterhalten eigene Schulen, und Mark Aurel muss dort an ihrem Unterricht teilnehmen. Der Historia Augusta zufolge lehnte es Apollonius, der von den antiken Geschichtsschreibern als Stoiker dargestellt wird, ab, in den Palast zu kommen, um seinem vornehmen Schüler Unterricht zu erteilen: »Der Schüler soll zum Lehrer kommen, nicht der Lehrer zum Schüler.« Kaiser Antoninus Pius, der ihn mit viel Aufwand aus dem tiefsten Chalkedon hatte holen lassen, damit er den jungen Thronfolger den Stoizismus lehre, bemerkte hierzu, es sei leichter gewesen, Apollonius aus Chalkedon nach Rom kommen zu lassen als aus seinem Haus zum Palast.41
Im ersten Buch der Selbstbetrachtungen (I,8) gedenkt Mark Aurel dieses Lehrers unmittelbar nach Rusticus. Wiederum verliert er kein Wort über den Inhalt seines Unterrichts, hält aber die moralische Haltung und praktischen Ratschläge seines Lehrers fest: die innere Unabhängigkeit und die Kunst, Extreme miteinander zu versöhnen, zum Beispiel als Folge reiflicher Überlegung ohne Zögern zu entscheiden, gleichzeitig angespannt und entspannt zu sein, sich durch die Wohltaten, die man empfängt, nicht binden zu lassen, ohne sie dabei gleich zu verachten. In seinen Augen führte sich dieser Lehrer nicht als Schulmeister auf: Apollonius betrachtete die von ihm erworbene Erfahrung und Gewandtheit im Unterricht nicht als seine Hauptqualitäten und war in keiner Weise rechthaberisch bei den Textauslegungen. Bevor Mark Aurel das Kaiseramt übernahm, starb Apollonius. Sein Tod erfüllte ihn mit großem Schmerz und ließ ihn viele Tränen vergießen. Bei Hofe stieß seine offen zur Schau gestellte Betroffenheit auf Ablehnung, wahrscheinlich weil man über Mark Aurels philosophische Ambitionen spottete und ihm daher zeigen wollte, dass er seinen Prinzipien untreu geworden war. Kaiser Antoninus Pius entgegnete jedoch: »Erlaubt ihm, Mensch zu sein; weder die Philosophie noch das Kaiseramt vermögen die Gefühle zu entwurzeln.«42
Mark Aurel besuchte also die Schule des Apollonius bereits, als er noch junger Thronfolger war. Erst als er älter war und das Kaiseramt bereits angetreten hatte, scheint er an den Unterrichtsstunden des Sextus von Chaironeia teilgenommen zu haben, den die Historia Augusta als Stoiker bezeichnet,43 ganz im Gegensatz zum byzantinischen Großlexikon Suda,44 das ihn mit dem berühmten Sextus Empiricus verwechselt und folglich als Skeptiker aufführt. Nach dieser letzten Quelle soll Mark Aurel ihn oft zum Beisitzer erkoren haben, wenn er Gericht zu halten hatte. Es wird erzählt, dass ein zeitgenössischer Philosoph namens Lucius, der für seine freimütige Art der Rede berühmt war, Mark Aurel gefragt habe, was dieser in der Schule des Sextus zu suchen habe. Und dieser soll geantwortet haben: »Es ist immer gut zu lernen, auch für jemanden, der bereits altert. Ich gehe zu Sextus, dem Philosophen, um zu lernen, was ich noch nicht weiß.« Daraufhin rief Lucius mit gen Himmel erhobener Hand aus: »Oh Zeus, der Kaiser der Römer hängt sich in seinem Alter die Wachstafeln um den Hals und geht zur Schule, während Alexander, mein König, mit zweiunddreißig Jahren starb!«45
Auch von Sextus ist, gleich nach Apollonius, im ersten Buch der Selbstbetrachtungen (I,9) die Rede. Mark Aurel erinnert sich unter anderem an sein Wohlwollen, die Art und Weise, wie er seinen Haushalt führte, das von ihm praktizierte Vorbild für ein naturgemäßes Leben, seine einfache Würde und die Kunst, die Gefühle seiner Freunde zu erraten, seine Geduld, das Vermögen sich jedem anzupassen, Leidenschaftslosigkeit mit Zärtlichkeit zu verbinden. Aber er ruft auch etwas von seiner Lehre ins Gedächtnis: seine Fähigkeit, »die Grundprinzipien [dogmata], die zum Leben notwendig sind, klar und methodisch« zu ordnen, und vor allem, »den Begriff eines naturgemäßen Lebens«. Diese letzte Präzisierung scheint wohl zu bestätigen, dass Sextus ein Stoiker war.
Wir sind nicht in der Lage herauszufinden, ob es Unterschiede zwischen der Lehre des Apollonius und der des Sextus gab. Wahrscheinlich jedoch dürfte es kaum welche gegeben haben, folgten doch alle Stoiker jener Zeit mehr oder weniger Musonius Rufus und dessen Schüler Epiktet. Fronto zumindest betrachtet die berühmten Philosophen seiner Zeit – Euphrates, Dion, Timokrates, Athenodot – allesamt als Schüler des Musonius Rufus.46 Und wenn Mark Aurel regelmäßig an den Unterrichtsstunden in den Schulen des Apollonius und des Sextus teilnahm, hat er die drei Teile der Philosophie, also nicht nur die Moral, sondern auch die Naturtheorie und die Dialektik, studiert. Es ist daher wahrscheinlich keine rhetorische Übertreibung, wenn Fronto Mark Aurel in einem Brief vorwirft, dass er die Dialektik und die Widerlegung der Sophismen studiere.47
Diesen Philosophen, die eine Schule leiteten, deren Kurse er besuchte, stehen unter den Lehrern Mark Aurels die römischen Staatsmänner gegenüber, die sich zur Philosophie bekannten. Dies geht, wie mir scheint, klar aus dem Aufbau des ersten Buches der Selbstbetrachtungen hervor. Mark Aurel gedenkt darin der Reihe nach: seiner Eltern; der Erzieher, die er seit seiner Kindheit gehabt hat, namentlich Diognetos; der vorherrschenden Gestalt des Seelenleiters Junius Rusticus, die für ihn mit seiner Bekehrung zur Philosophie verbunden ist; der beiden Lehrer, deren Schulen er besucht hat, Apollonius und Sextus; der Grammatik- und Rhetoriklehrer, Alexanders des Grammatikers und Frontos; Alexanders des Platonikers,48 eines Rhetors, der um 170 Mark Aurels Sekretär für den griechischen Briefwechsel wurde. Der Kaiser hat von diesem, den er als einen »Freund« betrachtet, einige Ratschläge für moralisches Verhalten angenommen.
Die drei folgenden Namen, Catulus, Severus und Maximus, bilden keine Gruppe von Lehrern, sondern von Freunden, die, wahrscheinlich älter als Mark Aurel, wie Junius Rusticus Staatsmänner sind, eine politische Karriere gemacht, aber auch Einfluss auf das philosophische Leben Mark Aurels genommen haben. Der Name Maximus bezieht sich auf Claudius Maximus, den Prokonsul von Afrika, einen Philosophen, von dem Apuleius in seiner Apologie spricht. Claudius Maximus und Cinna Catulus werden von der Historia Augusta als Stoiker dargestellt, und es gibt keinen Grund, diese Quelle in Zweifel zu ziehen, weiß doch die Historia Augusta durchaus zu unterscheiden, dass Severus, das heißt Claudius Severus Arabianus, Konsul im Jahr 146, Aristoteliker war.49 Auch dessen Sohn, ebenfalls Konsul, gehörte dieser Schule an, wie wir durch den berühmten Arzt Galen wissen, der dies ausdrücklich betont50 und berichtet, jener habe an den kommentierten Anatomiesitzungen teilgenommen, die er für den römischen Adel veranstaltet habe.51 Die von Aristoteles ausgehende Schule hat sich stets ein sehr reges Interesse an wissenschaftlicher Forschung bewahrt, und dies ist auch zweifelsohne der Grund dafür, dass der Sohn des Severus derart eifrig dem Unterricht des Galen folgte.
Sodann gedenkt Mark Aurel des Kaisers Antoninus (I,16), indem er ein Bild vom idealen Herrscher entwirft, der er selbst gern sein möchte. Die Philosophie hat ihren Platz in dieser Beschreibung: So wird Antoninus darin mit Sokrates verglichen, der in der Lage war, je nach den Umständen, sich der Dinge zu enthalten oder sie zu genießen. Buch I schließt mit der Erinnerung an all die Gunst, die die Götter Mark Aurel zuteilwerden ließen, wobei, wie er sagt, die Begegnung mit den Philosophen Apollonius, Rusticus und Maximus nicht die unbedeutendste war. Die letzten Zeilen dieses ersten Buches nehmen offenbar Bezug auf das 7. Kapitel, in welchem der Kaiser seine Dankbarkeit gegenüber Rusticus zum Ausdruck bringt, und zwar dafür, dass er ihn von sophistischem Eifer, papierenen Abhandlungen und auf Effekt berechneten Deklamationen abgebracht und ihm so offenbart habe, dass die Philosophie eine Lebensform sei.
Nach seinen eigenen Worten in Buch I verdankt Mark Aurel also Junius Rusticus die Entdeckung der wahren Philosophie und der Gedanken des Epiktet. Diesem entscheidenden Beitrag schließen sich die stoischen Unterweisungen des Apollonius und des Sextus an. Und von seinen »Freunden«, Alexander dem Platoniker, Claudius Maximus, Claudius Severus und Cinna Catulus hat er Ratschläge beziehungsweise Beispiele erhalten, die ihm dabei geholfen haben, sein philosophisches Leben zu leben.
7. Der Kaiser-Philosoph
Als Mark Aurel am 7. März 161 das Kaiseramt übernimmt, stellt dies ein unerwartetes und außerordentliches Ereignis dar: Rom erhält einen Kaiser, der sich als Philosoph versteht – mehr noch, als ein stoischer Philosoph. Der gute Fronto schien recht beunruhigt, dass ein solcher Mann das Imperium regierte, konnte die Philosophie doch in seinen Augen eine schlechte Beraterin sein. Als er Aufidius Victorinus zu einem juristischen Problem schrieb, das Mark Aurel mit dem Testament seiner steinreichen Tante Matidia hatte, bemerkte er: »Ich hatte befürchtet, dass ihn seine Philosophie zu einer schlechten Entscheidung bringen könnte.«52 Für Fronto war die stoische Philosophie, wie Mark Aurel sie verstand, der Feind der Beredsamkeit, die für einen Herrscher unentbehrlich war. Er schrieb dem Kaiser: »Auch wenn es dir gelingen sollte, die Weisheit eines Kleanthes oder eines Zenon zu erreichen, wirst du dennoch, auch wenn es dir widerstrebt, das purpurne pallium und nicht den grobwollenen Umhang des Philosophen annehmen müssen«53 – mithin also, versteht sich, in der Öffentlichkeit Reden halten und dich meiner Rhetorikstunden erinnern müssen. Während der Jahre, in denen Mark Aurel von den schweren Bürden des Imperiums fast erdrückt wird, wird sich Fronto gegenüber der philosophischen Strenge zum Anwalt des gesunden Menschenverstandes machen und dem Kaiser zum Beispiel raten, sich während seines Aufenthaltes an der Küste von Alsium zu entspannen und wirklich Urlaub zu machen: »Sogar dein Chrysippos gönnte sich, wie man sagt, jeden Tag seinen Schwips.«54 Auch wenn sich gewisse zeitgenössische Historiker – zweifellos aus Liebe zum Paradoxon – gefragt haben, ob Mark Aurel sich selbst als Stoiker betrachtet habe,55 gilt es, angesichts der Formulierung »dein Chrysippos«, hier festzuhalten, dass sich sein Freund Fronto derartige Fragen gewiss nicht stellte, nimmt er doch spontan auf die großen Gestalten des Stoizismus – Kleanthes, Zenon und Chrysippos – Bezug, wenn er von der Philosophie des Kaisers spricht. Es besteht keinerlei Zweifel daran, dass sich der Kaiser vor aller Augen zum Stoizismus bekannte. Manchmal begnügt sich Fronto damit, diese Schwärmerei des Kaisers zu belächeln: Seinen Dogmen treu (instituta tua), sagt er, durfte er sich von einer Situation, die sein Leben bedrohte, nicht aus der Ruhe bringen lassen.56 Und über die Kinder des Kaisers, denen er einen Besuch abgestattet hat, merkt er an, dass eines von ihnen, wie es dem wahren Sohn eines Philosophen gebühre, ein Stück Schwarzbrot in der Hand gehalten habe.57
Die Tatsache, dass der Kaiser ein Philosoph war, war dem Volk anscheinend sowohl in Rom als auch im ganzen Imperium bekannt. So machte während seiner Regierungszeit, als die Kriege in den Donaugebieten ihren Höhepunkt erreichten und Mark Aurel gezwungen war, auch die Gladiatoren einzuberufen, in Rom ein Scherz die Runde: Der Kaiser wolle das Volk zwingen, auf seine Vergnügungen zu verzichten und sich der Philosophie zuzuwenden.58 In dieser Hinsicht sind die Widmungen der Apologien interessant, die einige Christen dem Kaiser zukommen ließen. Denn tatsächlich bestanden die Ehrentitel der Kaiser im Allgemeinen aus den Beinamen, die sie sich selbst nach einem Sieg zugelegt hatten, bei Mark Aurel hingegen fügt ein christlicher Apologet, Athenagoros, den Namen »Philosoph« hinzu: »Den Kaisern Marcus Aurelius Antoninus und Lucius Aurelius Commodus, [Sieger über] Armenier und Sarmaten, und vor allem Philosophen.« Commodus, der unwürdige Sohn Mark Aurels, profitiert hier von dem guten Ruf seines Vaters. Gleiches gilt für den Adoptivbruder, Lucius Verus, in der Widmung, die Justin seiner Apologie voranstellt – ein Text, welcher in seinem gegenwärtigen Zustand jedoch verdorben ist. Auf jeden Fall wird Mark Aurel, derzeit noch Thronfolger, darin zusammen mit Lucius Verus als »Philosoph« bezeichnet.59 Wenn diese Widmungen den »Philosophen« im Titel aufführen, so deshalb, weil die Argumentation der Apologeten darin besteht zu sagen, dass ein Kaiser, der ein Philosoph ist, das Christentum dulden müsse, denn dieses sei doch auch eine Philosophie – sogar die beste von allen.





























