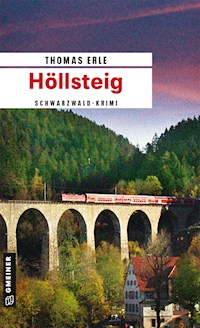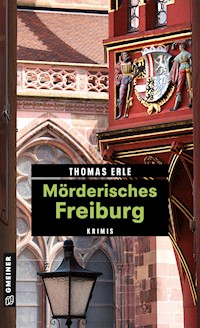Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: GMEINERHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Der Kunsthistoriker Benedikt Oswald wird von einem Freiburger Kollegen gebeten, in einem Schwarzwalddorf ein Gutachten über den Erhalt einer Kapelle zu erstellen. Doch es kommt anders. Vom Tag der Anreise an findet er sich einer seltsamen Welt gegenüber. Ereignisse aus ferner Vergangenheit werden lebendig, die Gegenwart verwirrt ihn. Die unscheinbare Kapelle mit der Statue der Heiligen Barbara öffnet ihm einen Weg, auf dem nichts ist, wie es scheint. Und dann gibt es die geheimnisvolle Witwe, mit der er sich auf unerklärliche Weise verbunden fühlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Erle
Die Kapelle
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © pixonaut / istockphoto.com und SchmitzOlaf / istockphoto.com und julianpictures / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7868-0
Widmung
Für Rosemarie
Zitat
»Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.«
Dschalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī (1207–1273)
*
»Alles, was du dir vorstellen kannst, ist real.«
Pablo Picasso (1881–1973)
*
»Der Mensch findet zuletzt in den Dingen nichts wieder, als was er selbst in sie hineingesteckt hat.«
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Kapitel 1
Es war Montagnachmittag um 15.30 Uhr, und es wurde dunkel. Je weiter ich durch Günterstal fuhr, desto enger drängten die Hänge des Tales aufeinander zu. An der Endhaltestelle der Freiburger Straßenbahn hatte man neben dem überdachten Wartehäuschen die gut zwei Meter hohe Spitze eines der vielen Türmchen des Münsters aufgestellt. Ein gut gemeinter Willkommensgruß für all diejenigen, die vom Schwarzwald herunter in die Stadt fuhren.
Ich musste schmunzeln. Vielleicht war es auch umgekehrt, und die von mittelalterlichen Steinmetzen kunstvoll gehauenen Ornamente und Blumen der Sandsteinplastik bildeten eine Markierung, ein Grenzzeichen, das an dieser Stelle darauf hinwies, dass von nun an die vertrauten und beruhigenden Zusammenhänge der Stadt nicht mehr galten.
Hinter dem Ortsausgang wurde das Tal wieder etwas breiter, und es hellte sich für kurze Zeit auf. Die letzten Häuser zogen an mir vorbei, alte Villen mit riesigen, mauerumfassten Vorgärten, hinter denen sich alte Geschichten versteckten, von denen nie jemand erzählen würde.
Am Ende eines geraden Wegstücks tauchte ein Gebäude auf, dessen Anblick mich sofort faszinierte. Es war anders als die, an denen ich zuvor in Günterstal vorbeigefahren war – stattlich, mehrstöckig, das Dach mit schwarzen Schieferschindeln gedeckt. Schwere hölzerne Fensterläden und großzügig geschnitzte Dachbalken erinnerten an eine Zeit, als Reisende auf dem Weg über die Berge hier Halt machten, übernachteten oder ein letztes Mal Verpflegung zu sich nahmen, und an einen Ort, an dem die Kutsch- und Reitpferde versorgt wurden.
Aus meinen Studien wusste ich, dass es im Schwarzwald einige solcher Häuser gab. Die meisten waren der unaufhaltsamen Welle von Fortschritt, Komfort und Geschwindigkeit nicht gewachsen gewesen und aufgegeben oder einer anderen Funktion zugeführt worden. Vor allem entlang der Schwarzwald-Hochstraße führten ein paar wenige ein erbarmungswürdiges Dasein als Lost Places, deren Besitzer nicht einmal das Geld für einen vernünftigen Abriss ausgeben wollten.
Ich dachte an die Aufgabe, die vor mir lag. Die Barbarakapelle in Todtnauberg hatte noch keine große Vergangenheit. Sie war kurz nach dem Krieg eilig errichtet worden als Dank, dass das Dorf und seine Bewohner von den schrecklichen Ereignissen weitgehend verschont geblieben waren. Man hatte damals weder die besten Baumaterialien noch das Geld für eine angemessene Innengestaltung. Die Fotos, die Georg mir zur Verfügung gestellt hatte, hatten mir einen ersten Einblick gegeben.
Ein einfaches Standbild der Jungfrau, dahinter eine Wandmalerei, ausgebleicht und rissig. Der Putz blätterte ab, das Alter zeitigte Risse und Falten in den Wänden. Die Natur ließ sich nicht aufhalten. Die Menschen starben, die Kunst überdauerte sich selbst.
Ars longa, vita brevis.
Der Anblick der Straßengabelung direkt vor dem Haus riss mich aus meinen Gedanken. Die Abzweigung nach rechts führte nach Horben, dem letzten Freiburger Ortsteil am Rande des Schwarzwalds. Ein buntes Schild mit einer stilisierten Gondel wies auf die Talstation der Bergbahn hin. Georg hatte mir bei seiner Wegbeschreibung stolz davon erzählt, dass über den Wipfeln der Tannen und Fichten auf den Schauinsland die älteste und bis heute längste Umlaufseilbahn der Welt fuhr.
Der Freiburger Hausberg mit dem vielversprechenden Namen war sommers wie winters eine der Hauptattraktionen für Städter und Touristen gleichermaßen. Vom Gipfel auf fast 1.300 Metern konnte man nicht nur die Vogesen im Elsass jenseits der Rheinebene, sondern mit etwas Glück sogar die Bergkette des Schweizer Jura im Süden bestaunen.
Georg war richtiggehend ins Schwärmen gekommen, zumal er selbst Besitzer einer Jahreskarte war und bei jeder freien Gelegenheit die »Fahrt in den Himmel«, wie er es nannte, unternahm.
Nicht zuletzt hatte er mir von der Alternativroute über Kirchzarten und Oberried abgeraten. »Der Schauinsland ist besser, du wirst schon sehen. Außerdem ist der Fahrweg bestens ausgebaut, schließlich war hier sogar schon mal eine Bergrennstrecke.«
Zumindest mit der Straßenbeschreibung schien er Recht zu haben. Direkt hinter der Bushaltestelle neben dem alten Hotel ging es auf breiter Straße zügig aufwärts. Doch bereits in der dritten Kurve bekam ich eine Ahnung, worauf ich mich eingelassen hatte. Die 180-Grad-Kehre war so steil, dass sie mich nicht nur überraschte, sondern trotz heftigen Lenkens auf die Gegenfahrbahn zwang. Ich hatte Glück, dass in diesem Moment kein Fahrzeug entgegenkam. Mit etwas Geschick bekam ich den Octavia wieder in den Griff, und das Ganze verlief glimpflich.
Doch von diesem Moment an begleitete mich ein unbestimmtes Gefühl der Furcht, das sich mit jeder weiteren Kurve verstärkte. Es ging beständig aufwärts. Direkt am Straßenrand zur Linken der Berghang – ein steiler, nur spärlich bewachsener Fels, an dessen Fuß vereinzelt abgebrochene Steinbrocken lagen. Zur rechten Seite schlossen sich die eng aneinander stehenden dunklen Fichten schon nach wenigen Metern zu einer dichten, bedrohlich wirkenden Wand, an der der Blick abglitt und jegliche Sicht ins Tal verwehrte.
Das Gefühl, in einem Tunnel zu fahren, verstärkte sich durch plötzlich aufkommende Nebelfetzen, die aus dem Nichts auf die Fahrbahn krochen und sich zu einer immer dichter werdenden milchweißen Decke zusammenzogen, je mehr Höhe ich gewann.
Es begann zu regnen, und ich schaltete das Licht ein.
Ich nahm mein ohnehin langsames Tempo weiter zurück. Die Kurven blieben unvorhersehbar. Es gab rhythmisch aufeinanderfolgende angenehm geschwungene Passagen, an denen bei schönem Wetter sportlich fahrende Biker gewiss ihre Freude hatten. Es gab lang gezogene Biegungen, die ich regelmäßig unterschätzte, weil sie kein Ende nehmen wollten. Und immer, wenn ich es am wenigsten erwartete, überraschten mich eklige 180-Grad-Kehren, deren alleinige Anwesenheit jeglichen fahrerischen Übermut zum Verstummen brachten.
Nur zwei Autos kamen mir entgegen, beide ohne Licht und mit erstaunlichem Tempo. Der Fels zur Linken und die Baumkulisse auf der Talseite blieben meine ständigen Begleiter. Ab und an passierte ich eine Haltebucht.
Nach einer Weile hatte ich jegliches Zeitgefühl verloren. Ich hatte versäumt, unten beim Einstieg an der Weggabelung auf den Kilometerstand zu achten, auf die Uhrzeit sowieso, ich wollte schließlich keine Rekorde aufstellen. Von Georg wusste ich nur, dass ich um die 1.000 Höhenmeter zu bewältigen hatte. Wie lange das dauern würde, hatte er nicht verraten. Im Augenblick hatte ich genug damit zu tun, das Auto auf der nassen Straße sicher durch die Kurven zu steuern.
Aus dem Nichts tauchte eine Abzweigung auf, eine schmale, kaum sichtbare Straße verlor sich im Scheitelpunkt einer Linkskurve zur anderen Seite in den Wald. Die Namen auf dem Schild sagten mir nichts.
Am Ende der Serpentine glitt plötzlich und lautlos ein riesiger dunkler Schatten durch den Nebel über mir. Mir stockte der Atem. Reflexartig nahm ich das Gas weg und lenkte den Wagen zur Seite. Was war das? Ich hielt an und ließ das Fenster heruntergleiten. Der Schatten war so rasch verschwunden, wie er gekommen war.
Aus der Ferne hörte ich ein metallisches Rumpeln. Sonst blieb es still, die Nebelschwaden zogen über mir weg, die Wipfel der Fichten schwangen kaum wahrnehmbar im Wind.
Erst als es für einen Moment heller wurde, erkannte ich die beiden dunklen Seile, die wie archaische Zeichen in die milchige Suppe eingeschrieben standen. Sekunden später waren sie erneut verschluckt.
Natürlich! Dies musste die Seilbahn sein, die zum Gipfel führte. Und ich hatte eine der Gondeln gesehen.
Ich schüttelte den Kopf über meine Schreckhaftigkeit, die ich sonst gar nicht von mir kannte. Aber es war ein Zeichen, dass ich aufpassen musste.
Der kurze Zwischenfall brachte mich einigermaßen zur Besinnung. Ich zwang mich wieder zu konzentriertem Fahren. Der Regen wurde dichter und durchsetzte sich mit nassen Schneeflocken. Längst liefen die Scheibenwischer auf der zweiten Stufe.
Seltsamerweise wurde es jetzt wieder heller. Kurz darauf drängte ein ausladender Parkplatz den Steilhang nach hinten. Auf den paar wenigen Autos lag eine dünne weiße Schneedecke.
›Schauinsland-Passhöhe – 1.200 m ü.d.M.‹ Das Schild war sogar im Nebel nicht zu übersehen.
Ich hatte es geschafft. Am liebsten hätte ich eine kleine Pause eingelegt. Doch um mich herum gab es keine einzige Stelle, die das Halten gelohnt hätte. In dieser Höhe gab es zwar kaum mehr Bäume, was die unverhoffte Helligkeit erklärte. Doch an eine Aussicht irgendeiner Art war nicht zu denken. Mir schien es nicht weiter schlimm, das konnte ich später nachholen. Allerdings verriet der Blick zur Uhr, dass mich der langsame Anstieg viel Zeit gekostet hatte. Ich wollte unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit ankommen. Ich hasste es, mich in der Nacht an einem unbekannten Ort zurechtfinden zu müssen.
Ich legte den Gang ein und fuhr weiter.
Ich hatte erwartet, dass es nach der Passhöhe in ähnlicher Weise wie beim Anstieg von Günterstal aus abwärts ginge. Doch es kam anders. Der Nebel riss auf, und ich sah, wie die Straße auf einer Hochebene weiterführte. Wald gab es auf dieser Höhe keinen mehr, lediglich ab und an tauchten vereinzelte oder sich in kleinen Gruppen aneinander kauernde sturmzerzauste Bäume auf, deren bizarrer Wuchs ihnen ein geheimnisvolles Aussehen verlieh. Die Äste waren wie knorrige Zeigefinger in die Richtung gekrümmt, die ihnen der allgegenwärtige Wind vorgab, und der auch mich jetzt zwang, das Lenkrad mit beiden Händen festzuhalten.
Der Regen hatte sich endgültig in Schnee verwandelt. Dicke, nasse Flocken klatschen an die Windseite meines Wagens und lösten sich auf in wässrige Schlieren, die mir jegliche Sicht nahmen. Die Fahrbahn vor mir verschwand innerhalb von Sekunden unter einer schmierigen Schicht, die sich mehr und mehr in eine gleichförmige weiße Fläche verwandelte.
Zweifel stiegen in mir auf, ob mein Wagen für die Weiterfahrt genügend vorbereitet war. Seit Jahren hatte ich keine Winterreifen mehr aufgezogen. Zu Hause, am Rand der Rheinebene, waren Schnee und Eis in den zurückliegenden Wintern selten geworden. Beim Abschied von Georg in Freiburg hatten in den Gärten der umstehenden Häuser Forsythien, Krokusse und die ersten Veilchen geblüht, die Osterglocken hatten gelbe Spitzen getragen.
»Oben ist es noch frisch.« Mehr hatte Georg mir nicht mit auf den Weg gegeben. Der Euphemismus des Jahres.
Der Wind zerrte an meinem Wagen. Die beiden Scheibenwischer liefen ohne nennenswerten Erfolg auf höchster Stufe. Ein weiteres Mal passierte ich eine Kreuzung, deren beide Abzweigungen nach links und rechts in eine konturlose Suppe führten. Danach wieder eine nach allen Seiten ausgebreitete helle Fläche. Eine Szene wie in einem Traum, wären da nicht das unaufhörliche Heulen des Windes und die allmählich aufkommende Kälte gewesen, die mich zurück in die unerbittliche Realität zogen.
Jetzt wurde mir auch die Bedeutung der meterhohen Holzstangen klar, die mich von Beginn des Aufstieges an dem alten Landhotel begleiteten. Im Abstand von wenigen Metern waren sie links und rechts der Fahrbahn in die Erde gerammt und zeigten den Verlauf der Straße an. Jetzt war ich dankbar darum, da ich inzwischen keinen Unterschied mehr zu der umliegenden Fläche auszumachen vermochte. Nicht auszudenken, wenn ich hier oben den Wagen ins Gelände lenken würde.
Ich atmete einmal tief durch, nahm erneut ein wenig Tempo heraus und tastete mich weiter vorwärts. Erst als allmählich aus dem Nichts die ersten Bäume auftauchten, wurde es etwas besser. Immer noch ging die Straße nur leicht abwärts, doch die Orientierung war nun leichter.
Unvermittelt tauchte vor mir ein Gebäude auf. Die Straße führte direkt darauf zu. ›Waldhotel‹, stand auf dem schwach erleuchteten Schild über dem Eingang. Ich konnte die Größe des Gebäudes nur abschätzen, den Fenstern nach zu schließen musste es Platz für viele Gäste haben. Im Moment deutete nichts darauf hin. Schräg vor dem Eingang stand ein Lieferwagen mit Freiburger Kennzeichen. Die Windschutzscheibe war mit Schnee zugeweht.
Ein Schild auf der gegenüberliegenden Straßenseite. ›Notschrei-Passhöhe, 1.120 m ü.d.M.‹ Ein weiterer Pass.
Notschrei. Wahrscheinlich verdankte der Ort seinen eigenartigen Namen einem meiner Vorgänger, der irgendwann einmal an gleicher Stelle wie ich auf den Höhen des Schwarzwaldes umhergeirrt war.
Immerhin hatte ich das schützende Blech meines Octavia um mich herum.
Die Straße, die von unten heraufkam und vor dem Hotel einmündete, war offenbar der Weg, von dem Georg mir abgeraten hatte. Der Gedanke, dass diese Streckenführung noch schlimmer gewesen sein konnte als das, was ich bisher mit Glück und Bangen hinter mich gebracht hatte, war wenig tröstlich. Denn das, was vor mir lag, sah keineswegs so aus, als sollte es von hier aus besser werden.
›Todtnau 7 Kilometer‹. Wenigstens war ich auf dem richtigen Weg. Von dort musste es irgendwo eine Abzweigung nach Todtnauberg geben. Es konnte nicht mehr weit sein.
Ich hatte die Heizung angestellt, die Schneeflocken schmolzen auf der Scheibe und lösten sich in rasch davoneilenden Tropfen auf. Es wurde dunkler. Nebel oder tief hängende Wolken – ich wusste es nicht. Die konturlose Masse trübte sich rasch von milchigem Weiß in trauriges Grau.
Ich setzte den Blinker, obwohl auch hier weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen war, und bog nach rechts ab. Ein paar Hinweisschilder am Straßenrand auf Skilifte und Loipen, dann verschluckte mich wieder das Dunkel.
Von hier an ging es sofort deutlich bergab. Meine Zuversicht wandelte sich rasch in Bangen. Das Schneegestöber blieb so dicht wie das dunkle Grau, das meine Sicht auf wenige Meter beschränkte. Ich war dankbar um jeden Leitpfosten, um jede Fahrbahnkennzeichnung. Ob es dahinter Hang oder Wald, Fels oder Abgrund gab, konnte ich nur erahnen. Ich fuhr jetzt so langsam, dass ich befürchten musste, von hinten könnte ein anderer auf mich auffahren. Doch es blieb mir nichts anderes übrig. Selbst meine geringe Geschwindigkeit genügte, dass ich beim Bremsen ins Rutschen kam.
Schweiß trat auf meine Stirn. Ich reduzierte das Tempo auf eine Geschwindigkeit, bei der ich selbst hätte neben mir herlaufen können. Den schweren Wagen hielt ich, so gut ich es vermochte, in der Mitte der Fahrbahn. Ich konnte nur hoffen, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug mich rechtzeitig bemerken würde.
Anfangs war es mir seltsam vorgekommen, doch inzwischen war ich froh darum, dass es so wenig Verkehr gab. Außer den beiden Autos gleich zu Beginn des Anstiegs hatte ich keine weiteren gesehen.
Wahrscheinlich waren die Menschen in dieser Gegend vernünftiger als ich und blieben zu Hause. Vernünftiger jedenfalls als der Restaurator und Kunsthistoriker, der mehr Ahnung hatte von den Feinheiten der Kulturepochen in der italienischen Renaissance als von den Widrigkeiten des Wetters in den Bergen im deutschen Südwesten.
In einer Kurve, die länger und länger wurde, endete meine Fahrt abrupt und unmissverständlich. Mein überhasteter Bremsversuch blockierte die Reifen, gleichzeitig ließ der Schwung den Wagen sich drehen und zur Seite rutschen. Für einen langen Augenblick hatte ich keinerlei Kontrolle mehr.
Mit einem hässlichen dumpfen Knall kam ich am Ende der Biegung an der Leitplanke zum Stehen.
Mein erster Gedanke nach der Schrecksekunde war, dass ich keinen Meter mehr weiterfahren würde. Nicht jetzt, nicht bei diesem Wetter. Meine Hände zitterten, als ich den Kofferraum öffnete und das Warndreieck hervorholte. Ob es irgendeinen Sinn machte, es aufzustellen, wusste ich nicht. Ich handelte kaum mehr als instinktiv. So hatte ich es gelernt, so war es richtig.
Ich stapfte zurück zum Auto, schaltete den Warnblinker ein und sank erschöpft in den Fahrersitz.
Es ging nicht weiter. Alles andere war lebensgefährlich.
So merkwürdig es auch war – ich war erleichtert. Nachdem die Entscheidung gefallen war, dauerte es nicht lange, bis ich mich beruhigt hatte. Mein Atem wurde gleichmäßiger, ebenso mein Herzschlag. Aus den Händen löste sich die Verkrampfung, der Schweiß auf der Stirn trocknete. Am Ende blieb nur ein ungläubiges Kopfschütteln über meine eigene Blauäugigkeit.
Oder war es nichts anderes als Dummheit? Das Leben war, wie es war und scherte sich wenig darum, was in meiner Vorstellung vor sich ging.
Wie lange war es her, dass ich zum letzten Mal die Natur in dieser Intensität erlebt hatte? Fünf Tage Wandern im mallorquinischen Hinterland im vorletzten Sommer, Tagestouren mit Vollpension und zertifiziertem Guide auf bestens ausgeschilderten Wegen, gut begehbar, mit ausgesuchten Zwischenstopps mit Gelegenheit zur Erfrischung und zum Tausch verschwitzter T-Shirts.
Natur. Alles bestens geplant und durchgetaktet. Schon am ersten Tag hatte ich mir eine Blase an der linken Achillessehne gelaufen. Beim Aufstehen am nächsten Morgen fuhr mir der Schmerz in die Lendenwirbel, am Abend blühte der Sonnenbrand auf allen nur denkbaren Körperflächen.
Alles für Renate. Nur für Renate.
Alles für eine Beziehung, die längst keine mehr war. Im darauffolgenden Herbst hatte Renate den Mut, es auszusprechen. Nach dem gemeinsamen Besuch einer klassischen Klaviermatinee, die sich quälend lange hingezogen hatte, hatte ich mich zu Hause, so rasch es ging, meiner Ausgehkleidung entledigt und war zurück in die Bequemlichkeit von Jeans und Hausschuhen geschlüpft.
»Ich gehe.«
Ein einfacher Satz, nicht mehr. Zwei Worte für einen Schlussstrich. Noch am selben Abend war sie weg.
Es dauerte Wochen, ehe ich realisiert hatte, was dieses Wegsein bedeutete. Sie war nicht unterwegs zum Einkaufen, nicht beim Treffen mit der Kaffeefreundin. Auch nicht bei einem der üblichen Dreitagebesuche bei ihrer Mutter im Seniorenheim in Bielefeld.
Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass es einen Unterschied gab zwischen »nicht da« und »weg«. Keine vorübergehende Lücke, die ich zu oft nicht einmal bemerkte. Kein vertrautes Kratzen des Schlüssels an der Wohnungstür irgendwann.
Zurück blieb ein Nichts, formlos. Zusammengesetzt aus Erinnerungen und vergessenen Gefühlen, eingerahmt in hilflose Konstruktionen meines Verstandes, der ohnmächtig zuerst nach Erklärungen, dann nach Rechtfertigungen suchte und ungläubig erfahren musste, dass alle Deutungen am Schmerz der Realität zerschellten.
Renate war weg. Und ich tat genau das, was sie mir zuvor zunehmend vorgehalten hatte. Ich stürzte mich in die Arbeit, wissend, dass es Ablenkung war.
Es waren ihre Augen, die mich vom ersten Moment an fasziniert hatten. Und nicht nur das. Das glänzende Blau hatte ein Tor aufgestoßen, das mir bisher verschlossen geblieben war. Das ich bis dahin noch nicht einmal bewusst wahrgenommen hatte. Verführerisch die smaragdgrünen Einsprengsel, Wegweisern gleich, ebenso wie ein Versprechen auf das, was damals jenseits meiner Vorstellungskraft lag. Dass es auch eine Warnung sein konnte, wollte ich nicht wahrhaben.
Später verloren die Augen ihren Glanz, schlossen sich die Tore wieder. Bis zuletzt weigerte ich mich zu begreifen, dass ich selbst es war, der das Leuchten im anderen hervorrief, dass ich es war, der die Welt dahinter zum Leben erweckte.
Seither hatte ich sie immer wieder gesucht, in meinen Erinnerungen, in den einsamen Stunden im Lesesaal der Fachbibliothek, in den Galerien, wenn ich vorsichtig und konzentriert die Farbschichten des Bildes untersuchte, mit dem ich gerade beschäftigt war.
In den Nächten, wenn der Traum kam. Der Traum, der sich wiederholte, der immer dann zurückkam, wenn ich gehofft hatte, die Endgültigkeit akzeptiert zu haben. Der Traum, in dem ich vor zwei verschlossenen Türen stand, Türen ohne Knauf, ohne Griff, ohne Schloss. Ich flehte, schluchzte, hämmerte mit den Fäusten, bis ich zusammensank, verzweifelt. Aus der Mitte erstanden zwei zitternde Funken, die größer wurden, leuchtender, stechendes Licht kam direkt auf mich zu, weißes Flackern, ein grellroter Blitz, ich riss erschrocken die Arme hoch, schütze mein Gesicht, mächtiges Grollen, ein tiefes Brummen bringt meinen Leib zum Erzittern.
Es klopfte, zweimal, dreimal. Eisiger Wind fegte durch die Wagentür zu mir herein. Ich blinzelte in den lichtumkränzten Schatten, der sich über mich beugte.
»Was ist los? Hast du eine Panne? Bist du verletzt?«
Ich fand mich wieder auf dem Fahrersitz meines Octavia. Das Lenkrad war kalt, die Scheiben beschlagen. Im Rückspiegel zwei Lichter.
Die Stimme störte und gab Halt zugleich. Die Lichter – vorne, von hinten, von der Seite. Mein Traum löste sich auf in Kälte und Wind. Das Geräusch eines Lkw-Motors.
»Sag doch was! Geht’s?«
Der Mann, zu dem die Stimme gehörte, stand vornübergebeugt neben der Wagentür. Er trug eine dicke orangefarbene Jacke, breite weiße Streifen reflektierten das rhythmisch aufleuchtende Blinklicht.
Ich stieg aus. Die Straße war weiß und glatt, meine Beine versagten den Dienst. Ich musste mich am Wagendach festhalten.
Der Mann griff mir unter die Arme. Er war kleiner als ich, doch sein Griff war kräftig.
»Was ist mit dem?«
Eine zweite Stimme, etwas tiefer als die erste, aber mit einem ähnlichen Singsang, der die Sprache der Gegend auszeichnete. Die beiden sprachen kurz miteinander, ich verstand nur einzelne Worte.
»… Stadt … Glück gehabt … spinnt …«
»Kannst du fahren?« Ich realisierte, dass die Frage an mich gerichtet war. Der Mann gab sich Mühe, verständlich zu klingen.
»Ich denke schon. Aber die Straße …«
»Hier kannst du nicht bleiben. Du holst dir den Tod heute Nacht. Ist außerdem zu gefährlich, dein Auto direkt an der Straße.«
Der zweite Mann schob mich zur Seite und zwängte sich auf den Fahrersitz. Sekunden später hörte ich das Geräusch des Anlassers. Der Motor lief. Kurz darauf bewegte sich das Fahrzeug.
»Du steigst bei mir ein. Der Kollege fährt hinter mir her.«
Ich war jetzt wieder so weit bei Bewusstsein, dass ich erkennen konnte, was geschah. Die beiden Männer gehörten offenbar zum Straßendienst. Das große Räumfahrzeug stand einige Meter hinter uns in der Kurve. Die Scheinwerfer brannten hell, dazu das rhythmische Zucken der Signallampe über der Fahrerkabine.
Ich protestierte nur schwach. Das schräg gestellte glatte Eisenblech des Schneeschiebers, die matt glänzenden Schneeketten auf den nassen Reifen, der orangegelbe Anstrich – ich registrierte alles, ohne wirklich hinzuschauen. Auf dem Beifahrersitz des Lkws lag eine Decke, die Kabine war warm, im Radio lief ein deutscher Schlager.
Der Fahrer zog das Lenkrad nach links, legte den Gang ein und fuhr los. Im Rückspiegel sah ich, wie mein Octavia sich ebenfalls in Bewegung setzte.
Draußen war es stockdunkel. Die Scheinwerfer des Räumfahrzeugs bohrten einen Tunnel in das Dunkel. Ein paar Meter gleichförmiges Weiß leuchteten vor mir auf, das war alles.
Seltsamerweise fühlte ich mich jetzt sicher und zufrieden. Eingehüllt in einen Kokon aus Wärme, Scheinwerferlicht, Motorbrummen und dem eigenartigen Kratzen unter uns, mit dem der Schneeschieber die Fahrbahn räumte, war es mir, als seien für diese Minuten sämtliche Unbilden nicht nur ausgespart, sondern in einer anderen Welt verschwunden.
Ich spürte, wie die Anspannung von mir abfiel und einer wohligen Müdigkeit wich. Der gleichförmige Rhythmus der Schlagermusik, die mich sonst eher nervte und die ich unter anderen Umständen keine drei Minuten aushielt, wirkte einlullend und beruhigend.
Für ein paar Augenblicke unterbrach das gelbe Licht einiger Straßenlaternen den monotonen Anblick. Flüchtig nahm ich ein paar Häuser wahr, eine Bushaltestelle, durch die mein Fahrer einen eleganten Schlenker zog, die grünen Leuchtbuchstaben eines Hotels.
»Ist das Todtnau?«
»Muggenbrunn.«
Ich verstand nicht, was er meinte, und wiederholte die Frage. »Nach Todtnau! Ist es noch weit dahin? Gehört dieser Ort schon dazu?«
»Nein, das ist Muggenbrunn.«
»Ich muss nämlich noch von dort nach Todtnauberg, wissen Sie? Ich werde dort erwartet!«
Der Fahrer lachte kurz auf, gab aber keine Antwort. Stattdessen begann er, mit den Fingern im Takt der Musik auf das Lenkrad zu klopfen. »Durch die Nacht, mit dir allein …« Er summte die Melodie und sprach den Refrain mit.
Wieder wurde alles schwarz. Mir fiel auf, dass uns jetzt an der rechten Fahrbahnseite eine durchgehende Leitplanke begleitete, an manchen Stellen mit Schnee zugeweht. Es sah so aus, als ginge es jetzt abwärts. In diesem Moment war ich heilfroh, nicht in meinem Auto zu sitzen und mir mühsam den Weg ertasten zu müssen.
»Das geht heute nicht mehr.« Die Stimme des Fahrers klang unaufgeregt. Beiläufig. Als ob er gar nicht mit mir gesprochen hätte. Den Inhalt verstand ich wieder nur halb.
»Wie bitte?« Ich wandte mich zu ihm. Sein Gesicht blieb im Dunkel. Ich sah einzig, dass er eine Mütze trug.
»Du kommst heute Nacht dort nicht mehr hin.«
»Wohin?«
»Nach Todtnauberg.« Seine Finger klopften immer noch auf das Lenkrad.
Wieder war ich unsicher, was er meinte. Fuhren wir etwa nicht nach Todtnau?
»Aber ich muss dorthin. Ich bin angemeldet. Ich werde erwartet.« Mir fiel ein, dass ich die Adresse notiert hatte. Georg hatte von seinem Institut aus alles für mich organisiert. Eine kleine Ferienwohnung in einer Pension.
»Du sollst dich ganz um die Arbeit kümmern können. Abends kannst du dir etwas selbst kochen. Oder du gehst in ein Restaurant. Dort gibt es einige.«
Ich griff nach meinem Geldbeutel und zog den Zettel mit der Adresse heraus. Ich musste mich weit nach vorn zu der Instrumentenbeleuchtung bücken, um lesen zu können.
»Pension Alpenblick. Todtnauberg, Vordere Hangstraße 12. Eine Frau Wehrle. Erika Wehrle. Eine Telefonnummer habe ich auch.«
»Ja so. Die Erika.« In seinem Tonfall schwang so etwas wie Überraschung. »Ja, das ist gut. Aber heute nicht mehr.«
»Wie, heute nicht mehr?«
Der Fahrer hob das Kinn und wies nach draußen. Der Schneefall hatte zugenommen. Dicke weiße Flocken leuchteten im Scheinwerferkegel auf und verschwanden Sekunden später aus dem Blickfeld, nur um unablässig von anderen ersetzt zu werden. Kleine Windstöße wirbelten.
»’s Wetter.«
Einiges Nachfragen und ein paar Missverständnisse später verstand ich, dass ich heute nicht mehr an meinem Ziel ankommen würde. Der plötzliche Wetterumschwung hatte dazu geführt, dass auf den Straßen der Gegend das Chaos herrschte. Alle Räumfahrzeuge des Bezirks waren im Dauereinsatz. Dennoch reichte es nur, um die wichtigsten Landesstraßen befahrbar zu halten.
Der Weg nach Todtnauberg gehörte nicht dazu. Es hätte ein eigenes Fahrzeug gebraucht, das mit nichts anderem beschäftigt wäre, als die Strecke pausenlos auf- und wieder abzufahren.
»Ja, aber das geht doch nicht«, wagte ich einzuwerfen. »Man kann doch nicht einen ganzen Ort von der Welt abgeschnitten lassen.«
»Machen wir auch nicht. Heute Nacht hört es auf zu schneien, und morgen früh geht’s gleich los. Um 5 Uhr.«
»Und es gibt keinen, der mich dort hochbringen könnte? Taxifahrer mit Schneeketten?«
Der Fahrer unterbrach sein Trommeln und schüttelte den Kopf. »Keinen. Taxifahrer schon gar nicht. Der Özkan hat sich seine beiden Daimler erst letztes Jahr gekauft. Das Risiko geht der nicht ein. Auch nicht mit Schneeketten.«
Er wandte sich zu mir und tätschelte beruhigend meinen linken Arm. »’s isch schlimm. Bleibsch halt hit Nacht in der Stadt, morge sieht’s besser aus. Do kasch selber hochfahre.«
Ich verzichtete auf weiteres Nachfragen. Im Grunde hatte der Mann Recht. Es war die einzige vernünftige Möglichkeit. Zudem spürte ich, wie die Müdigkeit jetzt mit bleiernen Schritten durch meinen Körper stapfte. Ich konnte froh sein, überhaupt so weit gekommen zu sein. Wer weiß, wie ich die Nacht allein im Auto überstanden hätte.
»Gibt es ein Hotel in Todtnau?«
»Schon. Ein paar. Aber die werden voll sein. Touristen. Und Burefasnet.«
»Burefasnet?«
Seine Finger nahmen den Rhythmus wieder auf. »Ich bring dich zum Sepp, der hat bestimmt noch was.«
»Wer ist Sepp?« Ich wurde skeptisch. Das Ganze klang verdächtig nach Holzhütte, Scheune und Stroh.
»Giuseppe Bertolotti. Sein Sohn backt die beste Pizza im Schwarzwald. Der hat Fremdenzimmer.«
An den Seitenfenstern glitten vereinzelte Häuser vorbei. Zu den Scheinwerfern des Räumfahrzeugs kam das Licht von Straßenlaternen. Vor uns tauchte eine Kreuzung auf. Ich las etwas von Basel und Donaueschingen, doch mein Fahrer bog ohne anzuhalten scharf nach links in Richtung Ortsmitte ab. Hier war die Straße bereits geräumt worden. Zusätzlich hatte man Salz und Splitt gestreut. Zum ersten Mal seit Stunden sah ich wieder Asphalt. Er war nass und glänzte. Am Rand der Straße zog sich ein kniehohes Band aufgeworfenen Schnees.
Der Fahrer drückte einen der Knöpfe am Armaturenbrett und hob den Schneeschieber an. Sofort war das Kratzen und Schaben unter uns verschwunden.
Vereinzelt kamen uns Autos entgegen. Die meisten von ihnen hatten Schnee auf dem Dach und auf der Kühlerhaube. Hinter einer Tankstelle, deren Firmenzeichen weiß und blau in den milchigen Abendhimmel leuchtete, bogen wir ein weiteres Mal ab. Verschneite Autos am Straßenrand, ein paar kahle Bäume, milchiges Licht, die Silhouette einer Kirche mit zwei mächtigen Zwiebeltürmen.
Mein Fahrer blieb mit dem Wagen mitten auf der Straße stehen. »Endstation. Kannst aussteigen.«
Es knirschte unter meinen Füßen, als ich von den Stufen der Fahrerkabine hinunter auf die Straße sprang. Im nächsten Moment knickten mir die Beine weg. Gleichzeitig bohrte sich die eisige Luft wie ein Speer in meine Lungen. Ich hatte Mühe, mich aufrecht zu halten, und stützte mich an eines der Räder des Räumfahrzeugs ab.
Das nasse Metall der Schneeketten, der dick mit Eisschnee verkrustete Kotflügel, das zuckende Licht der Signallampe, ein paar Stimmen im Dunkel, die ich nicht auseinanderhalten konnte …
Jemand packte mich unter den Achseln und schob mich vorwärts. Ein paar Stufen, eine Tür. Sekunden später fand ich mich in einem großen hellen Raum voller Tische und Stühle wieder. Ich spürte, wie mich jemand aus meiner Jacke befreite, mich auf eine Bank zog, mir ein Kissen unterschob. Meine Hände umfassten ein bauchiges Gefäß, es war warm und roch einladend.
»Du musst essen.« Die Stimme der Frau war sanft und einladend. »Die Suppe ist gut.«
Die Frau hatte lockige schwarze Haare. Ein Paar kräftiger Arme zeichneten sich unter einer kurzärmeligen roten Bluse ab. Sie redete weiter auf mich ein, italienisch-deutsch-alemannisch. Ich verstand nur wenig von dem, was sie sagte. Doch es war nicht wichtig. Eine sizilianische Mutter, die ihr Kind besänftigte.
Der erste Löffel der heißen Suppe verbrannte mir Lippen, Zunge und Gaumen. Ich musste husten.
Sofort spürte ich ein beruhigendes Klopfen auf meinem Rücken.
»Langsam. Musst puste. Feste puste.«
Es war der Moment, an dem ich wieder zu mir kam. »Feste puste«, wiederholte ich, hustete noch einmal, nahm einen zweiten Löffel, vorsichtig.
Wieder verbrannte ich mir den Mund, doch dieses Mal aß ich tapfer weiter. Die heiße Flüssigkeit lief mir wie ein Flammendolch die Kehle hinunter. Tränen traten mir in die Augen, ich hustete wieder. Dann musste ich lachen. Das Gesicht meiner Gastgeberin leuchtete auf. Vorsichtig nahm ich einen dritten Löffel und blies so lange darüber, bis meine Hand zu zittern begann.
»Minestrone.« Die Frau nickte mir aufmunternd zu. »Tut gut.« Sie schob mir ein Körbchen zu, in dem sich ein paar dick geschnittene Weißbrotscheiben türmten. »Iss. Gut für die Kraft. Gut für alles.«
Während ich einen zweiten Teller aß, wurde mein Bewusstsein klarer. Es sah so aus, als habe mich der Räumdienstfahrer in ein italienisches Restaurant gebracht. Doch außer der resoluten Signora war im Gastraum niemand zu sehen, auch nicht mein hilfsbereiter Fahrer. Er musste längst wieder unterwegs sein.
Doch was war mit meinem Auto? Was war mit der Pension Alpenblick, in der ich mit Sicherheit längst erwartet wurde?
»Ich muss telefonieren«, sagte ich und legte den Löffel zur Seite. »Und mein Auto, wo ist es?«
Ein Schlüsselbund fiel neben mir auf die Tischplatte.
»Dein Auto steht hinten im Hof.« Die etwas hohe Stimme gehörte einem Mann, der von hinten an den Tisch herangetreten war. »Deine Tasche ist schon oben. Anrufen brauchst du nicht mehr«, sagte der Mann. »Erika weiß Bescheid. Und jetzt iss weiter.«
Im nächsten Moment flogen ein paar italienische Satzfetzen hin und her.