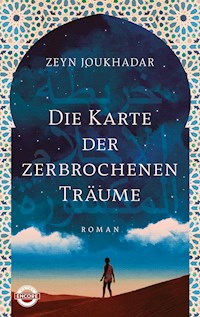
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der in der Hoffnungslosigkeit von Krieg und Flucht das Leben feiert
Sommer 2011. Nour ist als Kind syrischer Einwanderer in New York geboren. Als ihr Vater stirbt, beschließt Nours Mutter, in ihre Heimat Syrien zurückzugehen. Doch das Syrien, das Nours Eltern noch kannten, gibt es nicht mehr. Schon bald erreicht der Krieg auch das ruhige Stadtviertel von Homs, in dem die Familie lebt. Als ihr Haus von einer Granate zerstört wird, fällt die Entscheidung, das Land zu verlassen. Ziel ist Spanien, und der Weg wird die Familie durch Jordanien, Ägypten, Libyen, Algerien und Marokko führen. Auf der Suche nach Trost und Ablenkung erzählt sich Nour während der Flucht die Fabel von Rawiya, einer jungen Abenteurerin, die sich im 12. Jahrhundert dem berühmten Kartografen al-Idrisi anschließt, um die Kunst des Kartenzeichnens zu erlernen. Viele Orte, die Rawiya durchreist, liegen auf der Route von Nour und ihrer Familie. Damals wie heute lauert Gefahr. Bis Nours Mutter vor einer Entscheidung steht, die die Familie für immer auseinanderreißen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Sommer 2011. Nour ist als Kind syrischer Einwanderer in New York geboren. Als ihr Vater stirbt, beschließt Nours Mutter, gemeinsam mit den drei Töchtern in ihre Heimat Syrien zurückzugehen. Doch das Syrien, das Nours Eltern noch kannten, gibt es nicht mehr. Schon bald erreicht der Krieg auch das ruhige Stadtviertel von Homs, in dem die Familie lebt. Als ihr Haus von einer Granate zerstört wird, fällt die Entscheidung, das Land zu verlassen. Ziel ist Spanien, wo ein Onkel lebt, und der Weg wird die Familie quer durch Jordanien, Ägypten, Libyen, Algerien und Marokko führen. Auf der Suche nach Trost und Ablenkung erzählt sich Nour während der Flucht eine Gutenachtgeschichte ihres Vaters, die Fabel von Rawiya, einer jungen Abenteurerin, die sich im 12. Jahrhundert dem berühmten Kartografen al-Idrisi anschließt, um die Kunst des Kartenzeichnens zu erlernen. Viele Orte, die Rawiya durchreist, liegen auf der Route von Nour und ihrer Familie. Und damals wie heute lauert Gefahr. Bis Nours Mutter vor einer Entscheidung steht, die die Familie für immer auseinanderreißen könnte.
Zum Autor
Zeyn Joukhadar wurde als Tochter einer christlichen Mutter und eines muslimischen Vaters in New York geboren. Sie hat Pathobiologie studiert und in der biomedizinischen Forschung gearbeitet, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. »Die Karte der zerbrochenen Träume« ist ihr erster Roman. Zeyn Joukhadar ist Mitglied bei RAWI (Radius of Arab American Writers) und lebt heute in Pennsylvania.
ZEYN JOUKHADAR
DIE KARTE DER ZERBROCHENEN TRÄUME
ROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea Kunstmann
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
The Map of Salt and Stars
bei Touchstone, New York
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Unter www.heyne-encore.de finden Sie das komplette Encore-Programm.
Weitere News unter www.heyne-encore.de/facebook
Copyright © 2018 Zeyn Joukhadar
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Claudia Fritzsche
Karte Vorsatz: © Kyle Kabel
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung des Originalmotivs by Sandra Chiu, Gettyimages/ Andy Teo aka Photocillin/RF
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-21734-1V001
www.heyne-encore.de
Dem syrischen Volk
in Syrien und in der Diaspora
sowie allen Flüchtlingen gewidmet
TEIL I
SYRIEN
Oh Geliebter, du stirbst an gebrochenem Herzen. Die Frauen wehklagen in den Straßen. Der Reis ist verschüttet, die Linsen sind verstreut, das feine Laken treten sie mit Füßen, das Wadi fließt über von Tränen. In welcher Sprache sagtest du mir, dass alles, was wir liebten, nur ein Traum war? Ich träume nicht mehr auf Arabisch – ich träume überhaupt nicht mehr. Schließe ich meine Augen, sehe ich deine, Geliebter: zwei bleiche Kiesel im Fluss. Deine Arme der rissige Marmor der Jahrhunderte, die Sterne deine Decke, die Hügel Trittsteine. Im Traum waren wir immer schnell wie der Wind. Schöpf das Meer in deinen Nabel und wasch mir die Tränen ab. Meine Tränen und deine, sie vermischen sich, Geliebter. Ich wollte nicht schlafen, nicht jetzt, aber ich muss. Warum fürchten wir den Tod – den tiefen Fall sollten wir fürchten. Um uns stürzt alles zusammen, dein flüsterndes Grün, der Lichtbogen deiner Handgelenke. Die erlösten Planeten wenden sich ab. Wurde meine Mutter in der Krümmung deines Rückgrats geboren? Ich blute, mein Fleisch zahnt Flügel. Bis es dämmert, dann werde ich fliehen – und ich kehre niemals zurück. Oh Geliebter, nimm mich in deine bleichen Arme, bis der Morgen graut. Füll meinen Mund mit dem Nebel deines Atems, dein Herz ein Granatapfelkern. Oh Geliebter, bis zum Ende bist du bei mir, bis das Meer sich teilt, bis die Bruchstücke unserer Erinnerungen uns wieder zu einem Ganzen fügen.
Die Erde und der Feigenbaum
Die Insel Manhattan ist voller Löcher, und in einem davon schläft Baba. Als ich ihm Gute Nacht sagte, war er ein schweres, schlaffes weißes Bündel, und das Loch, das sie für ihn gegraben hatten, war furchtbar tief. Und auch in mir war ein Loch, und in dem verschwand meine Stimme. Sie verschwand zusammen mit Baba, ganz tief im weißen Gebein der Erde, und jetzt ist sie fort. Meine Worte versanken wie Samen, meine Vokale und der rote Raum für Geschichten zerfielen unter meiner Zunge.
Ich glaube, auch Mama hat ihre Stimme verloren, denn statt zu sprechen, durchnässte sie mit ihren Tränen unsere ganze Wohnung. Im Winter fand ich überall Salz: unter den Spulen der elektrischen Kochplatten, zwischen meinen Schnürsenkeln und an den Umschlägen mit den Rechnungen, auf den Schalen der Granatäpfel in der Obstschüssel mit dem Goldrand. Wenn Anrufe aus Syrien kamen, kratzte Mama Salz von der Telefonschnur, während sie sich bemühte, sie zu entwirren.
Bevor Baba starb, rief praktisch nie jemand aus Syrien an, wir bekamen nur E-Mails. Aber in einem Notfall, meinte Mama, müsse man eine menschliche Stimme hören.
Offenbar sprach die Stimme, die Mama geblieben war, nur Arabisch. Selbst als die Frauen aus der Nachbarschaft Geschirr mit Essen und weiße Nelken brachten, blieb Mama stumm. Warum wohl haben die Menschen nur eine einzige Sprache für ihre Trauer?
In diesem Winter hörte ich Abu Saids honiggelbe Stimme zum ersten Mal. Huda und ich saßen manchmal vor der Küche und lauschten. Hudas aschbraune Locken, die sie an den Türpfosten drückte, sahen dabei aus wie Garnrollen. Huda konnte nicht wie ich die Farbe seiner Stimme sehen, aber wir wussten beide, dass es Abu Said war, der anrief, weil Mamas Stimme in Fahrt zu kommen schien, so als sei jedes Wort, das sie jemals auf Englisch gesagt hatte, nur ein Schatten seiner selbst. Huda kapierte es noch vor mir: Abu Said und Baba waren zwei Knoten im selben Faden, dessen Ende Mama aus den Fingern zu gleiten drohte.
Mama erzählte Abu Said alles, worüber meine Schwestern schon seit Wochen tuschelten: die ungeöffneten Stromrechnungen, die Landkarten, die sich nicht verkauften, die letzte Brücke, die Baba gebaut hatte, bevor er krank wurde. Abu Said sagte, er kenne Leute an der Universität in Homs, er könne Mama helfen, ihre Karten zu verkaufen. Gäbe es einen besseren Ort, um drei Töchter großzuziehen, als das Land ihrer Großeltern?, fragte er.
Auf den Flugtickets nach Syrien, die Mama uns zeigte, war das o in Nour, meinem Namen, ein durchscheinender Salzfleck. Meine älteren Schwestern lagen ihr wegen der Unruhen in Dara’a in den Ohren, von denen wir in den Nachrichten gehört hatten. Sie sollten nicht albern sein, erwiderte Mama, Dara’a liege so weit südlich von Homs wie Baltimore von Manhattan. Und Mama musste es wissen, denn sie verdiente ihr Geld mit Landkarten. Mama war überzeugt davon, dass die Lage sich beruhigen würde und dass Syrien durch die Reformen, die die Regierung versprochen hatte, wieder Hoffnung schöpfen und aufblühen würde. Und auch wenn ich eigentlich nicht wegwollte, freute ich mich darauf, Abu Said kennenzulernen und Mama wieder lächeln zu sehen.
Ich kannte Abu Said nur von Papas Polaroidfotos, die in den Siebzigern entstanden waren, bevor er Syrien verlassen hatte. Abu Said trug darauf einen Schnurrbart und ein orangefarbenes T-Shirt und lachte jemanden an, der nicht auf dem Foto war, während Baba direkt hinter ihm stand. Baba bezeichnete Abu Said nie als seinen Bruder, aber ich wusste, dass er es war, denn er war immer überall dabei: beim abendlichen Fastenbrechen im Ramadan, beim Kartenspiel mit meiner Oma, grinsend am Tisch des Kaffeehauses. Babas Familie hatte ihn aufgenommen, ihn zu einem der ihren gemacht.
Als der Frühling kam und die Rosskastanien unter unserem Fenster weiße Blüten bekamen, die wie dicke Brocken Steinsalz aussahen, verließen wir unsere Wohnung in Manhattan mit ihren tränenverkrusteten Granatäpfeln. Die Räder des Flugzeugs hoben vom Boden ab wie Vogelbeine, und ich blinzelte aus dem Fenster und sah einen schmalen Streifen der Stadt, in der ich volle zwölf Jahre gelebt hatte, und die grüne Mulde des Central Park. Ich hielt Ausschau nach Baba, aber die Stadt lag schon so tief unter uns, dass ich die Löcher nicht mehr sehen konnte.
Mama hat einmal gesagt, die Stadt sei eine Landkarte all der Menschen, die in ihr lebten und starben, und Baba hat gesagt, jede Landkarte sei in Wahrheit eine Geschichte. So war Baba. Die Leute bezahlten ihn für die Planung von Brücken, aber seine Geschichten erzählte er umsonst. Wenn Mama eine Landkarte und eine Kompassrose malte, zeigte Baba auf die unsichtbaren Meeresungeheuer, die jenseits der Kartenränder lauerten.
In dem Winter, bevor Baba unter die Erde ging, ließ er keine einzige Gutenachtgeschichte aus. Manche seiner Erzählungen waren kurz, wie die von dem Feigenbaum, der im Hinterhof wuchs, als Baba noch ein kleiner Junge in Syrien war, andere so verwickelt und unglaublich, dass ich Abend für Abend ungeduldig auf die Fortsetzung wartete. Meine Lieblingsgeschichte, die über den Lehrling des Kartografen, dehnte er über zwei komplette Monate hin. Mama hörte von der Tür aus zu, und wenn Baba heiser wurde, brachte sie ihm ein Glas Wasser. Als er seine Stimme verlor, erzählte ich zu Ende. So wurde es unsere Geschichte.
Mama sagte oft, die Geschichten seien Babas Art, den Dingen einen Sinn zu geben. Er müsse die Knoten der Welt entwirren, sagte sie. Nun, neuntausend Meter über ihm, versuche ich, den Knoten zu entwirren, den er in mir hinterlassen hat. Einmal meinte er, dass irgendwann ich es sein würde, die ihm unsere Geschichte erzählte, aber meine Wörter sind ein wildes Land, für das ich keine Karte habe.
Ich presse mein Gesicht gegen das Flugzeugfenster. Unter uns sieht die durchlöcherte Insel Manhattan aus wie ein Spitzendeckchen. Ich halte Ausschau nach dem Loch, in dem Baba schläft, und versuche, mich an den Anfang der Geschichte zu erinnern. Meine Wörter stürzen durch die Scheibe und hinunter auf die Erde.
Der August in Homs ist heiß und trocken. Seit drei Monaten sind wir in Syrien, und Mama hinterlässt ihre Tränen nun nicht mehr auf den Granatäpfeln. Sie hinterlässt überhaupt nirgends mehr Tränen.
Wie jeden Tag suche ich auch heute nach dem Salz, in dem ich meine Stimme gelassen habe – in der Erde. Ich gehe hinaus zu dem Feigenbaum in Mamas Garten, der voller Früchte hängt. Genauso habe ich mir den in Babas Hinterhof vorgestellt. Ich drücke meine Nase an die Wurzeln und atme ein. Ich liege auf dem Bauch, die Finger bis zu den Knöcheln in der rötlichen Erde. Heiße Steine drücken gegen meine Rippen. Ich will, dass der Feigenbaum eine Geschichte zu Baba am anderen Ende des Meeres trägt. Angestrengt flüstere ich, und meine Oberlippe streift dabei die Wurzeln. Ich schmecke purpurfarbene Luft und Öl.
Ein gelber Vogel pickt auf dem Boden nach Würmern. Doch das Meer ist schon vor langer Zeit ausgetrocknet, wenn es überhaupt je hier war. Liegt Baba noch da, wo wir ihn zurückgelassen haben, braun und starr und trocken wie Feuerholz? Wenn ich zurückkehrte, kämen mir dann die vielen Tränen, die damals hätten kommen sollen? Oder ist das Meer in mir für immer ausgetrocknet?
Ich reibe Wassergeruch aus der Rinde des Feigenbaums. Ich werde Baba unsere Geschichte erzählen, und vielleicht finde ich dann zu dem Ort zurück, an dem meine Stimme ist, und dann werden Baba und ich nicht mehr so allein sein. Ich bitte den Baum, meine Geschichte mit seinen Wurzeln aufzunehmen und dorthin zu schicken, wo es dunkel ist, wo Baba schläft.
»Sorg dafür, dass er sie bekommt«, sage ich. »Unsere Lieblingsgeschichte, die von Rawiya und al-Idrisi. Die Geschichte, die Baba mir Abend für Abend erzählt hat. Die, in der sie eine Karte von der ganzen Welt zeichnen.«
Aber die Erde und der Feigenbaum kennen die Geschichte nicht so gut wie ich, also erzähle ich sie ihnen noch einmal. Ich fange genau so an wie Baba immer: »Alle kennen Rawiyas Geschichte«, flüstere ich. »Sie wissen nur nicht, dass sie sie kennen.« Und dann sind die Worte plötzlich wieder da, als hätten sie mich nie verlassen, als wäre schon immer ich es gewesen, die die Geschichte erzählt.
Drinnen klappern Huda und Mama mit Holzschüsseln und Porzellan. Ich habe das Festessen für Abu Said heute Abend ganz vergessen. Vielleicht kann ich die Geschichte nicht zu Ende erzählen, bevor Mama mich zum Helfen reinruft, mit einer Stimme, die ganz rote Ränder hat.
Ich presse meine Nase in die Erde und verspreche dem Feigenbaum, dass ich es schon irgendwie schaffen werde, meine Geschichte zu beenden. »Wo auch immer ich bin«, sage ich, »ich übergebe sie der Erde und dem Wasser. So wird sie Baba erreichen und dich auch.«
Ich stelle mir vor, wie die Schwingungen meiner Stimme Tausende von Meilen überwinden, die Erdkruste aufbrechen, sich zwischen den tektonischen Platten, von denen letzten Winter im Naturkundeunterricht die Rede war, ins Dunkle graben, wo alles schläft, wo die Welt in allen Farben gleichzeitig leuchtet, wo niemand stirbt.
Ich fange noch einmal von vorne an.
Alle kennen Rawiyas Geschichte. Sie wissen nur nicht, dass sie sie kennen.
Es war einmal ein Mädchen namens Rawiya, die Tochter einer Witwe, die so arm war, dass die Familie langsam, aber sicher verhungerte. Sie wohnten in Benzú, einer am Meer gelegenen Siedlung in Ceuta – heute eine zu Spanien gehörende Stadt, ein winziges Territorium auf einer afrikanischen Halbinsel, die in die Straße von Gibraltar hineinragt.
Rawiya träumte davon, die Welt zu sehen, doch sie und ihre Mutter konnten sich kaum Couscous leisten, denn auch das Geld, das Rawiyas Bruder Salim auf seinen Seereisen verdiente, reichte nicht weit. Rawiya versuchte, sich mit Stickerei zu beschäftigen und sich mit dem beschaulichen Leben an der Seite ihrer Mutter abzufinden, doch innerlich war sie rastlos. Am liebsten streifte sie auf ihrem geliebten Pferd Bauza durch das Hügelland und die Olivenhaine und dachte sich Abenteuer aus. Sie wollte losziehen und reich werden, um ihre Mutter von einem Leben zu erlösen, das darin bestand, in ihrem weiß verputzten Häuschen unter dem steinernen Gesicht des Mosesbergs zu sitzen, Gerstenbrei zu essen und am Ufer nach dem Schiff von Rawiyas Bruder Ausschau zu halten.
Als Rawiya schließlich im Alter von sechzehn Jahren beschloss, ihr Zuhause zu verlassen, hatte sie nichts anderes mitzunehmen als die Schleuder, die ihr Vater ihr gemacht hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war, das mit Steinen auf Libellen schoss. Sie wollte sie nicht zurücklassen und packte sie in ihre Ledertasche. Unter dem Feigenbaum, der neben dem Haus ihrer Mutter stand, sattelte sie Bauza.
Rawiya wagte nicht, ihrer Mutter zu gestehen, wie lange sie weg sein würde, weil sie fürchtete, dass diese dann versuchen würde, sie zurückzuhalten. »Ich reite nur zum Markt nach Fes, um meine Stickereien zu verkaufen.«
Doch die Mutter sah sie zweifelnd an und ermahnte sie, vorsichtig zu sein. An jenem Tag blies ein heftiger Wind von der Meerenge her und brachte Kopftuch und Kleidersaum ihrer Mutter zum Flattern.
Rawiya hatte sich ein Stück roten Stoff um Kopf und Hals geschlungen, um ihr frisch geschnittenes Haar zu verbergen. »Ich bleibe nicht länger, als ich muss«, versicherte sie. Sie wollte ihrer Mutter nicht verraten, dass sie an die Geschichte dachte, die sie so oft gehört hatte – von dem berühmten Kartografen, der einmal jährlich zum Markt in Fes kam.
In der Brise hob und senkte sich der Stoff über Rawiyas Gesicht. Schmerzhaft wurde ihr bewusst, dass sie nicht sagen konnte, wie lange sie weg sein würde.
Rawiyas Mutter hielt die Traurigkeit ihrer Tochter für Nervosität und lächelte. Sie zog eine Misbaha aus Holzperlen hervor und legte sie ihrer Tochter in die Hand. »Meine Mutter hat mir diese Gebetskette geschenkt, als ich noch ein Mädchen war«, sagte sie. »So Gott will, wird sie dir Trost spenden, während du weg bist.«
Rawiya schloss ihre Mutter fest in die Arme, versicherte ihr, dass sie sie liebe, und versuchte, sich ihren Geruch einzuprägen. Dann stieg sie auf, und Bauza kaute klappernd auf der Trense.
Die Mutter lächelte dem Meer zu. Einmal war auch sie in Fes gewesen, und diese Reise hatte sie nie vergessen. »Jeder Ort, den du aufsuchst, wird zu einem Teil von dir«, sagte sie zu ihrer Tochter.
»Aber nicht mehr, als es mein Zuhause ist.« Damit war es Rawiya ernster als mit allem anderen, das sie gesagt hatte.
Dann stupste Rawiya aus Benzú ihr Pferd an und lenkte es zu der Straße, die ins Landesinnere führte, vorbei an den hohen Gipfeln und fruchtbaren Hochebenen des Rif-Gebirges, wo die Berber lebten, zum Atlas und zu den von Menschen wimmelnden Märkten in Fes, die im Süden auf sie warteten.
Die Handelsstraße verlief an Kalksteinfelsen und grünen Ebenen entlang, in denen Gerste und Mandelbäume gediehen. Sie war von unzähligen Reisenden ausgetreten, und auch Rawiya folgte auf Bauzas Rücken zehn Tage lang ihren Windungen. Dabei rief sie sich ihr Vorhaben ins Gedächtnis: den berühmten Kartografen Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi zu finden. Sie würde sich als Sohn eines Händlers ausgeben, sein Lehrling werden und so ihr Glück machen. Sie würde ihm einen falschen Namen nennen: Rami, was »der den Pfeil wirft« bedeutete. Ein guter und starker Name, wie sie fand.
Rawiya ritt auf Bauza über grüne Hügel, die das ellenbogenförmige Rif-Gebirge vom Atlas trennten. Sie erklommen steile Hänge, bekrönt von Zedern und Korkeichen, in deren Ästen Affen raschelten, und passierten Täler, die von gelben Wildblumen übersät waren.
Das Atlasgebirge war die Hochburg der Almohaden, einer Berberdynastie, die den ganzen Maghreb, die nordafrikanischen Länder westlich von Ägypten, unter ihre Herrschaft bringen wollte. Hier, in deren Gebiet, wurde Rawiya bei jedem Geräusch bang, selbst beim Grunzen der Wildschweine oder dem Klappern von Bauzas Hufen, das zwischen den Kalksteinfelsen widerhallte. Nachts hörte sie in der Ferne den Klang von Instrumenten und Gesang, und sie konnte kaum schlafen. Sie musste an Geschichten denken, die sie als Kind gehört hatte, Märchen von bedrohlichen Vögeln, die so groß waren, dass sie sogar Elefanten davonschleppten, und von finsteren Tälern, in denen smaragdgrün geschuppte Riesenschlangen hausten.
Schließlich erreichten Rawiya und Bauza in einem Tal eine von Mauern umzogene Stadt. Die Karawanen der Händler aus der Sahara und aus Marrakesch lagerten auf den mit Eukalyptusbäumen bestandenen Wiesen der Ebene. Das grüne Band des Flusses Fes teilte die Stadt in zwei Hälften. Die faltigen Ausläufer des Hohen Atlas warfen lange Schatten.
Innerhalb der Stadttore trottete Bauza an rosa und safranfarben verputzten Häusern, an grün bekrönten Minaretten und vergoldeten Fensterbögen vorbei. Rawiya war geblendet von jadegrünen Dächern und den Jacarandabäumen mit ihren leuchtenden purpurfarbenen Blüten. In der Medina hockten Händler im Schneidersitz hinter riesigen Körben mit Gewürzen und Getreide. Der Farbenteppich fesselte Rawiyas Blick: das weiß mattierte Indigo reifer Feigen, das Rostrot der Paprikaschoten. Laternen aus Schmiedeeisen und farbigem Glas warfen winzige Lichttupfen auf die schattigen Gassen. Überall wuselten Kinder herum, die nach gegerbtem Leder und Gewürzen rochen.
Rawiya lenkte Bauza ins Zentrum der Medina, wo sie den Kartografen zu finden hoffte. Bauzas Hufe waren mit Straßenstaub überzogen. Angesichts der Tageshitze boten die Schatten der steinernen Mauern und Mosaikfliesen erfrischende Kühle. Rawiya war ganz betäubt von den Schreien der Händler und Gewürzverkäufer. Die Luft war erfüllt von Schweiß und Öl, vom Geruch der Pferde, Kamele und Männer, der Säure der Granatäpfel und der lockenden Süße der Datteln.
Rawiya suchte zwischen Reisenden und Händlern, unterbrach sie beim Verkaufen von Gewürzen, Parfüm und Salz, um sie nach einem Mann zu fragen, der mit schwerem Gepäck reiste, das aus ledergebundenen Büchern und Pergamenten mit Skizzen der Gegenden, die er bereist hatte, bestand. Einem Mann, der das ganze Mittelmeer gesehen hatte. Niemand wusste, wo er zu finden war.
Rawiya wollte schon aufgeben, als sie eine Stimme hörte: »Ich kenne den, den du suchst.«
Sie wandte sich um. In einem kleinen Innenhof saß ein Mann gebeugt vor einem Kamel, das er an einen Olivenbaum gebunden hatte. Sein weißer Turban war fest um den Kopf geschlungen, seine Lederschuhe und sein Mantel von Straßenstaub bedeckt. Er winkte sie heran.
»Ihr kennt den Kartografen?« Rawiya betrat den Hof.
»Was willst du von ihm?« Der Mann hatte einen kurzen, dunklen Bart, und während er sie musterte, glänzten seine Augen wie polierter Obsidian.
Rawiya sagte ihre vorbereiteten Sätze auf. »Ich bin der Sohn eines Händlers«, sagte sie. »Ich möchte dem Kartografen meine Dienste anbieten. Ich möchte sein Handwerk erlernen und damit meinen Lebensunterhalt verdienen.«
Ein katzenhaftes Lächeln überzog das Gesicht des Mannes. »Ich werde dir sagen, wo du ihn findest, wenn du drei Rätsel lösen kannst. Einverstanden?«
Rawiya nickte.
»Das erste Rätsel«, sagte der Mann, »geht so:
Es ist eine Frau, unsterblich und alt,
doch ständig zeigt sie eine neue Gestalt.
Sie kann die ganze Welt sehen,
und niemals bleibt sie stehen.«
»Lasst mich nachdenken.« Rawiya tätschelte Bauzas Hals. Ihr war schwindelig vor Hunger und Hitze, und die Erwähnung einer Frau ließ sie an ihre Mutter denken. Rawiya überlegte, was ihre Mutter wohl gerade tun mochte – wahrscheinlich blickte sie aufs Meer hinaus und hielt Ausschau nach Salim. Es war schon so lange her, dass Baba ihr dabei Gesellschaft geleistet hatte, dass er mit ihr durch den Olivenhain spaziert war. Rawiya erinnerte sich, wie ihr Vater in ihrer Kindheit vom Meer gesprochen hatte, von der unsterblichen Frau mit den tausend Gesichtern.
»Das Meer!«, rief Rawiya. »Es lebt ewig, seine Laune wechselt ständig. Das Meer hat tausend Gesichter.«
Der Mann lachte. »Sehr gut.« Und fuhr mit dem zweiten Rätsel fort:
»Eine Karte, die dich leitet,
überall dich hinbegleitet,
Sommer, Winter, dort und hier,
immer hast du sie bei dir.«
Rawiya runzelte die Stirn. »Wer trägt immer eine Karte bei sich? Meint Ihr die Karte im Kopf?« Sie blickte an sich herab, auf ihre Hände, die zarten Adern, die Handgelenke und Handflächen durchzogen. Und dann … »Das Blut ist eine Art Landkarte, ein Straßennetz durch den Körper.«
Der Mann sah sie scharf an. »Gut gemacht«, sagte er.
Rawiya trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. »Und das dritte Rätsel?«
Der Mann beugte sich vor:
»Welches ist der wichtigste Punkt auf einer Landkarte?«
»Das soll das dritte Rätsel sein?«, fragte Rawiya. »Das ist gemein.«
Doch der Mann spitzte nur die Lippen und wartete, während Rawiya ächzte und angestrengt nachdachte.
»Immer da, wo man sich im Augenblick befindet«, antwortete sie dann.
Der Mann lächelte wieder sein Katzenlächeln. »Wenn man weiß, wo man sich befindet, wozu bräuchte man dann eine Karte?«
Rawiya zupfte am Ärmel ihres Umhangs herum. »Na gut, dann eben das Zuhause. Der Ort, zu dem man hinwill.«
»Aber den kennt man doch, wenn man dorthin unterwegs ist. Ist das deine endgültige Antwort?«
Rawiya zog die Stirn kraus. Sie hatte in ihrem ganzen Leben noch keine Landkarte gesehen. »Dieses Rätsel hat keine Antwort«, meinte sie. »Man benutzt nur dann eine Landkarte, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, wenn man an einem Ort noch nie zuvor gewesen ist …« Das ergab einen Sinn, und Rawiya lächelte. »Das ist die Lösung: Die wichtigsten Orte auf einer Karte sind die, an denen man noch nie war.«
Der Mann stand auf. »Hast du einen Namen, kleiner Rätsellöser?«
»Mein Name ist … Rami.« Rawiya blickte hinter sich auf die Medina. »Bringt Ihr mich jetzt zu dem Kartografen? Ich habe Eure Fragen beantwortet.«
Der Mann lachte. »Mein Name ist Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi, Gelehrter und Kartograf. Es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen.«
Rawiya spürte ihr Herz schneller schlagen. »Herr …« Sie senkte den Kopf und errötete. »Ich stehe Euch zu Diensten.«
»Dann wirst du in vierzehn Tagen mit mir nach Sizilien fahren«, antwortete al-Idrisi. »In Palermo, im Palast König Rogers II., erwartet uns eine große und ehrenvolle Aufgabe.«
Kaum habe ich begonnen, dem Feigenbaum Rawiyas Geschichte zu erzählen, als ein lauter Knall in der Ferne die Steine unter meinem Bauch erbeben lässt. Meine Eingeweide krampfen sich zusammen. Ein dumpfes Dröhnen kommt aus einem anderen Viertel der Stadt.
Es ist die dritte Explosion in drei Tagen. Seit wir in Homs sind, habe ich dieses Dröhnen erst wenige Male gehört, und es war immer weit von uns entfernt. Es klang wie Donner, und wenn man zu lange darüber nachdachte, machte es einem Angst, aber nicht so wie etwas, was das eigene Haus treffen könnte. Bisher schien es nie so nah an unserem Viertel zu sein.
Das Beben lässt nach. Ich warte auf eine zweite Panikattacke, aber sie bleibt aus. Ich löse meine Hand von der Erde, meine Daumen zucken noch.
»Nour!« Es ist Mamas Stimme, ein warmes Braun wie Zedernholz, das an den Rändern ins Rötliche spielt. Sie ist sauer. »Komm rein und hilf mir.«
Ich küsse die Wurzeln des Feigenbaums, bedecke sie wieder mit Erde. »Ich werde meine Geschichte zu Ende erzählen«, sage ich. »Ich verspreche es.«
Ich drücke mich in die Hocke und wische den Schmutz von meinen Knien. Mein Rücken war die ganze Zeit in der Sonne, meine Schulterblätter sind ganz starr vor Hitze. »Heiß« bedeutet hier etwas ganz anderes als in New York, wo die Luftfeuchtigkeit dafür sorgt, dass man nur noch vor dem Ventilator auf dem Boden herumliegen kann. Hier ist die Hitze trocken, und die Luft macht die Lippen so rau, dass sie aufspringen.
»Nour!«
Mamas Stimme ist jetzt so rot, dass sie fast schon weiß ist. Ich taumele Richtung Tür. Ich weiche der aufgespannten Leinwand aus, die am Türpfosten trocknet, und den gerahmten Landkarten, für die Mama keinen Platz im Haus hat. Ich tauche in die kühle Dunkelheit ein, meine Sandalen klatschen auf den Steinen. Die Wände atmen Sumach, seufzen vom würzigen Duft der Oliven. Öl und Fett zischen in einer Pfanne, ein gelbes und schwarzes Knallen in meinen Ohren. Vor meinen Augen verheddern sich die Farben der Stimmen und Gerüche. Wie auf einem Bildschirm sehe ich die rosa und lila Kurve von Hudas Lachen, das ziegelrote Schrillen eines Küchenweckers, das beißende Grün der Backhefe.
An der Tür streife ich mir die Sandalen von den Füßen. In der Küche redet Mama auf Arabisch vor sich hin und schnalzt mit der Zunge. Ein bisschen verstehe ich, aber längst nicht alles. Seit wir hierhergezogen sind, scheinen ständig neue Wörter aus Mama herauszusprudeln – Formulierungen, die ich nie zuvor gehört habe, die aber klingen, als hätte sie sie schon ihr Leben lang benutzt.
»Wo sind denn eigentlich deine Schwestern?« Mamas Hände stecken in einer Schüssel mit rohem Fleisch und Gewürzen, woraus der scharf-herbe Geruch von Koriander aufsteigt. Statt Hosen trägt sie heute einen Rock, ein hauchdünnes Teil in Marineblau, das um ihre Kniekehlen spielt. Und obwohl sie sich keine Schürze umgebunden hat, kann ich keinen einzigen Spritzer Öl auf ihrer weißen Seidenbluse entdecken. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich meine Mutter noch nie mit einem Fettfleck oder mit Mehlstaub auf der Kleidung gesehen.
»Woher soll ich das wissen?« Ich werfe einen Blick auf die Arbeitsplatte, um herauszufinden, was sie zubereitet: Sfiha? Hoffentlich sind es Sfiha. Ich liebe das würzige Lammfleisch und die Pinienkerne in den dünnen, ölig-knusprigen Teigtaschen.
»Mama!« Huda kommt aus der Vorratskammer angelaufen, ihr Kopftuch mit dem Rosenmuster ist mehlbestäubt. Sie hat die Hände voll mit Gewürzgläsern und Kräutern aus dem Garten. Sie stellt sie auf die Arbeitsplatte. »Uns ist der Kreuzkümmel ausgegangen.«
»Schon wieder!« Mama streckt ihre Hände in die Höhe, die rosa vom Fleischsaft des Lamms sind. »Und die faule Zahra? Hilft sie mir jetzt mit den Hackfleischtaschen, oder was?«
»Ich wette, sie hat sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.« Niemand hört mir zu. Seit wir nach Homs gezogen sind, hängt Zahra am Telefon oder vergräbt sich in dem Zimmer, das sie mit Huda teilt. Seit Baba gestorben ist, ist sie richtig gemein geworden, und wir müssen es ausbaden. All die Kleinigkeiten, mit denen man sich beschäftigen konnte, als Baba krank war, fallen jetzt weg – zum Laden an der Ecke laufen und Süßigkeiten kaufen oder Bälle an Hauswände kicken. Mama malt ihre Karten, Zahra tippt auf ihrem Handy rum, und ich kann nichts anderes tun, als diese brütend heißen Tage auszusitzen.
Früher haben Zahra und Huda immer über Syrien gesprochen, als wäre es unser Zuhause. Sie kannten es lange vor Manhattan und behaupteten, es fühle sich für sie realer an als die Lexington Avenue oder die 85. Straße. Ich aber bin zum ersten Mal außerhalb von Amreeka (so sagen sie hier), und das ganze Arabisch, das ich zu können glaubte, bringt mir hier nicht viel. Für mich fühlt es sich nicht wie ein Zuhause an.
»Such deine Schwester!« Mamas Stimme hat schon wieder rote Ränder, ein Alarmsignal. »Heute ist ein besonderer Abend. Wir wollen doch, dass für Abu Said alles bereit ist.«
Damit kriegt sie mich, und ich flitze davon, um Zahra zu suchen. Sie ist nicht in Hudas und ihrem Zimmer. Die Hitze bringt die rosafarbenen Wände zum Schwitzen. Zahras Kleidung und Schmuck liegen auf ihrer zerknautschten Steppdecke und dem Teppich verstreut. Ich bahne mir einen Weg zwischen zusammengeknüllten Jeans und T-Shirts und einem einsamen BH. Ich inspiziere einen Flakon von Zahras Parfüm auf der Kommode. Die Glasflasche sieht aus wie ein riesiger lila Edelstein oder wie eine durchsichtige Pflaume. Ich sprühe mir etwas Parfüm auf den Handrücken, es riecht wie verwelkter Flieder. Ich niese auf Zahras BH.
Auf Zehenspitzen schleiche ich wieder hinunter in den Flur und durch die Küche ins Wohnzimmer. Meine Zehen graben sich in den rot-beige gemusterten Perserteppich und machen Mamas Staubsaug-Bemühungen zunichte. Aus der Stereoanlage dröhnt etwas, das wohl Musik sein soll: rote Gitarrenläufe, die schwarzen Kleckse einer Trommel. Zahra rekelt sich auf der niedrigen Couch, die Beine über der blumengemusterten Lehne, und tippt auf ihrem Smartphone herum. Wenn Mama sähe, dass sie die Füße auf den Polstern hat, würde sie schreien.
»Sommer 2011.« Zahras Stimme klingt schleppend in der Hitze. »Nächstes Jahr hätte ich meinen Abschluss gemacht. Jahrgang 2012. Wir haben schon alles für die Fahrt nach Boston geplant. Das hätte das beste Jahr meines Lebens werden können.« Sie dreht ihr Gesicht Richtung Polster. »Stattdessen hocke ich hier. Es hat 65 Grad. Wir haben keine Klimaanlage. Und dann auch noch Mamas beklopptes Abendessen.«
Sie spürt nicht, dass meine Augen Löcher in ihren Rücken bohren. Zahra ist nur neidisch, dass Huda noch die Highschool abschließen konnte, bevor wir New York verlassen haben, und sie nicht. Wie es mir geht, scheint ihr völlig egal zu sein, und auch dass es mit zwölf Jahren genauso blöd ist, seine Freunde zu verlieren, wie mit achtzehn. Ich versetze ihr einen Klaps auf den Rücken. »Bekloppt ist deine Musik, und es hat keine 65 Grad. Mama braucht dich in der Küche.«
»Ich denke nicht im Traum dran.« Zahra legt den Arm über ihre trotzig blickende halb geschlossenen Augen. Ihre schwarzen Locken hängen seitlich über die Couch. Das goldene Armband an ihrem Handgelenk lässt sie hochnäsig und erwachsen wirken, wie eine reiche Lady.
»Du sollst ihr mit den Teigtaschen helfen.« Ich zupfe an ihrem Ärmel. »Nun komm schon, es ist zu heiß, um dich zu ziehen.«
»Ach, merkst du es auch, du Genie?« Zahra schwankt beim Aufstehen und macht barfuß ein paar träge Schritte, um die Stereoanlage auszuschalten.
»Uns ist schon wieder der Kreuzkümmel ausgegangen.« Huda kommt herein und wischt sich die Hände an einem Tuch ab. »Willst du mitkommen?«
»Lass uns Eis kaufen.« Ich schlinge meinen Arm um Hudas Taille. Zahra lässt sich wieder auf die Couch sinken.
Huda deutet mit dem Daumen Richtung Küche. »Nebenan steht eine Schüssel Lammfleisch mit deinem Namen drauf«, sagt sie zu Zahra. »Falls du nicht lieber einkaufen gehen willst.«
Zahra rollt die Augen zur Decke und trottet hinter uns her.
Mama hält uns auf, als wir an ihr vorbeikommen. »Ich möchte, dass ihr heute Abend euer bestes Benehmen zeigt – ihr alle.« Mit gesenktem Kinn sieht sie Zahra scharf an. Sie drückt den Koriander in das Lammfleisch und knetet es geschmeidig. »Und hier, in meiner Tasche.« Sie nickt Huda zu und streckt ihre fettigen Hände in die Höhe. »Noch ein bisschen extra, falls die Preise schon wieder gestiegen sind.«
Huda seufzt und angelt ein paar Münzen aus Mamas Rocktasche. »Ich glaube nicht, dass es so viel kosten wird.«
»Widersprich mir nicht.« Mama wendet sich wieder dem Lamm zu. »Alle Preise sind im letzten Monat gestiegen. Brot, Tahin, die ganzen Lebenshaltungskosten. Und bitte – passt auf! Keine Menschenmengen, nicht in das Chaos rein. Ihr geht zum Laden und kommt sofort wieder nach Hause.«
»Mama!« Huda klaubt einen trockenen Teigkrümel von der Arbeitsfläche. »Das Chaos tangiert uns doch gar nicht.«
»Gut.« Mama wirft Huda einen Blick zu. »Aber heute ist Freitag. Da ist alles noch schlimmer.«
»Wir werden vorsichtig sein.« Huda stützt einen Arm auf die Arbeitsfläche und sieht unter ihren dichten Augenbrauen, in denen der Schweiß hängt, zu ihr hoch. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen, was den Saum ihres hauchdünnen Rocks schwingen lässt. »Ganz bestimmt.«
Seit zwei Monaten schon schärft Mama uns ein, Menschenmengen zu meiden. Wie aus dem Nichts tauchen sie überall auf: Jungs im Pulk, die gegen irgendetwas protestieren, Leute, die gegen den Protest protestieren, und das Gerücht, dass es zwischen beiden Gruppen zu Auseinandersetzungen kommt. In den letzten Wochen sind sie so laut geworden, dass man ihre Gesänge und Megafone im ganzen Viertel hört. Wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, so predigt uns Mama seit Monaten, läuft man Gefahr, verhaftet zu werden – oder Schlimmeres. Aber genau wie in New York reicht es nicht immer, sich einfach rauszuhalten, um keinen Ärger zu kriegen.
Ich schließe die Augen und versuche, an etwas anderes zu denken. Ich atme den Duft all der Gewürze in der Küche ein, ganz tief, sodass ich ihre Farben in meiner Brust spüre. »Gold und gelb«, sage ich. »Ölteig. Ich wusste, dass es Sfiha sind.«
»Das ist meine Nour in ihrer Farbenwelt.« Mama lächelt in ihr Lammfleisch. »Formen und Farben für Gerüche, Klänge, Buchstaben. Ich wünschte, ich könnte sie auch sehen.«
Huda bindet ihre Schnürsenkel zu. »Es heißt, Synästhesie hat mit dem Gedächtnis zu tun. Ein fotografisches Gedächtnis, versteht ihr? Auf das man zurückgreift und Dinge vor seinem geistigen Auge sieht. Deine Synästhesie ist also eine Superkraft, Nour.«
Zahra kichert. »Wohl mehr eine Geisteskrankheit.«
»Sei still.« Mama wäscht sich die Hände. »Und kommt endlich in die Gänge, Himmel noch mal. Es ist fast fünf.« Sie schüttelt das Wasser von ihren Fingern, bevor sie sie abtrocknet. »Wenn heute wieder der Strom ausfällt, müssen wir Lamm und Reis roh essen.«
Zahra läuft zur Tür. »Sie hat also ein gutes Gedächtnis? Muss Nour deshalb immer und immer wieder Babas al-Idrisi-Geschichte erzählen?«
»Ach, halt doch den Mund, Zahra.« Ohne eine Antwort abzuwarten, schlüpfe ich wieder in meine Sandalen und öffne die Eingangstür. Als ich mir die Zweige des Feigenbaums aus dem Gesicht schiebe, verrutschen die Schattenflecken auf Mamas Landkarten. Aus unserer Gasse kullern mir Gesprächsfetzen wie blaue Murmeln entgegen. Ein Auto wischt vorbei, die Reifen geben ein graues Pfeifen von sich. Ein Windstoß streicht weiß über Kastanienblätter.
Ich laufe in den Schatten des Nachbarhauses und trete von einem Fuß auf den anderen, während ich warte, dass sich Huda und Zahra ihre Schuhe zubinden. Am liebsten würde ich mein Gesicht wieder in den salzigen Staub des Gartens schmiegen, stattdessen stupse ich mit der Zehe gegen die Ecken von Mamas Karten, die zum Trocknen an der Hauswand lehnen wie Dominosteine. »Warum lässt sie die alle hier draußen?«
Huda kommt heraus und streift die Karten mit einem Blick. »Es sind zu viele, um sie im Haus aufzubewahren«, sagt sie. »Hier draußen trocknen sie schneller.«
»Die Karten verkaufen sich nicht mehr so gut wie zu Anfang, als wir herkamen«, sagt Zahra und wischt sich Schweiß von der Wange. »Ist euch das schon aufgefallen?«
»Nichts verkauft sich«, antwortet Huda. Sie nimmt meine Hand. »Yalla! Los jetzt.«
»Was meinst du mit ›nichts verkauft sich‹?«, frage ich. Hudas Hidschab mit dem Rosenmuster blockt die Sonne. »Wir kaufen doch dauernd Pistazien und Eis.«
Huda muss lachen. Ich habe ihr Lachen immer gemocht. Es ist anders als das von Zahra, die schnaubt und quiekt. Huda hat ein nettes Lachen, es ist rosarot mit einem Schnalzer am Schluss. »Eis verkauft sich immer«, sagt sie.
Das Gehsteigpflaster dampft wie Brot, das frisch aus dem Ofen kommt, und verbrennt mir durch meine Plastiksandalen die Fußsohlen. Ich versuche, von einem Fuß auf den anderen zu hüpfen, ohne dass Zahra es merkt.
Wir biegen in die Hauptstraße ein. Ein paar Autos und blaue Busse kreisen auf dem Platz und wechseln auf den Spuren hin und her. Es ist Ramadan, da scheinen die Leute langsamer zu fahren und zu laufen. Nach dem Fastenbrechen heute Abend werden grauhaarige Männer mit vollen Bäuchen, die Arme auf dem Rücken verschränkt, durch die Straßen der Altstadt schlendern. Die Tische vor den Cafés werden voller Leute sein, die Kaffee mit Kardamom trinken und die Schläuche der Nargilehs, der Wasserpfeifen, kreisen lassen. Doch im Augenblick sind die Gehsteige wie leer gefegt, auch in unserem überwiegend christlichen Viertel. Mama sagt, dass Christen und Muslime in dieser Stadt schon seit Jahrhunderten Seite an Seite leben und sich auch in Zukunft noch gegenseitig Mehl und Nähnadeln borgen werden.
Zahras goldenes Armband schlackert an ihrem Handgelenk und erzeugt ovale Lichtreflexe. Sie mustert Hudas Kopftuch. »Ist dir heiß?«
Huda wirft Zahra einen Seitenblick zu. »Es macht mir nichts aus«, sagt sie. Das sagt sie immer, seit sie im letzten Jahr, als Baba krank wurde, angefangen hat, Kopftuch zu tragen. »Ist dir etwa nicht heiß?«
»Vielleicht trage ich auch eines, wenn ich älter bin«, sage ich und lasse meine Finger über den Baumwollsaum des Stoffstückes gleiten. »Dieses Kopftuch hier mag ich am liebsten, wegen der Rosen.«
Huda lacht. »Du bist zu jung, um dir darüber Gedanken zu machen.«
»Du hast ja noch nicht mal deine Periode«, sagt Zahra.
»Es ist doch nicht das Blut, das einen erwachsen macht«, entgegne ich.
Zahra inspiziert ihre Fingernägel. »Du hast definitiv keine Ahnung, was es bedeutet, erwachsen zu sein.«
An einem Backsteingebäude biegen wir ab. Das Pflaster und Zahras schwarzes Haar flirren in der Hitze. Ein Stück weiter die Straße hinunter steht ein Teeverkäufer mit einer silbernen Kanne auf seinem Rücken, aber er hat keine Kundschaft. Er lässt sich auf den Stufen eines Wohnhauses nieder und wischt sich den Schweiß unter seinem Hut ab.
Huda sagt: »Ich trage das Kopftuch, damit ich nicht vergesse, dass ich Gott gehöre.«
Ich muss an unser Bücherregal in der Stadt denken, in dem der Koran und die Bibel Seite an Seite standen, mit den wechselseitigen Kommentaren von Mama und Baba darin. Mama nahm uns manchmal sonntags mit zur Messe und Baba an besonderen Tagen zum Freitagsgebet.
»Aber was war der Auslöser dafür?«, frage ich.
»Eines Tages wirst du es verstehen.«
Ich verschränke die Arme. »Wenn ich älter bin, meinst du wohl?«
»Nicht unbedingt.« Huda greift wieder nach meiner Hand und bringt mich so dazu, meine Arme wieder zu öffnen. »Einfach, wenn es Zeit ist.«
Ich runzele die Stirn und überlege, was das bedeuten soll. Ich frage: »Wie alt ist Abu Said?«
»Warum?«
»Ist das nicht sein Geburtstagsessen heute Abend?«
Zahra lacht. »Kriegst du eigentlich auch mal was mit, du Dummkopf?«
»Es ist nicht ihre Schuld«, meint Huda. »Ich habe es ihr nie gesagt.« Sie drückt ihre Hand gegen den Oberschenkel, ihre Finger sind steif. Da ist etwas, das sie nicht sagen will. »Heute ist der Jahrestag, an dem Abu Said seinen Sohn verloren hat. Mama will nicht, dass er allein ist.«
»Er hatte einen Sohn?« Irgendwie hatte ich mir Abu Said nie mit einer Familie vorgestellt.
»Und wir lenken ihn mit Essen ab«, sagt Zahra verächtlich und kickt einen Stein weg. Sie wirkt fast wütend. »Wir machen uns Gedanken über Kreuzkümmel.«
»Dann ist Abu Said ja wie wir.« Mein Blick fällt auf meine Plastiksandalen, die immer noch heiß vom Pflaster sind. »Ihm fehlt die wichtigste Zutat.«
Huda verlangsamt ihre Schritte. »So habe ich das noch nie gesehen.«
Die Sonne bringt die Luft unter den silbernen Dächern der Autos zum Kochen.
»Wir sollten das Drehspiel mit ihm spielen«, sage ich.
»Drehspiel?« Zahra grinst. »Was hast du dir denn da wieder ausgedacht?«
Huda prüft die Straßenschilder, bevor wir dem Verkehrschaos den Rücken kehren. In dieser Straße ist es kühler, und die schmiedeeisernen Tore der Häuser sind mit Vögeln und Blütenranken verziert. Auf den oberen Balkonen wässern Frauen in makellosen Kleidern ihre Blumenkästen oder fächeln sich Luft zu. Wir kommen an einem Gehweg vorbei, der mit kleinen grauen und weißen Füllsteinen eingefasst ist, und ich schnappe mir einen Kiesel.
Huda greift wieder nach meiner Hand und drückt sie. »Das Drehspiel – wie spielt man das?«
Ich grinse, hüpfe rückwärts vor ihr her und schlenkere mit den Armen. »Man macht die Augen zu und dreht sich um sich selbst. Es ist ein Zauber, der einen dann in verschiedene Ebenen transportiert, und man zählt beim Drehen bis zehn, eine Umdrehung für jede Ebene, durch die man kommt. Und wenn man die Augen wieder öffnet, sehen alle Dinge noch genauso aus wie vorher, aber durch den Zauber sind sie verändert.«
»Ebenen?« Huda dreht ihren Kopf in die Richtung, aus der ferne Stimmen und der schwarz-orange Knall eines Auspuffs dringen.
»Ebenen der Existenz«, antworte ich und öffne meine Arme weit. »Es gibt verschiedene Schichten von Wirklichkeit. Weißt du, unter dieser ist noch eine und darunter wieder eine. Es gibt die ganze Zeit alle möglichen Sachen, ohne dass wir es überhaupt wissen, Dinge, die in einer Million Jahren nicht passieren, oder Dinge, die vor ganz, ganz langer Zeit passiert sind.« Ich vergesse, auf meine Füße zu achten, und stoße gegen den Bordstein.
»Nour spinnt mal wieder rum«, sagt Zahra.
»Also diese anderen Wirklichkeiten verlaufen die ganze Zeit parallel zu unserer?«, fragt Huda. »Wie die verschiedenen Arme eines Flusses? Dann gibt es also eine Ebene, auf der Magellan noch immer die Welt umsegelt?«
»Und eine, auf der Nour normal ist«, sagt Zahra.
»Vielleicht gibt es ja eine Ebene, auf der wir alle Flügel haben«, überlegt Huda.
»Und eine Ebene, auf der man Babas Stimme hören kann«, sage ich.
Es ist, als hätten meine Füße durch diese Worte plötzlich am anderen Ende der Welt Wurzeln geschlagen, und ich bleibe abrupt vor dem schmiedeeisernen Tor eines Wohnblocks stehen. Panik hängt wie ein tonnenschweres Gewicht an meinen Fußgelenken, der Gedanke, dass ich niemals mehr Babas Geschichten oder seine Stimme hören werde. Wie kann eine fehlende Geschichte ein so großes Loch hinterlassen, wo sie doch nur eine Aneinanderreihung von Wörtern ist?
Sonnenlicht tröpfelt über die Blätter einer krumm gewachsenen Pappel herunter. Im nächsten Häuserblock reihen sich geschlossene Läden für Halal-Lebensmittel und Schawarma aneinander. Ihre Besitzer sind schon zum Fastenbrechen nach Hause geeilt. Keine von uns sagt etwas, nicht einmal Zahra. Keine erwähnt, dass Mama und Baba hier in der Altstadt zusammenlebten, als Huda und Zahra noch Babys waren. Keine prahlt, dass sie all die Läden und Restaurants kennt, nicht einmal Zahra gibt damit an, dass sie besser Arabisch spricht als ich.
Aber ich spüre all das: dass mir diese Stadt nicht vertraut ist, dass niemand in New York seine Laken vom Balkon hängen lässt, dass im Central Park Ahornbäume statt Dattelpalmen stehen, dass es hier in den Straßen keine Pizzabuden oder Brezelverkäufer gibt. Dass Arabisch aus meinem Mund komisch klingt. Dass ich nicht mehr mit meinen Freundinnen zur Schule laufen und mir keinen Kaugummi mehr an Mr. Harcourts Zeitungsstand kaufen kann. Dass diese Stadt hier jetzt manchmal in der Ferne bebt und bröckelt und ich mir deshalb so fest auf meine Lippen beiße, dass ich Blut schmecke. Dass unser Zuhause verschwunden ist. Und dass es mir ohne Baba so vorkommt, als würde ich nie wieder eines haben.
Hudas Sneaker werfen rote Nachmittagsschatten. Um uns ragen hohe gelb-weiße Steinfassaden auf. Irgendwo kippt jemand eine Tasse Wasser aus einem Fenster, weiß und silbern rinnen die Tropfen in den Gully.
Huda geht auf dem Gehsteig vor mir in die Hocke, die Falten ihres Rocks rutschen ihr zwischen die Beine. »Nicht weinen«, sagt sie und trocknet mein Gesicht mit einer Rose am Saum ihres baumwollenen Hidschabs.
»Ich weine ja gar nicht, Huppy.« Ich wische mir mit dem Unterarm übers Gesicht und verfehle meine Nase. Huda nimmt mich in die Arme, und ich schmiege mich hinein wie in eine Holzschale. Sie ist ganz warm, eine rot-goldene Hitze wie von McIntosh-Äpfeln.
Ich vergrabe mein Gesicht in weichen Stofffalten, da wo ihr Kopftuch in den Kragen ihrer Bluse übergeht.
Zahras Lachen klingt nach Kieselsteinen. »Wie alt bist du denn, drei? Keiner nennt sie mehr Huppy.«
Ich schnauze Zahra an: »Halt den Mund!«
»Sie kann mich nennen, wie sie will«, sagt Huda.
Schweigend laufen wir zum Ende des Blocks, wo der Gewürzladen ist, und Zahra weicht meinem Blick aus. Ich hätte es wissen müssen: Seit dem Begräbnis hat niemand mehr Baba groß erwähnt. Baba ist der Geist, über den wir nicht sprechen. Ich frage mich manchmal, ob Mama und Huda und Zahra vielleicht so tun wollen, als wäre er nie krank geworden, als hätte der Krebs nie seine Leber und sein Herz zerfressen. Ich vermute, das ist wie bei dem Drehspiel: Manchmal wäre man lieber auf irgendeiner anderen, einer magischen Ebene als auf der eigenen. Aber ich will Baba nicht vergessen. Ich will nicht, dass es so ist, als hätte es ihn nie gegeben.
Die Regale im Gewürzladen sind vollgestopft mit Säcken und Dosen und Gläsern, mit offenen Schalen voll rotem und gelbem Pulver, bezeichnet mit kleinen handgeschriebenen Schildchen auf Arabisch. Der Mann hinter der Theke lächelt uns an und breitet die Arme aus. Auf Zehenspitzen stehend, deute ich mit den Fingern auf die Körbchen mit ganzen Nelken und Kardamomkapseln, die aussehen wie winzige Holzperlen.
Zahra packt Huda am Ärmel, ihr Armband schlackert. »Wie wäre es mit einem Spiel?«, fragt sie auf Englisch, damit ich es verstehe. Auf ihrem Gesicht breitet sich langsam und bedächtig ein Lächeln aus, das irgendwie grausam wirkt. »Warum lassen wir Nour nicht nach dem Kreuzkümmel fragen?«
Huda wirft ihr einen scharfen Blick zu. »Nicht.«
»So kann sie Arabisch üben«, meint Zahra. Sie legt beim Lächeln eine Hand über den Mund.
Der Mann hinter der Theke wartet und kratzt dabei seine Bartstoppeln. Ich wische mir die feuchten Hände an den Shorts ab. Draußen geht der Teeverkäufer vorbei. »Schai«, ruft er, »Schai.«
»Tee«, denke ich. Das Wort kenne ich. Mein Blick wandert zu einem Wandteppich hinten im Laden, von dem ein roter Wollfaden herabhängt, der im Luftstrom des Ventilators zittert. Ich versuche, mich daran zu erinnern, was »ich möchte« heißt.
Der Mann hinter der Theke stellt mir eine Frage, die ich nicht verstehe, seine Stimme fühlt sich an wie grüne Stiche, dazwischen schwarze Punkte aus Konsonanten.
»Bitte«, sagt Huda, »das ist nicht …«
»Ana …« Meine Stimme dringt durch die Hitze, und alle verstummen. Ich habe nur das Wort für »ich« herausbekommen. Ich muss schlucken, bohre mir die Fingernägel in die Handflächen, der Schmerz soll meine Angst vertreiben. »Ana …« Mein Hirn kribbelt und brodelt, da sind rote und rosa Blitze, und obwohl mir das Wort für Kreuzkümmel – al-kamun – einfällt, kann ich mich immer noch nicht erinnern, was »ich möchte« heißt. Ich habe es bestimmt schon ein Dutzend Mal gesagt, aber jetzt, wo alle mich anstarren, habe ich einen Blackout.
Der Mann sagt: »Shu?« Wie bitte?
»Ana – al-kamun.«
Der Mann lacht.
»Du bist Kreuzkümmel?« Auch Zahra bricht in lautes Gelächter aus.
»Ana uridu al-kamun«, sage ich, diesmal lauter. »Ich kann es sagen, hört ihr!«
»Das weiß ich doch«, sagt Huda.
Zahra feilscht mit dem Verkäufer, und ich presse die Wange auf meine Schulter, um zu verhindern, dass mir die Tränen kommen. Die Münzen klimpern, als Huda sie aus ihrer Hand zählt. Beim Rausgehen stößt sie einen leisen Pfiff aus. Über meine zerzausten Locken hinweg flüstert sie Zahra zu: »Mama hatte recht, was die Preise betrifft.«
Auf dem Nachhauseweg kann Zahra ihren Mund nicht halten: »Was bist du denn für eine Syrerin? Du kannst ja nicht mal Arabisch!«
Im Stillen weiß ich, was sie wirklich meint: dass ich nicht weiß, was es bedeutet, Syrerin zu sein.
»Hör auf damit«, sagt Huda.
»Ja klar«, erwidert Zahra, »ich vergaß: Du bist keine Syrerin. Du erinnerst dich ja nicht mal an das Haus, in dem wir wohnten, bevor wir in die Staaten gingen. Du bist Amerikanerin. Du sprichst nur Englisch.«
»Zahra!« Huda bohrt ihre Fingernägel in Zahras Arm.
Zahra heult auf und entwindet ihr den Arm. »Mein Gott, das war doch nur ein Witz!«
Es fühlt sich aber nicht wie ein Witz an. Als Zahra die Arme verschränkt, funkelt das goldene Armband an ihrem Handgelenk. Ich würde es ihr am liebsten abreißen und auf die Straße werfen – soll es doch ein Auto platt fahren.
Durch die leeren Straßen des alten Homs laufen wir zurück, während die Ladenbesitzer im Schein der länglichen roten Sonne ihre Metalljalousien herunterlassen. Ich halte Ausschau nach den bloß liegenden Wurzeln einer Dattelpalme oder einem Fleckchen sauberer, nackter Erde.
Wir kommen wieder an der krummen Pappel mit ihrem kahlen Fuß vorbei. Ich stelle mir vor, wie meine Finger sich in ihre raue Rinde drücken und meine Stimme sich um ihre Wurzeln schlingt.
Wie zwei Hände
So also geschah es, dass Rawiya, ein armes Mädchen aus dem auf einem Zipfel Afrikas gelegenen Dorf Benzú bei Ceuta, das Mittelmeer überquerte. Sie wollte reich werden, nach Hause zurückkehren und für ihre Mutter sorgen. Ihr Vater, der gestorben war, als sie noch ein kleines Mädchen war, hätte das so gewollt. Ihr Bruder Salim fuhr mit Händlern zur See und war nie zu Hause. Es war ein hartes Leben, und die Mutter wusste nie, wann sein Schiff wiederkehren würde – ob es überhaupt wiederkehrte.
Also verließ Rawiya mit der Schleuder ihres Vaters und der Gebetskette ihrer Mutter ihr Zuhause, um sich unter dem Namen Rami der Forschungsreise al-Idrisis anzuschließen, auf der dieser eine Landkarte des gesamten Mittelmeerraums erstellen wollte. Zu jener Zeit hieß es allerdings noch nicht »Mittelmeer«, sondern Bahr ar-Rum, »römisches Meer« oder »byzantinisches Meer« oder auch Bahr ash-Shami, »syrisches Meer«. Für al-Idrisi war dieses Meer das Tor zum größten Teil der bewohnten Welt.
Rawiyas Welt jedoch bestand aus dem winzigen Fleckchen Land ihrer Mutter in Benzú, dem kleinen Olivenhain und dem Strand, den Märkten von Ceuta und dem Hafen von Punta Almina. Rawiya hätte nie gedacht, dass die Welt so riesengroß sein könnte.
Sie waren bereits drei Wochen unterwegs, als die Mannschaft zu raunen begann, dass sie sich Sizilien näherten. Ermutigt von dieser Neuigkeit, stand Rawiya, den Umhang fest um ihre Schultern gezogen, nun an Deck des Schiffs. Die salzige Luft linderte ein wenig die Seekrankheit, an der sie wochenlang gelitten hatte. Sie musste an ihr Pferd Bauza denken, das unter Deck stand, und empfand Schuldgefühle.
Al-Idrisi trat neben sie. Der Wind fuhr mit rauen Fingern durch seinen kurzen Bart und ließ seine Pluderhosen flattern. Er sagte ihr, wie sehr er es liebe, aufs Meer zu schauen. Die salzige Gischt setzte sich dabei in den feinen Linien um seine Augen ab, die den Eindruck vermittelten, er habe viele Jahrzehnte nicht etwa mit Lesen, sondern mit Lachen verbracht. Rawiya hätte ihm gerne erzählt, wie sie als Kind immer die Küste beobachtet hatte und dass sich auch ihr Bruder Salim genau in diesem Moment irgendwo auf diesem Meer befand, aber sie schwieg. Genau jetzt würde die Mutter auf ihren Sohn warten – und, nun meldete sich Rawiyas schlechtes Gewissen, sich langsam auch um ihre Tochter sorgen.
»Ich habe viele Jahre meines Lebens in Türmen und Bibliotheken mit Lesen und Rezitieren verbracht.« Al-Idrisis Brust schwoll von der Seeluft an. »Dann kam der Zeitpunkt, da ich beschloss, nicht noch weitere Jahre damit zu verschwenden.« Er gab Rawiya den Rat, mit Worten sorgfältig umzugehen. »Geschichten haben eine große Macht«, sagte er. »Doch wenn man in seinem Herzen zu viele Worte anderer Menschen ansammelt, dann begraben sie deine eigenen unter sich. Vergiss das nicht.«
Noch immer konnten sie nirgends Land sehen, um sie herum war nichts als das Meer, der Mast ächzte, und die Segel knatterten wie die Flügel Hunderter Sturmvögel.
»Ihr gehört nicht in eine Bibliothek«, sagte Rawiya. »Hier scheint Ihr Euch zu Hause zu fühlen, so wie in den Bergen und in der Medina.«
»Früher hatte ich eine Familie, die hätte dir recht gegeben.« Al-Idrisi stützte seine Arme auf die Reling und richtete seinen Blick aufs Wasser. »Das Meer zeigt uns unser wahres Ich. Manchmal denke ich, dass wir aus dem Wasser kamen und es uns ruft, damit wir dorthin zurückkehren. Wie eine Hand sich nach einer anderen ausstreckt.«
Rawiya wandte sich wieder dem Muster der Wellen zu. Sie hatte sich das offene Meer platt vorgestellt, wie einen Spiegel oder eine Münze, aber es konnte die unterschiedlichsten Farben und Formen annehmen. Bei einem nahenden Sturm wurde es grün oder schwarz und manchmal auch rot oder violett oder silbern und weiß-golden. Und es hatte scharfe Kanten. Es hatte seine Launen, blaue Perioden, Lachanfälle.
»Das Meer ist ein Kind«, sagte Rawiya, »neugierig, hungrig und fröhlich zugleich.«
Al-Idrisi antwortete: »Das Meer wechselt seine Gestalt nach Belieben.«
Und Rawiya musste an ihren Vater denken, wie er die Küste beobachtet hatte, während er den Olivenhain hegte, wie er immer sagte, das Meer verändere sich nachts. Sie dachte an die kurze Krankheit ihres Vaters zurück, wie er unwiederbringlich in die Dunkelheit gefallen war, so wie man von einer Leiter in den Olivenbäumen fällt. Sie hatte sich nie richtig von ihm verabschieden können.
Wieder lächelte al-Idrisi, diesmal sanfter. »Ruh dich ein wenig aus«, sagte er, »damit du bei Kräften bist, wenn wir in Palermo ankommen. Dort müsst ihr beide viel lernen.« Denn al-Idrisi hatte noch einen zweiten Lehrling mitgenommen, einen Jungen namens Bakr, der seekrank unter Deck lag. »Du, Rami«, sagte al-Idrisi, »bist der widerstandsfähigste von allen meinen Lehrlingen.« Er lachte.
Dann war er verschwunden. Sein Lachen hallte zwischen Tauen und Mast wider. Es wurde zum Lachen von Rawiyas Vater, gekräuseltes Grün wie von der Sonne gedörrte Olivenblätter. Über die Reling gebeugt, sah Rawiya ihr Spiegelbild auf der Wasseroberfläche, den roten Turban und das jungenhafte Gesicht. Sie erkannte sich nicht wieder.
Nach Babas Begräbnis, nachdem die Nachbarn, meine Lehrer und Babas Arbeitskollegen gegangen waren, räumte Mama das Geschirr beiseite und stellte die Nelken in ein Glas Wasser. Da die Stiele zu lang für das Glas waren, nahm Huda es, als Mama nicht hinsah, und platzierte es am Fenster, wo die Köpfe der Blumen am Schrank Halt fanden.
Mama merkte es gar nicht. Sie schien an einem Ort zu sein, an dem nichts sie erreichte. Sie bewegte sich durch die Küche wie der Luftzug eines Ventilators, schaltete den Gasherd ein und füllte den Teekessel zu voll.
Während wir stumm dasaßen, tupfte Mama ihr verschmiertes Make-up weg und braute eine Kanne starken Salbeitee, einen von der Sorte, von dem meinen Freundinnen übel wurde und den ich so liebte.
Der Tee schmeckte nach Samstagmorgen, wenn Mama mit uns zum Laden ging, um Gemüse einzukaufen, und alles nach Obst und Wasser roch. Er schmeckte nach Herbstnachmittagen, an denen Baba mit mir in den Central Park ging und sich beim Ballspielen in das leere Becken des Springbrunnens stellte, um sich meiner Größe anzupassen. Er schmeckte wie Babas Gutennachtgeschichten.
Also fragte ich Mama nach der einzigen von Babas Geschichten, von der ich sicher war, dass sie sie kannte. Ich bat sie, die Geschichte von Rawiya und al-Idrisi zu erzählen.
Mama beugte sich über den Tisch, ihre Augenbrauen zogen sich über ihrer Nase zusammen, während sie überlegte, wie sie anfangen sollte. Doch obwohl sie immer zuhörte, hat sie selbst nie Geschichten erzählt wie Baba. Sie sagte: »Vor vielen Jahren reiste ein tapferes Mädchen namens Rawiya von Ceuta nach Fes, um ihr Glück zu suchen.«
»Aber so hat Baba nie angefangen. Was ist mit dem Feigenbaum und Bauza?«, wandte ich ein.
Mama rückte ihren Stuhl näher an meinen heran und glättete mit den Händen die Stoff-Sets auf dem Tisch. »Du darfst nicht vergessen«, sagte sie, »dass selbst Baba immer sagte, dass zwei unterschiedliche Menschen eine Geschichte nie ganz genau gleich erzählen.«
Ich zupfte an einer Tischsetfranse. Ich wollte keine neue Version der Geschichte, ich wollte die von Baba. »Aber ich vermisse es, wie er sie erzählt hat.«
Mama antwortete: »Keiner von uns hat seine Stimme.« Sie nahm meine Hände und setzte damit meinem Gezupfe ein Ende. Meine Finger hinterließen in den geflochtenen Fransen eine Lücke, eine kahle Stelle in der Bordüre.
In dieser Nacht, als ich schon meinen Pyjama anhatte und in die Küche tappte, um nach den Nelken zu sehen, fand ich die ersten Spuren von Salz auf dem Griff des Teekessels. Sie bildeten die Umrisslinien von Meeren, die mir gänzlich unbekannt waren, von Ländern, die ich nie zuvor gesehen hatte.
Auf dem Rückweg vom Gewürzladen will Zahra unbedingt in ein Schmuckgeschäft. Nicht weit weg von uns stehen mürrische Polizisten in der Hitze unter einem Porträt des Präsidenten. Aus einer entfernteren Ecke des Viertels schallen Rufe. Bis auf die Polizisten und Huda und mich scheint sich niemand in dieser Straße aufzuhalten. Ich drehe mich weg, das Glas Kreuzkümmel in der Hand.
»Kann sie sich vielleicht ein bisschen beeilen?« Ich kicke Steinchen vor mir her. »Abu Said wird jeden Augenblick kommen.«
»Mach dir keine Sorgen«, antwortet Huda. »Abu Said wohnt noch eine Straße weiter als die, wo der Gewürzladen ist. Wenn er sich schon auf den Weg gemacht hätte, wären wir ihm begegnet.«
Verärgert verziehe ich das Gesicht. »Überhaupt, wozu braucht Zahra noch mehr Zeug? Sie hat doch schon das goldene Armband mit dem dämlichen Muster.«
»Meinst du den Filigranschmuck?« Huda zuckt mit den Schultern und bindet ihre Schnürsenkel zu. »Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Für Zahra ist eben … ein bestimmtes Aussehen wichtig.«
»Aber sie benimmt sich hässlich.« Die Schatten meiner Beine auf dem Gehweg sind lang wie ein Giraffenhals, und es sieht seltsam aus, wie sie an meinen Sandalen hängen.
Huda wirft einen kurzen Blick zum Schmuckgeschäft und nimmt dann meine Hand. »Wie wäre es mit einem Eis?«
Über warmen Stein und Beton schlendern wir auf eine winzige Eisdiele im nächsten Häuserblock zu. »Zahra muss vieles erst herausfinden«, sagt Huda. »Aber sie ist kein schlechtes Mädchen.«
»Was gibt es denn da groß herauszufinden?« Ich schwenke das Gewürzglas, während mein Blick hinauf zu den Fenstern über den Bekleidungsgeschäften und Cafés schweift, aus denen sich Frauen beugen und Staub aus Teppichen und Vorhängen schütteln. »Jetzt jedenfalls ist sie gemein. Sie ist die schlimmste Schwester der Welt.«
»Sag so was nicht.« Um einem Spalt im Gehweg auszuweichen, lassen wir unsere Hände los. Huda hebt den Arm, und graziös wie eine Tänzerin bewegt sie ihr Handgelenk auf meine Hand zu. Hinter ihr weht ihr Rock im Wind, er sieht aus wie das stahlblaue Kielwasser eines Schiffs. »Manche Menschen brauchen Zeit, um herauszufinden, wer sie sind«, erklärt sie. »Sie lassen sich von Kleinigkeiten durcheinanderbringen. Es ist wichtig für sie, was andere denken. Das ist, als würde man vom Wind herumgewirbelt wie ein Blatt.«
Ich spiele am Deckel des Gewürzglases herum, und das Pulver darin bildet kleine Gipfel und Grate. »Deswegen ist es noch lange nicht okay, sich wie ein Idiot zu verhalten.«
»Nein, ist es nicht.«
Ein Mann radelt vorbei. Sein Schatten gleitet die Wand entlang und huscht schwarz-weiß gestreift über die Türstöcke. Das Schild über der Eisdiele ist von der Hitze so wellig geworden, dass ich die Buchstaben kaum noch lesen kann. Die Glasfront ist geöffnet, um die Hitze herauszulassen. Vor der Tür stehen ein Tisch und zwei Plastikstühle, leer. Die Wände drinnen sind mit Tüchern und gerahmten Fotos dekoriert. Die warme Luft der Ventilatoren kitzelt unsere Gesichter. Immer wieder fällt kurz der Strom aus, dann wird das Licht bräunlich, und die Ventilatoren bleiben stehen.
Huda fastet wegen des Ramadans und bestellt nur für mich eine Portion. Der Verkäufer schabt das Eis aus dem Behälter, bringt es mit der Hand in Form, rollt es in Pistazien und setzt es in eine in Wachspapier gewickelte Waffel. Hinter ihm rührt ein Mann mit Papierhut und T-Shirt Eiscreme mit einem Holzlöffel. Er sieht zu mir hoch, als ich mich bedanke, weil ihm mein Akzent auffällt.
Draußen macht sich sofort die Hitze über mein Eis her. Ich fange die Tropfen mit der Zunge auf, das Kreuzkümmelglas in der einen, die Eiswaffel in der anderen Hand.
Ich nehme einen Mundvoll Eis, die Kälte lässt mich erschauern. »Und warum bist du anders, lässt dich nicht … nicht so leicht von Windstößen herumwirbeln?«, frage ich Huda.
»Ich habe beschlossen, dass es wichtigere Dinge gibt als das, was andere denken«, antwortet sie.
»Trägst du deshalb Kopftuch, seit Baba krank wurde?« Aus meinem Mund steigt Dampf.





























