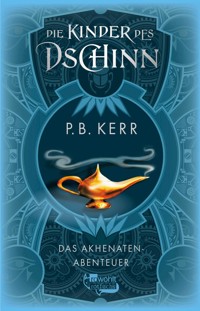
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kinder des Dschinn
- Sprache: Deutsch
»Auch der wunderbarste Märchenheld, der an seiner kupfernen Lampe reibt, hätte sich keine fesselndere Geschichte als das rasant und brillant erzählte Abenteuer wünschen können.« (Spiegel) Eigentlich führen die Zwillinge John und Philippa ein ganz normales Leben. Bis ihnen eines Tages ihre Weisheitszähne entfernt werden und plötzlich unerklärliche Dinge geschehen. Denn John und Philippa sind keineswegs wie andere Zwölfjährige. Sie sind Dschinn. Und ehe die beiden so recht wissen, wie ihnen geschieht, landen sie mitten in einem unglaublichen magischen Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
P. B. Kerr
Die Kinder des Dschinn. Das Akhenaten-Abenteuer
Über dieses Buch
«Auch der wunderbarste Märchenheld, der an seiner kupfernen Lampe reibt, hätte sich keine fesselndere Geschichte als das rasant und brillant erzählte Abenteuer wünschen können.» (Spiegel)
Eigentlich führen die Zwillinge John und Philippa ein ganz normales Leben. Bis ihnen eines Tages ihre Weisheitszähne entfernt werden und plötzlich unerklärliche Dinge geschehen. Denn John und Philippa sind keineswegs wie andere Zwölfjährige. Sie sind Dschinn. Und ehe die beiden so recht wissen, wie ihnen geschieht, landen sie mitten in einem unglaublichen magischen Abenteuer.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
P. B. Kerr wurde 1956 in Edinburgh/Schottland geboren. Er studierte Jura an der Universität Birmingham und arbeitete zunächst als Werbetexter, bis er sich einen Namen als Autor, u. a. von Krimis und Thrillern für Erwachsene, machte. Viele seiner Bücher wurden internationale Bestseller, etliche mit großem Erfolg verfilmt. Für seine Arbeit wurde er u. a. zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Als freier Schriftsteller lebte der Vater von drei Kindern bis zu seinem Tod in einem Vorort von London. «Das Akhenaten-Abenteuer» war sein erstes Kinderbuch und der Start der Reihe «Die Kinder des Dschinn». Die Filmrechte daran hat sich Hollywoods Star-Regisseur Steven Spielberg gesichert.
Dieses Buch wurde für und mit Hilfe von William Falcon Finlay Kerr, Charles Foster Kerr und Naomi Rose Kerr geschrieben, die alle in London SW19 leben. Möget ihr immer wissen, was Glück bedeutet.
Prolog
Der heißeste Ort auf Erden
s war an einem heißen Sommertag kurz nach zwölf Uhr mittags in Ägypten. Hussein Hussaout, sein elfjähriger Sohn Baksheesh und ihr Hund Effendi lagerten zwanzig Meilen südlich von Kairo in der Wüste. Wie gewöhnlich waren sie mit der illegalen Ausgrabung historischer Gegenstände beschäftigt, die sie in ihrem Laden verkaufen konnten. Nichts bewegte sich in der Wüste – außer einer Schlange, einem Mistkäfer, einem kleinen Skorpion und in der Ferne einem Esel, der einen Holzkarren voller Palmenblätter einen Weg entlangzog. Ansonsten herrschten nur Einsamkeit und stille Hitze. Ein zufälliger Besucher dieser Gegend hätte sich kaum vorstellen können, dass der kahle Wüstenrand aus Sand und Steinen zum größten archäologischen Gebiet Ägyptens gehörte und dass unter dem dürren Trockenland noch immer unschätzbare Reichtümer an Gedenkstätten und Schätzen verborgen lagen.
Baksheesh machte es Spaß, seinem Vater bei der Schatzsuche in der Wüste zu helfen. Doch es war harte Schweißarbeit, und alle paar Minuten ließ Baksheesh oder sein Vater den Spaten fallen und ging zurück zum Jeep, um einen Schluck Wasser zu trinken und sich für ein paar Minuten im klimatisierten Wagen abzukühlen, bevor er wieder zur Ausgrabungsstelle zurückkehrte. Die Arbeit war zudem gefährlich, denn außer den Schlangen und Skorpionen wimmelte es in der Gegend von tiefen, versteckten Gruben, in die ein unvorsichtiger Mann oder ein Kamel fallen konnte.
Ein erfolgreicher Vormittag lag hinter ihnen: Bisher hatten sie mehrere altertümliche Shabti-Figuren gefunden, dazu ein paar Tonscherben und einen kleinen goldenen Ohrring. Baksheesh war glücklich, denn er hatte den goldenen Ohrring ausgegraben, den sein Vater für sehr wertvoll hielt. Als das Schmuckstück die Strahlen der heißen Wüstensonne reflektierte, brannte es in Husseins Hand wie ein Ring aus Feuer.
»Geh und hol dir was zum Mittagessen, Junge«, sagte er. »Du hast es dir verdient.« Er selbst grub weiter in der Hoffnung, noch mehr verborgene Kostbarkeiten zu finden.
»Ja, Vater.« Dicht gefolgt von Effendi, der einen Leckerbissen zu bekommen hoffte, ging Baksheesh zum Geländewagen zurück und ließ die Ladeklappe herunter. Gerade wollte er die Kühlbox herausholen, als der Jeep sich plötzlich in Bewegung setzte. In der Meinung, die Handbremse hätte sich gelöst, rannte Baksheesh schnell zur Fahrertür. Er wollte hineinspringen und die Bremse anziehen, doch als er die Hand nach dem Türgriff ausstreckte, glitt das Auto mit einem Ruck zur Seite. Einen Augenblick später spürte Baksheesh eine starke Erschütterung unter den Füßen, als hätte ein unterirdischer Riese mit der Faust gegen die steinerne Decke über seinem Kopf geschlagen. Als Baksheesh hinunterschaute, schlug der Boden unter ihm Wellen, die das ganze Tal durchliefen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte gegen den Wagen; dabei verletzte er sich leicht am Ellbogen. Er schrie auf, als eine zweite und noch stärkere Erschütterung rasch auf die erste folgte.
Baksheesh kam mühsam auf die Beine. Er versuchte, sein Gleichgewicht zu halten, was leichter wurde, als er nicht mehr auf den Boden sah und stattdessen den Blick auf die Wand des Steilhangs richtete. Hier hatten sein Vater und er schon oft gearbeitet – sie kannten die Stelle gut. Doch noch während er dorthin schaute, gab eine ganze Felswand nach und stürzte in einer Welle aus Staub, Steinen, Felsbrocken und Sand auf den glitzernden Wüstenboden.
Baksheesh setzte sich schnell auf den Boden, um nicht noch einmal zu fallen. Er hatte noch nie ein Erdbeben erlebt, und dennoch wusste er, dass diese erschreckende Erschütterung des Bodens kaum etwas anderes bedeuten konnte. Im Gegensatz zu ihm schien das Erdbeben seinen Vater eher in Entzücken zu versetzen; hysterisch lachend versuchte er, wieder auf die Beine zu kommen.
»Endlich«, rief er, »endlich!« Offenbar war er davon überzeugt, dass das Erdbeben ein wahres Glück für ihn war.
Fassungslos sah Baksheesh zu, wie sein Vater über den zuckenden Erdboden lief, wie auf einem schwankenden Schiff. Er war überzeugt, sein Vater müsse verrückt geworden sein.
»Zehn Jahre!«, schrie Hussein Hussaout und übertönte das donnernde Dröhnen des Erdbodens. »Zehn Jahre habe ich darauf gewartet!«
Zu Baksheeshs Erstaunen ließen die gute Laune und Aufregung seines Vaters selbst dann nicht nach, als eine Explosion von Erde und Steinen den Jeep fast zwei Meter in die Höhe schleuderte und auf dem Dach landen ließ.
»Vater, hör auf!«, schrie der Junge und hielt Effendi fest, der vor Angst zitterte und jaulte. »Du bist ja übergeschnappt. Bitte hör auf, sonst wirst du noch getötet!«
In Wahrheit war es für Hussein Hussaout nicht gefährlicher, auf der bebenden Erde zu stehen, als für seinen Sohn und den Hund, sich am Boden festzuklammern. Doch der Junge hatte das Gefühl, dass sein Vater sich irgendwie respektlos verhielt, sodass die Erdgeister in der guten Laune und der scheinbaren Sorglosigkeit des Vaters einen Mangel an gebührendem Respekt sehen und deswegen alle drei töten könnten.
Und dann ließen die unterirdischen Beben genauso plötzlich wieder nach, wie sie begonnen hatten. Das beängstigende Rumoren hörte auf, der Staub und der Sand legten sich wieder, und die gleißende Stille kehrte zurück, als würde die Natur den Atem anhalten und abwarten, was als Nächstes geschah.
Alles war wieder ruhig – bis auf Hussein Hussaout.
»Ist das nicht wunderbar?«, rief er. Erst jetzt, nachdem der Boden endlich aufgehört hatte zu beben, sank er in die Knie und faltete die Hände lächelnd wie zum Gebet.
Baksheesh drehte sich zu dem umgestürzten Geländewagen um und schüttelte den Kopf. »Sieht so aus, als müssten wir zur Straße gehen und Hilfe holen«, sagte er. »Ich verstehe nicht, was daran so wunderbar sein soll.«
»Aber es ist wunderbar«, beharrte sein Vater und hielt ein Stück Stein in die Höhe, das nicht viel kleiner als eine CD war. »Sieh her. Ich habe es sofort entdeckt, als die Erde anfing sich zu bewegen. Seit Tausenden von Jahren haben Wind und Sand die Schätze des Pharaos bewacht. Aber immer mal wieder bebt die Erde und bringt Verborgenes ans Tageslicht.«
Für Baksheesh sah das Steinstück nicht wie ein Schatz aus, und fast jeder andere hätte das rechteckige Stück aus glattem grauem Basalt voller Einkerbungen sicher ignoriert. Doch Hussein hatte es sofort als das erkannt, was es war: eine ägyptische Stele.
»Es ist eine Steintafel mit Hieroglyphen aus der achtzehnten Dynastie«, erklärte der Vater. »Wenn das der Stein ist, für den ich ihn halte, dann haben wir den Schlüssel zu einem Geheimnis gefunden, das seit Tausenden von Jahren ungelöst ist! Das könnte der größte Tag unseres Lebens werden! So eine Chance gibt es nur einmal im Leben. Das ist so wunderbar daran, mein Sohn. Das ist der Grund, warum ich so glücklich bin!«
Hundenamen
r und Mrs Edward Gaunt lebten in New York. Sie wohnten in der East 77th Street Nummer 7, einem alten Stadthaus mit sieben Stockwerken. Sie hatten zwei Kinder, John und Philippa, die zwar Zwillinge von zwölf Jahren waren, sich jedoch zu ihrer eigenen Befriedigung so wenig ähnelten, wie man es sich bei Zwillingen nur vorstellen kann. Die meisten Leute konnten kaum glauben, dass sie wirklich Zwillinge sein sollten, so verschieden waren sie. John, der um zehn Minuten Ältere, war groß und dünn. Er hatte glattes braunes Haar und trug am liebsten Schwarz. Philippa war kleiner als er, hatte lockiges rotes Haar und trug eine Hornbrille, wodurch sie intelligenter wirkte als ihr Bruder. Ihre Lieblingsfarbe war Rosa. Beide hatten ein wenig Mitleid mit eineiigen Zwillingen und schätzten sich glücklich, diesem Schicksal entronnen zu sein. Auch wenn es ihnen auf die Nerven ging, wenn die Leute immer wieder hervorhoben, wie wenig ähnlich sie einander sahen, so als wäre das bisher noch niemandem aufgefallen – in ihren Köpfen sah es ganz anders aus. John und Philippa dachten fast immer dasselbe. Wenn der Lehrer in der Schule eine Frage stellte, hoben sie jedes Mal gleichzeitig die Hand. Wenn sie sich eine Quizshow im Fernsehen anschauten, antworteten sie wie aus einem Mund. Und gegen die beiden zusammen in Memory zu gewinnen war praktisch unmöglich.
Ihr Vater Mr Gaunt war ein Investmentbanker, was bedeutet, dass er reich war. Mrs Gaunt oder Layla, wie sie von allen genannt wurde, war eine wunderschöne Frau. Sie wirkte bei vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen mit und war dort sehr gefragt, denn alles, womit sie sich befasste, hatte Erfolg. Sie gab viele Dinnerpartys, und ihre Unterhaltung war so prickelnd wie ein Glas Champagner; zudem war sie glamourös, was bedeutet, dass sie klug und schön zugleich war, und das ganz ungemein.
Es bestand jedoch kein Zweifel daran, dass Mr und Mrs Gaunt ein ungleiches Paar abgaben – sie waren ungefähr so verschieden wie ihre Zwillingskinder. Die dunkelhaarige Layla mit der Figur einer Sportlerin war sogar ohne Absätze über einen Meter achtzig groß, während ihr Mann Edward, der eine Brille mit getönten Gläsern trug und sein graues Haar nicht zu kurz schneiden ließ, selbst in seinen feinen italienischen Schuhen kaum einen Meter fünfzig überschritt. Wenn Layla einen Raum betrat, nahmen die Leute sie sofort wahr, doch Edward wurde meistens übersehen. Glücklicherweise war ihm das ganz recht, denn er war eher der schüchterne und zurückhaltende Typ und damit zufrieden, seiner Frau das Heim in der 77th Street als Bühne zu überlassen.
Das Haus der Gaunts auf der feinen Upper East Side in New York wurde oft in allen möglichen eleganten Zeitschriften gezeigt, da Edward und Layla sehr viel Geschmack besaßen. Die Haustür bestand aus massivem Ebenholz, und innen waren alle Wände mit bestem Mahagoni getäfelt. Das Haus war mit vielen wertvollen französischen Gemälden, antiken englischen Möbeln, seltenen Perserteppichen und teuren chinesischen Vasen ausgestattet. Manchmal glaubte Philippa, ihren Eltern seien die Möbel wichtiger als ihre Kinder – doch sie wusste, dass es nicht wahr war, und sie sagte es auch nur, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen; genauso wie ihr Zwillingsbruder John seinem Vater gern vorwarf, ihr Haus würde mehr einer Kunstgalerie ähneln als einem Zuhause, das sich für zwei zwölfjährige Kinder eignete. Immer wenn John das bemerkte – meist wenn sein Vater mit einem weiteren altmodischen Gemälde nach Hause kam –, lachte Mr Gaunt und sagte zu seinem Sohn, wenn dies eine Kunstgalerie wäre, würden ihre beiden Hunde sofort das Gebäude verlassen müssen.
Alan und Neil waren zwei große Rottweiler und bemerkenswerte Tiere – nicht zuletzt deswegen, weil sie alles zu verstehen schienen, was man ihnen sagte, solange es auf Englisch war. Einmal, als John zu faul gewesen war, aufzustehen und die Fernbedienung des Fernsehers zu suchen, hatte er Alan befohlen, einen anderen Sender einzuschalten – und zu seinem Erstaunen hatte Alan es tatsächlich getan. Neil war genauso intelligent wie Alan: Beide Hunde kannten den Unterschied zwischen dem Kinderkanal, dem Disney-Sender, Nickelodeon und CNN. Sie begleiteten John und Philippa oft auf ihren Wegen in New York, und die Zwillinge waren sicher die einzigen Kinder in der Großstadt, die ohne Angst nach Anbruch der Dunkelheit durch den nahe gelegenen Central Park spazierten. Dass zwei so schlaue Hunde so gewöhnliche Namen haben sollten, fand John äußerst irritierend.
»Schon die alten Römer züchteten Rottweiler«, erzählte er seinen Eltern kurz vor Beginn der Sommerferien eines Morgens beim Frühstück. »Und zwar als Wachhunde. Sie sind so ziemlich die einzigen Haustiere, vor denen der Gesundheitsminister warnt. Ihr Biss ist stärker als der aller anderen Rassen, vielleicht mal abgesehen von diesem dreiköpfigen Hund, der den Hades bewacht.«
»Zerberus«, murmelte Mr Gaunt. Er nahm seine New York Times und las den Artikel über das Erdbeben in Kairo, der auf der Titelseite von einem großen Foto begleitet wurde.
»Das weiß ich, Dad«, sagte John. »Jedenfalls werden Rottweiler aus diesem Grund von der Armee und der Polizei bevorzugt eingesetzt. Und deswegen finde ich es irgendwie lächerlich, sie Alan und Neil zu rufen.«
»Warum?«, fragte Mr Gaunt. »So hießen sie doch schon immer.«
»Das weiß ich. Aber wenn ich zwei Rottweilern Namen geben sollte, würde ich mir etwas Passenderes einfallen lassen. Vielleicht Nero und Tiberius. Nach den beiden römischen Kaisern.«
»Nero und Tiberius waren keine besonders netten Leute, Liebling«, sagte Johns Mutter.
»Das stimmt«, pflichtete sein Vater ihr bei. »Tiberius hatte kein freundliches Wesen – civile ingenium. Er war ein grässlicher Mensch. Und Nero war total verrückt. Dazu kommt, dass er seine Mutter Agrippina ermordete. Und seine Frau Octavia. Und er hat die Stadt bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Odisse coepi, postquam parricida matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius extitisti.« Der Vater lachte grausam. »Ich frage dich: Was für ein Vorbild ist das für einen Hund?«
John biss sich auf die Lippe; es fiel ihm schwer, sich mit seinem Vater zu streiten, wenn er lateinisch redete. Mit Leuten, die Latein sprachen – wie Richter und Päpste –, konnte man sich grundsätzlich nicht streiten.
»Also gut«, sagte er. »Vielleicht nicht gerade Nero.«
»Und schlage bloß nicht Commodus vor«, sagte Mr Gaunt, »denn der war noch schlimmer als Nero.«
»Also gut, kein römischer Kaiser«, gab John nach. »Dann eben was anderes. Etwas, das ein bisschen hündischer klingt. Zum Beispiel Elvis.«
»Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest«, erwiderte Mr Gaunt hartnäckig, »ist keiner unserer beiden Hunde besonders hündisch, wie du es ausdrückst. Du hast selbst gesagt, dass Rottweiler von Polizeibehörden und dem Militär bevorzugt werden. Manche Leute haben einen Hund, der die Zeitung aus dem Briefkasten holt. Ich habe zwei Hunde, die am Samstagmorgen zur Bäckerei laufen und eine Tüte Brötchen holen können, ohne ein einziges zu fressen. Das hätte sogar Elvis nicht fertig gebracht. Und wie hündisch ist es, sich selbst zum Tierarzt zu bringen, wenn man sich krank fühlt? Oder eine Parkuhr zu füttern? Ich würde gern sehen, wie Kaiser Nero versucht, eine Münze in eine Parkuhr zu stecken! Außerdem«, fügte er beim Zusammenfalten der Zeitung hinzu, »ist es dafür schon ein bisschen zu spät. Jetzt sind es erwachsene Hunde. Ihr ganzes Leben haben wir sie Alan und Neil genannt. Glaubst du wirklich, sie können plötzlich auf andere Namen hören? Schließlich ist ein Hund kein alberner Popstar oder Filmschauspieler. Solche Leute können sich an einen merkwürdigen neuen Namen wie Dido oder Sting gewöhnen. Aber ein Hund passt sich seinem Namen an wie kein anderes Tier.« Mr Gaunt sah seine Tochter an. »Findest du nicht auch, Philippa?«
Philippa nickte nachdenklich. »Es stimmt, dass sie keine besonders hündischen Hunde sind. Deswegen glaube ich, wir könnten ihnen behutsam erklären, dass jeder von ihnen einen neuen Namen bekommt. Mal sehen, wie sie darauf reagieren. Ein Hund, der schlau genug ist, den Unterschied zwischen CNN und dem Kinderkanal zu erkennen, ist sicher auch intelligent genug, sich an einen neuen Namen zu gewöhnen.«
»Aber ich verstehe einfach nicht, warum ihre jetzigen Namen nicht gut genug sein sollen. Alan und Neil sind keltische Namen. Alan bedeutet ›der Hübsche‹, und Neil bedeutet ›Sieger‹. Ich verstehe wirklich nicht, was an zwei Hunden auszusetzen ist, deren Namen Hübscher und Sieger bedeuten.«
»Ich halte es für eine ausgezeichnete Idee, Liebling«, stimmte Mrs Gaunt zu. »Selbst mit viel Phantasie lässt sich Alan nicht als hübsch bezeichnen. Und Neil hat in seinem Leben noch keinen einzigen Wettkampf gewonnen.« Sie lächelte zufrieden, als sei die Angelegenheit damit beschlossene Sache. »Also – wie werden wir sie nennen? Ich muss zugeben, mir gefällt der Name Elvis. Alan ist der größere der beiden und hat einen Riesenappetit. Er ist ein Elvis, wie er im Buche steht.«
Mr Gaunt warf seiner Frau einen strengen, fragenden Blick zu, so als würde er ganz und gar nicht mit ihr übereinstimmen. »Layla«, sagte er ruhig. »Das ist nicht lustig.«
»Und Neil sollten wir Winston nennen«, schlug Philippa vor. »Nach Winston Churchill. Er ist der bissigere der beiden, und mit seinem Doppelkinn und seinem bösen Knurren wirkt er genau wie Winston Churchill.«
»Und Zigarren mag er auch«, warf John ein. »Immer wenn jemand im Haus eine Zigarre raucht, kommt Neil angerannt und schnüffelt in der Luft herum, als würde er den Geruch lieben.«
»Das stimmt«, sagte Philippa. »Genau das tut er.«
»Dann bleibt nur noch die Frage: Wer bringt es ihnen bei?«, fragte John.
»Das musst du tun, Mum«, sagte Philippa. »Auf dich hören sie immer. Alle hören auf dich. Sogar Dad.«
Das stimmte. Alan und Neil gehorchten Mrs Gaunt stets, ohne zu zögern.
»Ich bin immer noch nicht einverstanden«, beharrte Mr Gaunt.
»Also gut, dann stimmen wir ab«, schlug John vor. »Alle, die dafür sind, dass die Hunde neue Namen bekommen, heben die Hand.«
Als sich drei Hände erhoben, gab Mr Gaunt sich seufzend geschlagen. »Macht, was ihr wollt. Aber ich wette, Alan und Neil werden es nicht schlucken.«
»Das werden wir ja sehen«, sagte Mrs Gaunt. »Wir hätten schon viel früher daran denken sollen. Die Kinder haben Recht.« Sie steckte die Finger in den Mund und stieß einen ohrenbetäubenden Pfiff aus, der jeden Cowboy vor Neid hätte erblassen lassen.
Wenige Sekunden später erschienen die beiden Hunde in der Küche und blieben aufmerksam vor Mrs Gaunt stehen, als würden sie auf ihre Anweisungen warten.
»Jetzt hört mir mal gut zu, Jungs«, sagte sie. »Wir haben beschlossen, euch neue, hundgerechte Namen zu geben.«
Neil warf Alan einen fragenden Blick zu und knurrte leise. Alan gähnte übertrieben und setzte sich.
»Ich will mit euch gar nicht darüber diskutieren«, beharrte Mrs Gaunt. »Neil? In Zukunft heißt du Winston. Und Alan? Du heißt von jetzt an Elvis. Habt ihr verstanden?«
Die Hunde blieben stumm. Deswegen wiederholte Mrs Gaunt die Frage, und dieses Mal bellten beide Hunde laut.
»Cool«, sagte John.
»Ich werde sie weiterhin bei ihren alten Namen rufen«, sagte Mr Gaunt. »Auch wenn die Hunde sich vielleicht an die neuen Namen gewöhnen – ich werde es sicher nicht.«
»Platz, Winston«, befahl Mrs Gaunt, und der Hund, der bisher auf den Namen Neil gehört hatte, legte sich auf den Küchenboden. »Elvis, steh auf.« Und der Hund, der früher Alan geheißen hatte, stand gehorsam auf.
»Unglaublich«, sagte John. »Wer hat behauptet, man könnte einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen?«
»Man sollte diese Hunde im Fernsehen zeigen«, sagte Philippa.
Gereizt schleuderte Mr Gaunt seine Zeitung weg und stand vom großen Kirschbaumtisch auf. »Auf keinen Fall«, sagte er und verließ ziemlich verärgert die Küche.
Später gingen die Zwillinge wie gewohnt in die Schule, und wie gewohnt passierte dort nichts Aufregendes. John und Philippa waren in den meisten Fächern außer in Mathe sehr gut, doch im Sport überragten sie alle, schon allein deswegen, weil sie so unglaublich gut in Form waren – viel fitter als die meisten der übergewichtigen, trägen Schüler in ihrer Schule. Der Grund für die gute Kondition der Zwillinge war, dass beide unter Klaustrophobie litten, was bedeutet, dass sie Angst vor geschlossenen Räumen hatten. Am meisten verabscheuten sie Aufzüge, was in einer Stadt wie New York mit ihren vielen hohen Wolkenkratzern ein echtes Problem ist, wie man sich vorstellen kann. Während die meisten Leute den Aufzug benutzten, nahmen John und Philippa die Treppen. Manchmal rannten sie fünfzig oder sechzig Stockwerke hoch, um an ihr Ziel zu kommen. Und das machte die Zwillinge so fit wie ein Paar Flöhe. Tatsache ist, dass Flöhe ins Fitnesscenter eintreten müssten, um so fit wie John und Philippa zu werden. Doch selbst zwei so sportliche Kinder wie John und Philippa konnten nicht so schnell sein wie ein Aufzug und kamen deswegen fast immer zu spät. Dies hätte ihre Eltern sehr ärgerlich machen müssen, doch Edward und Layla Gaunt hatten viel mehr Verständnis für ihre Kinder, als John und Philippa je vermutet hätten.
Besuch beim Zahnarzt
ie meisten Kinder freuen sich auf das Ende des Schuljahrs und den Anfang der Sommerferien. Doch die Zwillinge verbanden den ersten Tag der Sommerferien immer mit einer gewissen Panik, denn an diesem Tag vereinbarte Mrs Gaunt regelmäßig einen Zahnarzttermin für John und Philippa.
Die Zwillinge hatten gute, feste Zähne, weiß wie Pfefferminz und ebenmäßig wie eine Reihe parkender Autos. Keiner von beiden hatte bisher eine Füllung gebraucht, und in Wahrheit gab es für die beiden wenig Anlass, nervös zu werden. Dennoch hatten sie immer das dumpfe Gefühl, dass Dr. Larr eines Tages irgendetwas finden würde, das behoben werden müsste, und dann würden all die glänzenden Metallbohrer, Nadeln, Zahnstocher und Spiegel, die wie lauter Folterinstrumente auf seinem Tisch lagen, plötzlich ihre schmerzhafte Anwendung finden.
Die Zwillinge hatten schon genug Filme gesehen, um zu wissen, dass alle Arten von unerträglichem Schmerz möglich wurden, sobald ein Zahnarzt zur Tat schritt, statt nur die Routineuntersuchungen durchzuführen, an die sie gewöhnt waren.
Das war vielleicht auch die Erklärung dafür, warum John am frühen Morgen des Termins bei Dr. Larr von einem besonders lebhaften Traum aufwachte, in dem er unter schrecklichen Zahnschmerzen gelitten hatte – genau der Art von grauenhaften Zahnschmerzen, die einen starken, erwachsenen Mann in ein zitterndes Häufchen Elend verwandeln können. Johns Traum endete damit, dass ihm sämtliche Zähne gezogen werden mussten.
Schweißgebadet und zitternd vor Angst fiel John aus dem Bett. Er hielt sich die Hände vors Gesicht und stellte erleichtert fest, dass die grauenhaften Zahnschmerzen nur ein Albtraum gewesen waren. Doch es gab noch etwas Kurioseres an seinem Traum: Während er schlief, hatte der Spiegel an der Wand neben seinem Bett einen Sprung bekommen, der sich von der linken Ecke bis zur rechten erstreckte; und über den Spiegel hinaus verlief der Sprung bis in das Kopfteil seines Betts, sodass sogar das Holz gesprungen war. Oder vielleicht war es auch andersherum, denn auf seinem Kopfkissen befanden sich eine kleine versengte Stelle und ein Riss. Es sah fast so aus, als hätte sich der Schmerz aus seinem träumenden Gehirn in Energie umgewandelt, die sich auf die umliegenden Gegenstände in seinem Zimmer auswirkte.
Zumindest war das Johns erster Gedanke.
»Was hast du denn gemacht?«, fragte Philippa, die in der Tür stand und den Schaden betrachtete. »Hast du in der Nacht Hunger bekommen und an der Wand herumgeknabbert?«
»Sehe ich etwa aus wie ein Hamster?«, fragte John gereizt. Dennoch traute er sich kaum, seiner Schwester zu erzählen, was er sich als Erklärung für den seltsam anmutenden Sprung im Spiegel zusammengereimt hatte. Er fürchtete, sie würde ihn auslachen.
»Nein«, sagte sie. »Aber manchmal riechst du wie einer.« Sie ging zum Spiegel und fuhr vorsichtig mit der Fingerkuppe über den Sprung. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt sagen, dass es wie nach einem Erdbeben aussieht. Aber das letzte dieser Größenordnung im Bundesstaat New York war ein Erdbeben mit der Stärke 5,1 im Jahr 1983.«
»Du scheinst eine Menge darüber zu wissen«, sagte John beeindruckt.
»Ich habe vor ein paar Wochen einen Fernsehfilm darüber gesehen«, sagte sie und runzelte die Stirn. »Das hier ist merkwürdig.«
»Klar ist es merkwürdig«, sagte John, doch Philippa hatte sein Zimmer schon wieder verlassen. Mehrere Minuten lang dachte er nicht mehr an das, was sie gesagt hatte, bis sie mit einer Ausgabe der New York Times zurückkam.
»Sieh dir das an!«, rief sie aufgeregt und drückte ihm die Zeitung in die Hand.
»Die Zeitung von gestern? Was soll das?«
»In Ägypten gab es ein Erdbeben.«
»Was hat das mit dem Sprung in meinem Spiegel zu tun?«
»Schau es dir genau an«, erwiderte Philippa. Sie nahm ihm die Zeitung wieder ab und drückte sie an den Spiegel. Auf dem Foto der Titelseite war ein Riss in der Wand des weltberühmten Ägyptischen Museums von Kairo abgebildet. Es hing nun direkt neben dem Sprung in Johns Wandspiegel. Mit offenem Mund starrte er das Bild an: Die beiden gezackten Risse waren identisch.
»Wow«, sagte John atemlos. »Das ist ja cool!«
Wieder runzelte Philippa die Stirn. »Das hast du mit Absicht gemacht. Um mich zu schocken.«
»Das habe ich nicht«, beharrte John. »Ehrlich. Ich schwöre es dir: Als ich aufgewacht bin, war er plötzlich da.«
»Was ist passiert?«
»Das klingt jetzt sicher bescheuert, aber ich habe geträumt, ich hätte fürchterliche Zahnschmerzen. Das Seltsame daran ist, dass es fast so aussieht, als würde der Riss genau an der Stelle auf meinem Kopfkissen beginnen, wo meine Wange lag.«
Statt sich über ihn lustig zu machen, untersuchte Philippa das Kopfkissen. »Warum habe ich das dann nicht auch geträumt?«, wollte sie wissen. »Schließlich haben wir doch oft die gleichen Träume.«
»Das habe ich mich auch schon gefragt«, gab John zu. »Vermutlich liegt es daran, dass ich mehr Angst vor dem Zahnarzt habe als du.«
Philippa nickte. Es stimmte. »Aber das erklärt noch nicht die Ähnlichkeit zwischen dem Riss in deiner Wand und dem Riss an der Wand des Museums von Kairo.«
Als sie ein paar Stunden später die vierundzwanzig Stockwerke hinauf in die Praxis von Dr. Maurice Larr auf der Third Avenue stiegen, diskutierten sie immer noch den Riss in der Wand.
Die Zwillinge trafen ihre Mutter, die den Aufzug genommen hatte, im Wartezimmer, wo Dr. Larr sich mit ihr nicht über Zahnmedizin, sondern über Tennis unterhielt, was beide sehr gern spielten.
Dr. Larr warf einen Blick über seinen Brillenrand und zwinkerte den Kindern zu. »Sie hat mich glatt in den Boden gestampft«, sagte er und beschrieb das letzte gemeinsame Tennisspiel im Detail. »Richtig gedemütigt, dass ich mich vor Scham am liebsten in ein Loch verkrochen hätte. Eure Mutter hätte wirklich ein Profi werden können. Es gibt professionelle Tennisspielerinnen, die sich ihren Aufschlag wünschen würden. Und dabei noch so graziös! Schon das allein ist eine Seltenheit. Viele weibliche Tennischampions gehören doch eigentlich ins Herrenteam! Aber nicht eure Mutter. Ihr könnt stolz auf sie sein.«
Die Zwillinge nickten höflich. Sie waren längst daran gewöhnt, dass ihre Mutter für alles und jedes in den Himmel gelobt wurde. Manchmal schien es ihnen, als hätte das Schicksal ihrer Mutter eine kleine Portion Extraglück geschenkt, die sie in allem außergewöhnlich erscheinen ließ. Friseure lobten ihr wunderschönes schwarzes Haar und sagten, sie sollte Werbung für Shampoo machen. Designer lobten ihre tolle Figur und sagten, sie hätte Fotomodell werden sollen. Kosmetikerinnen lobten ihre seidenweiche, glatte Haut und sagten, sie sollte eine eigene Kosmetikserie auf den Markt bringen. Schriftsteller lobten ihren Witz und sagten, sie sollte ein Buch schreiben. Wohltätigkeitsvereine lobten ihr Geschick, Gelder für gute Zwecke zu sammeln, und sagten, sie hätte Diplomatin werden sollen. John und Philippa waren deswegen über Dr. Larrs hohe Meinung vom Tennisspiel ihrer Mutter kein bisschen überrascht.
»Ach, hör doch auf, Mo«, sagte Mrs Gaunt lachend. »Du beschämst mich ja!«
Doch die Zwillinge wussten, dass sie das Lob genoss. Wenn ihre Mutter überhaupt eine Schwäche hatte, dann war es eine für Komplimente, die sie genauso gierig verschlang wie dicke Leute Schokolade.
Dr. Larr sah die Kinder an, lächelte sein freundlichstes Lächeln und rieb sich die Hände. »Also gut, wer von euch setzt sich als Erster auf Onkel Mos Stuhl?«
»John«, sagte Mrs Gaunt. Mehr musste nicht gesagt werden. Wie ein Richter oder Polizist war sie daran gewöhnt, dass man ihr gehorchte – ohne Widerspruch.
Also nahm John auf dem Zahnarztstuhl Platz, während sich Dr. Larr Gummihandschuhe anzog. Dann stellte er sich neben John und trat mit der Zehenspitze seines befransten Slippers auf einen Knopf im Boden, sodass sich der Stuhl, der sich eher wie eine Ledercouch anfühlte, hob. John kam sich vor wie ein Freiwilliger aus dem Publikum, den ein Zauberer in die Höhe steigen ließ.
»Weit aufmachen«, sagte Dr. Larr und schaltete ein Licht ein, das sich auf Johns Nase warm anfühlte.
John öffnete den Mund.
»Bitte noch etwas weiter, John, danke.« Bewaffnet mit einem Spiegel, der wie ein winziger Golfschläger aussah, und einem ebenso kleinen Haken starrte Dr. Larr in Johns Mund. Er beugte sich nahe über John, bis dieser die Zahnpasta an seinem Atem und das Rasierwasser auf seiner glatten gebräunten Haut riechen konnte – dasselbe Rasierwasser wie das seines Vaters.
»Mmm-hmm«, machte Dr. Larr mit der ausdruckslosen Miene eines Mannes, der tausendmal am Tag »Mmm-hmm« machte. Doch dann sagte er plötzlich: »Oje. Oje. Was haben wir denn hier?«
Nervös klammerte John sich fester an die Armstützen.
»Oje. Was ist das? Und noch einer? Du lieber Himmel!«
Dr. Larr schob die Schutzbrille in die Stirn und streifte sich den Mundschutz ab. Dann drehte er sich zu Mrs Gaunt um. »Wie alt ist John nochmal, Layla?«
»Er ist zwölf, Mo.«
»Ach ja, richtig.« Grinsend schüttelte er den Kopf. »So was habe ich bei einem Jungen in seinem Alter noch nie gesehen. Junger Mann, du hast Weisheitszähne bekommen. Du bist der jüngste Patient mit Weisheitszähnen, den ich je gesehen habe.«
»Weisheitszähne?« Stöhnend ließ Mrs Gaunt sich auf einen Stuhl fallen. »Das ist ja eine schöne Bescherung!«
»Weisheitszähne?«, fragte John und stützte sich auf die Ellbogen. Weisheitszähne klangen nicht halb so schlimm wie Karies. »Was sind denn Weisheitszähne?«
»Sie werden Weisheitszähne genannt, weil man sie normalerweise erst dann bekommt, wenn man mindestens zehn Jahre älter ist als du. Man geht davon aus, dass man älter sein muss, um weise zu sein, auch wenn man das von so manchen Erwachsenen nicht glauben kann. Layla, das Problem ist«, fuhr der Zahnarzt fort, »dass der Kiefer des Jungen noch nicht breit genug ist, um vier neuen Zähnen Platz zu bieten. Ja, so ist es, John. Genau wie in der Apokalypse. Es sind vier. Und wenn dein Kiefer nicht groß genug für all die neuen Zähne ist, wird das deinen anderen Zähnen Probleme bereiten. Die Weisheitszähne drücken die anderen Zähne zusammen, und dann sieht dein strahlendes Lächeln schief und krumm aus. Und das wollen wir doch nicht, oder?«
»Und was heißt das?«, fragte John, obwohl er die Antwort auf die Frage schon vermutete.
»Deine Weisheitszähne müssen gezogen werden, John. Alle vier, um es genau zu sagen. Das wird ambulant gemacht werden. Du wirst eine Vollnarkose bekommen und schlafen, während wir sie ziehen.«
»Was?« John erblasste.
»Na, na, na«, sagte Dr. Larr freundlich. »Du brauchst keine Angst zu haben, junger Mann. Ich werde die Zähne selber ziehen. Du wirst gar nichts spüren. Layla? Ich kann die Operation auf übermorgen legen, wenn dir das recht ist?«
»Müssen sie denn sofort gezogen werden, Mo?«, fragte Mrs Gaunt. »Könnten wir es nicht auf später verschieben? Jetzt ist wirklich kein guter Zeitpunkt.«
»Bei einem so jungen Kiefer wie Johns rate ich, es so schnell wie möglich machen zu lassen«, sagte Dr. Larr. »Unabhängig von kosmetischen Gesichtspunkten könnten seine anderen Zähne in Mitleidenschaft gezogen werden. Außerdem riskieren wir sonst eine eitrige Entzündung.«
»Also gut, Mo«, seufzte Mrs Gaunt. »Wenn du meinst. Wenn sie rausmüssen, dann müssen sie eben raus. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es so früh passieren würde.«
»Wer rechnet schon mit so voreiligen Weisheitszähnen? In Ordnung. Du bist für heute fertig, junger Mann. Und jetzt wollen wir uns mal deine Schwester Philippa ansehen. Phil, komm her und tu so, als seist du eine Opernsängerin.«
Philippa setzte sich auf den Stuhl und riss den Mund weit auf. Sie war sicher, dass Dr. Larr in ihrem Mund nichts Interessantes finden würde. Es war typisch für John, der jüngste Patient mit Weisheitszähnen zu sein, den Dr. Larr je gesehen hatte. Immer muss er angeben, dachte Philippa und versuchte sich zu entspannen. Sie überlegte, für welchen Film sie stimmen würde, denn Mrs Gaunt ging nach einem Zahnarzttermin mit den Zwillingen immer ins Kino.
»Also, das glaube ich einfach nicht!«, sagte Dr. Larr. »Wer hätte das gedacht? Ich weiß ja, dass ihr Zwillinge seid, aber es ist wirklich unglaublich!«
Mrs Gaunt stöhnte noch einmal.
»Was ist denn?«, fragte Philippa, doch da ihr Mund voller Zahnarztfinger und Instrumente war, klang es eher wie: »Wasch – isch – gen?«
Dr. Larr, der diese einsilbige Sprache vollkommen beherrschte, nahm seine Finger und Instrumente aus ihrem Mund und schob den Mundschutz herunter. Er grinste breit. »Ich sag dir, was es ist, junge Dame. Es ist Zahngeschichte, das ist es. Du hast auch Weisheitszähne, genau wie dein Zwillingsbruder.«
»Na, wunderbar«, murmelte Mrs Gaunt in einem Ton, der John genau das Gegenteil vermittelte.
»Ha«, sagte Philippa und sah John triumphierend an, »da ich zehn Minuten jünger bin als John, scheine ich wohl die jüngste Patientin mit Weisheitszähnen zu sein und nicht dieser Streuselkuchen da.« Wenn Philippa ihren Bruder ärgern wollte, nannte sie ihn immer »Streuselkuchen«.
»Es sieht so aus«, sagte Dr. Larr und strahlte Mrs Gaunt an. »Diese Kinder sind wirklich erstaunlich.«
»Ja«, sagte Mrs Gaunt schwach. »Erstaunlich.«
»Eigentlich dürfte mich das gar nicht überraschen«, fuhr er fort und tätschelte sanft Mrs Gaunts Hand. »Wahrhaftig. Bei dieser erstaunlichen Mutter.«
Philippa runzelte über diese ungerechte Bemerkung die Stirn. Immerhin war sie die jüngste Patientin mit Weisheitszähnen, die Dr. Larr je gesehen hatte – und nun tat er so, als sei dies das Verdienst ihrer Mutter, so wie ihr Tennisaufschlag oder ihre samtige Haut.
»Was hat das zu bedeuten?«, erkundigte sich Philippa.
»Probleme«, sagte Mrs Gaunt. »Das hat es zu bedeuten.«
»Ich meine, müssen meine Weisheitszähne jetzt auch gezogen werden?«
»Ja, Philippa, es wäre sicher das Beste, wenn wir sie zur gleichen Zeit ziehen würden wie die deines Bruders. Wir werden euch in ein Krankenzimmer legen, dann fühlt ihr euch nicht einsam.« Er sah Layla an und schüttelte den Kopf. »Es ist wirklich keine große Sache, Layla.«
Bedrückt machte Layla den Termin für die Operation fest und ging dann mit den Kindern zurück nach Hause in die 77th Street. »Unter diesen Umständen«, sagte sie, »halte ich es für besser, unseren Kinobesuch zu verschieben. Ich muss eurem Vater die Nachricht überbringen. Und wir müssen noch einiges erledigen.«
»Zum Beispiel ein Bestattungsinstitut anrufen«, sagte John in der Hoffnung, es seiner Schwester für den »Streuselkuchen« heimzuzahlen und ihr ein bisschen Angst einzujagen.
»Sei nicht albern, Liebling. Dr. Larr hat Recht. Wir brauchen uns gar keine Sorgen zu machen.« Sie lächelte matt, als wollte sie sich selbst beruhigen.
»Warum sollte ich es euch verschweigen?«, fuhr sie fort. »Ich wollte es bloß nicht vor Dr. Larr sagen, weil er so begeistert war. Aber frühe Weisheitszähne sind in meiner Familie keine Seltenheit. Ich war nur wenige Jahre älter als ihr, als mir meine Weisheitszähne gezogen wurden. Und seht mich an.« Sie lächelte ihr strahlendes Zahnpastalächeln, doch ihr Lächeln war traurig und besorgt. »Ich habe perfekte Zähne.«
»Ja, aber das Krankenhaus«, stöhnte John.
»Sieh es ganz einfach so«, sagte seine Mutter. »Es ist ein Ritual, das zum Erwachsenwerden gehört. Es bedeutet, dass ihr erwachsen werdet. In eurem Fall sogar doppelt.« Sie fügte hinzu: »Ich meine, weil ihr Zwillinge seid.«
Sie seufzte und zündete sich eine Zigarette an. Die Zwillinge verzogen das Gesicht; sie konnten es nicht ausstehen, wenn ihre Mutter rauchte. Es schien ihre einzige nicht vorzeigbare Seite zu sein, vor allem in New York, wo sich die Leute mehr über das Rauchen aufregten als über Schusswaffen.
»Musst du unbedingt rauchen?«, stöhnte John.
Mrs Gaunt ignorierte die Missbilligung ihrer Kinder. »Ich mache euch einen Vorschlag«, sagte sie. »Wenn ihr tapfer seid und ohne Aufstand ins Krankenhaus geht, um euch die Weisheitszähne ziehen zu lassen, dann dürft ihr ins Sommercamp fahren. Na, was haltet ihr davon?«
»Meinst du das ernst?«
»Natürlich meine ich es ernst«, beteuerte Mrs Gaunt. »Ich möchte bloß, dass ihr beide tapfer seid. Und dass ich eure Weisheitszähne behalten darf.«
»Du willst wirklich unsere Zähne behalten?«, fragte Philippa. »Alle acht? Igitt, wie eklig! Na, viel Spaß damit.«
»Wofür brauchst du unsere Zähne?«, fragte John.
»Als Erinnerungsstücke. Ich dachte, ich lasse sie vielleicht in Gold tauchen und trage sie als Anhänger an einem Armband.«
»Cool«, meinte John. »So ungefähr wie ein Kannibale. Das leuchtet mir ein.«
»Ihr werdet viel Spaß haben«, sagte Mrs Gaunt. »Ich kenne ein tolles Ferienlager in Salem, Massachusetts, wo ihr beide …«
»Aber Mom«, protestierte Philippa. »Ich will doch nicht in dasselbe Camp wie John.«
»Und ich will auf keinen Fall mit Philippa in irgend so ein Camp in Massachusetts«, sagte John. »Ich möchte ein Überlebenstraining machen.«
»Ich kann euch versichern, dass Alembic House eines der besten Feriencamps für Jungen und Mädchen in Nordamerika ist«, sagte Mrs Gaunt. »Das Gelände hat 600 Morgen mit Wiesen, Hügeln, Bächen und Wald und einen kilometerlangen Strand. Wenn ihr nicht dorthin wollt, könnt ihr den Sommer natürlich auch mit eurem Vater und mir auf Long Island verbringen, wie jedes Jahr.«
John sah Philippa an und zuckte mit den Schultern. Alembic House klang immer noch besser als gar kein Sommercamp, und alles war besser als ein weiterer langweiliger Sommer in den Hamptons. Philippa spürte, was er dachte, und nickte.
»Nein, ich finde, Alembic House klingt gut«, sagte sie.
»Ja, klar«, stimmte John zu. »Wann geht’s los?«
»Es wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis ihr euch genügend von der Zahnoperation erholt habt, um verreisen zu können«, meinte Mrs Gaunt. »Und ich muss es natürlich noch mit eurem Vater besprechen. Ich weiß, dass er sich schon darauf gefreut hatte, mit euch ein paar Wochen zu verbringen. Aber wie wäre es mit nächster Woche?«
Man lebt nur zweimal
s war am Morgen der Operation, und die Zwillinge befanden sich im W.-C.-Fields-Memorial-Kinderkrankenhaus – einem schönen modernen Gebäude im Gramercy Park, vor dessen Eingang die große Bronzestatue eines Mannes mit freundlichem Gesicht und einer Medizinflasche in der Hand stand. Ihre Zahnoperation war auf neun Uhr morgens gelegt worden, was bedeutete, dass die Zwillinge nicht hatten frühstücken dürfen. Als Dr. Larr kurz vor acht ihr Krankenzimmer aufsuchte, um sie dem Narkosearzt Dr. Moody vorzustellen, machten Johns Hunger und Nervosität – in Abwesenheit seiner Mutter, die sich gerade im Starbucks Café am Union Square einen Kaffee holte – ihn etwas gereizt.
»Nun«, fragte er Dr. Moody, »welches Betäubungszeugs werden Sie meiner Schwester und mir denn verpassen?«
Dr. Moody, ein großer, müde wirkender Mann, der nicht daran gewöhnt war, seine Narkosemittel mit anderen zu diskutieren, schon gar nicht mit einem Zwölfjährigen, lächelte gequält. »Na ja, da du fragst – ich werde ein Narkosemittel anwenden, das Ketamin heißt. Es hat eine sehr gute Wirkung.«
John, der sich im Internet gründlich über Narkotika informiert hatte und nun glaubte, genauso viel darüber zu wissen wie jeder Arzt, runzelte die Stirn. »Aber ist das nicht ein Narkosemittel für Tiere?«
»Die Kinder von heute«, grinste Dr. Larr. »Man kann ihnen nichts mehr vormachen, nicht wahr?«
»Ich habe nicht die Absicht, jemandem etwas vorzumachen«, sagte Dr. Moody und bemühte sich angestrengt, seine Gereiztheit zu verbergen. »Hast du etwa Angst vor Ketamin, junger Mann?«
»Nein, Sir, ich habe gar keine Angst«, sagte John mit fester Stimme. »Eigentlich hatte ich sogar gehofft, dass Sie Ketamin anwenden würden.«
»Ach? Und warum?«
»Es soll das beste Mittel für eine NTE sein. Oder wenigstens für die Hauptmerkmale einer NTE.«
»Eine NTE? Ich glaube, von so etwas habe ich noch nie etwas gehört«, gab der Narkosearzt grimmig zu.
»Eine Nah-Todes-Erfahrung«, sagte John nüchtern. »Sie wissen schon, wenn man eine Operation hat und beinahe stirbt und dann durch einen dunklen Tunnel bis zu dem Licht am anderen Ende schwebt, wo man von einem Engel abgeschleppt wird.«
Dr. Larr sah, wie sich Dr. Moodys Gesicht vor Wut verfinsterte, und versuchte, den Streit im Keim zu ersticken. »Aber John«, sagte er beunruhigt. »Entspanne dich. Alles ist in bester Ordnung. Es wird ein Kinderspiel. Dr. Moody ist ein ausgezeichneter Anästhesist. Der beste in New York.«
»Klar doch«, sagte John. »Das bezweifle ich ja nicht. Ich dachte bloß, es wäre cool, mal einen Engel zu sehen. Wenn auch nur als Halluzination.«
»Über eines kannst du dir absolut sicher sein«, sagte Dr. Moody. »Keiner meiner Patienten ist je aus der Narkose aufgewacht und hat berichtet, er hätte einen Engel gesehen.«
»Warum fällt es mir nur so leicht, das zu glauben?«, murmelte John in sich hinein.
Die Tür ging auf, und Mrs Gaunt trat mit einem großen Kaffeebecher in der perfekt manikürten Hand ein.
»Wo wir gerade von Engeln reden«, sagte Dr. Larr. »Hier ist einer.«
Philippa stöhnte und wandte empört den Kopf ab. »Können wir endlich anfangen?«, fragte sie. »Ich habe schon das Frühstück verpasst. Das Mittagessen möchte ich nicht auch noch versäumen.«
An der Wand des Flurs vor ihrem Zimmer war eine Ausstellung von Bildern anderer Kinder zu sehen, die Patienten des Krankenhauses gewesen waren. Auf Zeichnungen, Postern und in Geschichten berichteten sie davon, wie die Operation für sie gewesen war. Doch keine der Geschichten und keins der Bilder der anderen Kinder gaben Philippa eine wirkliche Vorstellung davon. Vermutlich war es schwer, darüber zu schreiben. In einem Augenblick umklammerte sie die Hand ihrer Mutter und spürte etwas Kaltes, das sich in ihrem Arm ausbreitete, und im nächsten Augenblick spürte sie nichts mehr. Als hätte jemand auf einen Schalter in ihrem Kopf gedrückt und alle Sinne abgestellt.
Oder fast alle.
Aus der Unterhaltung zwischen ihrer Mutter und Dr. Moody hatte Philippa den Eindruck gewonnen, dass sie gar nichts mehr mitbekommen würde, sobald die Narkose begann. Doch als das Ketamin Wirkung zeigte, fand sie sich an einem gewundenen, verzweigten Fluss wieder, der durch eine beinahe grenzenlos große Höhle in ein Meer floss. Dies alles hätte ihr ein bisschen Angst machen können, wenn nicht merkwürdigerweise auch John dort gewesen wäre.
»Was ist das?«, fragte sie ihn. »Ist das ein Traum oder eine dieser Nah-Todes-Erfahrungen, die du vorhin erwähnt hast?«
John sah sich um. »Keine Ahnung. Aber das hier sieht kaum nach einem Tunnel aus, und ich sehe weder ein kleines weißes Licht noch einen Engel.«
Als sie das Ufer des leblos wirkenden Meeres erreicht hatten, erblickten sie einen königlichen, arabisch anmutenden Pavillon, der ungefähr fünfzehn Meter über den Wellen schwebte. Er hatte minarettähnliche Türme und Gitter und gewölbte Dächer mit winzigen rautenförmigen Fenstern, in denen sich die Sonnenstrahlen spiegelten.
John warf einen Blick auf seine Schwester und spürte ihre Beunruhigung. »Keine Angst, Schwesterherz«, sagte er. »Dir passiert nichts.«
»Das muss ein Traum sein«, sagte Philippa.
Er runzelte die Stirn. »Warum sagst du das?«
»Weil du so nett zu mir bist«, erklärte sie.
»Hör mal, wir können doch nicht beide denselben Traum haben.«
»Wer behauptet das denn? Ich habe nur einen Traum, in dem du hier bist und darauf bestehst, denselben Traum zu haben wie ich, das ist alles.«
»Wenn du es so ausdrückst, klingt es total logisch«, sagte John. »Aber wie kannst du dir so sicher sein, dass du nicht in meinem Traum bist?«
»Ich bin mir gar nicht sicher. Ich werde es erst dann wissen, wenn wir beide aus der Narkose aufwachen.«
Nach ein paar Augenblicken öffnete sich in dem Pavillon ein Fenster. Ein großer Mann mit blitzenden Augen und wehenden Haaren beugte sich hinaus und winkte ihnen zu.
»Hey, Phil, weißt du noch, was ich vorhin gesagt habe? Dass ich einem Engel begegnen möchte? Das war bloß Gerede. Ich habe Angst.«
»Ich auch.«
John nahm die Hand seiner Schwester und hielt sie fest umklammert, wodurch sie sich wieder etwas besser fühlte. Dann stellte er sich vor sie, als wollte er sie vor allem beschützen. Manchmal konnte John der beste Bruder der Welt sein.
»Steht nicht da wie angewachsen«, drängte der Mann im Fenster. »Kommt herauf.«
»Wie denn?«, rief John ihm zu. »Es gibt keine Treppe.«
»Tatsächlich?« Der Mann beugte sich noch ein Stück weiter aus dem Fenster und starrte auf das Meer unter ihm. »Du hast völlig Recht. Wir scheinen in der Luft zu schweben, statt auf den Wellen zu schwimmen. Mein Fehler. Na ja, das bringen wir in Ordnung.«
Und dann sank der königliche Pavillon mit dem geheimnisvollen Fremden darin wie ein riesiges Raumschiff, das auf einem verbotenen Planeten landet, ganz langsam nieder auf den Strand.
»Da wären wir«, rief der Mann. »Jetzt beeilt euch. Wir haben nicht viel Zeit.«
Die Zwillinge betraten Hand in Hand das Gebäude, welches voller Spiegel war, sodass jedes Zimmer einer Eishöhle glich. Von irgendwoher ertönte der Gesang einer Frau, begleitet von einem ihnen unbekannten Musikinstrument.
»Vielleicht ist es doch ein Engel«, sagte Philippa ängstlich. »Das hier ist doch eine Halluzination, oder?«
»Wenn nicht, dann hast du jetzt ein großes Problem.«
»Wieso ich?«
»Du hast gesagt, es sei dein Traum, nicht meiner. Hast du das vergessen?«
Im Zimmer vor ihnen ertönten Schritte, und dann sahen sie ihn. Er war groß und dunkel, trug einen roten Anzug und ein rotes Hemd mit roter Krawatte, und er strahlte sie an. »Na, erkennt ihr mich nicht mehr?«, fragte der Mann mit lauter, dröhnender Stimme, die wie ein Nebelhorn durch den großen Raum aus Rot und Gold hallte.
»Engel tragen kein Rot, glaube ich«, murmelte Philippa.
»Du glaubst doch nicht etwa, er ist – der Teufel?«, fragte John.
»Was sagst du da? Der Teufel?«, schnaubte der Mann entrüstet. »Wie kommst du darauf? Ich bin euer Onkel Nimrod. Aus London.« Er machte eine Pause, als würde er auf eine ungestüme Begrüßung warten. »Wir haben uns bei eurer Geburt kennen gelernt.«
»Du entschuldigst sicher, dass wir uns daran nicht mehr erinnern können«, sagte John.
»Tatsächlich?«, fragte Onkel Nimrod erstaunt.
»Aber wir haben von dir gehört«, fügte Philippa freundlich hinzu. »Wir sind bloß ein bisschen erschrocken, dich hier in unserem Traum zu sehen. Während wir operiert werden.«
»Ja, die Umstände tun mir Leid«, sagte Nimrod. »Aber das lässt sich leider nicht ändern.« Der Onkel breitete seine Arme aus. »Na, bekomme ich denn keine Umarmung oder ein Küsschen oder irgendwas?«
Und da es ein Traum war und er immerhin ihr Onkel zu sein schien, den sie verschwommen von einem Foto auf dem Schreibtisch ihrer Mutter wiedererkannten, lächelten sie tapfer und umarmten Nimrod höflich.
»Was ist das für ein Gebäude?«, fragte Philippa stirnrunzelnd.
»Gefällt es dir nicht? Es ist der königliche Pavillon aus Brighton«, erklärte Nimrod. »Von der Südküste Englands. Ich dachte, er würde in euren Traum passen. Ihr wisst doch – der Mann aus Porlock?«
Die Zwillinge sahen ihn verständnislos an.
»Coleridge? Kubla Khan ließ in Xanadu einen stattlichen Lustpavillon errichten. Sagt euch das nichts? Na ja, ist auch egal. Anscheinend lehren sie das nicht an amerikanischen Schulen.«
»Und wer singt da?«
»Das ist die abessinische Maid, begleitet von einer Schlagzither« sagte er und schüttelte verlegen den Kopf. »Sie wurde gratis mitgeliefert. Kümmert euch nicht um sie, die modernen Narkosemittel lassen uns nicht viel Zeit.« Er zeigte auf ein paar elegante antike Stühle, die um einen Kartentisch herumstanden. »Lasst uns Platz nehmen und uns unterhalten.«
Sie setzten sich, und Nimrod holte einen großen Holzbecher hervor, in den er fünf Würfel fallen ließ. »Wir können beim Unterhalten ein Spiel spielen«, sagte er freundlich.
»Was für ein Spiel?«, fragte John.
»Tesserae«, antwortete Nimrod. »Ein Würfelspiel, mein Junge. Wir würfeln beim Planen, genau wie die alten Römer. Ich fange an.« Nimrod warf die Würfel auf den Tisch, verzog das Gesicht und ließ sie in seiner Hand verschwinden, bevor John und Philippa sehen konnten, was er geworfen hatte.
»Was planen wir denn?«, wollte John wissen.
»Lass mich überlegen«, sagte Nimrod und warf einen Blick auf seine goldene Armbanduhr. »Was immer ihr wollt.« Er ließ die Würfel in den Becher fallen und gab ihn John. »Du bist dran.«
»Ich wüsste gern die Spielregeln«, sagte John.
»Es gibt bei diesem Spiel nur eine Regel«, erwiderte Nimrod, als John dreimal die Sechs würfelte. »Die wichtigste Spielregel bei jedem Spiel: Glück zu haben. Was du eindeutig hast, mein Junge.«
Philippa schob die Würfel zusammen. »Alles, was er kann«, sagte sie, während sie die Würfel in den Becher warf und auf den grünen Filz des Kartentischs rollen ließ, »kann ich noch besser.« Sie jauchzte vor Freude, als sie sah, dass sie viermal die Sechs gewürfelt hatte.
»Ausgezeichnet«, sagte Nimrod und sammelte die Würfel ein. »Jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gemeinsam schafft.« Er reichte John den Becher und legte dann Philippas Hand auf die Hand ihres Zwillingsbruders. »Macht weiter. Ich habe nicht viel Zeit.«
Die Zwillinge sahen einander an, zuckten die Schultern und würfelten … fünfmal die Sechs.
»Genau das dachte ich mir«, sagte Onkel Nimrod.
»Na, was sagst du dazu?«, jubelte John.
»Gemeinsam habt ihr noch mehr Glück als allein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das können wir nutzen.«
»Wie?«, fragte John.
»Lass mich mal die Würfel sehen«, sagte Philippa.
»Sie sind nicht präpariert«, sagte Nimrod.
»Glück gibt es nicht«, meinte Philippa verächtlich. »Jedenfalls glaubt Dad nicht daran.«
»Oh, meine Liebe, sag das nicht«, warnte Onkel Nimrod. »Die Chance, gleich fünfmal die Sechs zu werfen, beträgt 6–5 oder anders ausgedrückt 0,0001286. Ich schätze, die meisten Leute müssten die Würfel 3888-mal werfen, um auch nur eine 50-prozentige Chance zu haben, fünfmal die Sechs zu bekommen. In anderen Worten ausgedrückt: Ihr seid zwei kleine Glückspilze.«
»Das habe ich noch nie gemerkt«, sagte John.
»Mag sein. Aber ihr werdet es noch merken. Ganz sicher. Ihr müsst unbedingt Astragali spielen.«
»Was ist das?«
»Ein Spiel, das mit sieben Würfeln gespielt wird«, erklärte Nimrod. »Es wurde vor Tausenden von Jahren erfunden, um Glückszufälle zu umgehen. Wenn ihr wollt, erkläre ich euch die Regeln.«
»Ich verstehe nicht, wozu«, weigerte sich Philippa, »wenn das hier sowieso nur ein Traum ist.«
»Ach Unsinn. Die Aborigines in Australien zum Beispiel glauben daran, dass Träume genauso wichtig sind wie das reale Leben. Ziemlich oft passieren die wirklich wichtigen Dinge in Träumen.«
»Ja klar – und was hat ihnen das genützt?«, gab John zurück.
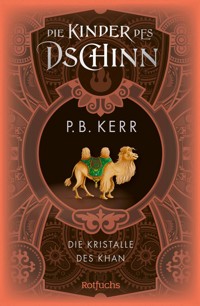
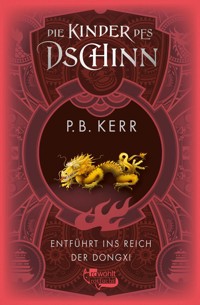
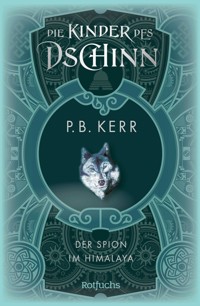
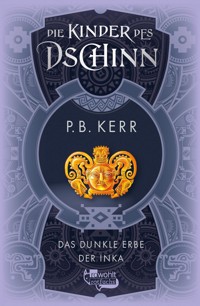
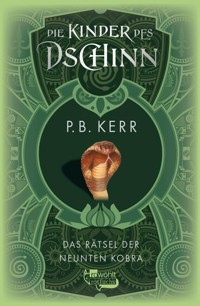
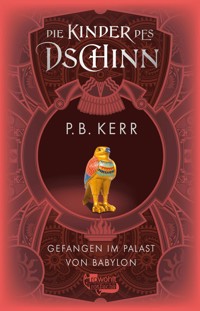













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









