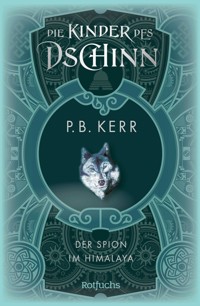
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kinder des Dschinn
- Sprache: Deutsch
John und Philippa sind ratlos: Jemand hat das irdische Gleichgewicht zwischen Glück und Unglück zerstört. Überall auf der Welt häufen sich die Unglücksfälle. Die Suche nach dem Übeltäter führt die Dschinn-Zwillinge auf die Spur einer Gruppe tibetischer Bettelmönche. Doch wer ist der Kopf der Organisation? Gemeinsam mit ihrem Onkel Nimrod und dem weisen Mr Rakshasas folgen John und Philippa den Hinweisen quer durch den Himalaya. Ziel ihrer gefährlichen Bergtour ist Shamba-La, das bedeutendste Kloster Tibets. Doch dann müssen sie feststellen: Die böse Macht weilt mitten unter ihnen! Das sechste atemberaubende Abenteuer der «Kinder des Dschinn».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
P. B. Kerr
Die Kinder des Dschinn. Der Spion im Himalaya
Über dieses Buch
John und Philippa sind ratlos: Jemand hat das irdische Gleichgewicht zwischen Glück und Unglück zerstört. Überall auf der Welt häufen sich die Unglücksfälle. Die Suche nach dem Übeltäter führt die Dschinn-Zwillinge auf die Spur einer Gruppe tibetischer Bettelmönche. Doch wer ist der Kopf der Organisation? Gemeinsam mit ihrem Onkel Nimrod und dem weisen Mr Rakshasas folgen John und Philippa den Hinweisen quer durch den Himalaya. Ziel ihrer gefährlichen Bergtour ist Shamba-La, das bedeutendste Kloster Tibets. Doch dann müssen sie feststellen: Die böse Macht weilt mitten unter ihnen!
Das sechste atemberaubende Abenteuer der «Kinder des Dschinn».
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
P. B. Kerr wurde 1956 in Edinburgh/Schottland geboren. Er studierte Jura an der Universität Birmingham und arbeitete zunächst als Werbetexter, bis er sich einen Namen als Autor, u. a. von Krimis und Thrillern für Erwachsene, machte. Viele seiner Bücher wurden internationale Bestseller, etliche mit großem Erfolg verfilmt. Für seine Arbeit wurde er u. a. zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Als freier Schriftsteller lebte der Vater von drei Kindern bis zu seinem Tod in einem Vorort von London. «Das Akhenaten-Abenteuer» war sein erstes Kinderbuch und der Start der Reihe «Die Kinder des Dschinn». Die Filmrechte daran hat sich Hollywoods Star-Regisseur Steven Spielberg gesichert.
Für Linda Shaughnessy
Taranuschi
Die Zwillinge John und Philippa verließen ihr Haus in der East 77th Street in New York und gingen zum Hotel Carlyle um die Ecke, wohin sie ihr Onkel Nimrod, der dort mit seinem Butler Groanin abgestiegen war, zum Mittagessen eingeladen hatte.
Nach dem vollständigen und unwiderruflichen Verzicht auf ihre Dschinnkräfte hatte Nimrods Schwester Layla, die Mutter der Zwillinge, ihrem Bruder hinlänglich klargemacht, dass die bloße Erwähnung von Dschinnangelegenheiten in ihrer und in Gegenwart ihres Mannes nicht länger erwünscht war. Und obwohl Nimrod strikt dagegen war, dass ein Dschinn seine beziehungsweise ihre wahre Natur verleugnete, verlangten es seine tadellosen englischen Manieren, dass er die Entscheidung seiner Schwester respektierte – jedenfalls weit genug, um ihr in einer kurzen Mitteilung genau zu erläutern, aus welchem Grund er ihre Kinder zum Mittagessen eingeladen hatte.
Da kein Einwand gegen das Essen erfolgt war, hatte Nimrod einen Tisch im protzigen Restaurant des Hotels reserviert, wo er und Groanin die Zwillinge nun empfingen.
Nach einem ausgiebigen Festmahl aus Kornischer Hummersuppe, Peeky-Toe-Krabben aus Maine, gebratener Hudson-Valley-Gänseleber (die Philippa nicht aß), Brathähnchen nach Art der Amish und Nachspeisen vom Servierwagen kam Nimrod schließlich auf das Thema zu sprechen, das er mit seiner Nichte und seinem Neffen besprechen wollte.
»Da ihr beide vor Kurzem vierzehn geworden seid«, sagte er, »ist es Zeit, dass ihr einer alten Tradition der Marid nachkommt, die Taranuschi genannt wird.«
»Warum wird sie denn so genannt?«, wollte John wissen.
»Nun«, sagte Nimrod. »Wie ihr vielleicht wisst, war Taranuschi der Name des ersten großen Dschinn. Bevor es die sechs Stämme gab, hatte er die Aufgabe, die anderen Dschinn zu kontrollieren, doch er wurde von einem bösen Dschinn namens Azazal bekämpft und geschlagen. Der Stamm der Marid pflegt die Taranuschi-Tradition, im Gedenken an seinen Sturz durch böse Dschinn.«
»Und warum wurde er bekämpft?«, fragte Philippa.
»Einfach deshalb, weil er versucht hat, den Irdischen ihr Schicksal zu erleichtern.«
Nimrod warf einen Blick auf Groanin, der gerade einen Hosenknopf öffnete, um seinem vollgestopften Bauch mehr Platz zu verschaffen. »Entschuldigen Sie, Groanin, ich habe gerade von Menschen gesprochen. Das war nicht böse gemeint.«
»Keine Ursache, Sir.«
»Also«, fuhr Nimrod fort. »Wie ich gerade sagte, hat Taranuschi versucht, den Menschen ihr Schicksal zu erleichtern, indem er hin und wieder einigen von ihnen drei Wünsche gewährte. Im Grunde genommen war er es, der die Tradition der drei Wünsche einführte.«
»Und worin besteht nun diese Tradition?«, fragte John.
»Sie besteht darin, dass sich jeder von euch an einen Ort seiner Wahl begeben und dort jemanden suchen muss, der seiner Meinung nach drei Wünsche verdient hat. Allerdings sollte sich diese Person wirklich verdient gemacht haben, denn ihr müsst euch nach eurer Rückkehr vor einem Richtergremium verantworten, dem ich angehöre, Mr Vodyannoy …«
»Aber erst, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin«, warf Groanin ein. »Erst dann, sage ich. Und nicht früher. Es ist Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal richtig Urlaub gemacht habe.«
Nimrod fuhr fort, die Namen des Taranuschi-Richtergremiums aufzuzählen. »Dann wären da noch Jenny Sacstroker und Uma Ayer, die Eremitin. Außerdem sollte das Ziel eurer Reise geheim bleiben, für den Fall, dass jemand versucht, drei Wünsche zu ergattern. Selbst ich sollte daher nicht Bescheid wissen. Auch wenn das keine große Rolle spielt, da es sich um mich handelt. So oder so seid ihr diesmal ziemlich auf euch selbst gestellt.«
»Wohin wir wollen?«, hakte John nach.
»Wohin ihr wollt«, bestätigte Nimrod.
»Vielleicht sollte ich mit Ihnen in Urlaub fahren, Groanin«, sagte John. »Es muss doch etwas geben, was ich für diese komische kleine Stadt in Yorkshire tun kann, wo Sie Ihren Urlaub verbringen. Bumby heißt sie, nicht wahr?«
»Oh nein«, sagte Groanin. »Du fährst nicht dorthin und damit basta! Bumby ist gerade richtig, so wie es ist, auch ohne dass du den Ort mit drei Wünschen auf den Kopf stellst.«
»Aber irgendwas muss ich für die Stadt doch tun können«, neckte ihn John.
»Nichts«, sagte Groanin. »Nicht das Geringste. In Bumby ist alles bestens, so wie es ist.«
»Wie Sie meinen.« John zuckte die Schultern. »Besonders kompliziert klingt die Sache jedenfalls nicht.«
»Nicht?« Groanin lachte. »Es ist ebenfalls Tradition, falls du das vergessen haben solltest, dass Dschinnfrischlinge wie du normalerweise kompletten Murks machen, wenn sie jemandem drei Wünsche gewähren. Und dass sie meist keine Ahnung haben, was am Ende dabei herauskommt. Genau deshalb will ich dich nicht mal in der Nähe von Bumby haben, junger Mann. Schon gar nicht, wenn ich dort Urlaub mache.«
»Schon gut, schon gut.« John lachte. »Ich habe doch nur Spaß gemacht.«
»Kann sein«, sagte Groanin. »Aber du weißt, was der alte Mr Rakshasas immer gesagt hat: Ein Wunsch ist wie ein Fisch. Hat man ihn erst gebraten und gegessen, kann man ihn schlecht wieder ins Wasser werfen.«
»Ja, das weiß ich«, sagte John. »Ich habe nicht vor, irgendwas von dem zu vergessen, was er gesagt hat, okay?« Er runzelte die Stirn. »Ich wünschte nur, ich wüsste, was ihm zugestoßen ist.«
Es herrschte einen Moment lang Stille, während alle Mr Rakshasas gedachten, der im Metropolitan Museum in New York wohl unwiderruflich von einem chinesischen Terrakottakrieger absorbiert worden war.
»Groanin hat ganz recht«, sagte Nimrod und kehrte zum eigentlichen Thema zurück. »Es geht nämlich nicht nur darum, dass der Empfänger die drei Wünsche verdient haben muss. Ihr müsst euch auch für das rechtfertigen, was sie mit ihren drei Wünschen anfangen. Und ich glaube, ihr wisst, dass das eine ganz andere Geschichte sein kann. Menschen sind unberechenbar. Und gierig.«
Groanin schaffte es, ein Rülpsen zu unterdrücken. »Das können Sie laut sagen«, bestätigte er, winkte den Ober herbei und bestellte sich einen zweiten Nachtisch.
»Wenn es um drei Wünsche geht, kann selbst im ehrlichsten und aufrechtesten Menschen die Gier erwachen«, fügte Nimrod hinzu.
»Jawohl. Und nicht jeder wünscht sich den Weltfrieden«, sagte Groanin. »Nein, das macht wirklich nicht jeder. Selbst wenn das in Ihrer Macht läge.«
»Was bedauerlicherweise nicht der Fall ist«, sagte Nimrod.
»Wie sollen wir herausfinden, ob jemand wirklich drei Wünsche verdient hat?«, fragte John.
»Durch Nachforschungen«, erwiderte Nimrod. »Lest Bücher und die Zeitung. Stellt fest, was in der Welt vor sich geht.«
John stöhnte. »Ich hätte mir denken können, dass es was mit Lesen zu tun hat.«
»Jedenfalls spart es Zeit, wenn man Dinge selbst herausfindet«, meinte Nimrod.
»So ist es«, stimmte Groanin ihm zu.
»Vielleicht gehe ich nach Kanada«, meinte John. »Ich wette, dort gibt es jede Menge Leute, die drei Wünsche brauchen können.« Er grinste. »Das kann man ja nachvollziehen, oder?«
»Erzähle mir nichts davon«, insistierte Nimrod. »Selbst deine Eltern sollen es nicht wissen. Es ist ein Geheimnis, schon vergessen?«
»Er hat keine Ahnung, wie man Geheimnisse für sich behält«, sagte Philippa.
»Das sagst ausgerechnet du«, beschwerte sich John. »Du bist die größte Klatschtante, die ich kenne.«
Als er sah, dass Groanin eine Zeitung in der Tasche hatte, bat John ihn, sie kurz ausleihen zu dürfen, und Groanin stimmte geistesabwesend zu. Es war eine englische Tageszeitung namens Yorkshire Post, und zu Johns Überraschung stand auf der Titelseite ein Bericht, in dem Bumby als die glückloseste Stadt der Welt bezeichnet wurde und sämtliche Gründe dafür aufgezählt wurden.
»Ich glaube, ich könnte es deutlich schlechter treffen, als nach Bumby zu gehen, wissen Sie«, sagte John. »Hier in Ihrer Zeitung steht eine Geschichte, Groanin, die mir den Eindruck macht, als wäre Bumby der perfekte Ort, um jemandem drei Wünsche zu gewähren.«
»Ach?«, sagte Nimrod. »Darf ich bitte mal sehen, John?«
Groanin verzog das Gesicht. »Du hältst dich von Bumby fern, das sage ich dir. Ich will nicht, dass du mir mit deiner Dschinnkraft den Urlaub vermurkst.«
»Ich würde schon nichts vermurksen, wie Sie das nennen«, beharrte John. »Ich will doch nur hinfahren, um zu helfen.«
»Warum fährst du nicht nach Miami zu dieser ›Kids mit Courage‹-Preisverleihung für junge Leute, die sich selbstlos oder besonders geistesgegenwärtig gezeigt haben?«, schlug Groanin vor. »Womöglich hast du viel gemeinsam mit diesen jungen Sowiesos, die sich so gern einmischen. Ich wette, da findest du jemanden, der drei Wünsche verdient hat. Oder noch besser, fahr nach Italien und versuch diesem Kerl zu helfen, den sie für den größten Unglücksraben der Welt halten. Warum hilfst du dem nicht?«
»Wo in Italien?«, fragte Philippa.
»Ich glaube, er arbeitet in Pompeji«, sagte Groanin. »Ein Kerl namens Silvio Prezzolini.«
»Das nenne ich das Schicksal herausfordern«, prustete Philippa. »Als größter Pechvogel der Welt in Pompeji zu arbeiten!«
»Warum?«
»Oh Mann! Weil Pompeji eine römische Stadt war, die von einem Vulkan zerstört wurde«, erklärte Philippa. »Und der Vulkan, der Vesuv, ist bis heute schwer aktiv.« Sie schüttelte den Kopf, als bemitleide sie ihren Bruder für seine Ignoranz.
»Das weiß ich«, sagte John.
»Du und etwas wissen?« Philippa lächelte. »Doch, du hast recht. Du verstehst tatsächlich alles, was ich verstehe. Es dauert nur ein bisschen länger.«
Philippa erwog insgeheim, nach Indien zu reisen. Zum einen glaubten die Menschen in Indien an Dschinn, und Philippa wusste aus Erfahrung, dass es wesentlich leichter war, jemandem drei Wünsche zu gewähren, wenn er oder sie so etwas überhaupt für möglich hielt. Zum anderen gab es viele Menschen in Indien, die etwas Gutes verdient hatten. Wo man auch hinkam, man sah sie fast an jeder Straßenecke. Doch je länger sie darüber nachdachte, desto mehr erschienen ihr der »Kids mit Courage«-Preis oder sogar Pompeji als attraktive Alternative. Sie war noch nie in Pompeji gewesen.
»Angenommen, du und diese anderen Richter kommen zu dem Schluss, dass die drei Wünsche nicht gerechtfertigt waren«, sagte Philippa. »Was passiert dann?«
»Gut, dass du es erwähnst«, sagte Nimrod. »Dann wird man bestraft.«
»Wie bestraft?«, fragte John.
»Was könnte schlimmer sein, als mit ihm verwandt zu sein?«, warf Philippa ein.
»Eigentlich ist es keine richtige Strafe«, sagte Nimrod.
»Was ist es dann?«, fragte John. »Nun sag schon.«
»Ihr verliert für ein Jahr eure Dschinnkraft«, sagte Nimrod.
»Was?«, erboste sich John. »Und wie funktioniert das?«
»Durch eine simple, von mir und den anderen im Gremium verhängte Dschinnfessel«, erklärte Nimrod. »Ihr müsst in der Lage sein nachzuweisen, dass ihr eure Dschinnkraft verantwortungsvoll einzusetzen wisst.«
»Ein Jahr erscheint mir ziemlich hart«, meinte Philippa.
Nimrod zuckte die Schultern. »So ist es Tradition.«
»Habt ihr, du und Mom, auch ein Taranuschi gehabt?«, wollte John wissen. »Als ihr so alt wart wie wir?«
»Allerdings«, erwiderte Nimrod. »Eure Mutter hat natürlich bestanden. Aber ich bin durchgefallen. Bei Mr Rakshasas übrigens.«
»Und du hast für ein Jahr deine Dschinnkraft verloren?« John machte große Augen.
»Das Beste, was mir je passiert ist«, sagte Nimrod. »Es hat mich … neben vielen anderen Dingen Bescheidenheit gelehrt.«
»Das muss lange her sein«, sagte Groanin.
Nimrod gab John Groanins Zeitung zurück.
»Bumby soll um diese Jahreszeit wunderschön sein«, sagte er mit Nachdruck. »Es würde mich interessieren zu sehen, was du damit anstellst. Vielleicht spinnst du Stroh zu Gold. Wir werden sehen.«
Die glückloseste Stadt der Welt
Jedes Jahr nahm Mr Groanin zwei Wochen Urlaub, und weil er vom »Ausland« nicht allzu viel hielt, wie er alles nannte, was nicht innerhalb Englands lag, fuhr er fast immer in das Seestädtchen Bumby, in der Nähe von Scarborough, im nördlichen Yorkshire. Für Nimrods Neffen John Gaunt, der trotz der lauten Einwände des Butlers beschlossen hatte, Groanin in seine alljährlichen Osterferien zu begleiten, war es schwer, die kleine Stadt in Yorkshire mit Urlaub in Verbindung zu bringen. Bumby war ein finsterer, unfreundlicher Ort. Seine Silhouette wurde beherrscht von den schwarzen Überresten der St.-Archibald-Kathedrale hoch oben auf dem Nordkliff. Unterhalb der Ruinen, auf der anderen Seite des Flusses Rost, befand sich ein Labyrinth aus dunklen Gassen und engen düsteren Straßen, die sich an dem einstmals geschäftigen, heute aber fast ausgestorbenen Kai entlangzogen. Das Fischereigewerbe, das einst zum Unterhalt der Stadt beigetragen hatte, existierte nicht mehr. Bumby kannte man heutzutage nur noch als jenen Ort, an dem Graf Dracula in einer früheren und unveröffentlichten Version von Bram Stokers berühmtem Roman auf seinem Weg zur nahe gelegenen Stadt Whitby einen kurzen Halt eingelegt hatte.
»So schlimm, dass nicht einmal Graf Dracula dableiben wollte«, beschrieben die Leute, die in Bumby lebten, ihre Stadt ebenso scherzhaft wie zutreffend. Denn wie viele Scherze enthielt auch dieser ein Körnchen Wahrheit.
John konnte Dracula verstehen. Die Stadt wirkte ganz und gar trostlos. Und der Gedanke, dass Dauerregen, grauer Himmel und der beißende Nordwind, der die Stadt permanent heimzusuchen schien, irgendetwas mit Frühling oder Urlaub zu tun haben könnten, war für den jungen Dschinn unbegreiflich und bewog ihn, dem glatzköpfigen Butler eine Frage zu stellen.
»Wenn es in Bumby so im Frühling aussieht, wie ist es dann hier im Winter?«
»Na ja, es lässt sich nicht leugnen, dass es das Wetter dieses Jahr nicht besonders gut meint«, gab Groanin zu. »Besonders gut ist das Wetter wirklich nicht. Aber an schönen Tagen geht nichts über Bumby.«
»Ich kann kaum glauben, dass die Sonne hier überhaupt mal scheint«, sagte John. »Warum verbringen Sie Ihren Urlaub an so einem lausigen Ort, Groanin?«
Sie waren gerade am Strand, saßen auf Liegestühlen und hatten sich zum Schutz gegen die steife Meeresbrise in Wolldecken und Handtücher gehüllt. John aß Eiscreme, die deutlich mehr Eis als Creme war.
»Gewohnheit«, sagte Groanin. »Ich komme immer an Ostern nach Bumby. Früher bin ich nach Harrogate gefahren. Aber das wurde mir zu teuer. Bumby ist deutlich billiger.«
»Kein Wunder«, sagte John.
»Es hat dich niemand gebeten mitzukommen, junger Mann«, erwiderte Groanin. »Deshalb wäre ich froh, wenn du deine Ansichten über Bumby für dich behältst.«
»Sie wissen, warum ich mitgekommen bin«, sagte John.
»Das tue ich«, sagte Groanin. »Und ich will dich nur noch mal daran erinnern, dass du zugestimmt hast, den Ort in Ruhe zu lassen, bis mein Urlaub so gut wie zu Ende ist. Ich will nicht, dass du mit deiner Dschinnkraft hier jetzt schon Mist baust.«
»Ich bin nicht hier, um Mist zu bauen, wie Sie das nennen«, insistierte John. »Ich bin hier, um zu helfen.«
Der junge Dschinn suchte in seinen Taschen nach dem Zeitungsartikel aus der Yorkshire Post, der ihn bewogen hatte, Groanin auf seiner Urlaubsreise zu begleiten. Als er den Schnipsel fand, faltete er ihn auseinander und strich ihn auf dem Knie glatt, was in der immer heftiger werdenden Brise nicht ganz einfach war.
»Hier«, sagte er. »Lesen Sie selbst. Die glückloseste Stadt der Welt.«
»Ich weiß, was da steht«, sagte Groanin pikiert. »Ich bin Leser der Yorkshire Post, nicht du, junger Mann.«
»Ich verstehe nicht, warum Sie so strikt dagegen sind«, sagte John. »Sie haben doch gehört, was Nimrod gesagt hat. Jetzt, wo ich vierzehn bin, muss ich für mein Taranuschi irgendwo hingehen und drei Wünsche vergeben. Das ist Tradition für einen jungen Dschinn wie mich.«
»Ich habe dir erklärt, warum«, grummelte Groanin. »Weil es bei jungen Dschinnschnöseln wie dir auch Tradition ist, die Vergabe von drei Wünschen komplett zu vermurksen.«
»Ach, kommen Sie«, sagte John. »Ich bin doch schon viel besser geworden. Ich habe Ihren Arm wieder in Ordnung gebracht, oder etwa nicht?«
Früher war Groanin ein einarmiger Butler gewesen (weil ein Tiger seinen anderen Arm gefressen hatte), bis John, seine Schwester Philippa und ihr Freund Dybbuk ihm mithilfe von Dschinnkraft zu einem neuen verholfen hatten.
»Richtig, aber dabei haben dir andere geholfen«, sagte Groanin. »Deine Schwester zum Beispiel. Und das ist ein Riesenunterschied.«
»Wollen Sie damit andeuten, dass sie besser ist als ich?«
»Das will ich nicht andeuten«, sagte Groanin. »Das ist eine Tatsache.«
»Wir sind Zwillinge, also ist das unmöglich«, meinte John. »Alles, was sie kann, kann ich auch. Das ist doch wohl logisch.«
Groanin gab einen Laut von sich, der höfliche Ablehnung signalisierte. »Und was dein Hilfsangebot für Bumby betrifft«, fügte er hinzu, »vermute ich, dass dein Onkel Nimrod nur deshalb damit einverstanden war, weil er davon ausgeht, dass es an einem Ort wie diesem nicht allzu sehr darauf ankommt, wenn die Sache schiefgeht.«
»Das stimmt nicht«, widersprach John. »Er hat einfach gedacht, wenn ich schon irgendwo hingehe und jemandem drei Wünsche gewähre, dann sollte es ein Ort sein, der ein bisschen Glück brauchen kann.«
»Ich sehe, du kennst deinen Onkel schlecht«, sagte Groanin.
»Und es gibt keinen anderen Ort«, fuhr John unbeirrt fort, »der ein bisschen Glück dringender nötig hat als Bumby.«
»Das lässt sich nicht leugnen«, gab Groanin zu. »Sie haben es hier wirklich schwer gehabt. Schwerer als schwer. Härter geht es gar nicht. Eine richtige Katastrophe.«
John überflog den ausgeschnittenen Zeitungsartikel, um sich noch einmal die Serie von Unglücksfällen in Erinnerung zu rufen, die über Bumby hereingebrochen war. »Katastrophe« war noch milde ausgedrückt.
Als Erstes war aus der nahe gelegenen Chemiefabrik versehentlich ein großes Quantum grellrosa Farbstoff in den Fluss Rost ausgetreten. Kurz darauf hatte eine ungewöhnlich hohe Springflut, gefolgt von einem vierwöchigen Dauerregen, den Fluss über die Ufer treten lassen, sodass die ganze Stadt überschwemmt wurde und alles – die Kirche, das Rathaus und sämtliche Läden und Häuser – in einem scheußlichen Rosaton eingefärbt wurde. Bumby war so rosa, dass die Stadt auf einem Satellitenbild von England aussah wie ein leuchtender Pickel auf der Schulter des Landes.
Als Nächstes waren mehrere Bewohner von Bumby ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie im indischen Restaurant der Stadt ein tödlich scharfes Curry zu sich genommen hatten. Eine Untersuchung durch das Amt für Nahrungsmittelkontrollen ergab, dass das im Restaurant angebotene Currygericht »Hühnchen Madras« eine Yorkshire-Mamba enthalten hatte – eine Chilischote, die fünfmal schärfer ist als die Dorset-Naga, die bislang den Rekord als schärfste Chilischote der Welt innehatte. (Die Yorkshire-Mamba ist so scharf, dass es verboten ist, ihre Samen zu verkaufen und außerhalb eines Labors heranzuzüchten. Warum ausgerechnet England zum Zentrum für scharfe Chilizüchtungen wurde, erkläre sich, wer will.)
Es heißt, ein Unglück komme selten allein. In Bumby aber kam es gleich dutzendweise.
Nicht lange nach dem Curry-Zwischenfall kam ein ukrainischer Zirkus in die Stadt. Am ersten, katastrophal verlaufenen Abend schaffte es der Wunderbare Wladimir, ein weltberühmter Zauberer, eine Dame wahrhaftig in zwei Teile zu zersägen, während Leonid, der Löwenbändiger, von einer hungrigen Löwin gefressen wurde.
In der Zwischenzeit entpuppte sich Bumby als Ausgangspunkt eines Computervirus – der Bumby-Bakterie –, welcher die Hälfte aller Computer in Europa infizierte, ehe man ihn zu fassen bekam und vernichtete. Dann brachte der Fremdsprachenverlag Bumby Foreign Language Press einen englischen Sprachführer in zweiundvierzig Sprachen heraus, der jede Menge Übersetzungsfehler enthielt, sodass Fremde, die beispielsweise glaubten, nach dem Weg zum Tower von London zu fragen, in Wirklichkeit darum baten, ins Gefängnis geworfen zu werden. Wo viele von ihnen auch landeten.
Und als ob all das noch nicht schlimm genug wäre, entpuppte sich die Goldmine von Bumby als das größte Desaster von allen. Nachdem man in den für ihre Tiefe berühmten Höhlen von Bumby mehrere große Klumpen aus echtem, 22-karätigem Gold entdeckt hatte, glaubte man, das Schicksal der Stadt habe sich endlich gewendet. Die Bewohner kamen zu Hunderten, um nach dem wertvollen Edelmetall zu graben und ein Vermögen zu machen. Doch weiteres Gold wurde nie gefunden. Obendrein verschwanden mehrere Goldgräber auf Nimmerwiedersehen, als einer von ihnen seine Spitzhacke in einen Felsen trieb und damit einen uralten Vulkan reaktivierte, der als längst erloschen gegolten hatte.
So viel Pech war John noch nie untergekommen. Noch während er und Groanin sich in Bumby aufhielten und das schlechte Feiertagswetter erduldeten, wurde die Stadt von einer weiteren Plage in Form einer besonders unangenehm riechenden Stinkwanze, der Nezara viridula, heimgesucht, die, wenn sie sich bedroht fühlt, einen widerlichen Geruch absondert. Damit war Bumby nicht nur die am meisten von Pech, sondern womöglich auch von Gestank verfolgte Stadt.
Wenig überraschend tummelte sich kaum einer der üblichen Touristen in der Stadt, die normalerweise während der Osterferien nach Bumby kamen. John und Groanin waren die einzigen Gäste in dem ungastlichen, grellrosa Hotel, das den unpassenden Namen Pension Oase trug.
John schnippte eine Stinkwanze von seinem Knie und steckte den Zeitungsartikel weg, ohne zu merken, dass das Insekt auf Groanins kahlem Schädel landete und auf der Stelle zu stänkern begann.
»Sind Sie sicher, dass Bumby es sich leisten kann, auf das Ende Ihres Urlaubs zu warten?«, fragte John den Butler. »Bevor ich versuche, das Glück der Stadt wiederherzustellen, meine ich.«
Groanin hob den Kopf und schnüffelte misstrauisch. »Was hast du gesagt?«
»Sind Sie sicher, dass die Stadt es sich leisten kann, so lange zu warten?«, wiederholte John. »Bei dieser Pechsträhne landet hier morgen womöglich ein Meteorit. Dann wäre Ihr Urlaub jedenfalls gelaufen.«
Groanin sah zum Himmel hinauf und fragte sich, wie die Chancen für solch ein Ereignis wohl standen. Die Kopfbewegung sorgte dafür, dass sich die Stinkwanze noch unsicherer fühlte und abermals zu stänkern begann, diesmal noch schlimmer als beim letzten Mal.
»Ja, da hast du recht«, sagte Groanin. »Ich nehme an, es ist zwecklos, die Dinge weiter aufzuschieben. Aber pass auf, was du tust. Wie hat der alte Rakshasas immer gesagt? Einen Wunsch frei zu haben, ist, wie ein Feuer anzuzünden. Man muss immer damit rechnen, dass der Rauch irgendjemanden zum Husten bringt.«
Groanin hustete. Doch daran war kein Rauch schuld, sondern der Gestank der Stinkwanze.
»Ich vermisse den Mann«, murmelte John.
»Sorge einfach dafür, dass nicht allzu viel Rauch entsteht, wenn du anfängst, Wünsche zu gewähren, will ich damit sagen«, sagte Groanin.
»Natürlich«, sagte John. »Glauben Sie, ich habe nichts dazugelernt, seit ich herausgefunden habe, dass ich ein Dschinn bin?«
Groanin schnüffelte herum und suchte nach der Ursache für den üblen Geruch. »Wie willst du die Sache angehen? Ich meine, wie willst du es anfangen? Der Stadt drei Wünsche zu gewähren und was weiß ich.«
»Ich hatte eigentlich gehofft, Sie könnten mir einen Rat geben, Mr Groanin«, gestand John. »Wie ich die Sache am besten anpacken soll.«
Groanin besann sich einen Augenblick und setzte dann seinen Hut auf, der den Gestank der Stinkwanze zumindest vorübergehend eindämmte. »Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht«, sagte er. »Und ich schätze, dass es am besten wäre, wenn wir den Bürgermeister, Mr Higginbottom, aufsuchen und die Karten einfach auf den Tisch legen. Du sagst ihm, dass du ein Dschinn bist und der Stadt drei Wünsche gewähren willst.«
»Meinen Sie nicht, dass es ihm vielleicht schwerfällt, mir das zu glauben?«, fragte John.
»Gut möglich, dass es ihm so geht«, räumte Groanin ein. »Gut möglich, dass jeder, der einen Jungspund wie dich sieht, bezweifelt, dass du dir schon aus eigener Kraft die Schuhe zubinden kannst, geschweige denn jemandem drei Wünsche gewähren. Andererseits, was hat er zu verlieren?«
Der größte Pechvogel der Welt
Durch die Pflege des Taranuschi-Brauchs sollen junge Dschinn daran erinnert werden, dass es nicht annähernd so leicht ist, einem Irdischen drei Wünsche zu erfüllen, wie es sich anhört. Und für Philippa sollte dies schon bald eine bittere Erfahrung werden.
Ihre Suche nach jemandem, der oder die drei Wünsche verdient hatte, führte sie als Erstes nach Miami zur »Kids mit Courage«-Preisverleihung für junge Leute, die Selbstlosigkeit oder große Geistesgegenwart bewiesen hatten. Auf die eine oder andere Weise hatten alle diese Kinder im Lauf ihres jungen Lebens bewiesen, dass sie Mumm besaßen. Jedenfalls behaupteten das die Organisatoren. Vielleicht waren sie tatsächlich irgendwann einmal couragierte Kinder gewesen, Philippa jedoch war dort einer Bande raffgieriger, verzogener Blagen begegnet, die nur darauf aus waren, um jeden Preis den Wettbewerb zu gewinnen. Sie kam zu dem Schluss, dass es keiner von ihnen auch nur im Mindesten verdient hatte, drei Wünsche gewährt zu bekommen.
»Fürwahr«, hatte Mr Rakshasas einmal zu ihr gesagt, »es hat keinen Zweck, einem Mann mit Löchern in den Sohlen einen Regenschirm zu geben.« So ähnlich jedenfalls.
Daher befand sich Philippa nun in Italien, in der zerstörten römischen Stadt Pompeji, um dort den größten Pechvogel der Welt aufzuspüren und ihm ein besseres Schicksal zu gewähren.
Natürlich hatte Pompeji selbst mehr als genug Pech gehabt. Im Jahr 79 war die Stadt bei einem langen und verheerenden Ausbruch des Vulkans Vesuv komplett zerstört und unter einer dicken Ascheschicht begraben worden. Zweitausend der fünfzehntausend Bewohner zählenden Stadt waren dabei ums Leben gekommen.
Groß ist Pompeji heute immer noch. Mindestens so groß wie zehn Fußballfelder und eine der beliebtesten Touristenattraktionen in ganz Italien. Außerdem sieht der Ort genauso aus wie das, was er darstellt: eine zerstörte römische Stadt. Überall gibt es gepflasterte Straßen mit tiefen Furchen von den Rädern der Fuhrwerke, große gepflasterte Plätze, die Fora genannt werden, und frei herumstehende korinthische Säulen. Über alldem thront der gewaltige Vulkan, der die Bucht von Neapel überragt, dass man den Eindruck hat, jemand hätte den Himmelsvorhang angehoben, um einen dunklen Haufen darunterzufegen.
Für Philippa war Pompeji einer der faszinierendsten Orte, an denen sie je gewesen war.
Im Gegensatz zu John reiste sie allein. Da sie bedachter und wissbegieriger war als ihr Bruder, verband sie ihr Taranuschi mit einer kleinen Besichtigungstour zu den Uffizien in Florenz, den Vatikanischen Museen in Rom und dem Archäologischen Nationalmuseum in Neapel. Sie schlenderte für ihr Leben gern durch Galerien und Museen.
Außerdem konnte sie beim Betrachten von Bildern und antiken Skulpturen in Ruhe darüber nachdenken, wie sie sich einem fremden Menschen nähern und ihn davon überzeugen konnte, dass sie wahrhaftig ein Dschinn war, um dem Mann seine Herzenswünsche zu erfüllen, ohne gleichzeitig sein Leben zu ruinieren.
Das war immer die Gefahr, wenn man jemandem drei Wünsche gewährte: dass die Leute losredeten, ohne weiter nachzudenken, wie König Midas, der sich gewünscht hatte, alles, was er anfasste, möge sich in Gold verwandeln. Zu seinem Pech erstreckte sich das auch auf alles, was er zu essen oder zu trinken versuchte, sodass Midas schon bald von heftigem Hunger und Durst geplagt wurde. Und noch schlimmer wurde es, als er es schaffte, seine einzige Tochter in eine goldene Statue zu verwandeln.
Diese Dinge gingen Philippa durch den Kopf, als sie überlegte, wie sie sich dem Mann nähern sollte, der verschiedenen italienischen Zeitschriften und Zeitungen zufolge der größte Pechvogel der Welt war: Silvio Prezzolini.
Silvio arbeitete im Souvenirladen von Pompeji, und dies seit mehr als zehn Jahren, auch wenn er gerade erst an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt war, nachdem er sich bei einem Sturz in einen Schacht beide Beine gebrochen hatte. Er war neunundvierzig und hatte sich im Laufe seines Lebens unzählige Male die Knochen gebrochen, seit er im Alter von zwei Jahren aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt und, bis dahin unverletzt, von einem neapolitanischen Pizzalieferwagen überrollt worden war.
Mit dreizehn wurde er aus einem Flugzeug der Alitalia gesaugt, bei dem die Tür abgefallen war.
Seinen sechzehnten Geburtstag feierte Silvio im Krankenhaus, nachdem er auf einem Fußballplatz vom Blitz getroffen worden war. Am Tag seiner Entlassung tobte ein heftiges Gewitter und er wurde auf dem Dach eines mehrstöckigen Parkhauses ein zweites Mal vom Blitz getroffen.
(Die Wahrscheinlichkeit, zweimal vom Blitz getroffen zu werden, liegt bei 1:500000.)
Zwischen seinem einundzwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr wurde Silvio in zweiundvierzig Autounfälle verwickelt.
Mit sechsunddreißig bekam er eine Stelle im Souvenirladen des Zoos von Rom und wurde fast augenblicklich Opfer eines heftigen Angriffs durch einen ausgebrochenen Panda namens Felix.
Etwa zu dieser Zeit kam Silvio allmählich in den Ruf, der größte Pechvogel Italiens zu sein. Das war der Grund, warum sich eine japanische Fernsehgesellschaft bereit erklärte, ihm fünfzigtausend Dollar zu zahlen, wenn sie ihn ein Jahr lang begleiten und zusehen durften, was ihm zustieß. Als das Jahr verstrich, ohne dass Silvio irgendwelches Pech ereilte, ging die Fernsehgesellschaft pleite und Silvio sah keinen Cent. Viel schlimmer war jedoch, dass der japanische Fernsehproduzent einen Selbstmordversuch unternahm, indem er mit einem Wagen über eine Klippe fuhr, in dem natürlich auch Silvio saß.
Silvio überlebte, aber mit knapper Not. Nachdem er ein Jahr im Krankenhaus gelegen hatte, nahm er einen neuen Namen an und begann, als Fremdenführer auf dem Vesuv zu arbeiten. Doch eine italienische Zeitung sorgte dafür, dass seine Identität an die faszinierte Weltöffentlichkeit gelangte, was mehrere andere Fremdenführer bewog, ihren Job aufzugeben, mit der Begründung, in Anbetracht von Silvios Glück könnte ihr eigenes bald eine Wendung zum Schlechteren nehmen. Da ein neuer Ausbruch des Vesuvs seit Langem überfällig ist – der letzte ereignete sich im Jahr 1944 und die derzeitige Ruhepause der vulkanischen Aktivität ist die längste seit fünfhundert Jahren –, war das vielleicht verständlich.
Silvio arbeitete mehrere Jahre auf dem Vesuv und fiel dabei nur ein einziges Mal in die Staubschüssel des Kraters. In der gleichen Zeit zog er sich eine ernsthafte Verbrühung durch einen heißen Dampfstrahl zu sowie eine Gehirnerschütterung in einem plötzlichen Hagelsturm; er überlebte ein Erdbeben, wurde von einem deutschen Touristenbus überfahren und wäre fast in einer Flutwelle ertrunken beziehungsweise vom Trümmerteil eines ausgefallenen russischen Satelliten erschlagen worden.
Bei seiner Arbeit im Souvenirladen von Pompeji wurde Silvio derzeit aus sicherem Abstand von einer Schar Wissenschaftler der Universität Princeton beobachtet, die sich mit Globalem Bewusstsein befassten und festzustellen versuchten, ob die Auswirkungen zufälliger oder sogenannter tragischer Unglücksfälle wissenschaftlich messbar sind.
Natürlich waren die Leute aus Princeton nicht die Einzigen, die Silvio Prezzolini beobachteten: Auch Philippa schaute ihn sich an, um zu sehen, was für ein Mensch er war. Genauso wie sie es auf der »Kids mit Courage«-Preisverleihung gemacht hatte. Schließlich bedeutete die Tatsache, dass jemand in seinem Leben jede Menge Pech gehabt hat, nicht automatisch, dass es sich von vornherein um einen guten Menschen handelt. Auch schlechten Menschen widerfährt Schlechtes.
Zu Philippas großer Erleichterung fand sie in Silvio Prezzolini einen kleinen, hinkenden Mann mit schütterem Haar und einem strahlenden Lächeln, der freundlich zu Tieren und Kindern war. Je genauer sie ihn unter die Lupe nahm, desto mehr kam sie zu der Ansicht, dass niemand drei Wünsche mehr verdiente als Silvio Prezzolini. Philippa wusste, dass er gut Englisch sprach, daher war ihr einziges Problem – und das jedes Dschinn, der einem Irdischen drei Wünsche gewähren will – die Frage, wie sie den armen Mann dazu bringen konnte, ihr Glauben zu schenken, ohne ihn zu Tode zu ängstigen und ohne dass er einen wichtigen Wunsch verschleuderte.
Eine sorgfältige Beobachtung Silvios ergab, dass er seinen Arbeitstag im Souvenirladen damit begann, sämtliche Waren sorgfältig abzustauben. Das meiste davon war Plastikschund, doch es gab auch einige ziemlich hübsche Reproduktionen römischer Überfanggläser mit Szenen aus Pompeji, die Silvio besonders aufmerksam behandelte und sorgfältig polierte.
Dies brachte Philippa auf eine Idee, wie sie sich Silvio Prezzolini als Dschinn zu erkennen geben könnte, der bereit war, ihm drei Wünsche zu gewähren. Sie kam zu dem Schluss, dass die herkömmliche, altmodische Herangehensweise in diesem Fall vielleicht die beste war. Und so transsubstantierte sie eines Morgens, ehe Silvio in den Laden kam, in einer dicken Rauchwolke und versteckte sich in einer der römischen Vasen.
Sobald Silvio anfing, die Vase zu polieren, in der Philippa steckte, nahm sie wieder ihre menschliche Gestalt an, als wäre sie gerade den Seiten von Tausendundeiner Nacht entsprungen. Bis sie jedoch alle ihre in Rauch aufgelösten Atome wieder beisammenhatte und in der Lage war, ihn anzusprechen, hatte Silvio die Vase bereits fallen gelassen und die Flucht ergriffen, sodass Philippa ihm hinterherlaufen musste.
»Das kam in Tausendundeiner Nacht aber nicht vor«, schnaufte sie, während sie ihm über das Forum nachrannte. »Wer hat je davon gehört, dass ein Dschinn jemandem nachlaufen muss, um ihm drei Wünsche zu gewähren?«
Allerdings war Silvio nicht besonders fit, sodass Philippa ihn kurz darauf einholte, als er sich im Garten der Flüchtlinge verstecken wollte. Dieser wurde so genannt, weil dort die Gipsabdrücke von dreizehn Toten zu finden sind, die den vergeblichen Versuch unternommen hatten, sich vor der Asche des Vesuvs in Sicherheit zu bringen.
»Wer bist du?«, quietschte Silvio, in eine Ecke gekauert. »Was willst du von mir?«
»Warum rennen Sie denn weg?«, fragte Philippa atemlos. »Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.«
Als Silvio sie sprechen hörte, schien er sich ein wenig zu beruhigen. »Dann kommst du also nicht aus dem Vulkan«, stellte er fest, stand auf und klopfte sich den pompejischen Staub aus den Kleidern.
»Nein«, sagte Philippa. »Wie kommen Sie denn auf die Idee?«
»Einfach deshalb, weil du aus einer dicken grauen Rauchwolke erschienen bist«, erwiderte Silvio. »Damit musst du hier in der Gegend vorsichtig sein. Die Leute könnten dich für einen lokalen Vulkanausbruch halten. Oder glauben, dass du etwas mit Vulcanus, dem römischen Gott des Feuers und der Vulkane, zu tun hast.«
»Nein, ich habe weder mit ihm noch mit Vulkanen etwas zu tun«, sagte Philippa. »Ich bin ein Dschinn. Ein Flaschengeist, könnte man sagen. Und ich bin gekommen, um Ihnen drei Wünsche zu erfüllen.«
»So wie im Märchen, meinst du?«
»Wenn Sie so wollen«, erwiderte Philippa.
Silvio musterte das Mädchen, das vor ihm stand, skeptisch. Er schätzte sie auf etwa vierzehn Jahre. Sie war nicht sehr groß, hatte rötlich blondes Haar und trug eine Brille, was sie eher klug als magisch wirken ließ. Und sie war unbestreitbar Amerikanerin, wenn auch auf angenehme Art und Weise.
»Du hast nicht viel Ähnlichkeit mit einem Dschinn«, sagte Silvio.
»Wie sollte ein Dschinn denn aussehen?«, fragte sie zurück.
»So um die neun Meter groß, mit seidenen Pluderhosen, nackter Brust, einer kleinen Weste, Turban und großem, gebogenem Schnurrbart. Unheimlich eben.«
»Wir sind heute ein wenig moderner. Glauben Sie mir.«
»Und warum ich?«, fragte Silvio.
»Warum nicht?«
»Was ich meine, ist: Ich habe nichts für dich getan. Hätte ich dich nicht wenigstens aus einer Lampe befreien müssen, in der du tausend Jahre gesteckt hast, oder so?« Er zuckte die Schultern. »Aber vielleicht habe ich das ja. In dem Fall soll es mir recht sein.«
»Das passiert tatsächlich hin und wieder«, sagte Philippa. »Aber nicht sehr oft. Und um Ihre erste Frage zu beantworten: Man muss nicht immer etwas für einen Dschinn tun, um drei Wünsche gewährt zu bekommen. In Ihrem Fall will ich Ihnen drei Wünsche erfüllen, weil vier italienische Zeitungen und zwei japanische Zeitschriften Sie zum größten Pechvogel der Welt gewählt haben.«
Silvio verzog das Gesicht. »So sehe ich mich selbst aber nicht.«
»Nicht?« Philippa klang überrascht. »Zwei Mal in einer Woche vom Blitz getroffen zu werden, hört sich für mich schon nach ungewöhnlich viel Pech an. Und das nach all den anderen Dingen, die Sie durchgemacht haben.«
Silvio schüttelte den Kopf. »Ich sehe das eher so: Ich bin immer noch da. Es stimmt zwar, dass mir einige schreckliche Dinge passiert sind, aber ich habe alles überlebt. Dafür braucht man schon ziemlich viel Glück. Im Grunde muss man sogar der größte Glückspilz der Welt sein. Und so sehe ich mich. Eher als der größte Glückspilz der Welt.« Er lächelte freundlich. »Ich finde also, dass du deine drei Wünsche nehmen und sie jemandem schenken solltest, der sie wirklich nötig hat. Aber nicht mir.«
Philippa war sprachlos. »Hören Sie, ich bin wirklich ein Dschinn«, sagte sie. »Und ich habe wirklich die Macht, Ihre Wünsche wahr werden zu lassen.«
»Oh, das glaube ich dir«, sagte Silvio. »Alles war genau so, wie ich es immer gelesen habe. Wie bei Aladin und diesen anderen Geschichten. Du bist vielleicht keine neun Meter groß und trägst keine seidenen Pluderhosen, aber du bist in einer Rauchwolke aus einer Vase aufgestiegen. Das schafft nicht jedes x-beliebige Mädchen.«
»Also wirklich«, sagte Philippa, die nicht gedacht hätte, dass es sich als so schwierig erweisen könnte, einem Menschen drei Wünsche zu gewähren. »Sind Sie sicher?«
Silvio zuckte die Schultern. »Was soll ich denn mit drei Wünschen anfangen? Nach allem, was ich gelesen habe, äußern die Leute ihre Wünsche entweder völlig unüberlegt und ruinieren sich damit das Leben, oder sie sind vor lauter Unentschlossenheit wie gelähmt, weil sie nicht wissen, was sie sich wünschen sollen. Außerdem bin ich inzwischen in einem Alter, wo mein Leben in recht geregelten Bahnen verläuft. Einfach alles haben zu können, was ich will, würde die Dinge nur verkomplizieren.« Er schüttelte den Kopf. »Es würde sie verkomplizieren und mir womöglich den Spaß verderben.«
»Den Spaß verderben?« Philippa klang überrascht. »Das würden viele Leute anders sehen.«
»Dann verstehen sie nicht, worum es im Leben geht«, sagte Silvio. »Wenn man einem Menschen alle seine Wünsche erfüllt, raubt man ihm seine Träume und Ziele. Das Leben ist aber nur lebenswert, wenn man etwas hat, nach dem man streben kann. Auf das man hinarbeiten kann. Verstehst du?«
»Sie sind ein sehr ungewöhnlicher Mann, wissen Sie das?« Philippa war wider Willen beeindruckt. »Die meisten würden alles dafür geben, dass ein Dschinn ihnen drei Wünsche erfüllt.«
»Ich habe aufgehört, mich wie die meisten Menschen zu fühlen, seit ich in dreitausend Metern Höhe aus einem Flugzeug gesaugt wurde«, erklärte Silvio.
»Ach ja«, sagte Philippa. »Wie haben Sie es nur geschafft, das zu überleben?«
»Als ich schon fast unten war, bin ich auf einen Heißluftballon geprallt«, berichtete er. »Das hat meinen Sturz gehörig gedämpft. Und als ich vom Ballon hinunterrutschte, befand ich mich direkt über einem Zirkus. Ich landete oben auf der Zirkuskuppel, was meinen Sturz noch weiter abmilderte. Dann stürzte ich durch das Zeltdach, aber wie es der Zufall wollte, fiel ich genau in dem Moment in die Manege, als ein Hochseilakt im Gange war und sie für den Mann auf dem Drahtseil ein Sicherheitsnetz gespannt hatten. Das fing mich auf.«
»Meine Güte, was für ein Glück!«, sagte Philippa.
»Ja, nicht wahr?« Silvio grinste. »Das habe ich doch gesagt. Ich bin wirklich ein richtiger Glückspilz. Willst du noch ein Beispiel? Dieser verrückte japanische Fernsehproduzent, der sich von einer Klippe gestürzt hat, als ich im Auto saß … bevor der Wagen unten aufprallte, ging er in Flammen auf, aber ich war zum Glück schon rausgesprungen. Auf dem Weg nach unten sauste ich an einigen Hochspannungsleitungen vorbei, was ebenfalls ein Glück war. Und dann stürzte ich in einen Baum. Zu meinem Glück hatte sich der Mann, der an diesem Tag die Bäume hätte zurückschneiden sollen, verspätet, sonst wären keine Äste da gewesen, um meinen Sturz aufzuhalten. Es stimmt, dass ich mir damals viele Knochen gebrochen habe. Trotzdem finde ich, dass ich Glück hatte. Sehr viel Glück. Das lässt sich nicht bestreiten.«
Philippa lächelte. »Das hatte ich auch nicht vor«, sagte sie. »Wissen Sie, es ist wirklich ein Vergnügen, jemandem zu begegnen, der nicht nach Reichtum oder Macht giert oder was auch immer. Sie haben mich gerade etwas sehr Wichtiges gelehrt. Dass nicht alle Menschen etwas haben wollen. Manche sind einfach glücklich, so wie sie sind.«
Der Jinx von Bumby
John und Mr Groanin gingen zum Rathaus, um zu sehen, ob sie in der Stadtverwaltung mit einem der Stadtoberen einen Termin vereinbaren konnten.
In der Eingangshalle hing eine Übersichtstafel, auf der die Namen sämtlicher Angestellten aufgeführt waren. Hinter einer offenen Tür befand sich ein Raum mit unbequem aussehenden Plastikstühlen, auf denen mehrere Einwohner von Bumby auf ihren Termin warteten. Sie schienen einen typischen Querschnitt der bunt gemischten Bevölkerung zu repräsentieren: eine kleine dicke Frau mit einer Einkaufstasche und einem schlimmen Hautausschlag; eine große dicke Frau mit einer Einkaufstasche und einem schlimmen Hautausschlag sowie ein kleiner Junge mit Hautausschlag, der mehr Krach machte als ein ganzer Campingplatz; außerdem zwei große, gut aussehende Männer mit sehr langen Bärten und noch längeren Haaren und eine verdächtig aussehende Gestalt mit roten Haaren, eng stehenden Augen, Raffzähnen und – für Groanin das Verdächtigste überhaupt – einer gepunkteten Fliege.
Bei seinem Anblick stieß Groanin John in die Seite und nickte dann in Richtung des Mannes mit der Fliege. »Trau nie einem Mann, der am helllichten Tag eine Fliege trägt«, flüsterte er. »Vor allem, wenn sie gepunktet ist. Es sei denn, er ist ein Zirkusclown. Und selbst dann sollte man lieber auf der Hut sein.«
»Winston Churchill hat auch eine Fliege getragen«, wandte John ein. »Was war mit ihm?«
»Das stimmt, Junge, aber das gilt auch für Karl Marx, Sigmund Freud und Frank Sinatra. Ich wette mit dir, dass dieser Kerl nichts Gutes im Schilde führt. Lass es dir gesagt sein.«
Groanin las die Namen einiger Mitarbeiter der Stadtverwaltung von der Übersichtstafel ab, während er sich zu entscheiden versuchte, wen sie aufsuchen sollten.
»Also«, sagte er. »Da wäre Mr Higginbottom, der Bürgermeister. Dann Sheryl Shoebottom, die Sekretärin des Bürgermeisters; Henry Sidebottom, der Oberstadtdirektor; Arthur Shipperbottom, der Pressesprecher, und Colin Schufflebottom, der Finanzdirektor.«
John kicherte. »Heißt denn jeder in der Stadt Sowiesobottom?«
»Damit ist nicht die Art von ›Bottom‹ gemeint, an die du denkst, du dummer Lausebengel«, sagte Groanin. »Mit dem Hintern hat dieses ›Bottom‹ nichts zu tun. Das Problem mit euch Yankees ist, dass ihr alles wörtlich nehmt, obwohl es in Wirklichkeit etwas ganz anderes bedeutet. Das kommt davon, wenn man anderen Leuten die Sprache klaut, statt seine eigene zu erfinden. ›Bottom‹ hieß ursprünglich ›Bothom‹. Das ist ein altsächsisches Wort und bedeutet ›der breite Boden eines Tals‹. In diesem Teil der Welt gibt es viele Täler. Und in denen finden sich nun mal viele Böden.«
John kicherte wieder. »Ich kann mir nicht helfen«, beharrte er. »Es kommt mir trotzdem komisch vor, dass so viele Bottoms an ein und demselben Ort leben.«
»Und das sagt ein Junge aus einem Bundesstaat mit Städten wie Cat Elbow Corner, Hicksville, Yaphank und Yonkers.«
»In New York gibt es eine Stadt, die Cat Elbow Corner heißt?«, fragte John überrascht.
»In Seneca County«, sagte Groanin. »In der Nähe von Glenora, wenn dir das weiterhilft.«
»Nö«, gab John zu.
Nach weiterem, minutenlangem Nachdenken kam Groanin zu dem Schluss, dass sie zuerst mit der Sekretärin des Bürgermeisters, Sheryl Shoebottom, reden sollten. Also gingen sie hinauf zu ihrem Büro und erkundigten sich, ob sie einen Termin bei Seiner Ehren, dem Bürgermeister, bekommen könnten.
»In welcher Angelegenheit?«, fragte Miss Shoebottom.
Sie war eine lange dünne Frau mit einem Pferdegesicht, deren Frisur und Mund aussahen, als hätte man sie in Gips gegossen.
»Der Junge hier ist ein exzentrischer Millionär«, erklärte Groanin. »Er hat Gefallen an der Stadt gefunden und will ihr etwas Gutes tun.«
Da er mit einer Lady sprach, nahm Groanin den Bowler ab. Was bedauerlich war, denn die Stinkwanze, die sich am Strand auf seinem Kopf niedergelassen hatte, hatte bei ihren verzweifelten Versuchen, aus seinem Hut zu entkommen, mehrere üble Stinkattacken losgelassen, die sich zu einer gewaltigen Stinkwolke verbunden hatten. Und diese machte sich in dem Moment bemerkbar, als Groanin den Bowler von seinem Glatzkopf nahm.
Zu Groanins und Johns Glück machte Miss Shoebottom Groanin nicht persönlich für den üblen Geruch verantwortlich. Sie wusste nur zu gut von der Stinkwanzenepidemie, die Bumby heimgesucht hatte. Daher schritt sie, sobald ihr der Geruch in die Nase stieg, mit einer Sprühflasche zur Tat, deren chemischer Inhalt gerade mal eine Winzigkeit nach Rosen duftete. Sie sprühte sogar ein wenig davon in Groanins Hut und auf seinen Kopf.
»So ist es besser«, sagte sie.
»Besten Dank«, sagte Groanin, der sich nicht sicher war, ob der chemische Rosenduft wirklich besser war als der Gestank der Stinkwanze.
»Sie sagten gerade?«, erinnerte ihn Miss Shoebottom.
»Jawohl, dass der Junge hier ein exzentrischer amerikanischer Millionär ist, der es sich in den Kopf gesetzt hat, der Stadt einen Gefallen zu erweisen. Drei Gefallen, um genau zu sein.«
Miss Shoebottom musterte John skeptisch, so wie sie vielleicht einen verwahrlosten Hund betrachten würde, der dringend ein Bad braucht. Der Junge war etwa vierzehn Jahre alt. Wahrscheinlich recht groß für sein Alter, mit dunklen Haaren und im Begriff, ein ziemlich gut aussehender Kerl zu werden, wie sie fand. Seine Kleidung war schwarz und unauffällig.
»Ach, wirklich?« Sie verzog das Gesicht. »Wo ist dann die goldene Armbanduhr?«
»Wie bitte, was?«, fragte Groanin.
Miss Shoebottom seufzte ungeduldig. »Ich meine, mein Guter, ohne Ihrem Jüngelchen hier zu nahe treten zu wollen, dass er nicht unbedingt wie ein Millionär aussieht.«
»Na, wer tut das heutzutage schon?«, erwiderte Groanin. »Ich meine, wer sieht denn heute noch wie ein Millionär aus? Um ehrlich zu sein, verwende ich den Ausdruck nur, weil ich mir ein bisschen ordinär vorkomme, hier mit dem B-Wort rumzuprotzen.«
»Mit dem B-Wort?« Miss Shoebottom runzelte die Stirn.
»Er meint ›Bottom‹«, sagte John.
»Nein, das tue ich nicht«, sagte Groanin. »Und ich wäre Ihnen dankbar, Sir, wenn Sie mir die Erklärungen überlassen würden.« Er sah Miss Shoebottom an. »Das B-Wort wie Billionär.«
»Wenn Sie mich fragen«, sagte diese, »sieht er danach auch nicht aus.«
»Ja, da würde ich Ihnen nicht widersprechen, Gnädigste«, sagte Groanin. »Aber Tatsache ist, dass der Junge die Taschen voll Schotter hat und ich die Ehre habe, sein Butler zu sein. Es liegt in meiner Verantwortung, ihm dabei zu helfen, das Geld an Leute zu bringen, die es nötig haben.«
»Wir hatten noch nie einen Jungen mit einem eigenen Butler in Bumby«, sagte Miss Shoebottom.
»Nur in Yorkshire glauben die Leute, sie hätten alles gesehen, was es zu sehen gibt, das ist wohl wahr«, stellte Groanin fest. »Und dass das, was sie nicht gesehen haben, nicht wert ist, gesehen zu werden. Hören Sie, Gnädigste: Der Junge kann dieser armen Stadt wieder auf die Beine helfen, bevor es zu spät ist.«
»Ich sage Ihnen was, mein Bester«, sagte Miss Shoebottom. »Sie lassen mir Ihre Namen und Ihre Adresse da, und ich sorge dafür, dass Seine Ehren, der Bürgermeister, Sie anruft, wenn er eine Minute Zeit hat. Einverstanden?«
Groanin nickte. »Wir wohnen in der Pension Oase«, sagte er.
»Dem Haus von Mrs Bottomley«, sagte sie. »Das kenne ich.«
John hatte alle Mühe, nicht wieder loszukichern, und verließ hastig das Büro.
»Aber warten Sie nicht zu lange, sonst zieht er mit seiner Hilfsbereitschaft womöglich weiter nach Whitby«, sagte Groanin. Er bedankte sich bei Miss Shoebottom und folgte dem Jungen in den Korridor, wo dieser damit beschäftigt war, drei Porträts früherer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen anzustarren: Mr Frederick Oakenbottom, Sir Geoffrey Longbottom und Mrs Hilda Longbottom.
»Ich will kein Wort mehr hören«, sagte Groanin.
Sie gingen hinaus auf die High Street.
»In dieser Stadt laufen einige merkwürdige Gestalten rum«, stellte John fest, als er einen Mann mit pinkfarbenem Turban entdeckte. »Wenn Sie mich fragen, sehen manche von denen ziemlich finster aus.«
»Das ist wahr«, stimmte Groanin ihm zu. »In Yorkshire sehen die Leute wirklich ziemlich finster aus. Als jemand, der aus Lancashire kommt, muss ich dir da recht geben.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte John. »Wenn Sie nicht aus Yorkshire kommen, warum fahren Sie dann im Urlaub nicht nach Lancashire?«
»Weil es kein Urlaub wäre, wenn ich nicht mal alles hinter mir lassen kann«, erklärte Groanin. »Und Urlaub in Yorkshire ist fast so gut wie Urlaub in Lancashire, ohne dass ich dafür nach Lancashire fahren muss. Wenn ich dort Urlaub machen würde, würde mir am Ende noch jemand über den Weg laufen, den ich kenne, und das wäre eine Katastrophe.«
»Warum?«
»Weil es in Lancashire jede Menge Leute gibt, die ich nie wiedersehen will, solange ich lebe. Und jetzt hör auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen, und lass uns gehen, damit wir rechtzeitig zum Abendessen zurück sind.«
Sie kehrten in ihr Zimmer in der Pension Oase zurück.
Der Name war nicht gut gewählt. John fand, dass selbst eine stillgelegte Autofabrik einer Oase ähnlicher war als diese Pension. Sie hatte nicht einmal viel Ähnlichkeit mit einer Pension, denn es gab mehr Regeln und Vorschriften als in einem Golfclub.
»Ich habe nachgedacht«, sagte John.
»Das ist mal eine Abwechslung«, sagte Groanin.
»Ich könnte unsichtbar ins Büro des Bürgermeisters zurückkehren und mir anschauen, was für ein Mensch er ist. Mir ein Bild von ihm machen, verstehen Sie? Ich will sicher sein, dass er kein Gauner ist, bevor ich ihm drei Wünsche überreiche, als wären sie eine Schachtel Pralinen.«
»Gute Idee«, sagte Groanin. Er ließ sich in einem verknautschten Sessel nieder und schüttelte eine Ausgabe des Daily Telegraph auf. »Ich lese die Zeitung, während du weg bist. Aber komm nicht zu spät. Heute Abend gibt es Bratwürstchen.«
John legte sich auf sein hartes Bett, schloss die Augen und ließ in aller Stille seinen Geist aus seinem Körper aufsteigen. Es fühlte sich immer ein wenig seltsam an, sich selbst zurückzulassen. Er schwebte einen Moment knapp unter der Decke und begutachtete den Staub und die herumhängenden Spinnweben, die Mrs Bottomley übersehen hatte, und stieß dann zu Groanin hinab, um ihm in sein haariges Ohr zu blasen.
Groanin fuhr sichtlich zusammen. »Lass das!«, rief er und wedelte sicherheitshalber noch mit der Zeitung durch die Luft.
Mit einem fröhlichen Glucksen schwebte John aus der Pension und auf die Straße hinaus.
Er benahm sich überwiegend anständig, doch da er nun mal gern Streiche spielte, konnte er es sich nicht verkneifen, auf seinem Weg durch die Stadt einem Polizisten über den speckigen Nacken zu fahren und in der Verwunschenen Teestube ein ganzes Blech Kuchen anzuheben. Es gab Momente, in denen John überzeugt war, dass es auf dieser und bis weit in die nächste Welt nichts Amüsanteres gab, als unsichtbar zu sein.
Doch als er sich dem Rathaus näherte, unterbrach er seinen Schwebeflug für einen Moment, weil er etwas Seltsames bemerkte, etwas, das er noch nie zuvor gesehen hatte – und er hatte mit seinen vierzehn Jahren schon eine ganze Menge gesehen.
Es schien eine Art kleiner weißer Affe zu sein.
Fast genauso interessant aber war die Tatsache, dass der Affe für alle außer John unsichtbar zu sein schien. Und nicht nur das. Offensichtlich konnte der Affe auch John sehen, obwohl dieser ebenfalls unsichtbar war. Und als ob all das noch nicht bemerkenswert genug gewesen wäre, stellte sich bald heraus, dass der kleine weiße, halb unsichtbare Affe ausgezeichnet Englisch sprach. Sogar besser als Groanin, hatte John den Eindruck.
»Hallo«, sagte der Affe.
»Hallo«, sagte John.
»Ich heiße Cornelius«, sagte der Affe.
»Und ich John.«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, jemanden zu sehen, der mich sehen kann«, sagte Cornelius. »Es ist Wochen her, seit ich mit jemandem gesprochen habe, der mir geantwortet hat.«
»Du kannst mich sehen?«
»Nur einen schwachen Umriss, muss ich gestehen«, sagte Cornelius. »Bist du ein Geist?«
»Äh, nein«, sagte John. »Ein Dschinn.«
»Davon habe ich schon gehört. Aber ich bin noch nie einem begegnet.«
»Bist du ein Affe?«
»Der Beschreibung würde ich zustimmen, wäre da nicht der Umstand, dass ich sprechen kann. Soweit ich weiß, sind Affen dazu nicht fähig. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir nicht ganz sicher, was ich bin. Cornelius ist bloß ein Name, den ich im hiesigen Fernsehgeschäft aufgeschnappt habe. Dort lief ein Film mit dem Titel Planet der Affen, und einer der Darsteller, eine dunklere Ausgabe von mir, hieß Cornelius.«
»Woher weißt du, wie du aussiehst, wenn du doch unsichtbar bist?«, erkundigte sich John vernünftigerweise.
»Für mich selbst bin ich nicht unsichtbar«, erwiderte Cornelius. »Und für dich anscheinend auch nicht.«
»Wie bist du nach Bumby gekommen?«
»Das weiß ich auch nicht.«
»Und warum gehst du dann nicht wieder?«
»Wo soll ich denn hin? Und welchen Sinn hat es, von irgendwo fortzugehen, wenn man sich verirrt hat? Außerdem hieß es in einer anderen Sendung, die ich gesehen habe, dass man, wenn man sich verirrt hat, am besten dort wartet, wo man ist, bis jemand kommt und einen findet. Und jetzt hat mich jemand gefunden.«
»So?« John sah sich um. »Wer denn?«
»Na du, natürlich.« Cornelius runzelte die Stirn. »Abgesehen davon ist mir alles Weitere ein Rätsel, fürchte ich.«
John überlegte einen Augenblick. »Möglicherweise kann ich dir weiterhelfen.«
»Wirklich? Wie denn?«
»Da ich ein Dschinn bin, kann ich dir vielleicht drei Wünsche erfüllen«, sagte John. »Ich sage ›vielleicht‹, weil es so ist, dass ich immer noch lerne, ein Dschinn zu sein, deshalb gelingen mir die Wünsche nicht immer hundertprozentig. Und ich sage außerdem ›vielleicht‹, weil ich bisher immer nur Irdischen drei Wünsche erfüllt habe. So nennen wir Dschinn die Menschen. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich sie einem, was immer du auch bist, gewähre. Betrachten wir dich für den Moment einfach als Affen.«
»Einverstanden. Aber was könnte ich mir wünschen, um meine Situation zu verbessern?«
»Du kannst dir wünschen, dich an etwas zu erinnern, das du vergessen hast. Deinen richtigen Namen zum Beispiel. Und daran, was du bist und wo du herkommst – wo du zu Hause bist. Solche Dinge eben.«
»Kann ich mir das wirklich alles wünschen?«
John zuckte die Schultern. »Warum nicht? Das Problem ist nur, dass ich dir keine drei Wünsche gewähren kann, solange ich in diesem transsubstantierten Zustand bin. Ich muss zuerst meinen Körper wiederholen, dann kann ich mich um dich kümmern. Andererseits kann ich dich möglicherweise nicht mehr sehen, wenn ich wieder in meinem Körper stecke. Ich bin ziemlich sicher, dass mir eine weiße Affengestalt, die durch die Stadt spaziert, schon früher aufgefallen wäre. Deshalb sollten wir uns lieber jetzt etwas überlegen, für den Fall, dass das passiert.« Er zuckte die Schultern. »Es sei denn, du hast eine Idee, wie du dich bemerkbar machen kannst.«
Cornelius schüttelte den Kopf.
»Also gut«, sagte John. »Komm mit.«
Sie kehrten zur »Oase« zurück, wo gerade das Abendessen serviert wurde. Es gab Bratwürstchen, wie Groanin versprochen hatte. Das ganze Haus roch danach. John befahl Cornelius, in der Garage zu warten, wo Mr Bottomley, der Ehemann der Pensionswirtin, sein Motorrad abgestellt hatte.
»Hör gut zu«, sagte John zu seinem neuen Freund. »Für den Fall, dass ich zurückkomme und dich nicht sehen kann, möchte ich, dass du drei Mal auf den Auspuff des Motorrads klopfst, um mir zu zeigen, dass du da bist und die drei Wünsche empfangen willst. Wollen wir das mal versuchen?«
Cornelius klopfte drei Mal auf den Auspuff, wie John es ihm gesagt hatte. Das Geräusch war unüberhörbar.
»Gut«, sagte John. »Sobald du mir durch das Klopfen angezeigt hast, dass du so weit bist, äußerst du die drei Wünsche, über die wir gesprochen haben, und ich sage mein Fokuswort – mein Wort der Macht. Damit müssten deine Wünsche in Erfüllung gehen. Klopfe wieder drei Mal, damit ich weiß, dass es geklappt hat. Dann verlasse ich meinen Körper, damit wir reden können. Alles verstanden?«
»Das hört sich kompliziert an«, meinte Cornelius. »Aber ich glaube, ich kann mir alles merken.«
John schwebte die Treppe hinauf und nahm seinen Körper wieder in Besitz. Groanin war bereits unten und wartete auf das Abendessen. John erhob sich vom Bett und rannte die Treppe hinunter, was sich in der alten Pension anhörte wie ein kleines Erdbeben.
Mrs Bottomley kam mit einem Pfannenwender in der Hand aus ihrer Küche und starrte wütend ins Treppenhaus. »Muss das sein?«, fragte sie herrisch.
»Tut mir leid«, sagte John.
»Jungs«, sagte Mrs Bottomley. »Ihr seid alle gleich. Laut und ungehobelt. Eine Katastrophe auf zwei Beinen. Wenn sie nicht gerade die Treppe runterpoltern, trampeln sie sie rauf, oder sie singen im Badezimmer oder wiehern vor Lachen, oder sie schlagen die Eingangstür zu oder wälzen sich im Bett wie ein schlafloser Bär.«
John entschuldigte sich erneut, diesmal noch nachdrücklicher.
»Entschuldigungen sind schön und gut«, stöhnte Mrs Bottomley, die für eine Tätigkeit in der Tourismusbranche von Yorkshire nicht sonderlich geeignet war. »Aber mir wäre meine Ruhe lieber. Ich wünschte, ich müsste mir nicht ständig deinen Radau anhören.«
Einen Moment lang spielte John mit dem Gedanken, Mrs Bottomleys Wunsch zu erfüllen und sie für ein oder zwei Tage ertauben zu lassen oder sie gar auf eine verlassene Insel zu schicken. Aber er war nicht grausam und besann sich schnell eines Besseren. Außerdem quoll mittlerweile eine schwarze Rauchwolke aus der Küchentür wie Qualm aus einem Vulkankrater. Was auch immer gerade auf dem Herd stand, brannte lichterloh.
»Die Würstchen!«, schrie Mrs Bottomley.
John rannte aus dem Haus, ehe sie ihn auch dafür verantwortlich machen konnte.
Schon auf den ersten Blick sah er, dass es ein Postauto geschafft hatte, auf den Blumenbeeten in Mr Bottomleys Vorgarten zu wenden, und soeben jagte der Fahrer in seinem verzweifelten Versuch, vom Unfallort zu flüchten, ehe er entdeckt wurde, den Motor dermaßen hoch, dass die Reifen tiefe Furchen in den makellosen Rasen gruben.
Doch das war nicht die einzige Katastrophe, die urplötzlich über die Pension Oase hereingebrochen war. Eine Ziegenherde hatte auf der Weide eines Bauern hinter dem Haus über den Zaun gesetzt und war gerade dabei, die Betttücher aufzufressen, die auf Mrs Bottomleys Wäscheleine hingen. Dann explodierte der Fernseher – der einzige im Haus –, was dazu führte, dass ein großes Bild von Winston Churchill, das an der Wand über der Treppe hing, herabstürzte und Mrs Bottomleys Katze bewusstlos schlug.
Inzwischen hatte sich der Küchenbrand auf die sogenannte Sonnenterrasse ausgebreitet; und als es dem Postwagenfahrer schließlich gelang, aus dem Vorgarten zu flüchten, rammte er einen Telefonmast, der umstürzte und dabei das Gewächshaus plattmachte, in dem Mr Bottomley den größten Speisekürbis von ganz Yorkshire gezüchtet hatte.
John zögerte nicht lange. »ABECEDERISCH!«, sagte er laut, denn das war sein Fokuswort, und unterband damit jegliche weiteren Katastrophen in der Pension Oase. Vor allen Dingen ging das Feuer aus.
Der wahre Schaden war jedoch bereits angerichtet.
Einen kurzen Moment lang fürchtete John, seine vorangegangene Verärgerung über Mrs Bottomleys Bemerkung, er sei eine Katastrophe auf zwei Beinen, könnte dazu geführt haben, dass er eine echte Katastrophe herbeigewünscht hatte, um ihr den Unterschied vor Augen zu führen. Da er jedoch nicht das Gefühl gehabt hatte, dass ein wenig Lebenskraft seinen Körper verlassen hätte, war er sicher, für das, was geschehen war, nicht verantwortlich zu sein. Groanin würde mit Sicherheit versuchen, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber das ließ sich nicht ändern.
Die Sorge, er könnte an der Pension Oase Vergeltung geübt haben, wich der intuitiven Erkenntnis, dass diese katastrophalen Ereignisse ebenso gut mit Cornelius zusammenhängen könnten.
John rannte zur Garage und sah das wunderschöne, auf Hochglanz polierte Motorrad mit einer gewaltigen Delle im Benzintank auf dem Boden liegen. Er blickte sich um, und als er keine Spur eines weißen Affen entdecken konnte, schüttelte er den Kopf und sagte: »Nein. Ich kann dich nicht sehen. Also klopfe drei Mal, wenn du für die drei Wünsche bereit bist.«
Dreimaliges Klopfen auf das Motorrad bestätigte, dass Cornelius weiterhin in der Garage und bereit war.
John spürte etwas dicht an seinem Ohr; dann hörte er ein winziges Stimmchen, das er als die Stimme von Cornelius wiedererkannte und das aus dem Nichts zu ihm sprach.
»Ich wünschte, ich könnte mich an meinen richtigen Namen erinnern«, sagte die Stimme. »Ich wünschte, ich wüsste genau, was ich bin, und ich wünschte, ich wüsste, woher ich komme und warum ich hier bin.«
»ABECEDERISCH«, sagte John erneut.
Er spürte, wie ihn zum zweiten Mal ein wenig Lebenskraft verließ; dann wurde Cornelius ganz langsam sichtbar, wie ein Licht, das immer heller wird, bis er mehr oder weniger feste Gestalt angenommen hatte. Allerdings war er immer noch völlig weiß, sodass er nun aussah wie ein Exemplar einer weißen Affen- oder Schimpansenart, die man als Schneeschimpansen hätte bezeichnen können, so wie weiße Leoparden Schneeleoparden genannt wurden.
»Hat es funktioniert?«, fragte John besorgt, der schnellstens aus der Garage verschwinden wollte, bevor jemand auf die Idee kam, ihm vorzuwerfen, er hätte das Motorrad umgeworfen. »He, Cornelius? Hat es funktioniert?«
»Zunächst einmal heiße ich nicht Cornelius, sondern Zagreus, und ich komme aus Griechenland. Ich bin hier, weil mich irgendwelche bösen Männer gefangen genommen und hierhergebracht haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass ich ein Jinx bin. Ja, es hat funktioniert. Vielen Dank.«
»Du bist ein was?«
»Ein Jinx.«
»Äh, und was ist ein Jinx?«
»Es ist so, John«, sagte Zagreus. »Ich war früher etwas anderes oder jemand anders. Wahrscheinlich war es ein Jemand, denn ich kann immer noch sprechen. Auf jeden Fall wurde ich, als ich starb, als Affe wiedergeboren. Nur war die Wiedergeburt nicht ganz erfolgreich. Ein Jinx ist jemand, der, wie ich, nicht richtig wiedergeboren wurde. Ich befinde mich in einer Art Zwischenstadium zwischen meinem alten Leben und meiner neuen Inkarnation, die eigentlich ein Affe sein sollte. Deshalb bin ich weiß und hin und wieder unsichtbar, und deshalb kann ich auch immer noch sprechen. Ich bin weder das eine noch das andere.«
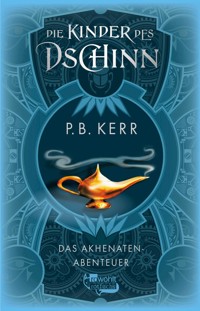
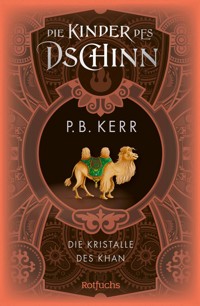
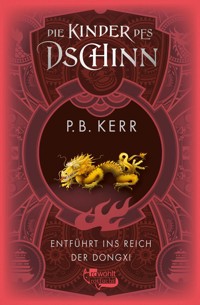
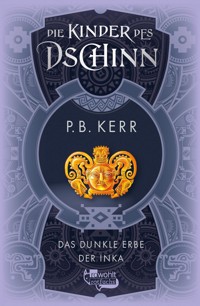
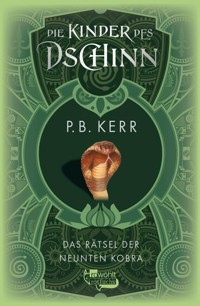
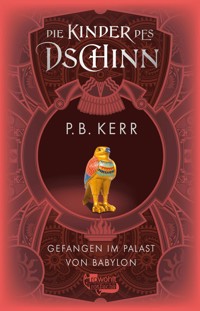













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









