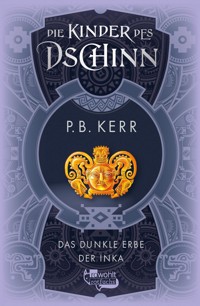
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kinder des Dschinn
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach der goldenen Stadt der Inka! Diesmal reisen John und Philippa nach Peru, um dort nach dem Auge des Urwalds zu suchen. Es soll sich dabei um das sagenumwobene Portal der goldenen Stadt der Inka handeln. Aber eine alte Dschinn-Prophezeiung berichtet von einem dunklen Vermächtnis, das mit dem Auge des Urwalds zusammenhängt. Die ganze Welt wäre vom Untergang bedroht, sollte der Forscher Macreeby seine Pläne verwirklichen und die goldene Stadt plündern. Ein abenteuerlicher Wettlauf beginnt – tief im gefährlichen Dschungel. Das fünfte Abenteuer der Bestsellerreihe «Die Kinder des Dschinn» von Philip Kerr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
P. B. Kerr
Die Kinder des Dschinn: Das dunkle Erbe der Inka
Über dieses Buch
Auf der Suche nach der goldenen Stadt der Inka!
Diesmal reisen John und Philippa nach Peru, um dort nach dem Auge des Urwalds zu suchen. Es soll sich dabei um das sagenumwobene Portal der goldenen Stadt der Inka handeln. Aber eine alte Dschinn-Prophezeiung berichtet von einem dunklen Vermächtnis, das mit dem Auge des Urwalds zusammenhängt. Die ganze Welt wäre vom Untergang bedroht, sollte der Forscher Macreeby seine Pläne verwirklichen und die goldene Stadt plündern. Ein abenteuerlicher Wettlauf beginnt – tief im gefährlichen Dschungel.
Das fünfte Abenteuer der Bestsellerreihe DIE KINDER DES DSCHINN von P. B. Kerr
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
P. B. Kerr wurde 1956 in Edinburgh/Schottland geboren. Er studierte Jura und arbeitete zunächst als Werbetexter, bis er mit Krimis und Thrillern für Erwachsene international erfolgreich wurde. Auch als Autor von Kinder- und Jugendbüchern machte er sich einen Namen. DAS DUNKLE ERBE DER INKA ist der fünfte Teil der 7-bändigen Reihe über DIE KINDER DES DSCHINN.
Dieses Buch ist für Joe Gilmour
Prolog – Doktor Kowalski
»Alle glücklichen Familien gleichen sich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich.«
Mit diesem Satz beginnt der berühmte Roman Anna Karenina des russischen Schriftstellers Leo Tolstoj. Tolstoj, der mehrere großartige Romane verfasste, interessierte sich sehr für Kinderliteratur und schrieb eine ganze Reihe von Geschichten und Fabeln für Kinder. Doch selbst die blühende Fantasie eines Tolstoj hätte wohl kaum die merkwürdige Art von Unglück erklären können, unter der die Familie Gaunt aus der East 77th Street in New York litt.
Sie waren, um es milde auszudrücken, eine sehr ungewöhnliche Familie, mit einem menschlichen Vater, Edward, einer Dschinnmutter, Layla, und den Dschinnzwillingen John und Philippa. Diese Mischung aus Dschinn (oder, weniger korrekt ausgedrückt, Flaschengeistern) und Mensch war nicht direkt der Grund für ihr Unglück, auch wenn sie natürlich damit zusammenhing. Lange Zeit war die Familie Gaunt sogar sehr glücklich gewesen und hatte in den Augen von Außenstehenden wie eine regelrechte Musterfamilie gewirkt, mit einer glamourösen Mutter, einem extrem reichen Vater und zwei wohlerzogenen, liebenswerten Kindern.
Das Einzige, was man an den Gaunts hätte kritisieren können, war die Tatsache, dass sie möglicherweise mehr besaßen, als gut für sie war. Auch wenn man zu ihrer Entschuldigung hinzufügen muss, dass eine Familie, die mindestens einen Dschinn in ihren Reihen hat und nicht stinkreich ist, kaum vorstellbar erscheint.
Nein, das Unglück der Gaunts hatte folgenden Grund: Mrs Gaunt hatte auf ihrem Rückflug vom Mittleren Osten nach New York einen schweren Unfall erlitten, bei dem ihre körperliche Gestalt restlos zerstört wurde. Für einen Menschen – oder Irdische, wie die Dschinn diese scheinbar identische, in Wirklichkeit aber völlig anders geartete Spezies zu nennen pflegen – wäre das in jedem Fall tödlich gewesen. Aber Mrs Gaunt hatte es klugerweise geschafft, ihren Geist aus ihrem verbrannten Ich hinauszukatapultieren, und war in Gestalt eines Albatros nach New York zurückgekehrt (damit hätte Tolstoj sicherlich ein Problem gehabt). Eine Verwandlung in einen Hund oder eine Katze sagte ihr ebenso wenig zu wie die Vorstellung, als Albatros weiterzuleben. Sturmvögel, wie die Albatrosse auch genannt werden, trinken Salzwasser und fressen verfaulte Fischköpfe. Und da sie diese unappetitliche Ernährungsweise leid geworden war, machte sich Mrs Gaunt alsbald auf die Suche nach einem menschlichen Körper.
Das war gar nicht so leicht, wie es klingen mag. Mrs Gaunt war ein Mitglied der Marid, eines guten Stamms der Dschinn (einem von drei guten Stämmen). Hätte sie einem schlechten Stamm angehört, wie den Ifrit (einem von drei schlechten Stämmen), hätte sie vermutlich einfach jemandem den Körper gestohlen. Nun ist es guten Dschinn zwar erlaubt, sich einen Körper auszuleihen, ihn zu stehlen hingegen ist ihnen nach den Regeln von Bagdad – dem Regelwerk, das die für alle Dschinn gültigen Verhaltensregeln enthält – strikt untersagt. Jedenfalls ist es verboten, solange ein Körper noch benutzt wird. Auch damit hätte Tolstoj sicherlich ein Problem gehabt.
Nun ergab es sich, dass die Gaunts eine treue Haushälterin namens Mrs Trump beschäftigten, die nach einem schweren Treppensturz im Krankenhaus im Koma lag. Nachdem sie Mrs Trumps Zustand erkundet hatte, kam Mrs Gaunt zu dem Schluss, dass der Körper ihrer Haushälterin zwar vollkommen einsatzfähig, der medizinische Zustand der armen Frau aber hoffnungslos war. In der Gewissheit, dass Mrs Trump mit ihrem Tun vollkommen einverstanden gewesen wäre, beschloss Mrs Gaunt, die Kontrolle über Mrs Trumps Körper zu übernehmen.
Sie hätte es schlechter treffen können, denn Mrs Trump war keine hässliche Frau. Sie war sogar eine ehemalige Schönheitskönigin, auch wenn ihr Mrs Gaunts Glamour und persönliche Ausstrahlung fehlten. Doch während es Layla Gaunt hin und wieder gelingen mochte zu vergessen, dass sie jetzt einen neuen Körper besaß, schaffte der Rest ihrer Familie das nur selten. Mr Gaunt und seine beiden Kinder hatten große Mühe, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Mrs Gaunt nun im Innern von Mrs Trump steckte.
Es heißt mitunter, dass der äußere Anschein täuschen kann. Im Falle von Mrs Trump/Gaunt traf das ganz besonders zu, was die bedauerliche Folge hatte, dass Mr Gaunt mit ihr meist nur über häusliche Angelegenheiten wie die Wäsche und die Reinigung seiner Hemden oder die Zusammensetzung des Abendessens sprach, während die Kinder sie beharrlich weiter Mrs Trump nannten statt Mutter oder Mum und sie baten, bestimmte Dinge auf den Wocheneinkaufszettel zu schreiben.
Noch schlimmer aber war vielleicht der Umstand, dass jene Freunde der Familie, die von der wahren Identität Mrs Trumps nichts ahnten oder davon, dass drei der Gaunts Dschinnkräfte besaßen, die allzu große Vertrautheit der Haushälterin gegenüber Mr Gaunt nur schwer erträglich fanden. Zum Beispiel die Art, wie sie seine Hand nahm oder ihn hin und wieder auf die Wange küsste. Dass sie tat, als sei das Haus ihr eigenes, und dass sie Mrs Gaunts Pelzmäntel trug und ihren Wagen fuhr.
Mr Gaunt behauptete beharrlich, seine Frau Layla sei fortgegangen, um in Australien als Bildhauerin Karriere zu machen. Doch aufmerksamere Freundinnen, denen nicht entgangen war, dass die Haushälterin nun Mrs Gaunts Schmuck trug, fragten sich, ob das nicht eine Lüge war. Eine oder zwei von ihnen überlegten sogar, ob man Layla Gaunt nicht um die Ecke gebracht hatte.
Die unglückliche Situation spitzte sich zu, als eines Tages ein Kriminalbeamter bei den Gaunts auftauchte. Er war groß und stark behaart, ein Bär von einem Mann, der aus dem New Yorker Stadtteil Bronx stammte und einen Walrossbart trug. Er hieß Detective Michael Wolff und hätte wirklich gut in den Zoo gepasst, nur dass es in der Bronx keinen Zoo mehr gab. Er hielt seine Polizeimarke hoch und zeigte sie der gut gekleideten Dame, die ihm die Tür öffnete und sich – jedenfalls ihm gegenüber – als Mrs Trump vorstellte, die Haushälterin der Familie Gaunt.
»Ist Mr Gaunt zu Hause?«, fragte Detective Wolff.
»Nein, er wird nicht vor heute Abend zurück sein«, sagte Mrs Trump. »Darf ich fragen, worum es geht?«
»Ich würde gern mit ihm über seine Frau sprechen«, sagte der Kriminalbeamte. »Sie wurde als vermisst gemeldet.«
»Unsinn«, sagte Mrs Trump. »Von wem denn?«
»Von einigen Freundinnen. Wissen Sie denn, wo sie ist, Mrs Trump?«
»Sie ist in Australien. Ich habe erst kürzlich mit ihr gesprochen.«
»Ich habe bei den australischen Behörden Erkundigungen eingezogen«, sagte Detective Wolff, »und dort hat man keinen Eintrag darüber, dass sie jemals das Land betreten hat.«
»Verstehe.« Widerstrebend begann Mrs Trump/Gaunt die Möglichkeit zu erwägen, ihre Dschinnkräfte einsetzen zu müssen. »Vielleicht sollten Sie lieber hereinkommen.«
Ohne etwas von der Gefahr zu ahnen, in der er nun schwebte, betrat der Kriminalbeamte den prächtigen Hauseingang und sah sich anerkennend um, während Mrs Trump die schwere schwarze Eingangstür hinter ihm schloss. »Schönes Haus«, sagte er. »Ich liebe diese großen Häuser an der Upper Eastside von New York.«
»Vielen Dank«, sagte Mrs Trump. Dann besann sie sich auf ihre Rolle und fügte hastig hinzu: »Aber schwer sauber zu halten.«
»Wie eine Putzfrau sehen Sie wirklich nicht aus, Lady«, stellte Detective Wolff fest. »Bei allem Respekt, M’am, aber ich habe noch nie eine Putzfrau gesehen, die solchen Schmuck trägt wie Sie und so ein Kleid. Und ich weiß, wovon ich rede. Meine Frau ist selber Putzfrau.«
Normalerweise verwandelte Mrs Gaunt Menschen, die für sie oder ihre Familie eine Bedrohung darstellten, in Tiere. Aber Detective Wolff hätte sie nur ungern in einen Wolf verwandelt. Ein Wolf auf den Straßen von New York konnte leicht von einem anderen Polizisten erschossen werden, um zu verhindern, dass er jemanden angriff. Es war ein Glück für den Kriminalbeamten, dass sie erst nach einem passenderen Tier suchte, in das sie ihn verwandeln konnte.
»Es ist allgemein bekannt, dass ich vor ein paar Jahren den Lotto-Jackpot von New York geknackt habe«, erklärte Mrs Trump/Gaunt.
Das stimmte. Lange Zeit hatte sich Mrs Trump nichts sehnlicher gewünscht, als im Lotto zu gewinnen, und dank Philippa wurde ihr dieser Wunsch erfüllt.
»Wie viel haben Sie denn gewonnen?«
»Dreiunddreißig Millionen Dollar.«
Detective Wolff pfiff durch die Zähne. »Und trotzdem arbeiten Sie weiter als Haushälterin?«
Ein Papagei vielleicht, überlegte sie. Er hat gepfiffen wie ein Papagei.
»Ich mag diese Familie«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Sie steht mir so nah wie meine eigene. Ich wollte nicht, dass das Geld mein Leben verändert. Sie wissen doch, wie das ist.«
»Na, das erklärt natürlich einiges«, sagte der Beamte. »Zum Beispiel, warum Sie so gut angezogen sind.«
Mrs Trump/Gaunt begann sich ein wenig zu entspannen: Vielleicht konnte sie sich doch noch aus der Sache herausreden.
»Das hoffe ich. Und danke für das Kompliment, Detective Wolff.«
»Nur erklärt das immer noch nicht, wo Mrs Gaunt ist.«
»Wie ich schon sagte, Detective Wolff, ich habe erst gestern mit ihr gesprochen. Sie hat hier angerufen. Aber ich habe keine Ahnung, von wo aus sie gesprochen hat, wenn es nicht aus Australien war.« Sie machte eine Pause, in der sie eine für ihre eigene Zukunft wichtige Entscheidung traf. »Jedenfalls …«
»Ja?«
»Jedenfalls hat sie mir erzählt, dass sie nach New York zurückkommt. Ende des Monats.«
»So, hat sie das?« Der Kriminalbeamte holte seine Geldbörse heraus und entnahm ihr eine Visitenkarte, die er Mrs Trump überreichte. »Würden Sie sie bitten, mich anzurufen, sobald sie wieder zu Hause ist?«
»Mit Vergnügen, Detective«, sagte Mrs Trump/Gaunt und brachte ihn zur Tür, ziemlich erleichtert darüber, dass er das Haus auf zwei und nicht auf vier Beinen verließ.
Nach dem Abendessen erklärte Mrs Trump/Gaunt, dass sie etwas Wichtiges zu sagen habe. »Ich habe beschlossen, für einige Wochen zu verreisen«, sagte sie.
»Wo wollen Sie hin, Mrs Trump?«, fragte Mr Gaunt. »Äh, wo willst du denn hin, Liebes, wollte ich sagen.«
»Nach Brasilien.«
»Und aus welchem Grund, Mrs Trump – ich meine, Mutter?«, fragte John.
»Um mich einem Eingriff zu unterziehen«, erwiderte diese. »Einem chirurgischen Eingriff.«
»Bist du denn krank?«, fragte John.
»In gewisser Weise schon, denke ich«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Aber nicht so, wie du denkst, mein Liebling. Man könnte sagen, dass es mich krank macht, dass alle ständig vergessen, wer ich wirklich bin. Es macht mich krank, dass die Leute vergessen, dass ich nur äußerlich Mrs Trump, aber im Innern immer noch Layla Gaunt bin.«
»Das tut mir leid, Liebes«, sagte Mr Gaunt. Auch wenn Mrs Trump/Gaunt der Frau, die er geheiratet hatte, kein bisschen ähnlich sah, war nicht zu übersehen, dass sie verletzt war. Deshalb stand er auf, ging zu ihr und küsste Mrs Trump/Gaunt auf die Stirn. Doch es war kein zärtlicher Kuss. Es fiel ihm schwer, eine Frau, die aussah wie seine frühere Haushälterin, sonderlich zärtlich zu behandeln, auch wenn sie die Kleider seiner Frau trug. Genau aus diesem Grund gab er ihr sicherheitshalber noch zwei weitere Küsse auf die Stirn. Zum Glück saß Mrs Trump/Gaunt gerade, die ihn, genau wie früher Mrs Gaunt, um eine ganze Haupteslänge überragte. »Ich versuche mir immer wieder klarzumachen, dass du in Mrs Trumps Körper steckst. Aber manchmal vergesse ich es einfach. Das ist alles. Im Gegensatz zu dir bin ich eben auch nur ein Mensch.«
»Oh, das ist ganz allein meine Schuld«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Mir hätte klar sein müssen, dass das alles deutlich schwieriger sein würde, als ich es mir vorgestellt hatte. Im Übrigen ist es gerade noch ein wenig schwieriger geworden, glaube ich. Heute ist nämlich ein Kriminalbeamter aufgetaucht.«
»Ein Kriminalbeamter?«, fragte John gespannt. »Hat es einen Mord gegeben?«
»Nein, aber die Polizei glaubt, dass es möglicherweise einen gegeben hat. Offensichtlich hat mich – und damit meine ich mich, Layla Gaunt – jemand als vermisst gemeldet.«
»Ach«, sagte Mr Gaunt. »Ich hatte mich schon gefragt, wann etwas in der Art passieren würde. Das war nicht anders zu erwarten.« Er nickte. »Was hast du ihm gesagt, Liebes?«
»Ich habe ihm erzählt, dass ich – und mit ›ich‹ meine ich Layla Gaunt – Ende des Monats aus Australien zurückkomme. Was natürlich beweisen würde, dass ich noch am Leben bin. Und einer peinlichen offiziellen Untersuchung zuvorkäme.«
»Wie willst du das machen?«, fragte Philippa. »Dein Körper wurde doch zerstört, als du auf dem Rückweg von Bagdad über diesen hawaiianischen Vulkan geflogen bist. Du hast gesagt, er wäre durch die Hitze eines pyroklastischen Stroms zu Asche verbrannt.«
»Das ist völlig richtig, mein Schatz. Ich hatte großes Glück, dass mein Geist lebend davongekommen ist. Nein, ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass mein Äußeres einen gewissen Feinschliff benötigt. Deshalb fahre ich nach Brasilien. Das Land gilt als das Zentrum der kosmetischen und plastischen Chirurgie. Dort gibt es einen Arzt, Doktor Stanley Kowalski, den besten plastischen Chirurgen der Welt. Eine ganze Reihe Filmstars, die ich kenne, haben mir erzählt, dass er wahre Wunder vollbringt. Und da ich zufällig weiß, dass Kowalski auch ein Dschinn ist, bin ich sicher, dass sein Ruf gerechtfertigt ist. Ich habe vor, mir von ihm genau das Aussehen zurückgeben zu lassen, das ich vor dem Unfall besessen habe.«
»Wie lange werden Sie weg sein, Mrs …?«, fragte Mr Gaunt.
Mrs Trump/Gaunt lächelte geduldig. »Ein paar Wochen. Vielleicht auch länger. So lange, wie es braucht, denke ich.«
»Können wir mitkommen?«, fragte John. »Ich war noch nie in Brasilien.«
»Lieber nicht, mein Schatz«, sagte die Frau, die seine Mutter war. »Außerdem möchte ich, dass ihr beide euch hier um euren Vater kümmert.«
»Aber ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert«, widersprach Mr Gaunt. »Ich bin wieder völlig gesund, wie du sehen kannst. Ich bin wieder ganz ich selbst.«
Damit meinte er, dass er sich vollständig von der Methusalem-Fessel erholt hatte, mit der Layla Gaunt ihren Mann belegt und die dazu geführt hatte, dass er rapide gealtert war. Eine Zeit lang hatte Mr Gaunt ausgesehen, als wäre er zweihundert Jahre alt. Aber nun war er wieder ganz der Alte: ein kleiner, adretter, grauhaariger Mann von zweiundfünfzig Jahren, was an sich schon alt genug ist.
»Wenigstens kann einer von uns beiden das von sich behaupten«, sagte Mrs Trump/Gaunt seufzend. »Ich jedenfalls bin mir nicht ganz sicher, wer ich bin. Nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich versucht, mich selbst zu fragen, ob noch saubere Handtücher da sind. Oder mich zu bitten, die Fensterputzer zu bestellen, oder in den Laden zu gehen und Kaffee zu kaufen. Ihr seid nicht die Einzigen, die bei meinem Anblick Mrs Trump sehen. Mir geht es genauso.«
»Kannst du das denn nicht mit Dschinnkraft beheben?«, fragte Philippa. »Ich meine, dein Äußeres verändern?«
»Zu riskant«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Sich selbst in Rauch aufzulösen ist eine Sache. Aber die eigene Gesichtsform zu verändern ist etwas ganz anderes. Dschinn, die versucht haben, sich ein schöneres Aussehen zu geben, sind schon die schrecklichsten Dinge widerfahren, das könnt ihr mir glauben. Ein Mädchen aus meiner Schule hat zum Beispiel versucht, ihre Nase zu verkleinern. Am Ende hatte sie überhaupt keine Nase mehr. Und ein Freund von Nimrod hatte Segelohren, die abstanden wie die Griffe eines Pokals. Er hat versucht, sie mit Dschinnkraft wieder anzulegen, und es geschafft, dass sie schließlich am Hinterkopf zusammenklebten. Schrecklich! Am Ende musste er zu einem Schönheitschirurgen. Und dann ist da euer Vater. Seht ihn euch an. Glaubt ihr nicht, dass ich ihn ein wenig größer gemacht hätte, wenn ich es könnte? Diese Dinge lassen sich nicht kontrollieren. Man will jemanden ein paar Zentimeter größer machen und am Ende wird es der größte Mensch der Welt.«
Mr Gaunt sah seine Kinder an und nickte. »Das stimmt. Wir haben irgendwann darüber gesprochen und die Idee verworfen. Wusstet ihr, dass einige dieser Burschen im Profibasketball früher kleine Kerle waren, denen irgendwann drei Wünsche gewährt wurden?«
»Wundert mich nicht«, sagte John. »Und was ist daran auszusetzen?«
»Gar nichts«, sagte Mr Gaunt. »Wenn man im Leben nichts anderes vorhat, als Basketball zu spielen. Ich meine, was kann man sonst tun, wenn man zwei Meter groß ist?«
»Hört mal, ich dachte, ihr würdet euch freuen«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Aber egal, ob ihr euch freut oder nicht, ich werde es tun. Ich will mich einfach wieder wohlfühlen in meiner Haut.«
»Wann fährst du?«, fragte Mr Gaunt.
»Ich habe bereits mit Doktor Kowalski telefoniert. Er hat für übermorgen die erste Behandlung vorgesehen. Was bedeutet, dass ich heute Abend nach Rio fliegen werde. Per Wirbelsturm.«
Sie begleiteten sie auf das Dach des New Yorker Guggenheim-Museums, um sie dort zu verabschieden.
Dschinn reisen seit Jahrhunderten am liebsten per Wirbelsturm und nicht mit fliegenden Teppichen. Wirbelstürme sind nicht nur ebenso schnell wie jedes Flugzeug – wenn nicht sogar schneller –, sie sind auch wesentlich umweltfreundlicher, da sie aus nichts als einem warmen Luftstrom erzeugt werden.
Schon seit ihrer Kindheit nutzten Layla Gaunt und ihr Bruder Nimrod das Dach des Guggenheim-Museums, um dort kleine Wirbelstürme zu entfachen. Irgendetwas an der schneckenhausähnlichen Spirale des berühmten Gebäudes von Frank Lloyd Wright erleichterte es, einen guten Wirbelsturm zu entfesseln. Es war ganz einfach. Man wartete auf eine kleine Windböe, die über den Boden fuhr, und formte sie zu einem Trichter. Sobald das Trichterende vom Boden abhob, glitt man in den Höhenwind hinauf und flog von dort aus in der gewünschten Himmelsrichtung davon. Der Trick dabei war, möglichst schnell vom Boden abzuheben, damit an den umliegenden Gebäuden kein Schaden entstand.
Dieses Mal aber musste Layla zu ihrem Entsetzen feststellen, dass sie nicht in der Lage war, den Wind zu kontrollieren. Das lag keineswegs daran, dass ihre Dschinnkräfte im Körper von Mrs Trump schwächer geworden wären, sondern an der simplen Tatsache, dass sich zu viel warmer, stürmischer Wind in der Atmosphäre befand.
»Ich verstehe das nicht«, schrie sie gegen den Wind an. »Eine kleine Böe dürfte eigentlich nicht so schnell an Kraft gewinnen. Nicht hier in New York.«
Sie versuchte den Wind festzuhalten, doch als der wirbelnde Trichter im Nu fast 500 Stundenkilometer erreichte, war sie gezwungen, ihn loszulassen. Der Wind fegte in westlicher Richtung davon, über den Central Park hinweg, wo er Bäume entwurzelte, Bänke umwarf und in der örtlichen Wettermessstation für Rekordwerte sorgte, von denen am nächsten Tag sämtliche Zeitungen berichteten. Es war der stärkste Wind, den New York seit dem 22. Februar 1912 erlebt hatte, als ein Sturm fünf Minuten lang mit einhundertfünfzig Stundenkilometern durch die Stadt gefegt war. Dieser Wind, der mehr als dreimal so stark war, dauerte nur zwei Minuten an, ehe er – zum Glück für die Stadt – in das Starkwindband im Bereich der oberen Troposphäre aufstieg und verschwand.
»Das ist mir noch nie passiert«, sagte Layla. »Ich verstehe das nicht. Es sei denn –« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das kann nicht sein. So schnell bestimmt nicht.«
»Was meinst du damit, Mutter?«, fragte Philippa.
»Nur, dass einige Dschinn vermutet haben, die globale Erwärmung könnte irgendwann dazu führen, dass wir keine eigenen Wirbelstürme mehr entfachen und kontrollieren können.« Sie schüttelte immer noch den Kopf. »Aber bis dahin sollten noch Jahre vergehen.«
»Es gibt heute mehr Tornados als früher«, sagte Philippa. »Das könnte etwas damit zu tun haben.«
»Ja, da hast du recht, mein Schatz. Es sind wirklich mehr geworden.«
»Warum versuchst du es nicht noch mal?«, schlug John vor.
»Das würde ich nicht wagen«, gestand Mrs Trump/Gaunt. »Zumindest nicht in einer so dicht bebauten Gegend, wo der Wind Schaden anrichten könnte.« Sie schüttelte wieder den Kopf. »Du liebe Zeit, ich fürchte, ich muss ein Flugzeug nehmen wie alle anderen auch.«
Und das tat sie. Allerdings nicht, ehe sie ihren Bruder Nimrod in London angerufen und ihm erzählt hatte, was geschehen war, nur um zu hören, dass er vor Kurzem das gleiche Problem gehabt hatte.
»Ich war gerade im Begriff, nach Amerika zu fliegen, als mir das Gleiche passiert ist«, sagte er. »Ich will das Wochenende in Frank Vodyannoys Haus in New Haven verbringen. Er veranstaltet dort ein kleines Dschinnverso-Turnier. Aber jetzt werde ich mit einem ganz normalen Flugzeug kommen müssen.«
»Aber woran liegt das nur?«, fragte seine Schwester. »Ist es der Klimawandel?«
»Ja«, sagte Nimrod. »Obwohl ich glaube, dass es mehr mit der Zerstörung der brasilianischen Regenwälder zu tun hat als mit Dingen wie dem Kohlenstoff-Fußabdruck.«
»Aber was sollen wir tun?«, fragte Mrs Trump/Gaunt. »Unter diesen Umständen erscheint es mir fast sträflich, ein Flugzeug nach Brasilien zu besteigen.«
»Allerdings«, stimmte Nimrod ihr zu. »Außerdem finde ich, dass man sich kaum noch wie ein Dschinn vorkommt, wenn man mit ganz normalen Flugzeugen verreisen muss. Von der Klaustrophobie ganz zu schweigen. Ich frage mich, wie wir es aushalten sollen, stundenlang wie die Hühner zusammengepfercht zu werden.«
»Die Irdischen schaffen es auch«, sagte seine Schwester. »Irgendwie.«
»Aber nur, weil sie sich daran gewöhnt haben, wie Hühner behandelt zu werden.«
»Ich fürchte, über kurz oder lang werden wir uns alle daran gewöhnen müssen«, sagte Mrs Trump/Gaunt. »Das ist wohl die unbequeme Wahrheit.«
Die drei Druiden
Wenn man bedachte, dass er ihr Zwillingsbruder war, schien sich John Gaunt in einer ganzen Reihe von Dingen von seiner Schwester Philippa zu unterscheiden. Am offensichtlichsten war, dass er ganz anders aussah als sie, was auf alle zweieiigen Zwillinge zutrifft: Philippa war kleiner, hatte rotes Haar und eine Brille, während John groß und dunkel war. Er neigte eher zum Handeln als zum Nachdenken und mochte lieber Filme als Bücher. Und dann war da noch die Tatsache, dass er etwas gegen Dschinnversoctoannular hatte, das eigenartige Täuschungsspiel, das fast alle Dschinn liebten. Durch ihre Mutter waren sowohl John als auch Philippa Kinder des Dschinn, doch nur Philippa mochte diesen uralten Zeitvertreib. Während seine Schwester inzwischen das Incognito-Level erreicht hatte, eine Stufe unter dem Expertenstatus, war John kein guter Täuscher. Er zog die ehrlichen, wenn auch eher geistlosen Spiele vor, die man auf einem kleinen LCD-Bildschirm spielte. Normalerweise hätte er nicht im Traum daran gedacht, Philippa zu einer Dschinnverso-Veranstaltung zu begleiten, doch wie der Zufall es wollte, war sie ebenfalls zu dem Wochenendturnier im Landhaus von Mr Vodyannoy in New Haven eingeladen worden.
John hatte Mr Vodyannoy immer eher als seinen eigenen Freund und nicht als Philippas Freund betrachtet und er wusste, dass ihm ohne seine Schwester in New York ein langweiliges Wochenende bevorstand, daher beschloss er, sich ihr anzuschließen. New Haven liegt knappe zwei Stunden Zugfahrt von New York City entfernt. Außerdem war Mr Vodyannoys Anwesen, das den Namen Nightshakes trug, Johns Onkel Nimrod zufolge ein berühmtes Spukhaus. Doch nicht nur das, Mr Vodyannoy besaß darüber hinaus auch die weltweit größte Sammlung antiker Ouija-Bretter, von denen einige mehr als hundert Jahre alt waren. Während seine Schwester, sein Onkel und sein Gastgeber sich mit Dschinnverso vergnügten, hoffte John einen praktischen Nutzen aus den schattenhaften Bewohnern von Nightshakes ziehen zu können. Der Dschinnjunge hatte nämlich keinen innigeren Wunsch, als mithilfe eines Ouija-Brettes die Geisterwelt anzurufen, um herauszufinden, ob sein alter Freund Mr Rakshasas wirklich tot war oder nicht.
Aber zuerst mussten sie die Erlaubnis ihres Vaters einholen, denn solange sich ihre Mutter in Brasilien befand, war er für ihr Wohlergehen verantwortlich.
»Mir ist klar, warum Philippa hinfahren möchte«, sagte Mr Gaunt. »Sie spielt für ihr Leben gern Dschinnverso. Aber du, John? Warum du mitfahren möchtest, verstehe ich nicht. Du kannst das Spiel nicht ausstehen.«
»Ich dachte, ich könnte mir das Peabody-Museum ansehen, während wir in New Haven sind«, sagte John.
Philippa sagte gar nichts.
»In der Yale-Universität«, fügte John hinzu.
»Ich weiß, wo das Museum ist«, sagte sein Vater. »Ich habe selbst in Yale studiert, falls du das vergessen hast. Es überrascht mich nur ein bisschen, dass du es dir ansehen willst.«
»Ich weiß wirklich nicht, warum dich das überrascht«, meinte John mit gespielter Unschuld. »Sie haben dort eine ziemlich gute Sammlung von Dinosaurierskeletten. Sie haben überhaupt ziemlich gute Sammlungen. Während Philippa ihre Spielchen spielt, werde ich mir wahrscheinlich das ganze interessante Zeug ansehen und mich weiterbilden.«
»Ein bisschen Bildung kann nie schaden, nehme ich an«, sagte Mr Gaunt. »Aber stell bitte nichts an, ja?«
»Ich?« John lachte. »Wie soll man denn etwas anstellen, wenn man einfach nur in einem blöden alten Museum herumläuft?«
»Und was ist mit dir, Dad?«, fragte Philippa. »Kommst du ohne uns zurecht?«
»Ich?« Mr Gaunt umarmte seine Tochter.
»Und ohne Mom«, fügte sie hinzu.
»Ich komme schon klar. Was soll mir denn passieren? Aber es ist nett von dir, dass du mich fragst.« Er fuhr John durch das Haar. »Dann fahrt. Alle beide. Und amüsiert euch gut.«
Was Philippa betraf, war sie froh über Johns Gesellschaft, auch wenn sie starke Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Erklärung hatte, wie er das Wochenende in New Haven zu verbringen gedachte. Schließlich war sie seine Zwillingsschwester, und selbst bei den Menschen schienen Zwillinge auf fast magische Weise übereinander Bescheid zu wissen, ohne darüber reden zu müssen. Man könnte fragen, wen man wollte. Fast alle Zwillinge würden bestätigen, dass zwischen ihnen eine Art telepathische Verbindung besteht, die wissenschaftlich nicht zu erklären ist.
Auf ihrer Zugreise von der New Yorker Penn Street Station nach New Haven in Connecticut wurden sie von ihrem Onkel Nimrod begleitet. Er war selbst ein versierter Dschinnverso-Spieler und soeben mit seinem englischen Butler, Groanin, in New York eingetroffen. Groanin verreiste nicht gern und es dauerte nicht lange, ehe er seine Abneigung gegen amerikanische Züge im Allgemeinen und den Mangel an anständigen Frühstücksmöglichkeiten im Besonderen zum Ausdruck brachte.
»Ein Bistrowagen«, maulte er. »Mehr hat dieser Zug nicht zu bieten. Wie soll ein anständiger Mann mit einer armseligen Bistrowagen-Suppe, Salat, Pizza, Sandwiches und irgendwelchen Snacks und Getränken auskommen? Was ist mit Frühstücksspeck, Würstchen, Pfannkuchen, Blutwurst, Eiern, Pilzen und Tomaten, Toast und Marmelade und einem ordentlichen Quantum heißem Tee mit Zucker? Ich wünschte wirklich, dieser Zug hätte einen anständigen Speisewagen.«
»Sie haben im Hotel gefrühstückt, ehe wir heute Morgen losfuhren«, sagte Nimrod.
»Das war im Hotel«, erwiderte Groanin. »Aber in Zügen werde ich immer schrecklich hungrig.«
John, dem bei Groanins Frühstücksbeschreibung selbst das Wasser im Mund zusammenlief, fand, es könnte ganz amüsant sein, den Wunsch des Butlers zu erfüllen. Und so nahmen sie wenig später in einem eleganten Speisewagen Platz, der selbst dem alten Orient-Express Ehre gemacht hätte.
»Du musst damit aufhören«, sagte Nimrod zu seinem Neffen.
»Es ist doch nur dieses eine Mal«, sagte John.
»Trotzdem«, erklärte sein Onkel streng. »Du weißt, dass du damit Gefahr läufst, Aufmerksamkeit zu erregen. Ganz zu schweigen von den unvorhersehbaren Konsequenzen, die die Erfüllung eines Wunsches nach sich ziehen kann. Weißt du noch, was Mr Rakshasas immer gesagt hat? Einen Wunsch frei zu haben, ist, als zünde man ein Feuer an. Man muss immer damit rechnen, dass der Rauch irgendjemanden zum Husten bringt.«
»Ich persönlich«, sagte Mr Groanin, »bin froh, dass der Junge meinen Wunsch erfüllt hat, Sir. Es gibt keine Reise, die durch ein gutes englisches Frühstück nicht dazugewinnt. Vor allen Dingen eines mit schöner weißer Tischdecke und anständigem Silberbesteck.«
»Nun, dagegen lässt sich nichts einwenden«, sagte Nimrod und lächelte seinem Neffen nachsichtig zu.
»Ich verstehe einfach nicht, warum wir überhaupt mit dem Zug verreisen müssen«, wandte John ein, »statt mit einem Wirbelsturm.«
»Hast du vergessen, was deiner Mutter widerfahren ist?«, fragte Nimrod. »Im Übrigen habe ich mich unter den anderen Dschinn in meinem Bekanntenkreis umgehört und erfahren, dass Wirbelsturmreisen für alle problematisch geworden sind, gute wie schlechte Dschinn. Solange nicht irgendjemand herausfindet, was sich an der Sache ändern lässt, müssen wir wohl oder übel wie die Irdischen reisen. Was Luftreisen angeht, ist das bedauerlich. Aber wenn man, wie in diesem Fall, einen wunderbaren Zug benutzen kann, habe ich eigentlich nichts dagegen einzuwenden.«
»Unter ›wunderbar‹ verstehe ich etwas anderes«, meinte Groanin.
»Muss ich dich wirklich daran erinnern, John«, fuhr Nimrod fort, ohne seinen Butler zu beachten, »welche Auswirkungen der verschwenderische Umgang mit Dschinnkraft auf deine Lebensenergie hat? Wie oft habe ich dir das schon erklärt? Jedes Mal, wenn wir unsere Dschinnkraft einsetzen, wird das Feuer, das in jedem von uns brennt, ein wenig schwächer. Du hast sicher nicht vergessen, was mit dem armen Dybbuk geschehen ist?«
»Nein, hab ich nicht«, sagte John, aber inzwischen war Nimrod als guter Onkel wild entschlossen, es ihm trotzdem noch einmal vor Augen zu halten.
»Er hat seine Kraft so leichtfertig verschwendet, dass sie restlos aufgebraucht wurde. Für immer, wie mich nicht wundern würde.«
»Ich frage mich, wo er jetzt ist«, überlegte Philippa.
»Er hat sich entschieden, unsere Welt hinter sich zu lassen«, sagte Nimrod leise. »Dybbuk hat sich an einen Ort begeben, an dem ihn unser Mitgefühl nicht mehr erreicht. Er hat die Kälte gewählt. Im wahrsten Sinne des Wortes, befürchte ich.«
»Kann man das niemals rückgängig machen?«, fragte Philippa.
»Ich fürchte, nein«, sagte Nimrod.
»Wohin wird er gehen?«, fragte Philippa.
»Wahrscheinlich nach Ägypten«, sagte Nimrod. »Dorthin würde ich gehen, wenn ich erkaltet wäre.«
»Armer Dybbuk«, sagte John und bestellte sich ein warmes Frühstück.
Edward Gaunt verließ sein Haus wie jeden Morgen genau um sieben Uhr dreißig und warf einen kurzen Blick nach rechts, wo seine graue Maybach-Limousine auf ihn wartete. Er sah kaum von seiner Zeitung auf, während er die Stufen hinabging und in den Fond des Wagens stieg. Er goss etwas Wasser in einen Silberkelch und lehnte sich in seinem Ledersitz zurück, um die Marktpreise zu studieren, wie er es immer tat. Gewohnheitstiere waren nichts im Vergleich zu Edward Gaunt. Sie waren schon ein ganzes Stück die Park Avenue hinabgefahren, ehe ihm auffiel, dass nicht sein üblicher Chauffeur, sondern ein anderer Mann am Steuer saß.
»Wo ist Mr Senna?«, fragte er.
Der Mann war groß und kahl und trug genau die gleiche Uniform wie Mr Senna.
»Er ist krank, Sir«, sagte der Mann. »Ich heiße Haddo. Oliver Haddo. Ich bin ein alter Freund von Mr Senna. Und Chauffeur wie er. Er hat mich gebeten, für ihn einzuspringen.«
»Ich wüsste nicht, dass Mr Senna schon jemals einen Tag gefehlt hätte«, sagte Mr Gaunt. »Was hat er denn? Und warum hat er nicht angerufen und mir selbst Bescheid gesagt?«
»Ich glaube, das hatte er vor, Sir«, antwortete Haddo. »Aber die Erkrankung hat seine Absicht leider durchkreuzt.«
»Sie sind Engländer, nicht wahr, Haddo?«, sagte Mr Gaunt.
»So ist es, Sir.«
»Meine Frau stammt aus England«, sagte Mr Gaunt. »Auch wenn davon inzwischen nichts mehr zu merken ist. Aus welchem Teil Englands kommen Sie?«
»Aus Strangways, Sir. In Wiltshire.«
»Nie gehört.«
»Es liegt nur einen knappen halben Kilometer von Stonehenge entfernt, Sir.«
»Sie meinen den alten Steinkreis der Druiden?«
»Jawohl, Sir.«
»Dann stammen Sie aus einer seltsamen Gegend«, sagte Mr Gaunt. »Was ist das überhaupt für ein seltsamer Geruch?«
»Strangways ist in vielerlei Hinsicht ein seltsamer Ort, Sir«, gab Haddo zu. »Oh, und der seltsame Geruch stammt vermutlich von mir, Sir. Wenn man mit dem Bösen in Berührung kommt, hinterlässt das mitunter gewisse Spuren.«
»Was hat das zu bedeuten?«
»Ich bin nicht nur Chauffeur, sondern auch Druide, Sir. Allerdings bin ich kein weißer Druide. Sie huldigen dem Guten. Ich bin ein schwarzer Druide.« Er kicherte böse. »Wir halten zur anderen Mannschaft.«
»Ich möchte gerne aussteigen«, sagte Mr Gaunt. »Halten Sie den Wagen an.«
»Wie Sie wünschen, Sir«, sagte Haddo. »Ich werde an der nächsten Ecke rechts ranfahren, wenn Sie wollen.«
»Tun Sie das bitte.«
Unter dem lautstarken Hupen der vielen Taxis und Autos hinter ihnen kam der Maybach an der Ecke Park Avenue und 57. Straße fast lautlos zum Stehen, doch ehe Mr Gaunt aussteigen konnte, gingen die schweren Türen auf und zwei noch seltsamere Männer setzten sich zu ihm in den Fond. Der merkwürdige Geruch im Wagen schien noch stärker zu werden.
»Danke, Mr Haddo«, sagte einer der beiden Männer, die ebenfalls Engländer waren.
Der Wagen fuhr wieder los und Mr Gaunt, der nun eine gewisse Gefahr erahnte, versuchte hinauszugelangen, musste jedoch feststellen, dass er sich nicht bewegen konnte.
»Keine Sorge«, sagte einer der beiden Männer. »Mr Haddos Geruch stammt von einer hypnotisierenden Paste, die dazu dient, Sie zu unserem und Ihrem eigenen Besten ruhigzustellen.«
»Was geht hier vor?«, fragte Mr Gaunt. »Wer sind Sie?«
»Wir sind Ihre Entführer«, sagte der Mann. »Und Sie werden gerade entführt.«
»Ich nehme an, Sie wollen Geld«, sagte Mr Gaunt.
»Geld?« Der Mann lachte. »Aber nein. Das ist viel zu banal.«
Das Ouija-Brett
New Haven, 1638 von fünfhundert Puritanern gegründet, die umgehend den Stamm der dort lebenden Quinnipiac-Indianer ausrotteten, liegt am nördlichen Ufer des Long-Island-Sunds und ist vor allem als Sitz der Universität Yale bekannt. Philippa wusste, dass sieben amerikanische Präsidenten und Vizepräsidenten dort studiert hatten (ganz zu schweigen von einem türkischen Premierminister und ihrem eigenen Vater), und sie hatte vor, dort eines Tages ebenfalls zur Universität zu gehen. John kannte nur einen einzigen weiteren Absolventen: Charles Montgomery Burns, den Besitzer des Kernkraftwerks von Springfield in der berühmten Fernsehserie Die Simpsons, Johns Lieblingssendung. Seiner Meinung nach war die Tatsache, dass Monty Burns in Yale studiert hatte, alles, was er über den Ort wissen musste.
Mr Vodyannoy, der auch ein Apartment im unheimlichen Dakotagebäude am New Yorker Central Park besaß, hieß die Zwillinge, Onkel Nimrod und Mr Groanin in seinem riesigen Haus am Meer willkommen, das mit seinen Dachtürmchen und Bogenfenstern eher an ein mittelalterliches Schloss erinnerte. John war beeindruckt. Mr Vodyannoys Haus war sogar noch unheimlicher als das Dakotagebäude.
»Verdammt großes Haus, Mr Vodyannoy«, sagte er. »Leben Sie schon lange hier?«
»Verdammt ist genau der richtige Ausdruck«, meinte Mr Vodyannoy. »Und für Nightshakes passender, als du ahnst. Als ich das Haus vor rund siebzig Jahren kaufte, lag ein Fluch auf ihm, der mich unter anderem zwang, es unaufhörlich auszubauen. Und in diesem Teil der Welt sollte man Flüche sehr ernst nehmen. Das Haus hatte nur dreizehn Zimmer, als ich es erwarb. Seitdem habe ich siebzig weitere Räume angebaut, hauptsächlich im Ostflügel, in den ihr niemals einen Fuß setzen solltet.«
»Ist das der Teil, in dem es spukt?«, fragte John.
»Schlimmer als das«, sagte Mr Vodyannoy. »Der Ostflügel ist der böse, Unheil bringende Teil des Hauses. Und ich habe diesem Umstand bei sämtlichen Baumaßnahmen Rechnung getragen. Es gibt zum Beispiel dreizehn kleine Kuppeldächer und dreizehn Gänge. Sämtliche Fenster haben dreizehn Scheiben, alle Fußböden dreizehn Dielenbretter und alle Treppen dreizehn Stufen. Im Ostflügel von Nightshakes gibt es Korridore, die nirgendwo hinführen, Türen, die sich ins Nichts öffnen; und das Haus ist inzwischen so groß, dass man nicht mehr darin herumlaufen kann, ohne sich zu verirren. Ich empfehle euch also, den Westflügel unter keinen Umständen zu verlassen. Oder ihr tragt die Konsequenzen, die selbst für einen Dschinn schrecklich sein können. Solltet ihr das große Pech haben, euch dort zu verirren, rate ich euch, so laut und so lange ihr könnt zu schreien. Vielleicht findet sich dann eine tapfere Seele, die euch rettet. Es sei denn, es ist bereits dunkel. In diesem Fall werdet ihr wohl auf euer Glück vertrauen und bis zum Morgen ausharren müssen.«
Mr Groanin schüttelte sich und sagte: »Wer mich nach der Dämmerung noch dort herumschleichen sieht, kann mich gleich ins örtliche Irrenhaus einweisen.«
»Das ist sicher eine Möglichkeit«, sagte Mr Vodyannoy. »Denn ehe ich das Haus kaufte, war Nightshakes das örtliche Irrenhaus.«
Seine etwas exzentrische Erscheinung ließ es geraten erscheinen, Frank Vodyannoys Warnung ernst zu nehmen: Er war groß, größer als Nimrod, hatte einen buschigen roten Bart und eine Adlernase; und er trug einen riesigen Ring mit einem Mondstein von der Größe und Farbe eines Alligatorauges. Mr Vodyannoy lebte seit fünfundsiebzig Jahren in New York, doch hin und wieder schimmerte in seiner Ausdrucksweise seine russische Herkunft ein wenig durch. »Doch genug davon. Das Dschinnverso-Turnier beginnt heute Nachmittag um drei Uhr in der Bibliothek. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, klingelt einfach nach meinem Butler Bo, der euch auf eure Zimmer bringen wird. Bo?«
Ein großer, unförmiger Mann trat vor, packte mit einem Griff das gesamte Gepäck – das aus mehr als einem Dutzend Taschen bestand – und hob es wie einen Haufen Einkaufstüten hoch. Während Mr Vodyannoy Zadie Eloko begrüßte, einen neuen Gast, wurden die anderen von Bo schweigend zu ihren jeweiligen Zimmern geführt, was Philippa Gelegenheit gab, ihren Onkel über die Bemerkungen ihres Gastgebers zum Ostflügel auszufragen.
»Nach unserem letzten Abenteuer«, sagte sie, »hatte ich den Eindruck, als sei die Geisterwelt mehr oder weniger leer gefegt worden. Als gäbe es keine Geister mehr, weil Iblis sie alle vernichtet hat.«
»Das stimmt«, sagte Nimrod. »Natürlich entstehen ständig neue Geister. Die Menschen sterben und manche von ihnen werden zu Geistern. Aber die Dinge sind mit Sicherheit nicht mehr das, was sie waren. Es wird Jahrhunderte dauern, bis es wieder ebenso viele Geister gibt wie zuvor. Trotzdem solltest du einem Mann mit einem Haus wie Nightshakes ein wenig dichterische Freiheit zugestehen. Zudem gibt es außer Geistern noch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als du dir im Moment vielleicht vorstellen kannst, Philippa. Zumindest hoffe ich das.«
»Ein wirklich tröstlicher Gedanke«, murmelte Groanin.
Er betrat das Zimmer, das Bo ihm zugewiesen hatte, machte die Tür hinter sich zu und sah sich um. Mit anerkennendem Kopfnicken gewahrte er das riesige Bett, den Großbild-Fernseher und das geräumige Marmorbad. Er hatte gerade seine Tasche fallen lassen und sich auf dem Bett ausgestreckt, als es klopfte. Es war John.
Groanin lächelte, so gut er konnte. »Was willst du, junger Mann?«, fragte er den Jungen. »Was ist los?«
»Ich nehme an, das Dschinnverso-Turnier interessiert Sie nicht besonders«, sagte John.
»Stimmt. Ich mag keine Spiele außer Fußball und Darts.«
»Deshalb habe ich mich gefragt, ob Sie vielleicht Lust hätten, mich ins Peabody-Museum zu begleiten.«
Mr Groanin dachte einen Augenblick über Johns Einladung nach. Eigentlich erschien ihm der Gedanke nicht allzu verlockend. Groanin hatte für Museen nichts mehr übrig, seit ihn an seinem Arbeitsplatz in der Bibliothek des Britischen Museums ein Tiger angefallen hatte. Aber John lag ihm sehr am Herzen und er beschloss, den Jungen zu begleiten, und sei es nur, um zu verhindern, dass er in Schwierigkeiten geriet. Jungen sind nun mal Jungen, selbst wenn sie keine Menschen, sondern Dschinn sind.
Das Peabody ist ein roter Ziegelsteinbau, der einer Kirche ähnlicher sieht als einem Museum. Aber nur wenige Kirchen, wenn überhaupt irgendeine, sind mit einer Statue gesegnet, wie sie das Peabody besitzt. Direkt vor dem Eingang erhob sich auf einem Granitsockel die lebensgroße und ziemlich echt aussehende Bronzestatue eines Torosaurus, einer Saurierart, die dem Triceratops sehr ähnelt.
Mr Groanin war keineswegs beeindruckt.
»Wie kann man nur auf die Idee kommen, von einem derart hässlichen Vieh eine Statue zu machen«, grummelte er. »Ich habe noch nie verstanden, was die Leute an diesen tumben Viechern so fasziniert. Große, hässliche Dinger mit scharfen Zähnen und tapsigen Füßen.« Er schüttelte sich. »Scheußlich.«
John war nicht seiner Meinung. »Ich finde die Statue toll«, sagte er. »Stellen Sie sich nur mal vor, was los wäre, wenn sie zum Leben erwacht. Welchen Schaden sie anrichten könnte. Unglaublich.«
»Wenn mir ein Dschinn in diesem Augenblick einen Wunsch gewähren würde«, sagte Groanin mit Nachdruck, »würde ich mir wünschen, dass dieses Riesenscheusal genau dort bleibt, wo es ist, und zwar für immer. Klar?«
»Ja«, sagte John. »Ich habe es mir ja nur vorgestellt, mehr nicht.«
»Lass es lieber sein. Wenn du dir etwas vorstellst, fühlen sich die meisten normalen Leute geneigt, sich einen Schutzhelm aufzusetzen.«
Sie gingen hinein und wanderten zwei Stunden lang im Zickzack hin und her, um sich die Sammlungen uralter wissenschaftlicher Instrumente, Meteoriten, ägyptischer Artefakte und verschiedener Gold- und Tongegenstände aus Südamerika anzusehen. John wäre das alles längst langweilig geworden, hätte er nicht das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden. Er drehte sich sogar einige Male unvermittelt um, in der Hoffnung, jemanden zu erwischen, der ihnen hinterherspionierte, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Nur Groanin warf ihm ein paar seltsame Blicke zu.
»Was ist los mit dir, Junge? Du bist ja schreckhaft wie ein Rudel Hirsche.«
»Nichts«, sagte John. Er sah aus dem Fenster nach draußen, wo der Wind auffrischte. »Wahrscheinlich war es nur der Wind.« Er sah auf seine Armbanduhr. »Kommen Sie. Gehen wir zurück. Hier ist es langweilig.«
»Wie recht du hast«, sagte Groanin. »Ich habe schon schmutzige Taschentücher gesehen, die interessanter waren als das hier.«
Im Haus war das Dschinnverso-Turnier in vollem Gange und niemand achtete auf John, was ihm ausnahmsweise sehr gelegen kam. Nach dem Abendessen suchte er Bo, Mr Vodyannoys merkwürdigen Butler, um ihn etwas zu fragen. Er fand ihn im Anrichtezimmer im Untergeschoss, wo er eine Zeitschrift über Boxen las, eine Sportart, in der er früher selbst geglänzt hatte. Er war nicht umsonst so groß wie ein Berggorilla und fast ebenso behaart.
»Entschuldigen Sie bitte, Bo«, sagte John nervös. »Ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht Mr Vodyannoys Sammlung von Ouija-Brettern zeigen könnten. Ich würde sie mir gerne ansehen. Weil es doch so wertvolle antike Stücke sein sollen oder so was.«
Bo knurrte leise vor sich hin, stand auf, griff nach seiner gänzlich unpassenden Jacke und zog eine Grundrisskarte des Hauses aus einer Tasche, die er auf dem Tisch ausbreitete. Dann sprach er mit einer Stimme, die sich anhörte wie eine üble Mischung aus Kaffee, vielen schlaflosen Nächten, Zigaretten, einem alten Faustschlag in die Kehle und Ungarisch.
»Wir sind hier«, sagte er und deutete mit einem Zeigefinger so dick wie der Ast einer Eiche auf ein kleines Viereck auf der Karte. »Du gehst diesen Korridor entlang und die Treppe hinauf bis zum Spiegelsaal. Dann verlässt du die Halle durch die östliche Tür, gehst leise durch die Ahnengalerie und das Musikzimmer, bis du zum Sommermalsalon kommst. Dort gehst du durch die hohe Tür wieder hinaus und durchquerst den Wintergarten, bis du zur Wendeltreppe kommst. Am oberen Ende der Wendeltreppe landest du, wenn du Glück hast, in einer Sternwarte, die leicht an einem großen reflektierenden Teleskop zu erkennen ist. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du die Sternwarte durch die grüne Malachittür wieder verlassen kannst. Anschließend gelangst du durch ein Trophäenzimmer in den Saal der Schatten. Was du suchst, findest du in den dreizehn großen Schubladen, auf denen HÜTE DICH steht.« Bo faltete die Karte wieder zusammen und gab sie John. »Hier. Nimm die. Falls du dich verirrst.«
»Danke«, sagte John. »Übrigens, warum steht auf den dreizehn Schubladen HÜTE DICH? Sind die Ouija-Bretter so wertvoll?«
»Mit ihrem Wert hat das nichts zu tun«, sagte Bo steif. »Eher damit, dass sie ziemlich gefährlich sind und auf keinen Fall von jemandem benutzt werden sollten, der sich damit nicht auskennt. Schon gar nicht von einem zwölf- oder dreizehnjährigen Jungen. Aber du bist schließlich ein Dschinn, also weißt du sicher, was du tust.«
»Ja«, sagte John, der trotz des Vertrauens, das Bo in ihn setzte, so gut wie keine Ahnung hatte, wie ein Ouija-Brett funktionierte. »Da haben Sie recht. Ich weiß natürlich, was ich tue.« Er steckte die Karte ein und ging zur Tür. »Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
»Nicht da entlang, Sir«, sagte Bo und wies in die entgegengesetzte Richtung: »Dort entlang. Übrigens befindet sich der Saal der Schatten ganz am Ende des Westflügels. Er grenzt also direkt an den Ostflügel, den man nach Anbruch der Dunkelheit besser nicht betreten sollte. Selbst ein Dschinn wie du. Meine Schwester Grace ist vor acht Monaten im Ostflügel verloren gegangen.«
»Wie lange wurde sie denn vermisst?«, fragte John interessiert.
»Das wird sie leider immer noch«, sagte Bo. »Hin und wieder hören wir sie in irgendeinem entlegenen Winkel des Hauses weinen, doch sooft wir auch nachgesehen haben, sie wurde nie gefunden. Natürlich stellen wir dem armen Ding Essen hin. Und das verschwindet. Also gehen wir davon aus, dass sie noch am Leben ist.«
»Aber Mr Vodyannoy könnte sie doch sicher mithilfe von Dschinnkraft wiederfinden.«
»Hat er das denn nicht erklärt?«, fragte Bo.
»Was erklärt?«
»Auf diesem Haus liegt eine Dschinnfessel, die verhindert, dass man innerhalb seiner Mauern Dschinnkraft einsetzen kann. Das ist der Fluch von Nightshakes. Ehe es ein Irrenhaus wurde, gehörte das Haus einem Mitglied des Stamms der Ifrit. Eine äußerst unangenehme Bande. Die reinste Pest, wenn ich das sagen darf.«
»Ja, ich hatte bereits das Vergnügen ihrer Bekanntschaft.«
»Du passt doch auf, nicht wahr?«, sagte Bo mit einer Stimme so tief wie die eines Alligators. »Es wäre schrecklich, noch jemanden zu verlieren. Eine ist schlimm genug. Aber bei zweien würde es aussehen wie mutwillige Nachlässigkeit meinerseits.«
»Ganz bestimmt. Mir wird nichts passieren.«
Einen Moment lang rieben Regen und Wind an der Fensterscheibe wie ein hungriger Wolf, und ein Blitz ließ das Anrichtezimmer sekundenlang aufleuchten, als spiele jemand mit einem Lichtschalter.
»Da braut sich was zusammen«, stellte Bo fest.
»Das sieht nach einem ganz schön starken Gebräu aus«, witzelte John.
Bo lächelte nicht.
»Ich erwähne es deshalb«, sagte er, »weil die Stromversorgung in diesem Teil des Hauses immer etwas ungewiss ist. Vor allem bei Gewittern. Ich würde dir raten, diese Taschenlampe mitzunehmen.«
Bo gab John eine Taschenlampe und setzte sich dann wieder hin, um seine Zeitschrift zu Ende zu lesen. Etwas verunsichert durch die Bemerkung des Butlers, aber nicht gänzlich entmutigt, machte sich John, der ein dickköpfiger und oft sehr mutiger Junge war, auf den Weg zum Saal der Schatten.
Es dauerte etwa eine halbe Stunde, ehe John den Saal erreichte, wobei er inzwischen ununterbrochen Selbstgespräche führte, um seine Angst in Schach zu halten. Die Galerie war voller Porträts von Mr Vodyannoys Ahnen gewesen, von denen einige eher in ein Gruselkabinett auf dem Jahrmarkt zu gehören schienen. Vor allem die Großtante mit dem roten Bart. Im Sommermalsalon hatte eine Grabeskälte geherrscht, was nicht weiter überraschend war, da die zahlreichen steinernen Wasserspeier aus der Familiengruft der Vodyannoys in Wien stammten. Nachdem er den sogenannten Sommermalsalon durch eine Tür verlassen hatte, die bis zur Höhe eines Basketballkorbs hinaufreichte, hatte John einen spinnwebenverhangenen Wintergarten durchquert und war über eine wacklige Wendeltreppe in eine Sternwarte hinaufgestiegen, in der ein menschliches Skelett in einem roten Lehnstuhl saß und durch das Teleskop zum Mond hinaufzustarren schien. Dann war er, nachdem er die Sternwarte durch eine Tür aus grünem Malachit wieder verlassen hatte, in ein Trophäenzimmer gelangt. Dort befanden sich keine silbernen Pokale, sondern äußerst lebensecht wirkende Tiere, die man erschossen und fachmännisch ausgestopft hatte, um sie anschließend als wild dreinblickende Möbelstücke im Raum zu verteilen: einen Kodiakbären, einen Löwen, einen Tiger, einen Schakal, eine Hyäne, einen Wolf, einen Jaguar, ein Rhinozeros und einen Elefanten, dessen Bernsteinaugen gefährlich glitzerten.
»Vergiss das Peabody-Museum, Junge«, sagte John zu sich selbst. »Hier hättest du dich umsehen sollen. Der Laden ist total unheimlich.«
Trotzdem ließ er sich nicht beirren und blieb bei seinem Entschluss, mithilfe eines der Ouija-Bretter Kontakt zu einem Geist aufzunehmen und herauszufinden, was dem armen Mr Rakshasas vor ein oder zwei Monaten zugestoßen war. Dessen Geist war aus dem New Yorker Metropolitan-Museum verschwunden, nachdem ihn ein gespenstischer chinesischer Terrakottakrieger absorbiert hatte. Kurz darauf war auch sein Körper verschwunden, den er in der Obhut der Familie Gaunt in der East 77th Street zurückgelassen hatte. John vermisste den alten Dschinn und seine seltsamen irischen Sprichwörter von ganzem Herzen.
Der Saal der Schatten trug seinen Namen nicht zu Unrecht. Der Kronleuchter an der Decke schien nicht zu funktionieren, dafür brannte in dem riesigen Kamin ein Holzscheit, was den Raum in Halbschatten hüllte und ihn unangenehm lebendig wirken ließ, als würde er sich bewegen. John knipste die Taschenlampe an, stieß einen zittrigen Seufzer aus und biss für einen Moment die Zähne zusammen.
»Kein Grund zur Sorge«, sagte er zu sich. »Es ist nur das Feuer. Sonst nichts.«
In der Mitte des Raums stand eine große sechseckige chinesische Kommode. Ihre typische rote Lackierung leuchtete im Feuerschein geradezu infernalisch. Sie hatte genau dreizehn Schubladen. Auf jeder einzelnen stand in goldenen Buchstaben das Wort CAVE. Einen Moment lang fragte sich John, ob er die falschen Schubladen vor sich hatte, bis ihm einfiel, dass cave das lateinische Wort für Hüte dich war. Gleich darauf kam ihm ein weiterer lateinischer Ausdruck in den Sinn.
»Carpe diem«, sagte er. »Carpe diem. Nutze den … Schubladengriff.« Er packte einen der Griffe und zog daran.
»Suchst du etwas?«
John stieß einen erschreckten Schrei aus, wirbelte herum und sah auf einem hohen Stuhl eine Frau sitzen, die aussah, als sei sie die hiesige Haushexe. Sie hatte langes, ungekämmtes Haar, trug ein schmutziges Kleid und ein merkwürdiges Lächeln in ihrem schmuddeligen gelblichen Gesicht, das nur aus Haut und Knochen bestand. Unwillkürlich vermutete John, dass dieses seltsame Wesen Bos verlorene Schwester sein musste.
»Sie müssen Grace sein«, sagte er und verdrängte seine Angst.
»Ich glaube nicht, dass ich dich kenne, Junge«, erwiderte sie.
»Ihr Bruder Bo hat mir von Ihnen erzählt«, sagte John.
»Was hat er denn erzählt?«, fragte Grace spitz.
»Nichts. Nur, dass Sie sich im Ostflügel verirrt hätten.«
»Das ist in diesem Haus kein Kunststück. Wirklich nicht.«
»Jetzt sind Sie im Westflügel«, sagte John. »Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie zurückkommen, wenn Sie wollen. Sobald ich erledigt habe, weswegen ich hergekommen bin.«
»Ich nehme an, du willst Karten spielen. Willst du Karten spielen?«
»Karten? Nein, eigentlich nicht.«
»Was suchst du in den Schubladen? Dort sind keine Karten, falls du danach suchst. Und auch kein Essen. Ich habe schon nachgesehen.«
»Ich suche nach Mr Vodyannoys Ouija-Brettern«, antwortete John und holte ein Brett aus der offenen Schublade. Es war ein recht schönes Holzbrett mit einem Bild, das einen amerikanischen Ureinwohner darzustellen schien und einen bärtigen Mann in einer Rüstung.
»Diese Bretter sind gefährlich«, sagte Grace. »Du solltest nicht damit herumspielen.«
Aber John hörte ihr gar nicht zu. Er ging mit dem Brett und einem kleinen Herzen aus Balsaholz – das eine Art Zeiger darstellte – zum Feuer hinüber, legte es auf den Teppich und setzte sich davor. Auf dem Brett war ein Alphabet abgebildet, die Zahlen von eins bis zehn und die Worte Sí, No, Hola und Adiós. Neugierig kam Grace herüber und setzte sich John gegenüber. So nahe, dass er sie riechen konnte, was nicht sehr angenehm war, doch John war zu höflich, um ihr zu sagen, dass sie stank und sich weiter weg setzen sollte. Außerdem hatte er immer noch ein wenig Angst vor ihr, da sie ganz offensichtlich verrückt war. Er holte tief Luft, packte das Brett auf beiden Seiten und starrte es an.
»Ich heiße John Gaunt«, sagte er laut. »Ich versuche einen Freund zu erreichen, der Mr Rakshasas heißt, und ich will herausfinden, ob er auf die andere Seite gegangen ist. Wenn Mr Rakshasas hier ist oder jemand, der ihn vielleicht kennt und weiß, wo er ist, möge er sich bitte zu erkennen geben.«
Nichts geschah, außer dass Grace den Kopf schüttelte. »Hör auf mich, Junge«, wisperte sie. »Das hier ist nichts für Kinder.«
»Still«, zischte John. »Bitte. Ich versuche, mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen.«
»Die andere Seite von was?«, fragte Grace mit einem boshaften Kichern.
»Weiß ich nicht genau«, gab John zu. »Aber mit mir hat auch mal ein Medium Kontakt aufgenommen. Und sie hat so etwas Ähnliches gesagt.«
»Ein Medium hat mit dir Kontakt aufgenommen?« Grace runzelte die Stirn. »Bist du denn tot? So siehst du gar nicht aus.«
»Hören Sie, ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen«, sagte John und legte die Hände auf das Brett, was zu funktionieren schien, denn fast augenblicklich begann sich das kleine Herz zu bewegen.
»Das warst du selbst«, sagte Grace.
»Nein, war ich nicht.«
»Warst du doch.«
John beschloss, sie nicht länger zu beachten und sich ganz auf das Ouija-Brett zu konzentrieren. »Ist dort irgendjemand?«, fragte er und sah sich nervös um, als er etwas gegen die Fensterscheibe klopfen hörte. Doch es war nur der Ast eines Baums. Der Wind fuhr in den Kamin und ließ die Flammen auflodern, dass eine kleine Rauchwolke über das Brett trieb. Wieder bewegte sich das Herz, diesmal noch deutlicher als zuvor. Es zeigte auf einen Buchstaben, dann auf den nächsten und den übernächsten. John las die Buchstaben laut vor.
»P-A-I-T-I-T-I.«
Dann blieb das Herz stehen.
»Paititi? Ist das ein Name? Ein Wort? Was hat das zu bedeuten?«
Nun begann sich das Herz schneller zu bewegen und John hatte Mühe, die Wörter nicht nur zu buchstabieren, sondern auch zu verstehen.
»Das geht zu schnell«, sagte er. »Langsamer. Und, bitte, welche Sprache soll das sein? Ich kenne sie nicht.« Schließlich schrie er: »Hören Sie! Wer immer Sie auch sind, welche Sprache ist das?«
Das Herz hielt für einen Moment inne und bewegte sich dann langsam weiter.
»M-A-N-C-O-C-A-P-A-C. Mancocapac? Ich spreche leider kein Mancocapac. Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich kann es leider nicht.«
Normalerweise hätte Johns Wunsch, Mancocapac sprechen zu können, völlig ausgereicht; schließlich war er ein Dschinn. Er hatte sich einmal gewünscht, Deutsch sprechen zu können, in Berlin, und gleich darauf festgestellt, dass er es tatsächlich konnte. Doch die alte Ifrit-Fessel, die auf Nightshakes lag, sorgte dafür, dass sein Wunsch unerfüllt blieb und er im Hinblick auf das, was sein unsichtbarer Gesprächspartner ihm mitteilen wollte, leider kein bisschen schlauer war.
Das Herz auf dem Brett begann zu vibrieren.
»Ich glaube, jetzt hast du ihn verärgert«, sagte Grace.
Im nächsten Moment flog das kleine Herz in den Kamin, als habe es ein starker unsichtbarer Zeigefinger dorthin geschnippt. Und als John das antike Herz eilig aus dem Feuer fischte, hob irgendetwas das Ouija-Brett hoch und schleuderte es durchs Zimmer, dass es gegen das Fenster krachte und eine der dreizehn Scheiben zu Bruch ging. Das Holzfeuer reckte sich dem neuen Luftzug entgegen. Dicker Qualm drang aus dem Kamin ins Zimmer und schien einem unsichtbaren Etwas Gestalt zu geben. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte John etwas, das aussah wie ein Mann mit den längsten Ohrläppchen, die er je gesehen hatte. Der Mann trug einen dicken Pony, der ihm fast die Augen bedeckte, und einen Federmantel, der ihn wie einen riesigen Pfau aussehen ließ. Dann verschwand der Mann aus seinem Blickfeld, jedoch nicht aus dem Zimmer, denn irgendetwas riss sämtliche Schubladen aus der sechseckigen Lackkommode und schleuderte Mr Vodyannoys Ouija-Bretter allesamt auf den Boden. Einen Moment später flog das Fenster auf und der Geist – denn um einen solchen handelte es sich Johns Meinung nach zweifellos – verschwand in die stürmische Nacht.
»Er ist weg«, sagte Grace. »Ein Glück, wenn du mich fragst. Das Zimmer so zu verwüsten … Was für eine Unverschämtheit.«
John legte den Finger auf die Lippen, denn etwas blieb zurück, das sich in den Schatten des Schattensaals verbarg. Etwas, das vorher nicht da gewesen war.
Es klang wie Donnergrollen. Oder vielleicht wie ein sehr großer Mann, der nach einem schweren Mittagessen schnarchte. Ein sehr großer Mann mit mächtigen Kiefermuskeln und spitzen Zähnen. Ein sehr großer Mann, der mehr Katze als Mensch war. John spürte, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten, als er begriff, dass es weniger nach einem sehr großen Mann als nach einer sehr großen Katze klang. Einer mit geflecktem Fell. Wie jene, die er im Trophäenzimmer gesehen hatte. Das Knurren kam näher, und nun konnte er eindeutig eine katzenartige Gestalt erkennen, die sich aus einer Ecke des Zimmers anschlich.
»Was ist das?«, fragte Grace und schluckte. »Ein Schaf?«
»Das ist ganz bestimmt kein Schaf, du verrückte Hexe«, flüsterte John.
»Was ist es dann?«
John gab keine Antwort. Doch er wusste nun, mit welcher Art Katze er es zu tun hatte. Es war ein südamerikanischer Jaguar oder Otorongo. Er war groß und sehr muskulös, etwa einen Meter achtzig lang und gut und gern zweihundert Pfund schwer.
»Ist das auch bestimmt kein Schaf?«
Es heißt, Adrenalin könne einen von einem Stier verfolgten Mann in die Lage versetzen, in einem Satz über ein Tor zu springen, oder ein Kind befähigen, einen schweren Gegenstand von einem verletzten Elternteil herunterzuheben. So erging es nun auch John, nur dass dieser ein Dschinn war, die, wie jeder weiß, aus Feuer gemacht sind. Ohne nachzudenken, tat er, was sein Überlebensinstinkt ihm eingab. Er griff in die lodernden Flammen, packte ein brennendes Holzscheit und stieß es der auf ihn losgehenden Raubkatze ins aufgerissene Maul. Das Gebrüll des Otorongos verwandelte sich in durchdringendes Jaulen und die riesige Katze wich vor dem Feuer in Johns Hand zurück. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse und taxierte John mit funkelnden Augen, als wollte sie abschätzen, ob es klug war, jemanden mit Feuer in der Hand ein zweites Mal anzugreifen. Dann schien sie sich eines Besseren zu besinnen, spannte sich an wie die Sehne einer Armbrust und sprang aus dem Fenster.
John stieß einen Stoßseufzer aus und warf das Holzscheit ins Feuer zurück. »Mann, das war knapp«, sagte er.
»Komisches Schaf«, sagte Grace.
»Ja, nicht wahr«, sagte John, der es sinnlos fand, länger auf diesem Punkt herumzuhacken.
Grace packte Johns Hand und betrachtete sie erstaunt. »Man sieht ihr nicht das Geringste an«, sagte sie. »Kein Brandmal. Gar nichts. Nicht mal ein Schmutzfleck.«
John betrachtete seine Hand und stellte ein wenig verwundert fest, dass Grace recht hatte: Sie war völlig unversehrt.
»Du bist kein Mensch«, sagte Grace fast triumphierend.
John lächelte und es war ihm ausnahmsweise fast egal, ob ein Mensch wusste, wer und was er war. »Nein«, sagte er. »Das bin ich nicht.«
Ein wenig furchtsam ließ Grace seine Hand fallen. »He«, sagte sie. »Sag bloß nicht, dass du wirklich tot bist.«
»Nein«, sagte John. »Ich bin nicht tot. Ich bin ein Dschinn.«
»Ist das so etwas Ähnliches wie ein Schaf?«
»Ja. Es ist genau wie ein Schaf. Aber warum interessieren Sie sich so für Schafe?«
»Weil ich selbst eines bin. Und nicht nur das. Ich bin sogar ein verlorenes Schaf. Und ich warte immer noch darauf, dass mein Bruder Bo kommt und mich wiederfindet. Genau wie in der Bibel.«
John, den ihre Worte sehr anrührten, überredete Grace, mit ihm ins Anrichtezimmer zurückzukehren, wo Bo außerordentlich froh darüber war, seine Schwester wiederzusehen.
»Ich fürchte, im Saal der Schatten herrscht ein ziemliches Durcheinander, Bo«, sagte John. »Die Ouija-Bretter sind überall verstreut. Aber ich dachte mir, dass es besser ist, Grace auf dem schnellsten Weg hierherzubringen, als vorher noch aufzuräumen.«
»Bitte, überlass das mir.« Bo umarmte Grace, die nun zu weinen begann, als begreife sie erst jetzt, was ihr widerfahren war. »Ich bin dir sehr dankbar und stehe für immer in deiner Schuld. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann …« Und mit diesen Worten küsste er John dankbar die Hand.
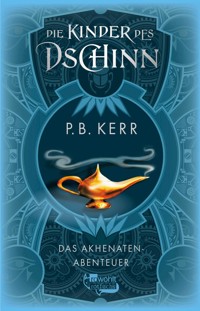
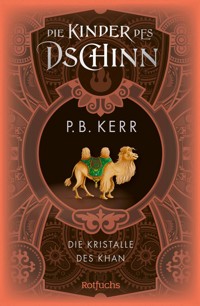
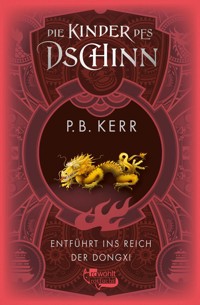
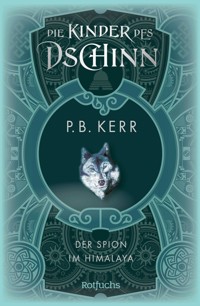
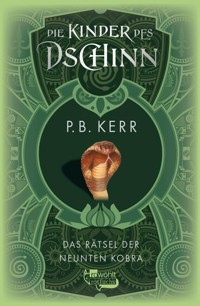
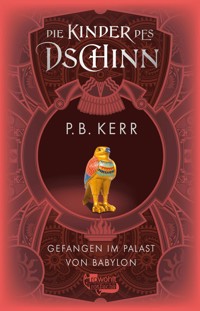













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









