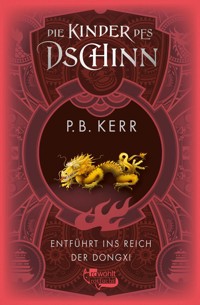
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kinder des Dschinn
- Sprache: Deutsch
Jade, Schwertkämpfer und eine zum Leben erweckte Terrakotta-Armee ... Überall auf der Welt verschwinden Jadeschätze aus den Museen. John und Philippa sind sofort alarmiert, als sie hören, dass asiatische Schwertkämpfer in den Diebstahl verwickelt sein sollen. Dieselben unheimlichen Kämpfer sorgen nämlich auch in der Dschinnwelt für Angst und Schrecken. In China bestätigt sich ein Verdacht: Jemand hat die Terrakotta-Armee des Kaisers Qin zum Leben erweckt. Und noch viel gefährlicher als die sogenannten Dongxi ist das düstere Geheimnis, das sie in ihrer Jade-Pyramide bewachen. Der vierte Band der phantastischen Reihe um die Dschinn-Kinder von Bestsellerautor Philip Kerr
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
P. B. Kerr
Die Kinder des Dschinn: Entführt ins Reich der Dongxi
Über dieses Buch
Überall auf der Welt verschwinden Jadeschätze aus den Museen. John und Philippa sind sofort alarmiert, als sie hören, dass asiatische Schwertkämpfer in den Diebstahl verwickelt sein sollen. Dieselben unheimlichen Kämpfer sorgen nämlich auch in der Geisterwelt für Angst und Schrecken. In China bestätigt sich ein Verdacht: Jemand hat die Terrakotta-Armee des Kaisers Qin zum Leben erweckt. Und noch viel gefährlicher als die sogenannten Dongxi ist das düstere Geheimnis, das sie in ihrer Jadepyramide bewachen.
Das vierte spannende Abenteuer der »Kinder des Dschinn«.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
P. B. Kerr wurde 1956 in Edinburgh/Schottland geboren. Er studierte Jura an der Universität Birmingham und arbeitete zunächst als Werbetexter, bis er sich einen Namen als Autor, u. a. von Krimis und Thrillern für Erwachsene, machte. Viele seiner Bücher wurden internationale Bestseller, etliche mit großem Erfolg verfilmt. Für seine Arbeit wurde er u. a. zweimal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Als freier Schriftsteller lebte der Vater von drei Kindern bis zu seinem Tod in einem Vorort von London. »Das Akhenaten-Abenteuer« war sein erstes Kinderbuch und der Start der Reihe »Die Kinder des Dschinn«. Die Filmrechte daran hat sich Hollywoods Star-Regisseur Steven Spielberg gesichert.
Für Charlie und Naomi Kerr
Methusalem
Bevor sie von New York in den Irak abreiste, um ihr neues Amt als Blauer Dschinn von Babylon anzutreten, hatte Layla Gaunt, der mächtigste Dschinn der Welt, ihren Mann Edward mit einer Methusalem-Fessel belegt. Sie wollte damit verhindern, dass ihre Kinder John und Philippa ihr folgten. Methusalem ist der älteste in der Bibel erwähnte Mensch. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, er sei neunhundertneunundsechzig Jahre alt geworden und dann gestorben. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man genauer darüber nachdenkt. Heutzutage gilt jeder, der über hundert Jahre alt wird, schon als ungewöhnlich betagt und erhält zumindest in England, wo solche Dinge noch eine Rolle spielen, ein Glückwunschtelegramm von Ihrer Majestät der Königin. Wie nicht anders zu erwarten, lässt eine Methusalem-Fessel einen Menschen in kürzester Zeit rapide altern.
Mrs Gaunt hätte ihren Ehemann einem solchen Schicksal normalerweise niemals ausgesetzt. Sie hatte ihre Dschinnfessel so konstruiert, dass sie nur in Abwesenheit der Zwillinge wirksam werden würde. Mit anderen Worten, Mr Gaunt wäre niemals im Schnelldurchlauf gealtert, wenn seine Kinder zu Hause gewesen wären. Mrs Gaunts Fessel hatte die Zwillinge lediglich davon abhalten sollen, ihr nach Babylon hinterherzureisen. Zu dem Zeitpunkt, als sie die Dschinnfessel schuf, wusste Mrs Gaunt allerdings nicht, dass die beiden Gestalten, die sie für ihre Zwillinge hielt, in Wirklichkeit nur deren perfekte Imitate waren, geschaffen von einem Engel namens Afriel, damit niemand merkte, dass die echten Kinder in Nepal und Indien in ein Abenteuer verstrickt waren. Als die Zwillinge endlich wieder nach Hause in die East 77th Street in New York zurückkehrten, war ihr armer Vater schon ein uralter Mann.
»Tattrig« beschreibt nicht einmal annähernd, wie er bei ihrem Wiedersehen aussah. Er wirkte altersschwach, greis, abgezehrt, prähistorisch und ein bisschen wie ein lebendes Fossil. Menschen – denn im Gegensatz zu seiner Frau und seinen Kindern war Edward Gaunt ein Irdischer, das heißt ein ganz gewöhnlicher Sterblicher und kein Dschinn –, die so alt aussehen, wie er es tat, befinden sich für gewöhnlich schon im Innern eines Sarges. An den Rollstuhl gefesselt, weil seine spindeldürren Beine inzwischen zu schwach waren, um ihn zu tragen, und mit einem karierten Schal um den Hals, der ihn vor der Kälte des New Yorker Frühlings schützen sollte, fiel es schwer, Mr Gaunt mit dem liebevollen Vater in Verbindung zu bringen, den die Zwillinge gekannt hatten. Ja, im Grunde wirkte er kaum noch wie ein Mensch, sondern eher wie etwas aus einem knisternden alten Horrorfilm – natürlich in Schwarz-Weiß und wahrscheinlich mit dem unheimlichen Boris Karloff in der Hauptrolle.
Sein Haar war sehr fein und spröde und schlohweiß, als habe eine kranke Spinne es gewebt. Seine Zähne waren extrem lang und gelb, wie die Tasten eines uralten Klaviers. Seine kraftlosen Hände zitterten und waren von kleinen braunen Altersflecken bedeckt. Seine wässrigen grauen Augen glichen zwei Austern. Seine pfeifende Flüsterstimme klang wie ein Heizkörper, aus dem abgestandene Luft entweicht. Und es ließ sich nicht leugnen, dass er roch wie ein blühender Weißdorn: ziemlich streng, muffig und nach Verwesung. Genau wie die Pest in London, wie die englischen Landbewohner im Mittelalter zu sagen pflegten.
John fand, sein Vater sehe aus wie achtzig. In Wirklichkeit jedoch war er mehr als dreimal so viel gealtert. Noch genauer gesagt, war er so stark gealtert, dass er schon jetzt so aussah, wie er mit zweihundertundfünfzig Jahren aussehen würde. Mr Gaunt war ohne Zweifel der am ältesten wirkende Mensch seit Methusalem.
Nimrod, ein weiterer mächtiger Dschinn und der Onkel von John und Philippa, war der Ansicht, dass Mr Gaunts Fessel nicht weiterwirken würde, solange sich die Zwillinge in der Nähe ihres Vaters aufhielten. »Nach einer Weile«, sagte er, »wird sich die Fessel umkehren und euer Vater wird sich wieder verjüngen. Da bin ich ganz sicher. Wichtig ist nur, dass ihr bei ihm bleibt, hier in New York. Und ich werde natürlich auch bei euch bleiben, statt nach London zurückzufliegen.«
Mr Rakshasas, ein weiterer Dschinn und mit seinen mindestens einhundertundfünfzig Jahren ebenfalls schon recht betagt – Dschinn leben nämlich wesentlich länger als Menschen –, teilte Nimrods Auffassung, dass sich die Fessel umkehren würde. Aus dem Innern der antiken Messinglampe, in der er lebte und die Nimrod mitgebracht hatte, riet er den beiden, die Dschinnärztin Jenny Sacstroker zu konsultieren. »Bestimmt«, sagte er mit seinem sanften irischen Akzent, »kann sie euch sagen, wie sich einige der unangenehmeren Folgen der Fessel auf euren armen Vater abschwächen lassen. Für alte Männer gibt es kein besseres Heilmittel als die Pflege einer jungen Frau.«
Doch Jenny Sacstroker konnte nicht kommen und riet Nimrod am Telefon, die Dienste einer Dschinnpflegerin namens Marion Morrison in Anspruch zu nehmen. »Sie ist Eremitin«, erklärte Mrs Sacstroker. »Eine der Dschinn, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, verdienten Menschen Glück zu bringen. Sie hat sich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, die das Opfer böser Dschinnfesseln wurden oder ungünstige Wünsche geäußert haben. Ich werde ihr eine Nachricht zukommen lassen, aber das kann ein wenig dauern. Ich glaube, sie ist im Amazonasgebiet und hilft einigen unglückseligen Indianern, die verflucht wurden.«
»Es ist ziemlich dringend, Jenny«, beharrte Nimrod.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Mrs Sacstroker. »Aber ich muss im Augenblick bei Dybbuk bleiben.« Dybbuk war ihr aufsässiger Dschinnsohn, ein Freund von John und Philippa. »Er braucht mich, Nimrod. Besonders jetzt, wo er herausgefunden hat, wer sein richtiger Vater ist.«
Jenny Sacstroker war ein guter Dschinn. Und Dybbuk war es auch. Zumindest bisher. Doch vor Kurzem hatte der arme Kerl herausgefunden, dass sein richtiger Vater Iblis war, der bösartigste Dschinn der Welt und Kopf der Ifrit, dem bösesten der insgesamt sechs Stämme der Dschinn. Unter den guten Dschinn herrschte die aufrichtige Besorgnis, dass sich Dybbuk, sofern man nicht behutsam mit ihm umging, leicht auf die Seite des Bösen schlagen könnte.
»Verstehe«, sagte Nimrod. »Reden wir nicht mehr davon, meine Liebe. Dybbuk geht natürlich vor, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich werde hier in New York auf Marion Morrison warten.«
Bis zum Eintreffen der Dschinnpflegerin war die Familie darauf angewiesen, Mr Gaunt der Obhut ihrer treuen Haushälterin Mrs Trump anzuvertrauen. In der Voraussicht, dass diese mit der Pflege von Mr Gaunt alle Hände voll zu tun haben würde, beschloss Nimrod, seinen englischen Butler Groanin kommen zu lassen.
»Armer alter Groanin«, sagte Philippa. »Hat er nicht eine Abneigung gegen New York?«
»Er hasst die Stadt abgrundtief«, erwiderte Nimrod. »Aber das lässt sich nicht ändern. Ich denke, Mrs Trump hat seine Hilfe bitter nötig.«
Mrs Trump, eine ehemalige Schönheitskönigin, war eine treue Seele und reich dazu. Im vergangenen Jahr hatte sie den Lottojackpot des Staates New York geknackt und mehrere Millionen Dollar gewonnen. Sie ahnte immer noch nicht, dass sie ihr Glück einem dahingesagten Wunsch verdankte, den Philippa gehört und natürlich erfüllt hatte. Trotz ihres Reichtums blieb Mrs Trump den Gaunts weiterhin eine treue Bedienstete. Besonders am Herzen lagen ihr die Kinder und die hinreißende Mrs Gaunt. Ihre Ergebenheit gegenüber Mr Gaunt war nicht ganz so ausgeprägt. Obwohl sie nicht wusste, dass der Rest der Familie Dschinn waren, schien sie instinktiv zu ahnen, dass er nicht besser war als sie selbst. Infolgedessen stellten die seltsamen Marotten des vorzeitig gealterten Mannes ihre Geduld bald auf eine harte Probe, wie sie Nimrod und den Kindern erklärte:
»Er ist wirklich anstrengend«, gestand sie am Ende eines sehr langen Tages, an dem das Klingeln einer großen Messingglocke sie nicht weniger als siebenundsiebzig Mal ans Bett des alten Mannes gerufen hatte. Das war mehr als dreimal die Stunde. »Manchmal hat er schon wieder vergessen, was er von mir will, wenn ich oben in seinem Zimmer ankomme. Und kaum bin ich gegangen, fällt ihm wieder ein, was es war, und er läutet erneut. Ich bin völlig erschöpft, das kann ich Ihnen sagen.«
»Arme Mrs Trump«, sagte John.
Er und seine Schwester hatten versucht, Mrs Trump bei der Pflege ihres zunehmend streitlustiger werdenden Vaters zu helfen, doch der alte Mann wollte sich nur von ihr versorgen lassen. Das lag daran, dass er weiterhin beharrlich daran glaubte, die Haushälterin sei seine Frau Mrs Gaunt. Und tatsächlich gab es einige Übereinstimmungen zwischen den beiden Frauen. Besonders in letzter Zeit. Seit dem Gewinn ihres Vermögens und mithilfe einiger Ratschläge von Mrs Gaunt war Mrs Trump wesentlich attraktiver geworden. Sie hatte einen Zahnarzt aufgesucht und ihren fehlenden Zahn ersetzen lassen. Sie hatte aufgehört zu rauchen. Außerdem hatte sie ein wenig abgenommen und ging nun fast ebenso regelmäßig zum Friseur und zur Maniküre wie Mrs Gaunt selbst. Außerdem zog sie sich schöner an. Alles in allem war Mrs Trump eine ziemlich attraktive Frau geworden. Trotzdem fehlten ihr nach wie vor Mrs Gaunts außergewöhnliche Ausstrahlung und Persönlichkeit.
Nicht dass Mr Gaunt, der kaum noch hören und sehen konnte, das bemerkte. Und niemand ahnte, dass diese Verwechslung dem einfachen Zufall geschuldet war, dass Mrs Trump das gleiche unverkennbare Parfüm trug wie Mrs Gaunt: La Chassed’Eau von Rita de Villalobos. Der Geruchssinn des alten Mannes funktionierte nämlich tadellos. Daher nannte er sie »Darling« oder »Liebes« und manchmal auch »Baby« und bestand darauf, dass sie seine Hand hielt, damit er ihr hin und wieder den sabbernden Mund auf den süßlich duftenden Handrücken pressen konnte, um anschließend sein nur allzu offensichtliches Unglück zu beweinen.
Mrs Trump war diese Situation peinlich. Mr Gaunts seltsamer Zustand und sein Benehmen waren für sie nur deshalb entschuldbar, weil sie Nimrods Erklärung akzeptierte, dass er an einer seltenen, aber heilbaren genetischen Krankheit leide, ebenso wie seine Versicherung, dass bald eine Extrapflegerin eintreffen werde, um sich um den alten Mann zu kümmern. Es war ein Glück, dass seltsame Begebenheiten in der East 77th Street Nummer 7 für sie nichts Neues waren. Tatsächlich kam es im Haus der Gaunts so häufig zu seltsamen Ereignissen, dass ihr viele davon gar nicht mehr seltsam vorkamen.
»Diese Pflegerin kann gar nicht schnell genug hier eintreffen«, meinte Mrs Trump am Ende eines weiteren langen Tages. »Wenn es morgen genauso zugeht wie heute, werde ich selbst eine Pflegerin brauchen.«
Sie ahnte nicht, wie sehr sie mit diesen Worten recht behalten sollte. Am nächsten Morgen schaffte es der ungeschickte Mr Gaunt, die Perlenkette zu zerreißen, die Mrs Trump unter ihrem Overall trug. Die Kette stammte von Mifanwy an der Fifth Avenue. Sie war aus ziemlich großen, teuren Südseeperlen gefertigt und Mrs Trumps Lieblingsstück, was erklärte, warum sie sie niemals ablegte, nicht einmal beim Staubsaugen oder Toilettenputzen.
Mrs Trump kroch auf allen vieren über den Schlafzimmerboden und sammelte fast alle Perlen wieder auf. Jedoch waren drei unter der Tür hindurch auf den Treppenabsatz hinausgerollt, wo Mrs Trump Minuten später auf sie trat, ausrutschte und mit solchem Gepolter die Treppe hinunterstürzte, dass es sich anhörte, als stürze ein ganzes Gebäude ein.
John und Philippa rannten in den Flur und fanden Mrs Trump ohnmächtig auf dem Boden. Sie hatte eine üble Schwellung am Kopf und ihr Atem ging schnell und flach wie der eines Hamsters. Nimrod rief einen Krankenwagen und man brachte Mrs Trump in das nur einen Block entfernte Kildare Hospital an der 78th Street. Dort wurde sie geröntgt und anschließend operiert, um ein Blutgerinnsel im Gehirn zu entfernen. Doch sie blieb auch nach der Operation weiter bewusstlos. Das Gesicht ihres Chirurgen, Doktor Saul Hudson, war so düster und Unheil verkündend wie der Friedhof von Salem, als er Nimrod und den Zwillingen gegenübertrat.
»Wir mussten Mrs Trump viel Blut aus dem Gehirn saugen«, sagte er leise. »Wir haben eine sogenannte Kraniotomie vorgenommen und getan, was wir konnten. Jetzt liegt es an ihr, ob sie wieder gesund wird. Im Moment reagiert sie auf keinerlei Reize. Und je länger sie bewusstlos bleibt, desto mehr Sorgen macht es mir. Es tut mir leid, dass ich keine erfreulicheren Nachrichten habe.«
»Können wir sie sehen, Dr. Hudson?«, fragte John.
»Natürlich.«
Dr. Hudson führte sie an Mrs Trumps Bett und ließ sie dann allein. Mrs Trumps Kopf war jetzt dick bandagiert und ihr Gesicht hatte die Farbe von Vulkanasche. Sie lag in einem Einzelzimmer mit Plasmafernseher und Blick auf den Garten der Gaunts. Lange Zeit sagte niemand ein Wort.
»Ich finde es schön, dass man von hier aus unser Haus sehen kann«, sagte Philippa schließlich. »Das würde Mrs Trump gefallen.«
»Ganz bestimmt«, pflichtete Nimrod ihr bei.
»Können wir denn gar nichts für sie tun?«, fragte John seinen Onkel. »Ich meine, mit Dschinnkraft.«
»Ich fürchte, nein«, sagte Nimrod. »Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte. Gehirne sind überaus komplexe Gebilde, von denen auch Dschinn lieber die Finger lassen sollten. Damit hat es bei Frankenstein auch angefangen.«
»Wenn doch nur Mom hier wäre«, sagte Philippa. Sie sah Nimrod mit einem schiefen Lächeln an. »Das soll nicht heißen, dass ich glaube, du könntest mit all dem nicht fertig werden, Onkel Nimrod. Das kannst du bestimmt. Aber sie fehlt mir einfach und es würde mir viel besser gehen, wenn sie jetzt bei uns wäre.«
»Bei meiner Lampe, da geht es mir wie dir«, sagte Nimrod. »Deine Mutter, meine Schwester, ist eine überaus patente Frau.« Er sagte nichts von dem noch halb fertigen Plan, seine Schwester nach New York zurückzuholen und sie seinem Neffen und seiner Nichte zurückzugeben.
Die Zwillinge blieben am Bett von Mrs Trump, hielten ihre Hand und sprachen mit ihr. Sie blieb bewusstlos. Nimrod leistete ihnen Gesellschaft und gab sich alle Mühe, den Kindern zuliebe optimistisch zu wirken, was Mrs Trumps Chancen auf eine völlige Genesung anging. Doch er wusste ebenso gut wie sie, dass es um ihre Haushälterin nicht gut stand. Nach einer Weile ging John ans Fenster. Als er über den kleinen Krankenhausgarten in seinen eigenen Garten hinüberblickte, glaubte er, am Schlafzimmerfenster seines Vaters eine Bewegung auszumachen. Und ein oder zwei Sekunden später die Umrisse einer Gestalt hinter einem der darunterliegenden Fenster.
»Seltsam«, sagte er. »Wir haben Dad doch im Bett zurückgelassen. Er kann unmöglich herumlaufen, oder?«
Nimrod trat zu ihm ans Fenster. »Hast du etwas gesehen?«
»Irgendetwas oder irgendjemanden«, sagte John. »Sonst ist niemand zu Hause. Es sei denn, man zählt Monty mit.« Monty war ihre Katze. Eine ziemlich ungewöhnliche Katze, die viele Jahre lang ein weiblicher Mensch namens Monica Retch gewesen war, bis Mrs Gaunt sie verwandelt hatte. »Aber ich glaube nicht, dass es Monty war.«
»Ich hoffe, es ist alles in Ordnung«, sagte Philippa. »Ich glaube nicht, dass ich im Augenblick noch eine Katastrophe verkraften kann.«
»Wir sollten lieber nach Hause gehen«, meinte Nimrod. »Wir können hier ohnehin nichts tun.«
Statt einer weiteren Katastrophe fanden sie zu Hause Mr Groanin vor, der in der Küche Silber polierte und Tee kochte. Seit er einen zweiten Arm erhalten hatte (Groanin hatte lange Zeit nur einen besessen), hatte er sich angewöhnt, immer zwei Dinge gleichzeitig zu tun; zum Beispiel zwei Kinder an seinen stattlichen Bauch zu drücken statt nur eines.
»Ich bin heute Morgen angekommen«, erklärte er. »Die Haustür war unverschlossen. Also habe ich mir erlaubt, hereinzukommen und mich nützlich zu machen, wie Sie sehen.«
Die Zwillinge waren begeistert, Groanin bei sich zu haben. Er mochte der mürrischste Butler sein, der jemals ein Teetablett oder einen Staubwedel in die Hand genommen hatte, aber irgendwie schaffte er es immer, die Kinder aufzuheitern.
»Es ist schön, euch beide wiederzusehen«, sagte er mit seinem dröhnenden Manchester-Akzent. »Wirklich schön. Auch wenn die Umstände alles andere als erfreulich sind. Die Mutter lässt euch sitzen und macht sich über alle Berge. Euer armer alter Vater sieht aus wie ein altersschwacher Orang-Utan. Und die bedauernswerte Mrs Trump vegetiert im Krankenhaus vor sich hin. Teufel auch! Mit so viel Schlamassel am Hals könntet ihr eure eigene Klapsmühle aufmachen.«
Die Zwillinge zuckten zusammen, als Groanin mit diesen Worten wie mit einem Paar Nagelschuhen auf ihren wunden Gefühlen herumtrampelte. Trotzdem wussten sie, dass der Butler das Herz auf dem rechten Fleck hatte, auch wenn sein Mundwerk manchmal woanders zu sein schien.
»Wenn das Sprichwort ›Aller guten Dinge sind drei‹ auch für das Gegenteil gilt, müsste das Unglück jetzt ein Ende haben«, sagte er. »Ich hoffe wirklich, dass es ein Ende hat. Damit ihr mich mit eurem Pech nicht ansteckt.«
»Seien Sie still, Groanin«, sagte Nimrod.
»Sie haben leicht reden, Sir. Aber ich war noch nie ein großer Glückspilz. Ich möchte nicht wieder einen Arm verlieren, bei einem Autounfall zum Beispiel. Oder ein Bein. Und das kann in einer Stadt wie dieser, mit so vielen Verrückten am Steuer, leicht passieren. Warum die Taxis hier ›Yellow Cabs‹ heißen, ist mir ein Rätsel. Bei dem Fahrstil wird doch jeder grün vor Angst.«
Philippa setzte ein Lächeln auf und umarmte Groanin noch fester, in der Hoffnung, seinen wilden Gedankenfluss unterbrechen zu können.
»Danke, dass Sie gekommen sind, Mr Groanin«, sagte sie.
»Nichts zu danken, Miss«, sagte er. »Ich hatte ohnehin nichts Besseres zu tun. Und City liefert derzeit auch nicht die besten Spiele.« Manchester City war Groanins Lieblingsfußballmannschaft.
»Immer noch der Alte«, sagte John.
Kurz darauf läutete es an der Tür und Groanin, durch und durch Butler, band sich die Schürze ab, schlüpfte in sein Jackett und glitt davon, um zu öffnen.
»Da ist eine amerikanische Person, die Sie sprechen möchte«, sagte er, als er ebenso elegant zurückkehrte. »Eine etwas ungewöhnlich aussehende Dame, die meint, sie werde erwartet und ihr Name sei Miss Marion Morrison. Ich glaube zumindest, dass sie das gesagt hat. Die Aussprache der Menschen in diesem Land ist, gelinde gesagt, sonderbar. Um nicht zu sagen unverständlich.«
»Da sprechen Sie ein wahres Wort gelassen aus«, sagte Nimrod. »Am besten führen Sie die Dame ins Bibliothekszimmer.«
Marion Morrison war in der Tat ungewöhnlich. Sie war eine große, dicke alte Frau mit rauer Stimme und grauen Knopfaugen, die sie unabhängig voneinander bewegen konnte, sodass sie in zwei Richtungen gleichzeitig zu sehen imstande war. Das war auch gut so, da sie mit ihrem kaum vorhandenen Hals und einem Brust- und Bauchumfang von der Größe zweier abgefahrener LKW-Reifen ihre Füße seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ihr kurzes rötlich graues Haar hatte Ähnlichkeit mit rostiger Drahtwolle. Sie trug ein rotes T-Shirt, gebleichte Hosen, Lederweste und Cowboystiefel. In der einen Hand hielt sie ein gewaltiges Bohnensandwich und in der anderen einen Steingutbecher mit dampfendem schwarzem Kaffee.
»Tag! Sie müssen Nimrod sein«, sagte sie, das eine Auge auf die Zwillinge gerichtet. »Und ihr müsst John und Philippa Gaunt sein«, sagte sie dann, das andere Auge auf Nimrod gerichtet. »Hab schon viel von euch gehört. Hauptsächlich Gutes.« Nach einem geräuschvollen Schluck Kaffee fügte sie hinzu: »Hab mir Abendessen gemacht. Hoffe, das stört euch nicht. War den ganzen Tag mit einem Wirbelsturm hierher unterwegs und bin ein bisschen durch den Wind.«
»Hatten Sie einen guten Flug?«, erkundigte sich Philippa höflich.
»Angekommen bin ich, oder?« Marion Morrison grinste und biss herzhaft in ihr Sandwich. »Mehr kann man nicht verlangen, denke ich.«
Zu Groanins größtem Entsetzen quollen mehrere Saubohnen aus ihrem Sandwich und fielen auf den teuren Bibliotheksteppich; außerdem wirkten ihre Cowboystiefel ziemlich schmutzig für jemanden, der den ganzen Tag in einem Wirbelsturm verbracht hatte. Neben der Tür lagen ihr zusammengerolltes Bettzeug und ein Paar Satteltaschen, als sei sie gerade vom Pferd gestiegen.
»Jenny Sacstroker sagte uns, Sie seien eine Dschinnpflegerin«, sagte Nimrod.
»Für Dschinn vielleicht«, erwiderte die merkwürdige Gestalt. »Für Menschen bin ich weit mehr als das. Ärztin, Heilerin, Medizinfrau, das haben mich die Irdischen alles schon genannt.« Mit lautem Schlürfen leerte sie ihren Becher und schüttete den Kaffeesatz ins Feuer. »Und wo ist der Patient? Wenn er einen Methusalem abbekommen hat, arbeitet die Zeit gegen uns, also machen wir uns an die Arbeit!«
Nimrod und die Zwillinge führten ihre merkwürdige Besucherin die Treppe hinauf, die auf dem Weg zu Mr Gaunts Zimmer den letzten Rest ihres großen Sandwichs vertilgte. Beim Betreten des Zimmers hielt sie die Hände in die Höhe wie eine Chirurgin vor dem Waschbecken und sekundenlang huschte eine kleine blaue Flamme knisternd über ihre Finger, während sie ein kleines Quantum Dschinnkraft aus ihrem Körper entweichen ließ, um Schmutz und Bakterien auf ihren Händen abzutöten. Die Flamme war kräftig genug, um ihr die Hemdsärmel anzusengen.
John, der das noch nie gesehen hatte, blieb der Mund offen stehen.
»Was ist, Junge?«, fragte sie. »Noch nie gesehen, wie sich jemand die Pfoten wäscht?«
»Äh, nicht mit Dschinnkraft«, sagte er.
»Jedenfalls besser als mit Wasser und Seife«, sagte sie. »Hab Wasser auf der Haut noch nie leiden können. Passt irgendwie nicht zu einem Dschinn, sich mit Wasser abzugeben, wenn du mich fragst.« Während sie ihr dickes Hinterteil auf Mr Gaunts Bett pflanzte, musterte sie diesen mit freundlichem Blick. »Hallo, alter Knabe«, sagte sie.
Mr Gaunt starrte kurzsichtig an seiner neuen Pflegerin vorbei ins Leere. »Wer ist da?«, fragte er und hielt sich die zittrige Hand an sein riesiges behaartes Ohr. »Wie?«
»›Wie?‹ sagt er oft«, erklärte Philippa. »Er ist ein bisschen schwerhörig.«
»Wie?«, sagte Mr Gaunt.
»Sehen Sie?«
»Mmh. Und sehen kann der alte Knabe auch nicht gut.«
»So alt ist er eigentlich noch gar nicht«, sagte John. »Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, Mrs Morrison. Er ist eigentlich erst fünfzig. Das ist alt genug für einen Menschen, nehme ich an. Aber so alt nun auch wieder nicht. Jedenfalls nicht so alt, wie er aussieht. Und normalerweise ist er auch nicht so streitlustig wie im Moment. Für einen Vater ist er wirklich sehr, sehr nett.«
Das eine Auge auf ihren Patienten gerichtet, nahm die Dschinnpflegerin mit dem anderen John ins Visier und lächelte anerkennend. »Nett von dir, dass du das sagst«, sagte sie. »Der Mann kann froh sein, einen Jungen wie dich zu haben. Tatsache ist, auch ausgewachsene Männer brauchen Güte und Verständnis. Übrigens heißt es nicht Mrs und auf keinen Fall Marion. Also nenn mich am besten M. oder Doc.«
»Wie?«, sagte Mr Gaunt.
»Und jetzt erzählt mir alles über die Fessel«, sagte sie.
Nimrod klärte sie über die Beschaffenheit und das Timing der Fessel auf und über die Tatsache, dass die Kinder diese eigentlich hatten aufhalten sollen. Doc hörte ihm zu und steckte Mr Gaunt dann den kleinen Finger in ein Ohr und einen anderen in ein Nasenloch, um seine Temperatur zu messen. Ihr zweites Auge wanderte zu einem Bonsai hinüber, der am anderen Ende des Zimmers auf einer Kommode stand. Es war ein knapp siebzig Zentimeter hoher japanischer Ahornbaum.
»Ich vermute, er wird zwei bis drei Monate brauchen, um wieder ganz auf die Beine zu kommen«, sagte sie. »Bis dahin können wir nur die schlimmsten Symptome des Alters abschwächen. Ist der Bonsai da drüben ein echtes Exemplar aus Fernost oder nur so ein Mistding aus dem Katalog?«
»Er ist wirklich echt«, sagte Philippa. »Dad hat ihn Mom zum Geburtstag geschenkt. Er hat ihn in Hongkong gekauft.«
Marion stand auf und sah sich den Baum näher an. »Die Erde stammt also hundertprozentig aus China?«
»Ich denke schon«, sagte Philippa. »Interessieren Sie sich für Bonsaibäume?«
»Nein«, sagte Marion. »Kann die Dinger nicht ausstehen.«
Sie holte ein wenig Erde aus dem Topf, roch daran, steckte sie in den Mund, spuckte sie wieder aus und nickte dann. Im nächsten Augenblick riss sie das jahrhundertealte Bäumchen aus seinem Topf und warf es in die Ecke.
»He«, sagte Philippa. »Der Baum hat zwanzigtausend Dollar gekostet.«
»Ich glaub nicht, dass die Größe des Geldbeutels was mit der Größe des Gehirns zu tun hat.« Marion spuckte auf eine Handvoll Erde und erhitzte die Mixtur in ihren Händen mit Dschinnkraft, um daraus eine Art Paste zu machen, die sie Mr Gaunt auf die Augenlider schmierte.
»Wie?«
»Das wird seine Sehkraft ein bisschen aufpeppen«, erklärte sie. »So, dass er Zeitung lesen und fernsehen kann.«
Den Rest der Paste erhitzte sie abermals in den Händen, bis sie sich in feinen Puder verwandelte. Diesen pustete sie Mr Gaunt in die behaarten Gehörgänge und in die Nasenlöcher.
»Damit wird er wohl wieder Radio hören können.«
»Wie?«
Marion grinste. »Dauert noch ’ne Minute.«
»Wie funktioniert das?«, wollte Philippa wissen.
»Dschinnspucke«, sagte Marion. »Sie enthält Heilkraft. Jedenfalls für Menschen. Mit chinesischer Erde vermischt, wird daraus eine mächtige Substanz, in der jede Menge vermeintlich übersinnliche Kräfte stecken.« Marion grinste. »War ein echter Glücksfall, hier einen Bonsai zu finden. Mir geht die chinesische Erde langsam aus.« Sie hob den Blumentopf auf und schüttete die restliche Erde in einen Plastikbeutel, den sie aus ihrer Hüfttasche zog. »Den Rest packe ich in meine Satteltaschen, wenn ihr nichts dagegen habt. Als Vorauszahlung auf mein Honorar.«
»Davon habe ich noch nie gehört«, sagte Nimrod. »Von Dschinnspucke und Erde.«
»Haben Sie noch nie von Adam gehört?«, sagte Marion.
»Adam?«
»Ein Typ aus der Bibel, der aus Ackererde gemacht wurde. Das bedeutet auch der Name: ›Der von der Erde Genommene‹.«
Nimrod nickte. »Ja, natürlich«, sagte er.
»Du bist nicht Layla«, sagte Mr Gaunt zu Marion. Anscheinend hatte sich seine Sehkraft bereits erheblich verbessert.
»Nur die Ruhe, alter Knabe«, sagte Marion. »Ich bin eine Heilerin. Wir versuchen, Sie wieder auf die Beine zu bekommen.«
»Was ist mit seinem Geruch?«, fragte John. »Können Sie da auch was machen, wo Sie gerade dabei sind?«
»John!«, rief Philippa aus. »Also wirklich. Wie kannst du über deinen eigenen Vater so etwas sagen.«
»Aber es stimmt doch«, beharrte John. »Er riecht komisch. Als ob im Kühlschrank etwas schlecht wird.«
»Der Junge hat ganz recht, Schwester«, sagte Marion. »Du hast eine scharfe Nase, John.«
John zuckte die Achseln. »Eigentlich nicht«, sagte er. »Es ist eher ein scharfer Geruch.«
»Vielleicht kümmere ich mich morgen um seinen Geruch. Und um ein paar andere Sachen auch noch. Im Moment bin ich einfach fix und fertig.«
»Vielleicht könnten Sie auch Mrs Trump heilen«, sagte Philippa und beeilte sich, ihr zu erklären, was ihrer geliebten Haushälterin zugestoßen war.
»Mrs Trump?«, sagte Mr Gaunt. »Warum? Was ist mit ihr passiert? Und wo ist meine Frau? Wo ist Layla?«
»Reg dich nicht auf, Dad«, sagte John zu seinem Vater. »Bleib ruhig liegen. Die Dame ist da, um dir zu helfen.«
»Ich schau morgen früh mal bei ihr vorbei und sehe sie mir an«, sagte Doc zu Philippa. »Aber so ein Gehirn hat’s in sich.«
Als sie Mr Gaunts Schlafzimmer verließ, bückte sich Marion und hob etwas vom Boden auf. Es war eine Perle. Sie betrachtete sie einen Moment, und ehe jemand sie aufhalten konnte, steckte sie die Perle in den Mund und zermalmte sie wie eine Nuss, was ein menschliches Gebiss niemals zustande gebracht hätte.
»Sie essen Perlen?«, sagte John.
»Na klar«, erwiderte Marion. »Ist gut für dich, wenn du ein Dschinn bist. Die Vereinigung von Feuer und Wasser. ›Das dritte Auge‹ sagen einige dazu. Auf jeden Fall sind sie einer der acht Schätze. Eine Perle ist die Kristallisation des Lichts, transzendentes Wissen, spirituelles Bewusstsein und der Inbegriff des Universums.« Sie grinste. »Außerdem schmecken sie gut.«
Am gleichen Abend, nachdem Marion und Groanin ins Bett gegangen waren, und nach einem langen Gespräch mit Mr Rakshasas rief Nimrod die Kinder in die Bibliothek. »Wir haben die Sache besprochen«, erklärte er, »und wir glauben, dass es vielleicht einen Weg gibt, eure Mutter zurückzuholen.«
Er trug wie gewöhnlich einen roten Anzug und saß neben Mr Rakshasas, der einen weißen anhatte, sodass die beiden Dschinn aussahen wie die Flagge von Indonesien, die, wie jeder weiß, aus einem roten Streifen oben und einem weißen Streifen unten besteht. Oder vielleicht wie die Flagge von Polen, die einen weißen Streifen oben und einen roten Streifen unten hat. Die beiden saßen sehr nahe am Feuer – fast zu nah –, aber da sie Dschinn waren, die aus Feuer gemacht sind, fühlten sie sich dort natürlich so wohl wie zwei Scheiben heißer Buttertoast.
»Wie denn das?«, fragte Philippa, die es fast aufgegeben hatte, darauf zu hoffen, ihre Mutter jemals richtig wiederzusehen. Wie sie nur allzu gut wusste, musste man sich, um der Blaue Dschinn von Babylon zu werden, jenseits von Gut und Böse stellen und nur noch den kalten Regeln der Logik folgen, wie ein staubtrockener Mathelehrer. Nur auf diese Weise, so glaubte man, könne der Blaue Dschinn als oberster Richter sowohl über die drei guten Stämme der Dschinn als auch über die drei bösen Stämme herrschen. Und nur auf diese Weise, so wurde allgemein angenommen, konnte zwischen beiden Seiten ein Gleichgewicht der Macht existieren. Philippa, die plötzlich alles verschwommen sah, nahm ihre Brille ab und begann wie wild die Gläser zu polieren. Allein der Gedanke an ein Wiedersehen mit ihrer Mutter trieb ihr die Tränen in die Augen.
»Wohlgemerkt, das ist bislang nur eine Idee«, sagte Mr Rakshasas, der trotz seines indischen Turbans und des langen weißen Barts so irisch klang wie ein irischer Dudelsack hinter den beschlagenen Scheiben des McDaid Pubs in der Dubliner Harry Street. »Es hat keinen Zweck, sich falsche Hoffnungen zu machen. Nicht, bis wir mit ihm geredet haben. Und mit ihr natürlich auch. Was vermutlich kein Zuckerschlecken werden wird.«
»Mit ›ihm‹?«, wiederholte John. »Mit ›ihr‹? Wen meinen Sie damit? Könnten Sie mal Klartext reden, Mr Rakshasas?«
»Dybbuk«, sagte Nimrod. »Und seine Schwester Faustina. Wir brauchen ihre Hilfe.«
»Aber hat Faustina nicht irgendwo in England ihren Körper verloren?«, fragte Philippa. »Nachdem du ihren Geist aus dem Premierminister vertrieben hast?«
»So ungefähr«, sagte Nimrod. »Als Guru Masamjhasara oder Dr. Warnasukulasuriya, wie er damals noch hieß, dem Premierminister eine Blutprobe entnahm, hinderte er Faustina damit unwissentlich daran, ihren Körper wieder in Besitz zu nehmen. Zumindest nicht ohne die Hilfe eines anderen Dschinn. Ein winziger Teil ihres Geistes ging mit dieser Blutprobe unwiederbringlich verloren.«
»Dann verstehe ich nicht, wie sie uns helfen kann«, sagte Philippa.
»Ich auch nicht«, sagte John.
»Wenn wir ihren Geist irgendwie mit ihrem Körper wieder vereinen könnten«, erklärte Nimrod, »besteht die Aussicht, dass sie anstelle eurer Mutter der Blaue Dschinn wird.«
»Es war immer vorgesehen, dass Faustina eines Tages der Blaue Dschinn werden sollte«, sagte Mr Rakshasas. »Sie war die Auserwählte. Das Wunderkind. Aber natürlich machte die Tatsache, dass sie ihren Körper verlor, dem Ganzen einen gehörigen Strich durch die Rechnung.«
»Aber geht das denn?«, sagte Philippa. »Ihren Körper und ihre Seele wieder zu vereinigen?«
»Nun ja«, sagte Nimrod. »Vorausgesetzt, man weiß, wo man nach der Seele suchen muss. Und das wusste ich nicht, bis du es mir gesagt hast, Philippa.«
»Ich?«
»Hast du mir nicht erzählt, dir hätte auf Bannermann’s Island ein unsichtbares Mädchen ins Ohr geflüstert?«
Auf Bannermann’s Island, im Hudson River in New York, lebte Dybbuks Tante Felicia in prachtvoller, aber nichtsdestotrotz unheimlicher Zurückgezogenheit.
»Ja«, sagte Philippa. »Jedenfalls einen Moment lang. Und ich habe gespürt, wie etwas an mir vorüberglitt. Wie schwebende Spinnfäden. Willst du damit sagen, dass Faustinas Geist dort herumschwebt?«
»Als Dybbuk in Gefahr war, ist er nach Bannermann’s Island geflohen, weil er sich dort sicher fühlte«, überlegte John. »Ich wette, Faustina ging es genauso. Dort hängt sogar ihr Porträt über dem Kamin.«
»Aber ich dachte, wenn man sich zu lange außerhalb seines Körpers befindet, riskiert man, ins All abzudriften«, sagte Philippa. »Das hast du uns jedenfalls in Ägypten erzählt.«
»Das stimmt«, bestätigte Nimrod. »Aber nur, wenn du keinen Ort findest, der dir vertraut ist. Eine geistige Heimstatt, sozusagen. Wenn man einen solchen Ort hat, kann es endlos so weitergehen. Und für Faustina wäre das zweifellos ein Ort wie Bannermann’s Island.«
»Dann müssen wir also nichts weiter tun, als nach Bannermann’s Island zu fahren und ihren Geist mit ihrem Körper wiederzuvereinen«, sagte Philippa.
»Das ist nicht ganz so leicht, wie es sich anhört«, meinte Mr Rakshasas.
»Das war mir irgendwie klar«, stöhnte John.
»Jemand muss sich dafür in transsubstantiiertem Zustand in die Welt der Geister begeben«, sagte Nimrod. »Diese Person muss ihren eigenen Körper zurücklassen und durch ein Portal auf die andere Seite hinübergehen, um mit Faustina zu reden.«
»Welche Art von Portal?«, fragte Philippa.
»Das Portal eines alten Tempels«, sagte Nimrod. »Aus Ägypten oder Babylon oder von einem Tempel der Maya. Das ist der Zweck, für den sie ursprünglich gebaut wurden.«
»Ich glaube, ein ägyptischer Tempel wäre am besten«, sagte Mr Rakshasas. »Dann hätten wir auch gleich einen Ka-Diener, der sich um sämtliche finsteren Gestalten kümmern kann, die uns vielleicht begegnen.«
»Und wer soll das tun?«, fragte John.
»Es muss jemand in ihrem Alter sein, dem Faustina vertraut«, sagte Nimrod.
»Dybbuk«, sagte John.
»Ja«, meinte Nimrod. »Das war auch mein Gedanke.«
»Er wird es tun«, sagte John. »Er muss es tun. Schließlich ist Faustina seine Schwester.«
»Vielleicht«, sagte Mr Rakshasas und seufzte. »Aber wir werden ihn behutsam davon überzeugen müssen. Auf einem unbekannten Pfad geht jeder Fuß langsam.«
»Natürlich wird er es tun«, beharrte John. Und er beschloss, Mr Rakshasas ausnahmsweise einmal auf dessen Weise zu antworten, mit einer Redewendung: »Schließlich ist Blut dicker als Wasser.«
»Ja«, sagte Mr Rakshasas in einem Tonfall, der John verriet, dass er sich keineswegs sicher war. »Honig ist süß, aber es braucht viel Mut, ihn von einem Bienenstock zu lecken.«
»Mr Rakshasas hat recht, John«, sagte Nimrod. »Wir werden den armen Jungen mit Samthandschuhen anfassen müssen. Dybbuk hat den Schock über die Entdeckung, wer und was er ist, noch nicht überwunden. Aber uns bleibt nicht viel Zeit. In weniger als dreißig Tagen ist es für Faustina zu spät, um den Platz eurer Mutter einzunehmen. Ich werde heute Nacht noch abreisen und morgen mit ihm sprechen.«
Es lag John auf der Zunge, vorzuschlagen, dass es besser wäre, wenn er Nimrod begleitete. Schließlich war er mit Dybbuk befreundet und dieser gehörte nicht zu den jungen Dschinn, die sich von einem älteren vorschreiben ließen, was sie zu tun und zu lassen hatten. Selbst von einem so umgänglichen älteren Dschinn wie Nimrod. Doch dann fiel ihm sein Vater und die Methusalem-Fessel wieder ein.
»Einverstanden«, sagte Nimrod, der zwar keine Gedanken, aber durchaus lesen konnte, was im Gesicht eines Jungen geschrieben stand. »Es könnte von Vorteil sein, dich dabeizuhaben, weil es unserer Sache mehr Gewicht verleiht.«
»Gruppenzwang funktioniert immer am besten«, sagte Philippa.
John schüttelte den Kopf. »Aber wie soll das gehen?«, fragte er Nimrod. »Phil und ich müssen hierbleiben, oder nicht? Sonst fängt Dad wieder an zu altern.«
»Es gibt vielleicht eine Möglichkeit«, sagte Mr Rakshasas, der als Autor des Badgad-Regel-Kompendiums ein Experte war für das, was ein Dschinn tun oder nicht tun konnte. »Eine Posse Commodata. Das bedeutet die Weitergabe von Dschinnkraft. Die meisten Dschinn scheuen sich, einem anderen Dschinn ihre Kräfte auszuleihen, da es ein ungewöhnliches Maß an Vertrauen erfordert. Aber ich denke, bei Zwillingen sollte das kein Problem sein. Die Fessel reagiert lediglich auf die Anwesenheit der Dschinnkraft. Nicht auf deinen Körper, John.«
»In Ordnung«, sagte John. »Und was muss ich tun? Wie übertrage ich Phil meine Kräfte?«
»Sei keine Gans, die es eilig hat, zum Fuchsbau zu kommen, junger Mann«, sagte Mr Rakshasas. »Man überträgt nicht mir nichts, dir nichts einem anderen Dschinn seine gesamte Dschinnkraft. Außerdem ist eine Posse Commodata nicht nach jedermanns Geschmack. Vorher wie nachher. Die einzige Art, wie ein Dschinn einem anderen seine Kraft leihen kann, besteht darin, ihm das zu geben, was die Irdischen einen Kuss des Lebens nennen würden.«
»Um genau zu sein«, sagte Nimrod, »haben wir sie damit auf diese Idee gebracht.«
»Ich soll meine eigene Schwester küssen?«, rief John und verzog angewidert das Gesicht. »Das ist nicht euer Ernst. Nicht für allen Tee in China würde ich sie küssen.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit, lieber Bruder«, sagte Philippa kühl. »Nicht für alle milden Gaben dieser Welt würde ich dich küssen.«
»Und ich würde dich nicht küssen, selbst wenn dein Vorname Dorn und dein Nachname Röschen wäre«, setzte John nach.
»Ein Prinz bist du jedenfalls nicht. Das steht fest.«
Nimrod und Mr Rakshasas schwiegen und ließen den Zwillingen Zeit, ihrem Abscheu und ihrer Empörung Luft zu machen. Sie wussten ebenso wie die Kinder selbst, dass sie es trotz aller Beschimpfungen würden tun müssen. Als John und Philippa nach einer Weile aufhörten, sich gegenseitig anzuschreien und Grimassen zu schneiden, sahen sie zu den beiden älteren Dschinn hinüber und schämten sich ein wenig über diesen Ausbruch jugendlicher Bockigkeit.
»Tut mir leid«, sagte John.
»Mir auch«, sagte Philippa. »Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist.«
»Wenn ihr älter werdet«, sagte Mr Rakshasas, »werdet ihr lernen, dass die Stille der Zaun ist, der das Feld der Weisheit umgibt.« Er lächelte milde. »Ihr müsst lernen, im Leben die kleinen Kartoffeln mit den großen hinzunehmen.«
»Was muss ich tun?«, fragte John gefasst, wenn auch nicht ganz sicher, dass er verstanden hatte, was Mr Rakshasas gemeint hatte.
»Vielleicht ist es am besten, du stellst dir vor, Philippa wäre ertrunken«, sagte Nimrod. Er wies Philippa an, sich auf den Boden zu legen, und befahl John dann, ihr die Nase zuzuhalten. »Und jetzt, John, holst du tief Luft und drückst deinen Mund auf ihren, als wolltest du ihr das Leben retten. Dann lässt du deinen Atem in sie hineinfließen, bis ich ›Stopp‹ sage.«
»Ich hoffe, du hast dir die Zähne geputzt«, sagte Philippa.
John sah Nimrod an und hob die Augenbrauen, als wolle er ihn bitten, diese neuerliche Provokation zur Kenntnis zu nehmen.
»Mach schon, du Idiot«, sagte Philippa und schloss die Augen.
Immer noch die Hand an Philippas Nase und bemüht, ihr nicht in den Mund zu seufzen, beugte sich John über sie.
Sobald er den Kuss beendet hatte, rollte sich Philippa zur Seite, wischte sich mit dem Unterarm über den Mund und spuckte mehrmals auf den Teppich. »Bäh, wie ekelhaft! Als würde man ein Neunauge küssen.«
Nimrod hatte es den Kuss des Lebens genannt, aber für John fühlte es sich genau umgekehrt an. Der Widerwille darüber, seinen Mund auf den seiner Schwester gepresst zu haben, wurde schnell von dem schrecklichen Gefühl irdischer Gewöhnlichkeit abgelöst. Es war, als sei ein kleiner Teil von ihm gestorben. Er stand auf, setzte sich aber gleich wieder hin und hielt sich den Kopf. »Was ist ein Neunauge?«, fragte er flüsternd.
»Ein kieferloser Fisch«, erwiderte Philippa unbarmherzig, »mit einem tunnelartigen Saugmaul und Hornzähnen. So ähnlich wie ein Aal.«
John grinste müde.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Nimrod den Jungen.
»Kaputt«, sagte John.
»Und du, Philippa«, fragte Nimrod. »Wie fühlst du dich?«
»Entschieden stärker«, sagte sie. »Als hätte ich mich gerade am Stromnetz aufgeladen und danach eine extrastarke Tasse Kaffee getrunken.«
»Ich glaube, es hat funktioniert«, sagte Nimrod.
»Fühlt es sich so an, ein Mensch zu sein?«, fragte John.
»Wie fühlt es sich denn an?«, wollte Philippa wissen und legte ihm in schwesterlicher Sorge die Hand auf die Schulter, wobei sie einige der Gemeinheiten, die sie zu ihm gesagt hatte, bereits bereute.
»Als wäre ich beim New-York-Marathon gerade Letzter geworden und hätte unterwegs etwas sehr, sehr Wertvolles verloren. Einen Arm oder ein Bein. Man könnte meinen, ich hätte mir einen Virus eingefangen.«
»Ja, man vermisst das Wasser immer erst, wenn der Brunnen versiegt«, sagte Mr Rakshasas.
»Scheint so«, meinte John. Er holte tief Luft und stand auf. »Wann reisen wir ab?«
»Auf der Stelle«, sagte Nimrod. »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Sie verließen das Haus und gingen in den Central Park von New York, der so spät in der Nacht wie ausgestorben dalag. Dort entfesselte Nimrod auf einer Lichtung einen kräftigen, aber unsichtbaren Wirbelsturm, der lediglich an einer weggeworfenen Zeitung zu erkennen war, die am unteren Ende des Wirbels durch die Luft sauste. Innerhalb von Sekunden begannen er und John auf dieser Luftsäule aufzusteigen, als habe man ihnen aufgetragen, vor einem himmlischen Gericht zu erscheinen. Philippa und Mr Rakshasas sahen ihnen nach, bis sie etwa fünfzehn Meter über dem Boden schwebten, wo Nimrod den Windtrichter nach Westen ausrichtete und sie mit einer Geschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern in der Nacht über Manhattan verschwanden.
Verwirrspiele
Dybbuk wollte seinen richtigen Vater treffen.
Das ist doch normal, oder etwa nicht? Auch wenn Iblis der bösartigste Dschinn der Welt ist, bin ich trotzdem sein Sohn. Was soll falsch daran sein, dass ich ihn treffen will? Jedes Kind will seinen Alten Herrn kennenlernen, selbst wenn er eine Art Monster ist.
Gleichzeitig jedoch wusste er, dass seine Mutter, Jenny Sacstroker, so etwas niemals erlauben würde. Zum einen hatte sie Angst vor Iblis. Das hatten die meisten vernünftigen Leute. Zum anderen würde sie befürchten, dass eine Begegnung mit Iblis Dybbuk verleiten könnte, selbst bösartig zu werden.
Ich weiß wirklich nicht, was sie sich für Gedanken macht. Ich bin schließlich kein schlechter Kerl, so wie er. Eigentlich bin ich sogar ein ziemlich anständiger Kerl. Natürlich schlage ich hin und wieder über die Stränge. Welcher Junge tut das nicht? Aber deshalb bin ich noch lange nicht schlecht. Vielleicht würde es Iblis helfen, sich zu bessern, wenn er mich kennenlernt. Womöglich ist er deshalb so schlecht geworden, weil er mich nie um sich hatte.
Dybbuk wusste, wo sein Vater zu finden war. Jeder Dschinn wusste, dass die Ifrit – und nicht die Mafia, wie die meisten Menschen glaubten – Las Vegas kontrollierten. Und Las Vegas lag nicht allzu weit von Palm Springs entfernt, wo Dybbuk lebte. Er musste einfach nur hinfahren. Doch wie sollte er es fertigbringen, seine Mutter zu überreden, ihn gehen zu lassen? Seit seiner Rückkehr aus Indien ließ sie ihn nicht mehr aus den Augen. Und was noch schlimmer war, sie hatte ihn einen Eid schwören lassen, dass er keine Wirbelstürme entfachen und auf eigene Faust irgendwo hinfliegen würde. Er saß fest.
Dybbuk musste immer lachen, wenn er in der Schule andere Kinder berichten hörte, ihre Eltern hätten ihnen »Ausflüge« und andere Vergnügungen gestrichen, als ob das etwas zu bedeuten hätte. Im Gegensatz zu ihnen musste er auf echte Ausflüge verzichten. Natürlich hätte er jederzeit einen Bus nach Las Vegas nehmen können, doch für so etwas war Dybbuk viel zu faul. Er hasste Busse. Fürchtete sich sogar ein wenig vor ihnen und den stinkenden, streitlustigen Dickwänsten, die häufig damit fuhren. Und dann war da noch die Platzangst, die ihn in Bussen befiel. Das kommt bei Dschinn häufig vor, die, abgesehen von ihrer eigenen Lampe, geschlossene Räume nicht ausstehen können.
Also blieb Dybbuk zu Hause und heckte einen Plan aus, der ihn auf legalem Weg nach Las Vegas bringen würde.
Es gab Zeiten, da konnte Dybbuk mit seiner Mutter spielen, als wäre sie eine Gitarre. Er wusste, wie er sie anzufassen hatte, wie er sie stimmen und ihr über die Saiten streichen musste, um ihr die Töne zu entlocken, die er hören wollte. Und er wusste genau, wie er sie dazu bringen konnte, so zu reagieren, wie sie es immer tat. Also lief er durchs Haus mit einem Gesicht wie drei Tage Regenwetter, sprach kaum ein Wort und starrte vor sich hin. Seine Mutter backte ihm seinen geliebten Currykuchen, ließ ihn nicht jugendfreie DVDs anschauen, gab ihm sein Taschengeld und kaufte ihm sogar ein neues Spiel für die Playstation. Trotzdem zog er weiter ein Gesicht. Schließlich knickte sie ein. Sie riss ihm eine Schale Frühstücksflocken aus der Hand, die er statt ihres Kuchens gegessen hatte, und pfefferte sie gegen die Küchenwand.
»Dybbuk!«, schrie sie. Nur wenn sie stocksauer war, benutzte sie seinen richtigen Namen, statt ihn Buck zu nennen, was ihm lieber war. »Gleich reißt mir die Geduld. Ich habe dir einen Kuchen gebacken und ein Spiel gekauft. Und du siehst immer noch aus wie das heulende Elend. Gibt es denn gar nichts, was dich aufheitern kann?«
Jetzt hab ich sie.
»Kann ich denn gar nichts tun, was dich wieder zum Lächeln bringt?«
Er nickte. »Doch«, sagte er. »Ich will nach Las Vegas.«
Misstrauisch kniff Jenny Sacstroker die Augen zusammen. »Vegas? Was willst du denn dort? Für das Glücksspiel bist du noch zu jung und für die Tour durch die Schokoladenfabrik zu alt. Außerdem setzt kein guter Dschinn einen Fuß in die Stadt, ohne sich sehr in Acht zu nehmen. Du weißt, dass die Ifrit die Stadt beherrschen.«
»Vergiss es«, stöhnte Dybbuk, gab einen Laut wie ein Fagott von sich und verdrehte die Augen.
»Nein, nein«, sagte sie. »Wenn es dich glücklich macht, fahren wir nach Las Vegas. Sag mir einfach, warum du dort hinwillst. Sind es die Lichter?«
»Ich hasse die Lichter«, sagte Dybbuk. »Sie sind kitschig und blöd.«
»Warum dann?«
»Ich will Adam Apollonius sehen.«
Adam Apollonius war der berühmteste Illusionist und Magier von ganz Amerika. Er hatte eine ausverkaufte Show im Winter Palace Hotel von Las Vegas, eine Spätabendshow im Fernsehen und er hatte ein Bestsellerbuch und eine ebenso erfolgreiche DVD herausgebracht. Außerdem war er der Urheber mehrerer werbewirksamer öffentlicher Stuntnummern, wie des berühmten Entfesselungsakts aus einer Zwangsjacke während eines Fallschirmsprungs oder der Ersteigung des Sears Towers in Chicago mit verbundenen Augen, bei der er lediglich ein 450 Meter langes Seil und ein Paar Lederhandschuhe zu Hilfe genommen hatte. Sein Poster hing in Dybbuks Zimmer.
»Ich verstehe nicht, was dich daran fasziniert«, sagte seine Mutter. »Du weißt, dass das alles nur Illusion ist. Jeder normale Dschinn kann diese Zaubertricks wirklich vollbringen.« Sie murmelte ihr Fokuswort – mit dem die Dschinn ihre Kräfte bündeln –, und schon hielt sie einen Strauß Blumen in der Hand. Einen echten Blumenstrauß, nicht die billigen Plastikrequisiten wie in einer Zaubervorstellung. »Siehst du? Wir können so etwas von Natur aus. Also, was findest du an dem Kerl?« Sie ließ die Blumen wieder verschwinden.
»Keine Ahnung.« Dybbuk gähnte. »Wahrscheinlich sieht es bei ihm einfach cooler aus als bei dir.«
»Recht herzlichen Dank.«
»Außerdem gefällt es mir, dass es nur eine Illusion ist. Einfach nur ein Trick. Wie du gesagt hast, wir können es wirklich tun. Und das macht die ganze Sache irgendwie banal. Aber er macht eine richtige Show daraus und kein großes Geheimnis, so wie wir.«
»Du weißt, warum wir es geheim halten«, sagte Jenny Sacstroker. »Es ist nur zu unserem Schutz.«
Dybbuk gähnte noch mehr. »Ja, ich weiß.« Er zuckte mit den Achseln. »Hör mal, du wolltest wissen, was mich glücklich macht, und ich hab es dir gesagt. Aber es ist okay. Vergiss es einfach, ja?«
»Nein, wir fahren hin«, willigte sie ein. »Vielleicht wird es trotzdem ganz lustig.«
Dybbuk gratulierte sich zu seinem gelungenen Plan.
Ich werde mich wohl kaum in Las Vegas aufhalten können, ohne dass mein Vater davon weiß. Er wird mich garantiert aufstöbern. Schließlich will ich gar nicht, dass er irgendetwas tut. Ich will nur mit ihm reden. Und ein paar Stunden mit ihm zusammen sein.
Er lächelte.
»Das gefällt mir schon viel besser«, sagte Dybbuks Mutter. »Ich will einfach nur das, was dich glücklich macht, mein Schatz.«
Iblis hatte immer damit gerechnet, dass sein jüngster Sohn irgendwann in Las Vegas auftauchen würde. Seit Jahren hatte er es kommen sehen, wenn auch vielleicht nicht ganz so schnell. Und es war ein Glück für Iblis – und damit natürlich Pech für den Rest von uns –, dass Dybbuk und seine Mutter in der Welthauptstadt des Glücksspiels auftauchten, kurz nachdem Iblis von einem Paar schwarzer Dschinn-Tiger angefallen worden war. Angefallen und derartig zugerichtet, dass er seinen bisherigen Körper verlassen und sich einen neuen suchen musste. Mit dieser drögen Aufgabe war Iblis gerade beschäftigt, als er plötzlich die Gegenwart seines Sohnes spürte – genau in dem Moment, als Dybbuk auf dem McCarran International Airport aus dem Flugzeug stieg und die Wüstenrollbahn betrat. Auch das war ein glücklicher Zufall für Iblis. In seiner menschlichen Gestalt hätte er die Gegenwart des Jungen vielleicht niemals wahrgenommen. Dschinn sind in körperlicher Gestalt für kosmische Vibrationen weniger empfänglich.
Mit Lichtgeschwindigkeit schoss Iblis durch die trockene Luft von Nevada, wie eine unsichtbare Bombe auf dem Weg zu ihrem ahnungslosen Ziel. Er fand den Jungen und seine Mutter vor der Gepäckausgabe und erkannte Jenny Sacstroker in ihrem scharlachroten, mit Rheinkieseln besetzten Hosenanzug sofort. Der Junge war groß, gut aussehend und besaß offensichtlich Charisma. Genau wie sein Vater, sagte sich Iblis geschmeichelt. Er brauchte nur wenige Sekunden, um von Dybbuks Geist Besitz zu ergreifen und die Geheimnisse seines jungen Herzens zu ergründen. Mit einem düsteren, ätherischen Lächeln wurde dem gasförmigen Iblis klar, dass ein brillanter Plan, der seit dreizehn Jahren auf seine Ausführung wartete, augenblicklich in Aktion treten konnte.
So schnell, wie er von Dybbuks Körper Besitz ergriffen hatte, war Iblis auch wieder verschwunden, ehe Jenny Sacstroker oder Dybbuk selbst auch nur bemerkten, dass der Geist des bösen Dschinn in ihrer Nähe gewesen war.
»Was ist los?«, fragte sie Dybbuk. »Du warst für einen Moment völlig weggetreten.«
»Wirklich?«
»Ja. Ich hatte dich gebeten, den Koffer zu nehmen, aber es war, als hättest du mich gar nicht gehört.«
»Hab ich auch nicht. Meine Ohren … Mir macht der Flug immer noch zu schaffen. Ich hasse Flugzeuge fast ebenso sehr wie Busse.«
»Das geht vorbei. Nimm noch eine Platzangsttablette.«
»Ich verstehe immer noch nicht, warum wir überhaupt mit dem Flugzeug gekommen sind statt in einem Wirbelsturm.«
»Jetzt sind wir ja da, nicht? Also hör auf, dich zu beklagen. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen, indem wir Dschinnkräfte einsetzen. In dieser Stadt wimmelt es von Ifrit, und wenn sie merken, dass wir Dschinnkräfte einsetzen, können wir schnell in Schwierigkeiten geraten. Klar?«
»Okay, okay.«
Sie nahmen ein Taxi zum Winter Palace Hotel und mieteten sich eine Zwei-Zimmer-Suite auf dem Dach des Hotels mit spektakulärem Blick über Las Vegas. Nach dem Abendessen sahen sie die Show von Adam Apollonius von den besten Plätzen des Hauses. Apollonius war ein großer, hagerer Mann mit einem kleinen Kinnbart, einem Ohrring und jeder Menge Tattoos. Jenny Sacstroker fand, er habe das Aussehen und die Sprechweise eines englischen Fußballstars. Und damit lag sie gar nicht so falsch. Adam Apollonius, dessen richtiger Name Alan Appleton war, stammte aus Schottland, was von England nicht sonderlich weit entfernt liegt, und hatte für den schottischen Fußballverein Celtic Glasgow gespielt, ehe ihn eine Verletzung zwang, den Sport gegen eine Karriere als professioneller Magier einzutauschen.
Die Show bestand aus zwei Teilen. In der ersten Hälfte ließ Apollonius alle möglichen Bären – Eisbären und Grizzlybären – an verschiedenen Stellen des Zuschauerraums auftauchen und wieder verschwinden. Außerdem verwandelte er sich selbst in einen echten Silbernackengorilla und wieder zurück, ehe er sich von einem Mann mit einer gigantischen Axt enthaupten ließ, der anschließend über die Bühne marschierte und den beständig weiterredenden Kopf des Magiers spazieren trug. (Für diejenigen, die den egozentrischen Apollonius nicht mochten, war dies für gewöhnlich der schönste Teil der Show.)
Mrs Sacstroker gab sich alle Mühe, nicht gelangweilt auszusehen, doch natürlich war sie es. Im Gegensatz zu ihr wirkte Dybbuk wie verzaubert. In der Pause besorgten sie sich etwas zu trinken und Mrs Sacstroker fragte Dybbuk, ob es ihm etwas ausmache, wenn sie den zweiten Teil nicht mit ansah. In Wirklichkeit wollte sie lieber ein wenig Roulette spielen. Jenny Sacstroker spielte gern, nur wollte sie nicht, dass Dybbuk davon erfuhr. »Ich gehe heute früh ins Bett«, sagte sie.
»Macht mir nichts aus«, sagte Dybbuk, der gehofft hatte, dass seine Mutter sich rarmachen würde.
Im zweiten Teil der Show ließ Apollonius einen Elefanten von der Bühne verschwinden, was selbst in Dybbuks Augen ziemlich beeindruckend aussah. Dann erklärte Apollonius, dass er einen Freiwilligen aus dem Publikum brauche, um ihm bei seiner Spezialnummer zu helfen: dem Kugeltrick. Er bat Dybbuk auf die Bühne, was diesen natürlich begeisterte. Er liebte Waffen fast so sehr wie die Zauberei.
Der Magische Kugeltrick, bei dem eine gekennzeichnete Gewehrkugel auf den Zauberer abgefeuert wird, der sie mit den Zähnen oder auf einem Teller auffängt, ist der gefährlichste Zaubertrick überhaupt und es ist kaum überraschend, dass bereits mehr als ein Dutzend Zauberkünstler dabei ihr Leben gelassen haben. Apollonius, der grundsätzlich keine halben Sachen machte, forderte Dybbuk auf, eine Mannlicher-Carcano Kaliber .30 auf seinen Kopf abzufeuern. Dybbuk, der über diesen Trick schon einiges gelesen hatte, wusste, dass Apollonius die von ihm gekennzeichnete Kugel heimlich gegen eine Wachskugel ausgetauscht haben musste. Etwas in der Art. Doch ehe er darüber nachdenken konnte, wie Apollonius den Trick wohl ausführen würde, hatte der Zauberer das Orchester schon um einen lauten Trommelwirbel gebeten und forderte Dybbuk auf, abzudrücken.
Einen winzigen Sekundenbruchteil bevor Dybbuk den Abzug betätigte, schrie der Magier ihm zu, nicht zu schießen. Doch es war zu spät. Die Waffe ging los, Adam Apollonius schrie laut auf und wälzte sich dann auf dem Boden. Das Publikum sprang gleichzeitig von den Sitzen. Rufe und Schreie wurden laut. Jemand rannte auf die Bühne. Dybbuk ließ das Gewehr fallen und eilte auf den offensichtlich getroffenen Magier zu.
Einen Augenblick später sprang Apollonius mit triumphierendem Grinsen auf und die Gewehrkugel leuchtete zwischen seinen Zähnen. Er reichte sie Dybbuk, der bestätigte, dass es sich tatsächlich um die zuvor von ihm markierte Kugel handelte, und verbeugte sich dann unter donnerndem Applaus, der das ganze Auditorium erschütterte. Apollonius nahm Dybbuk bei der Hand und ermunterte ihn zuerst, sich ebenfalls zu verbeugen, dann lud er ihn ein, ihn in seine Garderobe hinter den Kulissen zu begleiten.
»Vorhin habe ich einen Moment lang wirklich geglaubt, ich hätte Sie erschossen«, gestand Dybbuk, als er mit seinem Helden allein war.
»Gehört alles zur Nummer«, sagte Apollonius. »Der Gedanke, dass irgendetwas schiefgegangen ist, versetzt die Meute nur noch mehr in Aufregung.«
»Die Meute?«
»Das Publikum. Sie lieben den Gedanken, ich könnte ums Leben gekommen sein.«
»Genau wie der große Houdini, was?«
»So ist es«, sagte Apollonius. »Hört sich an, als wüsstest du über die Zauberei ein bisschen Bescheid, mein Junge.«
»Houdini war der Größte«, sagte Dybbuk. »Aber Sie sind auch nicht schlecht.«
Apollonius versuchte vergeblich, ein bescheidenes Gesicht zu machen. »Und was ist mit dir, Junge? Versuchst du dich selbst auch im Zaubern?«
»Sicher.«
Angesteckt von den funkelnden Lichtern Las Vegas’ und der Spannung einer extravaganten Bühnenshow, verspürte Dybbuk den Wunsch, seinen glamourösen Gastgeber zu beeindrucken. Also entschloss er sich trotz der Warnung seiner Mutter über den Einsatz von Dschinnkräften, Apollonius etwas zu zeigen, das der Zauberkünstler vermutlich nicht für bare Münze nehmen würde. Dybbuk streckte den Arm aus und schob den Ärmel hoch, wie echte Magier es im Fernsehen taten, zeigte Apollonius erst die offene Handfläche und dann den Handrücken. Dann flüsterte er sein Fokuswort, und als er die Handfläche wieder öffnete, befand sich eine kleine Tafel Schokolade darin.
»Nicht schlecht«, sagte Apollonius.
»Dürfte ich mir Ihr Taschentuch ausleihen, Sir?«, erkundigte sich Dybbuk höflich.
Apollonius zog sein Taschentuch aus der Brusttasche und verdeckte damit, wie gefordert, die Schokoladentafel in Dybbuks Hand. Dybbuk flüsterte wieder sein Fokuswort und zog dann das Taschentuch fort, um zu zeigen, dass die Schokolade wieder verschwunden war. Apollonius begann zu klatschen.
»Wie alt bist du, Junge?«, fragte er.
»Fast dreizehn, Sir.«
»Ich glaube, das ist die beste Tischzauberei, die ich je gesehen habe«, sagte der Mann. »Und ich habe das Beste vom Besten gesehen, das kannst du mir glauben.« Er setzte sich und goss sich ein Glas Champagner ein. »Zeig mir noch etwas.«
»Mal sehen«, murmelte Dybbuk und überlegte einen Moment. »Wie wär’s mit einer kleinen Levitation?«
Er hatte im Fernsehen schon Straßenzauberer gesehen, die ein paar Zentimeter vom Boden abhoben. Der Trick wurde mit einigen extrastarken Magneten in den Absätzen der Schuhe ausgeführt. Man zog einfach einen Schuh aus, der aber am anderen haften blieb, und hob dann ein Bein an. Normalerweise schummelten die Magier noch ein bisschen mit der Kamera, sodass man von ihnen immer nur eine Körperhälfte sah. Aber irgendwie wirkte es trotzdem immer ziemlich eindrucksvoll.
Vielleicht konnte er ein wenig vom Boden abheben, wenn er unter seinen Füßen einen winzigen Wirbelsturm entfachte. Er hatte es noch nie richtig probiert, aber zu seiner eigenen Überraschung funktionierte es. Und nicht nur das, es sah überzeugender aus als alles, was er je im Fernsehen gesehen hatte. Dybbuk stieg glatte dreißig Zentimeter in die Luft und schwebte dort mehrere Sekunden lang, ehe er langsam wieder herabkam.
»Whooaa«, sagte Apollonius, der manchmal eher amerikanisch als englisch klang. »Das ist unglaublich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen Levitationstrick so gut ausführt. Wie machst du das?«
Dybbuk zuckte bescheiden mit den Achseln. »Übung«, sagte er.
»Dreizehn Jahre alt und du vollführst Tricks, für die man jahrelang üben muss. Jahrelang.« Aufrichtig beeindruckt schüttelte Apollonius den Kopf. »Was ist dein bester Trick, deine Abschlussnummer?«
»Was meinen Sie damit?«
»Mit der du die Show beendest«, erklärte Apollonius. »Der Höhepunkt deiner Vorstellung.«
In Indien hatte sich Mr Groanin direkt neben einem jungen Mann in Luft aufgelöst, weil er versehentlich einen ihm gewährten Wunsch ausgesprochen hatte. Sie hatten sich zu diesem Zeitpunkt alle in einem Korb befunden, mit dem sie eine Felswand hinaufgezogen wurden. Auf der Suche nach einer Erklärung hatte Dybbuk dem jungen Mann eingeredet, Groanin habe bloß seinen indischen Seiltrick geübt. Und zu Dybbuks größtem Erstaunen und Vergnügen hatte der dumme Kerl ihm geglaubt. Also erklärte er Apollonius nun, der indische Seiltrick sei sein bester Trick. Schließlich wurde immer wieder erzählt, dass es mit der beste Zaubertrick überhaupt sei.
»Du beherrschst den indischen Seiltrick?«
»Ja, sicher.«
»Hast du ein Seil dabei?«
»Es liegt noch im Zuschauerraum«, sagte Dybbuk. »Ich habe es unter meinem Platz liegen gelassen.« Noch während er das sagte, beförderte er mit Dschinnkraft ein Seil unter seinen Sitzplatz.
»Du bist gut vorbereitet, was?«
Sie gingen zurück auf die Bühne im inzwischen menschenleeren Zuschauerraum. Dybbuk holte das Seil und legte es, zusammengerollt wie eine schlafende Python, auf den Boden.
»Normalerweise spiele ich den Schlangenbeschwörer«, erzählte er Apollonius. »Sie wissen schon, mit Flöte und so. Aber ich glaube, die habe ich vergessen.«
»Du hast ein Seil mitgebracht, aber keine Flöte«, stellte Apollonius fest.
Doch dann, als Apollonius gerade das Seil betrachtete, beschwor Dybbuk zum Spaß auch noch eine Flöte herbei. »Mein Fehler«, sagte er, »da ist sie ja.«
»Wie hast du das gemacht?«
»Übung.«
Dybbuk setzte sich hin und begann zu spielen und ganz langsam erhob sich das Seil in die Luft. Völlig fasziniert sah Apollonius ihm zu.
»Du bist unglaublich«, sagte er, als sich das Seil straffte und zu den Scheinwerfern über der Bühne hinaufrankte. »Hast du einen Draht in diesem Seil, oder was?«
Dybbuk legte die Flöte beiseite und kletterte flink wie ein Affe das Seil hinauf. Als er fast oben war, begann er eine Transsubstantiation, die aussah, als verdecke er mit dem Rauch sein Verschwinden.
»Wo bist du?«, rief Apollonius. »Wo bist du hin?«
Dybbuk ließ das Seil auf die Bühne hinabfallen, und während Apollonius es untersuchte, lenkte er den Rauch mit seinen Atomen und Molekülen in den hinteren Teil des Zuschauerraums, wo er wieder Gestalt annahm und dem berühmten Magier dann zurief: »Hier bin ich!«
Dybbuk kam zur Bühne zurück, wo Apollonius immer noch den Kopf schüttelte. »So etwas habe ich noch nie gesehen«, sagte er. »Nicht in all meinen Jahren als Magier. Bei dir sieht der indische Seiltrick aus, als wäre er echt.«
Dybbuk grinste. Die Sache machte ihm einen Riesenspaß.
»Du hast alles, was man braucht, Junge«, sagte Apollonius. »Du bist jung, siehst gut aus, du hast mehr Talent, als ich je gesehen habe. Was hältst du von einer eigenen Fernsehshow?«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Dybbuk, dem nun klar wurde, dass er vielleicht ein wenig zu weit gegangen war.
Apollonius lachte. »Was soll das heißen, du weißt nicht? Sei nicht so bescheiden, junger Mann. Du bist ein Naturtalent. Ein Star! Und ich kann es wahr werden lassen. Glaub es mir, du könntest innerhalb kürzester Zeit das bekannteste Gesicht Amerikas sein. Ich mache dich berühmter als berühmt!«
Dybbuk schüttelte immer noch den Kopf. Seine Mutter würde ihn umbringen.
Apollonius glaubte, Dybbuk sträube sich nach wie vor aus Bescheidenheit. »Ohne Flachs. Das ist mein Ernst. Auf dich hat die Zauberbranche gewartet. Ein Magier, berühmt wie ein Popstar. Vielleicht sogar noch berühmter. Wir werden ein Vermögen verdienen. Und die Mädchen werden verrückt nach dir sein, Buck. Sie werden dich anbeten, mein Junge.«
Das ließ Dybbuk aufhorchen. »Mädchen?«
»Natürlich Mädchen. Ganze Heerscharen. Magst du Mädchen?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:
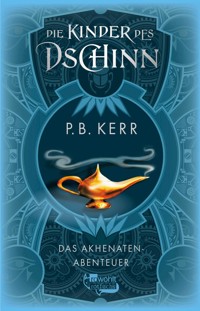
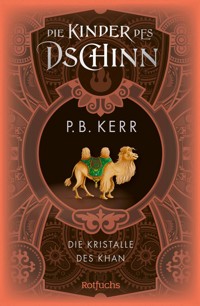
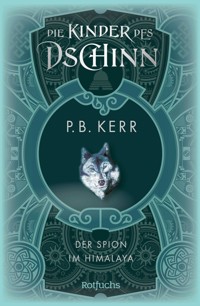
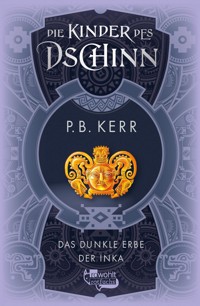
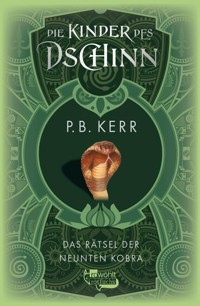
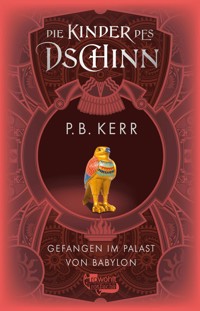













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









