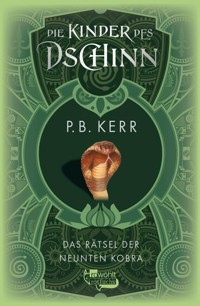
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kinder des Dschinn
- Sprache: Deutsch
Zwei Einbrecher hinterlassen ein rätselhaftes Medaillon bei John und Philippa. Es bringt die Zwillinge auf die Spur des alten Schlangenkults der Acht Kobras. Sein Anführer besaß einen Talisman, der ihm die völlige Macht über einen jungen Dschinn verlieh. Doch was bedeutet die Neun auf dem Medaillon? Um das herauszufinden, machen sich John und Philippa in Indien auf die abenteuerliche Suche nach dem vergessen geglaubten Talisman. Ein gefährliches Unterfangen, denn hinter der neunten Kobra verbirgt sich ein dunkles Geheimnis... Das dritte Abenteuer der »Kinder des Dschinn«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
P. B. Kerr
Die Kinder des Dschinn
Das Rätsel der neunten Kobra
Über dieses Buch
Zwei Einbrecher hinterlassen ein rätselhaftes Medaillon bei John und Philippa. Es bringt die Zwillinge auf die Spur des alten Schlangenkults der Acht Kobras. Sein Anführer besaß einen Talisman, der ihm die völlige Macht über einen jungen Dschinn verlieh. Doch was bedeutet die Neun auf dem Medaillon? Um das herauszufinden, machen sich John und Philippa in Indien auf die abenteuerliche Suche nach dem vergessen geglaubten Talisman. Ein gefährliches Unterfangen, denn hinter der neunten Kobra verbirgt sich ein dunkles Geheimnis...
Das dritte Abenteuer der »Kinder des Dschinn«.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
P. B. Kerr wurde 1956 in Edinburgh/Schottland geboren. Er studierte Jura und arbeitete zunächst als Werbetexter, bis er mit Krimis und Thrillern für Erwachsene international erfolgreich wurde. Auch als Autor von Kinder- und Jugendbüchern machte er sich einen Namen. DAS RÄTSEL DER NEUNTEN KOBRA ist der dritte Teil der 7-bändigen Reihe über DIE KINDER DES DSCHINN.
Dieses Buch ist für Brian Bookman
Vorwort/Anmerkung des Autors
(Für diejenigen Leser, die vielleicht vergessen haben, was sich in den ersten beiden Bänden ereignet hat.)
John und Philippa Gaunt sind zwei New Yorker Kinder, die nach der Entfernung ihrer Weisheitszähne erkennen, dass sie keine normalen Kinder sind, sondern Dschinn, wie die Flaschengeister aus Tausendundeiner Nacht. Bei Dschinnkindern kommen die Weisheitszähne, wie auch die Weisheit selbst, ungewöhnlich früh und sie zeigen an, dass die Dschinnkräfte sich zu entfalten beginnen.
Ihr Onkel Nimrod, der als mächtiger Dschinn in London lebt, nimmt sich der Erziehung der Kinder an und bringt sie nach Ägypten, wo sich Dschinnkräfte wegen der dort herrschenden Hitze besonders gut entwickeln können. Dschinn sind aus Feuer gemacht und haben für Kälte wenig übrig. Vor allem für junge, unreife Dschinn ist es schwer, mitunter sogar unmöglich, bei kalten Temperaturen ihre Dschinnkräfte einzusetzen.
Es gibt vieles, was John und Philippa über das Leben als Dschinn lernen müssen, und ihre Kräfte sind noch nicht voll ausgereift. Dennoch werden sie oft unterschätzt, da die Zwillinge gemeinsam ebenso mächtig sind wie ein erwachsener Dschinn – auch wenn man ihnen die Ähnlichkeit nicht ansieht, wie bei eineiigen Zwillingen.
Das alles erklärt, warum die beiden gemeinsam mit ihrem Onkel Nimrod verhindern können, dass Iblis, der bösartigste aller Dschinn, die siebzig vermissten Dschinn des Akhenaten für seine bösen Zwecke einspannt. Mit Hilfe der vermissten Dschinn hatte Iblis die Homöostasis, das Kräfteverhältnis zwischen den drei guten und den drei bösen Stämmen der Dschinn, aus dem Gleichgewicht bringen wollen.
Während diese Ereignisse ihren Lauf nehmen, ist Layla, die Mutter der Zwillinge und ebenfalls ein Dschinn, zu Hause darauf bedacht, sich von der Welt ihrer Artgenossen fernzuhalten. Als Ehefrau von Edward Gaunt, einem irdischen Investmentbanker, ist ihr dies bisher nicht schwergefallen, zumindest solange die außergewöhnlichen Kräfte ihrer Zwillinge noch nicht zutage getreten waren.
Doch als Philippa von Ayesha, dem Oberhaupt des Dschinnvolks, entführt wird, um zum nächsten Blauen Dschinn von Babylon gemacht zu werden, kann Layla das Schicksal ihrer Tochter nicht tatenlos hinnehmen. Der Blaue Dschinn von Babylon hat die Aufgabe, über gute wie böse Dschinn zu richten, was eine große geistige Unabhängigkeit erfordert. Außerdem verlangt diese Stellung gewaltige persönliche Opfer, weil der Blaue Dschinn verpflichtet ist, sein Heim und seine Familie aufzugeben und jenseits von Gut und Böse für sich allein zu leben.
Und so schaltet sich Layla ein, um John bei seiner unglaublich mutigen und heldenhaften Rettungsaktion in Iravotum, dem geheimen unterirdischen Reich des Blauen Dschinn in Babylon, zu unterstützen.
Bald stellt Layla fest, dass der jetzige Blaue Dschinn in Wirklichkeit nicht Philippa, sondern sie selbst zu seiner Nachfolgerin machen will. Um sicherzustellen, dass Philippa ihre restliche Kindheit genießen kann, willigt Layla ein, nach dem Tod von Ayesha anstelle ihrer Tochter der nächste Blaue Dschinn zu werden.
Man kann sich vorstellen, wie entsetzt John und Philippa sind, als sie erfahren, dass Ayesha ihre eigene Großmutter ist. Noch ahnen sie nichts von dem geheimen Pakt zwischen ihr und Layla und davon, dass die geliebte Mutter die Familie bald verlassen wird.
Auch wenn Iblis weiter ihr größter Feind bleibt, haben sie einige gute Freunde an ihrer Seite. Mr Rakshasas ist ein sehr alter Dschinn und enger Freund Nimrods, dessen eigene Dschinnkräfte langsam versiegen. Obwohl er in Indien geboren wurde, spricht er Englisch mit irischem Einschlag. Mr Groanin ist Nimrods treuer Butler aus Manchester, der nur noch einen Arm hat, weil der andere im Britischen Museum von einem hungrigen Tiger verspeist wurde. Dybbuk ist ein Dschinnjunge, der mit seiner Mutter, der Dschinnärztin Jenny Sacstroker, im kalifornischen Palm Springs lebt. Außerdem haben Mr und Mrs Gaunt eine treue Haushälterin, Mrs Trump, die ihre Arbeit bei den Gaunts selbst dann nicht aufgeben wollte, als Philippa ihr heimlich einen Wunsch erfüllte und sie den Lottojackpot des Staates New York knackte.
P.B. Kerr, Februar 2006
Prolog – Etwas, das sich nur wenige Wochen nach der Geburt der Zwillinge John und Philippa Gaunt in New York ereignete.
Wie so oft nahm das Grauen seinen Anfang tief in der Nacht, als die meisten Menschen schliefen. Das Haus, in dem das entsetzliche Geschehen stattfand, war ein Regierungsgebäude in London. Ein eher unscheinbar wirkendes klassizistisches Backsteingebäude in Whitehall, mit der ältesten und namhaftesten Adresse der Welt – bekannter noch als das Weiße Haus. Vor der berühmten schwarzen Eingangstür stand ein Polizist; auf der anderen Straßenseite reihten sich weitere Regierungsgebäude aneinander, bis nach Westminster und dem Westminster Palace mit der trüben Themse dahinter.
Weit nach Mitternacht, an einem kalten Aprilmorgen in den letzten Jahren des letzten Jahrtausends, war alles still in der Downing Street Nr. 10. Ein elfjähriges Mädchen befand sich allein auf seinem Zimmer, aber es schlief nicht, sondern lag mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke und las ein Buch. Ihre Mutter und ihr Vater, der Premierminister von England und Nordirland, schlummerten tief und fest am anderen Ende des Korridors, während ein Stockwerk tiefer der Leibwächter des Premierministers und der Pressesprecher in einem Büro hinter dem Cabinet Room Dienst taten. Gegen null Uhr vierzig sah das Mädchen von seinem Buch auf und runzelte verwundert die Stirn, weil es meinte, ein Lachen gehört zu haben. Ein seltsames, weibliches Lachen. Jung und gehässig.
Merkwürdig.
Das Mädchen streckte den Kopf aus dem Deckenzelt, horchte einen Moment und verwarf den Gedanken wieder.
Ich höre Gespenster.
Doch als das mädchenhafte Lachen wieder erklang, setzte sie sich auf und warf ihr Taschenbuch beiseite, weil sie sich nicht mehr konzentrieren konnte.
Diesese könnte ich dich Kichern ist total unheimlich.
Sie stand auf, um nachzusehen. Während sie sich ihren Morgenmantel überzog, öffnete sie die Tür und sah den Korridor entlang. Das Kichern schien aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern zu kommen. Was ist da los? Das ist nicht meine Mutter, die lacht. Sie klingt ganz anders. Außerdem lacht sie überhaupt nicht mehr, seit wir in die Downing Street gezogen sind.
Das Mädchen tappte durch den Korridor, und das Kichern wurde plötzlich lauter, gehässiger, ja richtiggehend boshaft, doch als sie die Tür zum Schlafzimmer des Premierministers aufstieß und eintrat, brach das Kichern abrupt ab. Wenn auch nur kurz.
Was zum Teufel ist hier los?
Ihre Mutter kauerte mit weit aufgerissenen Augen in der Ecke und schien vor irgendetwas entsetzliche Angst zu haben. Ihr Vater saß kerzengerade im Bett, hatte die Augen jedoch geschlossen und schnaufte so heftig durch die aufgeblähten Nasenflügel, als sei er gerade gerannt. Er schien überhaupt nicht er selbst zu sein. Sein Gesicht war leichenblass, sein Pyjama schweißnass und das Haar klebte ihm am Kopf wie feuchtes Stroh. Plötzlich öffnete er die flatternden Augendeckel, verdrehte die Augen wie ein paar Murmeln bis fast unter die Lider und schloss sie wieder.
Er hat einen Herzanfall! Das ist es!
Sie fühlte sich merkwürdig erleichtert, bis ihr auffiel, dass ihr Vater grinste. Doch es war nicht sein übliches selbstzufriedenes Grinsen. Das hier sah anders aus, eher wie ein Hund, der die Zähne fletschte. Und dann bemerkte sie die Hitze. Im Zimmer war es heiß wie in einem Ofen. Sie tappte zum Fenster. Öffnete es. Berührte den Heizkörper. Kalt.
Sehr merkwürdig.
Sie sah sich nach ihrer Mutter um. »Was ist los mit dir, Mum?«, fragte sie.
»Mit mir ist überhaupt nichts«, antwortete ihre Mutter erregt. »Aber mit deinem Vater!«
Das Mädchen ging zum Bett des Vaters und beugte sich über ihn. Mit dem Handrücken schob sie seinen Teddybär Archibald zur Seite und sprach ihn leise an, so als würde er schlafwandeln: »Dad? Bist du okay?« Wieder dieses heftige Schnaufen. Das wölfische Grinsen blieb, dann öffneten sich seine grünen Augen und hefteten sich mit einem derart seltsamen Ausdruck auf sie, dass es ihr eiskalt über den Rücken lief.
»Hör auf damit, Dad. Das ist nicht komisch. Du machst Mum Angst.«
In diesem Moment begann er zu lachen. Nur dass es gar nicht ihr Vater war, der lachte. Es war das Lachen eines jungen Mädchens, das aus seinem Mund drang, fast so, als befände sich jemand anderes in ihm, irgendjemand Fremdes, Unerwünschtes und möglicherweise auch Bedrohliches. Irgendjemand oder irgendetwas.
Wenn du das bist, Dad, und wenn das eine Art Scherz sein soll, dann ist er nicht sehr witzig. Du bringst mich nämlich dazu, dass ich mir vor Angst fast in die Hose mache, weißt du das?
Kalte, ausdruckslose Augen, die so gar nicht zu dem Kichern passen wollten, hielten ihrem forschenden Blick einen Augenblick lang stand, ehe schließlich die Stimme eines Mädchens – das sich nicht viel älter anhörte als sie selbst – erklang.
»Hol mir den Innenminister«, sagte die Stimme. »Und den Londoner Polizeichef. Und den Oberstaatsanwalt. Und den Generalstaatsanwalt. Ich will jemanden verhaften und in den Tower werfen lassen. Sofort. Heute Nacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Du kannst niemanden in den Tower werfen lassen«, antwortete sie. »Nicht mehr. Und nicht einfach so. Es gibt bestimmte Verfahren, an die man sich halten muss. Gesetze.«
»Dann hol mir die Königin ans Telefon«, sagte die Stimme. »Ich will ein neues Gesetz erlassen. Auf der Stelle. Ein Gesetz, das es mir erlaubt, jemanden verhaften und hinrichten zu lassen. Noch heute Nacht.«
Das Mädchen merkte, wie ihr die Kinnlade herunterklappte.
»Worauf wartest du noch, du dummes Gör? An die Arbeit. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Premierminister. Und mach gefälligst den Mund zu. Du siehst aus wie ein Goldfisch. Und zwar keiner von der intelligenten Sorte. Hab selten jemand gesehen, der so dumm aus der Wäsche schaut wie du.«
Völlig verängstigt wich die Tochter des Premiers vor ihrem Vater zurück und versuchte, sich die Haare glatt zu streichen, die ihr jetzt zu Berge standen.
»Übrigens, Fischgesicht: Sorg dafür, dass alle begreifen, wie ernst es mir ist. Andernfalls gebe ich euch postwendend eine kleine Kostprobe meiner Macht. Kapiert, Fischgesicht?«
Der Premierminister kicherte mädchenhaft, was seine junge Tochter zum Anlass nahm, loszuschreien.
»Babys sind schon seltsame Kreaturen«, stellte Nimrod fest. »Ich meine, sie sehen ziemlich … nun ja, scheußlich aus, findest du nicht?« Er befand sich auf einer Stippvisite in New York, um seinen neugeborenen Neffen und seine Nichte, John und Philippa Gaunt, in Augenschein zu nehmen, und betrachtete die Zwillinge in ihren Krankenhausbettchen mit regelrechtem Abscheu. Nimrod konnte Babys nicht ausstehen, was nicht zuletzt daran lag, dass er sich selbst nur zu gut an den Dreck und die Inkontinenz und all die anderen Schrecken seiner eigenen Babyzeit erinnern konnte. Bei erwachsenen Dschinn ist dies keine Seltenheit, viele von ihnen entwickeln eine lückenlose Erinnerung an alles, was sie je erlebt haben, und sind außerstande, etwas zu vergessen. »Ist es nicht merkwürdig, dass es die meisten von ihnen irgendwie schaffen, Winston Churchill zu ähneln? Oder Benito Mussolini – mit ihrer unberechenbaren, aggressiven Art. Ganz zu schweigen von ihrem irritierenden Drang, ständig im Mittelpunkt stehen zu wollen.«
Nimrods Schwester Layla, die ebenfalls ein Dschinn war, saß stocksteif in ihrem Krankenhausbett und lauschte den taktlosen Bemerkungen ihres Bruders mit wachsender Verärgerung. Auch die Zwillinge, die die kleinliche Abneigung ihres Onkels spürten, begannen wie ein Paar hungrige Katzen im Chor zu maunzen.
»Und dann auch noch Zwillinge«, fügte Nimrod hinzu, indem er das Geschrei übertönte. »Was für eine Plage für dich, meine Liebe. Wenn ich mir diese beiden kleinen Quälgeister so ansehe, fange ich an, der Legende von der Gründung Roms Glauben zu schenken. Dass man die Zwillinge Romulus und Remus in eine Wanne gesteckt und in den Tiber geworfen hat, aus dem sie dann allerdings von einer Wölfin und einem Specht gerettet wurden. Ja, sie sind wirklich ein Affront gegen die Ohren. Unglaublich, wie sie mit den Ärmchen herumfuchteln, wie ein paar zu kurz gekochte Hummer.«
»Sonst noch etwas?«, fragte Layla und lächelte geduldig. »Oder hast du den ganzen Weg von London hierher nur auf dich genommen, um Unverschämtheiten über meine Babys loszuwerden?«
»Unverschämt? Ich? Aber keineswegs«, widersprach Nimrod und hob einen Schuhkarton vom Boden auf. »Als ihr Onkel habe ich ihnen das traditionelle Dschinngeschenk mitgebracht: eine anständige Öllampe. Eine für jeden. Das ist kein malaysischer Zinntrödel, wohlgemerkt. Sie sind aus echtem Silber. Aus dem Osmanischen Reich. Und das prachtvolle Interieur stammt von meiner Wenigkeit.«
»Nun, die kannst du gleich wieder mitnehmen«, sagte Layla. »Meine Kinder werden nicht als Dschinn aufwachsen, sondern als ganz gewöhnliche Menschen.«
»Bei meiner Lampe, Layla«, sagte Nimrod. »Was meinst du damit?«
»Genau das, was ich sage«, antwortete Layla. »Ihr Vater ist ein Mensch. Warum also nicht?«
»Und ein äußerst sympathischer Mensch dazu«, sagte Nimrod. »Aber diese Kinder sind keine Irdischen und werden es niemals sein. Das weißt du.«
»Ich wäre dir dankbar, wenn du dieses Wort nicht benutzen würdest«, sagte Layla.
»Irdische?«, rief Nimrod. »Aber warum nicht? Genau das sind Menschen doch, meine Liebe. Es lässt sich nun mal nicht leugnen, dass die Kräfte der Dschinn nur über die Mutter vererbt werden. Irgendwann in ferner Zukunft – höchstwahrscheinlich in zehn oder zwölf Jahren, wenn ihre Weisheitszähne durchstoßen – werden du und dein Mann Edward der Tatsache ins Auge sehen müssen, wer und was diese Zwillinge sind. Sie sind Kinder des Dschinn, Layla.«
»Ich wäre dir dankbar, wenn du das vergessen würdest«, sagte Layla. »Und uns in Ruhe lässt. Dauerhaft. Ich möchte keinen Kontakt zur Dschinngesellschaft. Und das schließt dich mit ein, Bruderherz.«
»Wie du willst«, erwiderte Nimrod gekränkt. »Aber selbst, wenn es dir gelingt, die Kinder von anderen Dschinn fernzuhalten, kannst du doch den Dschinn in den Kindern nicht fernhalten.«
Nimrod flog noch am gleichen Tag nach London zurück.
Kurz nach seiner Rückkehr stand er im Tresorraum seines Hauses und wickelte die beiden osmanischen Silberlampen, die er John und Philippa hatte schenken wollen, in Zeitungspapier, als sein einarmiger Butler Groanin in der Tür erschien.
»Da ist eine Person in der Eingangshalle, Sir«, sagte er und betonte das Wort »Person«, wie ein anderer Butler vielleicht »Schwein« oder »Hyäne« gesagt hätte. »Er wünscht Sie dringend zu sprechen.«
»Und wie heißt diese Person?«
»Das ist schwer zu sagen, Sir.«
»Warum? Haben Sie Ihre Zunge verschluckt, Groanin?«
»So war es nicht gemeint, Sir. Ich wollte sagen, dass der Name schwer auszusprechen ist.«
»Versuchen Sie’s.«
»Sehr wohl, Sir.« Groanin ordnete seine Gedanken, seine Lippen und die Zunge und sagte dann: »Doktor Ruchira P. Warnakulasuriya.«
»Jetzt verstehe ich, was Sie meinen, Groanin. Das ist ein ganz schöner Brocken. Irgendeine Vorstellung, was er von mir will?«
»Er wollte seine Absichten nicht genauer kundtun, Sir. Nur dass es sich um eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit handelt. Oh, und er erwähnte, dass Sie seinen Vater kannten, den Fakir Murugan.«
»Führen Sie ihn besser in die Bibliothek, Groanin.«
»Jawohl, Sir«, sagte Groanin und entschwand mit leisem Murmeln.
Nimrod schloss die beiden Öllampen im Tresorraum ein und machte sich auf den Weg zu seinem Besucher. Der verstorbene Vater des Doktors war ein berühmter heiliger Mann aus Indien und ein Bekannter von ihm gewesen. Als Zeichen seiner großen religiösen Hingabe und Heiligkeit hatte der Fakir Murugan zehn Jahre seines Lebens mit acht Dolchen in Brust und Rücken auf einem hohen Pfahl gesessen. So etwas taten heilige Männer in Indien und anderswo und Nimrod hatte den Grund dafür nie verstanden; allerdings schien es sie auf irgendeine verquere Weise glücklich zu machen, und es war nicht Nimrods Art, sich über die Glücksvorstellungen anderer Leute zu mokieren.
In der Bibliothek traf Nimrod auf einen kleinen, rundlichen Mann in einem blauen Nadelstreifenanzug, mit einer getönten Brille und einer teuer aussehenden goldenen Uhr. Der Doktor verfügte über ausgezeichnete Umgangsformen – das Resultat einer exklusiven Ausbildung, die er an verschiedenen Orten erhalten hatte, darunter das Eton College, die Groton-School, Harvard und die London University sowie verschiedene medizinische Fakultäten, etwa in Birmingham und Edinburgh. Sobald er Nimrod erblickte, machte der Doktor eine Verbeugung und küsste ihm respektvoll die Hand. Der Fakir Murugan hatte gewusst, dass Nimrod ein Dschinn war, und Nimrod vermutete, dass sein Sohn ebenfalls im Bilde war. Der Doktor kam sogleich zur Sache:
»Vergeben Sie mir mein Eindringen, verehrter Herr«, sagte er. »Doch es handelt sich um eine Situation von höchstem nationalem Interesse.«
»Ja«, sagte Nimrod und zündete sich eine Zigarre an. »Das hat Groanin mir gesagt.«
»Ich führe eine sehr erfolgreiche medizinische Praxis in der Harley Street. Eine meiner Patientinnen ist die Frau des Premierministers, Mrs Widmerpool, der ich im Laufe der Zeit ein Freund und Vertrauter geworden bin.« Doktor Warnakulasuriya fingerte an seinem Schlips herum, als wäre es ihm ein wenig peinlich, den Namen einer so berühmten und einflussreichen Person zu erwähnen.
»Das muss schön für Sie sein«, sagte Nimrod, der nicht im mindesten beeindruckt war.
»Ja«, sagte Dr. Warnakulasuriya. »Und das ist der Grund, warum ich und nicht Mr Widmerpools eigener Arzt in eine Angelegenheit verstrickt wurde, die größtes Fingerspitzengefühl und äußerste Diskretion erfordert.«
»Sie machen mich neugierig«, sagte Nimrod und blies einen Rauchring aus, der die Gestalt mehrerer großer Menschenohren annahm.
»Oh, sehr schön«, sagte Dr. Warnakulasuriya, als er die Rauchohren bemerkte. »Sehr schön.« Dann erinnerte er sich an die Dringlichkeit seines Anliegens und fuhr fort: »Die Sache ist die, Sir: Ich vermute, dass Mr Widmerpool von einem Dschinn besessen ist, und ich komme, um Sie zu fragen, ob Sie gütigerweise eine Austreibung vornehmen würden.«
»Eine Austreibung?«, wiederholte Nimrod. »Wie kommen Sie zu der Annahme, dass es sich hier um einen Dschinn handelt und nicht um etwas anderes? Einen Dämon vielleicht.«
»Ich bin nicht mein Vater, Sir«, sagte Dr. Warnakulasuriya. »Doch im Rahmen meiner beschränkten Kenntnisse über die Dschinn bin ich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schluss gekommen; ja, ich bin überzeugt, dass es sich um einen Dschinn handelt. Mr Widmerpools Schlafzimmer beispielsweise, wo er momentan festgehalten wird, ist eher heiß als kalt zu nennen. Zudem habe ich vor seinem Mund ein Streichholz entzündet, das er nicht ausblies. Stattdessen saugte er die Flamme auf wie ein Mann, der von einer Untertasse Tee zu trinken versucht.«
»Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung.« Nimrod nickte. »Sonst noch etwas? Ein besonderer Geruch vielleicht?«
»Ich habe einen starken Schwefelgeruch bemerkt«, sagte Dr. Warnakulasuriya.
»Beschreiben Sie die Stimme, die Sie hörten, als Sie mit dem Premierminister sprachen.«
»Es war die Stimme eines Mädchens«, antwortete der Doktor. »Ein junges Mädchen, würde ich sagen, von etwa zwölf Jahren. Gebildet. Amerikanerin. Gehässig und beleidigend. Sie erteilt jedem, der in ihre Nähe kommt, Befehle, als erwarte sie Gehorsam, weil die Befehle aus dem Mund des Premiers kommen. Am Anfang waren es immer die gleichen: einen Mann zu verhaften, ihn zum Tower von London zu bringen und dort zu exekutieren, indem man ihm den Kopf abschlägt.«
»Oh. Und wie heißt der Mann, den sie erwähnte?«
»Es ist ein ungewöhnlicher Name. Klingt ausländisch, nicht englisch, meine ich. Hier, ich habe ihn aufgeschrieben.«Doktor Warnakulasuriya kramte in seiner Westentasche und reichte Nimrod dann eine Visitenkarte, auf deren Rückseite ein Name notiert war. »Obwohl ich nicht sicher bin, dass ich ihn richtig buchstabiert habe.«
Nimrod betrachtete den Namen schweigend und steckte die Karte dann in seine Hosentasche. »Erzählen Sie weiter«, bat er. »Sie sagten, am Anfang seien es immer die gleichen Befehle gewesen. Wie lauteten sie später?«
»Als klar wurde, dass niemand die Verhaftung des Mannes anordnen würde, veränderten sich die Befehle. Sie schienen nur noch darauf abzuzielen, den Premierminister lächerlich zu machen und den Anschein zu erwecken, er sei verrückt geworden. Zum Beispiel befahl sie dem Pressesprecher des Premiers, gegen den amerikanischen Präsidenten einen Haftbefehl wegen Hochverrats auszustellen, falls dieser sich weigern sollte, die Unabhängigkeitserklärung zu zerreißen und unverzüglich hierher zu fliegen und Ihrer Majestät der Königin einen Treueeid zu schwören.«
Nimrod lächelte. »Interessante Idee«, sagte er. »Ich frage mich, ob das funktionieren könnte.« Er dachte einen Augenblick nach. »Sagen Sie, Dr. Warnakulasuriya, gibt es in der Downing Street Nr. 10 eine Katze?«
»Eine Katze? Ja, ich glaube schon. Warum fragen Sie?«
»Weil wir eine Katze benötigen werden, um die Austreibung vorzunehmen.«
»Dann werden Sie also helfen?«
Nimrod sah aus dem Fenster und lächelte. »Warum nicht? Es ist ein wunderbarer Tag für eine Dschinn-Austreibung.«
Die Katze in der Downing Street Nr. 10 hieß Boothby. Es war ein zugelaufener Streuner mit langem, schwarzweißem Fell und einer Vorliebe für Schokoladenplätzchen. Trotz seines Rufs als Vogelkükenjäger wurde Boothby in der Downing Street sehr geschätzt, und vor Nimrods Eintreffen an jenem Morgen im April bestand die einzige echte Unannehmlichkeit, die er dort seit seinem Einzug erlitten hatte, aus jenem Moment, in dem er fast unter die Räder des zwei Tonnen schweren kugelsicheren Cadillacs des amerikanischen Präsidenten geraten wäre.
Bei seiner Ankunft in der Downing Street Nr. 10 bat Nimrod nicht darum, Mr Widmerpool sehen zu dürfen, sondern Boothby. Der Kater war nirgends zu entdecken, daher erbot sich der Doktor, ihn suchen zu gehen. Nimrod wurde in den Billard Room geführt, wohin ihm etwa zehn bis fünfzehn Minuten später Dr. Warnakulasuriya mit dem Kater auf dem Arm folgte. Der Doktor mochte keine Katzen; er mochte keine Katzenhaare auf seinen maßgeschneiderten Anzügen; vor allem aber mochte er den Kratzer nicht, den er sich eingehandelt hatte, als das Tier seinem zögerlichen Griff zu entkommen versuchte.
»Au«, sagte der Doktor und saugte das Blut von seinem Handrücken. »Du scheußlicher kleiner Parasit! Wie kannst du es wagen, du undankbares kleines Scheusal.«
Einen Moment lang sah es so aus, als wollte er nach der Katze treten. Doch Nimrod, der den wahren Grund für die Not des Tieres erahnte, hob den Kater hoch. »In diesem Raum spukt es, Doktor«, erklärte er. »Wir sollten uns lieber ein anderes Zimmer suchen, ansonsten wird die Katze niemals lange genug stillhalten, damit ich tun kann, äh … was notwendig ist.«
Der Doktor, der sich in der Downing Street offensichtlich auskannte, führte sie in den Terracotta Room, wo Nimrod, immer noch mit Boothby auf dem Arm, auf einem Sofa Platz nahm und seinen neuen Katzenfreund zu streicheln begann.
»Würden Sie mir bitte diesen Aschenbecher reichen?«, sagte er zum Doktor.
Der Doktor gab ihm den Aschenbecher.
»Sagen Sie, haben Sie dem Premierminister irgendetwas zu trinken gegeben? Ein Glas Wasser vielleicht?«
»Nein. Ich habe ihm den Puls gefühlt – er ging sehr schnell –, eine Blutprobe genommen, die Pupillen und die Zunge überprüft und die Lymphknoten am Hals abgetastet, um zu sehen, ob sie geschwollen sind. Was tatsächlich der Fall war. Und ja, jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Schwefelgeruch, den ich vorhin erwähnte, erst wahrnehmbar war, nachdem ich auf Mr Widmerpools Lymphknoten gedrückt hatte.«
»Das liegt daran, dass die Lymphdrüsen das Zentrum der Besessenheit sind«, sagte Nimrod. »Wo sich der Dschinn niederlässt, sozusagen. Wenn Sie die Drüsen massieren, bewirken Sie, dass der Körper des Premierministers eine Ladung reinen Schwefels ausstößt. Dschinn verfügen im Körper über einen wesentlich höheren Schwefelanteil als Irdische – als Menschen, meine ich. Nur zu Ihrer Information: Der menschliche Körper enthält im Schnitt gerade genug Schwefel, um sämtliche Flöhe eines großen Hundes abzutöten. Ein Dschinn dagegen enthält im Schnitt genug Schwefel, um sämtliche Flöhe eines Wollmammuts abzutöten. Aus diesem Grund haben die Menschen einen wesentlich besseren Geruchssinn als Dschinn. Das ist eines der wenigen Dinge, die ihr Menschen uns voraushabt.«
Nimrod erzählte dem Doktor das alles nicht, um dessen Wissen über die Dschinn zu verbessern – er war im Umgang mit geheimnisvollen Dingen wie jenen, die er gerade beschrieben hatte, vielmehr überaus vorsichtig –, sondern weil er merkte, dass seine tiefe, sonore Stimme die Katze zu beruhigen schien. Boothby sollte sich so weit entspannen, dass Nimrod seine Schnurrhaare berühren konnte.
Eine Katze hat vierundzwanzig bewegliche Barthaare, zwölf auf jeder Seite der Nase, und Nimrod benötigte sieben davon, um das Ritual einer Dschinn-Austreibung zu vollziehen. Dieses ist auch unter dem Begriff Katto bekannt, wenn auch aus Gründen, die mit Katzen nicht das Geringste zu tun haben. Nimrod war kein grausamer Mensch und er bedauerte, dass dieses Ritual den Einsatz von Dschinnkräften zur Erlangung der Schnurrhaare untersagte, da Boothby mit ziemlicher Sicherheit etwas dagegen haben würde, fast ein Drittel seiner Tasthaarausstattung hergeben zu müssen. Noch während er mit dem Doktor sprach, überlegte Nimrod, wie er Boothby nach dem Raub seiner Schnurrhaare wieder versöhnen könnte.
»Vergeben Sie mir mein Drängen, Sir«, sagte Dr. Warnakulasuriya und sah angespannt zur Decke, »aber die Situation eilt ein wenig. Der Premierminister erwartet den deutschen Bundeskanzler zum Lunch. Vielleicht könnten Sie ihn sich jetzt ansehen und entscheiden, was getan werden muss.«
Dr. Warnakulasuriya lächelte nervös. Er hatte keine Ahnung, warum Nimrod diese Katze für so wichtig hielt, wo doch ein Stockwerk höher der Premier daherplapperte wie ein freches Schulmädchen. Gleichzeitig aber wusste er, dass manchen Dschinn ein ungemein hitziges Gemüt nachgesagt wurde und sie, nach Aussage seines verstorbenen Vaters, häufig erst beruhigt und gehörig umschmeichelt werden mussten, ehe sie bereit waren, für menschliche Wesen einen Finger zu rühren. Daher verbeugte er sich unterwürfig und fügte hinzu: »Das heißt, wenn Sie fertig sind, mit der Katze zu spielen, Sir.«
Nimrod antwortete nicht und fuhr fort, Boothby am Kinn zu kraulen. Der Kater schnurrte behaglich und der Doktor ertappte sich dabei, wie er für einen Augenblick selbst die Augen schloss: Nimrods beruhigendes Einwirken auf die Katze war ansteckend, ja fast ein wenig hypnotisierend. Im nächsten Moment sprang der Doktor fast aus den Schuhen, denn Boothby gab einen markerschütternden Schrei von sich und sauste die Vorhänge hinauf, als fürchtete er um sein Leben. Nimrod ließ etwas in den Aschenbecher fallen, stand auf und ging mit raschen Schritten zum Fenster hinüber.
»QWERTZUIOP!«
Dem Doktor stockte der Atem, als der Dschinn auf wundersame Weise plötzlich eine Platte rohen Fisch in der ausgestreckten Hand hielt. Er hatte keine Ahnung, warum die Katze sich so aufgeführt hatte, aber das schien angesichts dieser Demonstration übernatürlicher Kräfte auch völlig unerheblich zu sein. Es war das erste Mal, dass er Dschinnkräfte in Aktion gesehen hatte, und der Doktor war zutiefst beeindruckt. Inzwischen hatte Nimrod die Fischplatte zur Vorhangstange hinaufgehoben, auf der Boothby Zuflucht gesucht hatte, und entschuldigte sich bei ihm.
»Der Fisch«, hauchte der Doktor. »Sie haben ihn herbeigezaubert. Einfach so aus dem Nichts, nicht wahr?«
»Ich finde, es ist das Mindeste, was ich als Dank für Boothbys Mithilfe bei diesem Ritual tun kann«, sagte Nimrod. »Sie nicht auch?« Er wartete, bis dem Kater der Fischgeruch in die Nase gestiegen war, ehe er die Platte auf dem Boden abstellte.
»Ja, das ist mir noch nicht ganz klar. Wie genau wird er uns denn helfen, Sir?«
»Das hat er bereits getan«, sagte Nimrod, nahm den Aschenbecher und zeigte dem Doktor die sieben Haare, die er dem armen Boothby aus dem Gesicht gerupft hatte. »Schnurrhaare.« In der Annahme, der verwirrte Ausdruck im Gesicht des Doktors drücke Schrecken und Missbilligung aus, fügte Nimrod hinzu: »Keine Sorge. Sie wachsen wieder nach.« Er wies mit dem Kopf zur Tür. »Gut. Dann wollen wir mal loslegen.«
Nimrod ließ sich Zeit beim Betreten des Ministerschlafzimmers. Der Premierminister von Großbritannien und Nordirland, Mr Kenneth Widmerpool, lag auf dem Rücken, den Kopf auf ein Kissen gestützt, jedoch mit Armen und Beinen an die Pfosten seines Bettes gefesselt. Neben ihm stand eine große, blonde Frau, in der Nimrod sofort seine Gattin Sheila erkannte. Sie hatte die Arme verschränkt und sah angespannt und müde aus. Und ziemlich dick, dachte Nimrod. In einem Sessel in der Ecke kauerte ein etwa elf- oder zwölfjähriges Mädchen; Nimrod vermutete, dass es Lucinda war, die jüngste Tochter des Premierministers. Hinter ihr stand der Pressesprecher, der mit einer Mischung aus Erleichterung und Irritation auf die Ankunft von Dr. Warnakulasuriya und Nimrod reagierte.
»Na, das wurde aber auch Zeit«, sagte er und sah auf seine Armbanduhr. Und mit einem ungläubigen Blick auf Nimrods roten Anzug fügte er hinzu: »Und wer sind Sie? Der Nikolaus?«
Die Frau des Premierministers dagegen zeigte sich wesentlich freundlicher. Mit Tränen in den Augen ergriff sie Nimrods Hand und drückte sie. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind«, sagte sie. »Vielen Dank.«
»Beruhigen Sie sich, verehrte Dame«, sagte Nimrod und schnupperte. »Ich versichere Ihnen, dass die Misere des Premierministers bald behoben sein wird.« Er schob sie vom Bett fort.
»So, so, und wen haben wir hier?« Das war der Premierminister oder vielmehr der junge weibliche Dschinn, der derzeit seinen Körper bewohnte. Nimrod hatte diesbezüglich keine Zweifel mehr: Der aufsteigende Schwefelgeruch, sobald der Premier den Mund auf- oder zumachte, war unverkennbar.
»Dasselbe könnte ich dich fragen«, sagte Nimrod. Er setzte sich auf die Bettkante und begann Arme und Beine des Premiers loszubinden. »Das heißt, eigentlich interessiert es mich mehr, warum du das tust. Bei meiner Lampe, man kann dein Treiben wirklich kaum mit ansehen.«
»Aber genau das ist der Witz. Sie können mich gar nicht sehen. Nicht, wenn ich mich Ihnen nicht freiwillig zeige.«
»Ich fordere dich in aller Freundlichkeit auf, zu gehen. Unverzüglich.«
»Wenn ich aber nicht will?«, sagte das Mädchen im Inneren des Premiers und kicherte.
»Dann werde ich dich zwingen.«
»Ach? Und wie wollen Sie das anstellen?«
»Das ist meine Angelegenheit.«
Das Mädchen kicherte und brachte den Premier dazu, sich aufzusetzen. »Es macht viel zu viel Spaß, um jetzt aufzuhören «, sagte sie. »Schauen Sie mal.« Sie hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als der Kopf des Premiers sich langsam zu drehen begann und dabei ein schrecklich knarzendes Geräusch von sich gab, so als verdrehe man mit den Händen eine Ledertasche.
Die Frau des Premiers hielt sich bei diesem Anblick den Handrücken vor den Mund, um nicht loszuschreien, und drückte dann das Gesicht an die Schulter des Pressesprechers. Als der Kopf des Premierministers seine 360-Grad-Rundreise beendet hatte, kicherte der Dschinn in seinem Inneren erneut und sagte: »Das kann ich mit seinem Kopf machen. Und nun stellen Sie sich mal vor, was ich alles mit seiner Partei und seiner Politik anstellen kann.«
Nimrod machte eine abschätzige Handbewegung und murmelte leise das Fokuswort, mit dem er seine Kräfte bündelte: »QWERTZUIOP!«
Der andere Dschinn merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. »Was war das? Was haben Sie gemacht? Ich kann mich nicht bewegen.«
»Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte Nimrod. »Ich habe dir nur eine andere Art von Bann auferlegt, das ist alles.«
»Warum? Was haben Sie vor?«
»Das frage ich mich auch«, murmelte Dr. Warnakulasuriya.
»Rufen Sie die Polizei!«, schrie die Stimme im Innern des Premiers. »Lassen Sie den Mann sofort verhaften.«
»Genug herumkommandiert «, sagte Nimrod und nahm eines von Boothbys Schnurrhaaren aus dem Aschenbecher. »Zum Korken noch mal! Jetzt ist Schluss.«
Der Premier beäugte das Haar misstrauisch. »Was ist das?«
Nimrod zog ein Feuerzeug aus der Tasche seines roten Jacketts. »Ich nehme an, du kennst das Sprichwort ›Versengte Katzen leben lange‹. Nun, für Dschinn gibt es keinen schlimmeren Geruch als den einer versengten Katze.« Nimrod kicherte. »In früheren Zeiten brauchte man für eine Dschinn-Austreibung mit dem Katto-Ritual eine ganze Katze. Zum Glück geht es heutzutage nicht mehr ganz so grausam zu und man benötigt nur noch sieben Schnurrhaare.«
Nimrod wackelte mit den Fingern, und zur maßlosen Verblüffung von Dr. Warnakulasuriya, der direkt neben ihm stand, beförderte er plötzlich eine Nasenklammer aus dem Nichts herbei. Nimrod schob sich die Klammer auf die Nase, um den Geruch des brennenden Katzenhaars nicht selbst einzuatmen. »Ich habe den Verdacht«, sagte er, »dass du mit dem, was du getan hast, in der Politik ordentlich Stunk machen wolltest.«
»So war es gar nicht«, widersprach der Dschinn im Innern des Premiers. »Jedenfalls nicht am Anfang. Ich wollte, dass Iblis verhaftet wird. Darum hab ich es getan. Verhaftet, exekutiert und gefoltert. Aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ich nehme an, Sie haben von Iblis gehört? Seinetwegen ist meine Familie völlig ruiniert.«
Nimrod nickte, als der junge Dschinn ihm seine Gründe nannte. Der Name Iblis war ihm durchaus ein Begriff. Als Kopf der Ifrit, eines der drei bösen Stämme der Dschinn, galt Iblis allgemein als der bösartigste Dschinn der Welt.
»Und was, um Himmels willen, hat dich auf den Gedanken gebracht, der Premierminister könnte dir helfen?«, fragte Nimrod.
»Kein anderer Dschinn, mein eigener Vater mit inbegriffen, scheint den Mumm zu haben, irgendetwas gegen seine Gemeinheit zu unternehmen«, antwortete die Mädchenstimme. »Also habe ich beschlossen, mir eine irdische Hilfsquelle zunutze zu machen: den Premierminister. Aber hier drinnen habe ich gemerkt, dass er gar nicht der Mann ist, für den ich ihn gehalten habe. Meine Mutter wird mächtig enttäuscht sein, wenn ich ihr das erzähle. Sie schwärmt ständig, was für ein toller Kerl er doch ist. Aber das ist er gar nicht. Er hat überhaupt keine Macht.«
»Das ist deine letzte Chance, zu gehen«, sagte Nimrod.
»Bei meiner Lampe«, höhnte das Dschinnmädchen. »Wenn ein Mann nicht mal nach Belieben Leute einsperren lassen kann, sollte er auch nicht Oberhaupt eines Landes sein. Also werde ich ihn für seine Unfähigkeit büßen lassen. Und zwar durch den politischen Stunk, den er bekommen wird.« Sie lachte. »Dafür werde ich schon sorgen. Sie werden sehen.«
»Du bist im Begriff, mehr Stunk zu bekommen, als dir lieb ist«, sagte Nimrod.
»Sie bluffen.«
»Das wird sich zeigen.«
Da Kopf und Körper des Premiers von Nimrods mächtiger Fessel festgehalten wurden, hatte der aufsässige Dschinn keine Chance, dem brennenden Katzenhaar zu entkommen, das Nimrod dem Premier nun unter ein Nasenloch hielt. Der beißende Qualm stieg diesem in die Nebenhöhlen, wo er in die Lunge hinabgesogen und von dort in den Blutkreislauf transportiert wurde.
»Ahh! Hören Sie auf damit! Das stinkt ja grauenhaft! Nehmen Sie das weg!«
»Du hast es so gewollt.« Nimrod ließ das verglimmte Schnurrhaar fallen und zündete das nächste an, dann noch eines, während über Mr Widmerpools Blutkreislauf im Handumdrehen mikroskopisch kleine Partikel von versengter Katze in die Lymphknoten in seinem Hals transportiert wurden und von dort in sein Gehirn. Der Gestank von Boothbys Haaren war jetzt so ätzend, dass sich Lucinda Widmerpool Mund und Nase zuhalten musste. Allerdings nicht lange, denn Sekunden später wurde ihr Geruchssinn von dem Drang überwältigt, mit dem Finger auf das Bett zu deuten.
Das Bett hebt vom Boden ab!
Wie gebannt starrte sie auf das Geschehen. Dreißig Zentimeter. Sechzig. Das Gewicht ihres Vaters und des Mannes im roten Anzug, der ein weiteres brennendes Schnurrhaar in der Hand hielt, schien keine Rolle zu spielen. Das Bett stieg noch ein Stückchen höher und schwebte in der Luft wie bei der Schwebenummer eines Magiers in einer Levitationsshow.
»Grundgütiger Himmel!«, rief Mrs Widmerpool, während der Pressesprecher mehrere deftige Flüche ausstieß.
»Kein Grund zur Beunruhigung, werte Dame«, sagte Nimrod und zündete das sechste Schnurrhaar an. »Wir nennen dies das Fliegender-Teppich-Stadium, wenn der Wunsch des Dschinn, davonzufliegen, fast übermächtig wird. Fast. Noch ein Schnurrhaar und wir müssten es eigentlich geschafft haben.«
»Grundgütiger Himmel«, wiederholte die Frau des Premiers, die das schwebende Bett weniger zu beunruhigen schien als das, was nun darunter zum Vorschein kam: halb aufgegessene Pizzas, alte Zeitungen, Zehennagelschnipsel, mehrere Dokumente mit dem Aufdruck STRENG GEHEIM, einige einzelne Socken, ein Parkschein, ein paar schmutzige Boxershorts, ein signiertes Bild Ihrer Majestät der Königin, einige (gekaute) Kaugummis, mehrere ausländische Münzen (vor allem französische Francs) und ein kaputter Tennisschläger.
»Halten Sie Abstand, Ma’am!«, rief Nimrod, als sich Mrs Widmerpool bückte, um das Bild der Königin an sich zu nehmen.
Sekunden später krachte das Bett plötzlich zu Boden und das Schlafzimmerfenster flog auf, durch das der aufsässige Dschinn unsichtbar den Rückzug antrat.
»Gewonnen«, sagte Nimrod. »Um eine Nasenlänge, denke ich.« Mit einer Handbewegung und dem Murmeln seines Fokuswortes löste er den Bann, der den Körper des Premierministers festgehalten hatte, dessen Blick und – was noch wichtiger war – Stimme wieder völlig normal erschienen.
»Was geht hier vor?«, fragte er unsicher.
Nimrod stand auf und trat vom Bett zurück, während Dr. Warnakulasuriya näher kam, um Mr Widmerpool den Puls zu fühlen und ihn mit einem Stethoskop abzuhorchen.
»Wirklich. Mir fehlt nichts.« Der Premierminister lächelte, als seine Tochter ihm den Teddybären reichte.
»Können Sie sich an irgendetwas von dem erinnern, was Ihnen widerfahren ist, Herr Premierminister?«, erkundigte sich Nimrod.
Mr Widmerpool wirkte verlegen. »Ein schlechter Traum, denke ich«, sagte er. »Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Worte oder Handlungen. Es war, als säße jemand in meinem Kopf und entscheide darüber, was ich sagen oder tun darf.« Er warf einen kurzen Blick zu seinem Pressesprecher, als wollte er sich vergewissern, dass er das Richtige sagte. »Ein Mädchen, glaube ich. Noch ziemlich jung. Nicht älter als meine eigene Tochter, würde ich sagen.«
»Hatte dieses Mädchen vielleicht einen Namen?«, fragte Nimrod.
»Keine Ahnung.« Mr Widmerpool dachte einen Augenblick nach und zuckte dann die Achseln. »Tina?« Er sah Nimrod an. »Sagt Ihnen das was?«
Nimrod schüttelte den Kopf. »Nun, für mich wird es Zeit, Sir«, sagte er dann und tat die diversen Dankesbezeugungen mit einem Winken ab. Selbst der leicht aufbrausende Pressesprecher war voll überschäumender Dankbarkeit. »Papperlapapp «, sagte Nimrod. »Nichts zu danken. Nicht im Geringsten. Bei meiner Lampe, ich habe nur meine Pflicht als treuer Engländer getan. Schließlich können wir nicht zulassen, dass sich der britische Premierminister vor dem deutschen Kanzler zum Narren macht. Nein, das überlassen wir lieber dem französischen Staatspräsidenten.«
Dr. Warnakulasuriya begleitete Nimrod zurück in die Eingangshalle, wo er ihm respektvoll noch einmal die Hand küsste. »Mein Vater, der Fakir, hat mir von den Dschinn und ihren mächtigen Kräften erzählt«, sagte er. »Aber zu meiner großen Schande und Beschämung muss ich gestehen, Sir, dass ich kaum etwas davon geglaubt habe. Ich bin ein Mann der Wissenschaft, verstehen Sie? Nicht des Aberglaubens.«
»Und doch waren Sie derjenige, der mich hergebracht hat.«
»In Wirklichkeit, Nimrod, habe ich nur halb daran geglaubt, dass Sie helfen könnten. Bis Sie dieses Bett zum Fliegen brachten. Ganz zu schweigen davon, wie Sie die Nasenklammer aus dem Nichts herbeibefördert haben. Und den Fisch für Boothby.«
»Ich bitte Sie, das war doch nur ein Fisch, kein Goldbarren«, erwiderte Nimrod bescheiden.
»Aber es hätte ebenso leicht ein Goldbarren sein können, nicht wahr? Und dieser Dschinn, den Sie Mr Widmerpool ausgetrieben haben … Die Kraft zu haben, so etwas zu tun: sich einfach seinen Körper anzueignen. Das junge Ding hätte alles Mögliche anstellen können.«
»Es war ein Glück für alle, dass sie keine oder nur wenig Erfahrung hatte. Wenn Tina – oder wie immer sie heißen mag – es geschafft hätte, das Sprachzentrum des Premiers zu übernehmen … nicht auszudenken, was sie vielleicht alles angerichtet hätte.« Nimrod sah auf die Uhr. »Ich werde mich jetzt auf die Suche nach ihr machen. Nach mehreren Stunden in einem fremden Körper wird es ihr vielleicht recht sein, wenn ich ihr helfe, ihren eigenen wiederzufinden. Liegengelassene Körper werden nur allzu leicht fortgeschafft. Selbst in London.« Nimrod lächelte strahlend und klopfte dem Doktor auf die Schulter.
»Sagen Sie«, sagte Dr. Warnakulasuriya und nahm die Brille ab. »Stimmt es, dass Sie wirklich die Macht haben, drei Wünsche zu erfüllen?«
Nimrod war klar, worauf die Unterhaltung hinauslief. »Ihr Vater, der Fakir, der ein überaus weiser Mann war, sagte einmal zu mir, dass es für einen Menschen besser sei, seinen Willen erfüllt zu sehen als einen Wunsch.«
Der Doktor nickte mit ernstem Gesicht, doch Nimrod spürte, dass ihn die Worte seines Vaters nicht überzeugten. Im Gegenteil: Nimrod bemerkte, wie in den Augen des Mannes eine undefinierbare Veränderung vor sich ging. Doch es sollten mehr als zehn Jahre vergehen, ehe er vollends begriff, wohin diese Veränderung den leicht beeinflussbaren jungen Arzt aus Indien führen würde.
Allerhand im Karton
Es war sieben Uhr morgens im Büro der Direktorin der Elroy Jetson School in Palm Springs. Mr Astor, der Putzmann, wischte und polierte wie gewöhnlich den Fußboden und zog dann den Plastiksack mit Miss Bonos Abfall aus dem Papierkorb neben dem Schreibtisch. Ganz oben im Sack, im Inneren einer leeren Getränkedose, spürte Dybbuk Sacstroker die Bewegung, mit der Astor den Sack herauszog, und schnallte sich eilends auf dem Düsenflugzeugsitz an, den er speziell für diesen Zweck in die Dose eingebaut hatte. Dann legte er sich eine Nackenstütze um und setzte sich einen Helm auf, um bei der Erschütterung – die nun unweigerlich folgen würde, wie der zwölf Jahre alte Dschinn wusste – kein Schleudertrauma zu erleiden.
Dschinn nehmen im Inneren von Flaschen, Lampen und in Getränkedosen nur selten Schaden, auch wenn Verletzungen nicht gänzlich unbekannt sind. Dybbuks eigene Großmutter hatte sich einmal eine Gehirnerschütterung zugezogen, als die gläserne Whiskeyflasche, in der sie unterwegs war, unerwartet zu Bruch ging. Und Dybbuk war keine Sekunde zu früh. Im nächsten Augenblick öffnete der Putzmann das Fenster und ließ den Sack in einen darunter stehenden Müllcontainer auf dem Schulhof fallen.
Dybbuks Vorsichtsmaßnahmen sorgten für eine angenehme Landung. Er blieb noch eine Minute an seinem Platz, bis er sicher sein konnte, dass Astor fort war. Dann begann er seine Transsubstantiation und lenkte den Rauch mit seinen Atomen und Molekülen aus der Getränkedose durch das lose zugebundene Ende des Sacks und den Müllcontainer auf den Boden des Schulhofes, wo er schließlich wieder seine irdisch-menschliche Gestalt annahm. Aus Freude über den Erfolg seiner Mission vor sich hin lachend, begab er sich geradewegs zum Haus seines Freundes Brad und klopfte an dessen Zimmerfenster.
»Ich bin’s, Buck. Mach auf.« Dybbuk hasste seinen Vornamen und ließ sich viel lieber Buck nennen – nach dem von Jack London in einem großartigen Roman beschriebenen mutigen Hund, Dybbuks liebster Romangestalt.
Es dauerte ein paar Sekunden, dann ging das Fenster auf und Dybbuk kletterte ins Zimmer, wo ihn ein ungefähr gleichaltriger Junge erwartete. Der Menschenjunge war groß, wenn auch etwas kleiner als Dybbuk, und dünn wie ein Besenstiel, während der junge Dschinn etwas breitere Schultern hatte.
»Du hast doch nicht -«, sagte Brad.
»Ich habe«, erwiderte Dybbuk und faltete mehrere Blätter auf, damit sein Freund sie sich ansehen konnte.
»Ohne Flachs? Das sind wirklich die echten Testfragen?«
»Nicht nur die Fragen«, erklärte Dybbuk stolz. »Auch die Antworten.«
»Wahnsinn«, sagte Brad mit ungläubigem Staunen. »Aber wie hast du das angestellt? Vor Miss Bonos Büro gibt es eine Videoüberwachungsanlage und eine Alarmanlage. Und die Papiere lagen im Safe. Was bist du, Buck? So eine Art Fassadenkletterer?«
Dybbuk hatte seinem Freund nie erzählt, dass er ein Dschinn war, um zu vermeiden, dass dieser ihn um drei Wünsche bat. Selbst Dybbuk wusste, dass es nicht immer gut war, wenn ein Mensch das bekam, was er sich am meisten wünschte. Wünsche werden vom Chaoseffekt beeinflusst, was bedeutet, dass sie manchmal auf eine Weise in Erfüllung gehen, die niemand vorhersehen kann. Also antwortete er ein wenig ausweichend: »Fassadenkletterer? Ja, so etwas Ähnliches.«
»Ehrlich?« Brads Bewunderung für seinen Freund kannte keine Grenzen mehr. »Wie im Film?«
»Ist doch jetzt egal«, sagte Dybbuk und wedelte mit den Testfragen und -antworten. »Wenn wir den Test jemals bestehen wollen, haben wir noch ein paar Stunden Arbeit vor uns.«
Am Tag nach dem Test – den beide Jungen bestanden, und zwar als Klassenbeste – lud Brad Blennerhassits Vater Harry die beiden in ein Lokal in der Stadt ein, das nicht weit von seinem Antiquariat entfernt lag. Brads Mutter lebte nicht mehr, und er und sein Vater standen sich sehr nahe. So nahe jedenfalls, dass der Junge seinem Vater erzählt hatte, wie er zu den beachtlichen Testergebnissen gekommen war. Doch statt einen strengen Vortrag über Schummelei zu halten – den Dybbuk erwartet und mit Sicherheit verdient hatte –, bedankte sich Mr Blennerhassit lächelnd bei Dybbuk.
»Wie bitte?«, sagte dieser und verschluckte sich fast an seinem Hamburger.
»Na, immerhin hast du großes Geschick und Einfallsreichtum bewiesen«, sagte Harry Blennerhassit. »Es gibt nicht viele Jungen, die sich an einem Videoüberwachungssystem vorbeischleichen, eine Alarmanlage überwinden und eine Safekombination knacken können. Das war ein netter kleiner Einbruch, den du da durchgezogen hast, junger Freund. Wirklich ein schöner kleiner Bruch.«
Dybbuk zuckte nur die Achseln und wagte kaum, sich zu der Tat zu bekennen, falls dies eine Art Falle war, die ihn zu einem Geständnis bewegen sollte.
Mr Blennerhassit nippte an seinem Kaffee und schwieg einen Moment. Mit seiner vor Anspannung gerunzelten Stirn, dem breiten, nervösen Lächeln und der kirschgroßen Nase sah er aus wie ein Clown ohne Make-up. »Glaubst du, dass du so etwas noch mal durchziehen könntest? Noch einen Überfall begehen, meine ich?«
Dybbuk sah Brad unsicher an. »Macht dein Dad Witze, oder was?«, fragte er sauer. »Wenn ja, habe ich ein ziemliches Problem damit, dass du ihm überhaupt davon erzählt hast. Außerdem weigere ich mich, auch nur ein weiteres Wort darüber zu verlieren, weil es mich belasten könnte. Wenn meine Mutter Wind von der Sache bekommt, bin ich geliefert. Zwischen uns läuft es auch so schlecht genug.«
»Es ist alles okay, Buck«, beteuerte Brad. »Ehrlich. Lass Dad einfach ausreden, ja? Er hat dir ein geschäftliches Angebot zu machen.«
»In Ordnung«, sagte Dybbuk. »Ich höre.«
»Vor einiger Zeit«, erzählte Mr Blennerhassit, »war ich in München, weil ich dort als Händler seltener Bücher und Kupferstiche geschäftlich zu tun hatte. Dort entdeckte ich in einem alten Laden eine Mappe mit technischen Zeichnungen von Paul Futterneid, einem Schmuckdesigner, der mit dem berühmten Carl Fabergé zusammengearbeitet hat. Ich kaufte die Zeichnungen und stellte fest, dass eine davon den Entwurf eines deutschen Marschallstabs darstellte. Etwa fünfundvierzig Zentimeter lang, aus Elfenbein, mit eingearbeiteten Diamanten und goldenen Adlern. Aber das Interessanteste daran war, dass der Stab einen versteckten Hohlraum enthielt, der sich öffnen ließ, indem man in einer bestimmten Abfolge auf Diamanten und Adler drückte. Als ich dahinterkam, dass dieser Marschallstab Hermann Göring gehört hatte, wurde mir klar, dass der Hohlraum entworfen worden war, um etwas sehr Wertvolles darin zu verstecken.«
»Wer ist Hermann Göring?«, fragte Dybbuk achselzuckend, weil die Art und Weise, wie Harry Blennerhassit den Namen ausgesprochen hatte, nahelegte, dass er eigentlich von ihm gehört haben sollte.
»Ein Nazi – rücksichtslos und brutal. Er war Hitlers Stellvertreter und Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe«, erklärte Brad.
»Und was hat es mit dem Marschallstab auf sich?«, hakte Dybbuk nach.
»Das will ich dir sagen«, fuhr Mr Blennerhassit fort. »1945, einen Monat nach dem Sieg der Alliierten in Europa, als die amerikanischen Truppen in Deutschland Kriegsbeute sammelten, nahm General Patch, der Kommandant der 7. Amerikanischen Armee, Hermann Göring gefangen und vermachte den Marschallstab Präsident Harry Truman als persönliche Kriegstrophäe.«
»Seitdem«, sagte Brad, »ist er ein Ausstellungsstück im Militärmuseum von Fort Benning in Georgia. Er liegt da einfach herum, Buck. Es haben ihn zwar schon viele in der Hand gehabt, aber bisher scheint keiner den versteckten Mechanismus entdeckt zu haben und – was noch viel wichtiger ist – das, was Göring vor seiner Gefangennahme womöglich darin versteckt hat. Vielleicht Diamanten. Göring hatte eine Vorliebe für Diamanten, sagt Dad.«
Dybbuk war fasziniert. Er liebte Geschichten über verlorene Schätze. »Wow«, sagte er. »Ich frage mich, wie viele Diamanten man in einem solchen Stab unterbringen kann?«
»Lass es uns herausfinden, ja?« Mr Blennerhassit legte einen in Luftpolsterfolie gewickelten Gegenstand auf den Tisch. »Ich habe mit Hilfe des ursprünglichen Entwurfs eine Kopie anfertigen lassen, Buck. Dieser Stab hier ist aus Kunstharz gefertigt und die Diamanten sind Imitate, aber er gleicht dem echten aufs Haar.« Er wickelte den gefälschten Marschallstab aus der Folie. Dann drückte er auf die Diamanten und Adler. »Und der Mechanismus funktioniert natürlich tadellos.«
Bei diesen Worten sprang eines der diamantenbesetzten Endstücke auf, und als Harry Blennerhassit den Stab umdrehte, rollte ein ganzer Haufen Paranüsse auf den Tisch. »Das hier sind fünfunddreißig Nüsse«, sagte er. »Wenn jede dieser Nüsse ein Diamant wäre – na ja, du kannst dir den Wert sicher ausmalen.«
»Millionen«, sagte Buck und grinste.
»Ein Drittel von dem, was wir finden, gehört dir, Buck«, sagte Brad. »Du musst nichts weiter tun, Kumpel, als mit Hilfe deiner besonderen Einbrecherqualitäten im Militärmuseum von Fort Benning diesen Stab gegen den echten auszutauschen.«
Dybbuk überlegte kurz. Geld war für ihn nicht von Bedeutung: Da er ein Dschinn war, konnte er über Geld verfügen, wann immer er wollte. Aufregung und Spaß dagegen waren in Palm Springs, wo hauptsächlich alte Leute lebten, schon wesentlich schwieriger zu haben; und der Einbruch, den Brads Dad da vorschlug, hörte sich nach einer Menge Spaß an. Er kam zu dem Schluss, dass es noch nicht mal ein Vergehen wäre – jedenfalls nicht, wenn er den Stab zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurücktauschte. Und was seinen Inhalt anging, so konnte man wirklich schlecht von Diebstahl reden. Dybbuk konnte beim besten Willen nicht einsehen, wie man etwas stehlen konnte, von dessen Existenz im Museum überhaupt nichts bekannt war. Aber konnte er die Sache durchziehen, ohne den Blennerhassits sein kleines Geheimnis zu offenbaren, dass er ein Dschinn war? Denn das würde alles verderben: Sie würden sich mehr dafür interessieren, drei Wünsche gewährt zu bekommen, als für das, was in Görings Marschallstab verborgen war. Von daher könnte es womöglich schwieriger werden, seine wahre Identität vor ihnen geheim zu halten, als die Marschallstäbe auszutauschen.
Schwierig, aber nicht unmöglich. Dybbuk nickte langsam.
»Heißt das, du bist dabei?«, fragte Brad aufgeregt. »Du machst es?«
»Klar mache ich es«, sagte Dybbuk und grinste. Das wird ein Spaß, dachte er.
Sie flogen nach Atlanta, mieteten einen Wagen und fuhren knapp hundert Kilometer nach Süden bis nach Fort Benning, wo sie in einer Pension in der Nähe der Militärbasis Zimmer nahmen. Von dort waren es nur wenige Häuserblocks nach Osten bis zum Infanteriemuseum, wo ein großes Sortiment an Waffen, Uniformen, Helmen, Fahrzeugen und anderen Objekten zur Schau gestellt wurde. Darunter befand sich auch der Marschallstab von Reichsfeldmarschall Hermann Göring.
»Schwer zu glauben, nicht?«, meinte Mr Blennerhassit. »Da liegt er seit Jahren hier und keiner kommt auf die Idee, dass er hohl sein könnte.«
Aber Dybbuk hörte nur mit halbem Ohr zu. Er tüftelte bereits an einem Plan. Beim Anblick einer tragbaren Schnapskiste, die einmal General Ulysses S. Grant gehört hatte, kam ihm eine Idee. Er könnte sich in Rauch auflösen und sich dann in einer der bernsteinfarbenen Glasflaschen verstecken, bis das Museum geschlossen wurde. Das würde kein Problem sein. Doch eine zweite Transsubstantiation mit dem Stab in der Hand würde nicht funktionieren – aus dem einfachen Grund, weil Dschinnkräfte bei Diamanten nicht wirkten. Von daher war klar, dass er den Stab irgendwo verstecken und auf einem anderen Weg hinausschaffen musste. Aber wie? Die Antwort fand Dybbuk im Museumsladen. Und sie war so offensichtlich, dass er über seine Gerissenheit selbst lachen musste. Er würde den echten Marschallstab in einer Posterrolle verstecken und am nächsten Morgen, wenn der Laden wieder aufmachte, einfach das Poster kaufen, das in dieser Rolle steckte.
»Glaubst du, du schaffst es?«, fragte Brad, als er Dybbuk lachen hörte.
»Klar schaffe ich es.«
Dybbuk sah auf die Uhr. Das Museum würde in ein paar Minuten schließen, und da er wusste, dass sich der falsche Marschallstab in Mr Blennerhassits Rucksack befand, bat Dybbuk Harry um den Rucksack. »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen«, sagte er. »Ich erledige es lieber gleich. Aber rechnet nicht vor morgen früh mit mir. Nachdem das Museum wieder geöffnet hat. Okay?«
Harry Blennerhassit nahm den Rucksack ab und reichte ihn Dybbuk, doch dieser konnte sehen, dass ihn etwas beunruhigte.
»Was ist los?«, fragte er. »Kriegen Sie kalte Füße?«
»Vielleicht. Sieh mal, du bist schließlich noch ein Junge«, sagte Mr Blennerhassit. »Wenn das hier schiefgeht, bin ich es, der ins Gefängnis wandert, nicht du.«
»Keine Sorge«, beteuerte Dybbuk. »Ich mach das schon. Vertrauen Sie mir. Ich habe einen guten Geist, der auf mich aufpasst.«
Das stimmte natürlich. Dybbuks Mutter war ebenfalls ein Dschinn, auch wenn sie mit dem, worauf ihr Sohn sich eingelassen hatte, sicher nicht einverstanden gewesen wäre. Mrs Sacstroker ging davon aus, dass Dybbuk sich mit Brad und Mr Blennerhassit die Schlachtfelder des amerikanischen Bürgerkriegs ansah. Das jedenfalls hatte Dybbuk ihr erzählt. Allerdings waren die Gedanken seiner Mutter Dybbuk ziemlich egal. Im Augenblick war Spaß das Einzige, was ihn interessierte.
»Ich weiß, was ich tue, Mr Blennerhassit«, sagte er. »Glauben Sie mir: Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, was ich alles kann.«
Dybbuk hielt ausnahmsweise Wort, und am nächsten Morgen um halb zehn, etwa eine halbe Stunde nachdem das Militärmuseum seine Pforten geöffnet hatte, erschien er mit einem breiten Lächeln im Gesicht und einer großen Posterrolle in der Hand im Gästehaus von Fort Benning.
»Gott sei Dank, es geht dir gut!«, seufzte Brads Vater.
»Natürlich geht es mir gut«, sagte Buck.
»Hast du ihn?«, fragte Brad. »Den Stab?«
»Der Lageplan des Forts ist das hier jedenfalls nicht«, sagte Dybbuk. »Natürlich hab ich ihn.« Er zog den Deckel aus der Rolle und ließ den Stab auf Brads Bett gleiten.
»Er hat ihn wirklich!«, rief Mr Blennerhassit und tanzte einen Moment lang mit Brad durchs Zimmer. Als er endlich aufhörte, stieß er einen lauten Seufzer der Erleichterung aus und schloss die Tür ab. »Ich hatte mir schon ernsthaft Sorgen um dich gemacht, Buck. Du warst so lange fort.«
»Für solche Dinge braucht man Geduld«, sagte Dybbuk. »Und Geduld braucht Zeit. Ansonsten kann man statt einbrechen bald einsitzen, nehme ich an.« Er warf sich neben den Marschallstab aufs Bett und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht: Mit seinen Jeans, dem T-Shirt und den Motorradstiefeln hatte er mehr Ähnlichkeit mit einem Rockstar als mit einem Einbrecher.
»Du musst am Verhungern sein«, meinte Brad, der für seinen Klassenkameraden nur noch grenzenlose Bewunderung empfand.
Dybbuk wollte eben erklären, dass er überhaupt nicht hungrig war, weil er sich im Innern von General Grants Schnapsflasche bereits ein Frühstück zubereitet hatte, doch er hielt sich gerade noch zurück. »Dafür bin ich viel zu aufgeregt «, sagte er stattdessen. »Mann, macht das Spaß!« Er hob die Hand und Brad klatschte ihn freundschaftlich ab.
Mr Blennerhassit nahm den Marschallstab andächtig hoch. »Ich kann kaum glauben, dass ich ihn wirklich habe«, sagte er. »Das ist ein Stück Weltgeschichte, was ich hier in der Hand halte.«
Dybbuk, dessen geschichtliches Interesse sich auf alte Kriegsfilme beschränkte, lächelte nachsichtig. »Sieht so aus«, sagte er und wartete darauf, dass der Mann endlich zum interessanten Teil überging.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:
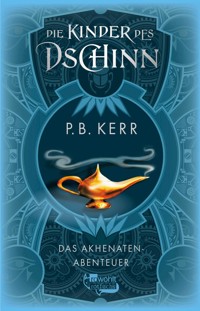
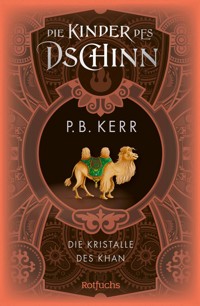
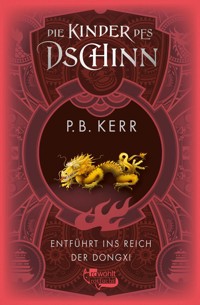
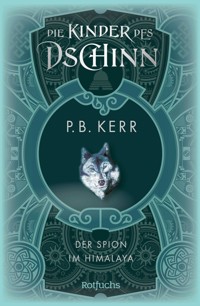
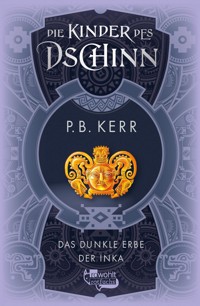
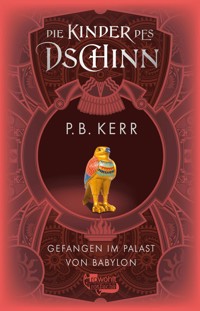













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









