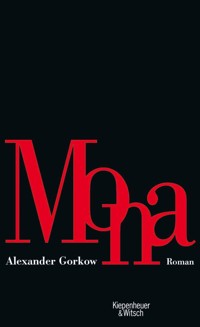9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander Gorkows autobiografischer Roman ist ein Wunderwerk der Poesie, das glänzende Portrait einer versunkenen Zeit, zugleich eine Hommage auf unsere Kindheit und die rätselhafte Kraft der Musik in einer Welt voller Risse – zwischen Gesunden und Kranken, Behinderten und angeblich Normalen, zwischen Armen und Reichen, zwischen Ordnung und Chaos. Die 70er Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der »ZDF Hitparade«. Das kleine Land weist gepflegte Gärten auf, die Kriegsgräuel sind beiseite geschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die Einbauküche daheim überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs des Bösen gegen das Gute. Neben brutalen Mitschülern, prügelnden Pfarrern und zynischen Ärzten leben in seiner Phantasie überall weitere Monster: der furchterregende Sänger Heino, ein Mann namens Barzel in einer rätselhaften Stadt namens Bonn sowie die Wiedergänger der Templer aus »Die Nacht der reitenden Leichen« im Dorfkino. Der gute Leitstern aber ist die umwerfende große Schwester – das Kind Nr. 1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den Kämpfern gegen das Establishment, deren Songs alles zum Glänzen bringen. Unter Anleitung von Pink Floyd zieht die Schwester mit ihrem kleinen Bruder in den Kampf, um das Böse zu bannen, sein Stottern, seine Ängste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Alexander Gorkow
Die Kinder hören Pink Floyd
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alexander Gorkow
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alexander Gorkow
Alexander Gorkow, geboren 1966 in Düsseldorf, ist Schriftsteller und Journalist. Seine Reportagen, Essays und Interviews in der »Süddeutschen Zeitung« sind vielfach ausgezeichnet worden. Er lebt in München.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die 70er-Jahre. Eine Vorstadt. Das Westdeutschland der letzten Baulücken, der verstockten Altnazis, der »ZDF Hitparade«. Das kleine Land weist gepflegte Gärten auf, die Kriegsgräuel sind beiseitegeschoben, zum Essen geht es in den Balkan Grill, die Einbauküche daheim überzeugt durch optimale Raumnutzung. Für den 10-jährigen Jungen aber ist es eine Welt der Magie, der geheimen Kräfte, des Kampfs des Bösen gegen das Gute.
Neben brutalen Mitschülern, prügelnden Pfarrern und zynischen Ärzten leben in seiner Phantasie überall weitere Monster: der furchterregende Sänger Heino, ein Mann namens Barzel in einer rätselhaften Stadt namens Bonn sowie die Wiedergänger der Templer aus »Die Nacht der reitenden Leichen« im Dorfkino.
Der gute Leitstern aber ist die umwerfende große Schwester – das Kind Nr. 1 der Familie. Sie ist herzkrank und sehr lebenshungrig. Mit trockenem Humor und großer Aufsässigkeit stemmt sie sich gegen alle Bedrohungen, nicht zuletzt mithilfe der vergötterten Band Pink Floyd aus dem fernen London, den Kämpfern gegen das Establishment, deren Songs alles zum Glänzen bringen. Unter Anleitung von Pink Floyd zieht die Schwester mit ihrem kleinen Bruder in den Kampf, um das Böse zu bannen, sein Stottern, seine Ängste.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Manuela
Supernova
Monster
Matinee
Mongo
Reißmüller
Supernova II
Eclipse
Epilog
Für Marek Lieberberg
One of these days I am going to cut you into little pieces
PF, 1971
Manuela
In der Grundschule an der Witzfeldstraße steht das Fräulein Lehrerin im Gang neben dem Casala-Tisch, ich bemerke es nur vage, es steht am Rande der Welt, denn ich schaue nicht hin, sondern durch das Fenster zum Himmel und erwarte dort oben das Erscheinen der Pyramide. Es ist eine Frage großer Konzentration. Wenn ich mich bemühe, werde ich die Pyramide am Himmel sehen, und dies bedeutet: Es besteht Kontakt zu Pink Floyd. Am Casala-Tisch neben mir sitzt Hubertus Irenäus Wendtland. »Hubi« Wendtland war aus der Sonderschule zu uns gestoßen, seine Mutter hatte ihn in die Klasse gebracht, sie hatte Hubi abgeliefert. Es gehe nun darum, erklärte das Fräulein Lehrerin damals, dass Hubi und wir uns mischen.
Hubi Wendtland Gangseite, Fensterseite ich.
Das Fräulein Lehrerin steht im Gang neben Hubi, der die Hände vor das Gesicht hält, weil es jetzt spannend werden könnte.
An jedem Morgen in der Schule kriecht Müdigkeit aus schwerem Eisen heran, gleich nach dem ersten Gong, wenn der Chor der kleinen Stimmen hell jammert: »Guten Morgen, Fräulein Lehrerin.« Reißen an den Kiefern, Gähnen, brennende Augen, stehende Zeit in schwerer Luft. Es ist mir nicht gestattet, wie dem Vater, daheim eine Weile auszuruhen und dann gestärkt wieder zu erscheinen (Zorn über diese Ungerechtigkeit, eine Unruhe, die für Sekunden durch das Kind flattert und es von innen kitzelt). Seitlich hänge ich vom Stuhl herab, ich sehe unter der Tischplatte, knapp unterhalb des Häkchens für den Turnbeutel, die dreieckige schwarze Plakette der Lauenauer Schulmöbelfabrik Casala.
Jetzt, an diesem Tag, sitze ich aufrecht und schaue aus dem Fenster, ich schaue über die Blumenhandlung Schmill hinweg, und dann geht der Blick hoch. Hier verharre ich zwischen den Wolken, denn nur wer gründlich schaut und wirklich verharrt, der sieht. Ich weiß, dass sich am Himmel die Pyramide, das weiße Licht und die Regenbogenfarben materialisieren könnten. Nur durch erhebliche Konzentration entsteht in der Atmosphäre die wichtige Vibration, sie führt zur Kontaktaufnahme mit Pink Floyd in London, den vier ernsten Männern, die alles verstanden haben.
Man war zu Beginn des Schuljahres gebeten worden, sich einander zuzuteilen, indem sich jedes Kind ein anderes Kind sucht, das entsprechende Kind sichert, indem man sich mit ihm an der Hand vor die Treppe in den ersten Stock stellt. Wichtiger als alles andere sind Ordnung, Zuteilung und Ruhe. Der Direktor, ein großer, alter Mann in einem dunkelgrünen Anzug, hatte am ersten Schultag über den Hof gerufen: »Schule ist Ordnung!« Das war sehr beeindruckend gewesen. Vier erste Klassen standen damals in Blöcken auf dem Schulhof, wir linsten gegen die Sonne den Direktor an, der unter einer Kastanie am Rande des Schulhofs Schatten gefunden hatte. Dreimal hintereinander gab er die Losung für die kommenden Jahre vor: »Schule ist Ordnung!« Er hob den Kopf und schaute in die Luft, als ob er der Bahn eines Vogels folgte. Dann musterte er wieder die Kinder, er musterte mich, ich war sicher. In Wellen verteilte sich vom Bauchnabel weg die Information, zu verharren, bis alles vorüber war und der Blick des gewaltigen grünen Mannes ein anderes Kind gefunden hatte. Atme.
Die ersten Jahre war ich an der Hand von Claudette in die Klasse gegangen. Claudette war mir verlässlich erschienen und schön. Mit ihr war alles immer gleichmäßig gewesen, ohne Anfang und Ende, man konnte in Ruhe atmen. Sie lächelte oft, als ob sie etwas wüsste, als hätte sie eine Botschaft erhalten, über die sie noch nicht reden durfte. Dieses Geheimwissen versetzte sie in einen Zustand der Ruhe und Fürsorge, während andere aus dem Dorf unvermittelt zuschlugen. Claudette erschien als Abbild der Mädchen aus den Büchern, aus denen der Vater abends vorlas. Es waren patente Zauberwesen, die aber in diesen Geschichten vergiftet, verbrannt oder vom Wolf gefressen wurden. Meine Aufgabe war es, für Claudette zu sorgen und sie vor den Monstern zu beschützen, während in Wahrheit vor allem sie für mich sorgte. Claudette erinnerte mich daran, zu atmen. Wer nicht atmet, fällt um.
Wenn man sein Rad in die kleine, quadratische Werkstatt zu Herrn le Bron am Deutschen Eck brachte und sagte »Guten Tag, Herr le Bron, mein Schutzblech …«, schrie Herr le Bron von drinnen schon los. Herr le Bron war immer ein Anlass, um die Luft anzuhalten. Sah ich ihn, hörte ich auf zu atmen. Das Rad habe draußen zu bleiben, schrie Herr le Bron aus der Werkstatt raus, kein Platz. Was man sich erlaube, das Rad reinzuschieben, raus mit dem Rad. Dann kam Herr le Bron die rote Steintreppe runter und trat draußen auf der Straße gegen das halb lose Schutzblech. Wichtig war, so lange gegen das Schutzblech zu treten, bis es abfiel. Alle Büdericher, die am Deutschen Eck einkauften, und auch die, die nur dort herumstanden, weil der Tag so lang war und noch nichts im Fernsehen kam, sie schauten, damit sie nichts verpassen. Was war denn da wieder los bei le Bron vor der Werkstatt, mal sehen.
Herr le Bron schrie, wie das Qualitätsrad aussehe, wie verdreckt das Qualitätsrad sei. Was die Eltern wohl zum Zustand des Qualitätsrads zu sagen hätten, war das Rad nicht erst wenige Jahre alt, die Eltern seien wohl reich? Richard le Bron, der Junge aus der Parallelklasse mit dem harten Kopf und den stumpfen Händen, kam kurz nach seinem Vater aus der Werkstatt gelaufen, die durch einen schmalen gelb gekachelten Flur mit der Küche verbunden war. Richard trat jetzt auch gegen das Rad. Er rief: »Wie hängt das Licht denn da? Das fällt auch bald ab.« Herr le Bron verschwand in der Werkstatt, er trampelte durch die gelben Kacheln in die Küche zurück, er kam wieder mit einem Diebels und dem Auftragsbuch (die öligen, präzisen Fingerabdrucke im fettigen Auftragsbuch), während Richard draußen weiter gegen das Rad trat, bis endlich auch das Licht hinüber war und an einem Kabel von der Lenkstange hing. Schade um das Qualitätsrad, das Licht müsse sein Vater jetzt auch noch machen.
Zu Beginn des neuen Schuljahres hatte das Fräulein Lehrerin verfügt, dass sich alle Kinder neu mischen. Einige Kinder hatten geweint, andere geschrien, ich verstand nicht, was das heißen soll, sich neu mischen, nachdem wir schon Hubi mit reingemischt hatten. Ich ergriff Claudettes Hand und hielt die Luft an. »Atmen«, flüsterte Claudette, »oder ich sag es deiner Mutter.« Sie löste sich aus meiner Hand, ging rüber zum Fräulein Lehrerin, besprach freundlich die Lage, das Fräulein Lehrerin schüttelte den Kopf, Claudette kehrte zurück.
»Nichts zu machen. Du gehst dieses Jahr mit Hubi.«
Hubi Wendtland und ich peilten uns ruhig in der Menge an, die sich in einer schnellen Auslese aus gespannten Körpern, geballten Fäusten, greifenden Händen sortierte. So standen wir schließlich an der Treppe, er schaute mich erst an und lachte dann, und seine Hand grabbelte unten nach meiner Hand. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er mir eine reinhaut, Hubi hatte überhaupt noch nie wem etwas angetan. Wenn wiederum er geschlagen wurde oder die Kopfnuss bekam oder die Brennnessel am Arm oder eben alles zugleich, ging er in die Hocke, rollte sich ein und wartete, bis alles vorüber war. Mal hatte Hubi derweil geweint, mal nicht, mal hatte er etwas gerufen von unten in seiner Sprache.
»Bitte findet ein Ende!« Oder: »Vermaledeit!«
Richard le Bron war wegen Hubis Sprache immer noch wütender auf ihn geworden. Alle anderen Kinder hatten einen Kreis gebildet, in der Mitte unten der eingerollte Hubi, oben der Schläger, meistens also Richard le Bron, das Parallelklassen-Inferno, gemeinsam mit »Panzerfrank« (Frank Schmellerkamp), Panzerfrank war Richards Hintersasse. Oder Richard verteilte die Kopfnüsse, und Panzerfrank rief zugleich »Hier kommt der Brennnesselmann!«, und so verdrehte Panzerfrank die Haut auf Hubis Armen, die er zum Schutz um seinen Kopf geschlungen hatte, und Hubi rief unten wie aus einer Höhle: »Haltet ein!« Mischte sich wer ein, brüllte Richard: »Wenn du petzt, sperrt mein Vater dich in die Werkstatt!« Panzerfrank rief »Genau!«, Panzerfranks Vater war ein hohes Tier bei Rheinmetall.
Es war immer richtig, Richard le Bron und Panzerfrank aus dem Weg zu gehen.
Hubi war, wie man sagte, ein Mongo. Er war ein armer Junge, also kannst du nie wissen, was er noch ausheckt neben seiner komischen Sprache, die sich immer wieder aus Worten zusammensetzte, die wir noch nie gehört hatten, und wenn, dann von unseren Eltern, wie »Obacht« oder »in Anbetracht«.
Hubi war in der Mitte des zweiten Schuljahrs in die Klasse gekommen, draußen hatte Schnee gelegen, auf dem Tisch des Fräulein Lehrerin stand ein Adventskranz mit vier Kerzen, von denen zwei brannten, und es gab einen Pappteller mit Keksen. Die Welt war nicht hell, wie im Sommer. Es war kalt und feucht, in der Klasse bollerte die miese Heizung, ständig brannten die verdammten Kerzen und nadelten die Kränze. Auf dem Boden taute der hereingetragene Schnee zu Seen, aus den Nasen lief der Rotz, all das Keuchen und Husten, die kleinen, nassen Handschuhe, und Kinder, die lieb gewesen waren, durften sich beim Gong einen Keks aussuchen und ihn mit in die Pause nehmen.
Hubi war an einem dieser Tage von seiner freundlichen und weinenden Mutter, Frau Wendtland, an der Tür abgegeben worden wie eine Lieferung. Frau Wendtland sah vollkommen anders aus als Hubi, als wäre entweder sie oder Hubi von einem anderen Stern, ich schaute abwechselnd auf Frau Wendtland und auf Hubi. Er stand in der Tür und wurde von uns betrachtet, mal stellte er den rechten Fuß nach vorne, mal den linken. Er sah nicht aus wie ein Japaner, aber so, als wäre ein Japaner in Hubi reingeraten. Frau Wendtland hingegen sah aus wie die anderen Frauen im Dorf. Wie Japaner aussehen, wusste ich, denn viele von ihnen wohnten in unseren Straßen, die Kinder der Japaner gingen in Düsseldorf zur Schule. Hubi lächelte in die Klasse, rechter Fuß vor, linker Fuß vor, Frau Wendtland umarmte Hubi von hinten und kreuzte die Hände vor Hubis Brust. Dann schluchzte sie. Still schauten wir auf Frau Wendtland.
Das Fräulein Lehrerin verabschiedete Frau Wendtland, man hörte Hubis Mutter noch einmal hinter der schon verschlossenen Tür des Klassenzimmers aufheulen, aber als das Fräulein Lehrerin die Tür zur Kontrolle noch mal öffnete, um nachzusehen, war Frau Wendtland weg.
»Nicht mehr da«, sagte das Fräulein Lehrerin und schloss die Tür. Sie lächelte Hubi an, rieb sich die Hände, und Hubi sagte: »Somit bin ich also auf mich allein gestellt.« Hubi ging mit großen Schritten in die letzte Reihe zur gestörten Ingeborg Wermelsdonk, die dort bisher alleine gesessen hatte. Alle redeten umher und zappelten und schauten Hubertus Irenäus Wendtland an. Das Fräulein Lehrerin sagte, Hubertus sei ein Kind wie jedes andere.
Hubi umarmte dann Ingeborg und küsste sie, und Ingeborg schlug um sich. Das Fräulein Lehrerin musste die Sache entschärfen und eilte zurück an die Tafel. Schon zeigte Hubi auf, er rief, dass er von nun an am Ende eines jeden Schultages dafür Sorge tragen werde, dass alle Stühle auf den Tischen stehen, sodass die Putzfrau unten schön bohnern könne.
»Hubert, danke, aber jedes Kind stellt bei uns seinen Stuhl nach dem letzten Gong in Eigenverantwortung auf den Tisch.«
»Ich stelle alle Stühle hoch, damit die Putzfrau unten schön bohnern kann, Fräulein Lehrerin. Ich werde dafür Sorge tragen.«
»Hubert, danke, aber jedes Kind stellt bei uns seinen Stuhl nach dem letzten Gong in Eigenverantwortung auf den Tisch.«
»Ich stelle alle Stühle hoch, damit die Putzfrau unten schön bohnern kann, Fräulein Lehrerin. Ich werde dafür Sorge tragen«, rief wieder Hubi.
»Hubertus!«, rief das Fräulein Lehrerin.
Hubi Wendtland ließ sich vom Stuhl fallen, er schlug mit der Faust auf den Boden und rief: »Jetzt schlägt es 13!« Es sei genug, er halte es schon jetzt nicht mehr aus, wo die Mutter sei, er wolle heim.
Jeden Mittag durfte Hubi Wendtland nun warten, bis die Kinder den Raum verlassen hatten. Das Fräulein Lehrerin lächelte und sagte: »Also, Hubert, los.« Wenn alle Kinder draußen waren, schauten einige von uns vom Flur aus durch die Tür des Klassenzimmers. »Hubi, bitte!«, sagte das Fräulein Lehrerin. Reihum, beginnend am Pult der Lehrerin, hob Hubi all die Stühle wieder von den Casala-Tischen herunter, stellte sie in jeweils gleichem Abstand vor die Tische auf den Boden. War er fertig mit Runterstellen, machte er eine Pause. Er atmete stark. Dann stellte er alle Stühle, beginnend wieder am Pult der Lehrerin, sorgsam vom Boden zurück auf die Tische. Er prüfte, ob die Stühle oben auf den Tischen mittig standen, damit sie nicht hinunterfallen, wenn die Putzfrau beim Bohnern irgendwo anstößt. Am Ende prüfte Hubi mit einem Rundblick, ob alles seinen Vorstellungen entsprach, er schaute auf die Uhr über der Tür zum Klassenzimmer. Stets rief er dann »Oh, heute bin ich aber spät dran!« und raste los.
Hinten waren zu Beginn des neuen Schuljahres wieder Kinder übrig geblieben, sie wurden vom Fräulein Lehrerin zugeteilt, und das letzte Kind, Ingeborg Wermelsdonk, fand niemanden, wen sollte Ingeborg finden, wenn es 23 Kinder waren, es aber schon elf Paare gab, und deshalb durfte Ingeborg, wie letztes Jahr, von nun an immer nach der Pause mit dem Fräulein Lehrerin die Treppe hoch und dann ab in die Bank in der letzten Reihe.
Vor der ersten Stunde, ebenso am Ende der ersten großen Pause, erwarte ich Hubi seither an der geschwungenen Treppe zum Klassenzimmer im 1. Stock, auf der wir als Zweierreihe vorzurücken haben. Das Fräulein Lehrerin spricht gegenüber den Eltern davon, dass man einen Mongoloiden mitnehme im Klassenverband, so wie auch Onur, den Türken. Onur war draußen auf der Rheinwiese auf die Welt gekommen, als die Eltern mit den vier Geschwistern und dazu den Onkels und Tanten Richtung Lörick spazieren gegangen waren, und so rief Onur immer wieder: »Ich bin am Rhein geboren, direkt am Fluss!«
Der Ursprung von Ingeborgs Störung war unklar, aber sie war wirklich heftig. Sagte ich daheim »Die Ingeborg ist plemplem«, sagten die Mutter, der Vater und die Schwester zugleich: »Das sagt man nicht.« Meine Schwester sagte, im Dorf erzähle man sich, dass Ingeborg Wermelsdonk zwar die Tochter ihrer Mutter Annemarie Wermelsdonk sei, nicht aber das leibliche Kind ihres Vaters Horst Wermelsdonk von »Heißmangel, Reinigung und Ausbesserung Wermelsdonk«. Vielmehr sei Ingeborg Wermelsdonk das Kind von Frau Wermelsdonk und Frau Wermelsdonks Cousin in der Eifel. Der Vater von Ingeborg sei der Sohn der Schwester von Frau Wermelsdonks Mutter. Der eine Teil der Familie kümmert sich um die Reinigung in Büderich, der andere, also Ingeborgs väterlicher Teil, um die Näh- und Ausbesserungsstube in Prüm in der Eifel. Gibt man in Büderich eine Hose zum Engermachen bei Herrn und Frau Wermelsdonk ab, wird die Hose zunächst in die Eifel gefahren zu Frau Wermelsdonks Cousin, der offenbar der Vater von Ingeborg ist. Nach ihrer Rückkehr aus der Eifel wird die Hose dann in Büderich noch gereinigt. Ingeborgs Mutter, Frau Wermelsdonk, sagt, ihr Cousin in der Eifel »näht wie der Teufel«, auch Leder.
Hubi, der überraschend am Rheinufer geborene Onur und Ingeborg stehen mir nah, neben der vom Fräulein Lehrerin aus meinem Leben sortierten Claudette.
Hier und da holt mich darüber hinaus in einem Rolls Royce in der Farbe Silbermetallic Herr Greulich ab, der Fahrer der Brenners im Villenviertel am Waldrand. Dann besuche ich Leviathan Brenner, Leviathan geht auch in meine Klasse und bleibt unauffällig. Leviathan sagt, es sei für ihn lebensentscheidend, dass er sich unauffällig verhalte, seine Mutter habe ihm das eingetrichtert, also hält er sich daran. Die Familie Brenner ist, wie die Schwester sagt, eine Dynastie, was immer das sein mag, ich weiß es nicht, ahne aber die Richtung.
Leviathan lebt in dem großen, ja endlosen Haus am Waldrand alleine mit der Mutter, Frau Brenner, da der Vater ausgezogen ist. Leviathans großer Bruder lebt beim Vater und dessen neuer Frau. Frau Brenner ist groß und hat lange rote Haare, sie trägt einen Morgenmantel aus türkisfarbener Seide, sie ist barfuß, und sie wirft Goldbarren in den Pool, Leviathan taucht dann nach Gold. Das Haus von Frau Brenner ist so groß, dass ich mich, wenn ich vom Pinkeln komme, verlaufe und in einem Flügel des Hauses lande, den ich, wie mir scheint, bis dahin noch nie betreten hatte. Immer wieder stehe ich vor weiten Fluchten und habe die Auswahl zwischen vielen weißen Türen, die einen goldfarbenen Türrahmen haben und auch Klinken aus Gold. Öffne ich eine der Türen, stehe ich zum Beispiel in einem Kino mit runden, tiefen Sitzen, in denen man verschwindet wie in einem Ei.
Ich habe keine Ahnung.
Es gibt, wie ich auf meinen Irrwegen sehe, hinter den weißen Türen immer wieder neue Zimmer, in denen Laken über Möbeln und über flachen, weiten Autos liegen. Es gibt Kartons mit Wein und ein großes Regal, eine ganze Wand entlang, bis unter die Decke vollgestellt mit den roten Campariflaschen von Frau Brenner. In einem Raum stehen in hohen Glasvitrinen silberfarbene Pokale, verbunden durch in der Sonne zitternde Spinnweben, und Leviathan sagt, die habe sein Vater beim Segeln in Amerika und Australien gewonnen, und auf den Lofoten habe der Vater beim Segeln das Polarlicht gesehen, ein Schauspiel aus Licht. Ich nehme mir vor, daheim die Schwester nach den Lofoten zu fragen.
Ich stehe mit Leviathan unten in einem der beiden Kellergeschosse zwischen den Pokalen und frage, was man auf den Lofoten tun muss, um am Himmel das Schauspiel aus Licht zu sehen, und Leviathan sagt: »Segeln.«
Sind Leviathan und ich beschäftigt und sitzt Herr Greulich draußen zufrieden in seinem Rolls Royce in Silbermetallic und liest die Rheinische Post, so legt Frau Brenner im Wohnzimmer Rod Stewart auf und tanzt. Im Wohnzimmer stehen auf einem Servierwagen ausschließlich Campariflaschen, womöglich 20. Ich kenne Campari von daheim, meine Mutter trinkt ebenfalls Campari, aber bei uns steht immer nur eine Flasche auf der Anrichte im Wohnzimmer, neben den Büchern, dazu der Cognac und der Calvados vom Vater und eine Flasche Whisky, aus der nie getrunken wird. Wenn die Campariflasche fast leer ist, entsteht zwischen den Eltern eine Diskussion darüber, dass die Flasche sich dem Ende entgegenneigt, dass besser bald wer neuen Campari besorgt, etwa die Mutter im Supermarkt Otto Mess oder der Vater auf dem Heimweg vom Büro in Heerdt in der Spirituosenhandlung von Herrn Hirn.
Ich denke, wenn ich bei Leviathan zu Besuch bin, dass Frau Brenner besonders schön ist, aber etwas älter als die Jungfrauen aus der »Nacht der reitenden Leichen«.
In die Küche von Frau Brenner involviert, wie Frau Brenner sagt, ist ein Gerät, das leere Konservendosen zusammenpresst, sodass sie so klein wie Spielwürfel herauskommen. So etwas können sich nur Menschen leisten, die reich sind. Ich habe bis dahin geglaubt, meine Familie und ich auf der Bonhoefferstraße seien reich, denn wir fliegen in den Urlaub nach Spanien, anders als die anderen auf der Straße, die meisten müssen mit dem Auto nach Jugoslawien oder auf den Campingplatz in die Eifel. Wir gehen auch einmal die Woche in den Balkan Grill und bestellen für vier Personen die Gurman-Platte. Der Vater fährt einen Citroën DS wie die Staatschefs in Frankreich. Ich lerne aber von der Schwester, dass wir nur aus dem Mittelviertel des Dorfes kommen, nicht aus dem Villenviertel. Die Schwester sagt: »Wir sind nicht reich, wir haben nur sehr viel Geld.« Reichtum bedeute nicht, sehr viel Geld zu besitzen, sondern derartig viel Geld, dass das Geld seinen Zustand verändere, es werde flüssig, gasförmig, es sei nicht mehr zählbar, es sei immer da, egal, wie viel man ausgibt, immer sei weiteres Geld da.
Es sei bei Brenners und den anderen Bonzen mit dem Geld wie mit dem Sand am Meer.
»Sag, kleiner Mann, habe ich dir gezeigt, was in unsere Küche involviert ist?«, ruft Frau Brenner. Sie stellt den Campari mit den Eiswürfeln ab und klatscht in die Hände. Sie öffnet elektrisch an einem Gerät oben in der Wand zwei Dosen Erbsen, die Dosen drehen sich im Gerät, bis die Deckel sich lösen und am Magneten kleben bleiben, sie schüttet die Erbsen in einen der Kupfertöpfe auf dem Herd und lacht. Sie legt dann die leeren Dosen in den aus der Anrichte gezogenen Behälter neben der Spülmaschine, schiebt den Behälter zurück in die Küchenzeile, schließt die Tür und dreht an einem Schalter. Man hört nun ein Brummen. Die Anrichte mit den leeren Dosen drin vibriert. Es folgt ein knappes Röcheln, als würde jemand erwürgt. »Halt dich fest, Spatz!«, ruft Frau Brenner, sie zieht den Behälter aus der Anrichte, und die Dosen liegen da klein wie Spielwürfel.
»So sparen wir eine Menge Platz!«, singt Frau Brenner. (Wieso müssen die Brenners Platz sparen?) Frau Brenner schaut dann mit einem Mal ratlos, ja traurig in den Kupfertopf. Sie hält uns den Topf hin, in dem die nassen Dosenerbsen liegen, die riechen, als müsste gelüftet werden. »Wollt ihr Erbsen?«, ruft sie. Leviathan und ich schütteln den Kopf. Frau Brenner kippt die Erbsen in den Müll, sie wirft die zwei Würfel aus der Dosenzerkleinerungsmaschine hinterher.
»Geht schwimmen! Ich komme mit dem Gold, wenn ich die Zeit dazu finde!«
Sie geht ab mit der Campariflasche in der Linken, einem Glas, das in der Sonne funkelt, und einem Kübel mit Eiswürfeln in der Rechten, sie öffnet mit dem Ellbogen die Schiebetür zum Wohnzimmer mit dem orangefarbenen Teppich. Wir hören die Stimme von Rod Stewart. Leviathan sagt, als wir die Treppe zum Pool hinabgehen (der Geruch von warmem Chlor): »Meine Mutter ist spitz auf Rod Stewart.«
Neben dem Pool sitzt Frau Brenner in ihrem Morgenmantel, sie trinkt auch hier Campari und raucht, im Sommer auch draußen vor der Scheibe zum Garten. Wenn Leviathan Brenner seine Mutter bittet, gibt sie sich die Ehre, wie Leviathan es nennt. Frau Brenner findet dann die Zeit, sie geht ab und erscheint wieder, nun mit einem braunen Stoffbeutel vom Bankhaus Brinck & Pfeiffer, darin kleine Goldbarren, auf einigen steht »Brinck & Pfeiffer«, auf anderen »Degussa« oder »Olympische Spiele München 1972«. Frau Brenner geht langsam und aufrecht ans Ende des Pools, wo das Wasser tief ist. Hier steht, an der Kante zum Becken, ein Korbstuhl aus dem Garten mit einem Polster aus Tigerfell. Sie stellt den Campari sorgsam auf den Boden neben das schlürfende Gitter, erhebt sich, wendet sich mit einem nur kleinen Ausfallschritt zum Korbstuhl hin und setzt sich. Sie stellt nun ihre langen, schmalen Füße auf das schlürfende Gitter und wackelt mit den nassen Zehen. Nun endlich nimmt Frau Brenner einen der kleinen Barren aus dem Beutel, beugt sich vorsichtig aus dem Stuhl heraus nach vorne über das Wasser, sie presst die Füße zur Sicherheit feste auf das Gitter, streckt den Arm mit dem Goldbarren aus.
Sie schaut von hier, vom Ende des Pools, aus ihrem Sessel zu uns hinüber, die wir am Anfang stehen, dort, wo das Becken flach ist und eine Treppe ins Wasser führt. Frau Brenner, den Arm mit dem Barren über dem Wasser, ruft: »Schaut mir in die Augen, bitte!«
Sie lässt das Gold ins Wasser gleiten.
Der Punkt fällt überraschend schnell durchs Blau, eine kleine Sonne. »Und: Bitte!«, ruft Frau Brenner. Leviathan muss durch den Pool tauchen, vom flachen ins tiefe Wasser, immer am Boden entlang, sonst gilt es nicht, er muss den Barren finden und sichern. Erwischt er das Gold und bringt es hoch, darf er es behalten. Überall im Zimmer von Leviathan Brenner im zweiten Stock liegen die kleinen Barren herum. Ich tauche auch nach Gold, gebe die Barren aber bei Frau Brenner ab, die lacht und sich freut (»Gut gemacht, Spatz!«). Sie legt meine Barren zurück in den Beutel von Brinck & Pfeiffer, holt sie wieder raus, wirft sie in den Pool, und dann ist Leviathan dran.
Am Ende eines wieder ereignisreichen Nachmittages steige ich bei Herrn Greulich in den nach Leder riechenden Wagen in Silbermetallic, und still fahren Herr Greulich und ich zurück auf die Bonhoefferstraße im Mittelviertel. (Sein Lederetui mit den Pfeifen und Tabaken neben der Rheinischen Post auf dem Beifahrersitz.) Herr Greulich hat die Erlaubnis, im Wagen bei geöffnetem Fenster Pfeife zu rauchen, während er vor dem Haus im Villenviertel oder sonst wo wartet, meistens auf Frau Brenner, auch auf Leviathan, wenn er Nachhilfe hat oder Fechten. Herr Greulich bringt mir bei, nach der Ankunft auf der Bonhoefferstraße so lange sitzen zu bleiben, bis er um den Wagen herumgegangen ist, um hinten rechts meine Wagentür zu öffnen. Er sagt: »Junger Freund, auf Wiedersehen.«
Das Klärwerk Düsseldorf-Nord in Meerbusch-Ilverich schenkt dem Rhein sauberes Wasser, und über dem breit und still vorüberfließenden Fluss fächert sich der Himmel des Niederrheins, an dem sich die Pyramide zeigen kann, ins Unendliche.
Auf dem Gelände des Klärwerks stehen Hubi und ich neben runden oder rechteckigen Becken, in denen graues Wasser mal ruht, dann wieder Blasen wirft, da in den blasenwerfenden Becken Bakterien aktiv sind. Bakterien sind entsetzliche Wesen. Bei Licht betrachtet kennt man sie aus den Monsterfilmen, die am Sonntag in der Kinder-Matinee bei den Horstbroichs im Kino zu sehen sind. Die Bakterien sind zwar kleiner als die Körperfresser, die Rächer, die lebenden Toten und die haushohen Echsen im Kino, aber hier in der Stadtentwässerung Düsseldorf-Nord gibt es dafür mehr von ihnen. Im Kino wähne ich mich in Sicherheit, denn ich habe die Schwester dabei, auf sie kann ich mich verlassen, und ich habe eh keine Angst vor Godzilla, King Kong und auch nicht vor dem Orden der Templer aus der »Nacht der reitenden Leichen«, die aus ihren Gräbern steigen, um Jungfrauen zu schänden.