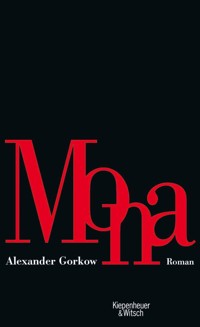12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alexander Gorkow: Seine besten Interviews aus der legendären Reihe im SZ WochenendeWer auch nur eines von ihnen liest, bemerkt sofort: Diese Interviews sind anders als andere – intensiver, lustiger, inniger, überraschender, offener.Seine Auswahl ist total subjektiv, aber dann wagt Alexander Gorkow alles. Wo andere mit vollgeschriebenen Notizblöcken anrücken, paukt sich der Leiter des »SZ Wochenende« die Biographien seiner Gesprächspartner ein und rückt dann mit einem Notfall-Zettel an, auf dem höchstens fünf Fragen stehen – für den Fall peinlicher Pausen. Sein Credo lautet: »Wenn ich ständig auf meine Fragen schaue statt in die Augen meiner Gesprächspartner, ergibt sich kein Gespräch.« Der Verlauf seiner Interviews gibt ihm recht: Entweder geht alles flamboyant in die Hose (wie mit Lou Reed), oder Weltstars wie Jeanne Moreau, Sylvester Stallone oder Eric Clapton reden so offen wie selten zuvor. Oft färbt Gorkows Spontaneität auf die Interviewpartner ab, sodass plötzlich Dinge gesagt werden, die sonst der inneren Selbstzensur zum Opfer fallen – wie im Interview mit Steve Martin, bei dem Gorkow kurzfristig als Ersatz für eine Kollegin einsprang und ganz ohne Fragen dastand.Dieser Band versammelt eine Auswahl seiner besten Interviews. Gorkow redet mit der hinreißenden Amira Casar über Europa, mit Lou Reed über Hass, mit der Underground-Filmikone Klaus Lemke über Jungs und mit dem Konzertagenten Marek Lieberberg über Ereignisse. Mit David Gilmour geht es um Erfolg, mit Louis Begley ums Schreiben, mit Sylvester Stallone um Werte und mit Mick Jagger um Klasse. Auch seine jüngsten Interviews finden sich hier: mit Helen Mirren, die über Image spricht, mit Neil Diamond, den Gorkow in seinem Studio in L.A. besuchte, und mit dem Ex-»Monty-Python«-Star Michael Palin, mit dem Gorkow über die Eigenarten der Engländer sprach.Eines ist dabei immer klar: Während Gorkow und seine Auserwählten drinnen über den Ernst des Lebens sprechen, macht die Welt draußen weiter, was sie will. Oder, wie Gorkow im Studio von Neil Diamond in L.A. seufzt: »Und draußen scheint die Sonne.« »Bezaubernd klug, nachdenklich heiter, anmutig konkret, unauffällig welthaltig. Wer die gegenwärtig beschworene Total-Krise des deutschen Journalismus beklagen möchte, der müsste vorher Gorkows Interviews sorgfältig lesen. Dann könnte er es nicht mehr.«Joachim Kaiser
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Alexander Gorkow
Draußen scheint die Sonne
28 Interviews Mit einem Vorwort von Joachim Kaiser
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alexander Gorkow
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alexander Gorkow
Alexander Gorkow, geboren 1966, arbeitet seit 1993 bei der Süddeutschen Zeitung. Buchveröffentlichungen: »Kalbs Schweigen« (2003), »Mona« (2007), »Draußen scheint die Sonne. Interviews« (2008), »Hotel Laguna« (2017). Die Kinder hören Pink Floyd (2021). Als Herausgeber: Till Lindemanns »In stillen Nächten« (2013) und »100 Gedichte« (2020).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Seine Auswahl ist total subjektiv, aber dann wagt Alexander Gorkow alles. Wo andere mit vollgeschriebenen Notizblöcken anrücken, paukt sich der Leiter des »SZ Wochenende« die Biografien seiner Gesprächspartner ein und rückt dann mit einem Notfall-Zettel an, auf dem höchstens fünf Fragen stehen – für den Fall peinlicher Pausen. Sein Credo lautet: »Wenn ich ständig auf meine Fragen schaue statt in die Augen meiner Gesprächspartner, ergibt sich kein Gespräch.« Der Verlauf seiner Interviews gibt ihm recht: Entweder geht alles flamboyant in die Hose (wie mit Lou Reed), oder Weltstars wie Jeanne Moreau, Sylvester Stallone oder Eric Clapton reden so offen wie selten zuvor. Oft färbt Gorkows Spontaneität auf die Interviewpartner ab, sodass plötzlich Dinge gesagt werden, die sonst der inneren Selbstzensur zum Opfer fallen – wie im Interview mit Steve Martin, bei dem Gorkow kurzfristig als Ersatz für eine Kollegin einsprang und ganz ohne Fragen dastand.
Dieser Band versammelt eine Auswahl seiner besten Interviews. Gorkow redet mit der hinreißenden Amira Casar über Europa, mit Lou Reed über Hass, mit der Underground- Filmikone Klaus Lemke über Jungs und mit dem Konzertagenten Marek Lieberberg über Ereignisse. Mit David Gilmour geht es um Erfolg, mit Louis Begley ums Schreiben, mit Sylvester Stallone um Werte und mit Mick Jagger um Klasse. Auch seine jüngsten Interviews finden sich hier: zum Beispiel mit Lemmy Kilmister, mit Bette Midler, mit Helen Mirren, die über Image spricht, mit Neil Diamond, den Gorkow in seinem Studio in L. A. besuchte, und mit dem Ex-»Monty-Python«-Star Michael Palin, mit dem Gorkow über die Eigenarten der Engländer sprach.
Eines ist dabei immer klar: Während Gorkow und seine Auserwählten drinnen über den Ernst des Lebens sprechen, macht die Welt draußen weiter, was sie will. Oder, wie Gorkow im Studio von Neil Diamond in L. A. seufzt: »Und draußen scheint die Sonne.«
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Vorwort von Joachim Kaiser
Alexander Gorkows Kunst der Frage
Jeanne Moreau
Steve Martin
Mick Jagger
Françoise Wilhelmi de Toledo
David Gilmour
Martin Parr
Hans Janke
Bruce Willis
Phil Collins
Goldie Hawn
Udo Jürgens
George Lucas
Amira Casar
Nick Mason
Hélène Grimaud
Sylvester Stallone
Klaus Lemke
J.J.Cale/Eric Clapton
Louis Begley
Neil Diamond
Jürgen Schornagel
Marek Lieberberg
Lou Reed
Stefan Gabányi
Lemmy Kilmister
Helen Mirren
Michael Palin
Wolf Wondratschek
Jean Michel Jarre
Christoph Waltz
Karl Bartos
Bette Midler
Dank
Für Julie
»Der Mensch ist derart schlecht für das Leben ausgerüstet, dass man fast einen Übermenschen aus ihm machen würde, wenn man in ihm einen Schuldigen statt ein Opfer sähe«
Georges Simenon
Vorwort von Joachim Kaiser
Alexander Gorkows Kunst der Frage
Ein Vorwort von Joachim Kaiser
Alexander Gorkows Fähigkeit, heikle Zelebritäten zum Reden zu bringen, eine Gesprächsatmosphäre vollkommen freimütiger Bekenntnishaftigkeit zu schaffen, sie mutet fast gespenstisch an – und sie ist im gegenwärtigen Journalismus einzigartig. Man folgt seinen Interviews überrascht, fasziniert und stets gespannt. Hier wird noch darüber nachzudenken sein, wie der Kollege das fertigbringt. Zuvor jedoch sollen zwei Beispiele neugierig machen, in denen es ihm gelang, Künstler wie den brillanten amerikanischen Komiker Steve Martin und die britische Schauspielerin Helen Mirren zu Äußerungen über etwas so Delikates wie öffentliches Trauern und mediale Entschuldigung zu bewegen.
Helen Mirren, als Star der Royal Shakespeare Company gefeierte britische Bühnenschauspielerin, zugleich auch die weltberühmte Darstellerin von »Elisabeth II.« in dem Film »The Queen«, Helen Mirren nannte ihre Rollen-Darstellung der Queen eine »Wiedergutmachung an der echten Königin«. Eine Korrektur der Auffassung, Königin Elisabeth II. hätte sich nach dem Tod von Prinzessin Diana bemerkenswert kühl verhalten. Und damit dem Image des Königshauses erheblich geschadet. Zu alledem sagt nun, wunderbar offen und überhaupt nicht aggressiv provoziert, Helen Mirren im hier abgedruckten Interview: »Das Königshaus trauerte, aber es wollte sich nicht von Blair und den Medien öffentliche Trauer vorschreiben lassen. Das war richtig so … ich finde diese Entscheidung, sich nicht an einer Medien-Trauer zu beteiligen, respektabel. Man trauert doch als Privatperson und nicht als öffentliche Figur, oder? Was ist privater als Trauer?«
Gorkow wirft ein, Helen Mirren sei eigentlich nicht als Anhängerin des Königshauses bekannt. Dazu Helen Mirren: »Nein, das kann man wohl sagen!«
Bewegend. Überraschenderweise kritisiert auch der witzige Steve Martin hier die Instrumentalisierung rein zwischenmenschlichen Verhaltens zum politischen Akt. Es geht um das Bitten und Gewähren von Verzeihung. Martin äußert, einer seiner Filme sei eine »Entschuldigung« gewesen. Darauf wirft Gorkow ein, inzwischen entschuldigten sich die Leute öfter als früher. Nun aber Steve Martin: »Da haben Sie recht. Die Entschuldigung ist deshalb nicht mehr viel wert. Die Politiker haben sie entwertet. Clinton hat sich im Fernsehen bei seiner Frau entschuldigt, das müssen Sie sich vorstellen. Das ist in dem Sinne natürlich keine Entschuldigung, sondern ein politischer Akt. Seitdem entschuldigen sich die Amerikaner am laufenden Band. Furchtbar.«
Das sind ungemein differenzierte Bekenntnisse! Wie bringt Gorkow es fertig, seinen Partnern derart persönliche Antworten zu entlocken? Erste Voraussetzung: Er ist fabelhaft vorbereitet. Er vermag unauffällig Informationen einzufügen, die seine Partner im Eifer unterschlagen. Er kann brillant genau, zur Ebene und zur Aura des Gesprächsmomentes passend, Songtitel, Gegenbeispiele, Fakten und Namen beibringen. Solche journalistisch-technischen Voraussetzungen sind bei ihm selbstverständlich, und wie man weiß, sind sie es nicht bei allen Interviewern. Wer im Fernsehen oder im Rundfunk über sein neues Buch befragt wird, muss tatsächlich immer wieder erfahren, dass Reporter anfangs nebenher einräumen, sie hätten das Ding noch nicht gelesen, kennten nur den Klappentext und ein paar Kritiken: Doch nun dürfe der Autor ja das Fehlende nachliefern. (Auf eine solche Unverschämtheit müsste man grob reagieren – tut es aber, zumal als jüngerer Schriftsteller, um die Öffentlichkeit besorgt, lieber nicht.)
Mit solchen Sündern hat Gorkow wahrlich nichts gemein. Doch ein Fragender kann auch zu viel wissen! Ein Interviewer, der gegenüber dem Befragten allzu demonstrativ seine souveräne Beherrschung der Materie, seine sachliche oder auch verbale Überlegenheit ausbreitet und so auch ausspielt, er nimmt dem – möglicherweise weniger wortgewandten – Gesprächspartner gleichsam die Luft weg. Auch dies: Nicht bei Gorkow. Gewiss, seine Weltkenntnis – Gorkows subtile Romane verraten sie übrigens auch schon! – imponiert, seine professionelle Vertrautheit mit Musikalischem beeindruckt. Doch führt er diese Gespräche nie, um in irgendeiner Frage »recht« zu behalten oder gar um den Dialogpartner auf Widersprüche festzunageln. Seine Kunst ist intimer, und sie ist vor allem: intuitiver.
Er besitzt die unauffällige Fähigkeit, fantasievoll fortzuspinnen, was seine Partner an Meinungen oder Thesen vorgeben. Er nimmt auf und erweitert. So entsteht eine entspannte, nahezu poetische – und sehr oft auch komische! – Gestimmtheit. Ist aber eine solche Aura, eine solche Gesprächsatmosphäre erst einmal geschaffen, dann beseelt Gorkows (an derart taktvoll produktive Interviewer nicht gewöhnte) Partner eine wundersame Freiheit. Sie bringen Dinge vor, die spontan in ihnen zu entstehen scheinen, die sie oft gewiss kaum öffentlich äußern wollten. Da beteuert dann David Gilmour, der eben darüber jammerte, dass seine acht Kinder, zumal wenn sie noch Freundinnen oder Freunde nach Hause bringen, schon ein bisschen zu viel seien, auf Gorkows Gegenfrage: »Ihr Ernst?« entwaffnet: »Ich liebe das alles. Es ist das reine Glück.« Dann gesteht während des Dialogs plötzlich Neil Diamond: »Wissen Sie, ich rede und rede. Und ich bin eigentlich gar nicht da … mein Kopf ist eine Tür weiter – im Studio.« Oder es fallen eben jene anfangs zitierten Äußerungen über die Privatheit von Verzeihung und Trauer.
Gewiss bestehen diese Interviews nicht nur aus delikaten Fortspinnungen nuancierter seelischer Motive. Manchmal, wenn ein allzu verstiegenes Gegenüber, das eigentlich nur über Mietwohnungen zu diskutieren gewillt war, sich doch verliert in anthropologische Höhenflüge über die Unzuverlässigkeit menschlicher Versprechen, dann wechselt Gorkow rasch, aber freundlich das Thema und fragt, sowohl ablenkend wie zur Sache zurückführend: »Wie sah die Wohnung Ihrer Kindheit aus?« Das kann kein Partner übelnehmen. Und wir Leser atmen auf.
So wirken Alexander Gorkows Interviews tatsächlich einzigartig. Um eine Dimension erfüllter als die vielen Interviews in diesen Zeiten. Gorkow braucht auch nicht immerfort provozierende Bosheiten Dritter zu zitieren, womit streitbare Interviewer ihre Gesprächspartner unfehlbar zu temperamentvollen Heftigkeiten animieren. Kaum je widerspricht er direkt. Einmal freilich konterte er ungewohnt heftig. Und zwar auf die Feststellung Helen Mirrens, er sei nicht nur er selbst, sondern auch das, was andere in ihm zu erkennen glauben. Brüsk antwortete er: »Ich bin, was andere in mir sehen? Das ist absolut nicht akzeptabel!« (Arthur Schopenhauer – ein anderer begabter Komiker – hätte ihm da widersprochen!)
Der Interview-Auswahlband: »Draußen scheint die Sonne« ist die publizistische Arbeit eines sehr sorgfältig vorbereiteten Journalisten, und auch weit mehr als nur dies: Es ist die liebenswerte Arbeit eines mitfühlenden Künstlers. Bezaubernd klug, nachdenklich heiter, anmutig konkret, unauffällig welthaltig. Wer die gegenwärtig beschworene Total-Krise des deutschen Journalismus beklagen möchte, der müsste vorher Alexander Gorkows Interviews sorgfältig lesen. Dann könnte er es nicht mehr.
Joachim Kaiser, München im September 2008
Interview mitJeanne Moreau
»Es gab Niederlagen, einige sogar. Aber ich habe – in guten wie in schlechten Zeiten – immer meiner eigenen Moral standgehalten. Das Leid vergeht. Das Gewissen? Bleibt.«
Jeanne Moreau wurde 1928 geboren und galt wahlweise als Muse oder Racheengel der Nouvelle Vague. Sie drehte – unter anderem – mit Orson Welles, Luis Buñuel, Peter Brook, Jean-Luc Godard, Elia Kazan, Michelangelo Antonioni, François Truffaut und Louis Malle. Dabei entstanden prägende Werke der Filmgeschichte, wie »Fahrstuhl zum Schafott«, »Jules et Jim« und »Die Nacht«. Zum Skandal geriet 1965 ihr Striptease mit Brigitte Bardot in der Revolutionskomödie »Viva Maria!«. Sie führte inzwischen auch selbst Regie und engagiert sich auf Festivals in vielen Ländern für junge Regisseure und Schauspieler.
Paris im Frühling 2006: leuchtet. Auf der Avenue Hoche, nahe dem Triumphbogen, läuft eine kleine und doch große Dame durch eine Suite des Royal Monceau. Zum ersten Mal und bisher letzten Mal bringe ich Pralinen mit zu einem Interview. Bringt man einer feinen alten Dame Pralinen mit oder nicht? Doch. Sie ist begeistert, auch von der Likörfüllung. Zwar habe ihr der Arzt verboten, Alkohol zu trinken. Aber nicht, Alkohol zu essen. Braune Augen, die lieblich sind wie die eines kecken Mädchens – die jedoch, wenn das Mädchen böse wird, sensationell flackern. Die Augen, der Mund, die stockfinstere Stimme: Jeanne Moreau. Sie lässt sich Feuer geben für die extralange Zigarette. Sie lächelt tatsächlich abgrundtief. Dieses Gespräch sollte eigentlich Werbung machen für den Film »Die Zeit, die bleibt« von François Ozon. Dann aber ging es plötzlich um Leben und Tod.
Madame Moreau …
… die Tür zum Nebenzimmer ist offen. Im Nebenzimmer habe ich eben geraucht. Nun wird gelüftet. Es ist kalt.
Soll ich die Tür schließen?
Es gibt zwei Türen ins Nebenzimmer! Sie schließen die dort drüben, ich schließe die andere. Und anschließend rauchen wir dieses Zimmer hier voll, wir beide.
Man meinte es gut mit Ihnen, deshalb hat man gelüftet, glaube ich.
Man meint es gut mit mir und riskiert meinen Tod. Ich rauche, seit ich denken kann. Und jetzt sterbe ich an einer Lungenentzündung, weil gelüftet wird. Ich meine, es ist ein schöner Tag … aber noch haben wir ja nicht Sommer.
Madame Moreau, in François Ozons neuem Film spielen Sie eine Großmutter mit einem todkranken Enkel. Der Enkel erzählt nur Ihnen von seiner Krankheit. Mit der Begründung, dass auch Sie nicht mehr lange zu leben hätten …
… eine bemerkenswerte Szene …
… sie trifft den Zuschauer nur doppelt: Man sieht da nicht nur eine Großmutter in einem Film. Man sieht eben auch Jeanne Moreau. Vielleicht eine etwas unprofessionelle Sichtweise von mir.
Und worauf wollen Sie hinaus?
Mich hat es getroffen, dass jemand zu Ihnen sagt, Sie hätten nicht mehr lange zu leben. Und sei es im Film.
Hören Sie: Ich bin nicht sentimental. Eine außergewöhnlich starke Szene.
Warum genau?
Der Enkel stirbt, dabei ist er nur 30 Jahre jung. Ich sterbe auch, aber ich bin immerhin alt. Und doch keine typische Großmutter. Sehe ich aus wie die typische Großmutter? Sagen Sie!
Um Himmels willen: Nein!
Natürlich sehe ich nicht aus wie die typische Großmutter! In »Die Zeit, die bleibt« geht es um den Tod. Und darum, dass Leute immer sterben können – oft nicht erst, wenn sie alt sind. Die jungen Leute sterben heute zum Beispiel an Aids, nachdem sie lange krank waren. Wunderbare Freunde von mir sind an Aids gestorben. Andererseits können wir sehr alt werden und dann sterben, ohne vorher krank gewesen zu sein. Der junge Mann in dem Film verzichtet auf eine Chemotherapie und lebt in der Zeit, die ihm bleibt, sagen wir: wie ein Gesunder. Er beschäftigt sich weniger mit seinem nahenden Tod – sondern zum ersten Mal wahrhaftig mit seinem Leben.
Darf ich sagen, dass in Ihrem Gesicht schon in den frühen Filmen eine Art Todesahnung immer ablesbar war?
Sie dürfen alles sagen, mein Lieber.
Aber?
Aber es sind nur Interpretationen.
Haben Sie sich damals schon bewusst mit dem Tod beschäftigt? Als junge Frau?
Nein, nicht obsessiv. Ich denke auch heute nicht an den Tod, oder sagen wir: nicht oft. Wenn Sie älter werden, denken Sie etwas öfter an den Tod als früher. Ich sage Ihnen, warum: Sie verlieren Freunde. Louis Malle lebt nicht mehr, Orson Welles lebt nicht mehr, Tennessee Williams lebt nicht mehr, François Truffaut lebt nicht mehr – und viele andere Menschen, die ich sehr geliebt habe, sie leben auch nicht mehr.
Wie geht man damit um?
Wie man damit umgeht, weiß ich nicht. Aber ich? Ich nehme es zur Kenntnis. Und ich muss diesen Menschen dankbar sein. Ich vertraute mich ihnen an und wurde belohnt. Sie haben mir mein Leben ermöglicht. Sie wissen, was man sieht, wenn ein Baum gefällt wurde?
Die Jahresringe?
Exakt. An denen können Sie alles ablesen. Sogar Biografisches. Diese Menschen, sie sind meine Ringe. Ich bin gemacht aus diesen Menschen. Ich meine das nicht pathetisch. Es ist einfach so. Ich habe immer noch ihre Telefonnummern. Das ist überaus sonderbar, nicht wahr? Aber ich würde sie nie wegwerfen. Ich befasse mich also mit dem Tod, weil die Umstände es mitunter erfordern. Aber Sie sollten nicht annehmen, dass ich todessüchtig bin – oder gewesen bin. Lassen Sie es mich mal, da Sie dem Thema so viel Gewicht beimessen …
… es geht in dem Film von François Ozon sehr deutlich um den Tod …
… natürlich, lassen Sie es mich so sagen: Ich habe mit dem Tod früh Bekanntschaft gemacht – und mich dann leidenschaftlich ins Leben gestürzt. Mit allem, was dazu gehört, mit allem, okay?
Was waren das für Bekanntschaften?
Als ich ein Kind war, es war die Zeit der Okkupation, da war ich mit meiner Mutter auf der Flucht. Wir gerieten unter Beschuss. Meine Mutter warf mich in einen Graben am Wegrand. Ich erinnere mich, wie ich fiel, ich sehe diese Bilder noch klar: Ich falle. Menschen fallen über mich. Wir liegen im Graben. Ich spüre mit einem Mal etwas Warmes an meinem Hals, an meiner Schulter, es läuft und läuft, dieses Warme. Ich liege unter diesen Menschen, und ich denke, jemand hat dich bepinkelt, aus Angst, es muss Urin sein, verstehen Sie, aber es war …
Blut?
Ja, es war Blut. Ich stand anschließend über und über mit Blut beschmiert auf dem Weg. Ich sehe noch die Gesichter der Menschen, die mich anschreien, entsetzt, sie denken, ich sei verletzt, meine Mutter, die anderen, eine einzige Apokalypse. Dabei hatte es mich nicht erwischt. Den Mann, der auf mir gelegen hatte, den hatte es erwischt. Es war sein Blut.
Ein Trauma?
Ein großes Wort. Ich muss überlegen. Nein, kein Trauma. Ein Erlebnis.
Der zentrale Punkt im Film von Ozon: Menschen, die in ständiger Gefahr des Todes leben, leben anders als solche, die das Thema eher verdrängen können.
Wie leben die mit der Todesahnung?
Nun, wie man so sagt: bewusster? Sie treffen Entscheidungen, nutzen die Zeit, oft sind doch ausgerechnet diese Menschen sogar fröhlicher …
… sie stürzen sich ins Leben, ja, das stimmt, Sie haben recht …
… ist das nicht absurd? Dass man wissen muss, dass es jeden Moment vorbei sein kann, um die Angst davor und sogar sein Leben besser in den Griff zu bekommen?
Ich möchte Ihnen etwas erzählen: Ich war 30 … nein, es war das Jahr 1960, ich war also 32 Jahre alt, als bei mir Krebs diagnostiziert wurde …
Darüber habe ich nirgendwo gelesen.
Warum auch? Ich erzähle es Ihnen nun, weil wir über dieses Thema sprechen, und wieso sollten wir auch nicht drüber sprechen? Wenn Sie also 32 Jahre alt sind, sehr begehrt, wenn Sie mit den besten Regisseuren der Welt arbeiten, dann empfinden Sie eine solche Krankheit als einen großen Schlag – okay?
Und?
Und? Ich habe den Krebs überwunden. Ich habe ihn bekämpft und überwunden. Und wissen Sie, es gibt diese Phrase, dass jeder Tag danach ein Geschenk sein soll. Aber was soll ich sagen? Jeder Tag ist seitdem ein Geschenk. Jeder. Ich bin in zwei Jahren 80 Jahre alt, ich drehe seit bald 60 Jahren Filme: Ich soll Angst vor dem Tod haben? Nein, mein Lieber! Der Tod, er macht mir keine Angst mehr.
Was macht Ihnen Angst?
Nun, manchmal das geliebte Leben? Mag sein. Aber nicht mehr der Tod.
Täusche ich mich, oder sind Sie eine starke Frau, Madame Moreau?
Unsinn! Wie kommen Sie dazu, so etwas zu behaupten? Pardon!
… nun, wie Sie …
… hören Sie: Wir haben 45 Minuten, wir beide, das ist nicht viel Zeit. Doch reden wir über ein großes Thema, nicht wahr?
… es ist das Thema des Films …
… ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Aber jetzt sagen Sie, ich sei eine starke Frau! Das sagen Sie, weil wir jetzt gerade hier sitzen und ich Ihnen in der Kürze der Zeit klargemacht habe, wie ich über den Tod denke. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Wir haben 2006 – nicht 1960! Sie sitzen einer Frau gegenüber, die zu dem erst werden musste, was sie ist. Bin ich immer stark? War ich immer stark? Immer fröhlich? Nein. Als leidenschaftlicher Mensch ist das so eine Sache mit der Fröhlichkeit. Wenn wir fröhlich sind, sind wir es mit großem Elan – wenn wir traurig sind, sind wir es auch mit großem Elan. So bin ich. Gott sei Dank. Kann man gar nichts machen.
Wären Sie gerne ein kontrollierterer Mensch? Mit einer gewissen Schutzhaut?
Oh, kennen Sie solche Leute?
Den einen oder anderen, natürlich.
Und?
Und?
Sind die nicht furchtbar? Die kontrollierten Menschen? Mit ihrer sensationellen Schutzhaut? Nein, ich kann nicht im Namen dieser Menschen sprechen, verstehen Sie? Sie interessieren mich nicht. Dies sind Menschen, die nicht wirklich lieben können. Ich habe deshalb immer einen großen Bogen um die Kontrollierten gemacht! Mein Gott!
War das …
Das war nicht, sondern das ist: Intuition! Ich habe seit jeher eine sehr, sehr gut ausgebildete Intuition.
Ist man unkontrolliert, ist man aber auch verletzbarer, nicht wahr?
Das mag sein.
Und gab es da die totale Finsternis?
Ja, allerdings. Mir fehlen die Worte für diese Finsternis.
Viele Tage in verriegelten und dunklen Zimmern? Nächte gewalttätiger Traurigkeit?
Ja und noch mal ja. Ich meine: Bonjour! Was glauben Sie, ich bin eine Künstlerin und soll das nicht kennen?
Auch Lehrer oder Polizisten haben ein Recht darauf, nein?
Na eben. Auch die. Wieso ich nicht?
Lassen Sie mich raten: Selbstzweifel waren es nicht, die Sie traurig machten.
Wann sind wir so traurig, dass die Vorhänge zubleiben? Es ist der Verlust eines geliebten Menschen. Und ich rede hier nicht nur vom Verlust durch Tod.
Bei wem …
Nein … mehr nicht dazu.
Was war der Motor, um da jeweils wieder rauszukommen? Es gibt die Theorie, dass entweder der Tod oder die Liebe unser Leben antreiben.
Beides falsch. Die Neugier treibt unser Leben an. Es ist die Neugier! Seit Adam und Eva und der verbotenen Frucht. Die Neugier hat mich aus jeder Depression wieder befreit. Die Traurigkeit verging oft nur langsam. Aber schon vorher war meist die Neugier zurück. Sie ist ein lustiger kleiner Vorbote! Man lugt wieder in die Welt hinaus, verstehen Sie?
Neugier auf was?
Na, auf Menschen! Ich hatte immer Hunger darauf, mich mit leidenschaftlichen und kreativen Menschen zu umgeben. Menschen, die mich weiterbringen. Wenn Sie sich mit solchen Menschen einlassen, ist das oft nicht leicht. Aber da sind wir wieder bei den Jahresringen und den Bäumen: Ohne diese geliebten Menschen wäre ich nicht, was ich bin, sie haben mich gemacht, diese Menschen, ich habe sie gesucht, damit sie mich zu dem machen, was ich nun geworden bin. Das ist mir so konkret vielleicht erst heute klar, dass ich sie bewusst gesucht habe. … Halten Sie sich schön von den Kontrollierten fern, ich rate es Ihnen!
Man kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie bei der Suche nach leidenschaftlichen Menschen vordergründig Ihre Karriere im Blick gehabt hätten. Vor Louis Malle wurden Sie ja sogar gewarnt.
Mein Agent sagte damals, es war 1948: »Jeanne, vor dir liegt eine leuchtende Karriere. Wenn du dich nun mit diesen jungen Leuten da einlässt, sind wir getrennte Leute. Dann musst du dir einen neuen Agenten suchen!« Ich war damals aber selbst jung. Und arbeitete mit Herrschaften wie Jean Gabin und Fernandel und, und, und … Alles feine Leute. Sie behandelten mich wie eine Prinzessin. Es hätte ewig so weitergehen können. Aber ich trennte mich von meinem Agenten.
Warum konkret?
Huuu, Gott, das war alles sooo arriviert. Es gab diese sagenhafte Hackordnung, welcher Maskenbildner zu welcher Uhrzeit welchem Kameraassistenten welche Frage stellen durfte. Schauspieler liefen in den Drehpausen herum wie Bischöfe im Petersdom. Jeden Tag war das Thema, ob der eine oder die andere angesprochen werden durfte, ohne dass man sein Leben riskierte. Es war das Cinema de Papa. Ich wusste nur eins: »Ich will hier raus.«
Heutzutage kann man sich so schwer vorstellen, dass nicht schon bei den Dreharbeiten zu Filmen wie »Fahrstuhl zum Schafott« klar gewesen ist, dass es sich um ein Meisterwerk handeln wird.
Nein, das konnten wir nicht wissen. Aber ich sagte Ihnen eben, dass ich oft meine Bedenken abgestellt habe, wenn mir meine Intuition etwas gesagt hat. Und die Arbeiten mit Louis Malle oder Truffaut waren nur auf der einen Seite ein Wagnis. Auf der anderen waren sie ja eine große Befreiung. Plötzlich liefen wir in Paris einfach mit der Kamera über die Straße, ich legte mein Make-up selber auf … es war wirklich phantastisch.
An Ihren Namen wurden schon früh sehr große Erwartungen geknüpft.
Natürlich.
Finden Sie es manchmal anstrengend, einen derart großen Namen zu tragen?
Nein, nein, ich mag das.
Weckt Ihr Name nicht, sagen wir, ständig übermenschliche Erwartungen?
Ach, wissen Sie: Schauspieler, die sich über Ruhm oder Druck beklagen, die sind wirklich absolut furchtbar. Wir haben Grund zur Dankbarkeit. Punkt.
Es gibt heute wieder eine Sehnsucht nach einer derart starken Welle, wie es damals die Nouvelle Vague war …
… und ich habe kein Verständnis dafür.
Warum nicht?
Weil es sentimental ist. Und weil es so phantastische Regisseure gibt heute: Almodóvar, Van Sant, Ozon. Alle paar Jahre heißt es, das Kino sei tot. Das ist bullshit, verstehen Sie? Wenn Sie mal so alt sind wie ich, haben Sie diesen Aufschrei sicher schon 20-mal in der Zeitung gelesen: »Das Kino stirbt! Das Kino stirbt!« Das ist so langweilig, entsetzlich. In Wahrheit ist das Kino heute lebendiger, vielfältiger, engagierter, als es je war. Wir hatten noch nie so viele herausragende junge Regisseure. Nein, nein, es gibt niemals einen Grund, der Vergangenheit nachzutrauern.
Vielleicht ist das auch die Sehnsucht nach einem stilistisch puren Stil, nach der Klarheit der Nouvelle Vague …
… aber die Welt ist nicht mehr pur. In der Zeit, als wir diese Filme gemacht haben, hatten wir es leichter. Wie alt sind Sie?
39.
Schauen Sie: Sogar Sie – oder Menschen, die erst 30 sind – haben in den letzten 15 Jahren miterleben müssen, was für Veränderungen wir ausgesetzt sind: politisch, wirtschaftlich, die Kommunikation. Die Filme heute bilden das ab. Sie sind schneller. Die Literatur ist es auch.
Lesen Sie viel?
Natürlich. Aber wo wir vom Tempo sprechen: Ich zappe inzwischen auch beim Lesen. Ich lese Balzac oder Proust – und zappe dabei. Ist das toll? Ich ertappe mich dabei, wie ich ungeduldig werde beim Wiederlesen dieser geliebten Werke. Und blättere verschämt ein paar Seiten vor. Die modernen Schriftsteller, Leute wie Houellebecq, sie schreiben so, dass man nicht mehr vorblättern muss. Sie sind selbst Kinder des Zappings.
Mögen Sie Houellebecq?
Ich verehre ihn sogar, diesen Herrn …
Ist er Zyniker oder Moralist?
Oh, vielleicht beides? Die Leute machen ihm hier in Frankreich üble Vorwürfe. Das Wort Vision ist viel strapaziert worden. Aber Houellebecq: Er hat eine.
Eine dunkle.
Ist das keine? Dann hat er eben eine dunkle. Die Menschen mit den dunklen Visionen sind oft nicht die schlechtesten. Man sollte keine Angst vor ihnen haben.
Ich bleibe dabei: Sie wirken furchtlos.
Ich sagte Ihnen schon: Das Leben hat es so weit gebracht mit mir. Nicht einmal das Älterwerden hat mir übrigens länger als zwei Stunden Furcht eingejagt.
Exakt zwei Stunden? Wann war das?
1967 in Italien. Ich drehte mit Tony Richardson »Sailor from Gibraltar« (dt.: »Nur eine Frau an Bord«, die Red.) nach Marguerite Duras. Ich hatte einen drehfreien Tag. Also lag ich in diesem winzigen Hotel an der Küste, nahe Pompeji, auf meinem Bett. Um ehrlich zu sein: Ich langweilte mich wie verrückt! Ich ließ mir also einen Espresso kommen. Der Hoteljunge, der ihn dann brachte, war sehr charmant, bildhübsch, ich erinnere mich gerade sehr konkret an ihn … nun, auch egal. Jedenfalls: Als er weg ist, liege ich auf dem Bett und schaue in den Handspiegel, zupfe hier ein bisschen rum und dort – plötzlich sehe ich da diese sonderbaren Fältchen an meinem Hals.
Eine Katastrophe!
Natürlich! Holy Shit!! Aber ich lag zwei Stunden auf dem Bett, und schon war das Missvergnügen vorüber. Ich dachte: »Jeanne, du wirst bald 40 Jahre alt sein. Alles ist wunderbar. Mach dir nichts vor.« Ich ging zu den Dreharbeiten und schaute Vanessa Redgrave zu. Sie war sensationell. Ich glaube, sie wollte damals eine Beziehung mit mir. Diese wunderbare Frau. Aber was soll man machen … ich liebe nun mal die Männer.
Meine Zeit mit Ihnen ist mehr als um. Nun haben wir doch eher über das Leben statt über den Tod gesprochen, oder?
Ja – wie schön! Und, wissen Sie, am Ende unseres Gesprächs möchte ich sagen: Es geht im Leben nicht um den Tod oder das Leiden. Sondern alleine um die Moral.
Um welche denn?
Nur um die eigene natürlich! Am Ende geht es nicht um Trauer oder Glück. Sondern um richtig oder falsch. Am Ende stehen wir alleine da vor unserem Gewissen. Auf der Leiter, die Jakob in der Bibel im Traum sieht, bin ich deshalb immer nur nach oben gegangen: Es gab Niederlagen, einige sogar. Aber ich habe – in guten wie in schlechten Zeiten – immer meiner eigenen Moral standgehalten. Das Leid vergeht. Das Gewissen? Bleibt.
Sind Sie Optimistin, Madame Moreau?
Nein, nein, ich bin sehr sicher keine Optimistin. Und auch keine Pessimistin.
Sondern?
Je suis lucide! Verstehen Sie? Ich sehe klar, mein Lieber … ich sehe sehr klar!
Interview mitSteve Martin
»Wissen Sie, warum die Liebe erfunden wurde? Sie wurde erfunden, damit wir ficken.«
Steve Martin wurde 1945 in Texas geboren. Den Durchbruch als einer der großen Komiker der Gegenwart schaffte er Mitte der Siebziger mit Auftritten in der »Johnny Cash Show« und bei »Saturday Night Live«. Zu seinen zahlreichen Filmen gehören »Tote tragen keine Karos«, »Solo für zwei«, »L.A. Story« und »Im Dutzend billiger«. Aufsehen erregte er mit dem traurigen Film »Shopgirl« 2005. Die Slapstick-Neuverfilmung des »Rosaroten Panthers« kam 2006 in die Kinos. Steve Martin ist außerdem ein gefeierter Schriftsteller, Bühnenautor und Essayist. Mit Leidenschaft widmet er sich seiner angesehenen Sammlung moderner Kunst. Seine Affäre mit der Künstlerin Cindy Sherman zerbrach ebenso wie seine erste Ehe. Heute lebt Steve Martin mit seiner neuen Lebensgefährtin in Los Angeles und New York.
Man weiß von Journalisten, die er übel hat abfahren lassen – und ist nervös. Das Zusatzproblem: Ich erfahre von meinem Interviewtermin nicht, wie sonst, lange vorher. Sondern 15 Minuten vorher. Während ich mit einem Kollegen im Berliner Einstein Unter den Linden eine Kummerproblematik wälze, erhalte ich den Anruf einer Kollegin, die sich angeblich wegen einer Fischvergiftung auf dem Boden ihrer Berliner Wohnung krümmt. Ob ich bitte schnell das Interview übernehmen könne. Ich habe keine einzige Frage dabei, als ich – schweißüberströmt und exakt sieben Minuten zu spät – in die Suite 424 des Berliner Regent hetze. Steve Martin sitzt dort und lächelt. Er sieht aus, wie die wohlhabende Intelligenz in den USA nun mal aussieht: beige Hose, blaues Hemd, Sneakers. Er antwortet schnell und mitunter nur knapp – alte Schule der Stand-up-Comedians. Dass es ihm aber ernst ist mit dem Leben, dafür könnten seine so verletzlichen Augen ein Indiz sein. Vor ihm steht ein Eistee. Er wird ihn nicht anrühren. Er wundert sich, dass sein Interviewer keine einzige Frage vor sich liegen hat … Es muss dann einfach mal in Ermangelung von Fragen um Traurigkeit gehen.
Mister Martin, würden Sie Inspector Clouseau …
Sagen Sie, sitzen in München noch die dicken ernsten Männer über diesen riesigen Eimern voller Bier?
Ich fürchte: ja. Es gibt aber auch …
Wissen Sie, was ich so liebe an den Jungs?
Die Mengen von Bier, die sie …
Nein! Die Gesichter. Dieser Ernst. Diese Selbstgewissheit. Diese Ruhe. Unzerstörbar. Großartig. Kommen Sie ursprünglich aus München?
Nein, aus dem Rheinland. Wir haben es schwer in München. Wir reden zu viel – und werden dann falsch verstanden. Der Bayer an sich redet offenbar weniger.
Ah, Sie sind ein eher zweifelnder Mensch – und in Ihrer Wahlheimat Bayern nimmt man die Dinge, wie sie sind. Ja?
Vielleicht, ja …
Gehen Sie bitte nie nach Texas! Da, wo ich herkomme, ist alles, was mit dem Wort Zweifel zu tun hat, verboten. Texaner sind laut und selbstsicher. Wenn sie einander begegnen, fallen sie sich in die Arme und klopfen sich mit ihren riesigen Händen die Schulterblätter zu Brei.
Sind Sie auch so? Nein, oder?
Ich habe Texas als Kind verlassen.
Mister Martin, würden Sie Inspector Clouseau, den Sie nun wiederbelebt haben, als traurige Figur bezeichnen?
Nein. Von außen betrachtet kann man ihn traurig finden. Aber eigentlich ist er das Gegenteil einer traurigen Figur. Er ist zufrieden. Er ist mit sich und der Welt absolut im Reinen. Das können wohl die wenigsten von sich behaupten.
Er ist zu dumm, einen Smart in eine sehr große Parklücke zu setzen, ohne die Autos davor und dahinter zu demolieren.
Aber er merkt nicht, dass er sie demoliert. Doch, ich würde ihn sogar als glücklich bezeichnen. Sie spielen auf die Figur des »traurigen Clowns« an, für den es in der Filmgeschichte viele Beispiele gibt. Clouseau gehört nicht dazu. Schon bei Peter Sellers war er es nicht. Obwohl Peter wusste, was Unglück ist.
Seine Depressionen sollen dazu geführt haben, dass er seine Umwelt terrorisiert hat wie kaum ein Zweiter …
Ich will Ihnen sagen: Er war einer der respektvollsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ein wundervoller Mann. Man muss solche Männer lieben, und zwar mit ihren Fehlern oder sagen wir: Unvollkommenheiten. Anders bekommt man so einen nicht geliefert.
Haben Sie ihn verehrt?
Ich habe ihn vergöttert.
Ein bisschen ein Klischee – der traurige Clown, nicht wahr?
Ja, ich denke schon. Nicht alle Idioten sind traurig. Die meisten sind es ja eben nicht. Clouseau ist ein glücklicher Idiot. Frei von Selbstzweifeln. Für solche Typen gibt es in der Realität viele Beispiele. Im Film sind sie allerdings witziger.
Sie gelten in Hollywood nicht nur als einer der größten Komiker, sondern wegen Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit und Ihrem Interesse für moderne Kunst auch als eine Art Intellektueller …
… o, mein Lieber, in Hollywood gilt man sehr schnell als Intellektueller, das können Sie mir glauben! Es erfordert ja nun absolut überhaupt keine Intelligenz, Schauspieler zu werden.
Nein?
Nein.
Sondern?
Talent.
Bedingt Talent nicht eine gewisse …
Mein Gott, nein! Talent setzt doch keine Intelligenz voraus! Ich könnte Ihnen viele sehr berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler nennen, die meine These belegen. Das merken Sie natürlich nicht auf der Leinwand. Erst bei einem Drink an der Bar. Aber Sie spielen auf meine Selbstzweifel an …
Man sagt den Intelligenteren unter den Komikern – wie eben Peter Sellers – nach, sie seien eigentlich von Selbstzweifeln geplagt. Auch Sie haben, mit Verlaub, schon einigen Interviewern das Leben nicht leicht gemacht.
Und jetzt fragen Sie sich, ob ich im Kern ein trauriger Mensch bin?
Wieso sind Sie Komiker geworden?
Ich war und bin kein depressiver Mensch. Ich war allerdings als Kind sehr schüchtern – und das in Texas! Schüchterne Menschen leiden an ihrer eigenen Überkontrolliertheit. Sie kommen nie von diesem goldenen Mittelweg ab. Das führt dazu, dass sie ersticken. Sie haben dann Angst vor dem Beruf, vor dem Leben – und auch vor der Liebe.
Showbiz war Ihr Ventil.
Showbiz war mein Ventil. Hier konnte ich extrem sein – und das, ohne von der Polizei abgeführt zu werden. Ja, ich denke, es ging um einen gewissen Extremismus. Wenn Sie als schüchterner Mensch merken, dass die Leute Sie als Extremisten großartig finden, dass Sie sogar reich und unabhängig damit werden, das ist eine gute Sache, verstehen Sie?
Sie müssen einen sagenhaften Ehrgeiz besessen haben.
Glauben Sie’s oder nicht, aber ich war nicht ehrgeizig. Ich habe mir nie gesagt: »Steve, du wirst ein verdammter Erfolg!« Es ging bei mir – psychisch, wenn Sie so wollen – nur darum: »Steve, du bist im Showbiz! Du bist gerettet!«
Dann sind Sie mit sich im Reinen.
Ich bin es im Moment. Und seit einigen Jahren, ja. Ich habe eine Freundin, die ich sehr liebe und die meine vielen Fehler erträgt, weil sie mich offenbar auch liebt. Ich mache die Filme, die ich machen will. Ich verdiene mein Geld nicht mit dem Verkauf von Waffen. Ich denke, das alles ist eine gute Bilanz. Und ich muss niemanden um Verzeihung bitten, das ist der Punkt, ich tue niemandem weh.
Darf ich fragen, wann zuletzt Sie um Verzeihung gebeten haben?
Ich rede nur ungerne über mein Privatleben, so diskret Sie auch fragen.
Namen interessieren nicht.
…
Okay? Keine Namen und so was!
Nun, ich schrieb vor einigen Jahren den Roman »Shopgirl«, eine Geschichte über die Liebe eines älteren Mannes zu einem jungen und depressiven Mädchen. Vielleicht war das eine Art …
Den älteren Mann haben Sie im gleichnamigen Film auch gespielt. Eine sehr traurige Geschichte, Mister Martin …
Ja. Und dieses Buch, dieser Film, das war eine Entschuldigung. Das ist mir heute erst klar. Vielleicht sogar erst jetzt, wo Sie mich fragen. Denn alles basierte auf einer traurigen Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe diese Geschichte natürlich verfremdet. Aber ich hatte wohl das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Und die Geschichte, die mir passierte, war wichtig genug, um ein Buch daraus zu machen – diese Episode meines Lebens musste irgendwie manifestiert werden.
Eine sehr emotionale Geschichte.
Allerdings. Ja. … Allerdings.
Inzwischen entschuldigen sich die Leute öfter als früher nach traurigen Geschichten, nicht wahr? Viel öfter sogar.
Da haben Sie recht. Die Entschuldigung ist deshalb nicht mehr viel wert. Die Politiker haben sie entwertet. Clinton hat sich im Fernsehen bei seiner Frau entschuldigt, das müssen Sie sich vorstellen. Das ist in dem Sinne natürlich keine Entschuldigung, sondern ein politischer Akt. Seitdem entschuldigen sich Amerikaner am laufenden Band. Furchtbar.
Wird sich Clintons Nachfolger auch noch entschuldigen?
Bush?
Er sieht nicht so aus, oder?
Sie glauben, er ist sich seiner Sache zu sicher, um sich zu entschuldigen?
Er sieht so aus, finde ich.
Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, nicht nur nachdenkliche Komiker wie ich oder nachdenkliche Journalisten wie Sie liegen nachts in den Betten und grübeln über das Leben. Bush tut es auch.
Ihr Präsident?
Ja. Er darf es nur nicht zeigen.
Mögen Sie Bush? Sie unterstellen ihm eine Nachdenklichkeit, die viele Menschen in Hollywood ihm nicht zutrauen.
Die Frage ist nicht, ob ich ihn mag. Sondern, ob ich seine Politik unterstütze.
Tun Sie es?
Nein.
Aber?
Kein Aber. Ich bin nicht einverstanden mit seiner Politik. Ich bin nicht einverstanden damit, was im Irak passiert. Aber es ist immer so leicht, über den Präsidenten herzufallen. Ich wollte nur sagen, dass er womöglich nachdenklicher ist, als er weiß Gott aussieht.
Hat ein Mensch, der um Verzeihung bittet, eine zweite Chance verdient?
Da kommt es darauf an, wie traurig die ganze Geschichte war, nicht wahr? Wenn Sie Tausende Menschenleben auf dem Gewissen haben, so wie viele Politiker …
Reden wir wieder von Ihnen! Und vielleicht von beruflichen Fehlern …
Nein! Nirgendwo hat das Wort Verzeihung eine so große Bedeutung wie in der Liebe. Wenn sie ernst gemeint ist. Wir sprachen ja eben von »Shopgirl« …
Haben Sie schon oft eine Frau um Verzeihung gebeten?
Ich musste es erst lernen. Wirklich wahr.
Und?
Und wenn man es aber ernst meint, hat man natürlich eine zweite Chance verdient. Wenn jemand es ernst meint, wirft man nicht einfach alles weg.
Für was haben Sie sich bei Frauen schon entschuldigt?
Nun, dafür, sie nicht aufmerksam genug behandelt zu haben. Da fällt mir eine etwas dumme Geschichte ein!
Bitte!
Ich habe neulich in Los Angeles in einem Café eine Frau gesehen – und bin spontan aufgestanden und zu ihr hingegangen.
Und?
Ich habe mich bei der Frau dafür entschuldigt, was ich ihr vor 25 Jahren angetan habe. Es war mir ein Bedürfnis. Die Sache war mir all die Jahre nicht aus dem Kopf gegangen. Ich gehe also mit gesenktem Kopf zu ihr. Und sage: »Hey, ich glaube, ich habe dich damals nicht gut behandelt. Es tut mir leid.«
Und die Frau?
Sie hatte keine Ahnung, wovon ich rede!
Eine Tragikomödie!
Nein, eine reine Komödie! Phantastisch. Sie freute sich, mich wiederzusehen – und bat mich immer wieder, ich solle endlich aufhören, mich zu entschuldigen. Sie wusste einfach nicht, wovon ich rede.
In Ihrem Beruf …
Wissen Sie, warum die Liebe erfunden wurde?
Nein.
Sie wurde erfunden, damit wir ficken.
Wie bitte?
Ja. Das war der Plan.
Verzeihen Sie, aber …
So ist es.
Soso, und die vielen, vielen Menschen, die ficken, ohne verliebt …
Stop! Ich rede nicht von der traurigen Realität. Sondern vom Plan. Der besagte: Es reicht nicht, Kinder zu zeugen, man muss sie auch großziehen. Und dazu muss man aber eine Seelengemeinschaft bilden. Es geht darum, dass wir mit der Frau ficken, die wir lieben. Damit wir nicht aussterben. So war es wenigstens mal angedacht.
So weit der Plan.
Ja, nun.
Traurig.
Die Liebe muss deshalb nicht traurig sein. Aber sie kann.
Können Sie Liebeskummer beschreiben?
Den Tod eines geliebten Menschen zu verkraften, ist schlimm. Aber ich glaube, die traurigste Kraft, die an uns zehrt, ist der Liebeskummer. Psychische Grippe. Mit dem Leid, das uns da umtreibt, kann man Strom für eine Kleinstadt erzeugen.
Leiden Sie lange an so etwas?
Nach meiner letzten Beziehung hatte ich zwei Jahre lang Liebeskummer. Traurigkeit ist kein Ausdruck für die Finsternis, durch die ich gelaufen bin. Man ist eine Art Junkie auf Entzug … nein?
Und?
Natürlich kommt man da raus. Man glaubt es nicht und kommt doch wieder raus. Das ändert nichts daran, wie schade es ist, dass es vorüberging. Oft merken die Leute ja erst zu spät, dass sie hätten zusammenbleiben sollen. Das ist dann der allertraurigste Moment. Das Begehren lief nicht synchron.
Zwei Jahre sind eine lange Zeit.
Sie gingen vorüber.
Keine Depressionen?
Nein. Ich sagte Ihnen schon, dass ich kein depressiver Mensch bin. Ich habe immer ein Licht am Ende des Tunnels gesehen. Es war allerdings zeitweise sehr klein, das Licht – das muss ich zugeben.
Clouseau braucht keine Frauen.
Nein, denn er hält sich selbst für viel zu großartig für die Frauen, sie haben ihn also gar nicht verdient. Und wie er selbst sagt: Gegen die Einsamkeit gibt es heute doch das Internet!
Im Kino habe ich darüber noch sehr gelacht. Jetzt gerade finde ich es traurig.
Aber auch dafür ist das Kino erfunden worden, dass Sie über so traurige Sachen lachen. Was nichts damit zu tun hätte, dass Clouseau ein trauriger oder doppelbödiger Charakter wäre. »Der Rosarote Panther« ist pures Entertainment. Da ist kein doppelter Boden. Nur Spaß.
Kann man sich vor Traurigkeit schützen?
Nein. Sie kommt. Man muss sich ihr stellen. Wenn Sie vor der Traurigkeit davonrennen, ist es nicht anders, als wenn Sie vor den Problemen, die eine Liebe mit sich bringt, davonrennen – und vorsichtshalber Solist bleiben: Sie werden sich dann als Solist selbst einholen.
In Ihrem Beruf …
Ich habe die traurigsten Fehler nie in meinem Beruf gemacht – und immer im Leben. Vielleicht ist es sogar besser so.
Der größte Fehler in Liebesbeziehungen?
Sehr einfach. Wenn Sie einer Frau nicht signalisieren, dass Sie 24 Stunden am Tag an allem, was sie denkt, fühlt und erlebt, partizipieren – wenn Sie das also nicht tun: wooooooooooom, ist sie weg!
Sie lachen.
Aber ich meine es ernst.
Und wie Sie lachen!
Los, sagen Sie Ihren Satz!
Okay. Ich sage jetzt: Frauen fühlen sich dann zu Tode geschmust. Ihre Definition würde doch keine Frau unterschreiben.
Natürlich nicht. Aber es stimmt trotzdem. Die Schlauen unter uns Männern haben das begriffen.
Und was machen diese schlauen Männer?
Sie heucheln. Sie heucheln ununterbrochenes Interesse an den Sorgen ihrer Frauen. Andere Männer hingegen sind von der Art, dass sie sich tatsächlich nur über ihre Frauen definieren. In diese zweite Sorte verlieben sich Frauen gerne. Sie bereuen es allerdings später sehr.
Okay – Sie sind einer der lustigsten Menschen der Welt. Wir müssen nun die Traurigkeit überwinden und zu einem glücklichen Ende kommen.
Ja. … Aber ich werde Ihnen trotzdem nichts von meiner Freundin erzählen.
Ich wollte doch gar nicht …
Sie hat nichts mit dem Showbiz zu tun. Ich schütze sie vor der Öffentlichkeit.
Sie lebt ein anderes Leben?
Sie ist überhaupt sehr anders als ich.
Und das geht?
Das ist sogar das Geheimnis unseres Erfolgs! Als wir das endlich akzeptiert hatten, blieb nur noch das übrig, was uns einst zusammengeführt hat.
Etwas Chemisches.
Ja. Wir wären vom Teufel besessen, uns das selbst zu versauen.
Verstehe.
Man malt sich dann gegenseitig in den schönsten Farben aus, verstehen Sie?
Das ist die Liebe.
Das ist die Liebe.
Clouseau wird es nie empfinden.
Nein. Er ist auch so glücklich.
(Die Pressedame kommt ins Zimmer: »Bitte jetzt die letzte Frage!«)
Wir müssen Schluss machen.
Yep. Tut mir leid. Strenge Regeln.
Gut, also: Empfinden Sie in Bezug auf Deutschland eine gewisse Traurigkeit?
Wieso das denn?
Nun ja …
Hören Sie mal: Die Sonne scheint! Berlin ist nicht mehr geteilt! Die Menschen …
Die Geschichte, die Schuld!
O, nein. Ich meine … also, sagen wir mal so: Ihr habt in Sachen Traurigkeit und Schuld einen sehr guten Job gemacht, oder? Jetzt dürft ihr wieder lachen!
Sie haben gut reden.
Nun, ich bin ja auch Texaner.
Danke. Ich wünsche Ihnen nur das Beste.
Ich Ihnen auch! Noch was für den Weg: Heute scheint hier in Berlin die Sonne. Und unter einem grauen Himmel ist auch New York hässlich. … Sie verstehen?
Interview mitMick Jagger
»Also, ich meine, ich kannte Helmut Berger gut, aber nein, wir hatten kein erotisches Verhältnis!«
Michael Phillip Jagger, geboren am 26. Juli 1943 in der Grafschaft Kent, hatte im Sommer 1962 mit den Rolling Stones seinen ersten Auftritt – im Londoner Marquee Club. Seit fast einem halben Jahrhundert nimmt die Band Platten auf und tourt. 2003 wurde Jagger vom Königshaus zum Sir geadelt. Auf ihrer letzten Tour im Jahre 2006 machten die Stones einen Reingewinn von 217 Millionen Dollar, mehr als jede andere Band zuvor. Abseits seines zeitweise skandalösen Privatlebens gilt Jagger als disziplinierter Arbeiter und fürsorglicher Vater relativ vieler Kinder.
Das Londoner Soho Hotel an einem Abend im September 2007. Eine Suite im zweiten Stock. Dieser Herr hat so schmale Schultern, dass man denkt, man kann ihn wie einen Speer durch die Gegend werfen. Das Gesicht erscheint nicht wie ein Gesicht – sondern wie die eine große Trademark des Gottes namens Pop. Mick Jagger ist kein Mensch, denkt man, sondern tatsächlich spricht man heute zum ersten Mal mit dem größten Logo der Welt. Kurz fasst man es nicht. Und dann? Dann ist er einfach nur ein aufmerksamer, gut gelaunter Mann aus London. Sehr fester Händedruck! Und wie er lacht und lacht und lacht …
Sir Mick, ich habe mich in meinen besten Anzug geworfen, und dies mit Bedacht.
Sie sehen aus wie Memphis Slim. Kennen Sie Memphis Slim?
Der Bluesmusiker? War er nicht ganz leicht untersetzt?
Er war großartig.
Memphis Slim war Afroamerikaner. Ich bin ein Weißer.
Spielt keine Rolle. Er hat auch immer diese grauen Anzüge getragen – vielleicht erinnern Sie mich deshalb an ihn.
Ich dachte, ein guter Anzug ist die beste Art, Rache zu üben.
Was habe ich verbrochen?
Jeder, der sich anzog wie Sie, machte sich zum Affen. Wenn man zum Beispiel nach einem Stones-Konzert 1982 mit einer gestreiften Hose in die Schule ging …
Gut, ja, Sie haben eine einfache Regel nicht befolgt.
Welche?
Dass es entscheidend ist, wann und wo man etwas trägt. Eine gestreifte Hose auf einer Bühne am Abend ist ein Utensil. Eine gestreifte Hose in der Schule am Morgen ist peinlich. Das tut mir leid für Sie. Wir haben hier bei uns in England Schuluniformen aus diesem Grund. Um die Jungen und Mädchen vor derartig dummen Peinlichkeiten zu bewahren.
Reden wir mal über Ihre unbestreitbare Klasse: Wieso schaden Ihnen Peinlichkeiten nicht?
Hm …
Ich meine, Sie sind ohne Zweifel der berühmteste Popstar der Welt …
… das ist ein übler Journalistentrick: Erst kommt das Kompliment …
… das ist ja nicht nur ein Kompliment, sondern eine Tatsache: Sie sind nun mal stilbildend. Aber ich habe mir jetzt diese Bonus-DVD auf Ihrer neuen Best-of-CD angesehen. Bitte verzeihen Sie: Sie haben da in einigen Videos Sachen an, dass man ja sofort blind werden möchte!
Okay, also: Sie haben recht. Ich sah diese Videos jetzt wieder. Bei »Let’s Work« dachte ich: Ich sehe aus wie ein Irrer, verheerendste 80er-Jahre. »Dancing In The Street« mit Bowie, die flatternden Seidenhemden, wir hatten nur ein paar Stunden für das Video damals, aber so oder so: schlimm. Dann »Don’t Look Back« mit Peter Tosh, 1978 in der Sendung »Saturday Night Life«: Ich trage eine Hose mit silbernen Klebestreifen! Sie deuten an, einige dieser Videos seien peinlich. Sagen wir es, wie es ist: Sie sind vielleicht sogar alle peinlich.
Muss man sich im Popgeschäft gelegentlich einfach deshalb blamieren, weil es nun mal das Popgeschäft ist?
Eine philosophische Frage. Also, ich muss darüber nachdenken. Ich denke nach, ich denke nach, ich denke nach …
Sie nehmen es jedenfalls mit Humor.
Nun, Sie tragen keine Hosen mit Klebestreifen. Sie tragen einen smarten Anzug. Ich inzwischen auch, wie Sie sehen. Aber diese Videos sind nicht nur peinlich – sie sind ja auch wunderbar. Sie sind ein Dokument. Sie dokumentieren den State of the Art – ihrer Zeit. Ich finde es sehr in Ordnung, das noch mal abzubilden. Ich meine, wen interessiert’s, dass das peinlich ist nach 30 oder 20 Jahren?! Es sind gute Songs. Ich mag auch den Gedanken dahinter, dass David und ich für die Coverversion von »Dancing In The Street« nur ein paar Stunden Zeit hatten, Song und Video, das haben wir runtergehauen, weil es halt zu »Live Aid« schnell fertig werden musste, alles nicht perfekt, aber ich liebe beides, den Song und das Video. Beides hat eine sehr rohe, spontane Qualität. Sie sehen, ich nehme vieles mit Humor, vor allem meine Sünden. Was bleibt mir übrig?
Wenn Sie heutzutage das Drogen- und Sextheater um Leute wie Pete Doherty oder Amy Winehouse mitkriegen – was löst das aus? Vatergefühle? Langeweile?
Hm, schwer zu sagen. Am ehesten Langeweile? … Aber Amy, sie ist eine wunderbare Künstlerin. Schreibt phantastische Songs, hat Klasse. Was löst es bei mir aus, sie auf Drogen in irgendwelchen Tabloids zu sehen? Am ehesten, dass ich hoffe, sie bekommt die Kurve. Es wäre schade.
Auch Pete Doherty spielt unbeirrt den Alltag der frühen Stones nach, oder?
Die Leute lieben Wiederholungen, Fortsetzungen, solche Sachen. Das Kino liebt so was. Und die Presse natürlich auch. Doherty bedient, was man von ihm sehen will, eine Art Teufelskreis …
. . . in der Art, dass man aus dem Image nicht mehr rauskommt?
Ja, er leidet an den Tabloids, weil sie nur über Dreck berichten, nicht über seine Kunst. Das Schlimmste aber wäre nun, dass sie gar nicht mehr über ihn berichten. Also gibt er sich ständig zu erkennen.
Und die Kunst?
Ich wüsste nicht, wie ich den Künstler Pete Doherty bewerten soll. Ich habe nicht ein Lied von ihm im Ohr … Bei Amy Winehouse ist das anders.
Das alles muss Sie an ganz, ganz alte Zeiten erinnern.
Neulich haben mich hier in Soho einige Fotografen über den Haufen gerannt. Ich sagte zu einem Freund: Was ist denn mit denen los? Er: Da hinten geht Pete Doherty. Ich: Was macht er denn Irres? Mein Kumpel: Er geht in ein Hotel. Ich: Was ist daran so aufregend? Er: Mick, ich habe absolut keine Ahnung, aber sie finden es ziemlich aufregend, und Pete Doherty findet es ziemlich aufregend, dass sie es ziemlich aufregend finden.
Haben die Fotografen Sie nicht erkannt??
Ich habe meine dezente Methoden der Verschleierung, damit man mich nicht erkennt. Da ich ein relativ einmaliges Gesicht habe, könnte ich sonst auch gar nicht auf die Straße gehen.
Ihre Stilikonen?
Hm …
Andy Warhol?
Andy? Nein!
Offenbar unpassend.
Nein, nein, schon in Ordnung – aber er ist keine Stilikone für mich. Nie gewesen.
Sondern?
Weiß nicht. Andy war halt eine Zeit lang da. Aber er war keine Ikone. Nicht für mich. Aber hier: Cary Grant hatte Klasse. David Niven. Fred Astaire. Coco Chanel für die Frauen. Ich habe diese Leute in meiner Jugend sehr verehrt. Später dann natürlich auch die klassischen Antihelden: John Cassavetes. Oder Marlon Brando in »On The Waterfront«.
Leni Riefenstahl.
Wie bitte?
Es gibt Fotos, wo man Leni Riefenstahl sieht, wie sie Sie und Bianca fotografiert.
Sieh mal einer an. Nun, lange her. Sie wurde gelegentlich eingeflogen von diesem oder jenem, nicht? Aber von mir? Nicht, dass ich mich erinnere.
Man denkt jedenfalls nicht, dass einer wie Sie den distinguierten Stil von David Niven oder Cary Grant verehrte. Jedenfalls kann man Ihnen schwerlich vorwerfen, dass Sie diesen Stil kopiert hätten.
Man sollte nie einen Stil kopieren, mein Lieber. Sondern einen schaffen. Sie haben ja gesehen, was passiert, wenn man einen Stil kopiert. Damals. 1982. Als Sie mit Ihrer gestreiften Hose in die Schule gegangen sind. Hahaha!
Der Stil, den Sie geschaffen haben …
… verzeihen Sie, eine Ikone habe ich vergessen: Memphis Slim. Auch den habe ich sehr verehrt, auch optisch. Sie sind auf dem richtigen Weg, Sie sind auf dem Memphis-Slim-Way-of-Life!
Der Stil, den Sie geschaffen haben, war aber ein anderer: Sie sahen mitunter aus wie ein Transvestit. Warum?
Nun, um zu schockieren natürlich.
Nur? Also ausschließlich deshalb?
Was glauben Sie denn?
Weiß nicht. Heute würde man sagen: Um sich in seiner Gänze auszudrücken, seine inneren Widersprüche zuzulassen, Blockaden zu lösen … solche Sachen.
Unsinn. Vergessen Sie diesen Unsinn! Das ist Psychoratgeberzeugs aus den Zeitschriften.
Sie lachen.
Na klar, ich meine: Ich hatte keine inneren Widersprüche! Zumindest keine nennenswerten. Ich hatte Spaß. Und ich wollte berühmt sein. Reich. Begehrt.
Waren Sie dann auch, und zwar begehrt nicht nur von Frauen. Die Leute dachten: Jagger muss wohl bisexuell sein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: