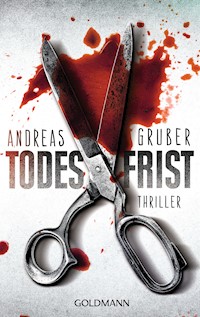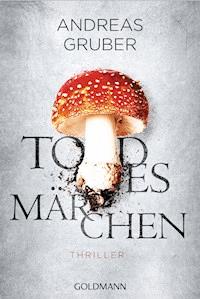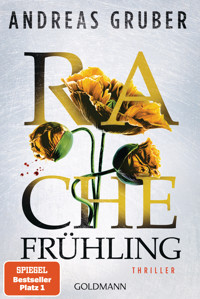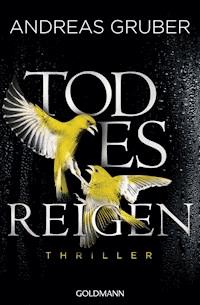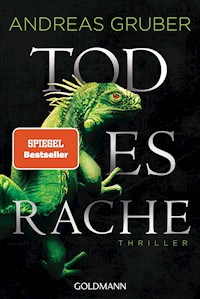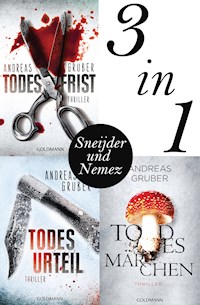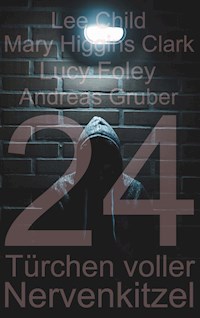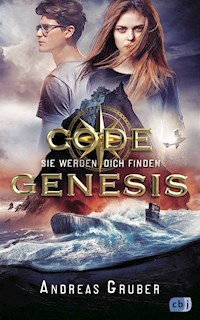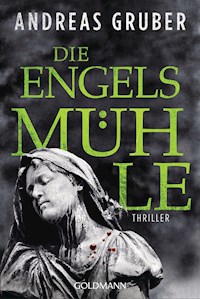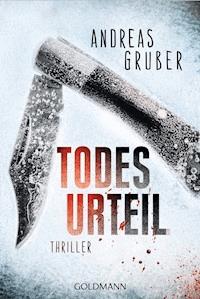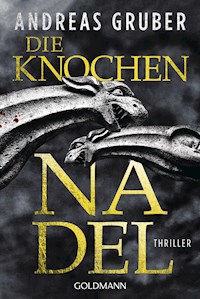
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Peter Hogart ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte der Wiener Privatdetektiv Peter Hogart nur einen Kurzurlaub in Paris verbringen. Doch dann verschwinden bei einer exklusiven Auktion in der Opéra Garnier plötzlich seine Freundin, die Kunsthistorikerin Elisabeth, sowie eine mittelalterliche Knochennadel – ein nahezu unbezahlbarer Kunstgegenstand. Wenig später werden zwei Antiquitätenhändler grausam ermordet, und für Hogart beginnt eine fieberhafte Jagd. Denn diese Morde sind nur der Anfang, und Hogart bleibt wenig Zeit, Elisabeths Leben zu retten und das Rätsel um die geheimnisvolle Knochennadel zu lösen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Paris: Der Wiener Privatdetektiv Peter Hogart begleitet seine Freundin Elisabeth zur Versteigerung eines wertvollen Kunstwerks. Die aus Elfenbein geschnitzte Knochennadel stammt von einem geheimnisumwobenen mittelalterlichen Künstler, und im Auftrag einer Versicherung soll Elisabeth den ordnungsgemäßen Ablauf der Auktion überwachen. Doch dann verschwinden sowohl die Knochennadel als auch Elisabeth unter mysteriösen Umständen – und kurz darauf wird einer der Teilnehmer der Auktion brutal ermordet. Hogart ist sich sicher, dass ein Zusammenhang besteht, und fürchtet um Elisabeths Leben. Weil er bei der französischen Polizei kaum Unterstützung findet, beginnt er selbst zu ermitteln. Bald stellt er fest, dass er nicht der Einzige ist, der Interesse an dem Verbleib der Knochennadel hat. Als dann auch noch eine zweite Leiche auftaucht, wird aus Hogarts Ermittlungen ein Wettlauf gegen die Zeit …
Weitere Informationen zu Andreas Gruber sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Andreas Gruber
Die Knochennadel
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Oktober 2020
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Ein Projekt der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de / www.agruber.com
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Arcangel / Claudia Carlsen
FinePic®, München
Karte von Paris: © Peter Palm, Berlin
TH · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-25822-1V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
für Robert Froihofer,
die Poker-Legende
von Grillenberg
»Paris ist nicht bloß die Hauptstadt von Frankreich, sondern der ganzen zivilisierten Welt und ist ein Sammelplatz ihrer geistigen Notabilitäten. Versammelt ist hier alles, was groß ist durch Liebe oder Hass, durch Fühlen oder Denken, durch Wissen oder Können, durch Glück oder Unglück, durch Zukunft oder Vergangenheit.«
Heinrich Heine, Französische Zustände
PROLOG
Ein dumpfes Geräusch riss Aimée aus dem Schlaf. Sie drehte sich im Bett um und tastete nach ihrem Idefix-Wecker. Der blinkte mit roten Ziffern. 00:09.
Wieder einmal Stromausfall! Und zwar vor genau neun Minuten.
Wie spät war es wohl tatsächlich? Aimée öffnete schlaftrunken die Schublade, tastete hinein und zog ihre rote Plastik-Armbanduhr heraus.
3.27 Uhr.
Nur noch drei Stunden, dann musste sie aufstehen und sich für die Schule fertig machen. Was war das vorhin für ein Geräusch gewesen? Egal! Wahrscheinlich hatte sich Mutter unten in der Küche ein Glas Wasser geholt und die Kühlschranktür zu fest zuge… Da, schon wieder!Eher dumpf. Wie von einem festen Schlag!
Jetzt saß Aimée aufrecht im Bett. Rasch schlüpfte sie unter der Decke hervor, schlich zur Tür, öffnete sie leise und lauschte. Der Gang lag im Dunkeln, das Mondlicht erhellte nur schwach den Teppich, die Kommode und die Gemälde an den Wänden. Von unten drangen Keuchen und Schnaufen herauf.
Mit nackten Füßen und in ihrem Wollpyjama huschte Aimée zum Absatz der breiten Holztreppe, die in den unteren Stock der Villa führte. Von hier oben wirkten die mannsgroßen griechischen Statuen, die in der Vorhalle mit dem schwarz-weiß gemusterten Boden standen, fast lebendig. In nahezu jeder Ecke des Hauses waren sie zu finden. Wegen der Sammelleidenschaft ihrer Mutter wusste Aimée mit ihren neun Jahren besser über Kunststile und Kulturepochen Bescheid als all ihre Mitschülerinnen zusammen.
Da öffnete sich die Tür am Ende des Gangs auf ihrer Etage. Sanftes Mondlicht fiel aus dem Zimmer auf den Teppich, und im Türrahmen sah Aimée die Umrisse ihres sechsjährigen Bruders. Davids Haare standen struppig weg. Er hielt seinen Teddybär in der einen Hand und rieb sich mit der anderen verschlafen die Augen. Als er Aimée am Treppenabsatz erkannte, taumelte er auf sie zu. Obwohl von unten weiter das Geräusch von Schlägen und ein lautes Stöhnen heraufdrang, das nach ihrer Mutter klang, legte sie rasch die Finger über die Lippen. Er begriff sofort, schlich leise zu ihr und drückte sich an sie.
»Hast du das auch gehört?«, flüsterte er.
»Ja.«
»Was ist da unten?«
Ich weiß es nicht, wollte sie gerade sagen, als etwas laut krachte, gefolgt von einem Splittern, als wäre eine von Mutters wertvollen Porzellanvasen auf den Boden gefallen.
Aimée zuckte zusammen, und David begann zu wimmern.
Nun fielen Schatten aus dem Wohnzimmer auf den Fliesenboden der Eingangshalle. Dort unten kämpft jemand! Mit Mutter!
»Komm mit, aber sei leise!«, zischte Aimée. Sie packte ihren Bruder an der Hand und zerrte ihn mit sich hinunter. Die Treppe knarrte, doch bei dem Lärm da unten war das garantiert nicht zu hören.
Als sie die Zwischenetage erreichten, spürte Aimée einen kühlen Luftzug. Sie blieb stehen und sah sich um. Einer der Vorhänge in der Eingangshalle bauschte sich auf. Scherben schimmerten auf dem Boden. Jemand musste die Fensterscheibe eingeschlagen haben und ins Haus eingedrungen sein. Aber warum war die Alarmanlage nicht losgegangen?
Der Stromausfall!
Aimées Herz schlug schneller. Sie hockte sich hin, David kauerte sich neben sie. Von dieser Stelle aus konnten sie zwischen den Holzstreben des Geländers hindurch ins Wohnzimmer spähen. Nun sahen sie tatsächlich ihre Mutter. Mit offenen Haaren und in ihrem cremefarbenen Nachthemd mit den Rüschen kämpfte sie mit einem maskierten Mann in dunkler Kleidung.
Aimée unterdrückte einen Schrei. Sie spürte, wie sich David an sie klammerte. »Lauf rauf und hol Papa«, wisperte Aimée, doch David bewegte sich nicht, hockte nur starr da.
»Mach schon!«, zischte Aimée.
David hob die Hand und zeigte in die hintere Ecke des Wohnzimmers. Dort lag eine reglose Gestalt in einem hellen Morgenmantel. Die kurzen grauen Haare glänzten im Mondlicht. Jetzt wäre Aimée beinahe doch ein Schrei entfahren. Papa! Der fremde Mann musste ihn niedergeschlagen haben. Bitte sei nicht tot!
Indessen rang ihre Mutter verzweifelt mit dem Kerl. Er packte und würgte sie, hob sie dabei hoch, sodass ihre zappelnden Beine zum Teil gar nicht mehr den Boden berührten.
Mama!
Aimées Herz schien stehen zu bleiben. Was, wenn er auch sie tötete? Was, wenn er danach raufging, um nach ihnen zu suchen? Ausgerechnet in dieser Nacht waren sie allein zu Hause, da ihr majordome, ihr Butler und Hausmeister, frei hatte. Was suchte der Einbrecher überhaupt hier?
Aimée bemerkte, dass ihr Vater sich zu bewegen begann. Ganz langsam, zuerst die Arme, dann die Beine. Papa ist am Leben! Jetzt würde alles gut werden. Er würde Mama zu Hilfe eilen und den Einbrecher vertreiben.
»Schau!« David fing aufgeregt an, mit den Fingern in Richtung ihres Vaters zu wedeln, doch Aimée presste ihm rasch die Hand auf den Mund.
»Sei leise!«, zischte sie.
Ihr Vater erhob sich. Dabei drückte er die Hand gegen die Schläfe, wo der Einbrecher ihn anscheinend getroffen hatte. Er taumelte auf den Mann zu, der immer noch ihre Mutter im Würgegriff hielt.
»Keinen Schritt weiter!«, ertönte da eine fremde keuchende Stimme.
Aimée spürte, wie David sich vom Treppengeländer losreißen wollte, um hinunterzulaufen. Doch ihre Finger krallten sich in seinen Arm, hielten ihn zurück. Er schrie auf, im gleichen Moment krachte ein Schuss.
Aimées Herzschlag setzte aus.
Der Fremde ließ den Hals ihrer Mutter los. Sie wurde schlaff in seinen Armen, sank langsam auf die Knie und fiel dann wie ein nasser Sack nach vorne, wo sie liegen blieb.
Nein, nein, nein!
Aimées Blick verschwamm. Sie ließ David los, ebenso das Geländer, das sie die ganze Zeit mit der anderen Hand umklammert hatte. Sie wollte aufstehen, spürte jedoch etwas Warmes, das sich um ihre Füße ausbreitete. Es roch nach Urin. David hatte sich in die Hose gemacht. Mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund hockte er neben ihr und starrte auf ihre Mutter, die einfach nur dalag und sich nicht mehr bewegte.
Als Aimée endlich nach Luft schnappte und wieder klar sah, konnte sie den Blick nicht von dem Einbrecher lösen. Er und ihr Vater standen sich wortlos gegenüber. Niemand bewegte sich.
Als Nächstes wird der Mann meinen Vater töten, schrie eine Stimme in ihr. Sie fühlte sich völlig hilflos.
Bis sie merkte, dass etwas an dieser ganzen Situation nicht stimmte.
»Papa?«, murmelte sie.
Nicht der Einbrecher hielt die Waffe in der Hand, sondern ihr Vater.
Er hatte Mutter erschossen.
1. TEIL PARIS Fünfzehn Jahre später Montag, 14. September
1. Kapitel
Mitten im Pariser Zentrum lag die Opéra Garnier – die Pariser Oper –, die trotz des wenigen Platzes, den man ihr zwischen den Häuserschluchten zugestanden hatte, majestätisch über der Stadt thronte.
Vor einigen Jahren hatte man ihr großes 150-jähriges Jubiläum gefeiert. Soviel Peter Hogart wusste, hatte es einige Jahre vor der ursprünglichen Eröffnung in der vorigen Oper einen Bombenanschlag gegeben, bei dem Teile des Gebäudes in Schutt und Asche gelegt worden waren. Das gab es damals also auch schon. Ein neues Opernhaus mit höheren Sicherheitsstandards musste her. Klingt verdammt vertraut. Deshalb hatte eine anonyme Ausschreibung stattgefunden, die schließlich der junge Architekt Garnier gewann.
All das, was es auch heute noch in der Oper zu sehen gab, die prunkvollen Treppen, Balkone, Säulenhallen, Rundbögen, Kronleuchter und Deckenfresken, ging auf Garniers visionäres Denken zurück. Doch so beeindruckend das auch wirkte – aus heutiger Sicht waren die Sicherheitsvorkehrungen alles andere als berauschend. Eine Tatsache, die Hogart bei seinem Besuch in der Oper sofort ins Auge gesprungen war. Das sagte ihm nicht nur seine Erfahrung als Versicherungsdetektiv, mit der er so manchen angeblich unlösbaren Fall geknackt hatte, sondern auch sein gesunder Menschenverstand. Allerdings hielt er den Mund – schließlich war er diesmal rein privat in Paris.
Die letzte deutschsprachige Führung an diesem Nachmittag war schon beinahe am Ende angelangt. Am meisten war Hogart von der riesigen Bühne beeindruckt gewesen, die weit in das Innere des Gebäudes und fünf Stockwerke tief hinunter reichte. Im Moment war noch Sommerpause, und die Handwerker arbeiteten an einem neuen Bühnenbild zur Wiedereröffnung. Außerdem hatte Hogart während der Führung den Schauspielern bei der Probe von Les Misérables zuhören können. Ein Musical! Normalerweise wurde das Haus mit Mozart oder Verdi bespielt, aber offenbar sollte das ein Special Event zur Saisoneröffnung werden. Dafür, dass die Premiere schon an diesem Samstag stattfinden sollte, sah alles noch sehr chaotisch aus.
Nachdem sie auch die Seitenpavillons, das Vestibül und das Pausenfoyer gesehen hatten, stand nun der angebliche Höhepunkt bevor.
»Dort hinten ist es«, wisperte Tatjana aufgeregt.
»Das ist doch nur ein Fake«, bremste Hogart die Euphorie seiner Nichte. »Das Phantom hat es nie gegeben, es ist bloß die Erfindung eines Schriftstellers.«
»Und was macht dich da so sicher?« Sie folgte dem jungen Mann, der die kleine Touristengruppe zu einer holzvertäfelten dunkelbraunen Tür führte. Dort breitete der Guide die Arme aus.
»Und in dieser Loge saß das berühmte Phantom der Oper, um sich die Vorstellungen anzusehen.«
Unter der Bezeichnung 6 Places 5 Louée hing ein Schild.
»Loge du Fantôme de l’Opéra«
Darunter befand sich ein rundes Guckloch, durch das man einen Blick in die Loge erhaschen konnte.
Tatjana presste ihr Gesicht ans Glas. »Siehst du«, zischte sie.
Hogart verdrehte die Augen.
»Und den unterirdischen See gibt es auch«, beharrte sie.
»Der ist genauso eine Legende«, flüsterte Hogart. »Bei den Bauarbeiten sind sie auf Grundwasser gestoßen und haben wegen Statik und Druckausgleich eine große Eisenwanne eingebaut, die gleichzeitig als Wasserreservoir für die Feuerwehr …«
»Danke, ich habe genug Sachbücher darüber gelesen und außerdem den Film gesehen«, unterbrach sie ihn.
»Den von Walt Disney?«, fragte er trocken.
»Nein, den Klassiker von 1925.«
Obwohl Tatjana schon neunzehn war, benahm sie sich in ihrer Begeisterung manchmal wie ein Kind. Und diese junge Frau wollte wie er eine Detektivin werden!
»Durch das Musical Das Phantom der Oper wurde dieses Opernhaus schließlich selbst zur Kulisse eines Stücks«, sagte ihr Guide. »Und damit sind wir am Ende unserer Führung angelangt.«
Hogart blickte auf die Uhr. Es war halb fünf, die Auktion würde bald beginnen.
Nach einem kräftigen Applaus und einigen Euro Trinkgeld löste sich die Gruppe auf. Tatjana fotografierte noch die Loge des Phantoms mit ihrem Handy, knipste nebenbei auch noch den jungen Guide im Profil, und im nächsten Moment war Hogart mit ihr allein.
»Suchen wir Elisabeth?«, schlug er vor.
Tatjana nickte. Sie gingen zurück ins Vestibül und weiter in den hinteren Bereich des Gebäudes, wo die Abteilungen für Technik und Verwaltung lagen.
»Was für ein Prunk«, staunte Tatjana.
Ja, es war erschreckend. Durch die vielen Kronleuchter und Laternen glänzte nicht nur der Marmor in Goldfarben, sondern das gesamte Interieur des Opernhauses. Man bekam den Eindruck, in einem gigantischen Schmuckkästchen zu stehen. Und trotz hunderter Besucher, die mit Fotoapparaten herumliefen, war immer noch so viel Platz. Die offene Bauweise umfasste sowohl die breiten Aufgänge als auch die Balustraden weiter oben, von denen man einen Ausblick auf die Eingangshalle hatte. Wie hatte Garnier es einst treffend formuliert? Die Oper war gebaut worden, um zu sehen und gesehen zu werden.
»Was machen wir nachher, wenn Elisabeth die Auktion beendet hat?«, fragte Tatjana.
»Zuerst einmal aus der Oper abhauen, bevor sie uns mit den anderen Besuchern rauswerfen. Um sechs machen sie hier dicht. Wir könnten auf den Eiffelturm gehen.«
»Und morgen?«
»Das Grab von Jim Morrison auf dem Père-Lachaise besuchen, Sacré-Cœur besichtigen, eine Bootsfahrt auf der Seine unternehmen oder nach Versailles fahren.«
»Oder wenn es regnet eine Vampir- und Geistertour durch die unterirdischen Katakomben von Paris machen und uns das Beinhaus anschauen«, schlug sie vor.
Hogart verzog das Gesicht. Nach diesem Besuch hatte er eigentlich genug von mühsam in Szene gesetzter Mystik. »Oder in ein Antiquariat, eine Tauschbörse oder eine nostalgische Kinovorstellung«, schlug er vor. Schon als Kind hatte er die Schulausflüge immer geschwänzt und stattdessen die Vormittagsvorstellung eines Filmtheaters besucht.
»Wie spannend!« Tatjana hielt ihr Handy hoch, verdrehte jedoch die Augen. »Die Verbindung hier ist zum Kotzen.«
Hogart hob den Blick zur Decke. »Massives Steingebäude.«
»Und wie soll ich bei diesem Funkloch bitte schön online gehen?«
»Gar nicht! Die Vorstellungen sollen ja nicht durch Handys gestört werden.«
»Und das wussten die damals schon, als sie die Oper gebaut haben?«
Hogart schüttelte nur den Kopf. Manche Dinge stellten sich eben erst im Nachhinein als sinnvoll heraus.
»Oh, jetzt geht was«, rief sie. »Haben wir ein Glück, ab morgen wird es schön.«
»Sagt wer? Deine tolle Wetter-App, die gestern schon falschgelegen ist?«
»Apps sind das Werkzeug des modernen Detektivs«, erklärte sie ihm. »Du solltest auch langsam auf ein Computersystem umsteigen.«
»Ich habe eines, das weder abstürzt noch für Viren anfällig ist.«
Sie sah ihn fragend an.
Er bewegte nur die Finger. »Papier und Bleistift.«
»Wie fortschrittlich.«
»Und außerdem arbeite ich hiermit«, er tippte sich an die Stirn, »wie die Detektive in der guten alten Zeit.«
»Auch wenn du es nicht wahrhaben willst, aber gerade jetzt ist die gute alte Zeit, nach der du dich in zwanzig Jahren zurücksehnen wirst.«
Klar, rede du nur!
Sie waren bis Freitagabend in Paris, ab morgen alle drei nur noch privat. Bloß heute hatte Elisabeth etwas Berufliches zu erledigen, denn an diesem Abend fand in der Opéra Garnier unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien eine Auktion statt. Seiner Meinung nach zwar ein eher merkwürdiger Veranstaltungsort, aber er hatte schon mehrere seltsame Dinge im Lauf seines Lebens erlebt, und außerdem ging es ihn ja auch nichts an. Jedenfalls hatte die Oper den Versicherungsriesen Medeen & Lloyd mit der finanziellen Abwicklung beauftragt. Da Elisabeth für Medeen & Lloyd als Gutachterin für Kunstgegenstände arbeitete und zudem staatlich geprüfte Auktionatorin war, leitete sie die Veranstaltung. Mit französischen Wurzeln seitens einer verstorbenen Großmutter und einem exzellenten Fachwissen über französische Antiquitäten war sie wie geschaffen für diesen Job.
Hogart hatte sie begleitet und in einem Anfall von onkelhaftem Großmut Tatjana mitgenommen. Immerhin war seine Nichte im Sommer neunzehn geworden, wollte schon immer mal Paris sehen, lernte neben ihrer Ausbildung an der Polizeischule in einem Abendkurs an der Volkshochschule Französisch und hatte diese Woche noch Ferien. Ausschlaggebend war für Hogart aber gewesen, dass sie dieses Mal auf einem reinen Urlaubstrip waren und seine kleine Hobby-Detektivin keine Gelegenheit haben würde, ihn wieder mit ihrem kriminalistischen »Wissen« zu beglücken.
»Was wird eigentlich versteigert?«, fragte Tatjana.
»Keine Ahnung, bin privat hier.«
Was glatt gelogen war, denn er wusste ganz genau, was heute unter den Hammer kam: ein etwa achtzehn Zentimeter großes, aus Elfenbein geschnitztes Exponat des französischen Künstlers Bíro aus dem 12. Jahrhundert, das den charmanten Namen Die Knochennadel trug und extrem hässlich war. Der Rufpreis lag bei 950 000 Euro, und bis gestern war die Knochennadel einen Monat lang im Louvre ausgestellt gewesen, um interessierte Käufer zu informieren. Aber das sollte Tatjana ohne ihn herausfinden. Sie war schließlich die Superdetektivin. Außerdem war er froh, sich einmal nicht den Kopf über Kunstquatsch zerbrechen zu müssen.
Sie gingen einen langen Korridor entlang und kamen in die Nähe des kleinen Auktionssaals, wo eine zwischen zwei goldverzierten Ständern gespannte Kordel den Zutritt versperrte.
Ein großer Mann in schwarzer Uniform mit rotem Bürstenhaarschnitt und vorspringendem Kinn hielt Hogart und Tatjana mit einer dezenten Handbewegung auf. Neben ihm stand eine ebenso hochgewachsene Dame in der gleichen Montur, die ihn musterte.
»L’Auction«, sagte Hogart knapp, obwohl er wusste, dass das nicht gerade sehr französisch klang, was er da von sich gab. Daher nickte er zum Auktionssaal und wedelte mit einem Flyer, auf dem die Knochennadel abgebildet war.
»Du wusstest es also doch!«, zischte Tatjana.
»Klar.«
Der Flyer reichte, damit der riesenhafte Kerl die Kordel abnahm und sie durchließ.
950 000 Euro, und die Sicherheitsvorkehrungen sind der reinste Witz!
Jeder, der rein wollte, kam auch rein.
2. Kapitel
Vor dem eigentlichen Eingang des Saals trafen sie auf Elisabeth, die in ein Gespräch mit einer älteren Dame vertieft war. Elisabeth trug ihren dunkelblauen Hosenanzug zusammen mit dem roten Schal und den roten Stöckelschuhen. Auf ihrem Blazer steckte ein Schild. Elisabeth Domenik – commissaire-priseur. Sie sah zwar noch sehr jung, aber unglaublich kompetent und hinreißend aus. Selbst in einem Kartoffelsack wäre sie eine Augenweide gewesen, mit ihren blonden gewellten Haaren und dem atemberaubenden Lächeln.
»Ah, hallo …« Sie bemerkte Hogart und gab ihm einen Kuss. »… mein grauer Wolf«, flüsterte sie. Eine kleine Anspielung auf sein Alter. Dann wandte sie sich an ihre Gesprächspartnerin. »Mein Lebensgefährte, Peter Hogart, und seine Nichte Tatjana«, stellte Elisabeth sie beide vor.
Hogart und Elisabeth kannten sich zwar schon seit zweieinhalb Jahren, waren aber erst seit drei Monaten ein Paar. Auch wenn es noch ein wenig früh schien, hatten sie vereinbart, einander gegenüber anderen als Lebensgefährten vorzustellen, weil Freund und Freundin so dämlich klang und sie, Anfang dreißig, und er mit seinen knapp fünfundvierzig Jahren schon lange über dieses Alter hinaus waren.
Hogart musste jedes Mal schmunzeln, wenn er an ihren ersten gemeinsamen romantischen Abend in ihrem Lieblingssteakhouse dachte, an dem sie ihn mit einer Rose und den Worten überrascht hatte, dass er das allein ja doch nie hinbekommen würde.
»Grins nicht so blöd«, zischte Elisabeth ihm zu, dann stellte sie ihr Gegenüber vor. »Frau Dr. Meyer-Lanski.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen.« Die ältere Dame, die genauso groß war wie Elisabeth, hatte schulterlanges graues Haar und trug ein schwarzes Kostüm. Sie sprach fast akzentfreies Hochdeutsch mit leichtem Berliner Dialekt. Außerdem hatte sie einen festen Händedruck und funkelnde eisblaue Augen, mit deren Blick sie Hogart nun regelrecht sezierte.
»Die kulturelle Leiterin des Opernhauses«, erklärte Elisabeth.
Dachte mir schon, dass das keine normale Besucherin ist. »Angenehm.« Hogart lächelte. Bei diesem Drachen spurte das Personal vor Ort sicherlich ohne Mätzchen.
Hogart fiel auf, dass sie Tatjana etwas länger als nötig betrachtete, vor allem die wilde Mähne mit den schwarzen Rastalocken, die Doc Martens und die alte Lederjacke, die aussah, als hätte sie schon Hogarts Großvater in den 50er Jahren beim Motorradfahren getragen. Mit den Dreadlocks war Tatjana anscheinend nicht nur auf der Polizeischule ein obskurer Anblick.
Sind wir hier im Zoo, schien deren irritierter Blick jetzt zu sagen. Zum Glück blieb Meyer-Lanski Tatjanas Spinnen-Tattoo auf der Schulter verborgen.
»Wir wollten nicht stören, bloß Hallo sagen.« Hogart wollte sich schon wieder abwenden.
»Kein Problem, wir haben bereits alles besprochen.« Elisabeth klappte ihre rote Mappe zu und klemmte den Medeen & Lloyd-Kugelschreiber an die Hülle. »Wie war eure Führung?«
»Riesig.« Tatjana strahlte. »Die Bühne ist der Hammer!«
»Habt ihr auch den unterirdischen See gesehen?«, fragte Elisabeth.
»Wanne«, korrigierte Hogart.
»Leider nur durch ein Gitter.«
»Und die Loge des Phantoms?«, wollte Elisabeth wissen.
»Du meinst die Loge mit dem Schild? Ja, die haben wir auch gesehen«, raunte Hogart.
Tatjana stieß ihm den Ellbogen hart in die Seite. »Ja, auch die ist toll!«
Dr. Meyer-Lanski schob sich die Brille auf die Nasenspitze und blickte über den Rand. »Womöglich hat es das Phantom tatsächlich gegeben …«
Jetzt ging das wieder los!
»Siehst du«, rief Tatjana.
»Von mir aus«, gab Hogart sich geschlagen. Er hatte keine Lust, mehr Energie als nötig auf dieses Thema zu verschwenden.
»Sie glauben nicht daran?«, fragte Meyer-Lanski herausfordernd.
»Ich glaube an eine gut funktionierende Werbekampagne für Touristen.« Er dachte an die vielen Masken, Poster und Fähnchen zum Thema Phantom im Souvenirshop.
»Möglicherweise basiert Gaston Leroux’ Roman ja auf wahren Begebenheiten«, bemerkte sie augenzwinkernd.
Oh, schau an, sie konnte sogar kokett sein.
»Sie meinen so wie Dracula, Frankenstein und Jekyll & Hyde?«, entgegnete er.
Sie seufzte. »Wären Sie nicht Elisabeth Domeniks Lebensgefährte, würde ich keine Minute an Ihre kulturelle Bildung verschwenden, doch in Ihrem Fall mache ich gern eine Ausnahme. Jetzt schließt das erste Untergeschoss leider schon bald, aber wenn Sie morgen die Sonderausstellung der Oper besuchen, werden Sie dort den Briefwechsel zwischen Gaston Leroux und Lon Chaney finden.«
Hogart horchte auf. »Der Lon Chaney?«, entfuhr es ihm. »Der im Stummfilm von 1925 das Phantom gespielt hat?«
Nun hob Meyer-Lanski überrascht die Augenbrauen. »Sie sind ja doch nicht so unwissend, wie Sie vorgeben.«
»Der Schein trügt. Mein Onkel liebt nur alte Schwarz-Weiß-Filme und sammelt Autogramme und Filmplakate«, erklärte Tatjana.
Hogart ignorierte den Seitenhieb. Lon Chaney! Das klang ja nun wirklich interessant. »Und wie sind Sie an diese Briefe gekommen?«, fragte Hogart skeptisch.
»Ich bitte Sie! Wenn jemand davon Kenntnis hat, dann wohl ich«, sagte sie ein wenig echauffiert. »Und als kulturelle Leiterin der Oper habe ich meine Methoden.«
»Und was schreibt Leroux? Dass er das Phantom mit eigenen Augen gesehen hat?«
Meyer-Lanski kniff die Augen zusammen, als fühlte sie sich ein klein wenig veräppelt. »Lesen Sie sich morgen die Briefe durch.«
»Garantiert.« Tatjanas Augen leuchteten.
Und diesmal konnte er ihr nur aus vollem Herzen zustimmen. Schon allein Lon Chaneys Signatur zu sehen wäre einen neuerlichen Opernbesuch wert.
In diesem Moment gingen einige auffällig gut gekleidete Damen und Herren an ihnen vorbei und reichten einem Angestellten eine Karte. Der öffnete die Tür zum Auktionssaal, und Hogart erhaschte einen Blick hinein. Der Raum bot für etwa siebzig Personen Platz, war aber nur zu zwei Drittel gefüllt. Seitlich gab es eine kleine Videowand. Hogart konnte auf dem Monitor die Silhouette eines Mannes erkennen. Offenbar wurde sogar ein Interessent per Videostream live dazugeschaltet, der gegenüber den anderen Mitbietern anonym bleiben wollte.
»In wenigen Minuten geht es los«, sagte Elisabeth. »Es sind schon fast alle da.«
Fast alle?
Hogart blickte noch einmal in den Raum. »Einen Monat im Louvre ausgestellt, und dann sind nur so wenige an der Auktion interessiert?«, flüsterte er.
Elisabeth wollte etwas sagen, doch Meyer-Lanski übernahm die Antwort. »Als die Knochennadel vor einem halben Jahr überraschend aufgetaucht ist, hat das natürlich Wellen geschlagen. Dennoch ist es eine Insider-Versteigerung ohne öffentlichen Zutritt, nur mit vorheriger Anmeldung, und bei der Höhe dieses Rufpreises sind nur noch wenige renommierte Antiquitätenhändler an dem Exponat interessiert. Qualität statt Quantität. Sie entschuldigen mich. Ah, Monsieur Bonnet …« Sie ging zur Seite und begrüßte einen älteren, kleinen Mann mit sympathischem Blick, der mit einem deutlichen Hinken soeben den Raum betreten wollte.
»Du hättest ruhig ein wenig freundlicher zu ihr sein können!«, tadelte Elisabeth ihn.
Na klar, ich bin ja auch Mutter Teresa. »Hattest du schon öfter mit ihr zu tun?«
»Ja, warum?«, fragte Elisabeth. »Sie ist doch nett, oder?«
Hogart verzog das Gesicht. »Ich hoffe, sie hat alles im Griff.«
Elisabeth kniff die Augenbrauen zusammen. »Wie meinst du das?«
»Ach, nichts.«
»Was heißt, ach nichts? Diesen Blick kenne ich nur zu gut. Los, sag schon!«
»Warum muss die Auktion ausgerechnet in einer Oper stattfinden?«, presste er schließlich hervor. »Warum in keinem Museum oder Auktionshaus?«
Sie zuckte die Achseln. »Meyer-Lanski hat Erfahrung in solchen Dingen, und die Oper macht solche Veranstaltungen nicht zum ersten Mal. Hier kamen schon einige äußerst bedeutende Kunstgegenstände unter den Hammer.«
»Auch so wertvolle?«, fragte er.
Sie runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?«
Hogart biss sich auf die Lippe.
»Die Sicherheitsvorkehrungen erinnern nicht gerade an Fort Knox«, antwortete Tatjana schließlich an Hogarts Stelle.
Na bitte, sogar diesem Dreikäsehoch ist es aufgefallen.
»Ach?« Elisabeth klemmte sich die Mappe vor die Brust und verschränkte die Arme. »Machen sich Detektiv Auguste Dupin und seine Assistentin etwa Sorgen?«, fragte sie spitz, aber immer noch amüsiert.
»Ich finde das nicht zum Lachen«, entgegnete Hogart ernst. »Jeder kann hier einfach so hereinmarschieren!« Er nickte zu dem Kerl mit dem roten Bürstenhaarschnitt im Gang. »Und dieser Bergtroll und seine Kollegin überprüfen nicht einmal die Personalausweise oder machen einen Securitycheck.«
»Den gab es schon, als du die Oper betreten hast.«
»Richtig, aber die zwei Eingänge bei den Seitenpavillons sind nicht bewacht.« Er deutete zur Decke. »Hier gibt es keine Überwachungskameras, der Zutritt zu den Toiletten ist nicht abgesperrt, ebenso wenig wie der Aufgang in die nächste Etage, zu den Balkonen und seitlich zu den Logen. Und der Schätzwert des Exponats ist mindestens doppelt so hoch wie der Rufpreis. Wenn es jemand klaut, dann heute und hier!«
Elisabeth beugte sich zu Hogart und senkte die Stimme. »Wir werden es sogar für über drei Millionen Euro versteigern.«
Tatjana riss die Augen auf.
»Es sind nicht nur Galeristen und private Sammler daran interessiert«, erklärte Elisabeth, »sondern auch internationale Museen.«
»Drei Millionen! Und das beunruhigt dich nicht?«, zischte Hogart. »Ich fasse es nicht. Du hast doch selber ständig mit Versicherungsbetrug zu tun. Normalerweise bist du viel …«
Elisabeth schmunzelte. »Ich habe alles unter Kontrolle.«
»Bin ich denn der Einzige hier, der sich Sorgen macht?« Nun war Hogart ungewollt laut geworden, sodass sogar Dr. Meyer-Lanski und Monsieur Bonnet zu ihnen herüberblickten.
»Kommt mit, ich zeige euch etwas.« Elisabeth packte Hogart am Arm und führte ihn in eine abseits gelegene Nische. Tatjana folgte ihnen neugierig.
Nachdem sich Elisabeth umgesehen hatte, ob sie auch niemand beobachtete, zog sie ein etwa zwanzig Zentimeter langes schwarzes Etui aus der Innentasche ihres Blazers und klappte es auf. In dunkelroten Samt eingebettet lag eine aus blankem Elfenbein geschnitzte und mit vielen Hohlräumen, kreisrunden Vertiefungen und filigranen Verzierungen versehene achtzehn Zentimeter lange Nadel. Hogart berührte sie. Ein wenig sah sie aus wie ein Miniaturschwert, jedenfalls hatte die Klinge die scharfe Schneide eines Messers.
»Dieses hässliche Ding ist drei Millionen wert?«, entfuhr es Tatjana mit gepresster Stimme, woraufhin sie sich sofort die Hand über den Mund schlug. »Und wem gehört das?«, wisperte sie. »Dem Louvre?«
»Nein, dort war die Nadel nur ausgestellt. Sie ist Eigentum einer privaten Sammlerin, die sich jetzt von ihr trennt.« Elisabeth setzte sich ihre Lesebrille auf, die in ihren Haaren gesteckt hatte. »Hier, unter dieser Vorwölbung erkennst du eine winzige eingravierte Prägung«, erklärte sie.
»Made in Taiwan?«, witzelte Hogart, doch im nächsten Augenblick verschlug es ihm die Sprache. Dort war tatsächlich ein Produktionshinweis, so klein, dass man ihn kaum erkennen konnte. Neben dem Wort »Duplikat« stand die UID-Nr. einer Firma. »Was soll das? Das stammt doch niemals aus dem zwölften Jahrhundert.«
»Richtig, es ist ein Duplikat aus Keramik im historischen Look, das auf meine Empfehlung hin extra für diese Auktion bis ins kleinste Detail exakt gleich angefertigt worden ist – aus Sicherheitsgründen«, flüsterte Elisabeth.
»Und im Louvre?«, wisperte Tatjana.
»Stand das Original – aber jetzt kommt diese Kopie unter einem Glassturz auf den Versteigerungstisch.«
Hogart entspannte sich ein wenig. »Wer weiß davon?«
»Nur Frau Dr. Meyer-Lanski, Helmut Rast, ich … und jetzt ihr.«
Medeen & Lloyd war keine gewöhnliche Versicherung, bei der man normale Haushaltspolicen abschloss. Im Gegenteil, dort wurden Millionenwerte versichert: Rennpferde, Diamanten, Oldtimer, barocke Gemälde, Güterzüge, Fluglinien und ganze Öltankerflotten. Die Liste der zusätzlichen Serviceleistungen war länger als das Pariser Branchenverzeichnis. Mit weltweit über zweihundertfünfzig Büros und drei Milliarden Euro Jahresumsatz zählte Medeen & Lloyd zu den Branchenriesen. Jetzt wurde Hogart klar, warum Helmut Rast, der Vorstandsdirektor und Geschäftsführer der Wiener Zweigstelle, ausgerechnet Elisabeth für diesen Job nach Paris geschickt hatte. Sie dachte an alles. »Und die echte Knochennadel?«
Elisabeths Augen leuchteten voller Faszination auf. »Befindet sich während der Auktion sicher in einem Raum hinter dem Saal in einem Tresor der Oper und wird mir erst nach der Versteigerung in einem tragbaren Safe übergeben.«
Hogart sah sie skeptisch an.
»Ich weiß, was du jetzt denkst.« Das Leuchten in Elisabeths Augen war wieder verschwunden. Sie ließ die schmale Schatulle zuschnappen und in ihrem Blazer verschwinden. »Aber für den Abtransport stehen mir zwei Leute vom Sicherheitspersonal der Oper zur Verfügung. Zufrieden?«
»Und wer sind die?«
»Du bist erst dann beruhigt, wenn du alles weißt, nicht wahr?«
»Ich habe ständig mit Mördern, Dieben und Versicherungsbetrügern zu tun«, rechtfertigte er sich und merkte gerade selbst, dass er nicht einmal im Urlaub abschalten konnte.
»Der Sicherheitsmann heißt Girard, seine Kollegin Isabelle. Sie sind auf sichere Transporte spezialisiert und tragen beide eine Waffe. Er hat außerdem einige Medaillen im Siebenkampf und kennt zwölf verschiedene Möglichkeiten, einen Menschen innerhalb von drei Sekunden mit bloßen Händen zu töten.«
»Du machst Scherze?«
»Glaubst du allen Ernstes, ich würde mir eine so billige Pointe ausdenken?« Sie zog eine Karte aus ihrer Handtasche und reichte sie ihm. »Falls du dir trotzdem Sorgen machst, hier hast du sämtliche Pariser Notfallnummern.«
Hogart blickte auf die Telefonnummern von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Taxi, Krankenhäusern, der österreichischen Botschaft und von anderen nützlichen Kontakten. Er steckte die Karte ein und atmete tief durch. »Und wo sind diese Superhelden jetzt? Auf der Toilette, ihren Umhang anziehen?«
Elisabeth wies mit einem Kopfnicken den Gang hinunter, wo der Hüne mit dem roten Bürstenhaarschnitt stand. »Es sind der Bergtroll, wie du ihn zuvor bezeichnet hast, und seine Kollegin. Falls Diebe auftauchen, wird er sie kaltmachen.«
3. Kapitel
Nachdem sich die Tür des Auktionssaals geschlossen hatte, damit die Versteigerung pünktlich um 17 Uhr beginnen konnte, gingen Hogart und Tatjana zur Kolonnade. Dieser Gebäudeteil lag im Freien und glich einem riesigen Balkon mit Säulen und Rundbögen, der sich über dem Haupteingang befand. Von hier aus konnte man die breite Avenue kerzengerade bis zur Gebäudefront des Louvre hinunterblicken, hinter der sich die gläserne Pyramide befand. Noch weiter hinten schlängelte sich die Seine durch die Stadt.
Die Wolken, die an diesem Morgen den Pariser Himmel noch grau in grau bedeckt hatten, waren inzwischen verschwunden. Tatjanas App hatte anscheinend recht. Der Abend war sonnig, und ein milder Wind strich über den Balkon. Der September wurde vielleicht noch richtig warm.
Hogart knöpfte sein Sakko auf und lehnte sich an die Marmorbalustrade. Neben ihm zoomte Tatjana den Louvre mit ihrer Handykamera heran und machte ein Foto. Unglaublich, wie gut diese Kameras mittlerweile waren! Man konnte sogar fast die einzelnen Ziegel, Fensterkreuze und Dachschindeln sehen.
In dieser Hinsicht war Hogart wirklich noch alte Schule. Wie eigentlich in fast jeder anderen Hinsicht auch. Er liebte nicht nur Schwarz-Weiß-Klassiker, sondern auch Schallplatten von Muddy Waters, John Lee Hooker, Duke Ellington sowie den Jazz der 30er Jahre und hatte mit moderner Technik nicht viel am Hut. Sein alter Skoda besaß nicht einmal ein Navi. Doch um Versicherungsbetrüger zu überführen, brauchte es zum Glück weder WLAN, Datenbanken noch irgendwelche Apps, sondern lediglich ein scharfes Auge, etwas Grips und Einfühlungsvermögen in die Psyche eines Kriminellen.
Und weil er darin, trotz altmodischen Vorgehens, richtig gut war, hatte Hogart kein Problem, an Aufträge zu kommen. Meist handelte es sich um größere Sachen wie Firmenbrände, außergewöhnliche Personenunfälle oder Diebstähle in großem Rahmen. Versicherungsschwindler glaubten, die perfekte Masche für den absolut glaubwürdigen Betrug gefunden zu haben, doch jeder machte irgendwann einen Fehler. Hogarts Job bestand darin, diesen aufzuspüren, und als Freelancer konnte er ohne Konkurrenzklausel für mehrere Versicherungen gleichzeitig arbeiten.
Doch jetzt hatte er endlich einmal frei, und das galt hoffentlich dann bald auch für Elisabeth. Hogart strich sich über den ergrauten Dreitagebart. Direkt unter der Kolonnade saßen Straßenmusiker auf den Treppen zum Haupteingang und spielten Gitarre, Akkordeon und Synthesizer – eine Mischung aus Chansons und französische Balladen.
»Klasse Musik, oder?«, neckte Hogart seine Nichte.
»Unglaublich.« Sie steckte sich den Finger in den Rachen und tat so, als wollte sie sich übergeben.
Obwohl Tatjana Frankreich und Paris liebte, mochte sie diese Musik überhaupt nicht. Stattdessen spielte sie unter dem Namen Spider – daher das Tattoo – Bass in einer Girls-Punkband, die sich Johnny Depp nannte. Die Mädels waren schon lange dem Status einer reinen Garagenband entwachsen, hatten bereits ihr erstes Album in einem Tonstudio aufgenommen und sogar schon die ersten Auftritte gehabt. Hatten sie früher noch auf Deutsch gesungen, so waren sie jetzt zum Englischen übergegangen und hatten ihr erstes Album völlig unbescheiden Greatest Hits genannt. Dieses befand sich im CD-Player von Hogarts Leihwagen, der vor ihrem Hotel am Montmartre stand. Zwar hatte es wenig mit seinem geliebten Jazz zu tun, aber man konnte es sich anhören, ohne einen Gehörschaden zu bekommen.
»Wie lange dauert so eine Versteigerung?«, fragte Tatjana jetzt, nachdem sie in alle Richtungen fotografiert hatte.
»Bei einem Rufpreis von 950 000 Euro gehen die Sprünge in Fünfundzwanzig-, danach in Fünfzigtausender-Schritten. In nicht mal zehn bis fünfzehn Minuten ist die Sache abgewickelt. Im Grunde genommen ist es ziemlich unspektakulär.«
Tatjana blickte auf die Uhr. »Dann müsste sie doch schon längst fertig sein.«
»Ich habe ihr eine SMS geschickt, dass wir hier sind. Sie wird sich bei uns melden«, beruhigte Hogart sie. »Aber es wird noch eine Weile dauern, bis sie herauskommt.« Falls sie die SMS überhaupt empfängt.
Tatjana spielte an ihrem Lippenpiercing und sah ihn fragend an. »Was passiert danach noch so?«
»Wenn es so ähnlich abläuft wie bei anderen Auktionen, die ich kenne, wird Elisabeth die Echtheit der Knochennadel prüfen und sie anschließend gleich mit einer Police für den Käufer versichern, damit bis zur Übergabe kein Risiko besteht.«
»Und das dauert so lange?«
»Dann wird der Kaufpreis auf das Treuhandkonto eines Notars überwiesen, der für Medeen & Lloyd arbeitet, und Elisabeth muss für den Transport der Nadel in ein Bankschließfach sorgen, wo das Ding bis zur Übergabe an den Käufer verwahrt wird.«
»Und danach?«
Hogart zuckte die Achseln. »Wird es dem Käufer zugestellt – oder er holt es sich selbst ab. Ist nicht wirklich kompliziert«, beruhigte er sie. Aber auf dem Weg zum Banktresor kann vieles schiefgehen.
»Ah, hier sind Sie also!«, ertönte eine Stimme hinter ihnen.
Hogart drehte sich um. Frau Dr. Meyer-Lanski stand vor ihnen, blickte mit Sonnenbrille und gerecktem Hals zum Horizont in Richtung Louvre und sah dann Hogart an. »Frau Domenik hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden werde.«
»Ist die Auktion zu Ende?«, fragte Hogart.
Meyer-Lanski nickte. »Frau Domenik wickelt noch das Bürokratische ab.«
»Wie vereinbart werden wir sie anschließend auf ihrer Fahrt mit Girard und seiner Kollegin zur Banque de Paris begleiten«, erklärte Hogart. Danach ging es ins Hotel.
»Gut, soviel ich weiß, wartet Mademoiselle Perrin von der Bank bereits dort auf sie.« Meyer-Lanski blickte auf die Armbanduhr, dann lächelte sie ihn an. »Es ist beruhigend, jemanden wie Sie beim Transport dabeizuhaben.«
Sie machte sich definitiv über ihn lustig, doch Hogart entgegnete nichts. Immerhin sparte er sich so das Taxi zum Hotel, das in der Nähe der Bank lag.
»Und zu welchem Preis wurde die Knochennadel verkauft?«, fragte Tatjana.
Meyer-Lanski sah sich um – die nächsten Touristen standen in einigen Metern Entfernung und fotografierten die Aussicht –, dann senkte sie die Stimme. »Es war spannend.«
Ganz sicher! Hogart unterdrückte ein Gähnen. Er brauchte so bald wie möglich einen starken doppelten Espresso ohne Zucker.
»Bis zuletzt, als alle anderen Interessenten schon lange abgesprungen waren, haben sich vier Händler und ein Geschäftsmann ein langes Bieterduell geliefert«, erklärte Meyer-Lanski.
»Hat sie der skandinavische Geschäftsmann schließlich ersteigert?«, fragte Hogart wie nebenbei.
Tatjana sah ihn überrascht an.
Auch Meyer-Lanski hob die Augenbrauen. »Sie sind erstaunlich gut informiert.«
»Ich habe gehört, dass er bereits im Vorfeld angekündigt hat, das Exponat um jeden Preis besitzen zu wollen«, erklärte Hogart. Tatsächlich hatte niemand etwas zuvor angekündigt – wäre ja auch schön blöd, so etwas öffentlich zu machen. In Wahrheit hatte Hogart im Flugzeug nach Paris einen Blick in Elisabeths rote Mappe geworfen, während sie neben ihm geschlafen hatte. »War das der Bieter, der live dazugeschaltet worden ist?«
»Ja, und er hat die Knochennadel tatsächlich ersteigert«, sagte sie und senkte abermals die Stimme. »Und zwar für 7,3 Millionen Euro.«
Tatjanas Mund klappte auf.
»Gratuliere.« Auch Hogart war für einen Moment baff. Deutlich mehr, als Elisabeth erwartet hatte. Das war ein fetter Deal für Medeen & Lloyd. Gewiss würde Elisabeth von ihrer Provision ein fürstliches Abendessen für sie im Restaurant auf dem Eiffelturm springen lassen.
»Ich muss los. Die Oper schließt bald für die Tagesbesucher. Ich gebe der Le Monde jetzt noch ein Kurzinterview, danach muss ich noch einige Vorbereitungen für die Saisoneröffnung treffen. War nett, Sie kennenzulernen.« Sie gab Hogart und Tatjana die Hand, dann verschwand sie durch die Schwingtür ins Pausenfoyer.
Le Monde, dachte Hogart besorgt. Wenn Meyer-Lanski in ihrer Euphorie rausrutschte, wer die Nadel ersteigert hatte, würden sämtliche Diebe ihr Einbrecherwerkzeug aus dem Keller kramen.
Eine Durchsage erklang über die Lautsprecher, woraufhin sich die Kolonnade innerhalb der nächsten Viertelstunde leerte. Nun blickte auch Hogart auf die Uhr. Mittlerweile dauerte es tatsächlich schon ziemlich lang. Die Versteigerung war seit mindestens einer halben Stunde zu Ende.
»Gehen wir zum Auktionssaal zurück«, sagte er schließlich. Tatjana folgte ihm.
Kurz vor 18 Uhr erreichten sie den Korridor. Die Kordel mit den vergoldeten Stehern war weg. Von Girard und seiner Kollegin war weit und breit keine Spur zu sehen.
Die Tür zum Saal stand offen, darin befand sich kein Mensch. Die Videowand war schwarz, und auf dem Teppichboden lag ein Flyer. Der Glassturz auf dem Versteigerungstisch war leer. Schließlich kam ein kleiner älterer Mann im grauen Anzug mit schief geknoteter Krawatte durch eine Tür aus dem Raum mit dem Tresor. Er hielt einige Dokumente in der Hand.
»Wissen Sie, wo Elisabeth Domenik ist?«, fragte Hogart, doch der Mann sah ihn nur verständnislos an. Erst als Tatjana ins Französische übersetzte, erhellten sich seine Augen und er antwortete wild gestikulierend.
»Die Versteigerung ist schon lange beendet«, erklärte Tatjana. »Elisabeth hat die Knochennadel in dem tragbaren Safe in Empfang genommen. Danach ist sie in Begleitung weggegangen.«
Weggegangen?
Wo zum Teufel sind die hin? Und warum hat sie uns nicht informiert?
4. Kapitel
Hogart rannte sofort in Richtung Haupteingang. Gefolgt von Tatjana hetzte er die breite Treppe hinunter, wobei sie sich hastig zwischen den Besuchern hindurchzwängen mussten, die allesamt zum Ausgang strömten.
Er zog sein Handy aus der Hosentasche und überprüfte es. Keine Nachricht!
»Hat Elisabeth dir geschrieben?«, keuchte er.
»Nein«, rief Tatjana.
Mist! Entweder hatte sie sich wirklich nicht gemeldet, oder es lag am miesen Empfang in diesem Gebäude.
»Glaubst du, es ist etwas passiert?«
»Nein«, log er. In Wirklichkeit sagte ihm sein Bauchgefühl schon den ganzen Abend, dass an der Sache etwas nicht stimmte – Sicherheitsvorkehrungen hin oder her! Warum zum Teufel hatte sich Elisabeth nicht bei ihm gemeldet?
Sie drängten durch das Vestibül und gingen auf die Türen zu, die ins Freie führten. Das Gemurmel der vorbeiströmenden Menschen erfüllte den Saal. Jedes Mal, wenn eine der Türen geöffnet wurde, hörte er die Lieder der Straßenmusikanten.
Hogart rief Elisabeth an. Mobilbox! Mist!
Er sah sich um. Da erkannte er Isabelle. Die hochgewachsene Dame in der schwarzen Uniform stand vor einer Tür. Erleichtert ließ Hogart die Schultern sinken. »Da ist Isabelle«, sagte er zu Tatjana und wurde langsamer. Sie gingen auf die Sicherheitsfrau zu.
»Etwas stimmt nicht«, flüsterte Tatjana.
In diesem Moment hatte Hogart es auch bemerkt. Isabelle reckte den Hals und sah sich unruhig in alle Richtungen um.
Verfluchter Mist!
Endlich erreichten sie die Frau.
»Wo ist Elisabeth?«, platzte es sofort aus Hogart heraus.
»Das ist ihr Lebensgefährte, und ich bin seine Nichte«, erklärte Tatjana auf Französisch.
»Ich weiß«, sagte Isabelle auf Deutsch, aber mit starkem französischem Akzent. Sie blickte äußerst unglücklich drein. »Ich bin rausgegangen, um den Wagen zu holen. Madame Domenik wollte inzwischen zur Garderobe gehen.«
»Allein?«
»Nein, natürlich nicht. Mit Girard.«
Hogart blickte durch die Glastür nach draußen. Vor der Treppe stand tatsächlich eine dunkle Limousine mit der Aufschrift der Pariser Oper im Halteverbot, umzingelt von vier gelb-schwarz gestreiften Kegeln.
»Warum haben Sie sich nicht auf die Suche nach den beiden gemacht?«
»Wo hätte ich sie suchen sollen? In Richtung Garderobe?« Isabelle blickte sich immer noch um. »Dann hätten sie zu einem der anderen Ausgänge an mir vorbeilaufen können. Sehen Sie sich um! Da sind so viele Leute. Hier habe ich alles besser im Blick.«
»Haben Sie Girards Nummer?«, fragte er.
»Ja, aber die nützt Ihnen in diesem Gebäude nicht viel.«
Herrgott! Verstört sah Hogart zwischen den Marmorsäulen die weiße Treppe hinauf zur Garderobe, die sich zwischen Souvenirladen und Internet-Corner befand. Überall hingen rote Kordeln, um die Touristen auf verschiedensten Wegen aus dem Gebäude zu lotsen. Langsam leerte sich die Eingangshalle. Von Elisabeth und Girard war keine Spur zu sehen.
Er ging kurz ins Freie und checkte sein Handy. Keine Nachricht! Danach betrat er wieder das Gebäude. »Warten Sie hier!«, sagte er zu Isabelle und lief los.
Tatjana folgte ihm zur Garderobe. Hinter dem Tresen saß eine Frau neben einer Schale mit Münzen. Mittlerweile hingen nur noch wenige Mäntel und Jacken auf den Kleiderbügeln. In einer Ecke lagen Rucksäcke, daneben standen Einkaufstüten.
»War Elisabeth Domenik hier?«, fragte Hogart. Die Frau sah ihn verwirrt an. Fuck! Flieg nie wieder in ein Land, dessen Sprache du nicht perfekt sprichst.
Hogart konnte Französisch zwar einigermaßen lesen und ganz gut verstehen, wenn er konzentriert zuhörte, aber fast nicht sprechen und schon gar nicht schreiben. Dazu fehlte ihm einfach die Übung.
Während Tatjana übersetzte und der Frau Elisabeths Aussehen beschrieb, erinnerte sich Hogart an die Nummer der Marke, die Elisabeth für ihre Jacke und seinen Mantel erhalten hatte.
»Treize«, sagte er.
Die Frau nickte und sagte etwas.
»Elisabeth war tatsächlich hier«, übersetzte Tatjana. »Allerdings allein.«
Allein? Und wo verdammt ist Girard?
»Außerdem hat sie ihre Jacke nicht abgeholt, sondern nur danach gefragt«, sagte Tatjana verwirrt.
»Das heißt, die Jacke muss noch da sein.« Hogart reckte den Hals und deutete zur Nummer 13, wo tatsächlich immer noch Elisabeths dünne schwarze Jacke hing. Offenbar hatte sie nur etwas daraus holen wollen. Das könnte bedeuten, dass sie und Girard noch im Haus waren.
Während die Garderobenfrau die Jacke holte, beruhigte sich Hogart wieder. Schließlich legte sie ihnen die Jacke auf den Tresen. Sogleich durchsuchte er alle Taschen innen und außen. Eigentlich hatte er erwartet, dass sie leer waren, doch in der Innentasche stieß er auf etwas Hartes, Längliches, das er herauszog.
Elisabeth hat nichts aus der Jacke geholt, sondern etwas hineingesteckt!
Hogart hielt ein schwarzes Etui in der Hand. Während nun andere Gäste zum Tresen kamen, um ihre Kleidung abzuholen, drehte sich Hogart zu Tatjana und öffnete es. Gleichzeitig starrten sie hinein.
»Meine Fresse!«, entfuhr es Tatjana.
Eingebettet in rotem Samt lag die Knochennadel.
»Ist das die echte?«, flüsterte Tatjana.
»Das weiß ich noch nicht.« Behutsam drückte Hogart auf das spitze Ende der Nadel, sodass sie aus der Vertiefung sprang. Schon wollte Tatjana danach greifen, um sie umzudrehen, doch Hogart zog das Etui weg.
»Nicht anfassen!«, zischte er.
»Waaas?«, rief Tatjana.
»Fingerabdrücke«, murmelte er und hob das Etui, sodass sie einen Blick unter die Nadel werfen konnten. Dort war die Prägung zu erkennen. »Es ist nur das Duplikat.« Er ließ die Nadel wieder in die Vertiefung fallen. Offenbar hatte Elisabeth keine Verwendung mehr für die Nachbildung gehabt und sie deshalb hier verstaut.
»Und wo ist die echte?«
»Im Safe, mit dem Elisabeth verschwunden ist.« Er schloss das Etui und steckte es in die Innentasche seines Sakkos.
»Ohne Jacke?«, fragte Tatjana.
Das war ein Argument.
Nachdem die Garderobenfrau sich noch um zwei weitere Gäste gekümmert hatte, kam sie wieder zu ihnen. Hogart schob ihr Elisabeths Jacke mit einem dankbaren Nicken hin, doch bevor sie sie wieder aufhängte, blickte sie zum Internet-Corner und sagte noch einen Satz zu Tatjana. Hogart konnte sich das meiste auch ohne Übersetzung zusammenreimen. Elisabeth war in den Internet-Corner gegangen.
Was ist nur in dich gefahren? Draußen werden alle nervös, und du setzt dich mit diesem unbezahlbaren Knochenteil in ein Internet-Café? Ohne Bescheid zu geben?
»Merci beaucoup«, bedankte sich Hogart bei der Frau und lief mit Tatjana zum Internet-Corner.
Eigenartig! Er kannte Internet-Ecken nur von Hotellobbys. Doch offenbar hatte die Oper wegen des Funklochs für ihre Besucher PCs eingerichtet, die für eine schnelle Verbindung an Glasfaserkabeln hingen.
Als sie im Corner ankamen, erblickten sie nur die etwa zwölf Computerarbeitsplätze, auf denen Bildschirmschoner mit einem Bild der Pariser Oper über die Monitore flackerten. Keine Spur, weder von Elisabeth noch von Girard! Bloß ein junger Kerl packte soeben seine Sachen zusammen. Schließlich hatte der Internet-Corner schon vor wenigen Minuten geschlossen.
Fuck!
Tatjana ging kurz zu dem Franzosen und fragte nach. »Er sitzt leider erst seit kurzem hier und hat niemanden gesehen«, übersetzte sie danach seine Antwort.
Hogarts Unterkiefer mahlte.
Was hat sie hier verdammt nochmal gewollt? Oder hat sich die Garderobenfrau geirrt, und Elisabeth ist gar nicht hier gewesen?
Hogart wollte sich bereits abwenden und wieder zu Isabelle gehen, als ihm der Monitor des letzten PCs in der hinteren Ecke neben dem Laserdrucker auffiel. Dort lief kein Bildschirmschoner, stattdessen war eine Internetseite geöffnet.
Er kniff die Augen zusammen und ging näher. Neben der Tastatur lag ein Kugelschreiber.
»Peter?«, fragte Tatjana.
»Bin gleich wieder da.«
Auf dem Monitor war nur die Standardmaske einer Suchmaschine zu sehen. Aber der Kugelschreiber hatte das Logo von Medeen & Lloyd, das er nur zu gut kannte.
Verdammt! Sie war tatsächlich hier gewesen. Er legte die Hand auf den Stuhl. Er war noch etwas warm. Und dann sah er unter dem Tisch eine Spiegelung. Elisabeths Lesebrille! Hogart kniete sich unter den Tisch. Ein langes blondes Haar hing noch am Bügel.
Das wird immer gruseliger!
Er suchte den roten Teppichboden ab, doch bis auf die Brille gab es keine weiteren Spuren. Auch nicht auf dem Tisch. Keine Blutflecken, keine anderen verräterischen Hinweise. Nichts!
Mittlerweile stand Tatjana neben ihm.
»Zuletzt ist sie hier an diesem Platz gewesen.« Hogart sah sich um. Neben dem Arbeitsplatz führte ein Gang zu den Toiletten. Vom anderen Ende fiel Tageslicht in den Gang. Außerdem hörte er Gemurmel. Anscheinend ging es dort zum Seitenpavillon. Und gerade jetzt kam ihnen von dort jemand entgegengelaufen, der kaum zu übersehen war mit seinen ein Meter neunzig, dem breiten Brustkorb und Bürstenhaarschnitt. Girard! Und zwar allein!
Hogart stand auf und richtete sein Sakko. »Wo ist Elisabeth?«, rief er.
»Sie sind Madame Domeniks Freund, richtig?«, keuchte Girard auf Deutsch mit französischem Akzent. Der Mann war ziemlich aufgebracht.
»Ja, ihr Lebensge… egal! Wo ist sie?«
»Ich weiß es nicht.«
»Was heißt, Sie wissen es nicht?«
»Madame Domenik wollte zur Garderobe und anschließend auf die Toilette, sich frisch machen.«
»Und Sie haben sie allein gelassen?«
»Nein … nur kurz. Sie sagte, ich sollte bei der Treppe auf sie warten und mich umsehen.«
»Umsehen? Das haben Sie zugelassen?«, entfuhr es Hogart.
»Sie glaubte, dass uns jemand verfolgte. Ich wollte sie nicht allein lassen, aber sie hat mir erklärt, ich soll, nachdem ich mich umgesehen habe, vor der Damentoilette auf sie warten.«
»Aber dort war sie natürlich nicht mehr!«, rief Hogart. »Sie hätten Elisabeth auf jeden Fall begleiten müssen! Mann, Sie waren dazu verpflichtet!« Aber jetzt hatte es natürlich keinen Sinn mehr, sich darüber aufzuregen.
»Und der Safe?«, fragte Tatjana.
»Den wollte ich an mich nehmen, während Madame Domenik zur Toilette ging, aber sie sagte, der unterliege ihrer Verantwortung.«
Das klang nun wirklich nach Elisabeth. Außerdem schien Girard nicht der plumpe Leibwächter zu sein, den Hogart in ihm vermutet hatte. Zumindest sprach er besser Deutsch als Hogart Französisch.
Hogart zog nochmal sein Handy heraus und drückte die Wahlwiederholungstaste. Er hatte gerade mal einen Balken. Die Verbindung wurde aufgebaut, es läutete. Einmal, zweimal … schließlich sprang erneut die Mobilbox an.
»Hier ist … Anschluss … Elisabeth Domenik«, knisterte und knackte ihre Stimme. »… Moment … leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie …«
Dann verstummte die Ansage mitten im Satz. Als hätte jemand plötzlich die SIM-Karte aus Elisabeths Handy entfernt.
5. Kapitel
Girard machte ein langes Gesicht. »Ich habe bereits mit Madame Meyer-Lanski …« Er schnippte mit den Fingern, als suchte er nach dem richtigen Wort. »… gesprochen. Sie weiß auch nicht, wo Madame Domenik ist.«
Hogart blickte in den Gang. »Wohin geht es in diese Richtung?«
»Zu den Toiletten, dahinter führt eine Tür durch den Seitenpavillon nach draußen in einen kleinen Innenhof«, erklärte Girard. »Dort ist das L’Opéra, ein Café. Aber dort ist Madame Domenik auch nicht.«
»Ist niemand nach draußen gegangen?«
»Ich habe vom Kellner erfahren, dass vor zehn Minuten eine Besucherin mit Kreislaufproblemen ins Freie gebracht worden ist.«
»Von wem?«
Girard hob die Schultern. »Angeblich vom Opernpersonal.«
»Warum angeblich?«
»Unser Personal hat nichts mit dem Bistro zu tun«, erklärte Girard.
»Das war auch niemand vom Personal«, sagte Hogart. »Ich bin sicher, die Frau mit den Kreislaufproblemen war Elisabeth.«
»Aber die Dame war schwarzhaarig, und deshalb …«
»Ja und?«, unterbrach Hogart ihn. Elisabeth ist blond. »Trotzdem glaube ich, dass sie es war.«
Girard wurde blass. Anscheinend wurde ihm soeben bewusst, was passiert war. »Sie denken, Madame Domenik wurde entführt?«
»Ohnmächtig ist sie sicher nicht geworden«, ätzte Hogart und hob sein Handy hoch. »Jedenfalls ist sie nicht mehr erreichbar.«
»Ich könnte nach diesem angeblichen Personal suchen lassen«, schlug Girard vor.
»Vergessen Sie das«, unterbrach Hogart ihn. »Die sind längst weg.« Er blickte sich um. »Gibt es hier keine Überwachungskameras?«
»Nicht im Internet-Corner«, antwortete Girard.
»Ist das Ihr Ernst?«
»Die Kameras filmen nur die Garderobe und den Souvenirladen. Was sollte man hier schon klauen?«
Computer, Tastaturen, Drucker … die Knochennadel, antwortete Hogart in Gedanken, sagte aber nichts, sondern zog die Karte mit den Notfallnummern heraus, die Elisabeth ihm gegeben hatte, und wählte eine davon.
Ein Balken genügte.
»Wen rufen Sie an?«, fragte Girard.
»Die französische Kripo.«
6. Kapitel
Bei den Beamten, die eine halbe Stunde später anrückten, handelte es sich nicht um Ermittler der Kripo, sondern um ganz gewöhnliche Polizisten. Mittlerweile befanden sich im Vestibül nur noch einige Mitarbeiter der Oper, wodurch die Vorhalle noch größer wirkte; jedes einzelne Räuspern und Schuhklappern hallte von den Wänden wider. Das Opernhaus war endgültig für Besucher geschlossen und würde erst morgen früh wieder öffnen, wenn die nächste Ladung Touristen sowie die Schauspieler, Tänzer und Sänger zu ihren Proben eintreffen würden.
Les Misérables.
Passt!, dachte Hogart. Genauso fühlte er sich.
Während Girard und Isabelle der Polizei halfen, die Oper zu durchsuchen, standen Frau Dr. Meyer-Lanski, Tatjana, er und zwei andere Polizisten im Internet-Corner und besprachen die seltsamen Vorkommnisse an diesem Abend. Ziemlich hitzig – und die Stimmung wurde immer geladener. Denn bis auf Elisabeths Lesebrille deuteten weder Spuren noch Zeugenaussagen auf eine Entführung hin. Behaupteten zumindest die ermittelnden Beamten, nachdem einige ihrer Kollegen den vorderen Bereich der Oper und das Bistro durchsucht hatten.
Noch dazu war die Frau mit dem angeblichen Kreislaufkollaps ja schwarzhaarig gewesen. Und was die zwei Angestellten der Oper anging, die sie begleitet hatten – darauf wies zumindest die Beschreibung der Uniformen hin –, so hatte vor einer halben Stunde der Schichtwechsel stattgefunden, weswegen die beiden nicht so rasch ausfindig gemacht werden konnten.
Zum Kotzen! Im Fünf-Minuten-Takt war Hogart ins Freie gelaufen und hatte Elisabeths Nummer gewählt, doch die Verbindung zu ihrem Telefon blieb unterbrochen.
Nachdem die Beamten Hogarts und Tatjanas Zeugenaussagen aufgenommen hatten, wollten sie gehen. Hogart hielt sie auf und warf Meyer-Lanski einen hilfesuchenden Blick zu. Doch sie hob nur die Schultern. »Was soll denn ich Ihrer Meinung nach unternehmen?«
»Die Knochennadel ist fort, und Elisabeth ist ohne Ihre Sicherheitsleute verschwunden«, zischte er. »Fürchten Sie keinen Skandal?«
»Wenn es einen Skandal gibt, dann für Medeen & Lloyd, sicher nicht für das Opernhaus. Wir haben das Exponat völlig korrekt in einem Safe an Frau Domenik übergeben und alles ordnungsgemäß abgewickelt – und bisher liegen der Polizei weder eine Anzeige wegen Diebstahls noch die Forderungen eines Erpressers vor. Elisabeth Domenik ist vom Fach und hat so eine Auktion nicht zum ersten Mal abgewickelt. Sie weiß, was sie tut, und Sie werden sehen, alles wird sich in Wohlgefallen auflösen.« Sie wiederholte ihre Aussage auf Französisch, und die Beamten stimmten ihr zu.
Es muss immer erst etwas passieren, damit etwas passiert.
Tatjana trat an Hogarts Seite. »Ich war eben draußen und habe mit der Hotline der Banque de Paris telefoniert und mich zu dieser Mademoiselle Perrin durchstellen lassen«, wisperte sie. »Sie wartet immer noch auf uns, bis jetzt ist Elisabeth dort nicht aufgetaucht.«
Wunderbar! Und Girards Wagen stand immer noch draußen.
»Sie müssen sie suchen!«, beharrte Hogart in seinem bruchstückhaften Französisch gegenüber den Beamten.
»Oh, non«, murmelte eine Polizistin, blätterte in ihren Unterlagen und sprach in langsamen Sätzen, die Hogart auch ohne Übersetzung verstand. Anscheinend hatte Frau Dr. Meyer-Lanski den Polizisten zuvor von der kleinen Auseinandersetzung zwischen Hogart und Elisabeth vor dem Auktionssaal erzählt und wie Elisabeth versucht hatte, Hogart zu beruhigen.
Das wird ja immer besser!
»Möglicherweise ist das Ganze ja nur ein Missverständnis«, übersetzte Tatjana ungläubig den letzten Satz der Beamtin.
»Missverständnis?«, rief Hogart und merkte, wie seine Halsschlagadern anschwollen. »Eine Person und ein Kunstgegenstand im Wert von über sieben Millionen Euro sind verschwunden!«
»Nicht so laut!«, zischte Meyer-Lanski.
Ach, darum ging es also! In wenigen Tagen würde die Saison mit einer neuen Aufführung eröffnet werden, und anscheinend hatte sie doch Angst vor schlechter Presse und einem Skandal.
»Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben«, sagte Hogart schließlich.
Tatjana übersetzte die Antwort der Frau. »Die kannst du in vierundzwanzig Stunden beim Kommissariat machen.«
»In vierundzwanzig Stunden?« Hogart war kurz davor zu explodieren. Er trat an die Polizeibeamtin heran und senkte die Stimme zu einem gefährlichen Grollen. »Ihre Methoden sind ziemlich …« Er verbiss sich den Rest des Satzes. »Morgen um diese Zeit ist Elisabeth Domenik vielleicht schon tot und die Knochennadel längst außer Landes gebracht – Tatjana, übersetz das!«
Sie schluckte und tat ihm den Gefallen, wobei sie anscheinend ein paar beschönigende Worte hinzufügte.
Die Beamtin schüttelte den Kopf und wurde nun ihrerseits ein wenig unfreundlich. Demonstrativ blickte sie auf die Uhr. »Vielleicht wollte Madame Domenik nach der Diskussion mit Ihnen einfach ein wenig Ruhe und ist ohne Sie und die Securityleute weggefahren.« Die Polizistin ließ ihren Notizblock in der Tasche verschwinden. Sie wollte sich bereits abwenden, doch Hogart hielt sie erneut auf.
»Es ist mir völlig egal, was Sie glauben, aber Elisabeth Domenik wurde entführt!«, fuhr er sie an. »Und die Knochennadel wurde gestohlen!«
»Jetzt beruhigen wir uns alle. Wenn Sie unbedingt wollen, gehen wir zuerst einmal einem möglichen Diebstahl nach.«
»Prima«, seufzte Hogart. Er dachte an Elisabeths Reisepass mit ihrem digitalen Fingerabdruck, der allerdings genauso verschwunden war wie sie selbst, ihre Handtasche und die Knochennadel. »Haben Ihre Kollegen einen tragbaren Live-Scanner im Polizeiwagen?«
Die Beamtin sah Hogart verwirrt an. »Mais oui.«
»Gut.« Hogart zog das Etui aus seiner Sakkotasche und öffnete es. »Nehmen Sie die Fingerabdrücke von dieser Stelle, und dann vergleichen Sie sie mit dieser Computertastatur.«
7. Kapitel
Als um 22 Uhr in der Pariser Oper absolute Dunkelheit herrschte, waren Hogart und Tatjana endlich in ihrem Hotel am Montmartre eingetroffen.
Das Jardin, das wohl wegen des Wintergartens mit den vielen Blumen so hieß, lag direkt am Place du Tertre, von wo man auch nachts einen tollen Ausblick auf das Künstlerviertel und die beleuchtete Sacré-Cœur hatte. Doch diese Aussicht war Hogart im Moment herzlich egal. Denn auch im Hotel war Elisabeth natürlich nicht aufgetaucht, und ihr Mietwagen befand sich nach wie vor auf dem Hotelparkplatz. Ihren Besuch in Versailles konnten sie sich abschminken, genauso wie den Rest des geplanten Urlaubs. Der erste mit Elisabeth. Und dann passiert so etwas!
Tatjana stand auf dem Balkon des Nebenzimmers, der von Hogarts eigenem nur optisch mit einer großen Topfpflanze abgetrennt war, die seine Nichte allerdings beiseitegeschoben hatte. So konnten sie gegenseitig ihre Zimmer betreten und hätten – wenn alles nach Plan gelaufen wäre – abends gemütlich beisammensitzen können.
Durch die geöffnete Balkontür hörte Hogart jetzt, wie Tatjana mit ihrem Vater telefonierte. Kurt, sein um drei Jahre jüngerer Bruder, Chiropraktiker mit eigener Praxis, hatte keine Ahnung von Polizei- und Detektivarbeit und regte sich noch dazu viel zu leicht auf. Dagegen war Tatjana ja noch ein Vollprofi in Sachen Ermittlungsarbeit, und darum hatte Hogart ihr eingeschärft, vorerst nichts über die Vorfälle zu erzählen, damit daheim niemand nervös wurde. Es genügte, wenn seine eigenen Nerven blank lagen.
»Tatjana!«, rief er nach draußen. »Sag deinem Vater, dass ich letzte Woche endlich seine Edgar-Wallace-VHS-Sammlung auf dem Flohmarkt verkauft habe.«
»Für wie viel?«, rief Tatjana ins Zimmer.
»Dreißig Euro.«
Es entstand eine lange Pause.
»Du bist ein Genie, soll ich dir von Papa ausrichten«, sagte Tatjana.
Ich weiß, dachte Hogart. Hat ja schließlich nur drei Jahre gedauert. Über eBay wäre es deutlich schneller gegangen, aber auf den digitalen Wahnsinn konnte er gern verzichten. Dann griff er zum Handy.
Nachdem er mit der österreichischen Botschaft telefoniert und einem Sekretär dort den Sachverhalt erklärt hatte, ging er zur Minibar. Er ignorierte Wein, Bier und Cognac und öffnete stattdessen eine Flasche Breezer, die er in einem Zug halb leerte. So sah also ihr nächtlicher Ausflug mit Abendessen auf dem Eiffelturm aus. Stunden zuvor hatte Hogart noch gedacht, dass Elisabeth einen fetten Deal an Land gezogen hätte. Gut, ein fetter Deal war es ja! Fragt sich nur, für wen?
Nachdem die Pariser Polizei erst morgen Abend etwas wegen ihres Verschwindens unternehmen würde und auch die österreichische Botschaft zurzeit nichts machen konnte, war er auf sich allein gestellt. Denn er würde ganz sicher nicht bis morgen warten und untätig herumsitzen. Er trank die Flasche aus, stellte sie auf den Tisch und wollte sich gerade erheben, da piepte sein Laptop, der über das Hotel-WLAN mit dem Internet verbunden war. Das Skype-Symbol blinkte auf.
Ein Video-Anruf!
Tatjana hatte ihm das Programm installiert; eines seiner wenigen Zugeständnisse an die moderne Technik, weil er es enorm hilfreich fand, seinem Gegenüber bei einem Gespräch direkt in die Augen zu sehen. Jetzt schlug sein Herz augenblicklich höher. Elisabeth? Doch die Hoffnung währte nur kurz. Der Anruf kam von Kohlschmied – Magister Kohlschmied –, dem Außendienstleiter von Medeen & Lloyd, den Hogart so gut leiden konnte wie einen dicken Pickel am Arsch.
Kohlschmied war eine kleine unscheinbare Erscheinung, und auf dem Foto seines Skype-Logos sah er genauso schleimig aus, wie er in Wirklichkeit war. Im uralten Nadelstreifanzug, den heutzutage kein Mensch mehr trug, mit viel Pomade im zum Seitenscheitel gekämmten Haar und eindeutig dem falschen Stylingberater, sonst hätte er längst seine Hornbrille gegen eine andere eingetauscht. Aber das war seine typische Masche: optisches Understatement, damit andere ihn unterschätzten. In Wahrheit war er alles andere als dumm.
Hogart nahm den Anruf an. »Ja?«
»Hogart, sind Sie es?«
»Nein, Charles de Gaulle«, knurrte er.
»Sehr witzig, Hogart. Schalten Sie die Kamera ein. Ich weiß, Sie können mich nicht leiden, aber glauben Sie mir: Ich bin auch nicht gerade begeistert, mit Ihnen reden zu müssen.«
Dann sind wir ja tatsächlich zum ersten Mal einer Meinung!
Widerwillig aktivierte Hogart seine Kamera. Nach dem Desaster vor zweieinhalb Jahren im Fall der Engelsmühle, bei dem er im Zuge seiner Recherchen Elisabeth kennengelernt hatte – der einzige positive Nebeneffekt dieser Sache –, hatte er sich geschworen, nie mehr wieder für Medeen & Lloyd zu arbeiten. Zumindest solange Kohlschmied den Außendienst leitete. Allerdings munkelte man mittlerweile, dass Kohlschmied eines Tages sogar den Direktorposten übernehmen würde.
Unbewusst fuhr sich Hogart durch den Dreitagebart, den er seit damals trug, damit man die Narben in seinem Gesicht nicht sah. »Was gibt es, Kohlschmied?«, murrte er.
»Was es gibt? Ist das Ihr verdammter Ernst?« Kohlschmieds Kopf lief rot an. Nervös drückte er die Mine seines Kugelschreibers mit einem steten Klicken rein und raus. Anscheinend saß er noch in seinem Wiener Büro in dem mächtigen Glasturm, durch dessen Front Hogart die Neonreklamen und die Straßenbeleuchtung am anderen Ufer der Donau sehen konnte. Was würde er darum geben, wenn er in diesem Moment auch in Wien sein könnte – und zwar mit Elisabeth.
Kohlschmied hatte die Hornbrille abgenommen und massierte seine Nasenwurzel. »Ich hatte soeben ein ausführliches Gespräch mit Kommerzialrat Rast.«
Rast war der Direktor der Versicherung. Hogart kannte ihn schon, seit er selbst ein kleiner Junge gewesen war. Ein zähes, altes Schlachtross und einer der besten Freunde seines verstorbenen Vaters. »Und?«, fragte er.