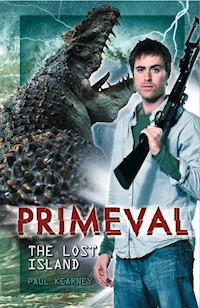4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Königreiche Gottes
- Sprache: Deutsch
Die fünf Königreiche Gottes stehen vor weitreichenden Veränderungen. Die Merduks, unter ihrem mächtigen Feldherren Shar Baraz, haben das Bollwerk im Osten, die Metropole Aekir, einfach überrannt und lagern nun vor den Toren der westlichen Welt. Gleichzeitig bläst der Orden der Brüder vom Ersten Tag zu einer Säuberungsaktion gegen alles ungläubige Zauberervolk in den fünf Königreichen Gottes. Besonders in Hebrion hat der junge König Abeleyn unter den frommen Fanatikern zu leiden. Bei der Suche nach einem Weg seine "magischen" Untertanen zu retten, stößt er auf die Pläne seines Vetters, Fürst Murad, und dessen Absichten, auf dem unerforschten westlichen Kontinent eine hebrionische Siedlung zu errichten.
Auf den beiden Schiffen des Seemannes Richard Hawkwood soll die Expedition nach den Angaben aus einem alten Logbuch einer früheren Reise gestartet werden. Doch was Murad sowohl seinem König als auch Hawkwood verschweigt: Damals reiste das Grauen mit aus den westlichen Landen. Keiner der Expeditionsteilnehmer kehrte je lebendig in die Häfen von Hebrion zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Weitere Atlantis-Titel
Paul Kearney
Die Königreiche Gottes 1
Hawkwoods Reise
Ins Deutsche übertragen von Michael Krug
Prolog
Es war ein Schiff der Toten, das sich mit der Nordwestbrise der Küste näherte. Die Marssegel waren noch gesetzt, die Rahen hingegen gebrasst für einen längst auf dem offenen Meer zurückgebliebenen Wind. Die Männer in den Jollen sichteten es als Erste, am Tage vor dem Sankt-Beynacs-Tag. Selbst in der leichten Dünung krängte es stark, und was von den Segeln noch übrig war, zitterte und flatterte, wenn die Brise aussetzte.
Es war ein strahlend blauer Tag – die See und der Himmel präsentierten sich so klar, dass sie einander wie Spiegelbilder glichen. Ein paar Möwen kreisten erwartungsvoll über den mit dem silbrig schimmernden Fang gefüllten Netzen, die von den Fischern emsig eingeholt wurden. Ein Schwarm glitzernder Thunfische schwamm Richtung Hafen davon: ein böses Omen. Dem Volksglauben nach hauste in jedem die Seele eines Ertrunkenen. Doch der Wind stand günstig und der Fang erwies sich als gut – die Schwärme waren unter dem Schiffskörper als große Schatten zu erkennen. Bisweilen blitzte die leuchtende Flanke eines sich windenden Fisches daraus hervor. Schon seit der Vormittagswache weilten die Fischer hier draußen und füllten die Netze mit den Gaben der See, derer sie sich nie gewiss sein konnten. Die dunkle Linie der hebrionischen Küste zeichnete sich verschwommen rechter Hand hinter ihnen ab.
Der Kapitän einer Jolle hielt schützend die Hand an die Stirn, verharrte und schaute hinaus auf die See; seine Augen blitzten wie blaue Edelsteine auf rauem Leder und auf dem Kinn sprossen Bartstoppeln, so weiß wie die Härchen an Nesselhalmen. Flackernd spielten die Schatten der Wellen in den Tiefen der Augenhöhlen.
»Schiff in Sicht«, brummte er.
»Was ist es, Vater?«
»Eine Karacke, Junge. Allem Anschein nach handelt es sich um ein Hochseeschiff. Aber die Segel hängen in Fetzen von den Rahen – eine Brasse ist sogar lose. Soweit ich es erkenne, muss sie wohl mindestens eine Tonne Wasser gefasst haben. Sieht ziemlich mitgenommen aus, das Schiff. Und was ist mit der Besatzung? Unfähige Landratten!«
»Vielleicht sind alle tot. Oder zu Tode erschöpft«, meinte sein Sohn aufgeregt.
»Vielleicht. Oder von der Pest befallen, die dem Hörensagen nach in den östlichen Ländern wütet – Gottes Fluch auf alle Ungläubigen.«
Als sie das vernahmen, hielten die anderen Männer auf der Jolle inne und starrten mit düsteren Mienen auf das herannahende Schiff. Der Wind drehte sich leicht – sie spürten, dass er ihnen nur noch in ein Auge blies – und der seltsame Kahn geriet vom Kurs ab. Nun trieb er mit dem Rumpf voraus; die lädierten Masten zeichneten sich schwarz gegen den ungewissen Horizont ab, der gleichsam Himmel wie Meer sein konnte. Wasser troff von den Händen der Männer. Unbeachtet zappelten die sterbenden Fische in den Netzen. Schweißtropfen sammelten sich an Nasen und brannten in Augen; überall war Salz, selbst im Wasser des eigenen Körpers. Die Männer schauten zu ihrem Kapitän.
»Das Schiff ist Bergungsgut, wenn die Besatzung tot ist«, meinte einer.
»Ein Schiff aus dem gottverlassenen Westen, ohne Anzeichen von Leben an Bord, das bringt Unheil«, murrte ein anderer. »Da draußen ist nichts außer Tausenden Wegstunden nie befahrener See und dahinter der Rand der Welt selbst.«
»An Bord könnten Überlebende sein, die Hilfe brauchen«‚ sagte der Kapitän streng. Sein Sohn schaute mit großen Augen zu ihm auf. Einen Augenblick lang ruhten die Blicke aller Männer auf seinem Gesicht. Er fühlte sie wie die Strahlen der Sonne, doch das zerfurchte Antlitz zeigte keine Regung, als er seine Entscheidung traf.
»Wir fahren rüber. Jakob, hiss die Fock! An die Brassen! Gorm, hol die Netze ein und ruf die anderen Boote an. Sie sollen bleiben. Hier sind zu große Schwärme, um sie einfach ziehen zu lassen.«
Die Besatzung machte sich an die Arbeit, teils missmutig, teils aufgeregt. Die Jolle war ein Zweimaster, der Besanmast achtern vom Ruderkopf aufgestellt. Sie mussten entgegen der landwärtigen Brise segeln, um die Karacke anzulaufen. Die Fischer auf den übrigen Booten unterbrachen das Einholen des Fangs, um zu beobachten, wie die Jolle auf ihr Ziel zusteuerte. Das größere Schiff trieb nun mit der Breitseite zur Dünung und legte sich steuerbord über, als die Wellen gegen die windwärtige Seite schlugen. Immer näher segelte die Jolle an die Karacke; die Männer ließen schwere Ruder zu Wasser und legten sich kräftig in die Riemen, während der Kapitän und einige andere reglos auf dem Schandeck warteten, bereit für den gefährlichen Sprung an die Seite der Karacke.
Mittlerweile türmte diese sich bedrohlich über ihnen auf wie ein immer näher rückender Gigant. Die Geitaue hingen lose im Wind; die Lateinerrah auf dem Besanmast glich einem bloßen Stumpf; die mächtigen Planken an der Seite waren gesplittert und geborsten, als hätte sich das Schiff durch eine enge Stelle gezwängt. Kein Lebenszeichen, keine Antwort auf das Preien des Kapitäns. Verstohlen hielten einige Männer im Rudern inne, um das Heiligenzeichen vor der Brust zu schlagen.
Der Kapitän sprang, ächzte, als er an die Seite der Karacke prallte, hievte sich über die Reling und blieb schnaufend stehen. Die anderen folgten ihm, zwei mit Dolchen zwischen den Zähnen, als erwarteten sie, sich den Weg an Bord frei kämpfen zu müssen. Dann kehrte die Jolle um. Der Maat setzte sie auf Kurs Richtung Küste, wofür er beidrehen, den Wind auf der Wetterseite halten und mit der Brise segeln musste. Der Kapitän winkte dem weggleitenden Kahn nach.
Die Karacke lag tief im Wasser. Im Vorder- und Achterschiff fing sich der Wind. Außer dem Rauschen und Branden
der See, dem Knarren des Holzes und der Takelung und dem Scheppem eines Fasses, das im Speigatt auf und ab rollte, war kein Geräusch zu vernehmen. Der Kapitän reckte den Kopf, als er den Geruch der Fäulnis witterte. Der alte Jakob schaute mit wissendem Blick zu ihm herüber. Die beiden nickten einander zu. Tod war an Bord, irgendwo verwesten Leichen.
»Der heilige Ramusio beschütze uns; lass es nicht die Pest sein«, murmelte einer der Männer heiser, was ihm einen grimmigen Blick des Kapitäns einbrachte.
»Hüte deine Zunge, Kresten. Du und Daniel, seht zu, dass ihr sie vor den Wind bekommt. Ich bin sicher, die Fugen halten der Dünung stand. Wir wollen versuchen, sie nach Abrusio zu schaffen, ehe sie das Werg ausspeit und den Bug ins Wasser senkt.«
»Du willst sie in den Hafen steuern?« fragte Jakob.
»So ich kann. Vorher aber müssen wir uns unter Deck umsehen, um sicherzugehen, dass sie nicht kurz vorm Sinken ist.« Das Rollen des Schiffes brachte ihn leicht ins Wanken. »Der Wind legt zu. Umso besser, wenn wir sie wenden können. Komm, Jakob.«
Er stieß eine der Türen im Achtersteven auf und trat in die Finsternis dahinter. Der strahlend blaue Tag draußen war wie abgeschnitten. In der plötzlichen Düsternis hörte er den barfüßigen Jakob schwer atmend hinter sich hertrotten. Der Kapitän hielt inne. Wie ein sterbendes Wesen wand sich das Schiff unter seinen Beinen; der stärker werdende Moder überlagerte sogar den Geruch von Salz, Teer und Hanf. Als seine tastenden Hände auf eine weitere Tür stießen, schluckte er heftig.
»Herr im Himmel!«, keuchte er und schob sie auf.
Grell und blendend flutete Sonnenlicht durch geborstene Heckfenster. Eine große Kabine. Ein langer Tisch. Gekreuzte, funkelnde Schwerter an einem Schott. Und auf einem Stuhl ein toter Mann mit starrem Blick.
Der Kapitän zwang sich hineinzugehen.
Die Kabine stand unter Wasser, das mit dem Schaukeln des Schiffes um ihre Füße spülte. Offenbar waren rückwärtige Wellen durch die Fenster gedrungen. Am vorderen Ende der Kabine lagen Kleidung, Waffen und Seekarten verstreut. Außerdem war da ein kleiner, metallgefasster, ziemlich verbeulter Schrank. Der tote Mann jedoch saß aufrecht auf dem Stuhl, mit dem Rücken zu den Heckfenstern. Wie Pergament spannte sich die braune Haut über den Schädel. Die Hände glichen abgezehrten Klauen. Die Ratten hatten sich an der Leiche zu schaffen gemacht. Der Stuhl war in hölzernen Schienen auf dem Deck montiert, der Mann mit durchnässtem Tauwerk an den Stuhl gebunden. Anscheinend hatte er sich selbst gefesselt, denn die Hände waren frei. Eine verrottende Faust umklammerte einen zerfledderten Bogen Papier.
»Jakob, was hat das zu bedeuten?«
»Ich weiß es nicht, Kapitän. Auf diesem Schiff war der Teufel am Werk. Dieser Mann da muss der Kapitän gewesen sein – siehst du die Seekarten? Außerdem liegt da ein zerbrochenes Winkelkreuz. Aber was ist hier geschehen? Warum hat er sich selbst angebunden?«
»Es gibt keine Erklärung dafür – noch nicht. Wir müssen hinuntergehen. Sieh nach, ob du hier irgendwo eine Laterne oder eine Kerze findest. Ich muss mir den Frachtraum ansehen.«
»Den Frachtraum?« Der alte Seebär klang zweifelnd.
»Ja, Jakob. Wir müssen nachsehen, wie schnell sie Wasser fasst und was sie geladen hat.«
Das Licht wich aus den Fenstern und das Rollen des Schiffes wurde sanfter, als die Männer an Deck es vor den Wind setzten. Jakob und sein Kapitän warfen einen letzten Blick auf den Totenschädel des verstorbenen Schiffsherrn. Danach verließen sie den Raum. Keiner teilte dem anderen mit, was er insgeheim dachte: Der tote Mann war mit schreckensverzerrtem Gesicht von dieser Welt geschieden.
Wiederum grelles Sonnenlicht, die klare Gischt des Meeres. Die anderen Männer, die mit an Bord gekommen waren, mühten sich mit Hebewerken und Brassen ab und schwenkten die für sie ungewohnt schweren Rahen. Der Kapitän brüllte ein paar Befehle. Sie würden Segeltuch und neues Tauwerk brauchen. Backbord bestanden die Wanten des Hauptmastes nur noch aus dünnen Fäden – ein Wunder, dass die Karacke den Mast nicht abgeschüttelt hatte.
»Ein Sturm kann ein Schiff unmöglich so zurichten«, meinte Jakob und fuhr mit den rauen Händen über die
Reling. Das Holz war gesplittert und wies Kerben auf. Bisse, dachte der Kapitän und fühlte, wie sich ein kalter Wurm der Angst in seinen Eingeweiden krümmte.
Unter Jakobs fragendem Blick jedoch ließ er sich nichts anmerken.
»Wir sind Seeleute, keine Philosophen. Unsere Aufgabe ist es, das Schiff zum Schwimmen zu bringen. Kommst du nun mit oder soll ich einen der Jungen fragen?«
Seit mehr als vierzig Jahren segelten sie gemeinsam die hebrionische Küste auf und ab und hatten in dieser Zeit unzählige Fische eingeholt und mehr Stürmen getrotzt, als sie sich erinnern konnten. Stumm nickte Jakob. Zorn brannte die Angst hinweg.
Die Persenninge über den Luken flatterten zerrissen im Wind. Unten, in den Eingeweiden des Schiffes, war es dunkel; vorsichtig bahnten sich die beiden Männer den Weg hinab. Einer der anderen hatte eine Laterne gefunden und angezündet. Man reichte sie hinunter in die Finsternis und das Licht offenbarte, dass Jakob und der Kapitän von Kisten, Fässern und Säcken umgeben waren. Ein muffiger Geruch hing in der Luft, abermals leichter Moder. Sie hörten das Plätschern und Gurgeln von Wasser tiefer im Bauch des Schiffes, das rollende
Poltern loser Ladung, das Ächzen des überlasteten Schiffsrumpfes. Der in großen Schiffen üblicherweise unglaublich durchdringende Gestank der Bilge wurde vom eingedrungenen Meerwasser überlagert.
Langsam schlichen sie durch einen Gang zwischen der Ladung; der Schein der Laterne warf unstete Schatten in alle Richtungen. Sie entdeckten die Überreste von halb aufgefressenen Ratten, aber keine einzige lebendige. Und kein Zeichen von der Mannschaft. Fast mochte man glauben, der Kapitän oben in der Kabine hätte das Schiff bis zu seinem Tode allein, ohne jede Hilfe gesteuert.
Eine weitere Luke, hinter der ein Niedergang hinabführte in schwärzeste Finsternis. Das Schiff ächzte und stöhnte unter ihren Füßen. Die Stimmen der Kameraden in jener anderen Welt aus salziger Luft und Gischt hörten sie mittlerweile nicht mehr. Da war nur dieses gähnende Loch ins Nichts und jenseits der hölzernen Mauern, die sie umgaben, nur die endlose See.
»Da unten ist Wasser, und gar nicht wenig«, verkündete Jakob, der die Laterne in die Luke hinabhielt. »Ich sehe es wogen, aber da ist keine Gischt. Wenn es ein Leck ist, dringt nur langsam Wasser ein.«
Die beiden Kameraden zur See hielten inne und starrten hinab an einen Ort, den keiner der beiden erkunden wollte. Doch wie der Kapitän gesagt hatte, sie waren Seeleute und niemand, der sich dem Meer verbunden fühlte, konnte untätig zusehen, wie ein Schiff starb.
Der Kapitän wollte sich an den Abstieg machen, aber Jakob hielt ihn mit einem seltsamen Lächeln zurück und ging zuerst, wobei sein Atem deutlich vernehmbar in der Kehle rasselte. Der Kapitän sah den Schein der Laterne auf das Wasser fallen und sich darin brechen. Verschiedene Dinge trieben dort unten. Dann spritzte im Spiel von Licht und Schatten etwas auf.
»Da sind Leichen.« Verzerrt, wie aus weiter Ferne, drang Jakobs Stimme herauf. »Ich glaube, ich habe die Besatzung gefunden. O gütiger Gott und alle Heiligen …«
Ein Knurren ertönte und Jakob schrie. Die Laterne verlöschte. In der plötzlichen Dunkelheit verwandelte irgendetwas das Wasser in tobende Fluten. Der Kapitän erblickte den gelben Schimmer eines Auges, gleich einem gierigen, weit entfernten Feuer in rabenschwarzer Nacht. Seine Lippen formten Jakobs Namen, doch kein Laut drang aus der Kehle; seine Zunge hatte sich in Sand verwandelt. Rückwärts stolpernd, stieß er gegen die scharfe Kante einer Kiste. Lauf!, riet ihm sein Verstand, doch das Mark der Knochen schien sich in
Granit verwandelt zu haben.
Dann stürmte das Ding über den Niedergang herauf, unmittelbar auf ihn zu. Dem Kapitän blieb nicht einmal Zeit, ein Gebet zu murmeln, bevor das Wesen sein Fleisch zerfetzte. Nur die gelben Augen wurden Zeugen, wie die Seele des Seefahrers aus dem Körper entwich.
Eins
Die Stadt Gottes brannte …
Lange Feuersäulen stiegen wie Flaggen im Wind von den Straßen auf, stieben auseinander und verloren sich in den dunklen Wolken undurchdringlichen Rauches, die über den Flammen hingen. Viele Meilen entlang des Flusses Ostian brannte die Stadt, die Gebäude stürzten ein, doch der Lärm der niederkrachenden Mauern ging im allumfassenden Brüllen des Feuers unter. Sogar das Getöse der Schlacht an den Westtoren, wo die Nachhut immer noch kämpfte, verlor sich in dem drohenden Inferno.
Die Kathedrale von Carcasson, die größte der Welt, stemmte sich unbeugsam und schwarz den Flammen entgegen: ein einsamer Wächter mit Kuppeln und Türmen. Dem massiven Granit konnte die Hitze nichts anhaben, aber das Blei schmolz in dünnen Bächen vom Dach und die Holzbalken brannten über die gesamte Länge lichterloh. Die Leichen von Priestern lagen auf den Stufen verstreut; der heilige Ramusio starrte sorgenvoll hinunter, umgeben von einer Horde rangniedrigerer Heiliger, deren Augen aufsprangen und deren Bronzestäbe sich in der Feuersbrunst verbogen. Hier und da grinste boshaft ein blutrot geränderter Wasserspeier hinab.
Der Palast des Pontifex Maximus war voller plündernder Truppen. Die Merduks hatten Wandteppiche heruntergerissen und Reliquien zertrümmert, um an die wertvollen Edelsteine heranzukommen, die diese schmückten, und tranken nun Wein aus den heiligen Pokalen, während sie darauf warteten, dass sie bei den gefangen genommenen Frauen an die Reihe kamen. Ahrimuz meinte es heute wahrlich gut mit ihnen.
Weiter im Westen der Stadt waren die Straßen verstopft von flüchtenden Menschen und den Truppen, die hier stationiert gewesen waren, um die Menschen zu beschützen. Hunderte wurden in der Panik totgetrampelt, Kinder zurückgelassen, Alte und Gebrechliche beiseitegestoßen. Mehr als einmal begrub ein einstürzendes Haus Dutzende unter einer Lawine lodernden Mauerwerks; die anderen aber verschwendeten kaum einen Blick darauf. Nach Westen drängten sie, nach Westen zu den Toren, die nach wie vor von ramusischen Truppen gehalten wurden, dem Rest der Torunnen John Mogens, einst die gefürchtetsten Soldaten der Welt. Nun stellten sie nur noch einen verzweifelten Haufen dar; alle Tapferkeit war während der Belagerung und der sechs Angriffe vor diesem letzten Sturm versiegt. Und John Mogen war tot. Gerade im Augenblick kreuzigten die Merduks seinen Leichnam über den Osttoren, wo er gefallen war und den Feind bis zum letzten Atemzug verflucht hatte.
Wie eine Schar Küchenschaben stürmten die Merduks durch die Stadt, glitzernd und um sich stechend im Schein der Flammen. Die Gesichter leuchteten, die Schwertarme waren bis zu den Ellbogen in Blut getränkt. Lange hatte die Belagerung gedauert, hart war der Kampf gewesen, doch nun gehörte die größte Stadt des Westens endlich ihnen. Shahr Baraz hatte versprochen, ihnen freie Hand zu lassen, sobald die Stadt gefallen war, und ihnen stand der Sinn nach Plünderung. Aber nicht sie brannten die Stadt nieder, sondern die im Rückzug begriffenen westlichen Truppen. Sibastion Lejer, Mogens Leutnant, hatte geschworen, dass nicht ein einziges Gebäude intakt in die Hände der Heiden fallen sollte. Er und eine Handvoll Soldaten, die noch Befehle befolgten, setzten gewissenhaft die Paläste, Waffenarsenale, Lagerhäuser, Theater und Kirchen von Aekir in Brand und töteten jeden, ob Merduk oder Ramusier, der sie aufzuhalten versuchte.
Corfe beobachtete, wie die riesigen Flammenwände zum Himmel stiegen. Der Rauch der Feuersbrunst führte ein verfrühtes Zwielicht herbei, das Ende eines langen Tages für die Verteidiger von Aekir; für viele Tausende der letzte Tag auf Erden.
Corfe stand auf einem Flachdach, abseits des Mahlstroms der kreischenden Menge unter ihm. In dichten Wellen drang das Geschrei zu ihm herauf. Angst, Zorn, Verzweiflung. Aekir selbst schien zu schreien; die gemarterte Stadt wand sich im Todeskampf, das Feuer verzehrte ihre Lebensadern. Der Rauch brannte in Corfes Augen, weshalb er sie zu reiben begann. Er fühlte, wie sich Asche, schwarzem Schnee gleich,
auf seine Brauen senkte.
Nichts erinnerte noch an den gediegenen Fähnrich; er glich mehr einer Vogelscheuche – versengt, zerlumpt, blutig. Die Halbrüstung hatte er während der Flucht von den Mauern geworfen. Er trug nur noch sein Wams und den schweren Säbel, das Markenzeichen von Mogens Männern. Corfe war klein, drahtig und hatte tiefgründige Augen. Mordlust und Verzweiflung traten abwechselnd in seinen Blick.
Irgendwo da unten befand sich seine Frau und durfte sich der Aufmerksamkeit der Merduks erfreuen. Vielleicht war sie auch in einer menschenüberfüllten Gasse totgetrampelt worden oder sie lag als verbrannte Leiche unter den Trümmern eines Hauses.
Abermals rieb er sich die Augen. Dieser verdammte Rauch.
»Aekir kann nicht fallen«, hatte Mogen ihnen gesagt. »Die Stadt ist uneinnehmbar, die Männer auf den Mauern sind die besten Soldaten der Welt. Aber das ist noch nicht alles. Aekir ist die heilige Stadt Gottes, die Heimat des heiligen Ramusio. Aekir kann nicht fallen!« Und sie alle hatten gejubelt.
Eine Viertelmillion Merduks sollten Mogens Worte Lügen strafen.
Flüchtig überlegte der Soldat in Corfe, wie viele Männer der Garnison wohl geflohen waren und noch fliehen würden. Mogens Leibgarde hatte bis zum Tode gekämpft, nachdem er gefallen war, und dann hatte die Flucht eingesetzt. Fünfunddreißigtausend Mann waren in Aekir stationiert gewesen. Konnte sich ein Zehntel davon bis nach Ormann durchschlagen, durfte man getrost von Glück reden.
»Ich kann dich nicht verlassen, Corfe. Du bist mein Leben. Mein Platz ist hier«, hatte sie mit dem ihr eigenen, herzzerreißenden, schiefen Lächeln auf den Lippen gesagt. Die rabenschwarzen Locken hatten ihr tief in der Stirn gehangen. Und er, dummer Narr, der er war, hatte auf sie gehört – und auf John Mogen.
Es erwies sich als unmöglich, sie zu finden. Wie es das Schicksal wollte, befand sich ihr Haus im Schatten der östlichen Bastion, die als erste gefallen war. Dreimal hatte er versucht, dorthin durchzudringen, bevor er es schließlich aufgab. Dort war niemand mehr am Leben, der nicht Ahrimuz huldigte, und die überlebenden Frauen wurden bereits zusammengetrieben. Zofen von Ahrimuz sollten sie werden, Gefangene in den Feldbordellen der Merduks.
Verfluchte blöde Schlampe! Hunderte Male hatte er ihr gesagt, sie solle verschwinden, bevor die Belagerungslinien die Stadt von der Außenwelt abschnitten.
Er blickte nach Westen. Wie träges Blut in den Arterien eines gefallenen Riesen strömten die Menschenmassen dorthin. Den Gerüchten nach war die Straße nach Ormann noch den ganzen Weg bis zum Fluss Searil offen, wo die Torunnen die zweite befestigte Linie in zwanzig Jahren errichtet hatten. Die Merduks, so erzählte man, hatten diesen schmalen Weg absichtlich offen gelassen, um die Garnison zu verleiten, die Bevölkerung zu evakuieren, die dann die Straße zwanzig Wegstunden weit verstopfen würde. Corfe hatte das schon früher erlebt, in den zahlreichen Schlachten, die er geschlagen hatte, seit die Merduks zum ersten Mal die Jafrar-Berge überquerten.
War sie tot? Niemals würde er es erfahren. O Heria!
Sein Schwertarm schmerzte. Nie zuvor war er in ein solches Gemetzel verstrickt gewesen. Er hatte das Gefühl, seit ewigen Zeiten zu kämpfen, dabei hatte die Belagerung lediglich drei Monate gedauert. Es war alles andere als eine Belagerung aus dem Militärhandbuch gewesen. Die Merduks hatten Aekir vom Rest der Welt abgeschnitten. Daraufhin begannen sie, die Stadt in Grund und Boden zu stampfen. Sie versuchten nicht einmal, die Bevölkerung bis zur Kapitulation auszuhungern. Stattdessen griffen sie immer und immer wieder mit rücksichtsloser Selbstvergessenheit an, wobei sie für jeden gefallenen Verteidiger fünf bis sechs Mann verloren – bis heute Morgen der endgültige Angriff erfolgte. Ein grausames Gemetzel fand auf den Mauern statt, ein hin und her wogendes Blutbad, bis der kritische Augenblick erreicht war, das Fass überlief und die Torunnen einer nach dem anderen von den Schutzwällen flohen, auf denen die verheerende Niederlage sich deutlich abzeichnete. Der alte John hatte ihnen nachgebrüllt, bevor das Krummschwert eines Merduks auf ihn herabsauste. Danach setzte ein panikähnlicher Zustand ein. Niemand dachte an eine zweite Linie, an einen Rückzug unter Kampf. Die entsetzliche Anspannung während der Belagerung, die zahlreichen Angriffe – all das hatte die Soldaten ausgezehrt, sie brüchig wie die Klinge eines rostzerfressenen Schwertes gemacht. Die Erinnerung daran beschämte Corfe. Aekirs Mauern waren nicht eingenommen, sondern von den Verteidigern aufgegeben worden.
Hatte er etwa deshalb innegehalten? Stand er deshalb nun hier wie der Beobachter einer Apokalypse? Vielleicht um für die Flucht zu sühnen?
Oder um darin umzukommen. Meine Frau: Irgendwo da unten ist sie, lebendig oder tot.
Grollender Donner erhob sich und Detonationen erschütterten die rauchschwangere Luft. Prasselndes Hakenbüchsenfeuer. Irgendwo wurde noch Widerstand geleistet. Sollten sie. Es war an der Zeit, die Stadt hinter sich zu lassen – und mit ihr all jene, die er hier geliebt hatte. Die Narren, die jetzt noch weiterkämpften, würden als Leichen in der Gosse enden.
Corfe begann den Abstieg vom Dach, wobei er sich wütend die Augen rieb. Wie ein Blinder mit Stock ertastete er sich mit dem Säbel den Weg die Treppe hinab.
Als er die Straße erreichte, empfing ihn erstickende Hitze; die beißende Luft schmerzte in der Kehle. Das raue Geschrei der Menge schlug ihm wie eine Wand entgegen; dann geriet er mitten hinein in die Welle der Flüchtenden und wurde hinfortgetragen wie ein Schwimmer in einem reißenden Strom. Es stank nach Furcht und Asche, die Gesichter wirkten im höllengleichen Licht kaum noch menschlich. Corfe erblickte bewusstlose Männer und Frauen, die einzig das dichte Gedränge der Masse aufrecht hielt, und kleine Kinder, die über aneinandergepresste Köpfe krabbelten wie über einen Teppich. An den Straßenrändern wurden Menschen zerquetscht, als die treibende Flut sie über die angrenzenden Wände schleifte. Während Corfe weitergestoßen wurde, spürte er unter den Füßen die Körper anderer Menschen. Sein Absatz glitt über das Gesicht eines Kindes. Der Säbel ging verloren, entglitt im Gewimmel seiner Hand. Er reckte das Gesicht hoch zum rauchverhangenen Himmel und den lodernden Gebäuden, erkämpfte sich ein paar Atemzüge der stinkenden Luft.
Grundgütiger, dachte er, ich bin in der Hölle!
Aurungzeb der Goldene, dritter Sultan von Ostrabar, vertrieb sich die Zeit mit den drallen Brüsten seiner neuesten Konkubine, als ein Eunuch durch die Vorhänge am Ende des Raumes watschelte und sich tief verbeugte, sodass sein kahler Schädel im Schein der Lampen glänzte.
»Hoheit.«
Aurungzebs schwarze Augen blitzten, sein Blick durchbohrte den unverschämten Eindringling, der gebeugt und zitternd verharrte.
»Was gibt es?«
»Ein Bote, Hoheit, von Shahr Baraz vor Aekir. Er sagt, er habe Neuigkeiten von der Armee, die nicht warten können.«
»Tatsächlich?« Aurungzeb sprang auf und stieß seine schmollende Gespielin beiseite. »Willst du damit andeuten, dass jeder haarlose Eunuch und gemeine Soldat im Palast jederzeit über mich verfügen kann?« Er trat den Eunuchen, dass dieser der Länge nach hinfiel. Der Sklave zuckte, doch er blieb still.
Aurungzeb überlegte. »Von der Armee, sagst du? Sind es gute oder schlechte Nachrichten? Ist der Belagerungsring durchbrochen? Hat dieser Hund Mogen meine Truppen in die Flucht geschlagen?«
Der Eunuch stemmte sich mühevoll auf Hände und Knie und keuchte auf den in herrlichen Tönen gefärbten Teppich hinab. »Er wollte mir nichts verraten, Hoheit. Nur Euch persönlich will er die Neuigkeiten berichten. Ich habe ihm gesagt, dass dies ganz und gar nicht den Gepflogenheiten entspricht, aber …« Ein weiterer Tritt brachte ihn zum Schweigen.
»Schick ihn herein. Bringt er schlechte Neuigkeiten, mache ich ihn auch zu einem Eunuchen.«
Auf ein Kopfnicken hin tippelte die Konkubine rasch in die Ecke. Aus einem juwelenbesetzten Schrank holte der Sultan einen schlichten Dolch mit abgegriffenem Heft. Zwar wirkte er schon ziemlich abgenutzt, dennoch wurde er wie etwas überaus Wertvolles verwahrt. Aurungzeb steckte ihn in die Hüftschärpe, dann klatschte er in die Hände.
Der Bote war ein Kolchuk, eine Rasse, die von den Merduks schon vor langer Zeit auf dem Vormarsch in den Westen unterworfen worden war. Die Kolchuken aßen Rentier und hatten Verkehr mit ihren Schwestern. Nichtsdestoweniger stand dieser Mann aufrecht vor Aurungzeb, ungeachtet der gezischten Ratschläge des Eunuchen. Irgendwie hatte sich der Soldat am Wesir und am Kammerherrn des Harems vorbeigeschlichen, um so weit zu kommen. Es musste sich um wahrhaft bedeutende Neuigkeiten handeln. Dennoch – brachte er schlechte Kunde, so wollte Aurungzeb ihn um einen Kopf kürzer machen.
»Nun?«
Der Mann besaß die unergründlichen Augen der Kolchuken: dunkle Steine hinter Schlitzen in einem ausdruckslosen Gesicht. Aber er verfügte über eine gewisse Ausstrahlung, obwohl er leicht wankend dastand. Er roch nach Staub und Pferdefell und Aurungzeb bemerkte mit Interesse, dass getrocknetes Blut die Bauchgegend der Rüstung verdunkelte.
Nun sank der Mann auf ein Knie. Das strahlende Antlitz jedoch blickte unbeirrt auf.
»Die Hochachtung des Shahr Baraz, Oberbefehlshaber der Zweiten Armee von Ostrabar, Hoheit. Er erlaubt sich zu berichten, so Eure Exzellenz gestatten, dass er Aekir, die Stadt der Ungläubigen, eingenommen hat und sie im Augenblick vom letzten Rest der westlichen Horden reinigt. Die Armee steht zu Eurer Verfügung.«
Aekir ist gefallen!
Mit zwei säbelschwingenden Wachen im Gefolge stürzte der Wesir herein. Er brüllte etwas und sie packten den knienden Kolchuk an den Schultern. Doch Aurungzeb hob die Hand.
»Aekir ist gefallen?«
Der Kolchuk nickte und für eine Sekunde lächelten der unergründliche Soldat und der in Seide gekleidete Sultan einander an, zwei Männer, die einen Triumph teilten, den nur sie zu schätzen wussten. Dann verzog Aurungzeb die Lippen. Es wäre nicht angebracht, den Mann jetzt weiter zu befragen. Das sähe nach Ungeduld, ja Würdelosigkeit aus.
»Akran«, fuhr er den grimmig blickenden, verunsicherten Wesir an. »Gib diesem Mann ein Gemach im Palast. Sorg dafür, dass er zu essen bekommt, gebadet wird und ihm alle Wünsche erfüllt werden.«
»Aber Hoheit, ein gemeiner Soldat …«
»Gehorche, Akran! Dieser gemeine Soldat hätte ein Mörder sein können, aber du hast ihn an dir vorbei in den Harem gelassen. Wäre Serrim nicht gewesen« – der Eunuch lief rot an und lächelte albern –, »ich wäre völlig überrascht worden. Ich war der Meinung, mein Vater hätte dich eines Besseren belehrt, Akran.«
Der Wesir wirkte gebrochen und alt. Unsicher und angesteckt von seiner Schuld, traten die Wachen von einem Fuß auf den anderen.
»Geht jetzt, und zwar alle. Nein, halt! Wie ist dein Name, Soldat? Wie heißt du und unter wem dienst du?«
Der Kolchuk, nun wieder unnahbar, blickte ihn an. »Ich bin Harafeng, Hoheit. Ich gehöre zur Leibgarde des Shahr.«
Aurungzeb zog eine Augenbraue hoch. »Nun denn, Harafeng, wenn du gegessen und gebadet hast, bringt dich der Wesir wieder zu mir, damit wir uns über den Untergang Aekirs unterhalten können. Ihr habt meine Erlaubnis zu gehen, ihr alle.«
Der Kolchuk nickte flüchtig, was ein empörtes Prusten von Akran zur Folge hatte. Aurungzeb jedoch lächelte. Sobald er allein im Raum war, verwandelte sich das Lächeln in ein breites Grinsen, das den Bart teilte, und man erkannte den General in ihm, der er in seiner Jugend für kurze Zeit gewesen war.
Aekir ist gefallen!
Ostrabar stellte das drittmächtigste der Sieben Sultanate dar, nach Hardukh und dem antiken Nalbeni, doch diese heroische Kriegsleistung, dieser glorreiche Triumph, würde Ostrabar – mit Aurungzeb an der Spitze – an die erste Stelle der Sultanate der Merduks katapultieren. Noch in Jahrhunderten würde man von dem Sultan sprechen, der die heiligste und bevölkerungsreichste Stadt der Ramusier eingenommen und die Armee von John Mogen in die Knie gezwungen hatte.
Nun lag der Weg nach Torunn selbst frei; nur noch die feindlichen Linien am Searil und die Festung der Senke von Ormann galt es zu überwinden. Waren diese beiden Hürden erst genommen, gab es keine Verteidigungslinie mehr bis zu den Bergen von Cimbric, vierhundert Meilen weiter westlich.
»Gepriesen seist du, Ahrimuz!« flüsterte der Sultan, dann rief er scharf: »Gheg!«
Hinter einem der bestickten Vorhänge schlich ein Homunkulus hervor, setzte die ledrigen Flügel in Bewegung und ließ sich auf einem nahen Tisch nieder.
»Gheg«, krächzte er mit dünner, brüchiger Stimme und verschlagener Boshaftigkeit im Gesicht.
»Ich wünsche mit deinem Meister zu sprechen. Ruf ihn für mich.«
»Gheg hungrig!«, brummte die Kreatur missmutig.
Aurungzebs Nasenflügel bebten. »Du bist erst letzte Nacht gefüttert worden, mit einem Säugling, wie er zarter nicht sein könnte. Hol mir sofort deinen Herrn, du Ausgeburt der Hölle!«
Der Homunkulus warf dem Sultan einen grimmigen Blick zu, dann zuckte er die schmalen Schultern. »Gheg müde. Kopf tut weh.«
»Tu gefälligst, was ich dir sage, oder ich lasse dich braten wie eine Wachtel.«
Der Homunkulus lächelte – ein grauenhafter Anblick. Dann trat ein anderes Licht in die funkelnden Augen. Mit tiefer, menschlicher Stimme verkündete er: »Hier bin ich, Sultan.«
»Dein Tierchen verhält sich in letzter Zeit etwas aufsässig, Orkh. Einer der Gründe, weshalb ich es in letzter Zeit so selten benutze.«
»Verzeiht, Hoheit. Der Homunkulus wird langsam alt. Ich muss ihn wohl bald ins Fass verbannen und Euch einen neuen schicken~… Was ist Euer Begehr?«
»Wo bist du?« Es war seltsam, ein so großes, haariges Geschöpf derart gestelzt sprechen zu hören.
»Das spielt keine Rolle. Ich bin nah genug. Wolltet Ihr mich um eine Gunst bitten?«
Aurungzeb kämpfte merklich um Selbstbeherrschung.
»Du sollst für mich nach Süden blicken, nach Aekir. Erzähl mir, was dort vor sich geht. Ich habe Neuigkeiten erhalten, die ich bestätigt wissen will.«
»Selbstverständlich.« Eine Pause. »Ich sehe Carcasson in Flammen. Ich sehe Belagerungstürme entlang der inneren Mauern. Ein gewaltiges Feuer, kreischende Ramusier. Ich gratuliere Euch, Hoheit. Eure Truppen ziehen mordend durch die Stadt.«
»Shahr Baraz. Was ist mit ihm?«
Wieder eine Pause. Als die Stimme erneut ertönte, schwang ein wenig Überraschung darin mit.
»Er betrachtet den gekreuzigten Leib John Mogens. Er weint, Sultan. Inmitten des Sieges weint er.«
»Er gehört noch zum alten Hraib. Der romantische Narr trauert um seinen Feind. Die Stadt brennt, sagst du?«
»Ja. Die Straßen wimmeln von Ungläubigen, die im Rückzug die Stadt in Brand stecken.«
»Das muß Lejer sein, dieser niederträchtige Hund. Er wird uns nur Asche überlassen. Ein Fluch auf ihn und seine Kinder. Wenn er gefasst wird, lasse ich ihn kreuzigen. Ist die Straße nach Ormann offen?«
Dicke Schweißtropfen glänzten mittlerweile auf dem Homunkulus. Er zitterte, die Flügelspitzen krümmten sich.
Die Stimme jedoch blieb unverändert.
»Ja‚ Hoheit. Sie ist völlig verstopft von Karren und Menschen, eine wahre Völkerwanderung. Das Haus Ostrabar hat die Oberherrschaft.«
Noch vor achtzig Jahren hatte das Haus Ostrabar nur aus Aurungzebs Großvater und drei stämmigen Konkubinen bestanden. Militärische Führungsqualitäten, nicht Abstammung führten sein Geschlecht aus den Steppen im Osten ins Zentrum der Macht. Und konnten die Ostrabars ihre Schlachten nicht selbst gewinnen, so heuerten sie jemanden an, der es konnte. Daher stand Shahr Baraz in ihren Diensten, der schon unter Aurungzeb selbst mit sicherer Hand Truppen geführt hatte, doch vermochte er sie nicht in gleicher Weise zu motivieren. Dies stellte ein Unvermögen dar, über das er sich nach wie vor ärgerte. Shahr Baraz, ursprünglich ein Außenseiter, ein Nomadenführer aus dem fernen Kambaksk, hatte drei Generationen Ostrabars treu und kompetent gedient. Nun war er über achtzig Jahre alt, ein grausamer alter Mann, überaus angetan von Gebeten und Lyrik. Es war gut, dass Aekir jetzt gefallen war. Shahr Baraz’ langes Leben neigte sich dem Ende
zu. Damit würde auch die letzte Verbindung zwischen den Sultanen und den pferdeverliebten Häuptlingen der Steppen abbrechen, aus denen Erstere hervorgegangen waren.
Shahr Baraz hatte empfohlen, die Straße nach Ormann offen zu lassen. Der Ansturm der Flüchtlinge sollte die Männer der Verteidigungslinie am Searil schwächen und demoralisieren, meinte er. Aurungzeb fragte sich, ob nicht auch altmodische Ritterlichkeit bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hatte.
»Sag dem …«, setzte er an und verstummte. Der Homunkulus schmolz vor seinen Augen. Vorwurfsvoll starrte das Wesen den Sultan an, während es sich in eine übel riechende Pfütze verwandelte.
»Orkh! Sag dem Khediven, er soll zum Searil weitermarschieren!«
Der Mund des Homunkulus öffnete sich, doch kein Laut drang heraus. Dampfend und modernd löste sich das Wesen auf. In der ekelerregenden Lache, zu der es zerfloss, waren der halb verdaute Fötus eines Kindes, die Flügelknochen eines Vogels und der Schwanz einer Eidechse zu erkennen. Würgend klatschte Aurungzeb in die Hände, um die Eunuchen herbeizurufen. Ghegs Zeit war abgelaufen, aber zweifellos würde Orkh ihm bald eine neue Kreatur schicken. Er hatte noch andere Boten – vielleicht nicht ganz so schnelle, aber ebenso zuverlässige.
Aekir ist gefallen!
Der Sultan begann zu lachen.
Zwei
»Gütiger Gott!« rief Hawkwood. »Was ist denn hier los?«
»Starker Seegang!«, brüllte der Bootsmann mit Blick auf ein im Wind flatterndes Segel. »Brasst das Fockmarssegel, ihr gottverdammten Eunuchen! Was glaubt ihr eigentlich, wo ihr seid? Auf einer billigen Vergnügungsfahrt?«
Die Gnade Gottes, eine voll getakelte Karavelle, glitt um sechs Glas in der Vormittagswache sanft in den Hafen von Abrusio. Das ruhige, blau schimmernde Wasser an den Flanken des Schiffes war durchsetzt vom Dreck des Hafens. Wo die Sonne auf das Meer schien, entstand ein weißes Glitzern, das schmerzlich anzusehen war. Eine Brise aus Nordwest – der hebrionische Passat – ließ die Gnade Gottes wie einen Schwan übers Wasser gleiten. Die auf den Hafen starrende Besatzung musste trotz der Schimpfkanonade des Bootsmannes kaum Hand an die Seile legen.
Abrusio. Schon seit zwei Glas konnte man die Glocken der Kathedrale vernehmen, ein gespenstisches Echo der Frömmigkeit, das auf die See hinaushallte.
Abrusio, Hauptstadt von Hebrion und größter Hafen der Fünf Königreiche. Es bot einen wundervollen Anblick, selbst wenn man nur von einer kurzen Reise entlang der Küste zurückkehrte wie die Mannschaft der Gnade Gottes. Eine unangenehme Kreuzfahrt war es gewesen, entlang der Küste von Macassar, während der sie mit den Freibeutern um Wegezölle gefeilscht hatten, ständig mit der Hand am Dolch und brennenden Lunten an den Kulverinen. Dennoch erwies es sich als einträgliche Fahrt; trotz der Hitze, der Fliegen, des in den
Fugen schmelzenden Pechs und dieser plündernden Flussratten. Trotz der nächtlichen Festtrommeln entlang der mit Signalfeuern übersäten Küste und den mit Lateinersegeln getakelten Feluken voller grinsender Korsaren. Drei Tonnen Elfenbein aus den Skeletten großer Marmorills lagen gut verstaut im Frachtraum, außerdem Hunderte Kilogramm wohlriechender Gewürze aus Limia. Und nur einen Mann hatten sie verloren, einen tollpatschigen Neuling, der sich auf seiner ersten Reise zu weit über die Reling beugte, als gerade ein Hai
vorbeischwamm.
Nun kehrten sie zurück in die Königreiche Gottes, wo die Menschen ihr Essen mit dem Heiligenzeichen segneten und wo das Bildnis des Ramusio auf jede Straßenkreuzung und jeden Marktplatz herabblickte.
Für nahezu die Hälfte der Besatzung war Abrusio der Heimathafen, darüber hinaus befand sich hier die Werft, in der vor dreißig Jahren der Kiel der Gnade Gottes gezimmert worden war. Zwei Dinge sprangen einem seewärtigen Beobachter von Abrusio ins Auge: der Wald und der Berg.
Der Wald erstreckte sich über die spiegelglatte Bucht am Fuße der Stadt, ein unüberschaubares Durcheinander von Masten, Spieren und Rahen, die den Ästen blätterloser Bäume glichen, eine perfekte Geometrie zeichneten und mit unzähligen Seilen vertäut waren. Schiffe jeder Nationalität, Tonnage, Takelung, Besatzung und Berufung lagen in der Bucht von Abrusio zu Hunderten vor Anker; von Küstenhoyen und -jollen, deren Decks mit Netzen und Fischen überhäuft waren, bis zu Hochseekaracken mit stolzen Wimpeln. Auch die Seestreitkräfte von Hebrion hatten hier den Ankerplatz, daher fand man auch jede Menge riesiger Kriegskaracken, -galeeren und -galeassen‚ auf deren Achterdecks und Heckaufbauten Rüstungen und Helme in der Sonne funkelten; an den Großmasten flatterten träge die schweren königlichen Standarten, an den Besanmasten die der Admiräle.
Zwei weitere Dinge waren charakteristisch für diesen schwirrenden Wald und die vom Wasser geprägte Stadt: der Lärm und der Gestank. Hoyen luden ihre Fänge ab; Kaufleute standen an den Kais bei den offenen Luken, während Arbeiter sich an Zugwinden abmühten, um das Lebensblut des Handels aus den Bäuchen der Schiffe zu bergen: Wolle aus Almark, Bernstein aus Forlassen, Felle aus Fimbrien, Eisen aus Astarak, Holz aus den riesigen Wäldern von Gabrion, das beste Holz der Welt für den Schiffsbau. Von den Männern, die im Hafen an den vor Anker liegenden Schiffen und an den unzähligen Fuhrwerken auf den Kais arbeiteten, ging ein rhythmisches Gemurmel aus. Dazu mischten sich das Klappern und Kreischen von Karren, das Knirschen von Holz und Hanf. All das, die Essenz eines Hafens voller Leben, hallte eine halbe Meile hinaus auf die See.
Und es stank. An einem so windstillen Tag driftete der Gestank weit hinaus aufs Meer; der Gestank Zehntausender ungewaschener Menschen; der Gestank von Fischen, die im prallen Sonnenschein verrotteten; der Gestank von Abfall, der ins Wasser geschüttet wurde und um den sich ganze Horden von Möwen stritten; der Gestank von Pech aus den Schiffswerften, von Ammoniak aus den Gerbereien. Und über all dem der Hauch fremder Länder, eine betörende Mischung aus Gewürzen und frischem Holz, salziger Luft und Seegras: das Elixier des Meeres.
Das war die Bucht. Doch auch der Berg war nicht, was er zu sein schien. Aus der Ferne wirkte er wie ein mit blauem Rauch verhangenes Gemisch aus staub- und ockerfarbenem Gestein in Pyramidenform. Näher an der Küste erkannten ankommende Seeleute, dass sich aus der von Menschen wimmelnden Bucht ein Hügel erhob, auf dem sich Reihe um Reihe die aus engen, überfüllten Straßen bestehende Stadt hinaufwand. Die Wände der Häuser waren weiß getüncht und mit dicken Staubschichten belegt, die Dächer bedeckt mit ausgebleichtem roten Ton aus den Ziegelwerken in Feramuno. Hier und da ragten zwischen den bescheideneren Behausungen erhabene Kirchen empor, deren Türme wie Speere in den blauen, wolkenlosen Himmel wiesen. Und gelegentlich stach das massive Steinhaus eines wohlhabenden Händlers aus der Masse hervor – denn Abrusio war ebenso die Stadt der Händler wie die der Seeleute. Tatsächlich herrschte mancherorts die Meinung vor, einem Hebrionen werde eine von drei Berufungen schon in die Wiege gelegt: Seemann, Händler oder Mönch.
In Nähe der Kuppe des sanften Hügels befanden sich die Zitadelle und der Palast des Königs, Abeleyn IV., seines Zeichens Monarch der Reiche Hebrion und Imerdon, Admiral von über fünfhundert Schiffen. Die Bauwerke ließen den Hügel höher erscheinen, als er eigentlich war, und verliehen ihm das Aussehen eines steilhangigen Berges.
Die dunklen Granitmauern der Festung waren vor vier Jahrhunderten von fimbrischen Architekten errichtet worden. Über den hohen Wällen konnte man die höchsten der Zypressen des Königs erblicken, der Juwelen seiner Lustgärten. (Dem Gerede nach diente ein Fünftel des gesamten Wasserverbrauchs der Stadt allein dafür, diese Gärten grün zu halten.) Gepflanzt hatten die Vorväter des Königs sie, damals, als Hebrion sich vom Joch der zerfallenden fimbrischen Macht befreite. Nun flimmerten sie in der entsetzlichen Hitze, auch der Palast flackerte wie ein Trugbild in der Wüste Calmari.
Neben dem königlichen Palast und den Lustgärten schimmerte das Ordenskloster der Brüder vom Ersten Tage. Der Name rührte daher, dass der Orden als erster gegründet wurde, nachdem die Visionen des heiligen Ramusio Licht in das Dunkel des heidnischen Westens gebracht hatten. (Mancherorts ging der Volksglaube sogar so weit, dass Ramusio selbst den Orden gegründet hätte.) Seither galten die Brüder von Ersten Tage als die religiösen Wächter der ramusischen Königreiche.
Palast und Kloster blickten Seite an Seite hinunter auf die menschenüberfüllte, stinkende, vibrierende Stadt Abrusio. Eine Viertelmillion Seelen, die Einwohner des größten Hafens der bekannten Welt, plagten sich am Fuße des Hügels feilschend und schwelgerisch durchs Leben. »Gütiger Gott!«, hatte Richard Hawkwood ausgerufen. »Was ist denn hier los?«
Er hatte allen Grund zur Verwunderung, denn über Abrusio hing schwarzer Rauch in der klaren Luft und ein grauenhafter Gestank trieb über den geschäftigen Hafen zu seinem Schiff heraus. Verbranntes Fleisch. An den Galgen der Brüder vom Ersten Tage hingen dürre Gestalten; bis weit hinaus auf die See reichte der übel riechende Gestank versengten Fleisches, ranziger und schmutziger als der fauligste Moder einer Kloake.
»Sie verbannen Ketzer auf den Scheiterhaufen«, meinte der Bootsmann angewidert und kleinlaut. »Die Raben Gottes sind wieder am Werk. Die Heiligen mögen uns beistehen!«
Der alte Julius, der Erste Maat, ein Mann aus dem Osten mit pechschwarzem Gesicht, starrte seinen Kapitän mit weit aufgerissenen Augen an, Sein dunkelhäutiges Antlitz war beinahe grau. Dann beugte er sich über die Reling und rief ein nahes Proviantboot an, das bis zur Gilling voll mit Früchten war und von einem großen, hässlichen Kerl gesteuert wurde, dem ein Auge fehlte. »Ho! Was liegt da in der Luft, Freund? Wir kommen von einer monatelangen Fahrt aus den Königreichen der Freibeuter zurück und lechzen nach Neuigkeiten.«
»Was in der Luft liegt? Könnt ihr den Gestank nicht riechen? Seit vier Tagen hängt er über dem guten alten Abrusio. Wie es scheint, sind wir zu einem Hafen von Hexern und Ungläubigen geworden, die allesamt im Dienst der Sultanate stehen. Die Raben Gottes befreien uns in ihrer Güte von ihnen.« Über das Schandeck spuckte er ins Wasser, das zunehmend dicker vom Müll des Hafens wurde. »Und mit einem so dunklen Gesicht würde ich aufpassen, wohin ich gehe, Freund. Aber halt – einen Monat wart ihr auf See, sagst du? Habt ihr die Nachricht aus dem Osten schon gehört? Bei allen Heiligen, das müsst ihr doch wissen?«
»Was wissen, Kumpel?«, brüllte Julius ungeduldig hinüber.
Das Proviantboot fiel immer weiter zurück. Schon lag es eine halbe Trossenlänge achtern Backbord. Der Einäugige drehte sich um und rief: »Wir sind verloren, Freunde! Aekir ist gefallen!«
Der Hafenmeister erwartete sie, während einer der Schleppkähne von Abrusio, dessen Besatzung sich tüchtig in die Riemen legte, die Gnade Gottes in einen freien Anlegeplatz zog.
Der Wind war völlig abgeflaut und die sengende Hitze verharrte unbarmherzig glühend über dem Labyrinth aus Schiffen, Menschen und Docks, drückte auf die Gemüter und lockerte Tauwerk. Und über all dem hing der ekelerregende Gestank der Scheiterhaufen in der Luft.
Sobald die Dockarbeiter das Schiff achtern und vorne an den Pollern vertäut hatten, ergriff Hawkwood seine Papiere und ging als Erster an Land. Als er, noch ans Meer gewöhnt, den festen Kaiboden berührte, taumelte er leicht. Julius und Velasca, der Bootsmann, würden sich darum kümmern, dass die Ladung ordnungsgemäß gelöscht wurde. Die Männer würden die Heuer ausbezahlt bekommen und sich zweifellos in die Stadt begeben, auf der Suche nach den Vergnügungen eines Seemannes, wenngleich sie heute Nacht wohl wenig Vergnügen finden würden, dachte Hawkwood bei sich. Zwar schien das Leben der Stadt fast den üblichen hektischen Gang zu nehmen, doch alles wirkte irgendwie gedämpft. Der Kapitän erblickte missmutige Mienen, sogar offene Furcht auf den Gesichtern der Dockarbeiter, die bereitstanden, um beim Löschen der Ladung zu helfen; und sie betrachteten misstrauisch die Besatzung der Gnade Gottes, die mindestens zur Hälfte aus Fremden bestand, Seefahrern aus den verschiedensten Häfen. Hawkwood fühlte, wie ihn die Hitze, das rege Treiben und die Beklommenheit, die über allem lag, in düstere Stimmung versetzten, was seltsam anmutete, denn noch vor wenigen Stunden hatte er dem Ende der Reise mit Freude entgegengesehen. Er schüttelte Galliardo Ponera die Hand, dem Hafenmeister, den er gut kannte. Auf dem Weg zu den Hafenämtern verfielen die beiden in Gleichschritt.
»Ricardo«, begann der Hafenmeister hastig, »ich muss dir erzählen …«
»Ich weiß, großer Gott, ich weiß! Aekir ist letztlich doch gefallen und die Raben suchen nach Sündenböcken. Daher der Gestank.« Manchmal nannte man den grässlichen Gestank, der das Ende von Ketzern verhieß, den »Weihrauch der Brüder vom Ersten Tage«.
»Nein, das meine ich nicht. Es geht um die Anordnungen des Prälaten. Ich konnte nichts dagegen tun – nicht einmal der König kann etwas dagegen tun.«
»Wovon redest du, Galliardo?« Der Hafenmeister war, wie Hawkwood selbst, ein kleiner Mann und einst ein guter Seefahrer gewesen. Er war geborener Hebrione mit mahagonifarben gebräunter Haut, wodurch sein Lächeln besonders strahlend zur Geltung kam. Im Augenblick jedoch lächelte er nicht.
»Du kommst aus Macassar, zurück von den Malacar-Inseln, nicht wahr?«
»Ja‚ und?«
»Es gibt ein neues Gesetz, eine Notstandsmaßnahme, zu der die Brüder vom Ersten Tage den König gedrängt haben. Ich hätte dich ja gewarnt und dich in einen anderen Hafen umgeleitet …«
Doch Hawkwood war stehen geblieben. Fünfzehn Soldaten der hebrionischen Marine marschierten den Kai herunter auf sie zu. An der Spitze schritt ein ganz in Schwarz gekleideter Mönch der Brüder vom Ersten Tage. Das »A«-Zeichen‚ das Heiligensymbol, baumelte an einer goldenen Kette vor seiner Brust und funkelte grell in der Sonne. Der Geistliche war sehr jung und wirkte in der schweren Robe bei der drückenden Hitze äußerst schlaganfallgefährdet, doch das Gesicht des Mönches strahlte überzeugte Selbstverherrlichung aus. Vor Hawkwood und Galliardo blieb er stehen. Die Soldaten hinter ihm nahmen Habachthaltung an. Hawkwood taten sie in den Rüstungen leid. Der Unteroffizier schaute ihm in die Augen und hob den Blick leicht gen Himmel. Hawkwood rang sich ein Lächeln ab, beugte sich vor und küsste die Hand des Mönchs, wie es erwartet wurde.
»Was können wir für Euch tun, Bruder?« erkundigte er sich unbeschwert, wenngleich sein Mut rasch sank.
»Ich bin im Dienste des Herrn unterwegs«, erwiderte der Mönch. Schweiß troff ihm von der Nase. »Es ist meine Pflicht, Euch mitzuteilen, Kapitän, dass der Prälat von Hebrion in seiner unendlichen Weisheit zu einer schmerzlichen, aber notwendigen Entscheidung vor Gott gelangt ist, die da lautet, dass Fremden, die nicht aus den fünf ramusischen Königreichen, einem ramusischen Vasallenstaat oder einem Staat stammen, mit dem die ramusischen Monarchen eine Allianz unterhalten, der Eintritt in die Königreiche zu verwehren ist, damit sie mit ihrem gottlosen Glauben die armen Seelen unserer Völker nicht noch mehr beschmutzen und keine weiteren Katastrophen über uns bringen.«
Hawkwood stand stocksteif vor Zorn, doch der Mönch fuhr unbeirrt mit der hastig und monoton vorgetragenen Litanei fort, deren Wortlaut er offenbar schon viele Male verkündet hatte.
»Daher obliegt es mir, Euer Schiff zu durchsuchen. So ich Personen an Bord vorfinde, die der Verordnung des Prälaten unterliegen, muss ich diese an einen sicheren Ort geleiten, auf dass sie dort in Gewahrsam bleiben, bis die geistlichen Führer des erhabenen Ordens, dem auch meine Wenigkeit angehört, über ihr Schicksal entschieden haben.« Erleichtert wischte sich der Kuttenträger über die Augenbrauen.
Hawkwood spuckte mit Inbrunst über den Kai ins ölige Wasser. Der Mönch schien nicht beleidigt. Seeleute, Soldaten und andere Vertreter des niedrigen Pöbels pflegten sich bisweilen in ähnlicher Weise auszudrücken.
»Wenn Ihr also beiseitetreten wollt, Kapitän …«
Hawkwood richtete sich zu voller Größe auf. Er war nicht groß – der Geistliche überragte ihn um einen halben Kopf –, aber er hatte schrankbreite Schultern und die kräftigen Arme eines Hafenarbeiters. Ein kaltes Funkeln in den seegrauen Augen ließ den Ordensbruder zaudern.
Schweigend litten die Soldaten hinter dem Mönch in der schier unerträglichen Hitze.
»Ich bin Gabrionese, Bruder«, erklärte Hawkwood mit leiser Stimme.
»Darauf hat man mich hingewiesen. Euren Landsleuten wurde in Anerkennung ihres tapferen Einsatzes bei Azbakir eine Sonderstellung eingeräumt. Ihr habt nichts zu befürchten, Kapitän. Ihr seid ausgenommen.«
Hawkwood fühlte Galliardos Hand auf seinem Arm.
»Eigentlich, Bruder, will ich damit sagen, dass die Leute meiner Besatzung, auch wenn sie nicht aus den Königreichen, ja nicht einmal aus den ach so geschätzten Vasallenstaaten des Königs stammen, allesamt fähige Seeleute, aufrechte Bürger und hervorragende Kameraden sind. Mit manchen segle ich schon mein ganzes Leben lang, einer war sogar bei der Schlacht dabei, die Ihr erwähnt habt. Einer Schlacht, durch die das südliche Normannien vor den See-Merduks gerettet wurde.«
Er sprach hitzig und dachte wütend an Julius Albak, der insgeheim Ahrimuz huldigte. Als Junge aus Ridawan jedoch, als halber Knabe noch, hatte Julius an Bord einer gabrionesischen Kriegskaracke gestanden, als drei Galeeren der Merduks das Schiff rammten und nacheinander enterten. Das war bei Azbakir. Die Gabrionesen, vollendete Seeleute, aber ein stolzes, eigensinniges und stures Volk, hatten an jenem Tag ganz allein den Flotten der See-Merduks getrotzt und sie von der calmarischen Küste vertrieben, an der diese landen wollten, um im südlichen Astarac und in Candelaria einzumarschieren, dem empfindlichen Unterleib des Westens.
»Wo wart Ihr zur Zeit von Azbakir, Bruder? Noch als Samen in den Lenden Eures Vaters? Oder wart Ihr bereits auf der Welt und habt noch gelb geschissen?«
Der Mönch lief dunkelrot an. Hawkwood sah, wie sich der Marineunteroffizier hinter dem Pfaffen bemühte, die ausdruckslose Miene beizubehalten.
»Von einem gabrionesischen Korsaren hätte ich nichts anderes erwarten dürfen. Eure Zeit wird kommen, Kapitän, und die Eurer dickschädeligen Landsleute. Und nun tretet beiseite oder Euch ereilt das Schicksal der Ungläubigen etwas verfrüht.«
Als Hawkwood sich nicht rührte, schrie der Mönch: »Unteroffizier, schafft mir diesen gottlosen Hund aus dem Weg!«
Der Unteroffizier zögerte. Eine Sekunde lang starrte er in Hawkwoods Augen. Es war fast so, als hätten die beiden eine Vereinbarung über etwas getroffen. Mit der Hand am Dolch gab Hawkwood den Weg frei.
»Wäre es nicht Eurer Berufung wegen, Priester, ich würde Euch am Spieße rösten wie das schwarze, ausgenommene Federvieh, dem Ihr ähnelt«, erklärte er mit einer Stimme so frostig wie die Gischt der Nordsee.
Der Bruder vom Ersten Tage bebte. »Unteroffizier!«, kreischte er.
Entschlossen trat der Soldat vor, doch Hawkwood ließ ihn und seine Leute unbehelligt in Richtung des Schiffes vorbeimarschieren. Der Geistliche folgte ihnen dicht auf den Füßen. Sobald der Trupp an Hawkwood vorüber war, wirbelte der Betbruder herum.
»Ich kenne Euren Namen, Gabrionese. Auch der Prälat wird ihn bald kennen, das verspreche ich Euch.«
»Flieg davon, Rabe«‚ spöttelte Hawkwood, doch Galliardo zog ihn schon fort.
»Um Himmels willen, Ricardo, komm da weg! Wir können alles nur noch schlimmer machen. Willst du etwa am Schafott enden?«
Widerwillig ging Hawkwood weiter, ein aus seinem Element gerissenes Geschöpf der See. Das Blut war ihm ins Gesicht geschossen.
»Komm mit in mein Büro. Wir reden darüber. Vielleicht können wir etwas tun.«
Die Soldaten gingen an Bord der Gnade Gottes. Erneut vernahm Hawkwood die monotone Stimme des Ordensbruders.
Dann Geplätscher. Ein Besatzungsmitglied war über die Reling gesprungen und schwamm ziellos davon. Der Mönch brüllte; wie in einem Albtraum sah Hawkwood einen Soldaten die Hakenbüchse anheben.
Ein kurzer Knall ertönte, der den Hafen für einen Augenblick den Atem anhalten ließ; eine dichte Rauchwolke verhing die Sicht auf die Reling des Schiffes; der Mann aber schwamm nicht mehr, sondern war nur noch ein leblos auf dem dreckigen Wasser treibendes Etwas.
»Großer Gott!«, rief Galliardo mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen. Die Arbeit am Kai brach ab, als die Männer innehielten und gafften. Nur das wütende Gebrüll des Unteroffiziers war zu vernehmen.
»Möge Gott sie verfluchen!«, stammelte Hawkwood mit von Trauer und Hass belegter Stimme. »Möge er alle schwarz gewandeten Raben verfluchen, die in seinem Namen solche Schandtaten begehen!«
Der Tote war Julius Albak.
Nur mit roher Kraft gelang es Galliardo, den Kapitän wegzuziehen, wobei ihm der Schweiß in dicken Tropfen von der Stirn rann. Hawkwood ließ sich vom Kai schleifen, stolpernd wie ein alter Mann, die Augen blind vor Tränen.
Auch Abeleyn IV., König von Hebrion, war nicht glücklich. Wenngleich er sich in angemessener Weise niederkniete, um den Ring des Prälaten zu küssen, so lag in der Geste doch eine Steifheit, ein gewisser Widerwille, der seine Gefühle verriet. Der Prälat legte ihm die Hand auf das dunkelhaarige, gekrönte Haupt.
»Ihr wünscht mit mir zu sprechen, mein Sohn?«
Abeleyn war ein stolzer junger Mann in der Blüte seiner Jahre. Darüber hinaus war er König, einer der fünf Könige des Westens. Nichtsdestotrotz behandelte ihn dieser alte Mann stets wie ein auf Abwege geratenes, störrisches, doch unwiderstehlich liebenswertes Kind, was Abeleyn regelmäßig aus dem Gleichgewicht brachte.
»Ja, Heiliger Vater.« Er richtete sich auf. Sie befanden sich in den Gemächern des Prälaten. Hohe, massive Wände und die gewölbte Decke hielten die größte Hitze draußen. In weiter Ferne hörte Abeleyn die Mönche in Vorbereitung auf das Mittagessen singen. Den Zeitpunkt für den Besuch hatte er schlecht gewählt: Zweifellos harrte der Prälat ungeduldig seiner Mittagsmahlzeit. Nun, sollte er.
Wandteppiche, die Szenen aus dem Leben des heiligen Ramusio zeigten, lockerten ein wenig die asketische Erhabenheit des Raumes auf. Den Boden schmückte ein edler Teppich, in Räuchergefäßen brannte süßes Duftöl, die Hängelampen schimmerten golden, Weihrauch kitzelte in der Nase. Beiderseits des Prälaten saß ein Mönch auf einem samtbezogenen Stuhl. Einer hatte Feder und Pergament, denn hier wurden alle Gespräche aufgezeichnet. Hinter sich vernahm Abeleyn das leise Klirren der Stiefel seiner Leibgarde, die ebenfalls kniete. Die Schwerter waren vor der Tür zurückgeblieben. Nicht einmal ein König durfte bewaffnet in die Nähe des Prälaten. Seit Aekirs Fall und dem Verschwinden des Pontifex Maximus in den Wirren der untergehenden Stadt stellten die fünf Prälaten Gottes unmittelbare Vertreter auf Erden dar. Abeleyns Mundwinkel zuckten. Man munkelte, der Pontifex Maximus, Macrobius IV., hätte bereits in der Anfangsphase der Belagerung den Wunsch geäußert, Aekir zu verlassen, um seine heilige Person in Sicherheit zu bringen. John Mogen und seine Torunnen jedoch hätten ihn eines Besseren belehrt, indem sie ihm erklärten, es wäre das Eingeständnis der Niederlage, sollte der Pontifex aus der Stadt flüchten. Gerüchten zufolge hatte es sich als notwendig erwiesen, Macrobius in einen Lagerraum seines eigenen Palastes zu sperren, um ihn vom Bleiben zu überzeugen.
Abeleyns Stimmung verfinsterte sich. In den bevorstehenden Zeiten würde der Westen Männer wie Mogen brauchen. Dieser General war ein halbes Dutzend Könige wert gewesen.
Als Abeleyn sich erhob, brachte man ihm einen niedrigen Stuhl, sodass er zu Füßen des Prälaten saß und für alle Welt wie ein Lehrling zu Füßen seines Meisters wirkte. Der König schluckte den Zorn hinunter und sprach mit seidig weicher Stimme.
»Wir haben über dieses Edikt bezüglich der Ketzer und der Fremden in der Stadt gesprochen und wir waren einer Meinung, dass es notwendig sei, die Abtrünnigen, die Ungläubigen und die Verräter auszurotten …«
Der Prälat neigte den Kopf und lächelte milde. Mit der langen Nase und dem stechenden Blick wirkte er wie ein leberfleckiger Adler auf einem Ast.
»… aber Vater, wie ich erfahre, habt Ihr in den Wortlaut auch die Hellseher, die Weissager und jeden noch so unbedeutenden Anwender des Dweomer im Königreich aufgenommen – jeden, der eine übernatürliche Fähigkeit besitzt. Schon treiben meine Soldaten diese Leute unter der Führung Eurer Brüder zusammen. Wozu? Gewiss hegt Ihr nicht die Absicht, sie allesamt den Flammen zu übergeben?«
Der Prälat lächelte unablässig. »O doch, mein Sohn.«
Abeleyn kniff den Mund zusammen, als hätte man ihm eine bittere Frucht hineingestopft. Seine Lippen wirkten wie schmale Narben im Gesicht.
»Aber wozu soll es gut sein, jedes Ammenweib auszurotten, das Warzen heilt, jeden Kräuterdoktor, der seine Dienste anbietet, jeden …«
»Hexerei ist Hexerei, mein Sohn. Jede übernatürliche Kraft stammt aus derselben Quelle – der Quelle des Teufels.« Der Prälat gab sich wie ein heiliger Lehrmeister, der geduldig einen minderbemittelten Schüler unterrichtet. Wütend regte sich ein Soldat aus Abeleyns Leibgarde, doch der Blick eines der beiden Mönche zügelte ihn.
»Vater, dadurch könntet Ihr Tausende auf den Scheiterhaufen verbannen, sogar Angehörige meines Hofstaates. Golophin, der Magier, einer meiner Berater …«
»Gottes Arbeit ist niemals leicht. Wir leben in schwierigen Zeiten, was Ihr besser als jeder andere wissen solltet, mein König.«
Abeleyn, der in zwei Minuten ebenso oft unterbrochen worden war, musste an sich halten, um nicht lauter zu werden. Er verspürte das dringende Bedürfnis, den Prälaten zu packen und ihm an der nächstbesten Mauer den Schädel einzuschlagen.
Stattdessen lächelte er. »Aber zumindest müsst Ihr doch die praktischen Schwierigkeiten bei der Erfüllung eines solchen Ediktes erkennen, besonders in Zeiten wie diesen. Die Torunnen schreien nach Verstärkung, um den Vorstoß der Merduks aufhalten und die Stellung am Searil verteidigen zu können. Ich bin nicht sicher« – dabei setzte Abeleyn ein besonders geziertes Lächeln auf –, »ich bin nicht sicher, ob ich die Männer bereitstellen kann, die zur Erfüllung Eures Ediktes erforderlich sind.«
Der Prälat strahlte zurück. »Eure Sorge gereicht Euch zur Ehre, mein Sohn. Ich weiß, dass die gegenwärtige Krise schwer auf Euren Schultern lastet, doch verzagt nicht. Gottes Wille soll geschehen. Ich habe um ein Kontingent der Glaubensritter ersucht, das vom Sitz unseres Ordens in Charibon hierher gesandt wird. Sie werden Euch die Bürde erleichtern. So stehen Eure Soldaten für Einsätze andernorts zur Verfügung, zur Verteidigung der ramusischen Königreiche und des wahren Glaubens.«
Abeleyn wurde kalkweiß und sogar der Prälat schien unter seinem Blick zu schrumpfen und sah sich zu seiner Erklärung genötigt: »Ich tue alles in meiner Macht Stehende nur zum Wohle des Königreichs, mein Monarch.«
»Fürwahr.« Der Prälat spielte mit höherem Einsatz, als Abeleyn vermutet hatte. Während er seine eigenen Soldaten an die Grenze schickte, um den Torunnen zu helfen, hätten die Glaubensritter – der militärische Arm der Kirche – freie Hand in Abrusio. Seine Spione hätten ihn schon früher darüber informieren sollen, doch es war stets ungemein schwierig, etwas über die Vorhaben der Brüder vom Ersten Tage herauszufinden. Der Zusammenhalt dieser Priester war undurchdringlich wie ein Kettenhemd. Mühevoll kämpfte Abeleyn den aufwallenden Zorn nieder. Er wählte seine Worte sorgfältig.
»Es liegt mir fern, Euch, Vater, einen Fürst der Kirche, darüber zu belehren, was in Gottes Augen notwendig oder wünschenswert sein mag und was nicht. Aber ich fühle mich verpflichtet, Euch mitzuteilen, dass Euer Edikt – unser Edikt – in der breiten Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen wird. Wie Ihr wisst, ist Abrusio ein Hafen, der wichtigste Hafen des Westens. Die Stadt lebt vom Handel, Handel mit anderen Königreichen, anderen Nationen und anderen Völkern. Aufgrund dieser Umstände gelangen immer wieder einige Fremde nach Hebrion, die hier ein neues Leben beginnen. Umgekehrt leben in gut einem Dutzend anderer Länder von Normannien Hebrionen – sogar in Calmar und im entfernten Ridawan.«
Der Prälat erwiderte nichts. Seine Augen glichen zwei polierten Gagatsplittern.
Abeleyn argumentierte weiter: »Handel lebt von Wohlwollen, von entsprechenden Einrichtungen und Kompromissen. Mir wurde vorgetragen, dass dieses jüngste Edikt den Handel mit den südlichen Königreichen und den Stadtstaaten der Levangore schwerwiegend beeinträchtigen könnte – das sind Länder der Merduks, ja, aber sie haben seit Azbakir vor vierzig Jahren keinen Finger mehr gegen uns erhoben und ihre Galeeren helfen uns, die Meerenge von Malacar frei von den Korsaren zu halten.«
»Mein Sohn«‚ erklärte der Prälat mit einem grauenhaft warmherzigen Lächeln, »es betrübt mich, Euch in einer Weise sprechen zu hören, als wären Eure Sorgen die eines gewöhnlichen Händlers statt der eines ramusischen Königs.«
Mit einem Mal herrschte in der Kammer Totenstille. Geräuschvoll beschrieb der Federkiel des Protokollführers einen Bogen über das Pergament. Niemand sprach so mit einem König in dessen eigenem Reich.
»Wohl ist es bedauerlich«, verkündete Abeleyn in die Stille, »doch ich glaube, ich kann die Verstärkung nicht nach Torunna schicken, die dort so dringend gebraucht wird. Ich glaube, Heiliger Vater, der wahre Glaube kann von meinen Männern hier ebenso gut verteidigt werden wie an der Grenze. Wie Ihr mir so weise verdeutlicht habt, können von jeder Seite Gefahren für die Krone drohen, von innerhalb der Grenzen ebenso wie von außerhalb. Ich halte es deshalb für klüger, dass meine Truppen die Arbeit hier in Abrusio gemeinsam mit der Kirche fortsetzen. Und habt Ihr mich in Eurer Güte auch nicht dafür getadelt, so fühle ich doch, dass ich in dieser Angelegenheit bisher nicht genug Verantwortung übernommen habe. Von nun an sollen die Listen der Verdächtigen, Ketzer, Fremde – und natürlich der Hexer – mir vorgelegt werden, auf dass ich sie bestätigen kann. Danach werde ich sie an Euch weiterleiten. Wie Ihr so richtig sagt, dies sind schwierige Zeiten. Der Gedanke betrübt mich, dass einem Mann Eures Standes und Eurer fortgeschrittenen Jahre der Lebensabend durch derart abstoßende Aufgaben verleidet werden soll. Ich will danach trachten, Euch die Bürde zu erleichtern. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«