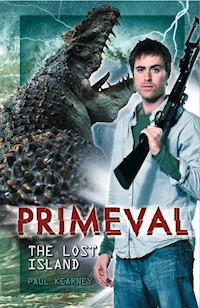4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Königreiche Gottes
- Sprache: Deutsch
Es ist Krieg in Torunna. Der Kampf gegen die verhassten Merduks geht in die entscheidende Phase. Die mächtige Feste Ormann ist gefallen und die Truppen des Sultans Aurungzeb marschieren gegen die Hauptstadt Torunn. Gefördert von der Königinmutter steigt der Stern des Soldaten Corfe aus Aekir. Ganz zum Missfallen des Königs Lofantyr. Dieser versucht alles, um den neuen Günstling seiner Mutter kaltzustellen.
Zur gleichen Zeit kämpft der junge König Abeleyn in Hebrion ums Überleben. Just im Moment des Sieges über seine adligen Gegner trifft ihn eine letzte Bombe und beraubt ihn seiner Beine. König Marks Schwester Isolla, die zur bündnisstärkenden Heirat aus Astarak angekommen ist, versucht zusammen mit dem Magier Golophin Abeleyn zurück ins Leben zu holen. Doch die Chancen sind gering und die adeligen Aasgeier kreisen bereits über dem Palast, um das Erbe des Königs anzutreten.
Auch in der nunmehr gespaltenen Kirche ist es unruhig. Die beiden Glaubensbrüder Albrec und Avila haben das Schriftstück über das wahre Leben des Heiligen Ramusio, dem Begründer des Glaubens in Normannia, aus dem Kloster Charibon gerettet und befinden sich nun auf der gefährlichen Reise zum zweiten Pontifex Macrobius nach Torunn. Die Wahrheit muss endlich ans Licht kommen: Sowohl die Merduks als auch die Bewohner der fünf Königreiche beten zum gleichen Heiligen, zum gleichen Gott.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil I. Mittwinter
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Teil II. Im Herzen des Sturms
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Epilog
Weitere Atlantis-Titel
Paul Kearney
Die Königreiche Gottes 3
Der eiserne Krieg
Ins Deutsche übertragen von Michael Krug
Ich habe dich bewacht in leichtem Schlummer Und dich vom eh’rnen Kriege murmeln hören …Heinrich IV., Teil I
Prolog
Im schweißtreibenden Albtraumfieber der Dunkelheit spürte er, wie die Bestie seine Kammer betrat und über ihm thronte. Aber das war unmöglich. Gewiss konnte sie nicht von so weit her …
O gütiger Gott im Himmel, Herrscher der Erde, steh mir bei …
Beten, beten, beten. Geradezu lachhaft schien es, dass er zu Gott betete, er, dessen Seele pechschwarz und bereits verkauft war; längst verloren und zu ewigen Qualen in den Feuern der Hölle verdammt.
Heiliger Ramusio, steh mir bei. Sei bei mir in dieser verzweifelten Stunde.
Er weinte. Sie war hier, selbstverständlich war sie hier. Sie beobachtete ihn, geduldig wie ein Stein. Er gehörte ihr. Er war verdammt.
Schweißgebadet öffnete er die verkrusteten Lider und blickte in die allumfassende Finsternis der mitternächtlichen Kammer. Während er schlief, waren ihm Tränen über Wangen und Hals gekullert und die schweren Felldecken des Bettes lagen kreuz und quer. Ihre massige, haarige Beschaffenheit ließ ihn zusammenzucken. Aber da war nichts. Er war doch allein, Gott sei Dank. Allein mit der stillen Winternacht, die draußen vor der Kammer mit all ihrer frostigen Macht verstrich.
Vom Nachttisch ergriff er Feuerstein und Stahl, schabte beides aneinander. Nachdem der Zunder Feuer gefangen hatte, übertrug er den Glutkeim auf den Kerzendocht. Ein Licht, ein heller Schimmer in der drückenden Düsternis.
Mutterseelenallein. Sogar der Gott hatte ihn verlassen, den er einst verehrt und dem er die besten Jahre seines Lebens gewidmet hatte. Geistliche und Theologen behaupteten, der Schöpfer wäre überall, in jedem Winkel, jeder Nische der Welt. Nicht aber hier in dieser Kammer. Nicht heute Nacht.
Doch etwas anderes nahte. Er spürte, wie es durch die Dunkelheit auf ihn zuraste, unaufhaltsam wie die Sonne am Himmel, mit fliegenden Füßen, die kaum den Boden der schlummernden Welt berührten. Binnen eines Lidschlags vermochte dieses Etwas, Kontinente und Meere hinter sich zu lassen.
Die Felle auf dem Bett zuckten; er kreischte auf. Von Panik ergriffen, kroch er mit hervorquellenden Augen und wild pochendem Herzen zurück ans Kopfteil. Dann begannen die Felle zu wachsen, bauschten sich in der Düsternis und im Schein der Kerze. Jäh verwandelte die Kammer sich im nunmehr flackernden, unsteten Licht in eine Spielwiese huschender Schatten.
Unaufhaltsam richteten die Felle sich im Bett auf, überragten ihn. Und als sie über ihm thronten, riesig wie ein unförmiger Megalith, blinzelten in ihrer Mitte zwei gelbe Augen, grell und gierig wie eines Feuerteufels Flamme.
Es war hier. Es war gekommen.
Huldvoll ließ er sich mit dem Gesicht auf die feuchten Leinenlaken fallen. Wahrhaftig hier – er konnte den Moder der Erscheinung riechen, die Hitze der massigen Gestalt fühlen. Ein Speicheltropfen löste sich von der Schnauze, der ihm mit leisem Zischen die Haut versengte, als er in seinem Nacken landete.
Sei gegrüßt, Himerius, sprach die Bestie.
»Meister«, flüsterte der auf dem Bauch liegende Geistliche und wand sich in seinem entweihten Bett.
Fürchte dich nicht, mahnte die Stimme der Bestie geräuschlos.
Himerius antwortete mit einem unverständlichen, gurgelnden Laut des Entsetzens.
Die Zeit ist gekommen, mein Freund, sagte das Wesen. Sieh mich an. Setz dich auf und schau.
Eine riesige Tatze mit Fingern und Klauen, gleich einem unwirklich anmutenden Mittelding aus Mensch und Tier, zog ihn auf die Knie. Die Ballen der Tatze versengten ihm durch die Wolle seiner Winterkluft die Haut.
Das Antlitz des Winterwolfs, die Ohren gleich Hörnern über dem massigen, schwarz behaarten Schädel, in dem die Augen wie safrangelbe Lichter in dunklen Schlitzen funkelten, und eine lange, mit Fängen bewehrte Schnauze, von der in silbrigen Fäden Speichel tropfte; die schwarzen, bebenden Lippen zurückgezogen. Und zwischen den Zähnen glitzerte ein zinnoberroter Klumpen.
Iss.
Von unaussprechlichem Entsetzen erfüllt, weinte Himerius. »Bitte‚ Meister«‚ winselte er. »Ich bin noch nicht bereit. Ich bin nicht würdig …«
Iss.
Die Tatzen schlossen sich um seine Oberarme und hoben ihn von den Beinen. Das Bett knarrte unter ihm. Sein Gesicht wanderte dicht vor die heiß glühenden Kiefer; der Atem der Bestie, gleich der feuchten Hitze eines fauligen Dschungels, drehte ihm den Magen um. Ein Tor zu einer anderen, gottlosen Welt.
Er nahm den Fleischbrocken in den Mund, die Lippen zu einem grässlichen Kuss gegen die Fänge des Wolfs gepresst. Er kaute, schluckte, kämpfte den Drang zu würgen nieder, als der Bissen seine Kehle hinabglitt wie auf der Suche nach dem blutig finsteren Weg zu seinem Herzen.
Gut. Sehr gut. Und jetzt zum anderen Teil.
»Nein, ich flehe Euch an!«, wimmerte Himerius.
Er wurde bäuchlings auf das Bett geschleudert; ein beiläufiger Wink mit der Klaue, und das Wesen fetzte ihm die Kleider vom Rücken. Dann war der Wolf auf ihm. Das Furcht einflößende Gewicht drückte ihn nieder, presste ihm die Luft aus den Lungen. Er hatte das Gefühl zu ersticken, konnte nicht einmal schreien.
Ich bin ein Mann Gottes. O Herr, hilf mir in meiner Not!
Und dann der jähe, lodernde Schmerz, als die Bestie auf ihn stieg und mit einem einzigen, erbarmungslosen Stoß in seinen Leib eindrang.
Sein Verstand wurde vor Pein weiß und leer. Die Bestie keuchte ihm ins Ohr; von der Schnauze troff Speichel und verbrühte ihm den Hals. Die Klauen gruben sich in seine Schultern, während das Wesen ihn schändete. Das Fell fühlte sich auf dem Rücken wie Tausende Nadeln an.
Nach einigen wenigen Stößen ergoss sich die Bestie schaudernd in ihn; ein tiefes Grollen der Befriedigung entrang sich ihrer Kehle. Die mächtigen Lenden hoben sich von seinen Hinterbacken. Das Ungetüm zog sich zurück.
Nun bist du wahrlich einer von uns. Ich habe dich mit einer kostbaren Gabe gesegnet, Himerius. Wir sind Brüder unter dem Licht des Mondes.
Himerius fühlte sich wie in Stücke gerissen, vermochte kaum, den Kopf zu heben. Nun gab es kein Beten mehr, niemanden, den er anrufen konnte. Etwas Kostbares war seiner Seele entwunden und durch ein fauliges Übel ersetzt worden.
Der Wolf entschwand und mit ihm wich der Gestank aus der Kammer. Himerius weinte bitterlich; sein Körper wurde von Schluchzern geschüttelt, während ihm Blut zwischen den Beinen hinabrann.
»Meister«, stöhnte er. »Danke, Meister.«
Und als er schließlich den Kopf hob, war er allein auf dem großen Bett, allein in der Kammer, und draußen schwoll der Wind zwischen den verlassenen Kreuzgängen zu einem durchdringenden Heulen an.
Teil I.Mittwinter
Ein Geist, der sich nicht zu unterwerfen weiß, der vor keiner Gefahr zurückweicht, weil sie Ruhm und Ehre für ihn birgt, ist die Seele eines SoldatenRobert Jackson, »Eine systematische Betrachtung zur Aufstellung, Disziplin und dem Unterhalt von Armeen«, 1804
Eins
Nichts, was man Isolla erzählt hatte, hätte sie auf diesen Anblick vorzubereiten vermocht. Selbstverständlich schwirrten wilde Gerüchte umher, schauerliche Geschichten von Zerstörung und Gemetzeln. Doch es erstaunte sie, welches Ausmaß die ganze Angelegenheit angenommen hatte.
Sie stand auf der leewärtigen Seite des Achterdecks der Karacke; ihre Zofen hielten sich stumm wie Eulen an ihrer Seite. Ein steter Nordwester blies von backbord herein und das Schiff stampfte im steifen Wind wie ein Hirsch auf der Flucht vor Jagdhunden; leewärts stieg eine zehn Fuß hohe Bugwelle auf, auf die der matte Schein der Wintersonne funkelnde Regenbogen malte.
Nicht der leiseste Hauch von Seekrankheit hatte Isolla befallen, was sie zutiefst erfreute; es war lange her, seit sie zuletzt auf See gewesen war, lange her, seit sie überhaupt irgendwo gewesen war. Die halsbrecherische Fahrt durch den Fimbrischen Golf war eine erfrischend aufregende Abwechslung gewesen, besonders nach der drückenden Wintertrübnis des Hofes – eines Hofes, der erst kürzlich einem versuchten Staatsstreich entronnen war. Isollas Bruder, der König von Astarak, hatte ein halbes Dutzend kleinerer Schlachten geführt, um sich den Thron zu wahren, und war als Sieger daraus hervorgegangen. Doch das war nichts im Vergleich zu dem, was sich in jenem Königreich ereignet hatte, in das ihre Reise führte. Überhaupt nichts.
Sie segelten beständig eine weitläufige Bucht entlang, an deren Ende sich die Hauptstadt von Hebrion befand, das schillernde, alte Abrusio, das gleich einer Dirne auf einem Nachttopf kauerte. Einst hatte Abrusio als der liederlichste und gottloseste Hafen der westlichen Welt gegolten. Und als der reichste, bunteste, belebteste. Nun war er nur noch eine verkohlte Hülle.
Der Bürgerkrieg hatte Abrusios Eingeweide zerfleischt. Ganze drei Meilen weit glich der Küstenstreifen einer rauchenden Ruine. Entlang der Überreste von Kais und Anlegestellen ragten die Rümpfe einst prächtiger Schiffe aus dem Wasser und vom Ufer erstreckte sich landeinwärts ein mehrere Hektar großes Ödland: das immer noch schwelende Gerippe der Unterstadt, die Häuser vom Inferno zerstört, das dort gewütet hatte. Einzig der Admiralsturm ragte großenteils unversehrt in den Himmel, wie ein ausgemergelter Wächter, ein Grabstein.
In den Außenstraßen lag eine mächtige Flotte vor Anker. Obwohl Hebrions Seestreitkräfte im Zuge des erbitterten Kampfes zur Rückeroberung der Stadt von den Glaubensrittern und den mit ihnen verbündeten Verrätern Verluste hinnehmen mussten, stellten sie auch jetzt noch eine beachtliche Macht dar: riesige Schiffe, deren Werften einem Nest verworrener Takelage und emsiger Matrosen ähnelten, die den Schaden zu beheben versuchten, den der Krieg angerichtet hatte. Abrusio besaß immer noch genügend scharfe Zähne.
Droben auf dem Hügel über dem Hafen standen nach wie vor der königliche Palast sowie das Kloster des Ordens vom Ersten Tage, wenngleich an beiden Bauwerken nur zu deutlich die Narben der Beschießung von See aus zu erkennen waren, mit der die letzten Sturmangriffe geendet hatten. Und irgendwo dort oben erwartete Isolla ein König, der auf die Ruinen seiner Hauptstadt hinunterschaute.
Isolla war die Schwester eines anderen Königs. Sie war eine groß gewachsene, hagere Frau, deren lange Nase über den Mund hinabzuhängen schien, außer wenn sie lächelte. Dazu ein Doppelkinn und eine breite, blasse, mit Sommersprossen gesprenkelte Stirn. Schon vor geraumer Zeit hatte sie es aufgegeben, nach der Porzellanpuppenreinheit zu streben, die man von einer Hofdame erwartete. Sogar auf Puder und Cremes verzichtete sie mittlerweile. Ebenso hatte sie die Vorstellungen verworfen, die sie überhaupt erst veranlasst hatten, derlei Tand zu benutzen.
Isolla segelte gen Hebrion, um zu heiraten.
Es fiel ihr schwer, sich des Knaben zu besinnen, der Abeleyn gewesen war, jenes Knaben, aus dem mittlerweile ein Mann und König geworden war. In jenen Tagen, die sie als Kinder miteinander verbrachten, war er grausam zu ihr gewesen, hatte sie ob ihrer Hässlichkeit verhöhnt, sie an den flammend roten Haaren gezogen, die ihre einzige Zierde darstellten. Aber schon damals hatte Abeleyn einen gewissen Glanz versprüht – irgendetwas, das es schwierig machte, ihn zu hassen, hingegen leicht, ihn zu mögen. »Issi Langnase« hatte er sie als Knabe genannt und sie hatte ihn dafür verwünscht. Und dennoch: Als der junge Prinz Lofantyr ihr eines Winterabends in Vol Ephrir ein Bein stellte, sodass sie in den Schlamm stürzte, drückte Abeleyn das Gesicht des künftigen Herrschers von Torunna in eine Pfütze und rieb die königliche Nase in dem Dreck, in dem Isolla stand. Warum er das getan habe, hatte Isolla wissen wollen. Weil sie Marks Schwester war, hatte Abeleyn geantwortet, und Mark sein bester Freund. Dann hatte er ihr mit unbeholfener, jungenhafter Zärtlichkeit die Tränen abgewischt. Isolla hatte ihn angehimmelt – um ihn am nächsten Tag aufs Neue zu hassen, als sie wieder zur Zielscheibe seiner Streiche wurde.
Nun würde er bald ihr Gemahl sein, der erste Mann, den sie je zu sich ins Bett ließ. Mit ihren siebenundzwanzig Jahren bereiteten Isolla derlei Dinge kaum noch Kopfzerbrechen, obwohl es selbstverständlich ihre Pflicht sein würde, einen männlichen Thronfolger zu gebären, je früher, desto besser. Eine politische Ehe ohne jede Romantik, die aber praktisch war und gelegen kam. Isollas Leib verkörperte den Vertrag zweier Königreiche, ein Symbol ihres Bündnisses. Davon abgesehen, besaß er keinen echten Wert.
»Beim elften Breitengrad!«, rief der Lotse im Bug. Und dann: »Beim heiligen Blut Gottes! Steuerbord, Steuermann! Da ist ein Wrack im Fahrwasser!«
Der Steuermann schwang das Ruder der Karacke, die sich sogleich sanft drehte. Als der Kahn an der Backbordseite des Bugs vorübertrieb, sah die Schiffsbesatzung das Wrack eines versunkenen Kriegsschiffes, dessen Rahspitzen höchstens einen Fuß aus dem Wasser ragten. Die dunkle Masse des Schiffsrumpfs zeichnete sich deutlich im klaren Wasser ab.
Die gesamte Besatzung starrte auf die vom Krieg verwüsteten Überreste der Stadt. Zahlreiche Matrosen erklommen wie Affen die Wanten, um eine bessere Aussicht zu erlangen. Auf dem Achterdeck hatten die vier schwer bewaffneten astarakischen Ritter ihre teilnahmslose Haltung aufgegeben und blickten ebenso gebannt wie alle anderen.
»Abrusio, Gott steh uns bei!«, entfuhr es dem Kapitän, der mit seiner gewohnten Schweigsamkeit brach.
»Die Stadt ist zerstört!«, platzte einer der Männer am Steuer hervor.
»Klappe zu und Kurs halten. Lotse! Gib gefälligst Laut. Ihr hirnloses Pack! Ihr würdet den Kahn noch auf Grund laufen lassen, um einen Tanzbären zu begaffen. An die Brassen! Bei Gott, wollt ihr so kurz vor dem Hafen den Wind sausen lassen, damit uns die Hebrionen für verträumte Narren halten?«
»Da ist kein Hafen mehr«‚ meinte einer der Obermaate kurz und treffend und spuckte gleich darauf mit einem flüchtigen, schuldbewussten Blick zu Isolla über die leeseitige Reling. »Die Stadt ist bis zur Küste niedergebrannt, Käpt’n. Kaum ’n Kai übrig, an dem wir anlegen könnten. Wir werden wohl in den Innenstraßen ankern und ein Langboot reinschicken müssen.«
»Aye«, murmelte der Kapitän mit noch immer finsterer Miene. »Macht Tampen an die Nocks. Vielleicht hast du recht.«
»Augenblick, Kapitän«‚ rief einer der Ritter aus Isollas Leibwache. »Wir wissen noch nicht, wer über Abrusio herrscht. Vielleicht ist es dem König nicht gelungen, die Stadt zurückzuerobern. Sie könnte noch in der Hand der Glaubensritter sein.«
»Am Palast ist das königliche Banner aufgezogen«, warf der Obermaat ein.
»Aye, aber nur auf Halbmast«‚ fügte jemand hinzu.
Eine Pause entstand. Die Besatzung wartete auf Befehle des Kapitäns. Der öffnete den Mund, doch just als er etwas sagen wollte, überschrie ihn der Ausguck.
»Ausguck an Decksmannschaft! Ich sehe ein Boot, das vom Fuß des Admiralsturms ablegt. Es hat das königliche Banner gesetzt.«
Im selben Augenblick sah die Schiffsbesatzung Rauchwolken von den zerbombten Küstenwällen der Stadt aufsteigen. Einen Herzschlag später setzte das Krachen der Schüsse ein – ein entfernter, abgehackter Donner.
»Königliche Salutschüsse«‚ stellte der Anführer der Ritter fest, dessen Miene sich sehr aufgehellt hatte. »Die Glaubensritter und Thronräuber hätten uns nie und nimmer mit Salutschüssen begrüßt – eher mit einer Breitseite. Die Stadt gehört den Königstreuen. Kapitän, Ihr solltet Euch darauf vorbereiten, die Gesandten des Königs von Hebrion zu empfangen.«
Die Spannung an Deck ließ spürbar nach und die Seeleute redeten munter durcheinander. Isolla verharrte schweigend; es war der aufmerksame Obermaat, der ihre Gedanken für sie aussprach.
»Also‚ warum das Banner auf Halbmast weht, würde ich schon gern wissen. Eigentlich tun sie das nur, wenn der König …«
Seine Stimme wurde übertönt vom Gepolter bloßer Füße, die über die Decks rannten, als die Besatzung Vorkehrungen traf, das herannahende hebrionische Schiff zu empfangen. Als es sich näherte – eine königliche Barke mit zwanzig Rudern und einer scharlachroten Kanonenbatterie –, erkannte Isolla, dass die gesamte Besatzung Schwarz trug.
»Wie es scheint, ist die edle Dame eingetroffen«, stellte General Mercado fest.
Er stand mit im Rücken verschränkten Händen da und blickte vom Balkon des Königs auf die Welt hinunter. Die gesamte Unterstadt war seiner Obhut anvertraut, ebenso die großen Buchten, die Abrusios Häfen bildeten, sowie die seewärtigen Befestigungsanlagen, die sich entlang der Buchten verteilten.
»Was, um alles in der Welt, sollen wir jetzt tun, Golophin?«
In der Düsternis des spärlich erhellten Zimmers, dort, wohin das Licht vom offenen Balkon aus nicht reichte, ertönte ein Rascheln. Eine hagere Gestalt löste sich geräuschlos aus den Schatten und gesellte sich zum General. Sie war dürrer, als ein lebendes Wesen eigentlich sein konnte – eine wie aus Pergament, Stöcken und angenagten Lederfetzen erschaffene Kreatur, haarlos und knochenbleich. Der lange Mantel, den die Erscheinung trug, schien sie förmlich zu überschwemmen. Doch aus dem zerschundenen Antlitz leuchteten zwei strahlende Augen, und als der Mann sprach, klang seine Stimme tief und melodisch, als wäre sie das Lachen und Singen gewöhnt.
»Wir spielen auf Zeit, was sonst? Ein angemessener Empfang, eine angemessene Unterkunft und striktes Stillschweigen über den Gesundheitszustand des Königs.«
»Die ganze Stadt ist in Trauer. Ich wette, die Bevölkerung hält den König bereits für tot«‚ herrschte Mercado ihn an. Eine Hälfte seines Gesichts hatte sich zu einer Grimasse verzogen, die andere präsentierte sich als ernste, starre silberne Maske, die sich nie veränderte, kein einziges Mal in all den Jahren, seit Golophin sie eingepflanzt hatte, um dem General das Leben zu retten. Der Augapfel auf der silbrigen Seite glarte blutunterlaufen und lidlos, ein furchterregend Ding, das Mercados Untergebene stets einschüchterte. Den Mann aber, der die Maske geschaffen hatte, konnte sie nicht einschüchtern.
»Ich kenne Isolla, zumindest kannte ich sie«‚ entgegnete Golophin in ebenso barschem Tonfall. »Sie ist ein einfühlsames Kind – mittlerweile wohl eher eine Frau. Wichtig ist auch, dass sie viel Verstand besitzt und nicht im Handumdrehen in Angst und Schrecken verfällt. Und bei Gott, sie wird tun, was man von ihr verlangt.«
Mercado schien beschwichtigt. Er mied den Blick des leichenblassen Magiers. Stattdessen murmelte er nur: »Und du, Golophin? Wie steht es um dich?«
Auf Golophins Züge legte sich ein überraschend mildes Lächeln. »Ich bin wie die alte Hure, die ihre Beine zu oft breitgemacht hat. Ich fühle mich wund und müde, General. Weder für Mensch noch für Tier von großem Nutzen.«
Mercado schnaubte verächtlich. »So weit kommt’s noch.«
Gemeinsam wandten sie sich vom Balkon ab und kehrten zurück in die Tiefe des Zimmers – das königliche Schlafgemach, mit schweren, in der Düsternis kaum zu erkennenden Wandteppichen behangen, mit Läufern aus Ridawan und Calmar auf dem Boden und erfüllt von süßen Weihrauchdüften aus der Levangore. Und auf einem riesigen Himmelbett lag eine ausgemergelte Gestalt zwischen den Seidenlaken. Schweigend standen sie vor ihm.
Abeleyn, König von Hebrion – oder was von ihm geblieben war. Just im Augenblick des Sieges, als er Abrusio wieder in Händen und das Königreich vor einer grausamen Herrschaft der Kirche gerettet hatte, streckte ein Geschoss ihn nieder. Es war wohl einer Laune der älteren Götter zuzuschreiben, dass es so gekommen war, ging es Golophin durch den Kopf. Keine Spur von der sogenannten Gnade und dem Mitgefühl der ramusischen Gottheit. Abeleyns derzeitiger Zustand – ein Dahinvegetieren zwischen Tod und Leben – war wie ein blanker Hohn des Schicksals.
Der König hatte beide Beine verloren und die Stummel oberhalb der Stümpfe waren zerschunden und gebrochen, ein Gewirr grässlicher Wunden und zerschmetterter Knochen. Das einst knabenhafte Antlitz wirkte wächsern, die Lippen schimmerten blau und der schwache Atem ging pfeifend und angestrengt, aber regelmäßig. Zumindest das Augenlicht war ihm geblieben. Und noch lebte er.
»Beim gütigen Heiligen, ich hätte nie gedacht, je miterleben zu müssen, dass ihm so etwas widerfährt«, flüsterte Mercado heiser und Golophin hörte in der Stimme des harten, alten Soldaten einen Beiklang, der ihn verdächtig an ein Schluchzen erinnerte. »Kannst du denn gar nichts tun, Golophin? Überhaupt nichts?«
Der Zauberer stieß einen seltsamen Seufzer aus. Es war, als würde damit ein Teil seiner Lebenskraft entweichen.
»Ich halte seine Atmung in Gang. Mehr kann ich nicht tun. Mir fehlt die Kraft. Ich muss den Dweomer in mir wieder heranwachsen lassen. Der Tod meines Hausgeistes, die Schlachten: Das alles hat mich ausgesogen. Es tut mir leid, General. Unsagbar leid. Er ist auch mein Freund.«
Mercado straffte die Schultern. »Selbstverständlich. Verzeih. Ich führe mich auf wie eine alte Jungfer. Wir haben keine Zeit für Jammer und Klagen, Händeringen und Zähneknirschen, nicht in Zeiten wie diesen … Wo hast du seine Geliebte untergebracht, diese Schlampe?«
»In den Gästegemächern, wo sie unentwegt danach schreit, ihn zu sehen. Sie steht unter Bewachung – zu ihrem eigenen Schutz natürlich.«
»Sie trägt sein Kind im Leib«‚ brummte Mercado grimmig.
»Anscheinend. Wir müssen sie genau im Auge behalten.«
»Verfluchte Weiber«, fuhr Mercado fort. »Und jetzt haben wir noch eine hier, die wir verhätscheln und umsorgen dürfen.«
»Isolla ist anders, wie ich schon sagte. Und sie ist Marks Schwester. Das Bündnis zwischen Hebrion und Astarak muss durch ihre Heirat besiegelt werden. Zum Wohle des Königreichs.«
Mercado prustete verächtlich. »Heirat! Und wann wird die wohl stattfinden? Soll sie etwa einen …« Jäh verstummte er und neigte das Haupt; Golophin hörte, wie Mercado leise fluchte und sich selbst verdammte. »Ich habe ein paar Dinge zu erledigen«‚ meinte er plötzlich. »Sehr viele Dinge sogar, bei Gott. Lass mich wissen, falls eine Veränderung eintritt, Golophin.« Damit stapfte er davon, als müsste er vors Kriegsgericht.
Golophin setzte sich auf die Bettkante und ergriff die Hand seines Königs. Die Züge des Magiers verwandelten sich in die eines grässlichen Totenschädels; Zorn und Hass huschten über sein Antlitz; dann blinzelte er und die Wut wich unaussprechlicher Erschöpfung.
»Besser, du wärst gestorben, Abeleyn«, murmelte er sanft. »Der Letzte der Kriegerkönige hätte sich das Ende eines Kriegers verdient. Wenn du erst fort bist, werden all die Mickerlinge unter den Steinen hervorkriechen.«
Und er neigte den Kopf und weinte.
Zwei
Bei Gott, dachte Corfe, der Mann hat gewusst, wie man Pferde züchtet.
Das Ross war dunkelbraun, fast schwarz und gute siebzehneinhalb Hände hoch. Ein Tier mit gewaltiger Brust, kräftigem Hals, lebhaften Augen und geraden Beinen. Ein wahres Schlachtross, wie es sonst nur Adelige ritten. Und er besaß Hunderte solcher Tiere, allesamt Wallache und alle drei Jahre oder älter. Ein Vermögen aus Knorpel, Knochen und Muskeln – aber, noch wichtiger, die Grundvoraussetzung für eine Armee der Reiterei.
Corfes Männer lagerten auf den Weiden eines der Gestüte des kürzlich verstorbenen Herzogs Ordinac. Mehr als zehntausend Quadratmeter hatten die vierhundert Stammeskrieger, die unter Corfes Kommando verblieben waren, mit Lederzelten verbaut, die in vereinzelten Grüppchen angeordnet waren; auch die Zelte stammten aus dem Besitz des verschiedenen Herzogs. In dem behelfsmäßigen Lager herrschte dermaßen reger Betrieb, dass es an einen eingestürzten Ameisenhaufen erinnerte: Männer und Pferde, Rauch von Kochfeuern, das Klirren von Hämmern auf kleinen Feldambossen, der vertraute und für Corfe überaus belebende Gestank und Tumult in einem Biwak der Reiterei.
Der Wallach tänzelte unter ihm, als würde das Tier spüren, wie Corfes Stimmung sich hob. Er beruhigte ihn mit Stimme und Knien. Im Umkreis von einer halben Meile hatte er in jeder Richtung berittene Wachen aufgestellt und Andruw war mit zwanzig Mann zu einem zweitägigen Erkundungsritt gen Staed unterwegs, wo Herzog Narfintyr gegen den König aufrüstete und bereits dreitausend Mann unter seinem Banner vereint hatte.
Ganz schön trübe Aussichten. Andererseits waren es gewiss Bauernsöhne und niedrige Adelige, Pöbel, den man vorübergehend in Soldaten verwandelt hatte. Kein Vergleich zu den geborenen Kämpfern, die Corfes wilde Stammeskrieger verkörperten. Zudem gab es auf Erden nur sehr wenige Fußtruppen, die einem Angriff schwerer Reiterei die Stirn zu bieten vermochten, wenn er ordentlich geführt wurde. Geübte Pikenstreiter vielleicht; aber das war auch schon alles.
Nein, Corfes schlimmster Feind war die Zeit. Sie zerrann ihm wie Sand zwischen den Fingern; er musste sich sputen, wollte er Narfintyr finden und besiegen, ehe ihm die zweite Armee zuvorkam, die König Lofantyr gen Süden entsandt hatte.
Heute war der dritte der fünf Heiligentage, die Gelehrte dem letzten Monat des Jahres hinzugefügt hatten, um den Kalender in Einklang mit den Jahreszeiten zu bringen. In zwei Tagen war Sidhaon, die Nacht zum Jahresende; danach würde der Kreislauf von Neuem beginnen und sich langsam auf die Wärme und das Wiedererwachen des Frühlings zubewegen.
Der schien längst überfällig. Dies war der längste Winter in Corfes Leben gewesen. Er konnte sich kaum erinnern, wie es war, die warme Sonne auf dem Gesicht zu spüren oder über Gras zu laufen, statt durch Schnee oder Schlamm zu stapfen. Eine höllische und widernatürliche Jahreszeit für Kampfhandlungen, besonders mit Reitersoldaten. Aber schließlich war auch die Welt in letzter Zeit ein höllischer und widernatürlicher Ort geworden; der alte Lauf der Dinge war auf den Kopf gestellt worden.
Corfe dachte über jene zweite Armee nach, die unterwegs nach Süden war, um sich der Rebellen anzunehmen, die zu zerschlagen eigentlich seine Aufgabe war. Einem gewissen Oberst Aras, einem der Lieblinge des Königs, war eine beachtliche gemischte Streitkraft unterstellt worden, mit der er den Adeligen im Süden Vernunft einbläuen sollte, da der König eindeutig erwartet hatte, Corfe würde die Sache mit seiner barbarischen, schlecht ausgerüsteten Truppe verpfuschen. Er hatte sowohl vor als auch hinter sich Feinde und musste sich den Kopf über mehr als bloß Taktik und Fragen des Nachschubs und der Versorgung zerbrechen; er musste in gewisser Weise auch als Politiker handeln. Solche Dinge waren unvermeidlich, wenn man zu einem höheren Rang aufstieg, doch Corfe hätte nie damit gerechnet, dass die Verästelungen und Zugeständnisse so mörderisch sein würden. Nicht in Kriegszeiten. Er hatte den Eindruck, die Hälfte der Offiziere in Torunn wäre mehr darauf bedacht, die Gunst des Königs zu erringen, denn die Merduks aus der Senke von Ormann zurückzuschlagen. Wenn er daran dachte, überkam ihn ein heißer, schwarzer Zorn – eine Wut, die ihren Ursprung im Fall von Aekir hatte und seither beständig und lautlos in seinem Inneren wuchs, ohne jede Hoffnung auf Erlösung. Nur das Töten vermochte diesen Zorn zu mildern, das Töten eines Merduks nach dem anderen, bis zum letzten plärrenden, dunkelhäutigen Säugling – so lange, bis keine dieser Heiden mehr übrig waren und die Welt verpesteten. Dann würden seine Träume vielleicht enden und Herias Geist sich endlich zur Ruhe begeben.
Ein Bote trabte zu ihm und verkündete ohne jeden Gruß: »Ondrow hat zurückgekehrt.«
Corfe nickte dem Mann zu – seine Stammeskrieger schnappten zwar allmählich ein wenig Normannisch auf, wussten aber nach wie vor wenig über angemessene Umgangsformen. Er folgte dem Krieger, als dieser gemächlich den Hügel emporritt, der das Lager beherrschte. Marsch war dort, außerdem Fähnrich Ebro mit drei Wachen. Sogleich vollführte Ebro einen zackigen Salut, den Corfe abwesend erwiderte.
»Wie weit entfernt?«
»Weniger als eine Wegstunde, auf der Straße nach Norden«, berichtete Marsch. Er massierte sich die Stirn, wo der schwere Ferinai-Helm zu reiben begonnen hatte. »Ich glaube, er hat es eilig. Er treibt seine Pferde schier zu Tode.« Marschs Stimme klang missbilligend, als wäre kein Notfall dringend genug, um die Misshandlung von Pferden zu rechtfertigen.
»Also ist er umgekehrt. Ich wette, er hat einen Blick auf unsere Gegner bei diesem Wettstreit geworfen.«
Die Gruppe verharrte und beobachtete, wie die etwa zwanzig Reiter die schlammige Straße nach Norden herangaloppierten und hinter ihnen, Erdklumpen gleich, aufgescheuchte Vögel emporstoben. Zehn Minuten später hatte der Trupp die Pferde gezügelt, deren gerötete Nüstern sich weit blähten und an deren Hals weißer Schaum prangte. Und überall war Schlamm; die Gesichter der Reiter waren damit gesprenkelt.
»Was gibt es Neues, Andruw?«, fragte Corfe gelassen, wenngleich sein Herz heftiger zu pochen begonnen hatte.
»Narfintyr hockt in Staed wie ein altes Weib am Herd. Seine Männer sind Bauerntölpel und ein paar Adelige in fünfzig Jahre alten Rüstungen. Bislang hat sich keiner der anderen Adelsherren erhoben – sie warten ab, ob Narfintyr damit durchkommt. Sie haben zwar von Ordinacs Schicksal gehört, aber niemand hält uns für ordentliche torunnische Truppen. Es wird gemunkelt, Ordinac wäre mit einer Bande kampflüsterner Abtrünniger und Aasgeier der Merduks zusammengestoßen.«
Corfe lachte auf. »Kann man ihnen nicht verübeln. Und wie stehen die Dinge im Norden?«
»Ah, jetzt kommt der interessante Teil. Aras und seine Kolonne sind bereits nahe – weniger als einen Tagesmarsch hinter uns. Fast dreitausend Mann, fünfhundert davon beritten … Kürassiere und Pistolenschützen. Und sechs leichte Kanonen. Die Vorhut bildet ein Reitereischutzschirm.«
»Haben sie dich gesehen?«, wollte Corfe wissen.
»Völlig ausgeschlossen. Wir sind auf den Bäuchen gerobbt und haben sie von einem Hügelkamm aus beobachtet. Der ganze Tross kann sich nur so schnell bewegen wie Kanonenwagen und Gepäckkarren, und die Straße gleicht einem Sumpf. Ich wette, die verfluchen ihre Kulverinen schon den ganzen Weg seit Torunna.«
Corfe grinste. »Du hörst dich mehr und mehr wie ein Reitereisoldat an, Andruw.«
»Aye. Na ja, es ist eine Sache, Kanonen abzufeuern, aber eine ganz andere, sie durch einen Sumpf zu zerren. Was tun wir jetzt, Corfe?«
Alle schauten ihn an. Plötzlich erfüllte eine Spannung die Luft, die Corfe kannte und zu lieben gelernt hatte.
»Wir packen und ziehen unverzüglich los«‚ erwiderte er forsch. »Marsch, kümmere dich darum. In der Vorhut will ich eine Schwadron als Schutz. Du wirst sie befehligen. Außerdem brauche ich eine weitere Schwadron, die unsere Ersatzpferde treibt, und eine dritte als Nachhut unter Andruws Befehl. Die Vorhutschwadron bricht auf, sobald sie gesattelt hat. Der Rest folgt so rasch wie möglich. Meine Herren, ich glaube, auf uns wartet Arbeit.«
Die kleine Gruppe löste sich auf. Andruws Mannen steuerten auf die Pferdeherde zu, um frische Tiere auszufassen. Nur Ebro verharrte neben Corfe.
»Und was soll ich tun, Herr?«, fragte er, halb ärgerlich, halb kläglich.
»Kümmere dich um die Packesel. Ich will, dass sie binnen zwei Stunden zum Aufbruch bereitstehen. Lad so viel auf, wie du kannst, aber übertreibe es nicht. Wir müssen uns schnell bewegen.«
»Herr‚ Narfintyr hat dreitausend Mann. Wir sind kaum vierhundert. Sollten wir nicht lieber warten, bis Aras eintrifft, und uns mit ihm zusammentun?«
Corfe bedachte seinen Untergebenen mit einem stechenden, kalten Blick. »Hast du denn gar kein Verlangen nach Ruhm, Fähnrich? Du hast deine Befehle erhalten.«
»Jawohl, Herr.«
Damit galoppierte Ebro davon, wobei er zutiefst unzufrieden wirkte.
Das geordnete Gefüge des Lagers fiel in sich zusammen, als die Offiziere umherritten und Befehle brüllten, die Stammeskrieger hastig die Rüstungen anlegten und die Pferde sattelten. Marsch hatte in der Burg des jüngst verblichenen Herzogs Ordinac ein Lager voller Lanzen entdeckt und die Soldaten rannten los, um die ihren aus dem Ständerwald zu holen, der zwischen den Zelten wucherte. Die Zelte selbst wurden zurückgelassen, da sie zu schwer für die Packesel waren, die Corfes Gepäckzug bildeten. Die sturen, plärrenden Viecher hatten auch so genug zu tragen: einen Wochenvorrat Futter für tausend Pferde, die Feldschmiedeöfen mit den kleinen Ambossen und klirrenden Werkzeugen, dazu Rohmetall zum Schmieden zusätzlicher Hufeisen, Lanzen, Waffen und Rüstungen und nicht zuletzt die sperrigen Kisten und Fässer mit den Vorräten, von denen die Männer auf dem Marsch zehren würden: vor allem doppelt gebackenes, steinhartes Brot und Pökelfleisch. Außerdem wurde für jede Schwadron ein großer Kessel mitgeführt, in dem das Schweinefleisch aufgeweicht und gekocht wurde. Tausenderlei Dinge für eine Armee, die kaum groß genug war, um überhaupt als Armee zu gelten. Für gewöhnlich verfügte eine Feldstreitkraft über einen schweren, doppelachsigen Ochsenkarren für je fünfzig Mann; bei der Reiterei und der Artillerie waren es doppelt so viele. Corfes zweihundert Tiere umfassender Maultiertross bot ein zwar eindrucksvolles Bild, konnte nach militärischen Maßstäben aber nur unbedeutende Mengen befördern.
Die Vorhut brach noch zur gleichen Stunde auf; der Haupttruppenkörper folgte eine Stunde später. Gegen Mittag wurde das Lager, das sie zurückgelassen hatten, nur noch von Geistern und ein paar räudigen Hunden bevölkert, die auf der Suche nach Essensresten oder Leder zum Kauen zwischen den Zelten umherstreiften. Der Wettlauf hatte begonnen.
In den Vorgebirgen der nördlichen Berge von Cimbric waren die Winter rauer als im Flachland von Torunna. Hier glich die Welt einem grausamen Ort von mörderischer Pracht und Gewalt. Die Berge von Cimbric ragten zwar immer noch dreieinhalbtausend Meter und mehr auf, schrumpften aber merklich; ihre Grate und Schluchten präsentierten sich deutlich weniger zerklüftet als weiter im Süden. An den Flanken und Hängen wuchsen karge Bäume und Sträucher: winterfeste Kiefern und Fichten, Gebirgswacholder. In diesem Land entsprang der Torrin. Schon hier war er ein reißender, schäumender, an die sechzig Meter breiter Fluss, eine zornige, von der Schneeschmelze genährte Wasserlawine, die zu heftig durch ihr Bett raste, als dass sie hätte gefrieren können. Bis der Torrin sich in den majestätischen, friedlichen Strom verwandelte, der gemächlich durch die Stadt Torunn floss und noch weiter flussabwärts in die wärmeren Gewässer der Kardischen See mündete, hatte er noch gut hundertfünfzig Wegstunden zurückzulegen.
Hier aber hatte er in den Tausenden und Abertausenden Jahren seiner Existenz die Berge, die ihn umgaben, zernagt und zerfressen, sich inmitten der Gipfel ein Tal gegraben. Im Norden waren die letzten Anhöhen der westlichen Berge von Thurian zu erblicken, jener felsigen Sperre, die den Horden aus Ostrabar Einhalt gebot, sodass diese Krieger in den Jahrzehnten ihrer Einmärsche immer wieder gezwungen waren, einen Weg entlang der Küste einzuschlagen, um nach Süden auszuweichen, wo sie sich den Mauern von Aekir, den Kanonen der Feste von Ormann gegenübersahen. Im Südwesten des Flusses thronten die Berge von Cimbric, Torunnas Rückgrat, Heimat der felimbrischen Stämme und ihrer geheimen Täler. Diese Schlucht jedoch, gegraben vom Lauf des Torrin, stellte seit Jahrhunderten die Verbindung zwischen Torunna und Charibon dar, von Westen nach Osten. In den Tagen des fimbrischen Kaiserreichs hatte sie kaiserlichen Boten als Schnellstraße gedient. Damals war Charibon selbst lediglich eine bemannte Festung gewesen, erbaut, um die Straße vor den Barbaren Almarks zu schützen. Zudem war sie ein Handelskanal gewesen und zuletzt von den Torunnen befestigt worden, als die fimbrische Herrschaft zerbrach und die Menschen erstmals im Namen Gottes töteten. Und nun marschierte hier eine Armee, ein Infanterietrupp schwarz gekleideter Soldaten mit sechs Meter langen Piken oder Hakenbüchsen in Lederfutteralen. Eine Große Hundertschaft fimbrischer Soldaten, fünftausend der gefürchtetsten Krieger der Welt, die durch die Schneestürme und Wechten auf die Senke von Ormann zumarschierten.
Er hörte die Laute, vermochte sie jedoch nicht einzuordnen. Es war ein Geräusch, wie er es nie zuvor gehört hatte – lauter als das Knirschen des Schnees oder das Knarren von Holz und Leder, lauter sogar als das Klirren von Metall auf Metall.
Füße. Zehntausend Füße, die gemeinsam durch den Schnee stapften und dabei ein dumpfes Donnergrollen hervorriefen, das man mehr spürte als hörte: ein Kribbeln in den Knochen.
Albrec schlug die Augen auf und stellte fest, dass er noch lebte.
Anfangs lähmte ihn tiefste Verwirrung. Nichts um ihn herum wirkte vertraut. Er befand sich im Inneren von irgendetwas, das schaukelte, rumpelte und schlingerte. Über ihm war ein Baldachin aus Leder, durch den an ein paar Stellen unerträglich grelle Lichtlanzen stießen. Schwere Felle bedeckten seinen Körper, sodass er sich kaum zu rühren vermochte. Sein Verstand war völlig leer. Er konnte sich an keinerlei Ereignisse erinnern, die zu seiner derzeitigen, rätselhafte Lage geführt haben mochten.
Schließlich setzte er sich auf. Als sein Kopf vor grellem Licht und Schmerz zu bersten schien, presste er die Augen krampfhaft zu. Mühsam wand er einen Arm frei, um sich das Gesicht zu reiben – irgendetwas daran erschien ihm seltsam, die Art und Weise, wie sein Atem pfiff –, und die Hand, die unter den Fellen hervorkam, war in saubere Leinenverbände gewickelt. Doch sie wirkte eigenartig, gestaltlos. Sie war …
Er blinzelte Tränen aus den Augen und versuchte, die Finger zu beugen. Aber das konnte er nicht. Da waren keine Finger mehr. Nur noch ein Daumen, doch von den Knöcheln aufwärts war nichts mehr. Nichts.
»Großer Gott!«‚ flüsterte er.
Hastig wand er die andere Hand frei. Auch sie war in Leinen gewickelt, doch da waren noch Finger, den gütigen Heiligen sei Dank. Etwas, das er bewegen, womit er berühren konnte. Sie juckten, als er sie vorsichtig krümmte, so als kehrten sie eben erst nach langem Schlaf ins Leben zurück.
Behutsam betastete er sein Gesicht, wobei er sinnloserweise die Augen schloss, als wollte er nicht sehen, was seine forschenden Finger ihm erzählen würden. Er fühlte die Lippen, das Kinn, die Zähne, die Augen. Aber …
Der Atem pfiff hörbar durch das Loch, wo einst seine Nase gewesen war. Er fühlte Knochen. Der fleischige Teil der Nase war verschwunden, ebenso die Nasenlöcher. Es musste aussehen wie das klaffende Loch in der Fratze eines Totenschädels.
Kraftlos sank er zurück, zu bestürzt, um zu weinen, zu verwirrt, um sich zu fragen, was geschehen sein mochte. Er besann sich nur der bruchstückhaften Schrecken eines weit entfernten Traumlandes. Das fängebewehrte Grinsen eines Werwolfs. Die Finsternis unterirdischer Katakomben. Die entsetzliche Leere eines Schneesturms. Dann nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Außer …
Avila.
Plötzlich kehrte alles mit der Gewalt einer Offenbarung zurück. Sie waren auf der Flucht aus Charibon. Das Schriftstück! Hektisch betastete er seine Kleider. Aber seine Kutte war verschwunden. Er war in einen weiten Wollkittel und lange Strümpfe gekleidet, ebenfalls aus Wolle. Entschlossen schüttelte er die Felle ab und kroch darüber, wobei er ins Wanken geriet, als das Gefährt, in dem er sich befand, schaukelte und rumpelte. Er fingerte an den Knoten, die das Lederverdeck zu seinen Füßen verschlossen hielten. Schließlich setzten die Tränen gleichzeitig mit der Erkenntnis ein, was geschehen war. Avila und er waren von den Mönchen des Ordens vom Ersten Tage ergriffen worden. Gewiss waren sie unterwegs zurück in die Klosterstadt. Man würde ihn und Avila als Ketzer verbrennen. Und das Schriftstück war verschwunden. Verschwunden!
Das Verdeck öffnete sich, als er mit der befingerten Hand an den Kordeln riss, und er stürzte mit dem Gesicht voraus in den zerfurchten Schnee.
Krampfhaft presste er die Augen zu. Auf der Wange spürte er warmen Atem und etwas Seidenweiches beschnupperte sein zerstörtes Antlitz.
»Weg da, Mistvieh!« knurrte eine Stimme; Schnee knirschte neben ihm. Albrec schlug die Augen auf und sah eine schwarze, über ihn gebeugte Gestalt, dahinter das schmerzlich grelle, auf dem weißen Schnee blendende Sonnenlicht.
Ein weiterer Schatten. Die beiden Schemen verfestigten sich zu den Gestalten zweier Männer, die Albrecs Arme ergriffen und ihn auf die Beine zerrten. Verstört wie eine Eule in hellem Tageslicht verharrte er.
»Komm weiter, Priester. Du hältst die ganze Kolonne auf«, brummte einer der beiden barsch. Dann versuchten sie, Albrec in den geschlossenen Karren zurückzuheben, in dem er zuvor gewesen war und den er nun zum ersten Mal sah. Hinter dem ersten Karren rumpelte noch einer über den Boden, gezogen von einem neugierigen Maultier; dahinter folgten hundert weitere sowie an die tausend Männer, deren in Rängen angeordnete Gestalten im Schnee eine dunkle Schlange bildeten, allesamt mit Piken an den Schultern.
Ein riesiger Menschenauflauf, der im Schnee stand und wartete, bis das Hindernis beseitigt war und der Karren weiterrollte.
»Wer seid ihr?«, fragte Albrec mit matter Stimme. »Was ist das hier?«
Die Männer hoben ihn hinten auf den zweirädrigen Karren; dann verschwand einer der beiden, um den Halfter des Maultiers zu ergreifen. Der Karren rollte wieder an. Die Kolonne bewegte sich weiter. Zwischenzeitlich hatte es kein Getuschel gegeben, kein Geschrei ob der Unterbrechung, nur Geduld und nüchternen Gehorsam. Albrec sah, dass der zweite Mann, der ihm geholfen hatte, ebenso wie der erste in kniehohe, fellgefütterte Stiefel und einen schwarzen Mantel gekleidet war, der mit der Kapuze und den geschlitzten Ärmeln beinahe wie das Gewand eines Geistlichen anmutete. Von einem Schulterwehrgehenk hing ein schlichtes Kurzschwert. Am Geschirr des Maultiers, das der Mann führte, war eine Hakenbüchse angebracht, deren eherner Lauf in der Sonne grell wie ein Blitz funkelte; daneben hingen ein kleiner stählerner Helm und ein Paar schwarz bemalter Metallhandschuhe. Der Mann selbst hatte kurz geschorenes Haar und wirkte unter dem Mantel breit und kräftig gebaut. Auf seinem Kinn glitzerten die Stoppel eines mehrere Tage alten Bartes und sein Gesicht war gerötet und von den Tagen und Wochen im Freien gebräunt.
»Wer seid ihr?«, fragte Albrec noch einmal.
»Mein Name ist Joshelin von Gaderia, sechsundzwanzigste Hundertschaft. Beltrans Hundertschaft.«
Weitere Einzelheiten blieben aus; offenbar glaubte der Mann, Albrecs Fragen damit beantwortet zu haben.
»Aber was seid ihr?«, hakte Albrec kläglich nach.
Der Mann namens Joshelin funkelte ihn an. »Was soll das werden? Ein Rätselspiel?«
»Verzeiht, aber seid Ihr ein Soldat aus Almark? Ein … ein Söldner?«
Zorn loderte in den Augen des Mannes auf. »Ich bin fimbrischer Soldat, Priester, und du befindest dich inmitten einer fimbrischen Armee. Also würde ich an deiner Stelle mit Begriffen wie ›Söldner‹ sehr vorsichtig umgehen.«
Albrecs Verblüffung musste ihm ins Gesicht geschrieben stehen, denn der Soldat fuhr merklich weniger schroff fort: »Vier Tage ist es her, seit wir euch aufgelesen und vor den Wölfen und dem Erfrieren gerettet haben – dich und den anderen Geistlichen. Er war weniger übel zugerichtet als du. Zumindest hat er noch ein Gesicht. Bloß ein paar Zehen und die Ohrläppchen sind ihm abgefroren.«
»Avila!«, rief Albrec voller Freude aus. Sogleich wollte er wieder vom Karren klettern, doch Joshelins hornige Handfläche legte sich auf Albrecs Brust, hielt ihn zurück.
»Er schläft, so wie du zuvor. Warte, bis er zu sich gekommen ist.«
»Wohin sind wir unterwegs, wenn nicht nach Charibon? Wieso marschieren die Fimbrier wieder?« Albrec hatte in Charibon zwar Gerüchte über derlei Dinge gehört, sie jedoch als Hirngespinste der Novizen abgetan.
»Wie es scheint, sollen wir die Feste von Ormann verstärken«, erwiderte Joshelin kurz angebunden und spuckte in den Schnee. »Die Festung, die wir selbst errichtet haben. Wir sollen den Schild dort wieder aufheben, wo wir ihn vor all den Jahren abgestellt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass uns kaum Dank dafür entgegengebracht wird. In dieser Welt traut man uns etwa ebenso weit über den Weg wie dem Orden vom Ersten Tag. Aber immerhin ist es eine Gelegenheit, wieder mal gegen die Heiden zu kämpfen.« Verkniffen schloss er den Mund, als fürchtete er, ins Plappern zu geraten.
»Die Feste von Ormann«, wiederholte Albrec laut. Der Name barg Geschichte und Legenden. Die große Festung im Osten, die noch nie im Sturm erobert worden war. Sie befand sich im nördlichen Torunna.
Sie marschierten gen Torunna!
»Ich muss mit jemandem sprechen«, sagte Albrec. »Ich muss wissen, was aus unseren Habseligkeiten geworden ist. Es ist wichtig.«
»Hast wohl was verloren, Priester, wie?«
»Ja. Ich sage doch, es ist wichtig. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie wichtig. Ein Schriftstück.«
Joshelin zuckte mit den Schultern. »Davon weiß ich nichts. Siward und mir wurde aufgetragen, uns um euch beide zu kümmern, das ist alles. Ich glaube, eure Kutten hat man verbrannt … sie haben nichts mehr getaugt.«
»O Gott!«, stöhnte Albrec.
»Was ist es denn? Eine Reliquie oder so etwas? Oder waren Juwelen in deine Kutte eingenäht?«
»Es war eine Geschichte«, entgegnete Albrec, dessen Augen brannten. »Es war bloß eine Geschichte.«
Dann kroch er zurück in die Finsternis des verhüllten Karrens.
Die Fimbrier marschierten bis spät in die Nacht. Als sie schließlich hielten, verteilten sie sich auf einem vertieft liegenden Platz, die Gepäckwagen und Maultiere in der Mitte. Angespitzte Pfähle wurden in den Boden gerammt, um einen scharfdornigen Zaun rings um das Lager zu errichten, und einzelnen Soldaten wurden befohlen, außerhalb der Umzäunung Feuerholz zu sammeln. Man reichte Albrec einen Soldatenmantel und Stiefel – beides viel zu groß für ihn – und setzte ihn vor ein Feuer. Joshelin warf ihm Zwieback, harten Käse und einen Weinbeutel zu; dann stapfte er davon, um seine Wache anzutreten.
Der Wind frischte auf und drückte die Flammen des Feuers nieder. Ringsum in der Dunkelheit woben weitere Feuer eine glutgepunktete Steppdecke über die schneebedeckte Erde und an jedem Horizont war die überwältigende Macht der Berge zu spüren, Ehrfurcht gebietende Riesen, durch deren Gipfel die Wolken wie schwebende Wollknäuel trieben und zerfransten. Vom gelegentlichen Schrei eines Maultiers abgesehen, herrschte eine beinahe gespenstische Stille im fimbrischen Lager. Einige Männer rings um die Feuer unterhielten sich mit leiser Stimme, während die Rationen verteilt wurden; die meisten aber aßen nur, wickelten sich in die dicken Mäntel und schliefen ein. Albrec fragte sich, wie sie das alles durchhielten: den anstrengenden Marsch, die kurze, gemeinsame abendliche Mahlzeit, den unbequemen Schlaf auf gefrorener Erde ohne jede Unterlage für den Kopf. In gewisser Weise flößte die Härte dieser Männer Albrec Furcht ein. Natürlich hatte er schon früher Soldaten gesehen, die almarkische Garnison in Charibon und die Glaubensritter. Diese Fimbrier jedoch waren mehr als das. Ihre Enthaltsamkeit besaß etwas beinahe Mönchisches. Er wagte gar nicht erst, sich auszumalen, wie diese Männer sich im Kampf bewähren würden.
»Wie ich sehe, hängst du wie üblich am Weinbeutel«, meinte eine Stimme, und Albrec wandte sich vom Feuer ab.
»Avila!«
Sein Freund war einst der bestaussehende Bruder vom Ersten Tage in Charibon gewesen. Seine Züge waren zwar immer noch fein geschnitten, doch wirkte sein Antlitz nunmehr ausgemergelt und abgespannt, trotz des Lächelns, das darauf lag. Irgendetwas war aus seinem Inneren herausgerissen worden – sein gewohnter Überschwang oder gar ein Teil seiner Jugend. Wie ein Greis humpelte er herbei und ließ sich unbeholfen und schwerfällig neben seinem Freund nieder. Wie Albrec war auch Avila in den Übermantel eines Soldaten gehüllt und seine Füße waren verbunden.
»Schön, dich zu sehen, Albrec.« Und dann, als der Schein des Feuers das Gesicht des kleinwüchsigen Mönchs erhellte: »Gütiger Gott im Himmel! Was ist denn mit dir geschehen?«
Albrec zuckte die Schultern. »Erfrierungen. Wie’s scheint, hattest du mehr Glück als ich. Nur ein paar Zehen, nicht wahr?«
»Mein Gott!«
»Das ist nicht weiter wichtig. Es ist schließlich nicht so, als hätten wir eine Frau oder ein Liebchen. Avila, weißt du, wo und bei wem wir sind?«
Avila starrte den Freund immer noch an und Albrec brachte es nicht über sich, seinem Gegenüber in die Augen zu blicken. Er verspürte das beinahe übermächtige Verlangen, mit der Hand das Gesicht zu bedecken, wehrte sich jedoch dagegen und reichte seinem Freund stattdessen den Weinbeutel. »Da. Du siehst aus, als könntest du’s gebrauchen.«
»Tut mir leid, Albrec.« Avila trank einen langen Schluck, wobei er die Finger in die Seiten des Beutels drückte, dass der Wein ihm tief in die Kehle spritzte. Er trank, bis ihm das dunkle Nass die Mundwinkel hinunterrann; dann zwang er noch mehr Wein in sich hinein. Schließlich wischte er sich den Mund ab.
»Fimbrier. Anscheinend sind unsere Retter Fimbrier. Und sie marschieren zur Feste von Ormann.«
»Ja. Aber ich habe es verloren, Avila. Ich meine … sie haben es genommen – das Schriftstück. Nichts anderes zählt mehr.«
Avila betrachtete seine Hände, die den Weinschlauch umfassten. An manchen Stellen schälte sich die Haut, und die Handrücken waren entzündet.
»Kälte«, murmelte er. »Ich hatte ja keine Ahnung. Sieht aus wie das, was man uns über die Lepra erzählt hat.«
»Avila!«, zischte Albrec.
»Das Schriftstück, ich weiß. Nun, es ist verschwunden. Aber wir leben noch, Albrec, und werden vielleicht doch nicht verbrannt. Danke Gott wenigstens dafür.«
»Und die Wahrheit wird im Dunkeln bleiben.«
»Besser die Wahrheit als ich, um ehrlich zu sein.«
Avila mied den finsteren Blick seines Freundes. Irgendetwas in seinem Inneren schien erschreckt und eingeschüchtert von dem, was sie durchgemacht hatten. Albrec hätte den Freund am liebsten beim Kragen gepackt und geschüttelt.
»Schon gut«, meinte der Bruder vom Ersten Tage mit einem schiefen Lächeln. »Ich bin sicher, ich komme darüber hinweg … über diesen Wunsch zu leben.«
Rings um sie hockten Soldaten am Feuer, die ihnen jedoch keinerlei Beachtung schenkten und so taten, als gäbe es sie gar nicht. Die meisten schliefen; aber im nächsten Augenblick rappelten sich jene auf, die wach waren, und verharrten unbewegt wie Statuen. Albrec und Avila schauten auf und erblickten einen Mann mit einer scharlachroten Schärpe um die Taille, der im Kittel eines gemeinen Soldaten neben ihnen stand. Der Fremde hatte einen Schnurrbart, dessen Enden tief herabhingen und der im Schein des Feuers rotgolden leuchtete.
»Rührt euch«, brummte er seinen Männern zu, worauf diese wieder zu Boden sanken. Dann setzte der Neuankömmling sich mit untergeschlagenen Beinen neben die beiden Mönche ans Feuer.
»Darf ich euch um einen Schluck Wein bitten?«, fragte er.
Da Avila und Albrec die Worte fehlten, starrten sie den Fremden bloß an. Endlich rührte sich Avila und sagte in seinem besten, aristokratischen, frostigen Tonfall: »Wenn es denn sein muss, Soldat. Vielleicht lässt du uns dann in Ruhe. Mein Freund und ich haben sehr wichtige Dinge zu besprechen.«
Der Mann trank ausgiebig aus dem ihm dargereichten Weinbeutel und wischte sich die Tropfen aus dem Schnurrbart. »Wie fühlt ihr euch?«
»Besser«, antwortete Avila, noch immer hochmütig, durch und durch der Bruder vom Ersten Tage, der mit einem minderen Waffenträger sprach. »Darf ich fragen, wer du bist?«