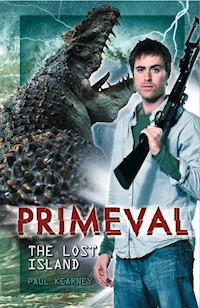4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Königreiche Gottes
- Sprache: Deutsch
Seit den erbitterten Kämpfen gegen die Merduks im Eisernen Krieg sind 17 Jahre vergangen. Mittlerweile sind die Menschen aus dem Osten mit den einstigen Feinden durch einen gemeinsamen Glauben vereint und mit den Bürgern Torunnas durch ein zartes Band der Freundschaft verbunden. Die Hochzeit der Kinder aus den beiden Königreichen soll die guten Beziehungen weiter festigen.
Doch neues Unheil braut sich zusammen und bedroht den gewonnenen Frieden. Das zweite Imperium um die himerianische Kirche setzt zur Eroberung von ganz Normannien an. Seit vor sechs Jahren Aruan, der mächtige Magier, aus dem Westen kam und von Pontifex Himerius als neue wichtige Figur des Glaubens in die himerianische Kirche etabliert wurde, bereitet sich diese neue Macht nachhaltig darauf vor, die bekannte Welt mit Waffen und Magie gänzlich zu unterwerfen. Die Herrscher von Hebrion, Astarak und Torunna schließen ein letztes Bündnis zur Verteidigung. Doch was können einfache Menschen gegen eine Armee, die aus bizarren, mit Magie neu gezüchteten Wesen besteht, schon ausrichten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Teil I. Der Untergang Hebrions
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Teil II. Der Soldatenkönig
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Teil III. Einbruch der Dunkelheit
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Epilog
Paul Kearney
Die Königreiche Gottes 5
Der letzte Sturm
Ins Deutsche übertragen von Michael Krug
Prolog
Richard Hawkwood rappelte sich aus der Gosse auf und bahnte sich ungestüm einen Weg durch die jubelnden Massen. Dabei trat er auf Füße, teilte nach links und rechts Ellbogenstöße aus und funkelte jeden wild an, der seinem Blick begegnete.
Dummköpfe! Verdammte Rindviecher! Im Schutz eines hohen Hauses fand er eine Art Haff, ein ruhiges Gewässer. Dort hielt er inne, um Atem zu schöpfen. Der Jubel war ohrenbetäubend, der Gestank schier unerträglich: In Massen versammelt, erwies das einfache Volk von Abrusio sich als wenig wohlriechend. Hawkwood wischte sich Schweiß von der Stirn. Gebrüll erhob sich von den Massen und Hufgeklapper erklang von der kopfsteingepflasterten Straße, begleitet von Trompetengeschmetter und im Gleichschritt marschierenden Stiefeln. Hawkwood fuhr sich mit den Fingern durch den Bart. Beim Blute Gottes, er brauchte etwas zu trinken!
Ein paar übermütige Narren warfen Rosenblüten aus den oberen Fenstern von Gebäuden. Hawkwood erhaschte durch die Menschenmenge nur einen flüchtigen Blick auf die offene Kalesche, das silbrige Glitzern auf dem grauen Haupt der Person, die darin saß, und das kurze Aufleuchten des herrlichen, rotbraunen, mit bernsteinfarbenen Perlen besetzten Haares.
Und dann war es auch schon vorbei. Die Soldaten stapften in der unerbittlichen Hitze weiter, die Kalesche rollte davon und die Hysterie der Massen erlosch wie eine Kerze. Die breite Straße schien sich zu öffnen, als die Mengen sich zerstreuten, und der gewohnte Lärm von Abrusios Unterstadt setzte wieder ein. Hawkwood tastete nach seinem Geldbeutel. Er war noch da, wenngleich verschrumpelt wie die Brüste eines alten Weibes. Ein einsames Münzenpaar drehte sich klimpernd unter seinen Fingern. Immerhin genug für eine Flasche narboskischen Fusel. Man erwartete ihn bald im Rudergänger. Dort kannte man ihn. Hawkwood wischte sich über den Mund und machte sich auf den Weg – eine dürre, ausgezehrte Gestalt in Seemannshosen und im Wams eines Schauermannes, das Gesicht über dem grauen Bart nussbraun. Er war achtundvierzig Jahre alt.
»Siebzehn Jahre«, brummte Milo, der Schankwirt. »Wer hätte gedacht, dass er sich so lange hält? Gott segne ihn.«
Zustimmendes Raunen kam von den Männern, die an den Tischen des Rudergängers hockten, undeutlich zwar, aber herzlich. Hawkwood nippte schweigend an seinem Weinbrand. War es tatsächlich so lange? Auf der einen Seite schienen die Jahre schnell zu verfliegen, auf der anderen Seite schien sich die Zeit, die ihm für Orte wie diesen zur Verfügung stand – die Gegenwart –, schier endlos hinzuziehen. Träge Stimmen; im Sonnenlicht tänzelnder Staub; der im lodernden Herzen eines Weinglases gefangene Sonnenschein des Tages.
Abeleyn IV., Sohn des Bleyn, von Gottes Gnaden König von Hebrion. Wo hatte Hawkwood sich an dem Tag herumgetrieben, als der Knabenkönig gekrönt worden war? Ach ja, natürlich. Auf See. Es waren die Jahre der Blüte Macassars gewesen, als er, Julius Albak, Billerand und Haukal auf den Malacar-Inseln ein hübsches Sümmchen verdient hatten. Er erinnerte sich, wie sie nach Rovenan im Einzugsgebiet der Korsaren gesegelt waren, sämtliche Kanonen ausgefahren, das Deck voller brennender Lunten. Das Gefeilsche, das schließlich grölender Kameradschaft wich, als die Korsaren der Höhe des Wegzolls endlich zustimmten – ehrenwerte Männer, auf ihre Weise.
Das war Leben gewesen, das einzig wahre Leben für einen Mann. Das Stampfen und Knarren eines lebendigen Schiffes unter den Füßen – die ganze weite Welt durchstreifen, ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu sein.
Nun aber hatte Hawkwood kein Verlangen mehr nach weiten, langen Reisen. Im letzten Jahrzehnt hatte das Seemannsleben viel vom einstigen Glanz eingebüßt. Dies einzugestehen, fiel Hawkwood schwer, aber so war es nun einmal.
Er stürzte den miesen Weinbrand hinunter, schüttelte sich und schenkte sich nach. Narboskischer Magentöter. Nach dem heutigen Tag würde er sich als Erstes eine Flasche guten fimbrischen Tropfens kaufen.
Was sollte er mit dem Geld anstellen? Es dürfte ein netter Batzen sein. Vielleicht würde er Galliardo bitten, es für ihn anzulegen. Oder er würde sich einen flotten, gut ausgerüsteten Kutter zulegen und damit in die Levangore aufbrechen. Oder er würde sich den verdammten Korsaren anschließen …
Doch er wusste, dass er nichts von alledem tun würde. Selbsterkenntnis war eine bittere Beigabe der mittleren Jahre des Lebens. Sie brachte die närrischen Träume und Wünsche der Jugend zum Verdorren und hinterließ an ihrer Stelle sogenannte Weisheit. Einer Seele, die es leid war, Fehler zu begehen, schien sie dem Verstand bisweilen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Hawkwood starrte ins Glas und lächelte. Ich werde noch zum versoffenen Philosophen, dachte er.
»Hawkwood? Kapitän Hawkwood?« Eine fleischige, schweißfeuchte Hand schob sich in Hawkwoods Blickfeld. Ohne nachzudenken, schüttelte er sie und verzog das Gesicht ob der klebrigen Feuchtigkeit, die schmatzend an seiner Handfläche zerrte.
»Der bin ich. Ihr seid Grobus, nehme ich an.«
Ein fettleibiger Mann nahm ihm gegenüber Platz. Er roch nach Duftwasser und trug schwere goldene Ringe in den Ohrläppchen. Einen Schritt hinter ihm stand ein weiterer Mann, ein breitschultriger, wachsam blickender Bursche mit Schlägergesicht.
»Hier braucht Ihr keinen Leibwächter, Grobus. Niemand, der nach mir fragt, bekommt hier Ärger.«
»Man kann nie vorsichtig genug sein.« Der fette Mann schnippte dem Schankwirt mit den Fingern zu. »Eine Flasche candelarischen Wein, guter Mann, und zwei Gläser – saubere, wenn’s geht.« Er wischte sich mit einem spitzenbesetzten Taschentuch die Schläfen ab.
»Nun denn, Kapitän, ich glaube, wir könnten zu einer Übereinkunft gelangen. Ich habe mit meinem Teilhaber gesprochen und wir haben uns auf einen angemessenen Betrag geeinigt.« Eine Schriftrolle wurde aus Grobus’ Ärmel hervorgezaubert. »Ich bin überzeugt, Ihr werdet sie als zufriedenstellend betrachten.«
Hawkwood schaute auf die Zahl, die aufs Papier geschrieben war. Seine Miene zeigte keine Regung.
»Das ist ein Scherz.«
»Durchaus nicht. Es ist ein angemessener Preis. Schließlich …«
»Für ein wurmzerfressenes Ruderboot mag es ein angemessener Preis sein, nicht aber für eine Hochseekaracke.«
«Wenn Ihr gestattet, Kapitän, muss ich darauf hinweisen, dass die Osprey seit mittlerweile acht Jahren nicht mehr auch nur in die Nähe der Hochsee gekommen ist. Der gesamte Schiffskörper ist von Teredos durchlöchert, und die meisten Masten und Rahen sind längst verschwunden. Wir reden hier von einem Hafenwrack, vom bloßen Gerüst eines Schiffes.«
»Was habt Ihr mit ihr vor?«, erkundigte sich Hawkwood, der wieder in sein Glas starrte. Er hörte sich müde an. Die Schriftrolle ließ er unberührt auf dem Tisch zwischen ihnen liegen.
»Für die Osprey bleibt nur noch der Abwracker. Das Holz im Innern ist zwar noch heil – die Rippen, die Knie und dergleichen. Trotzdem lohnt es sich nicht, das Schiff zu überholen. Die Abwracker der Marine haben bereits Interesse bekundet.«
Hawkwood hob den Kopf. Sein Blick war leer und ausdruckslos. Der Schankwirt kam mit dem candelarischen Wein, zog den Korken heraus und schenkte zwei Pokale des edlen Tropfens ein. Der Wein der Schiffe, wie man ihn nannte. Grobus nippte und beobachtete Hawkwood mit einer Mischung aus Vorsicht und Verwunderung.
»Dieses Schiff ist über die Grenzen des Wissens sämtlicher Geografen hinausgesegelt«, erwiderte Hawkwood schließlich. »Die Osprey hat in Ländern Anker geworfen, die der Menschheit bis dahin unbekannt waren. Ich werde nicht zulassen, dass man sie abwrackt.«
Grobus wischte sich Wein von der Oberlippe. »Verzeiht, Kapitän, aber Ihr habt keine andere Wahl. Zwar mögen sich unzählige Mythen um die Osprey ranken – und um Euch –, aber Mythen füllen keine leere Börse oder ein Weinglas, was das angeht. Eure Schulden umfassen Unsummen an Anlegegebühren. Nicht einmal Galliardo di Ponera kann Euch mehr helfen. Nehmt Ihr mein Angebot an, könnt Ihr Eure Schulden tilgen und es bleibt noch ein wenig für Euch selbst – für Euren Ruhestand. Das Angebot, das ich Euch unterbreite, ist angemessen und …
»Abgelehnt«, fiel Hawkwood ihm jäh ins Wort und erhob sich. »Tut mir leid, Eure Zeit vergeudet zu haben, Grobus. Die Osprey steht ab sofort nicht mehr zum Verkauf.«
»Kapitän, seid doch vernünftig …«
Doch Hawkwood stapfte bereits aus der Schänke, die Weinflasche in der Hand.
Unzählige Mythen. Das also waren sie? Für Hawkwood waren sie schreckliche Albträume, Bilder, die selbst nach zehn Jahren kaum verblasst waren.
Ein kräftiger Zug aus der Flasche. Hawkwood genoss die Wärme des Alkohols und schloss die Augen. Grundgütiger, wie hatte die Welt sich verändert!
Seine Osprey lag in den Außenstraßen mit Bug und Heck an Ankerbojen vertäut. Es war ein gutes Stück zu rudern, aber zumindest hatte er hier seine Ruhe und das sanfte Wogen der Dünung war für ihn wie ein Wiegenlied. Die vertrauten Gerüche von Teer, Salz, Holz und Meerwasser … Doch sein Schiff war nur noch ein mastloses Gerippe; die Rahen hatte er eine nach der anderen verkaufen müssen, um die Anlegegebühren zu begleichen. Was Hawkwood an Ersparnissen besessen hatte, war vor fünf Jahren durch die Beteiligung an einem gescheiterten Frachtunternehmen verloren gegangen, den Rest hatte Murad erledigt.
Hawkwood dachte zurück an jene entsetzliche Reise im Westen, als er nachts über Murad gewacht hatte. Wie einfach es damals gewesen wäre, ihn zu meucheln! Nun bewegte der zernarbte Adelige sich in einer anderen Welt – der Welt der bedeutenden Persönlichkeiten des Landes, und darin war Hawkwood bloß Staub an seinen Füßen.
Möwen liefen auf dem Deck umher und hatten es mit einer so harten und dicken Schicht Guano überzogen, dass es sich nicht mehr säubern ließ. Hawkwood blickte aus den breiten Fenstern der Heckkabine, in der er saß, und starrte landwärts auf Abrusio. Die von Rauch und Dunst verhangene Stadt zeichnete sich gegen das Meer ab, geschmückt mit Schiffsmasten, gekrönt mit Festungen und Palästen. Hawkwood hob die Flasche und trank auf diese Stadt, diese alte Hure, und legte die Füße auf den schweren, am Boden befestigten Tisch, wobei er das rostige Schwert mit der breiten Klinge klirrend beiseitestieß. Er hatte es wegen der Ratten hier – bisweilen verhielten sie sich aufsässig und unverfroren – und wegen der gelegentlichen Schiffsplünderer, die Ausdauer genug besaßen, so weit herauszurudern, wenngleich es kaum noch etwas zu plündern gab.
Abermals erklang das Scharren auf dem Deck über ihm. Verärgert starrte Hawkwood hinauf, doch ein weiterer Schluck Wein besänftigte seine Nerven. Die Sonne ging unter und verwandelte die Dünung in ein safrangelbes Glitzermeer. Er beobachtete die gemächliche Fahrt einer voll getakelten Handelskaravelle, die mit der schwachen Brise am Steuerbordbug in die Innenstraßen segelte. Bei der Geschwindigkeit würde sie die halbe Nacht brauchen, um den Hafen zu erreichen. Warum hatte der Narr von einem Kapitän nicht seine Lateinersegel gesetzt?
Schritte erklangen auf dem Niedergang. Hawkwood zuckte zusammen, stellte die Flasche ab und griff nach dem Schwert, doch da stand die Tür bereits offen und eine Gestalt mit Mantel und breitkrempigem Hut trat über den Sturmsüll.
»Seid gegrüßt, Kapitän.«
»Wer seid Ihr?«
»Wir sind uns vor Jahren ein paarmal begegnet.« Der Hut wurde gelüpft und enthüllte einen kahlen Schädel sowie zwei dunkle, freundliche Augen in einem elfenbeinblassen Antlitz. »Und einmal kamt Ihr in meinen Turm, um einem gemeinsamen Freund zu helfen.«
Hawkwood sank zurück auf den Stuhl. »Golophin! Jetzt erkenne ich Euch. Die Jahre haben es gut mit Euch gemeint. Ihr seht jünger aus als bei unserer letzten Begegnung.«
Eine buschige Augenbraue hob sich leicht. »Fürwahr. Ah, candelarischer Wein. Darf ich?«
»Wenn es Euch nicht stört, den Flaschenhals mit einem gemeinen Bürgerlichen zu teilen.«
Golophin trank einen Schluck. »Vortrefflich. Freut mich zu sehen, dass Eure Lebensumstände sich nicht in jeder Hinsicht verschlechtert haben, Kapitän.«
»Seid Ihr hier herausgesegelt? Ich habe kein Boot anlegen gehört.«
»Man könnte sagen, ich bin aus eigener Kraft gekommen.«
»Neben dem Schott hinter Euch ist ein Stuhl. Ihr verrenkt Euch am Ende noch den Hals, wenn Ihr länger so krumm dasteht.«
»Habt Dank. Die Eingeweide von Schiffen wurden noch nie für schlaksige Leute wie mich gebaut.«
So saßen sie denn kameradschaftlich da, reichten die Flasche zwischen sich hin und her und starrten hinaus auf den schwindenden Tag und die träge Fahrt der Karavelle in Richtung der Innenstraßen. Abrusio erwachte vor ihren Augen zu funkelndem Leben, bis die Stadt sich als düsterer, von einer halben Million gelber Lichter erhellter Schatten präsentierte und die Sterne in die Bedeutungslosigkeit verwies.
Dann gelangten sie zum Bodensatz des Weins. Hawkwood küsste die Flasche und schleuderte sie in eine Ecke, wo sie klirrend bei ihren leeren Gefährten landete. Golophin hatte sich eine fahle Tonpfeife angezündet und rauchte mit augenscheinlichem Genuss. Nach einer Weile drückte er sie aus und sagte:
»Ihr scheint mir über bemerkenswert wenig Neugier zu verfügen, Kapitän, wenn ich so sagen darf.«
Hawkwood starrte noch immer aus dem Heckfenster. »Als Tugend wird die Neugier überschätzt.«
»Dem pflichte ich bei, wenngleich sie gelegentlich dazu führen kann, nützliches Wissen offenzulegen. Wie ich höre, seid Ihr pleite – oder bestenfalls einen Steinwurf davon entfernt.«
»Hafengerede.«
»Dieses Schiff ist so etwas wie eine Kuriosität des Meeres.«
»So wie ich.«
»Ja. Ich hatte keine Ahnung, welchen Hass Fürst Murad gegen Euch hegt, auch wenn Ihr mir das vielleicht nicht glaubt. Er war die letzten paar Jahre ziemlich geschäftig.«
Hawkwood drehte sich um, zeichnete sich als schwarze Silhouette gegen das hellere, wogende Wasser hinter ihm ab. Die letzten Sonnenstrahlen hatten die Wellen blutrot getüncht.
»Ja, Murad war außerordentlich geschäftig.«
»Ihr hättet die Belohnung nicht ausschlagen sollen, die der König Euch angeboten hat. Hättet Ihr sie angenommen, wäre Murad in seiner Boshaftigkeit wenigstens eingeschränkt gewesen. So aber hatte er die letzten zehn Jahre freie Hand, um dafür zu sorgen, dass jedes Eurer Unterfangen fehlschlägt. Wenn man schon mächtige Feinde haben muss, Kapitän, sollte man mächtige Freunde nicht verschmähen.«
»Golophin, Ihr seid gewiss nicht hergekommen, um mir unausgegorene Wahrheiten oder altkluge Weisheiten anzubieten. Was wollt Ihr?«
Der Zauberer lachte und betrachtete das geschwärzte Kraut in seiner Pfeife. »Na schön. Ich will, dass Ihr in die Dienste des Königs eintretet.«
Verdutzt fragte Hawkwood: »Weshalb?«
»Weil auch Könige Freunde brauchen, und Ihr seid ein zu wertvoller Mann, als dass man Euch in einen Flaschenhals kriechen lassen dürfte.«
»Wie selbstlos von Euch«, knurrte Hawkwood, doch sein Zorn wirkte nicht echt.
»Ganz und gar nicht. Ob Ihr es nun zugeben wollt oder nicht, Hebrion steht in Eurer Schuld, ebenso der König. Außerdem habt Ihr einst einem Freund von mir geholfen, sodass auch ich in Eurer Schuld stehe.«
»Die Welt wäre ein besserer Ort, hätte ich es nicht getan.«
»Vielleicht.« Eine Pause entstand. Dann fügte Hawkwood kleinlaut hinzu: »Er war auch mein Freund.«
Das Tageslicht war geschwunden; abgesehen von einem matten Leuchten des Wassers jenseits der Heckfenster war es dunkel in der Kabine.
»Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war, Golophin«, flüsterte Hawkwood. »Ich habe Angst vor dem Meer.«
»Keiner von uns ist, was er einst war, aber Ihr seid immer noch der meisterliche Seefahrer, der dieses Schiff von der größten Reise in der Geschichte zurückgebracht hat. Nicht das Meer selbst fürchtet Ihr, Richard, sondern die Dinge, die Ihr auf der anderer Seite des Meeres vorgefunden habt. Diese Dinge sind jetzt hier. Ihr zählt zu den wenigen Auserwählten, die ihnen begegnet sind und überlebt haben. Hebrion braucht Euch.«
Ein ersticktes Lachen. »Als Stütze bin ich ein ziemlich brüchiger Stock für Hebrion, so viel steht fest. Was für Dienste hattet Ihr und der König denn im Sinn? Königlicher Türsteher oder womöglich Kapitän des Königlichen Ruderboots.«
»Wir wollen, dass Ihr Schiffe für die hebrionischen Seestreitkräfte entwerft, und zwar nach Vorlage der Osprey. Schnelle, hochseetüchtige Schiffe, die viele Kanonen befördern können. Neue Segel und neue Rahen.«
Eine Weile zeigte Hawkwood sich sprachlos. »Weshalb gerade jetzt?«, erkundigte er sich schließlich. »Was ist geschehen?«
»Gestern wurde Erzmagier Aruan – wir beide kennen ihn – hier in Normannien zum Generalvikar des Ordens der Brüder vom Ersten Tage ernannt. Seine erste Amtshandlung bestand darin, die Bildung eines neuen militärischen Ordens anzukündigen. Obwohl noch nicht allgemein bekannt, konnte ich in Erfahrung bringen, dass diese neue Einrichtung gänzlich aus Hexern und Gestaltwandlern bestehen wird. Er nennt sie die ›Bluthunde Gottes‹.«
»Heiliger im Himmel!«
»Wir möchten, Kapitän, dass Ihr uns helft, Hebrion auf den Krieg vorzubereiten.«
»Was für ein Krieg?«
»Einer, der sehr bald ausgetragen wird. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber innerhalb der nächsten paar Jahre. Eine Schlacht um die Herrschaft über diesen Kontinent. Niemand wird davon unberührt bleiben – ebenso wird niemand daran vorbeisehen können.«
»Es sei denn, er säuft sich zuvor ins Grab.«
Golophin nickte mit düsterer Miene.
»Also soll ich Euch bei der Vorbereitung auf einen großen Kampf gegen die Hexer und Werwölfe dieser Welt helfen. Und als Gegenleistung …
»… erhaltet Ihr eine hohe Stelle bei den Seestreitkräften und bei Hofe, das verspreche ich Euch.«
»Was ist mit Murad? Dem wird meine Beförderung kaum gefallen.«
»Murad wird tun, was man ihm sagt.«
»Und seine Gemahlin?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Nichts. Egal. Ich bin einverstanden, Golophin.«
Das Grinsen des Magiers leuchtete in der Düsternis der Kabine. »Ich wusste es. Was für ein Glück, dass Grobus heute einen so kümmerlichen Preis geboten hat. Wir werden die Gabrian Osprey noch brauchen. Sie soll als Muster für eine neue Flotte dienen.«
»Ihr habt davon gewusst. Hattet Ihr dabei die Hand im …
»Verdammt richtig.«
Nichts ändert sich, dachte Hawkwood. Plötzlich wird man vom Adel gebraucht, also fischt er einen aus der Gosse und setzt einen auf das große Spielbrett. Nun, er hatte seine eigenen Regeln …
»Hier drinnen ist es stockfinster. Lasst mich eine Laterne anzünden.« Hawkwood fingerte nach der Zunderbüchse, und nachdem er Feuerstein und Stahl ein Dutzend Mal aufeinandergeschlagen hatte, gelang es ihm, einer Schiffslaterne Leben einzuhauchen, in der sich noch ein wenig Öl befand. Das dicke Glas war gesprungen, doch das spielte keine Rolle. Der behagliche, gelbe Schimmer erhellte die zerfurchten Züge des Zauberers und verdunkelte das Meer achteraus.
»Also darf ich Euch morgen früh am Tor des Admiralsturms erwarten?«, fragte Golophin.
Hawkwood nickte.
»Hervorragend.« Der Magier warf einen kleinen Rehlederbeutel auf den Tisch, auf dem er klirrend aufprallte. »Ein Vorschuss auf Euren Lohn. Vielleicht wollt Ihr Euch eine neue Garderobe zulegen. Eine Unterkunft wird im Turm für Euch vorbereitet.«
»Wird oder wurde?«
Golophin erhob sich und setzte den Hut auf. »Dann also bis morgen, Kapitän.« Er streckte Hawkwood die Hand entgegen.
Hawkwood erhob sich ebenfalls und schüttelte sie. Seine Züge wirkten starr wie eine Maske. Golophin wandte sich zum Gehen, hielt aber noch einmal inne. »Es ist immer gut, wenn sich persönliche Vorlieben und politische Zwänge in Einklang bringen lassen. Gewiss, wir brauchen Euch, aber ich für meinen Teil bin zudem froh, Euch an unserer Seite zu haben. Der Hof ist voller hochwohlgeborener Schlangen. Der König braucht aufrichtige Männer um sich.«
Damit ging er, wobei er sich ducken musste, als er den Niedergang betrat. Hawkwood lauschte seinen Schritten bis zum Mittelschiff, dann vernahm er wieder das Scharren der Möwen auf dem Deck, und dann herrschte Stille.
Später nahm er eine Kabellänge von der Osprey entfernt die Riemen hoch und beobachtete, wie das Schiff brannte. Irgendwie gaben die Flammen, die von den Decks emporzüngelten und hell und lodernd in den nächtlichen Himmel brüllten, der Osprey einen Teil ihrer alten Schönheit zurück. Feucht und glänzend spiegelte das Feuer sich in Hawkwoods Augen. Stumm saß er da und verfolgte das Geschehen, bis das Schiff bis zur Wasserlinie niedergebrannt war und die See das Inferno zu überspülen begann. Zischender Dampf, dann ein leises Gurgeln, als der Rumpf kippte und in den Wogen versank. Hawkwood wischte sich in der Dunkelheit übers Gesicht.
Er würde ihnen ihre verdammte Kriegsflotte bauen und durch jeden Reifen springen, den sie ihm hinhielten! Immerhin war es eine Möglichkeit zu überleben. Doch sein wackeres Schiff würde niemals zu einem Entwurf in der Arbeitsstube eines Marinegutachters verkommen.
Schließlich ließ er die Riemen wieder zu Wasser und machte sich auf den langen Weg zurück ans Ufer.
Teil I.Der Untergang Hebrions
Er enthüllt Verborgenes aus der Dunkelheit, führt Finsternis ans Licht. Lässt Völker gedeihen und vertilgt sie wieder; Macht ein Volk groß und rafft dann hinfort. Den Königen des Landes nimmt er den Verstand Und lässt sie irren in wegloser Wüste.
Eins
Die Reitergruppe galoppierte in einer gelbbraunen Staubwolke die Kliffs entlang. Wenige Schritt vom Felsrand entfernt kamen die jungen Männer auf den hohen Rössern donnernd zum Stehen, blieben lachend auf den schnaubenden Tieren sitzen und klopften sich den Staub aus den Gewändern. Die Sonne brannte grell wie ein Beckenteller auf das himmelblaue Meer tief unten und ließ den Horizont so hell und gleißend funkeln, dass kein Auge den Anblick zu ertragen vermochte. Die kahlen Berge hinter den Reitern präsentierten sich in der Kraft des Sonnenlichts wabernd und verschwommen wie eine Vision.
Ein weiterer Mann kam herbeigeritten und gesellte sich zu den anderen; er war schon älter, trug dunkle Kleidung und einen stahlgrauen Bart. Gemächlich zügelte er sein Ross und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Wenn ihr nicht aufpasst, brecht ihr euch den Hals. Wisst ihr denn nicht, dass der Fels dort am Rand brüchig ist?«
Die meisten der jüngeren Männer lenkten die Pferde verlegen vom Furcht einflößenden Abgrund weg, nur ein breitschultriger Jüngling mit blassblauen Augen und rabenschwarzem Haar blieb, wo er war. Sein Ross war ein prächtiger grauer Wallach, der mit gespitzten Ohren aufmerksam dastand.
»Bevan, was würde ich nur ohne dich tun? Ich nehme an, Mutter hat dir aufgetragen, uns zu folgen.«
»Das hat sie, kein Wunder. Und jetzt weg da vom Rand, Bleyn. Mach einem alten Mann eine Freude.«
Lächelnd ließ Bleyn den Grauen ein, zwei Meter vom Klippenrand zurückweichen. Dann schwang er sich geschmeidig aus dem Sattel, tätschelte den Hals des schwitzenden Tieres und klopfte sich Staub vom Reitleder. Unberitten war er kleiner, als man vermuten mochte, ein kräftig gebauter Rumpf, der gedrungen auf stämmigen Beinen saß. Der Körper eines Schauermanns mit dem unpassend fein geschnittenen Antlitz eines Adeligen.
»Wir sind hergekommen, weil wir sehen wollten, ob wir einen Blick auf die Flotte erhaschen können«, erklärte er ein wenig reumütig.
»Dann schau zu der Landspitze dort – das Höft von Grios. Dort wird sie jeden Augenblick mit der Brise in Sicht geraten. Sie hat zur Mitte der Nacht Anker gelichtet.«
Auch die anderen Reiter stiegen ab, legten den Pferden Fußfesseln an und lösten Weinbeutel von ihren Sätteln.
»Worum geht’s überhaupt, Bevan?«, wollte einer von ihnen wissen. »Da wir hier draußen in der Provinz festsitzen, erfahren wir immer als Letzte etwas.«
»Eine riesige Piratenflotte, habe ich gehört«, meinte ein anderer. »Von den Macassar-Inseln, auf der Suche nach Blut und Beute.«
»Von Piraten weiß ich nichts«, entgegnete Bevan. »Aber ich weiß, Bleyn, dass dein Vater alle Trabanten des Anwesens zusammentrommeln und mit ihnen im Schlepptau nach Abrusio aufbrechen musste. Eine solche allgemeine Einberufung hatten wir zuletzt vor … nun, sechzehn oder siebzehn Jahren.«
»Er ist nicht mein Vater«, widersprach Bleyn hastig, wobei ein Schatten über seine fein geschnittenen Züge huschte.
Bevan blickte ihn unverwandt an. »Jetzt hör mir mal zu …«
»Da sind sie!«, rief einer der anderen aufgeregt. »Sie kommen um die Landspitze.«
Alle starrten hinaus. Die Zikaden zirpten unablässig in der Hitze rings um sie, doch von den kahlen Bergen wehte ihnen eine Brise in den Rücken.
Was derweil an der felsigen Landspitze in Sicht geriet, über eine Wegstunde entfernt, ähnelte einem Schwarm ferner, auf den Wogen treibender Vögel. Als Erstes stachen die weißen Segel ins Auge – die Schiffsrümpfe wurden zum Teil von der schweren Dünung verborgen. Riesige Kriegsschiffe, an deren Großmasten die scharlachroten Wimpel Hebrions flatterten. Zwölf, fünfzehn, zwanzig große Kähne in Schlachtformation, die durch die Wellen pflügten und mit dem Wind steuerbords aufs Meer hinauspreschten, die Segel gleißend und weiß wie Schwingen von Schwänen.
«Das ist die gesamte westliche Flotte«, murmelte Bevan. »Was, in aller Welt …«
Er drehte sich Bleyn zu, der die Augen mit einer Hand abschirmte und eindringlich seewärts schaute.
»Sie sind wunderschön«, stieß der junge Mann ehrfürchtig hervor. »Wahrhaftig, wunderschön!«
»Du blickst da gerade auf zehntausend Männer, Junge. Die größte Seestreitmacht der Welt. Dein Fürst Murad ist gewiss auch an Bord und zweifellos gut die Hälfte der Galiapeno-Trabanten. Ich wette, sie reihern sich die Seele aus dem Leib.«
»Was für glückliche Kerle«, seufzte Bleyn. »Und wir hocken hier wie Witwen bei einem Kränzchen und müssen zusehen, wie diese Burschen losziehen.«
»Wozu ist das alles gut? Geht es um einen Krieg, von dem wir nichts gehört haben?«, fragte einer der anderen verwirrt.
»Ich will verflucht sein, wenn ich’s weiß«, rief Bevan. »Jedenfalls muss es sich um etwas Großes handeln, wenn sie die gesamte Flotte vom Stapel lassen.«
»Vielleicht sind es die Himerianer und die Glaubensritter, die in unser Reich einfallen wollen«, meinte einer der Jüngeren.
»Die kämen durch die Pässe des Hebros-Gebirges, du Narr. Sie besitzen kaum Schiffe.«
»Vielleicht die See-Merduks …?«
»Mit denen leben wir seit gut vierzig Jahren in Frieden.«
»Na, jedenfalls ist da draußen etwas. Man schickt eine Flotte ja nicht zum Spaß aufs Meer.«
»Mutter weiß es bestimmt«, meinte Bleyn plötzlich. Er drehte sich um und schwang sich in einer fließenden Bewegung auf den großen Grauen. »Ich reite nach Hause. Bevan, du bleibst bei diesem Haufen. Du würdest mich nur aufhalten.« Der Wallach tänzelte schnaubend unter ihm.
»Warte mal …«, setzte Bevan an, doch Bleyn war bereits verschwunden und ließ nur eine Staubwolke hinter sich zurück.
Fürstin Jemilla war eine bemerkenswerte Frau. Ihr Haar war noch immer so schwarz wie das ihres Sohnes. Nur in hellem Sonnenschein traten die ersten grauen Strähnen zutage wie Silberadern. In ihrer Jugend war sie eine berühmte Schönheit gewesen und es ging das Gerücht, dass der König höchstpersönlich sie einst mit seiner Aufmerksamkeit geehrt hatte; mittlerweile aber war sie die pflichtbewusste, züchtige Gemahlin des Haushofmeisters von Hebrion, des Fürsten Murad von Galiapeno – eine Rolle, die sie seit fast fünfzehn Jahren bekleidete. Inzwischen waren die Eskapaden ihrer Jugend am Hof beinahe vergessen und Bleyn wusste nichts darüber.
Murads Lehnsgut, abgeschieden auf der Halbinsel Galapen südwestlich von Abrusio gelegen, war ein Provinznest und der Herrschaftssitz, der seine Familie seit Generationen beherbergte, war ein karges, festungsähnliches Gemäuer aus kaltem Hebros-Stein. Selbst in der ärgsten Sommerglut bewahrte es einen Rest winterlicher Kälte, weshalb ein kleines Feuer im offenen Kamin in Jemillas Gemächern brannte. Sie ging an ihrem Schreibpult die Haushaltskonten durch, während neben ihr ein geöffnetes Fenster den Blick auf die in der Hitze schwelenden Olivenhaine der Ländereien ihres Gemahls bot, gleich einer Aussicht auf ein hell erleuchtetes Bruchstück einer sonnigeren Welt.
Der Lärm bei der Ankunft ihres Sohnes war unüberhörbar. Jemilla lächelte, wodurch sie binnen eines Lidschlags zehn Jahre abschüttelte, und stemmte die zierlichen Fäuste ins Kreuz, als sie sich katzengleich vom Schreibpult erhob und streckte.
Die Tür öffnete sich, und ein grinsender Lakai erschien. »Fürstin …«
»Lass ihn herein, Dominian.«
»Ja, Fürstin.«
Bleyn fegte herein wie ein Sturmwind, der nach Pferd, Schweiß und warmem Leder riecht. Er umarmte seine Mutter und sie küsste ihn auf die Lippen. »Was ist es denn diesmal?«
»Schiffe! Tausende! Eine gewaltige Flotte! Sie sind heute Vormittag am Höft von Grios vorbeigesegelt. Bevan meint, Murad sei mit den Trabanten an Bord, die er letzten Monat nach Abrusio mitgenommen hat. Was ist denn los, Mutter? Welche bedeutenden Ereignisse ziehen diesmal an uns vorüber?« Bleyn ließ sich auf ein Sofa sinken, wobei er dessen antiken Samt mit Staub und Rosshaar besudelte.
»Für dich Fürst Murad, Bleyn«, maßregelte Jemilla ihn scharf. »Selbst ein Sohn darf sich nicht zu vertraulich ausdrücken, wenn der Vater dem Hochadel angehört.«
»Er ist nicht mein Vater.« Unwillkürlich meldete seine Bockigkeit sich zu Wort.
Des Streitens überdrüssig, beugte Jemilla sich vor und senkte ihrerseits die Stimme. »Für die Welt ist er das. Also, was diese Schiffe angeht …«
»Aber wir wissen es doch besser, Mutter. Weshalb also heucheln?«
»Willst du deinen Kopf auf den Schultern behalten, musst auch du den Fürsten als deinen Vater betrachten. Vor deinen Freunden kannst du schwafeln, was du willst – die lasse ich beobachten. Aber vor Fremden schluckst du diese Pille mit einem Lächeln. Versteh mich doch, Bleyn! Ich bin es allmählich leid, es dir zu erklären.«
»Und ich bin es leid zu heucheln. Ich bin siebzehn, Mutter – ein Mann und mein eigener Herr.«
»Wenn du weiterleben willst, dann höre auf mich! Obwohl der Leib dieser Schlampe aus Astarak unfruchtbar wie eine Salzwüste ist, wird Abeleyn kein Kuckucksei im Nest dulden – noch nicht.«
»Ein unehelicher Erbe ist besser als gar keiner.«
»Nein. Er will einen rechtmäßigen Erben, den niemand anfechten kann. Er ist noch keine fünfzig und diese Schlampe ist jünger. Außerdem haben sie diesen Hexer, diesen Golophin, der seine Zaubersprüche wirkt und Abeleyns Samen Jahr für Jahr in ihren Leib pflanzt.«
»Aber vergebens.«
»Ja. Hab Geduld, Bleyn. Letzten Endes wird er zur Besinnung kommen und erkennen, dass ein Bastard besser als gar nichts ist, wie du ganz richtig bemerkt hast.« Jemilla lächelte bei den Worten und zerzauste ihm das staubverkrustete Haar. »Also, was ist nun mit dieser Flotte?«
Bleyn zeigte sich mürrisch und zögerte trotzig mit einer Antwort, doch Jemilla spürte, wie die Neugier sein Schmollen mehr und mehr verdrängte.
»Die gesamte Kriegsflotte, sagte Bevan. Was geht da vor sich, Mutter? Welcher Krieg ist uns entgangen?«
Nun war es Jemilla, die zauderte. »Ich … ich weiß es nicht.«
»Du musst es aber wissen. Er erzählt dir alles.«
»Nein, tut er nicht. Ich weiß kaum mehr als du. Sämtliche Haushalte wurden in die Pflicht genommen und es wurde ein Bündnis besiegelt, wie man es seit den Tagen des Ersten Imperiums nicht mehr gesehen hat. Hebrion, Astarak …«
»… Gabrion, Torunna und die See-Merduks. Ja, Mutter, das ist seit Monaten bekannt. Also marschieren die Himerianer letztlich ein – ist es das? Nur besitzen sie keine erwähnenswerte Flotte. Außerdem meint Bevan, unsere Schiffe segeln gen Westen. Was gibt es dort draußen außer einem riesigen leeren Ozean?«
»Ja, was? Ein Meer von Gerüchten und Legenden vielleicht. Einen Mythos, der Gestalt anzunehmen beginnt.«
»Du sprichst wieder in Rätseln. Kannst du mir denn nie eine vernünftige Antwort geben?«
»Hüte deine Zunge!«, herrschte Jemilla ihn an. »Du wandelst kaum siebzehn Sommer auf dieser Welt und glaubst, du könntest Streitgespräche mit mir führen und deinen Vater schlecht machen? Rotzlümmel!«
Mit finsterer Miene starrte er sie an.
In sanfterem Tonfall fuhr Jemilla fort: »Es gibt Legenden über ein Land im äußersten Westen, eine unentdeckte und unbewohnte Welt. Hier in Hebrion werden diese Legenden den Kindern seit Jahrhunderten als Gutenachtgeschichten erzählt. Aber wenn diese Kindergeschichten nun wahr wären? Wenn es dort draußen im Westen tatsächlich einen riesigen, unbekannten Kontinent gäbe? Und wenn ich dir erzählte, dass hebrionische Schiffe bereits dort waren, hebrionische Füße diese unverzeichneten Strände bereits betreten haben?«
»Ich würde den hebrionischen Unternehmungsgeist preisen. Aber was hat das mit der Armada zu tun, die ich heute Vormittag gesehen habe?«
»Am Hof schwirren Gerüchte umher, Bleyn. Wie es scheint, muss Hebrion sich der Gefahr einer Invasion stellen.«
»Also doch die Himerianer!«
»Nein. Etwas anderes. Etwas aus dem Westen.«
»Aus dem Westen? Du meinst, draußen jenseits des Meeres gibt es wirklich ein neues Imperium? Mutter, das sind ja aufregende Neuigkeiten! Wie kannst du so ruhig hier sitzen? In welch wunderbaren Zeiten wir doch leben!« Bleyn sprang auf und ging in der Kammer auf und ab, wobei er vor Erregung in die Hände klatschte. Seine Mutter jedoch beobachtete ihn mit finsterer Miene. Er war immer noch ein Junge mit dem Überschwang und der Ahnungslosigkeit eines Knaben. Dabei hatte sie gedacht, sie hätte ihn besser erzogen. Vermutlich hätte er sich anders entwickelt, wenn Abeleyn – oder Murad – tatsächlich sein Vater gewesen wäre, doch dieser Knabe war der Spross eines gewissen Richard Hawkwood, eines Mannes, den Jemilla ironischerweise dereinst tatsächlich geliebt hatte, doch er war ein Gemeiner und daher nutzlos für ihr Leben und ihre Ziele gewesen. Aber man muss mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht, sagte sich Jemilla. Außerdem ist er mein Sohn und ich liebe ihn.
»Kein Imperium«, berichtigte sie ihn. »Zumindest noch nicht. Was immer sich dort draußen erhoben hat, es scheint seit Jahrhunderten mit Ereignissen hier in Normannien in Verbindung zu stehen. Wie, weiß ich nicht, aber die Himerianer sind ein Teil davon und das Zweite Imperium wird irgendwie … davon gesteuert.«
»Du drückst dich sehr unklar aus, Mutter«, meinte Bleyn.
»Mehr weiß ich nicht. Nur wenige wissen mehr – abgesehen von Fürst Murad, dem König und seinem Zauberer Golophin.«
Und Richard Hawkwood. Der Gedanke kam ihr unwillkürlich und ungebeten. Da er der Kapitän jener unglückseligen Reise gewesen war, würde auch er alles wissen. Es war die größte Meisterleistung maritimer Navigation in der Geschichte gewesen, hieß es, doch das anfängliche Interesse – nein, die anfängliche Hysterie – war binnen eines Jahres versiegt. Nie wurden die Logbücher veröffentlicht. Kein Überlebender bot seine Geschichte auf Handzetteln zum Gassenverkauf feil. Es war, als hätte dies alles nie stattgefunden.
Jemillas Gemahl hatte dafür gesorgt. Murad vergaß nichts und vergab nichts. Er war besessen davon, Richard Hawkwood in den Untergang zu treiben – weshalb, vermochte er nicht zu ergründen. Irgendetwas war ihnen dort draußen im Westen widerfahren, etwas Grauenhaftes. Es war, als versuchte Murad, dieses Etwas aus seiner Seele zu tilgen.
Sollte er je herausfinden, dass Bleyn in Wahrheit der Sohn dieses Seemanns war … Jemilla lief bei dem Gedanken ein Schauer über den Rücken.
Hawkwood hatte seine fantastische Reise nichts eingebracht, nachdem der Rausch der Bankette, Audienzen und Ehrungen verflogen war. Das Wunder hatte sich als Eintagsfliege erwiesen und war rasch in Vergessenheit geraten. Sogar der König war glücklich damit gewesen, es dabei zu belassen.
Was war dort draußen geschehen?
Und was näherte sich nun von diesem grässlichen Ort, dass man solche Vorbereitungen für angemessen hielt? Bündnisse, Schiffsbauprogramme, die Errichtung von Befestigungsanlagen – in den letzten fünf Jahren hatten sich sowohl Hebrion als auch die Verbündeten des Reiches auf einen groß angelegten Kampf mit dem Unbekannten vorbereitet. Und nun hatte dieser Kampf begonnen. Jemilla spürte es ganz deutlich, nahm es wahr wie einen üblen Gestank, der vom Wind herbeigetragen wurde.
Bleyn beobachtete sie. »Wie kannst du nur so dasitzen, Mutter? So teilnahmslos! Ich weiß, du bist eine Frau – aber keine Frau wie jede andere …«
»Kennst du denn so viele?«
»Ich kenne andere adelige Frauen. Du bist ein Falke unter Tauben.«
Sie lachte. Vielleicht steckte doch weniger von einem Knaben in ihm, als sie gedacht hatte. »Ich bleibe an meinem Platz, Bleyn, wie es von mir erwartet wird. Wie du weißt, ist Fürst Murad kein Mann, dessen Pläne man leichtfertig durchkreuzt, und ihm ist lieber, dass du und ich uns vom Hof fernhalten. Das gilt auch für den König. Wir müssen uns in Geduld üben.«
»Ich bin jetzt ein Mann, Mutter. Ich reite so gut wie jeder Soldat und ich bin der beste Fechter von ganz Galiapeno. Ich sollte draußen auf jenen Schiffen sein oder zumindest eine Hundertschaft der Stadtgarnison befehligen. Das gebührt mir meines Blutes wegen. Selbst wenn ich Murads Sohn statt der des Königs wäre, stünde es mir zu.«
»Ja.«
»Was glaubst du wohl, welche Bildung ich hier draußen auf dem Land erhalte? Ich habe keine Ahnung vom Hof oder dem anderen Adel …«
»Das reicht jetzt, Bleyn. Hab Geduld. Unsere Zeit wird kommen.«
Bleyns Stimme schwoll an. »Die wird kommen, wenn ich einst ein graubärtiger Tattergreis bin!« Damit stürmte er aus der Kammer und stieß beim Hinauslaufen mit der Schulter gegen den Türrahmen. Staub hing in seinem Fahrwasser in der Luft. Jemilla konnte ihn riechen. Staub – mehr war von sechzehn Jahren ihres Lebens nicht übrig. Einst hatte sie hohe Ziele verfolgt – zu hohe – und diese halbe Gefangenschaft hier war ihre Strafe gewesen und Murad ihr Kerkermeister. Sie konnte sich glücklich schätzen, überhaupt noch am Leben zu sein. Doch Bleyn hatte recht. Es war an der Zeit, einen neuen Wurf zu versuchen, ehe sechzehn weitere Jahre im kargen Staub und Sonnenlicht dieser verfluchten Einöde verstrichen.
Zwei
Die ersten Schlüsselblumen hatten das Licht der Welt erblickt und junger Adlerfarn kräuselte sich trübgrün durch die Nadelbetten der Kiefernhaine. Dieser Duft im Wind – nach Kiefernharz, jungem Gras und allerlei Blühendem: eine saubere Frische, aus der endlich die Kälte wich.
Die Pferde hatten den Geschmack der Luft gewittert und tänzelten und neckten einander wie Fohlen. Die beiden Reiter vor dem Haupttross ließen ihnen ihren Willen und galoppierten bald Hals über Kopf die Flanke eines der ausgedehnten Hochmoore entlang, die diesen Teil der Welt bildeten. Als ihre Rösser schließlich zu keuchen und dampfen begannen, zügelten die Reiter sie wieder und setzten den Weg im Passgang fort.
»Hydrax macht sich gut«, sagte der Mann. »Wie’s scheint, hast du da doch ein Talent.«
Seine Gefährtin – ein Mädchen, fast eine junge Frau – schürzte die Lippen. »Das denke ich schon. Shamarq meint, wenn ich noch mehr Zeit auf einem Pferderücken verbringe, kriege ich O-Beine. Aber wem würde das unter meinen höfischen Gewändern schon auffallen?«
Der Mann lachte und die beiden ritten schweigend weiter, während die Pferde sich den Weg durch die Knäuel zähen Heidekrauts bahnten. Einmal deutete das Mädchen himmelwärts auf einen einsamen Raubvogel, der im Norden emporstieg. Der Mann schaute in die Richtung, die ihr Finger wies, und nickte.
Eine halbe Meile hinter ihnen folgte eine Gruppe von etwa vierzig Reitern. Einige waren prunkvoll gekleidete Damen, andere bewaffnete Reitersoldaten. Einer trug ein Seidenbanner, das im Wind flatterte, sodass es unmöglich war, das Emblem darauf zu erkennen. Viele führten schwer beladene Packmulis, die klirrend einhertrotteten.
Der Mann drehte sich im Sattel nach hinten um. »Wir warten lieber, bis sie uns eingeholt haben. Nicht jeder ist ein Zentaur wie du.«
»Ich weiß. Briseis reitet wie ein Frosch auf einem Grillrost. Und Gebbia kann es kaum besser.«
«Es sind Hofdamen, Mirren, keine Reitersoldaten. Ich wette, beim Nähen und Kochen sind sie wesentlich tüchtiger als beim Reiten. Nun ja, zumindest beim Nähen.«
Der Mann lächelte. Er war ein breitschultriger Bursche in mittleren Jahren, dessen einst schwarzes Haar an den Schläfen ergraut war. Alte Narben prangten in dem wettergegerbten Antlitz; die Augen lagen schiefrig wie das Wintermeer tief in den Höhlen und strahlten frostige Kälte aus. Nur wenn er das Mädchen an seiner Seite betrachtete, erwärmten sie sich ein wenig. Er saß mit der vollkommenen Natürlichkeit eines geborenen Reiters im Sattel. Seine Kleider waren zwar von Meisterhand gefertigt, aber schlicht und schmucklos. Zudem waren sie schwarz, dunkel wie ein Pantherfell; kein bisschen Farbe hellte sie auf.
Das Mädchen an seiner Seite hingegen trug hellen, üppig mit Perlen und Juwelen besetzten Brokat mit einer Spitzenkrause am bleichen Hals und einen kunstvoll gewobenen Kopfputz aus Leinen und Draht auf dem blonden Haar. Sie saß wie eine junge Königin auf dem Ross. Der zerschlissene alte Reitmantel jedoch, den sie sich um die Schultern geschlungen hatte, trübte die Anmut. Es handelte sich um einen Soldatenmantel, der manch harten Einsatz erlebt hatte, wenngleich er viele Male liebevoll geflickt worden war. Kurz spähte darunter ein Seidenäffchen hervor. Es sog die belebende Luft ein, schauderte und zog sich wieder zurück.
»Müssen wir denn umkehren, Vater?«, fragte das Mädchen seinen düster gekleideten Gefährten. »Es war so lustig.«
Des Mädchens Vater, der König von Torunna, legte die warme Hand auf ihre Finger, in denen sie die Zügel hielt.
»Die schönsten Dinge«, erklärte er mit leiser Stimme, »sollte man nicht zu lange genießen.« Dabei schlich sich in seine kalte Augen ein Schatten, der keine Hoffnung auf einen Frühling erkennen ließ. Als das Mädchen ihn sah, ergriff sie seine Hand und küsste sie.
»Ich weiß. Die Pflicht ruft. Aber ich würde lieber hier draußen bleiben, als mich wohlig warm im größten Palast der Welt zu tummeln.«
Er nickte. »Ich auch.«
Das Hufgeklapper, Schnauben und Geplapper der zu ihnen aufschließenden Gruppe hinter ihnen wurde lauter und Corfe wendete das Pferd, um die Ankömmlinge zu begrüßen.
»Felorin, ich glaube, wir können allmählich den Rückweg zur Stadt antreten. Lass die Kavalkade wenden und warne den Palastverwalter vor. Wir schlagen das Lager eine Stunde vor Sonnenuntergang auf. Ich verlasse mich darauf, dass du eine geeignete Stelle findest. – Meine Damen, ich lobe mir eure Duldsamkeit. Noch diese eine letzte Nacht in Zelten, und morgen könnt ihr wieder die Behaglichkeit des Palasts genießen. Ich vertraue euch der Obhut meiner Leibgarde an. Felorin, die Prinzessin und ich stoßen in ein paar Stunden zu euch. Ich möchte noch einen bestimmten Ort besuchen.«
»Allein, Majestät?«, fragte der Reiter namens Felorin, ein drahtiger, schneidiger junger Bursche, dessen hübsches Antlitz von einem Wirbel scharlachroter Tätowierungen bedeckt war. Er trug eine schwarze Überjacke mit zinnoberrotem Besatz. An seiner Hüfte baumelte ein Reitereisäbel.
»Allein. Keine Sorge, Felorin. In diesem Teil der Welt kenne ich mich immer noch gut aus.«
»Aber die Wölfe, Majestät …«
»Wir haben flinke Pferde. Und jetzt hör auf, dich wie eine Glucke aufzuführen, und such einen Lagerplatz für heute Nacht.«
Felorin salutierte, wendete das Pferd und preschte zum hinteren Ende der kleinen Kolonne. Die umkehrende Kavalkade verwandelte sich in ein wüstes Gewirr klirrender Waffen, brüllender Soldaten, Hofdamen und Diener, störrischer Maultiere und tippelnder Zelter. Corfe wandte sich seiner Tochter zu.
»Komm, Mirren.« Damit ritt er in schnellem Kanter in Richtung der Hügel.
Die Wolkendecke über ihnen brach auf und vom blauen Himmel flutete helles Sonnenlicht, das die Flanken des Hochmoors förmlich zum Leuchten brachte, sie in einen gelbbraunen und rotbraunen Pelz verwandelte, über den Schatten huschten. Mirren folgte ihrem Vater, der einen alten, von Heidekraut überwucherten Pfad entlangzutraben schien. Die Hufe der Pferde stampften auf harten, moosgrünen Schotter statt auf feuchten Torf und sie wurden schneller. Der Pfad zog sich pfeilgerade nach Osten; im Sommer würde er unter dem Adlerfarn so gut wie unsichtbar sein.
Corfe verlangsamte das Ross zum Passgang. Seine Tochter tat es ihm gleich. Trotz ihrer Jugend war ihr Pferd, Hydrax, ein kräftiger Brauner, genauso groß wie der schwarze Wallach ihres Vaters. Ein Martingal beugte seinem wilderen Aufbäumen ein wenig vor, dennoch tänzelte er schelmisch unter ihr.
»Eines baldigen Tages wirft der Halunke dich ab«, sagte Corfe voraus.
»Ich weiß. Aber er liebt mich. Er ist bloß sehr lebendig. Vater, warum die Geheimniskrämerei? Wohin reiten wir? Und was ist das für ein alter Pfad, auf dem wir uns befinden?«
»Von Geschichte oder Erdkunde hast du trotz deiner Lehrer, die wir aus aller Herren Länder geholt haben, offenbar nicht viel Ahnung. Ich vermute, du weißt, wo wir sind?«
»Selbstverständlich«, erwiderte Mirren hochmütig. »In Barossa.«
»Ja. Die Stätte der Knochen, auf Altnormannisch. So hieß der Ort aber nicht immer. Dies ist die alte Straße nach Westen, die sich einst von Torunn geradewegs bis zum damaligen Aekir erstreckte.«
»Aurungabar«, berichtigte ihn seine Tochter.
»Ja, und zwar über die Feste von Ormann …«
»Khedi Anwar.«
»Ganz genau. Dieser alte Pfad war einst das Rückgrat Torunnas. Die Königsstraße verläuft etwa zwölf Wegstunden nach Nordwesten, aber die ist noch kaum fünfzehn Jahre alt. Noch bevor es Torunna überhaupt gab, bevor diese Gegend als Barossa bekannt wurde, war sie die östlichste Provinz des alten Imperiums. Die Fimbrier haben die Straße gebaut, auf der wir gerade wandeln, so wie sie die meisten Dinge gebaut haben, die auf dieser Welt bis heute Bestand haben. Wie es mit dem Gedächtnis der Menschen nun einmal ist, hat man diese Straße mittlerweile vergessen, aber einst war sie die Hauptstraße von Armeen, der Pfad flüchtender Völker.«
»Du … du bist diesen Weg aus Aurungabar entlanggekommen, als du noch gemeiner Soldat warst«, sagte Mirren mit einer Scheu, die ganz und gar unüblich für sie war.
»Ja«, bestätigte Corfe. »Vor fast achtzehn Jahren.« Er erinnerte sich an den Schlamm, den kalten Regen, an die Horden erschöpfter Menschen, an die zu Hunderten am Straßenrand liegenden Leichen …
»Heute ist die Welt Gott sei Dank anders. Entlang der Königsstraße wurden die Wälder gerodet, das Heidekraut verbrannt und Gehöfte mitten auf den Hügeln angesiedelt. Wo einst Wildnis wucherte, gedeihen nun Städte. Und hier, wo die Städte sich vor dem Einzug des Krieges befanden, hat man das Land wieder der Natur überlassen und die Wölfe streunen ungehindert umher. Mitunter stellt die Geschichte Dinge auf den Kopf. Was vielleicht gar nicht so übel ist. Und dort, vor uns – siehst du die Ruinen?«
Vor ihnen erhob sich ein lang gezogener Rücken, dessen Kuppe von einer dunklen Baumreihe markiert wurde. An seinem nördlichen Ende waren verfallene, niedrige Steinmauern zu erkennen, die wie geschwärzte Zahnstummel aussahen. Ein Stück näher hob sich ein Tumulus vom flacheren Land ab, der zu ebenmäßig wirkte, um natürlichen Ursprungs zu sein, und auf dem ein kahler Steinhaufen gen Himmel ragte. Das unüberhörbare, fröhliche Vogelgezwitscher, das sie den ganzen Vormittag vernommen hatten, war jäh verstummt.
»Was ist das für ein Ort?«, fragte Mirren flüsternd.
Corfe antwortete nicht, sondern ritt zum Fuß der Erhebung. Dort stieg er ab und reichte Mirren die Hand, als sie ihm folgte. Das Seidenäffchen wagte sich wieder hervor, huschte auf ihre Schulter und schlang den Schwanz um ihren Hals.
Steinkacheln waren ins Gras eingelassen. Die beiden erklommen sie, bis sie auf dem Gipfel vor dem Steinhaufen zum Stehen kamen. Er war etwa anderthalb Meter hoch, und oben darauf lag ein Granitblock. In den dunklen Stein waren Worte gemeißelt.
Hier liegen wir, die Toten Torunnas, Deren Lehen einst einer Nation Die Freiheit erkaufte.
Mirrens Mund klappte auf. »Ist das …?«
»Die Ruinen, die du hier siehst, waren einst ein Weiler namens Armagedir«, kam Corfe ihr mit leiser Stimme zuvor.
»Und der Hügel?«
»Ein Grabhügel. Wir haben alle, die wir finden konnten, hier beerdigt. Ich habe an diesem Ort viele Freunde, Mirren.«
Sie ergriff seine Hand. »Kommt sonst noch jemand hierher?«
»Formio, Aras und ich – einmal im Jahr. Abgesehen davon aber ist der Ort den Wölfen, Raubvögeln und Raben überlassen. Seit wir diesen Grabhügel errichteten, hat sich unsere Welt mit einer Geschwindigkeit fortentwickelt, die ich einst für unmöglich gehalten hätte. Aber es gibt sie in der heutigen Gestalt nur dank der Männer, deren Gebeine unter unseren Füßen vermodern. Das darfst du als meine Tochter niemals vergessen, selbst wenn andere es tun.«
Mirren setzte zu einer Erwiderung an, doch Corfe gebot ihr mit einer Geste Einhalt. »Warte!«
Aus dem Westen flog ein Vogel heran, ein Falke oder ein Habicht. Er kreiste einmal über ihren Köpfen, dann stürzte er auf sie herab. Das Seidenäffchen kreischte. Mirren streichelte es, um es zu beruhigen. Der Vogel, ein großer Gerfalke, landete nur wenige Schritte entfernt auf dem Gras und verbrachte ein paar Augenblicke damit, seine Schwingenfedern zu putzen, ehe er den krummen Schnabel öffnete und mit der tiefen, melodischen Stimme eines erwachsenen Mannes sprach.
»Seid gegrüßt, Majestät!«
»Golophin. Welche Kunde gibt es aus dem Westen?«
Der Vogel neigte den Kopf zu einer Seite, sodass ein gelbes Auge den König anstarrte. »Die vereinte Flotte ist vor drei Tagen in See gestochen. Sie kreuzt in der Gegend des Nordkaps und eine Schwadron hält im westlichen Einzugsgebiet der Brenn-Inseln Wache. Bislang noch nichts.«
»Aber Ihr seid sicher, dass der Feind sich auf See befindet?
»O ja. Wir hatten eine Patrouille von Gallioten, die vier Monate lang jenseits der Hebrionese kreuzte. In den letzten zwei Wochen sind sie alle verschwunden. Auch ein beachtlicher Teil der Heringsflotte hat es nicht zurück in den Hafen geschafft, obwohl das Wetter klar war. Da draußen ist irgendetwas …«
»Was ist mit den Augen Eures Raubvogels?«
Eine Pause, als ob der Gerfalke abgelenkt war oder Golophin seine Antwort überlegte. »Mein Hausgeist hält sich vorerst hier in Torunna auf, um die Verbindung zwischen Ost und West aufrechtzuerhalten.«
»Dann eben Charibon. Was gibt es von dort Neues?«
»Ah – von dort habe ich etwas Handfesteres. Die himerischen Armeen brechen in diesem Augenblick ihre Winterlager ab. Ich schätze, sie sind binnen zwei Wochen auf dem Marsch – oder sobald die letzten Schneewechten aus der Schlucht von Torrin gewichen sind. Der Wall von Thurian ist regelrecht überschwemmt von marschierenden Männern.«
«Dann hat es also begonnen«, sagte Corfe. »Nach all der Zeit öffnet sich der Vorhang.«
»Ich glaube schon, Majestät.«
»Was ist mit den Fimbriern?«
»Bislang noch kein Wort. Sie setzen auf Abwarten. Der Pakt von Neyr mag wohl der Welt ihre Neutralität verkündet haben, aber früher oder später werden sie vom Zaun steigen müssen.«
»Wenn es dieser bisher noch nicht gesichteten Flotte gelingt, an Land zu gehen, könnte sie das durchaus zu einer Entscheidung bewegen.«
»Und es würde einen Zweifrontenkrieg bedeuten.
»Richtig.«
»Gehe ich recht in der Annahme, Majestät, dass Eure Vorbereitungen im Gange sind?«
»Die Hauptarmee wartet nur auf mein Wort, um ins Feld zu ziehen, und General Aras hält die nördliche Garnison in Gaderion in Alarmbereitschaft. Lasst mich wissen, sobald etwas geschieht.«
»Selbstverständlich, Majestät. Darf ich Euch noch die besten Empfehlungen und Grüße Eures königlichen Vetters Abeleyn von Hebrion übermitteln? Und nun muss ich los.«
Des Vogels Schwingen explodierten in einem Federgewirr und wie ein Pfeil schnellte er in den blauen Frühlingshimmel empor. Corfe beobachtete, wie er davonflog.
»Das also war Golophin – oder zumindest sein Hausgeist«, sprach Mirren mit leuchtenden Augen. »Der große hebrionische Magier. Ich habe schon viel von ihm gehört.«
»Ja. Er ist ein guter Mann, obwohl sich allmählich die Jahre bemerkbar machen, die sein Leben nun schon währt. Es hat ihn schwer getroffen, welchen Weg sein Lehrling eingeschlagen hat.«
»Ah, Bardolin, der Presbyter der Glaubensritter. Stimmt es, dass er sowohl Werwolf als auch Magier ist?«
Corfe musterte seine Tochter eindringlich. »Da hat wohl jemand an Türschlössern gelauscht.«
Mirren errötete. »Man erzählt es sich überall …«
»Dann weißt du ja, dass unsere Welt durch eine gottlose Dreifaltigkeit bedroht wird. Himerius der Anti-Pontifex, Aruan der Hexer, nunmehr Generalvikar des Ordens der Brüder vom Ersten Tage, und Bardolin, ein weiterer Erzmagier, der als Presbyter der Glaubensritter wirkt. Und du hast recht – es geht das Gerücht, Bardolin sei ein Gestaltwandler. Er war Golophins Freund und begabtester Schüler. Nun ist er mit Leib und Seele eine Kreatur Aruans. Und Aruan ist der mächtigste der drei, obwohl er in den Augen der Welt den niedrigeren Rang einnimmt.«
»Man sagt, Aruan sei unsterblich, der letzte Überlebende einer uralten Rasse, die im Westen entstand, sich aber vor langer Zeit selbst vernichtete, indem sie mit schwarzer Magie experimentierte«, flüsterte Mirren.
»Man sagt viel, aber ausnahmsweise verbirgt sich hinter all den Märchen ein wahrer Kern. Dieser Aruan erschien vor mittlerweile knapp sechs Jahren aus dem Nichts und landete mit einigen Gefolgsleuten in fremdartig anmutenden Schiffen auf der Insel Alsten. Himerius erkannte sofort eine Art Messias in ihm und führte ihn in die höchsten Kreise der Macht ein. Aruan selbst behauptet, so etwas wie ein Vorbote eines besseren Zeitalters zu sein. Er ist unvorstellbar alt, so viel wissen wir, aber was diese untergegangene Rasse der Beschwörer angeht – nun, ich bin sicher, das ist ein Mythos. Jedenfalls kann er auf die Armeen von Perigraine, Almark sowie eines halben Dutzends anderer Fürstentümer zurückgreifen, dazu noch auf die Orden der Glaubensritter und der geheimnisvollen Bluthunde. Das Zweite Imperium, wie diese unheilige Allianz genannt wird, ist eine Tatsache, die unser aller Leben …«
»Die Fimbrier«, fiel Mirren ihm ins Wort. »Was werden sie tun?«
»Das ist die Frage. Auf welche Seite werden die Kurfürstentümer sich stellen? Seit dem Untergang Aekirs sehnen sie sich danach, ihre Hegemonie wieder aufleben zu lassen, aber diese neue Thearchie hat ihnen ein Schnippchen geschlagen. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden für die Eigenständigkeit aller ramusischen Königreiche kämpfen und das sehen die Fimbrier gar nicht gern. Andererseits wollen sie auch nicht dabei zusehen, wie die Himerianer unbesiegbar werden. Ich schätze, sie werden abwarten, bis wir und Charibon uns verausgabt haben, um dann ins Geschehen einzugreifen, indem sie sich wie Hyänen auf die Knochen stürzen.«
»Ich habe noch keinen Krieg miterlebt«, meinte Mirren ungewöhnlich kleinlaut. Sie streichelte das Seidenäffchen, das auf ihrer Schulter hockte. »Wie ist der Krieg, Vater?«
Corfe starrte hinaus auf die kahlen Anhöhen der Hochmoore. Vor sechzehn Jahren war diese stille Ödnis der Mittelpunkt einer wilden Vernichtungsschlacht gewesen. Noch immer glaubte er das Donnern der Kanonen zu hören, das in düsteren Winkeln seines Geistes widerhallte.
»Krieg ist wie ein Schritt über die Schwelle zur Hölle«, antwortete er schließlich. »Ich bete, dass du nie einen Krieg miterleben musst.«
»Aber du warst ein großer General. Du hast Armeen befehligt und warst ein Eroberer.«
Corfe bedachte sie mit einem kalten Blick. »Ich habe ums Überleben gekämpft. Das ist etwas anderes.«
Unverzagt bohrte sie weiter. »Und dieser nächste Krieg – dabei geht es doch auch ums Überleben, oder nicht?«
»Ja. Wir haben diesen Kampf nicht gewollt, er wurde uns aufgezwungen – vergiss das nie!« Seine Stimme klang schwermütig.
Doch der Hunger und die Finsternis in ihm frohlockten hämisch.
Drei
»Die Vögel«, sagte Abeleyn. »Sie folgen den Schiffen.«
Über der Flotte schwebte ein gewaltiger Schwarm lauthals kreischender Möwen. Es waren Tausende. Wild kreisten sie umher und stießen immer wieder nieder und ihre endlosen Schreie übertönten mühelos das Knarren des Holzes, das Rauschen des durchs Wasser gleitenden Kiels, das Ächzen der Taue und Rahen.
»Aasfresser«, rief Admiral Rovero vom Achterdeck herüber. »Trotzdem ist es seltsam, sie so weit vom Land entfernt anzutreffen.«
»Ich habe so etwas noch nie gesehen. Mal eine vereinzelte, ja, aber keine Schwärme wie diese«, tat Hawkwood seine Erfahrung kund.
Überall auf den vier Ebenen des Spardecks – Vorschiff, Mittelschiff, Hinterdeck und Poopdeck – starrten Soldaten und Seeleute empor, vorbei an den knarrenden, gebauschten Segeln, den ächzenden Rahen, dem beängstigenden Gewirr der Takelung. Die Möwen kreisten unermüdlich, wobei sie unablässig ihre kreischenden Schreie ausstießen.
Unter ihnen schulterte das Flaggschiff die Dünung mühelos beiseite. Die Pontifidad war ein riesiges Zwölfhunderttonnen-Kriegsschiff mit siebenhundert Mann Besatzung und achtzig Langkanonen, die nun dicht an den geschlossenen Lukendeckeln verzurrt waren wie gefangene Tiere, die nach Freiheit drängten. Die Pontifidad war eine schwimmende Batterie von ungeheurer Zerstörungskraft und das größte Kriegsschiff der westlichen Welt, der Stolz der hebrionischen Seestreitmacht.
Dennoch konnte sie zu schwach sein, dachte Abeleyn. Sie und all ihre mächtigen Mitstreiter – die gebündelte Macht von vier Nationen. Was waren Männer und Schiffe im Vergleich zu …
»Segel in Sicht!«, brüllte der Ausguck von der Großbramrah herunter. »Eine Karavelle mit dem Wind backbord querab.«
»Unsere Kundschafter kehren zurück«, meinte Hawkwood. »Ich frage mich, welche Neuigkeiten sie mitbringen.«
Die Gruppe der Männer stand auf dem Poopdeck der Pontifidad und erwartete ruhig das herannahende Schiff. Vor zwei Tagen war eine kleine Schwadron zum Kundschaften nach Westen gesandt worden, während die Flotte die mittlerweile hinter ihr liegende Landspitze umsegelte.
Admiral Rovero rief vom Achterdeck zum Ausguck hinauf. »Wie viele Segel?«
»Immer noch nur eins, Herr. Ein Vormarssegel ist fortgerissen und ich sehe lose Brassen.«
Abeleyn und Hawkwood blickten einander an. »Was meint Ihr, Kapitän?«, fragte Abeleyn.
Hawkwood strich mit einer Hand durch das ergrauende Gewirr seines Bartes. »Ich denke, die Schwadron könnte durchaus auf das gestoßen sein, wonach sie Ausschau hielt.«
»Das vermute ich auch.«
Admiral Rovero stapfte den Niedergang zum Poopdeck herauf und salutierte vor seinem Monarchen. »Majestät, auf dem Deck ist niemand zu sehen. Das schmeckt mir ganz und gar nicht. Bitte um Erlaubnis, Gefechtsbereitschaft befehlen zu dürfen.«
»Erlaubnis erteilt, Rovero. Kapitän Hawkwood, ich glaube, wir sollten die verbündeten Kontingente in Kenntnis setzen. Feind Nordwest voraus. Klar zum Gefecht!«
»Aye, Herr.«
Über mehrere Quadratmeilen Meeresoberfläche verteilt, erwachte die Flotte zu hektischem Leben. Dreiundfünfzig große Schiffe und Dutzende kleinerer Karacken und Karavellen reisten mit der Brise backbord querab nach Nordosten. Die einsame Karavelle, ein kleiner Kahn von höchstens hundert Tonnen, kreuzte unmittelbar vor dem Wind auf ihre sperrangelweit geöffneten Breitseiten zu.
Die Flotte befand sich annähernd in Pfeilformation. Die Spitze bildeten dabei die hebrionischen Schiffe, die das größte Kontingent stellten. Die linke Seite gehörte den Gabrionesen: elf schlanke, gut bemannte Kähne mit Besatzungen, die aus hervorragenden Seeleuten bestanden. Die rechte Seite setzte sich aus den Astarakern zusammen: größere Schiffe, aber weniger erfahrene Besatzungen. Der Schaftansatz der Pfeilspitze bestand aus den See-Merduks. Ihre Schiffe waren leichter, ebenso wie die Kanonen, dafür waren sie gepackt voll mit Hakenbüchsenschützen und Schwertkämpfern.
Insgesamt trieben an diesem strahlenden Frühlingsmorgen dreißigtausend Mann fünfzig Wegstunden von der Westküste Hebrions entfernt auf den Wellen. Es war die gewaltigste Seestreitmacht, die man bislang auf der Welt gesehen hatte; allein ihre Zusammenstellung hatte mehrere Jahre geduldiger Arbeit bedurft. Seit zehn Tagen kreuzten die Verbündeten gemeinsam gen Westen, nachdem sie vor zwei Wochen vor der hebrionischen Küste zueinandergestoßen waren. Und alles für diesen einen Tag, diesen einen Augenblick. Diesen strahlenden Frühlingsmorgen auf den Wogen des Westlichen Ozeans.
Der Gestank der Lunten stieg aus dem Kanonendeck zu Abeleyn empor, ebenso der Schweißgeruch der Matrosen, die sämtliche Geschütze ausfuhren, sodass die riesigen Kanonen wie stumpfe Stacheln aus der Schiffsseite ragten. Über ihm, in den Topps, luden Soldaten die verheerenden kleinen Zweipfünder-Drehbassen, rammten Ladungen in den Lauf ihrer Hakenbüchse und hievten Eimer voller Meerwasser hoch, um die unvermeidlichen Feuer zu bekämpfen, die in den Segeln ausbrechen würden.
Mittlerweile war die Karavelle kaum noch drei Kabel entfernt und hielt unmittelbar auf das Flaggschiff zu. Zwar stand niemand an der Pinne, dennoch blieb sie unbeirrt auf Kurs.
»Das gefällt mir nicht. Das ist ein totes Schiff mit einem lebendigen Ruder«, meinte Rovero. »Majestät, bitte um Erlaubnis, den Kahn aus dem Wasser sprengen zu dürfen.«
Abeleyn dachte kurz nach und einen Lidschlag lang hätte er schwören können, dass sämtliche Blicke von Hunderten Seeleuten und Soldaten auf ihn allein gerichtet waren. Schließlich antwortete er: »Erlaubnis erteilt, Admiral.«
Die Signalwimpel wurden gehisst und wenige Lidschläge später donnerte die gesamte Artillerie der Flotte los, Ehrfurcht gebietend wie der Zorn Gottes.
Die Karavelle verschwand hinter einem todbringenden Sturm aufpeitschenden Wassers. Hawkwood sah Holzbrocken hoch durch die Luft wirbeln, beobachtete, wie ein Mast erst schlingerte, dann kippte und sich in der Takelage verfing. Einige Kanonenkugeln flogen zu kurz oder zu weit, dennoch erreichten genug ihr Ziel, um den kleinen Kahn in Feuerholz zu verwandeln. Als er wieder auftauchte, präsentierte er sich als mastloses Gerippe, das tief im Wasser lag, umgeben von Trümmern. Die Möwen kreischten, als der Rauch sich lichtete und das Gebrüll der Breitseiten verhallte.
»Ich hoffe bei Gott, dass wir recht hatten«, murmelte Admiral Rovero.
»Schaut auf die Decks!«, gellte jemand vom Masttopp.