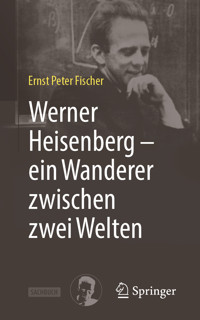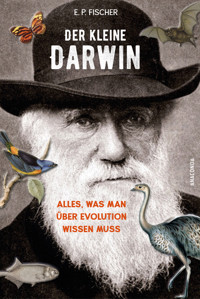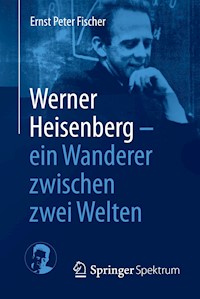16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der bestirnte Himmel hat die Menschen schon immer fasziniert. Ohne Fernrohr fing es an, mit Sternbildern und Himmelssphären. Vor 400 Jahren richtete Galilei dann das erste Fernrohr zum Himmel und entdeckte eine bis dahin unbekannte Welt. Mit Riesenteleskopen wurden danach Galaxien erkundet – bis hin zu Einsteins endlichem Universum, das keine Grenze zu haben scheint. Ernst Peter Fischer erzählt die Geschichte der wichtigsten Himmelsforscher. Über ihr Leben bekommen wir Zugang zu ihren Einsichten und das spannende Abenteuer der Erforschung des Weltalls von den Anfängen bis heute breitet sich vor uns aus. "Der Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer bringt die wahre Qualität naturwissenschaftlichen Denkens in Erinnerung." (Die Zeit)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ernst Peter Fischer
Die kosmische Hintertreppe
Die Erforschung des Himmels von Aristoteles bis Stephen Hawking
Mit 15 Abbildungen
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Für Karl Lubomirski
und seine poetischen Ermutigungen
© 2023 Langen Müller Verlag GmbH, München
© 2009 Nymphenburger in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Sibylle Schug, München
Satz: Satzwerk Huber, Germering
978-3-7844-8453-2
www.langenmueller.de
Inhalt
»Der bestirnte Himmel über mir«
Der antike Himmel mit christlicher Aufladung
Aristoteles (384–322 v. Chr.)
Aristarch (ca. 320–ca. 250 v. Chr.)
Hipparchos (um 190–ca. 120 v. Chr.)
Claudius Ptolemäus (um 100–175)
Dante Alighieri (1265–1321)
Ein kultureller Zwischenschritt
Die Wenden zur Neuzeit
Nikolaus Kopernikus (1473–1543)
Tycho Brahe (1546–1601)
Johannes Kepler (1571–1630)
Galileo Galilei (1564–1642)
Die wissenschaftliche Eroberung des Universums
Isaac Newton (1642–1727)
Edmond Halley (1656–1743)
Immanuel Kant (1724–1804)
William Herschel (1738–1822)
Friedrich Wilhelm Bessel (1784–1846)
Ein wissenschaftlicher Zwischenschritt
Die Vermessung des Lichts
Karl Friedrich Zöllner (1834–1882)
Edward Charles Pickering (1846–1919)
Henrietta Swan Leavitt (1868–1921)
Der expandierende Kosmos
Albert Einstein (1879–1955)
Arthur Stanley Eddington (1882–1944)
Edwin Powell Hubble (1889–1953)
Fritz Zwicky (1898–1974)
George Gamow (1904–1968)
Fred Hoyle (1915–2001)
Stephen Hawking (1942–2018
Nachwort: »Das moralische Gesetz in mir«
Anhang
Essay: Die Wissenschaft zittert nicht
Hinweise zur Literatur
Kosmische Zeittafel: Höhepunkte der Himmelskunde
Danksagung
Register
»Der bestirnte Himmel über mir«
»Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.«
Mit diesen schwärmerischen Worten aus der Kritik der praktischen Vernunft drückt Immanuel Kant aus Königsberg, der sonst eher rational wirkende und preußisch geprägte Philosoph der Aufklärung im 18. Jahrhundert, ein großes Bedürfnis aus – nämlich das Bedürfnis, den Himmel mit seinen Sternen zu verstehen. Er spannt sich wie ein funkelndes Zeltdach über ihn (und uns) und verleiht seiner (und unserer) Existenz dabei nicht nur ein eindrucksvolles Gewölbe, sondern ermöglicht darüber hinaus dem Menschen durch die nächtliche Sternenpracht das interesselose Erlebnis am Schönen der Natur. Kant spürt bei seinem ästhetischen Wahrnehmen der himmlischen Herrlichkeit, dass von diesem emotionalen Erleben offenbar direkt ein Weg zum moralischen Verhalten von Menschen führt. Der Betrachter der Sterne nimmt wahr, dass die Ästhetik die Mutter der Ethik ist, wie es der Dichter Joseph Brodsky im 20. Jahrhundert formuliert hat und wie wir uns im Verlaufe dieses Buches zu Gemüte führen wollen. Wir werden dann mehr über die wahrhaft immense Größe des Universums wissen, das sich nicht nur nach wie vor ausweitet, sondern dies mit zunehmender Dynamik tut und der Wissenschaft beinahe täglich überraschende neue Erkenntnisse beschert.
Einsichten dieser Art lassen jeden Menschen leicht zu »einem bloßen Punkt im Weltall« schrumpfen, wie es bereits bei Kant im Anschluss an die zitierten Sätze heißt. Der Philosoph stellt dort – wahrscheinlich mit tiefem Bedauern im Herzen – fest, dass die wissenschaftlichen Einsichten in den Kosmos mit der sich dort findenden ungeheuren »Weltmenge« dazu führen, die »Wichtigkeit« einzelner Beobachter zu »vernichten«, was natürlich auch bedeutet, dass sie selbst einen überragenden Philosophen zu einer »Winzigkeit« werden lassen – auch wenn dies niemanden vom Kaliber eines Immanuel Kant von seinen Bemühungen abhält, mehr über das Universum zu erfahren.
Die Freude und das Wissen
Kants ästhetisches Vergnügen am hohen Himmel mit seinen durchziehenden Planeten und funkelnd formierten Sternen erlaubt den Hinweis auf einen der Gründe, aus dem Menschen Wissenschaft treiben bzw. Wissen über die Weiten und Weisen des Wirklichen erwerben wollen. Sie tun dies – dem griechischen Philosophen Aristoteles zufolge –, weil sie Vergnügen an der Wahrnehmung der sinnlich zugänglichen Dinge in der Welt haben, und zu dem Schönsten, das uns dabei geboten wird, gehört die nächtliche Sternenpracht. Es ist keine Frage, dass es zu den primären Freuden der Menschen zu allen Zeiten gehört haben muss, den sichtbaren Nachthimmel mit seinen prächtigen Konstellationen – den Sternbildern – zu genießen und ihnen nachzusinnen. Und wer sich einmal in unseren Tagen dieses Vergnügen gönnt – was in den Städten mit ihrer Straßenbeleuchtung kaum noch möglich ist, im Gebirge aber eindrucksvoll gelingen kann, wenn man keine Angst vor der einen unmittelbar umgebenden Dunkelheit hat – und dabei zum Beispiel Mondphasen registriert oder den Abendstern bemerkt, bevor sich die ganze Pracht der Milchstraße mit ihrer immensen Sternendichte zeigt, wird sofort sich selbst oder seine Begleiter fragen, was da warum zu sehen ist und auf welche Weise es zustande kommt. Man hat unmittelbar das Gefühl, dass uns da Signale gegeben werden, und dieser Eindruck schlägt sich seit Jahrtausenden in den Bemühungen von Astrologen nieder, die sie verstehen und deuten möchten.
Wer jetzt mehr wissen will und sich – etwa in den Ferien – sogar mehrere Tage bzw. Nächte darauf einlässt, den Blick nicht nur dankbar, sondern neugierig auf den Himmel zu richten, und dabei bemerkt, wie sich zum Beispiel der Mondaufgang zwar verschiebt (ebenso wie das Erscheinen der Sterne), dass wir zum anderen aber den Erdtrabanten immer von derselben Seite sehen, der wird sich sofort Gedanken und Vorstellungen über die Bahnverläufe und Drehungen machen, die am Himmel nötig sind, um das gesamte Geschehen so zu orchestrieren, wie wir es wohlgefällig wahrnehmen und sogar einen Mann im Mond erkennen können.
Tatsächlich lassen sich bei den kosmischen Körpern sofort und problemlos zahlreiche Regelmäßigkeiten und Zusammenhänge erkennen, die viele räumliche und zeitliche Muster ergeben, die sich bei den Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen zeigen. Und so braucht es wenig Fantasie, um das erste Aufkommen einer Wissenschaft – die Anfänge eines systematischen Sammelns von Beobachtungsdaten – an dieser Stelle zu verorten. Tatsächlich haben bereits die frühen Kulturen sich um das bemüht, was auf Deutsch »Sternenkunde« genannt werden kann und mit griechischen Wortstämmen als »Astronomie« bekannt ist. Man notierte, wann die Sonne aufging und wie sich dies im Laufe der Zeit veränderte. Und man registrierte, wenn auf der Erde aus dem Frühjahr der Sommer wurde, dem die anderen Jahreszeiten nachfolgten, wie wir heute sagen. Bekanntlich kann man in unseren Breiten auch ohne Blick an den Himmel zumeist problemlos erkennen bzw. spüren, ob es Herbst oder Winter ist, aber definiert werden die aufeinanderfolgenden vier Jahreszeiten über den sichtbaren Lauf der Sonne und die damit feststellbaren Längen von Tag und Nacht. Wir benutzen heute noch das (schöne) Wort von der Tagundnachtgleiche, um die Zeitpunkte im Frühjahr und Herbst zu bezeichnen, zwischen denen ein Jahr ablaufen und sich vollenden kann.
Wir wollen hier aber nicht auf die Anfertigung von Kalendern eingehen, deren grobe Einteilungen sich an zwei periodischen Bewegungen orientieren – zum einen an der des Mondes um die Erde, was zu den dazugehörigen Monaten führt, und zum anderen an der Drehung unseres Planeten um seine Achse, was den Rhythmus von Tag und Nacht hervorbringt. Wir wollen vielmehr erkunden, wie unser Verstehen der Abläufe am Himmel und unsere Einsichten in kosmische Dimensionen zustande gekommen sind und welche Personen dabei zu welcher Zeit ihren Beitrag geliefert haben. Es geht um eine kosmische Hintertreppe, deren Aufstieg wir bei dem schon zitierten Aristoteles mit seinen Betrachtungen über den Himmel beginnen lassen wollen und die uns zuletzt in die Höhen führen soll, die Albert Einstein mit seiner Kosmologie in Form einer Allgemeinen Relativitätstheorie ermöglicht hat und zu deren Stabilisierung zahlreiche Physiker beitragen, von denen einer der (merkwürdigerweise) weniger bekannten Fritz Zwicky heißt, was uns zu sagen erlaubt, dass wir das Weltall aufsteigend von A bis Z erkunden.
Wenn wir bei Aristoteles beginnen, übergehen wir die Astronomie bzw. Himmelskunde, die sich zum Beispiel in uralten Hügelgräbern oder anderen Anlagen niederschlägt. In ihnen zeigen verlängerte Erdwälle eine Richtung, die sich moderner Einschätzung zufolge an Punkten orientiert, an denen helle Sterne auf- und untergehen. Wir lassen auch kreisförmige Monumente wie die im britischen Stonehenge (aus dem 2. Jahrtausend v. Chr.) unbeachtet, die offenbar Umkehrpositionen der Sonne – die Sommer- und Wintersonnenwende – markieren, die dann vermutlich den Lebensrhythmus der Erbauer prägten. Wir überspringen weiter die Bemühungen der alten Ägypter, die vor allem an der Perfektionierung ihrer Kalender arbeiteten, um auf die überlebenswichtigen Nilhochwasser vorbereitet zu sein. Merkwürdigerweise wird bei diesem Tun für unseren Blick nicht das Verlangen erkennbar, das umfassend Beobachtete in einem System – mit einer Theorie – erklärbar und begreifbar zu machen. Unabhängig davon wollen wir aber nicht übersehen, dass die Ägypter den aus zwölf Konfigurationen bestehenden Tierkreis aus dem damals bereits als alt geltenden Babylon in ihre Astronomie einführten, und sie unternahmen dies, nachdem Alexander der Große das Land der Pyramiden erobert hatte. Das heißt, die Ägypter übernahmen von den Griechen, was deren Astronomen wiederum bei den Babyloniern vorgefunden hatten und was bis heute viele Menschen interessiert und fasziniert, nämlich die Sternbilder am Himmel – wobei wir genauer sagen müssen: die Sternbilder an dem Teil des Himmels, der von der Nordhalbkugel der Erde aus sichtbar wird, die wir bewohnen.
Wer in unseren Tagen lieber Sternbilder deutet und sich weniger um Sternphysik kümmert, betreibt das, was man damals wie heute Astrologie nennt. Bei diesem Bemühen geht es mehr um den Sinn (Logos) der Sterne – um das, was sie uns sagen – und weniger um die Gesetze (Nomos), die ihre Entstehung und Bewegung bedingen. Es ist verständlich, dass die Astrologie mit ihren einfachen Bildern sehr beliebt ist und bleibt, und es gilt ernst zu nehmen, dass sie uns Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt und nach wie vor ihre Anhänger hat und zufriedenstellt. Es gilt aber ebenso deutlich zu betonen, dass viele Ansprüche von aktuell tätigen Astrologen – etwa zur Vorhersage der Zukunft – unsinnig sind und man bereits zu Goethes Zeiten von dem ewig gleichen und meist unverbindlichen Gemurmel der astrologischen Zunft gelangweilt war. Vermutlich sagen die Sterne uns auf direktem Wege gar nichts, selbst wenn uns mit großem Werbeaufwand in Horoskopen das Gegenteil vorgegaukelt wird. (Die Sterne kennen uns wahrscheinlich gar nicht und wir sind ihnen vollkommen gleichgültig.) Wenn überhaupt, dann sagen uns die Sterne indirekt etwas über die dramatische Dynamik einer weiten Welt, die an mindestens einem winzigen Punkt menschliches Leben ermöglicht und hervorgebracht hat, das auf diese Weise mit dem Kosmos zusammenhängt. Seine Geschöpfe gehören zu ihm und blicken zu ihm auf, um zu erkennen, woher sie denn da nun gekommen sind.
Wer die kosmische Hintertreppe mit aufsteigt, wird den sinngebenden (astrologischen) Aspekt des wissenschaftlichen Tuns erfahren, der zu den Konstanten im historischen Erforschen des Himmels gehört. Diese Tätigkeit dient doch letztlich der Bestimmung des Ortes, den wir in der Welt einnehmen. Die kosmische Hintertreppe führt also zu dem »Platze, den ich … einnehme«, wie Kant es behutsam und eindrucksvoll zugleich ausdrückt. Diesen Platz wollen und müssen wir finden bzw. wir können ihn einkreisen und benennen im Rahmen von Vorstellungen, die wir – mithilfe der Wissenschaft – über das gigantische Gebilde entwickeln, das wir Universum, Weltall oder Kosmos nennen und für das auch noch andere Bezeichnungen existieren. Diese Vorstellungen hängen natürlich von der außen gegebenen Wirklichkeit am Himmel ab, von der wir gerne annehmen, dass sie schon da war, bevor wir auf der Bildfläche erscheinen konnten. Diese Vorstellungen hängen aber auch von den Möglichkeiten ab, die der Mensch mit seinem evolutionär erworbenen Gehirn bekommen hat, um sie registrieren und einsehen zu können. Wenn wir einmal voraussetzen, dass die Zeit, die Menschen gebraucht haben, um die Erkenntnisstrukturen und die Denkfähigkeit ihrer Gehirne zu entwickeln, sich sehr viel länger hingezogen hat als die wenigen Jahrtausende, in denen sie mit den ihnen zur Verfügung gestellten Denkwerkzeugen Himmelskunde betreiben und Sterne beobachten, dann können wir annehmen, dass wir Heutigen Zugang zu den astronomischen Grundmustern unserer Vorgänger haben. Unser Erkenntnisapparat hat sich im Grunde nicht wesentlich erweitert oder verändert, er wird nur mit neuen Daten und Bildern gefüttert und er kann natürlich lesend oder studierend erfahren, was vorher über den Kosmos und seine Körper gedacht bzw. vermutet worden ist.
Mit der Erde als Mitte läuft die Sonne auf einer Bahn namens Ekliptik. Ihre zwölf Abschnitte markieren die Tierkreiszeichen.
Es kann bzw. sollte uns deshalb auf keinen Fall überraschen, dass die ältesten Modelle des Himmels und die jüngsten Theorien des Universums vergleichbare Strukturen – Tiefenstrukturen – aufweisen, die dann als etwas betrachtet werden können, was zum Menschen gehört. Wir werden sehen, dass dies tatsächlich der Fall ist, woraus wir lernen können, dass es unabhängig von den jeweiligen Zeiten und Epochen ein allgemein humanes Verstehen in uns gibt, das mit dem sternenübersäten Himmel über uns korrespondiert. Wenn wir in diesem Buch eine kosmische Hintertreppe ankündigen, dann hoffen wir auch, dabei einen Zugang zu diesem (psychischen) Hintergrund der Kosmologie anbieten zu können. Wir tun dies in der Überzeugung, dass es »dort oben« etwas von Dauer gibt, etwas, was ewig (im menschlichen Maßstab) gilt, was das mögliche Verstehen der Welt – des Universums – angeht und uns die Bedingungen erkennen lässt, unter denen Erkenntnis gelingen kann.
Wir sind dabei überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, um dieses Feste zu finden und als Fundament aufzuzeigen – nämlich den historischen, der erkennen kann, was Menschen zu allen Zeiten benötigten, um mit den Modellen zufrieden zu sein, die ihren Ort in der Welt zeigten. Wir wollen diesen Weg auf der kosmischen Hintertreppe gehen und fangen auf der nächsten Seite mit der ersten Stufe an.
Der antike Himmel mit christlicher Aufladung
Wer heute zu einem wolkenlosen Himmel aufblickt, sieht dort tagsüber neben der gelblichen Sonne die Farbe Blau und nachts Sternengefunkel vor schwarzem Hintergrund, wobei sich sowohl tagsüber als auch nachts der Mond in das Bild schieben und uns sein oftmals fahles Licht zeigen kann. Wir können den Lauf des Erdtrabanten am Himmel längst in aller Genauigkeit berechnen, spüren aber zugleich im Hinterkopf (oder im Herzen) die Gewissheit, dass der Mond mehr ist als ein Objekt der Wissenschaft. Immerhin kann er – poetisch ausgedrückt – die Täler mit Nebelglanz füllen und die Menschen ansprechen, die zu ihm aufschauen.
Der Blick in den Kosmos ist von Beginn der abendländischen Geschichte an in wissenschaftlicher Absicht unternommen worden, aber die Menschen im antiken Griechenland haben in der Fülle des am Himmel Sichtbaren immer auch Ausschau nach Schönheit und Vernunft gehalten und dort oben nach einem Maßstab für ihr eigenes Leben gesucht. So gesehen könnte man von einer frühen griechischen Kosmologie sprechen und damit das Wort benutzen, das in der modernen Gelehrtensprache die wissenschaftliche Erkundung des Himmels beschreibt (wobei es offenbar niemanden stört, dass durch den Gleichklang am Ende eine Nähe zu der ansonsten verpönten Astrologie entsteht). Und doch – das Wort Kosmologie für ihre Tätigkeit hätten die Griechen trotz seiner sprachlichen Herkunft nicht verstanden. Was sie interessierte und beschäftigte, war vielmehr das, was man etwas spröde Kosmografie – gebildet wie das Wort Geografie – oder mutiger Kosmogonie nennen könnte, wobei der letztere Begriff das Entstehen meint. Die Griechen wollten ja nicht nur wissen, woraus der Kosmos besteht. Sie wollten immer auch wissen, wie er entsteht, wie er das Aussehen bekommen hat, mit dem er sich uns darbietet.
Bekanntlich fangen die Menschen in solch einem Fall erst einmal damit an, Schöpfungsgeschichten zu erzählen. Das heißt, alles Begreifen des Kosmos – alle Kosmologie – beginnt mythisch, wobei wir annehmen, diese Phase der menschlichen Geistesgeschichte bereits hinter uns gelassen zu haben oder hinter uns lassen zu können. Wir beginnen in diesem Buch mit den Anfängen der Wissenschaft und können uns dabei sofort eines ihrer Grundmuster merken, das sich durch die ganze Sternerkundung hindurchzieht (und auch in andere Wissenschaftsbereiche hineinreicht). Auch wenn es paradox klingen man, aber Wissenschaft besteht – unter anderem – in dem Versuch, etwas, was man sieht, durch etwas anderes zu erklären, was man nicht sieht. Wir sehen Sonne, Mond und Sterne und deuten ihr Zusammenhängen und individuelles Bewegen durch Konstruktionen und Kräfte, die wir nicht sehen. Das Wissen, das wir erwerben, ist also von Anfang an merkwürdig. Aber es lohnt auf jeden Fall, sich ihm zuzuwenden.
Aristoteles (384–322 v. Chr.)
Aristoteles kennen wir vor allem als Philosophen, der den ihm bekannten abendländischen Menschentyp durch den zeitlosen Satz charakterisiert hat, »Menschen streben von Natur aus nach Wissen«. Der berühmte Grieche machte sich darüber hinaus Gedanken über das Leben, das er als Wechselspiel aus Form und Materie verstehen wollte, und er erkundete überhaupt in großer Vielfalt die Möglichkeiten unseres Erkenntnisstrebens mit seinen ethischen Konsequenzen. Seine Schriften blieben über die Jahrtausende hinweg einflussreich, auch wenn sie in physikalischer Hinsicht manche Fehler enthalten oder ab und zu etwas Unverständliches konstatieren, wie im Rückblick offenkundig und unübersehbar zu sein scheint. Wie konnte Aristoteles jemals zu der Ansicht kommen, dass eine Bewegung aufhört, wenn die Kraft nicht mehr wirkt, durch die sie zustande kommt? Jeder Stein, der geworfen wird, fliegt doch weiter, nachdem er die Hand, die ihn wegschleudert, verlassen und sich auf und davon gemacht hat!
Lassen wir die allzu sinnfällige Physik des Aristoteles beiseite und wenden uns nach einer kurzen Beschreibung seiner Lebensstationen den Vorschlägen und Analysen zu, die er dem Himmel und seinen Objekten – den Sternen und Planeten – gewidmet hat. Aristoteles stammte aus Stageira, das auf der Halbinsel Chalkidike liegt, und er sollte Arzt werden, da sein Vater Leibarzt des Königs von Mazedonien war. Zur Ausbildung ging Aristoteles nach Athen, wo er sich bald anders orientierte, in die von dem Philosophen Platon gegründete Akademie eintrat und ihr 20 Jahre lang – als Schüler und Lehrer – angehörte. Wie man hört bzw. liest, haben sich die beiden großen Philosophen nicht so recht verstanden und so nimmt es nicht wunder, dass Aristoteles das Machtzentrum Athen im Jahre 347 v. Chr. verließ und seinen Wohnsitz auf die Insel Lesbos verlegte. Hier – in dem ruhigen Örtchen Mytilene – lebte und arbeitete Aristoteles, bis ihn Philipp II., der König von Mazedonien, an seinen Hof rief, um ihn hier mit der Erziehung des Prinzen Alexander zu beauftragen, der inzwischen als »der Große« in die Weltgeschichte und die Schulbücher eingegangen ist. Als Alexander nach dem Tod seines Vaters umfangreiche Eroberungszüge startete, verließ Aristoteles seinen Herrn und Schüler. Im Jahr 334 kehrte er zurück nach Athen, wo er jetzt eine eigene Schule – das Lykeion – gründete, das als straff organisierte Denkstätte berühmt und später auch Peripatos genannt wurde. 323 starb Alexander der Große, was Aristoteles angreifbar machte, der zum Beispiel von der Existenz eines »unbewegten Bewegers« überzeugt war, dem wir als Ursprung aller Dynamik die am Himmel zu beobachtenden Umläufe der Planeten verdanken. Solch ein Gedanke konnte tatsächlich als Beleidigung der Götter aufgefasst werden. Um einem Prozess wegen dieser wissenschaftlich begründeten Gotteslästerung zu entgehen, siedelte Aristoteles nach Chalkis auf der Insel Euböa über, wo seine Mutter ein kleines Landgut besaß. Leider verblieben dem Philosophen nur noch wenige Lebensmonate an diesem Ort, bevor ihn ein Magenleiden heimsuchte, das schließlich im Jahre 322 v. Chr. seinen Tod herbeiführte.
»Über den Himmel«
Sosehr die heutigen Historiker Aristoteles wegen seiner empirischen Beiträge etwa in der Biologie loben, für die er zum Beispiel erst Baupläne von zahlreichen Tieren studiert und anschließend versucht hat, alle vergleichbaren Formen auf einer Stufenleiter anzuordnen, so wenig finden wir seine kosmischen Überlegungen durch spezielle Erfahrungstatsachen begründet – das heißt genauer, durch selbst gesammelte Daten und Beobachtungen untermauert. Er weiß natürlich als gebildeter Athener, dass man am Himmel zwischen Sternen und Planeten zu trennen hat, wobei das zweite (dem griechischen Original nachgebildete) Wort auf Deutsch »Wanderer« heißt und somit ausdrückt, worin der Unterschied besteht. Die Planeten ziehen zügig am Himmel umher, während die Sterne dort relativ feste Positionen einnehmen – also so etwas wie Fixsterne sind, wie man auch sagen kann. Wer sich damals über den Kosmos Gedanken machte, konnte also die Sterne zunächst lassen, wo sie waren. Er musste zuerst und vor allem die Bewegungen der Planeten verständlich machen bzw. in ein System bringen und darum bemühte sich Aristoteles – unter anderem – in seiner Schrift Über den Himmel.
Er geht dabei – was soll er auch sonst tun? – von der Erde selbst aus, von der man in seinen Tagen bereits wusste, dass sie die Gestalt einer Kugel hat. Das heißt, die Griechen wussten genau, dass die Erde keine flache Schale oder Scheibe ist, die auf einer Art Urozean treibt (und die Menschen haben dieses Wissen nicht vergessen; sie haben es auch noch im Mittelalter gehabt, selbst wenn es bis heute Schulbücher gibt, die uns das Gegenteil einreden wollen). Allerdings: Wie es so oft passiert, bringt eine Erkenntnis nicht nur Antworten, sondern vor allem neue Fragen mit sich. Eine von ihnen ist in diesem Fall ziemlich diffizil, denn wer die Erde als Kugel präsentiert, schafft damit das Problem, auf ihr den genauen Ort anzugeben, an dem sich die Menschen aufhalten. Noch ist nichts von einer Schwerkraft bekannt, die uns auch dann festhält, wenn wir uns auf der Rückseite der Erde befinden – da, wo heute Neuseeland ist – und somit quasi auf dem Kopf stehen. Dann müssten wir doch eigentlich – jedenfalls ohne gravitätische Hilfe – von der Erde ab- und ins Universum hinein- bzw. hinausfallen.
Leider wissen wir nicht, wie Aristoteles sich unser Umherlaufen bzw. Dasein auf der Kugel genau vorgestellt oder welchen Platz er uns auf der runden Erde zugewiesen hat. Wir wissen nur, dass er die Erde mehr oder weniger ruhen lässt, und unter dieser Vorgabe können bzw. müssen wir uns vorstellen, dass Aristoteles sich selbst und seine Landsleute gewissermaßen »oben« auf der Erde gesehen hat und nun von dieser Position aus sein Universum betrachtet und entwirft.
Als Erstes dehnt Aristoteles die Kugelgestalt der Erde aus, um eine Himmelskugel zu entwerfen, die uns umgibt und die als Sternendach sichtbar wird. Solch eine Überkugel stellte damals eine allgemein akzeptierte kosmische Konstruktion dar und wir benutzen sie heute noch, um die sogenannte Ekliptik zu definieren, mit der wir nach wie vor die Bahn der Sonne veranschaulichen bzw. die Anordnung der Sternbilder in ein astronomisches System bringen und somit rechtfertigen (vgl. dazu die Abb. der Ekliptik auf S. 34).
Aristoteles zimmert nicht nur um die Erdkugel eine Himmelssphäre. Er füllt überhaupt das Universum mit Kugeln bzw. Kreisen aus und auf, deren geometrische Form von ihm und seinen Zeitgenossen als vollkommen und somit als angemessen angesehen wird, und wenn wir heute von Himmelssphären sprechen, dann klingt in diesem Wort die antike Kugelkonstruktion immer noch durch. (Das gilt zum Beispiel auch im Englischen, wo eine Kugel mit »sphere« bezeichnet wird.) Die Sphären bzw. die Idee von kugelförmigen Strukturen des Universums halten sich bis in die Neuzeit hinein und noch Nikolaus Kopernikus wird 1453 seine moderne Erneuerung der Astronomie in einem Buch ankündigen, das von der »Umwälzung der Sphären« spricht.
Dabei ist allerdings für den Menschen des 21. Jahrhunderts etwas besonders zu beachten: Wenn wir Heutigen von den Bewegungen und Umläufen am Himmel sprechen, dann meinen wir die Bahnen der Himmelskörper. Das meinten aber weder Aristoteles noch Kopernikus und erst recht niemand in den Epochen zwischen ihnen. Vor dem 17. Jahrhundert redete ein Astronom von der Bewegung der Sphären, die die Himmelskörper in sich tragen bzw. mit sich führen. Bis um 1600 sind es nicht die (sichtbaren) Planeten, die sich bewegen, sondern die (unsichtbaren) Sphären und die Fokussierung auf diese geometrischen Gebilde bringt einen riesengroßen Vorteil mit sich, nämlich den, dass jetzt niemand nach einer Erklärung für deren Rotieren fragt. Wenn ein physikalisches Objekt seinen Ort wechselt, muss man einen Grund (eine Ursache) dafür finden. Wenn sich (himmlische) Sphären drehen, kann man das den Göttern überlassen. Man ist aus dem Schneider und kann sich weitere Konstruktionen ausdenken, die erklärungsfrei das Universum bevölkern – sie müssen nur geometrisch vollendet sein und sowohl den Menschen als auch den Göttern gefallen.
Es sei dem Autor an dieser Stelle ein Hinweis gestattet, der weniger mit der Himmelskunde und mehr mit unserem wissenschaftlichen Verstehen allgemein zu tun hat. Der Philosoph Karl Popper hat einmal darauf hingewiesen, dass wir immer dann zufrieden sind, wenn wir etwas, was wir sehen – das Fallen eines Gegenstandes, die Temperatur einer Flüssigkeit –, durch etwas erklären können, was wir nicht sehen – das Schwerefeld der Erde bzw. die Geschwindigkeit von Molekülen. Indem Aristoteles die der Beobachtung zugänglichen Planetenbahnen auf eine der menschlichen Fantasie entsprungene Sphärenrotation zurückführt, praktiziert er – sicher unbewusst – das Grundverfahren des wissenschaftlichen Verstehens, was uns vielleicht besser begreifen lässt, warum er ein so berühmter Philosoph werden konnte. Er dachte als Erster, was alle denken können und worüber alle nachdenken können.
Die sublunare Sphäre und darüber hinaus
Als Aristoteles das Weltall mit Sphären füllte, nahm er zugleich eine maßgebliche Trennung des Kosmos vor, und zwar mithilfe des Mondes, der natürlich eine eigene Kugelschale bekam und mit ihr kreisförmig rotieren konnte. Aristoteles unterschied nun mithilfe des Erdtrabanten zwischen der (irdischen) Welt unterhalb der Mondbahn – das ist die sublunare Sphäre – und der (himmlischen) Welt oberhalb der Mondbahn – das ist die supralunare Sphäre – und er machte es damit unmöglich, gleichberechtigt das Wort »Universum« für den Kosmos zu benutzen, wie wir es heute tun. Die Welt des Aristoteles war mehr ein »Duoversum« mit zwei Weltbereichen, zwischen denen eine gewaltige Differenz bestand bzw. zwischen denen Aristoteles eine solche angelegt hatte.
Schauen wir sie uns in einigen Details an: Während in der sublunaren und von uns Menschen bewohnten Welt die bekannten vier Elemente zu finden sind, mit denen die griechische Philosophie den Aufbau und die Zusammensetzung der gewöhnlichen Dinge erklären wollte – also das berühmte Quartett aus Feuer, Erde, Wasser und Luft –, setzt sich der Himmel über unserem Trabanten aus einfachen und unvermischten Körpern zusammen. Diese Gebilde der höheren Sphäre bestehen definitiv nicht aus den vier genannten Elementen, sondern aus einem besonderen fünften Stoff, der sogar als unvergänglich angesehen wird und deshalb als wesentlich (essenziell) gilt. Aristoteles gibt dieser Substanz einen Namen, der als »quinta essentia« ins Lateinische übersetzt wurde – eine Bezeichnung, die in unserem Sprachschatz als Quintessenz überlebt hat.
Ebenso überlebt hat das zweite Wort, das Aristoteles für das geheimnisvolle und uns Irdischen unerreichbare fünfte Element am Himmel eingeführt hat. Es heißt Äther und wird uns bis zu Albert Einstein (1879–1955) beschäftigen. Dabei interessiert uns nicht der Äther, der als flüchtiger Stoff aus den Laboratorien der Chemiker sich im medizinischen Bereich (als Betäubungsmittel) und auf dem kosmetischen Sektor (mit ätherischen Ölen) als segensreich und nützlich erweist. Uns interessiert also nicht der Äther aus den Fläschchen, sondern der Äther als Füllmaterial des Universums, mit dem man bis in unsere Tage gerungen hat, um den Kosmos so zu modellieren, dass er sich den Theorien von Einstein und seinen Nachfolgern fügt.
Aristoteles hat mit seiner Quintessenz tatsächlich etwas in die Welt – an den Himmel – gesetzt, das zum Wesen sowohl des Menschen als auch des Kosmos gehört, und wir müssen verstehen, was die Qualität des Äthers ausmacht, die ihm diese Möglichkeit einräumt. Unmittelbar klar ist, dass das fünfte Element keine Basis in der beobachtbaren Außenwelt hat und folglich aus der Innenwelt der Menschen stammen muss – weshalb dieses Konstrukt auch so viel Anklang gefunden hat. Wir erlauben uns an dieser Stelle die Vermutung, dass es sich bei dem Äther um etwas handelt, das Psychologen als archetypisches Konzept bezeichnen, womit sie Urformen des Denkens meinen, die allen Menschen zugehören und sich in unserem kollektiven Unbewussten befinden. Einsichten gelingen, wenn wir – entweder mit eigenem Bemühen oder dank der Anleitung anderer – an diese Muster herankommen und einen Weg finden, sie unserem Bewusstsein zugänglich zu machen.
»All die Sphären zusammengenommen«
Wie gesagt, Aristoteles hat uns sehr viel als Philosoph zu sagen, etwa durch seine berühmte Unterscheidung von vier Ursachen (siehe hier), wobei es stets zu beachten gilt, dass naturwissenschaftliches Erklären nicht final vorgehen darf. Hier wollen wir uns vor allem auf seine astronomischen Beiträge konzentrieren, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Denn wenn wir dies unternehmen wollten, müssten wir seine Bemühungen vorstellen, die richtige Zahl der Sphären zu finden, die benötigt werden, um die Welt als Ganzes modellieren zu können. Die Läufe der Planeten zeigten allerlei Unregelmäßigkeiten, die es in den vorgestellten Rahmen – also mit rotierenden Sphären – einzubauen bzw. in ihm aufzufangen galt, und das kann rasch so mühsam werden, dass eine Hintertreppe nicht der rechte Ort für dieses Ansinnen ist.
Aristoteles erkennt, dass, »wenn all die Sphären zusammengenommen« erklären sollen, was wir am Himmel beobachten und registrieren können, sich die Astronomen auf ziemlich komplizierte Konstruktionen einlassen und zum Beispiel zurückrollende von tragenden und anderen Sphären unterscheiden müssten, da ab und zu einmal Rückwärtsbewegungen der Planeten beobachtet werden. Er konstatiert, dass seine Zeitgenossen Eudoxos und Kallippos so etwas versucht und sich dabei an Mengen von 26 bzw. 33 Sphären versucht haben. In einigen Modellen wurden Planeten wie Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Merkur sogar unterschiedliche Sphärenzahlen zugewiesen, um alle ungewöhnlichen Beobachtungen unter Dach und Fach zu bringen, und Aristoteles setzt dieses mühsame Spiel ein wenig lustlos fort, um zuletzt mit 55 Sphären zu hantieren, ohne dass man den Eindruck gewinnt, dass ihn solche Versuche wirklich interessieren (weshalb sie an dieser Stelle auch nicht weiter beachtet werden). Er übergeht Details und erfreut sich an der grundsätzlichen Aussicht, mithilfe von beständigen Kreisbewegungen die universalen Abläufe im Kosmos verstehen zu können, der inzwischen so hieß, weil die sphärischen Kreisbahnen die Vorstellung einer himmlischen Harmonie beförderten, was die Griechen mit dem Wort für Schmuck – eben Kosmos – anerkannten. Was Aristoteles angeht, so hatte er mit seinem oben erwähnten »unbewegten Beweger« alles, was er brauchte. Die quantitativen Schwierigkeiten zur irdischen Erklärung der himmlischen Welt werden erst nach ihm offenkundig.
Die vier Ursachen nach Aristoteles
Bez. auf Lateinisch
Bez. auf Deutsch
Beispiel
Causa materialis
Stoffursache
Baumaterial
Causa formalis
Formursache
Bauplan
Causa movens
Antrieb
Hauswunsch
Causa finalis
Zweck
Familienleben im Eigenheim
Aristarch (ca. 320–ca. 250 v. Chr.)
Der Name Aristarch sagt den meisten Lesern vermutlich nicht viel. Auf der Schule hat man kaum – wenn überhaupt – etwas von diesem griechischen Genie gehört und tatsächlich wissen auch die Historiker nur sehr wenig über das Leben, das er geführt hat. Aristarch wurde auf der Insel Samos geboren, die vor der Küste von Kleinasien liegt, und das ist auch fast schon alles, was die Quellen preisgeben. Zum Glück lag in der Nähe seines Geburtsortes die Stadt Milet, die als Zentrum ionischer Kultur bekannt geworden ist und zum Beispiel den Mathematiker und Philosophen hervorgebracht hat, den wir als Thales von Milet kennen. Wohlwollende Historiker schreiben Letzterem gerne zu, im Jahre 600 v. Chr. mit der Vorhersage einer 584 v. Chr. tatsächlich eintretenden Sonnenfinsternis den Anfang der griechischen Wissenschaft markiert zu haben, aber vermutlich stellt diese Festlegung nur eine schöne Geschichte ohne faktischen Hintergrund – oder einen Zufallstreffer – dar. So weit waren die damaligen Philosophen mit der Berechenbarkeit der himmlischen Vorgänge garantiert noch nicht gekommen, denn sie mussten auf Aristarch warten, um überhaupt quantitativ werden und kosmische Dimensionen erfassen zu können.
Unabhängig davon entfaltete sich in den letzten Jahrhunderten vor dem Beginn unserer Zeitrechnung um Milet herum der Geist der geometrischen und physikalischen Wissenschaft und was immer Aristarch erkundete, erfuhr nach ihm der Mathematiker Konon von Samos, der wiederum ein Freund des antiken Alleskönners Archimedes (287–212 v. Chr.) war. Aus dessen Schriften endlich können wir heute erfahren, was Aristarch so gemacht und für uns gedacht hat (wie wir im Folgenden noch genauer zitieren werden). Daneben ist uns sogar ein einzelner Text von Aristarch direkt überliefert, und zwar eine Schrift mit dem Titel Über die Größen und Abstände von Sonne und Mond, in deren Verlauf der Autor verschiedene Methoden und Rechenverfahren entwickelt und vorstellt, um Entfernungen am Himmel und die Durchmesser der dort zu findenden Körper zu bestimmen.
Was für uns eher harmlos klingt, stellt tatsächlich eine heroische Anstrengung dar, deren erfolgreicher Abschluss unsere höchste Bewunderung und Aufmerksamkeit verdient. Die quantitative Ermittlung der einem philosophischen Denken vielleicht nur lapidar erscheinenden »Größen und Abstände« am Himmel kann uns nämlich erschrecken lassen und sollte uns zum Staunen bringen. Schließlich geht es nicht um die Entfernung zwischen Städten oder Dörfern, sondern um die Distanzen zwischen der Erde und der Sonne, die selbst heute noch unsere irdischen Maße sprengt –, und dabei nehmen die Quantitäten eine neue Qualität an, die uns das Staunen lehren kann.
Wenn wir im 21. Jahrhundert die Distanz zum Zentralgestirn unseres Planetensystems angeben, dann drücken wir sie nicht in Kilometern oder Meilen aus, sondern in Einheiten, die durch das Licht bestimmt werden. Wir wissen seit Albert Einstein und seinen Zeitgenossen, dass sich die Geschwindigkeit des Lichts als eine Konstante der Natur ansehen lässt, was uns die Möglichkeit liefert, die Strecke, die das Licht in einer Zeiteinheit zurücklegen kann – eine Lichtminute etwa oder ein Lichtjahr –, zum Vergleich von Entfernungen heranzuziehen. Nach den Kenntnissen der Physiker legt Licht in einer Sekunde die (zugleich unglaubliche und unvorstellbare) Strecke von rund 300.000 (dreihunderttausend!) Kilometern zurück, was in einer Minute etwa 18 Millionen Kilometer ausmacht (siehe hier). Wenn wir jetzt erfahren, dass die Sonne acht Lichtminuten von der Erde entfernt ist, erfassen wir mit dieser Angabe gute 144 Millionen Kilometer und an diese ungeheure Distanz wagte sich Aristarch damals heran. (Wollten wir diese kosmische Strecke wie gewohnt zurücklegen und billigten uns dafür eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 144 km/h auf der Autobahn zu, würden wir eine Million Stunden oder weit mehr als 100 Jahre bis zur Sonne brauchen – da warten wir lieber, dass das Licht zu uns kommt.)
Die Lichtstrecken in Kilometern
Eine Lichtsekunde entspricht rund 300.000 km.
Eine Lichtminute entspricht rund 18 Millionen km.
Eine Lichtstunde entspricht rund 1,1 Milliarden km.
Ein Lichttag entspricht rund 26,4 Milliarden km.
Ein Lichtjahr entspricht rund 9,5 Billionen km.
Aristarch hatte vermutlich anfänglich keine Vorstellung davon, auf welche Dimensionen er treffen würde, und vermutlich hätte ihn der Mut verlassen, wenn er auch nur geahnt hätte, auf welches Abenteuer der Quantität er sich da einließ. Ihn muss aber die Aussicht verlockt haben, all das bloß qualitative Spekulieren der Philosophen über das Universum mit präzisen Angaben zu erfüllen und zu bereichern. Aristarch stellt ein wunderbares Beispiel dafür dar, wie die Wissenschaft mit ihren Ergebnissen dann faszinierende Einsichten ermöglicht, wenn sie nur die geeignete Frage findet und sich hartnäckig um ihre Klärung bemüht. Die geeignete – und bis heute spannende – Frage lautet, wie groß die Sonne ist, die doch – aller griechischen Rationalität zum Trotz – das lebenserhaltende und Wärme spendende Gestirn am irdischen Himmel bleibt. Da lohnt es sich wahrlich zu wissen: Ist die Sonne größer als die Erde? Oder stimmt unser Augenschein, der uns weismachen will, die Sonne sei kleiner? Und was ist mit dem Mond? Wie groß ist dieses kleine Himmelslicht? Und wie weit sind wir von diesem unserem nächsten Landeplatz im All entfernt?
Die vier Schritte zur Größe der Sonne
Wer diese Fragen heute stellt oder gestellt bekommt, schaut einfach in einem Lexikon (oder im Internet etwa bei Google) nach oder fragt einen Lehrer (oder einen anderen Experten) (siehe hier). Für Aristarch bestanden diese Möglichkeiten nicht. Er musste es ganz allein herausfinden und man kann die Fantasie und den langen Atem nur bewundern, mit denen er sich ans Werk machte.
Sonne, Mond und Erde: Die heute bekannten Größenordnungen
Himmelskörper
Durchmesser
Faktor
Mond
3.476 km
1
Erde
12.756 km
knapp 4
Sonne
1.400.000 km
ca. 400
Aristarch ging Schritt für Schritt vor. Zunächst versuchte er etwas über die Größe des Mondes herauszufinden und die Gelegenheit dazu bot sich bei einer Mondfinsternis. Wenn man eine solche genau beobachtet, kann man zwei Zeitspannen unterscheiden (wobei wir jetzt einmal annehmen, dass Aristarch technisch und instrumentell in der Lage war, Zeiten messen bzw. vergleichen zu können). Da ist zum einen die Spanne, die der Mond braucht, um in den Erdschatten einzutreten, und da ist zum Zweiten die Dauer, die der Mond danach im Erdschatten verbleibt. Die erste Zeitspanne stellt ein Maß für den Durchmesser unseres Trabanten dar und die zweite liefert ein Maß für den Durchmesser der Erde selbst. Da die Größe der Erde bekannt ist (siehe hier), kann man aus dem Vergleich der beiden bestimmbaren Zeitspannen das Verhältnis der Größen von Erde und Mond berechnen – und damit die Ausmaße des Mondes. Er war Aristarchs Berechnungen zufolge – wie man sehen und vermuten konnte – deutlich kleiner als die Erde.
Wir wollen jetzt weder die (insgesamt erstaunliche) Genauigkeit noch die (uns kaum noch vertrauten) Einheiten im Detail vorstellen, mit denen Aristarch seine Ergebnisse angegeben hat, sondern nur betonen, dass dies einen großen Schritt in der Geschichte der abendländischen Kultur darstellt (auch wenn die wissenschaftsfernen Kulturexperten der Gegenwart dies nicht bemerken). Die quantitative Erkundung des Kosmos hatte begonnen und sie sollte bald ein Ergebnis hervorbringen, mit dem die luftigen Spekulationen der Philosophie überfordert werden.
Sobald Aristarch die Größenordnung des Mondes kannte, suchte er einen Weg, um auf dieser Grundlage die Entfernung zwischen der Erde und dem Planeten ermitteln zu können, der die sublunare Sphäre definierte und begrenzte. Was dabei überraschen muss: Der Astronom fand ihn mehr oder weniger vor den eigenen Augen. Er musste nur seine Hand ausstrecken, und zwar so weit, bis die Spitze eines Fingers den Mond vollständig abdecken konnte, wenn man mit einem Auge auf ihn blickte. Zieht man nämlich jetzt von dem offenen Auge (als Ausgangspunkt, geometrisch verstanden) Linien zur Fingerspitze und zum Mond, ergeben sich zwei Dreiecke, die zeigen, dass sich der gerade ermittelte Durchmesser des anvisierten Himmelskörpers so zu der gesuchten Entfernung verhält, wie dies der Durchmesser der Fingerspitze zur Länge des ausgestreckten Armes tut, die uns beide bekannt sind. Mit anderen Worten, wir können nach der geschilderten Messung einfach ausrechnen, wie weit der Mond weg ist (wobei dem Autor dieser Zeilen bis heute unverständlich bleibt, warum jemand, der an einer philosophischen Theorie des Erkennens arbeitet, nicht mit diesen Rechenbeispielen beginnt).
Mit dem Mond fest im quantitativen Zugriff, riskierte Aristarch den Sprung in die supralunare Sphäre hinein bis zur Sonne hin, wobei er die Phase des Halbmondes als Sprungbrett nutzte. Er stellte sich (ziemlich zutreffend) vor, dass sich diese Konstellation mit einem halb beleuchteten Mond durch ein rechtwinkliges Dreieck darstellen ließ, das er sich zwischen den Mittelpunkten von Sonne, Mond und Erde vorstellte, wobei der rechte Winkel beim Mond anzusiedeln war. In diesem gedanklichen Gerüst galt es, den Winkel zu bestimmen, unter dem die Sonne zu beobachten war, denn mit dieser Information – und den Grundkenntnissen der Euklidischen Geometrie – ließ sich bei bekanntem Abstand Erde–Mond die Entfernung zur Sonne berechnen (wobei man in meiner Jugend die dazugehörige Trigonometrie noch im Schulunterricht gelernt hat, weshalb sie hier vorausgesetzt und nicht näher ausgeführt wird).
Damit liegt der Weg frei, um das eigentliche Ziel anzuvisieren, nämlich die Größe der Sonne abzuschätzen. Wie im Fall des Mondes benötigen wir dazu eine besondere Konstellation am Himmel, nämlich eine Sonnenfinsternis. Für den irdischen Beobachter solch einer Himmelserscheinung spielt der Mond die Rolle, die bei der Ermittlung seiner Größe der Fingernagel übernommen hat. Wie vorher die Fingerspitze den Mond, verdeckt jetzt der Mond die Sonne und so können wir zwei Linien von der Stelle der Finsternis ziehen, die das kleine und große Licht am Himmel (den Mond und die Sonne) umfassen, und erhalten erneut zwei Dreiecke, in dem uns drei der vier Bestimmungsgrößen bekannt sind – die Entfernungen zu Sonne und Mond sowie die Größe des Letzteren. Das versetzt uns erneut mithilfe geometrischer Konstruktionen und Kenntnisse in die Lage, die vierte Zahl – den Durchmesser der Sonne – zu berechnen, und damit sind wir am Ziel bzw. erreichte Aristarch sein angestrebtes Ergebnis.
Der Ort der Sonne
Das Resultat seiner Bemühungen ließ Aristarch – bei aller Ungenauigkeit seiner Ergebnisse, die in den Geschichtsbüchern der Astronomie nachgelesen werden können – erkennen, dass die Sonne viel größer als die Erde war, und aus dieser Erfahrungstatsache zog er einen sensationellen Schluss, über den wir aus einer Schrift namens Sandmesser erfahren, die der schon erwähnte Archimedes verfasst hat. Er ist uns allen bekannt als der Mann, der nackt durch die Straßen gelaufen ist, als ihm beim Einstieg in eine Badewanne einfiel, wie er den Goldgehalt einer Krone ermitteln kann, ohne sie zu zerstören – nämlich durch ihren Auftrieb nach dem Eintauchen in Wasser. Archimedes zufolge bringt die von Aristarch vorgenommene Vermessung des Universums ihn zu der Hypothese, »dass die Erde sich um die Sonne auf der Umfangslinie eines Kreises bewegt, wobei sich die Sonne in der Mitte dieser Umlaufbahn befindet«.
Mit anderen Worten, Aristarch schlägt fast 2000 Jahre vor Kopernikus die Idee einer heliozentrischen Welt vor. Er lässt die Sonne in der Mitte der Welt in aller Ruhe stehen und er formuliert diesen kühnen Gedanken trotz der für die Augen unübersehbaren Tatsache, dass die Sonne nach wie vor geht – nämlich morgens auf- und abends unter-. Wir wissen nicht genau, was Aristarch den Mut gab, den unmittelbaren Sinneseindruck als zweitrangig zu betrachten, aber die üblichen Spekulationen der Historiker, dass es die großen Entfernungen waren, die er zwischen den Himmelskörpern ermittelt hatte, wirken wenig überzeugend. Es sollte doch eher einleuchten, dass ein Planetensystem mit einer riesigen Sonne und einer winzigen Erde leichter zu betreiben ist, wenn man den großen Klotz ruhen und dafür das kleine Ding rotieren lässt. Wer ein Klavier und einen Schemel zusammenbringen will, wird auch das Klavier lassen, wo es ist, und den Schemel in die Hand nehmen.
Trotzdem – Aristarchs heliozentrischer Vorschlag traf auf wenig Zustimmung. Er schien von Anfang bis Ende nicht stimmig zu sein. Am Anfang widersprach ihm der Augenschein, denn der zeigte eine Sonne, die am Himmelszelt wanderte. Und am Ende scheiterte er an der Konsequenz, dass eine sich drehende Erde dazu führen müsse, dass man zu verschiedenen Zeiten die Sterne am Himmel unterschiedlich angeordnet sieht. Wer etwa durch einen Wald geht, kann beobachten, wie sich weiter entfernte Bäume gegenüber solchen in der Nähe scheinbar verschieben (ohne dass sie dabei ihren Ort tatsächlich ändern). Von einer kreisenden Erde aus müssten solche Umordnungen bei den Fixsternen ebenfalls festzustellen sein und als dies trotz emsiger Beobachtung nicht bestätigt werden konnte, musste Aristarch – sicher schweren Herzens – einsehen, dass seine Hypothese einer heliozentrischen Welt gescheitert war.
Wir wissen heute natürlich, dass er – trotz des Augenscheins – recht hatte, und wir wissen auch, warum er die erwünschten Beobachtungen nicht machen konnte. Ihm fehlten zum einen die geeigneten Instrumente – noch reden wir von einer Astronomie ohne jedes technische Hilfsmittel, die ganz vom menschlichen Auge abhängt – und zum anderen sind die Entfernungen zu den Fixsternen riesig groß – es geht um viele Lichtjahre –, was die Verschiebungen so winzig erscheinen lässt, dass sie den antiken Beobachtern unbemerkt bleiben mussten.
Das Beispiel zeigt unübersehbar, dass die philosophische Behauptung, Wissenschaft mache Fortschritte durch die experimentelle Widerlegung (»Falsifizierung«) von Hypothesen, auf keinen Fall universelle Gültigkeit beanspruchen kann. Wenn ein Versuch zeigt, dass eine Vermutung nicht zutrifft – also falsch ist –, dann kann es ja auch (und wahrscheinlich auch häufiger) sein, dass im Versuch unangemessene Methoden benutzt worden sind und der Beobachter unzureichend genau vorgegangen ist.
Hipparchos (um 190–ca. 120 v. Chr.)
Wenn ein Engel auf die Erde niedersteigen und uns die Wahrheit über die Welt und ihre Gesetze mitteilen oder offenbaren würde, wir würden ihn nicht verstehen. Wir würden seine Worte selbst dann nicht begreifen, wenn er ausschließlich über die physikalischen (materiellen) Dinge reden und mentale (geistige) Phänomene weglassen würde. Die Hypothese des Aristarch stellt ein einfaches Beispiel für diese häufig zu hörende und einleuchtende Feststellung unseres Unvermögens dar, die Wahrheit zu erkennen, wenn sie sich zeigt bzw. uns vor die Nase gehalten wird. Natürlich gab es einige Astronomen, die das heliozentrische Denken akzeptierten und förderten – so zum Beispiel der Chaldäer Seleukos von Seleukia, der in der ersten Hälfte des 2. vorchristlichen Jahrhunderts lebte und dem als Erstem auffiel, dass es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Mond und den Gezeiten der Meere gibt. Aber ansonsten orientierte man sich weiter an der anschaulich gegebenen und somit eindeutig scheinenden Zentralstellung der Erde und mühte sich mit genaueren Datenerhebungen und Darstellungen ab.
Zu den bedeutendsten Astronomen der beobachtenden Zunft gehört ein aus dem in Kleinasien gelegenen Bithynien stammender Mann namens Hipparchos, von dessen Leben wir noch weniger wissen, als es bei Aristarch der Fall ist. Selbst seine Schriften sind verloren gegangen – mit der winzig kleinen Ausnahme eines Kommentars, den er den Schriften anderer Astronomen und deren Verständnis der »Himmelserscheinungen« gewidmet hat. Sie heißen im griechischen Original »Phainomena«, woraus wir unser schönes Wort von den Phänomenen gebildet haben (und woraus eine philosophische Disziplin namens Phänomenologie erwachsen ist, nur dass hier der Himmel keine Rolle spielt).
Wir verwenden die Phänomene inzwischen natürlich längst über den himmlischen Bereich hinaus, was den Hinweis auf die Tatsache erlaubt, dass sich immer mal wieder der Einzugsbereich von großen Wörtern ändern kann. Während zum Beispiel für die antiken Astronomen das, was sie am Himmel sahen, noch zur Natur gehörte, denken wir bei diesem Wort mehr an etwas Lebendiges auf der Erde. Hipparchos war also noch Naturforscher, eine Bezeichnung, die wir ihm heute nicht mehr zugestehen würden, wenn wir ihn als Kosmografen vorstellen, der keineswegs auf der Suche nach Leben hinter den Sternen war. Unabhängig davon: Was er gemessen und betrachtend untersucht hat, wissen wir aus Texten von anderen Autoren, mit deren Hilfe wir seine astronomisch aktive Zeit zwischen die Jahre 161 und 127 v. Chr. legen können und auch wissen, dass er sich vorwiegend auf der Insel Rhodos aufhielt, wo er seinen Blick den verschiedenen Himmelskörpern zuwandte und das Gesehene notierte.
Hipparchos – oder Hipparch – hat sich zum Beispiel Sorgen gemacht um einige Ungleichförmigkeiten, die bei der Bewegung der Sonne beobachtet worden waren und die sich keinesfalls mit der Gleichförmigkeit in Einklang bringen ließen, die zur Physik des Aristoteles gehörte. Genaue Bestimmungen hatten gezeigt, dass die Sonne nicht mit konstanter Geschwindigkeit längs ihres Weges auf der Ekliptik unterwegs war, sondern bei ihrem Durchlaufen des Tierkreises mal schneller und mal langsamer vorankam. Um die von Aristoteles geforderte Gleichförmigkeit der Bewegung zu erhalten – um also die Phänomene zu retten, wie es später auch berühmte Philosophen versucht haben –, nahm Hipparchos fantasievoll und großzügig zugleich an, dass der Umlauf der Sonne ein vom Beobachter aus gesehen besonderer Kreis ist, den er »exzentrisch« nannte. Solch ein Kreis ist dadurch definiert, dass er um einen anderen Mittelpunkt gebildet wird als den, der zu unserer Erde gehört. Das Runde bleibt, nur sein Zentrum ist verschoben – es zeigt sich eben exzentrisch, wie das jetzt anschauliche Wort besagt. Mit dieser Konstruktion lässt sich verstehen, wie die Sonnenbahn einen ungleichförmigen Verlauf nehmen kann – das Ungleichförmige liegt eben nur scheinbar – dem Anschein nach – vor, also in der (physikalischen) Wirklichkeit gerade nicht.
Die Erde dreht sich nicht nur um die Sonne und ihre eigene Achse, sie rotiert auch um deren Ausrichtung (die Präzession).