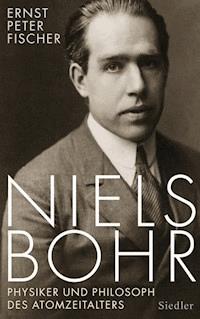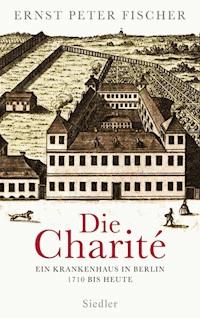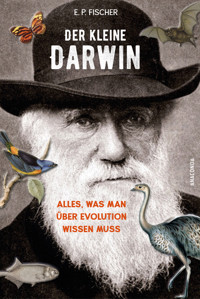Inhaltsverzeichnis
Widmung
KEPLERS PROBLEM
AUF DER ATOMAREN BÜHNE
Schrödingers Katze
Der Name vor der Katze
Der Auftritt der Katze
Das Geheimnis der Katze
Plancks Quantensprung
Der Auftritt des Quantums
Die Farben der schwarzen Körper
Diskret schwingende Atome
Das Ende der Klassischen Physik
Heisenbergs Unbestimmtheit
Der Blick auf die Atome
Die beobachtete Bahn
Unbestimmtheit im Alltag
Ein mystisches Erlebnis
Schrödingers Katze und Einsteins Mond
Bohrs Hufeisen
Bohrs Geschichten
Mut zum Widerspruch
Der Gedanke der Komplementarität
Die Lektion der Atome
»Mozart, die Quantenmechanik und eine bessere Welt«
Einsteins Spuk
Einsteins Licht und das Leben
Einsteins Einwände
Die Verschränktheit der Quantenwelt
Keine außersinnliche Wahrnehmung
Paulis Verbot
Der Mut zur Nachtseite
Der Quantensprung
Das Prinzip der Ausschließung
Der Pauli-Effekt
Professor mit Neurose in Zürich
Hawkings Strahlung
Zeilingers Prinzip
KLASSISCHE KNIFFLIGKEITEN
Maxwells Dämon
Die Richtung der Natur
Maxwells Sortiermaschine
Eine Frage der Information
Der Preis des Vergessens
Olbers’ Paradoxon
Ein kosmisches Problem
Warum ist die Nacht schwarz?
Angebotene Antworten
Die moderne Lösung des alten Rätsels
Faradays Käfig
Maxwells Gleichungen
Newtons Eimer
Newtons Apfel
Newtons Uhrwerk
Ein Eimer mit Wasser
Die relative Bewegung
Der absolute Raum
Mach’s besser, Einstein
Der gesunde Menschenverstand
Röntgens Strahlen
UMGANG MIT DEM UNENDLICHEN
Mandelbrots Apfelmännchen
Der visuelle Mathematiker
Die gebrochene Geometrie der Natur
Dimensionen der Natur
Selbstähnlichkeit
Eulers Zahl
Das exponentielle Wachstum
Hochzahlen
Steigungen und Ableitungen
Grenzwerte und Reihen
Bakterien, Bäume, Banken
Eine wundervolle Identität
Hilberts Hotel
Hilberts Rede und die Klasse der Ehre
Probleme mit Zahlen
Unentscheidbarkeit
Geheimnisse
Das 18. Problem
Russells Antinomie
Turings Maschine
Poincarés Vermutung
DES LEBENS VERTRACKTE REGELN
Darwins Finken
Darwins Einsicht
Darwins Beobachtungen
Antworten und Fragen
Das Forschungsprogramm namens Evolution
Die sexuelle Selektion
Darwins Opfer
Mendels Gesetze
»Versuche über Pflanzen-Hybriden«
Die Entdeckung der Gene
Was ist ein Gen?
Darwin und Mendel
Kekulés Traum
Organische Chemie
Die Suche nach der Struktur
Kekulés Traum
Die Logik des Benzols
Andere Träume
Liebigs Fleischextrakt
Delbrücks Schludrigkeit
Der Weg in die Molekularbiologie
Genetik mit Bakterien
Die Auferweckung der Toten
Das Prinzip der kontrollierten Schludrigkeit
Die Rolle des Wissenschaftlers
Cricks Dogma
Was ist Molekularbiologie?
Annäherung an die Gene
Das Rätsel des Lebens
Auf dem Weg zum Dogma
Cricks zweites Dogma
ZUR NATUR DES MENSCHEN
Kochs Postulate
Milgrams Experiment
Lorenz’ Prägung
Pawlows Reflex
HISTORISCHE BESONDERHEITEN
Plancks Prinzip
Plancks Person
Plancks Beispiel
Das genetische Material
Die Akzeptanz der Evolution
Die Verschiebung der Kontinente und andere Verrücktheiten
Freuds Kränkungen
Das Rätsel Ödipus
»Eine Schwierigkeit mit der Psychoanalyse«
Freuds Kränkungen
Der Ort der Demütigung
Keine kopernikanische Wende
An der Spitze der Entwicklung
Die Schatzkammer des Wissens
Die alte Überheblichkeit
Buridans Esel
Ockhams Rasiermesser
Brenners Besen
Moores Gesetz
Poppers Paradox
Bacons Diktum
Hersheys Himmel
Snows Kulturen
Nobels Preis
Das Erfolgsgeheimnis
Der Aufbruch in die Moderne
Wettstreit der Nationen
Die Zukunft des Preises
Geschichten um den Nobelpreis
Etwas Sand im Getriebe
Nach dem Fest
Fischers Lösung
Literatur
Personenregister
Copyright
Für Karin und Erwin Conradi,die Geschichten lieben und Geschichte machen.
KEPLERS PROBLEM
Keplers Problem betrifft die Vermittlung von Wissenschaft. Es betrifft alle Forscher, die etwas Neues erkannt, entdeckt oder ersonnen haben und über ihre Einsicht nun berichten wollen, und zwar nicht im Kollegenkreis, sondern vor einem breiten Publikum. Im Fall von Johannes Kepler (1571-1630) geht es um die Einsichten, die der Astronom und Astrologe vor rund vierhundert Jahren über die Bewegungen der Himmelskörper gewinnen konnte. Die Menschen hatten in den Jahrhunderten vor ihm versucht, die seit der Antike wahrgenommene Ordnung im Kosmos durch eine Welt voller Sphären mit idealer Kreisform zu beschreiben. Dabei gingen sie lange Zeit davon aus, dass die Erde, auf der sie lebten, im Zentrum des Universums zu finden war. Doch das Bemühen, die vielen Erscheinungen, die sich am Himmel dem menschlichen Auge darboten, unter dieser Vorgabe vollständig verstehen zu können, misslang. Die Vorhersagen der Astronomen wichen immer stärker vom Verlauf der Gestirne ab, und so wurden die Sterngucker nach und nach gezwungen, auch andere Vorstellungen über den Aufbau des Kosmos zu entwickeln. Kepler entschied sich um 1600, auf den Vorschlag von Nikolaus Kopernikus (1473-1543) einzugehen und die Sonne ins Zentrum zu rücken und die Planeten – einschließlich der Erde – um sie kreisen zu lassen. Bei der zunehmend genauer werdenden Durchmusterung der Bewegungen am Himmel fiel Kepler selbst ohne Fernrohr auf, dass zumindest der Mars bei seinem Umlauf um die Sonne sich nicht exakt auf einem Kreis bewegte. Als die Beobachtungsdaten nach mühevollem Rechnen eine Ellipse erkennen ließen, konnte Kepler ein erstes Gesetz für die Physik des Himmels formulieren: »Die Umlaufbahn eines Planeten hat die Form einer Ellipse.«
So lautet Keplers damals neuartige und überraschende Lösung für die Wissenschaft, und wir bewundern an seiner Einsicht die markante Knappheit, mit der sie Jahrhunderte des Messens und Nachdenkens in wenigen Worten ausdrücken kann. Die Wissenschaft liebt es, ihre großen Einsichten in knappen Formeln auszudrücken, und es fällt nicht schwer, Beispiele dafür zu finden: »Evolution gelingt durch Mutation und Selektion«; »Die Leitfähigkeit eines Metalls kommt durch die freie Beweglichkeit seiner Elektronen zustande«; »Die Chromosomen enthalten die Erbinformationen in Form von DNA-Molekülen«; »Eine Säure ergibt zusammen mit einer Base ein Salz«; »Alkohol ist wasser- und fettlöslich.«
Keplers Problem beginnt, wenn sich Wissenschaftler vor ein Publikum hinstellen, um ihre Einsichten zu verkünden. Jederzeit und allerorten ist nämlich damit zu rechnen, dass sich unter den Zuhörern jemand befindet, der einen der verwendeten Begriffe noch nie gehört oder gerade nicht parat hat. Konkret in Keplers Fall wird es entweder jemanden geben, der nicht weiß, was ein Planet ist, oder es wird sich jemand fragen, was eine Umlaufbahn ist, oder jemand hat vergessen, wie eine Ellipse aussieht. Dasselbe gilt für die anderen genannten Sätze der Wissenschaft: Was ist eine Mutation? Was sind Chromosomen? Was ist ein Elektron? Was ist eine chemische Base? Sie enthalten zwar alle wichtigen Einsichten aus der Wissenschaft, erwähnen dabei aber Dinge, mit denen wir gewöhnlich keinen Umgang haben und mit denen wir uns erst vertraut machen müssen.
Johannes Keplers »Uphill battle«.
Natürlich sind Fachausdrücke aus Politik, Wirtschaft und den Medien auch nicht einfacher zu verstehen. Aber wir haben uns im Alltag der Nachrichten und des Internets daran gewöhnt, Begriffe wie »Föderalismusreform«, »Weblog« oder »Subsidiarität« lässig hinzunehmen. Außerdem sind wir uns ziemlich sicher, dass es irgendwo schon jemanden gibt, der uns genau erklären kann, was es mit dem Vertrag von Maastricht, dem Schengener Abkommen, dem FIFA-Disziplinarausschuss und der passiven Abseitsregel im Fußball auf sich hat. Dies führt dazu, dass jemand, der diese Dinge nicht versteht, sich an die eigene Nase fasst, sich selbst dafür die Schuld gibt und sie nicht auf andere abwälzt. Bei der Wissenschaft ist das anders. Da spricht man von einer Bringschuld der Forschung statt von einer Holschuld des Publikums. Wer Mutation und Selektion nicht versteht, wer einen Planeten nicht von einem Fixstern unterscheiden kann, wer nicht weiß, ob ein Elektron größer oder kleiner als ein Atom ist, wer nicht versteht, warum Antibiotika nichts gegen Viren ausrichten, der wälzt diese Unkenntnis nicht auf seine eigene Passivität ab. Er klagt vielmehr das Bildungssystem an und beginnt, über die Unfähigkeit der Forscher zu jammern, die nicht in der Lage zu sein scheinen, ihren Fachjargon aus dem Elfenbeinturm abzulegen und allgemeinverständlich zu sprechen.
Keplers Problem ist also das Problem der Vermittlung von Wissenschaft, und hierfür gibt es auch nach Jahrzehnten des Experimentierens noch keine Lösung – und erst recht keine Patentlösung. Eine von vielen Möglichkeiten besteht darin, das Interesse an der Wissenschaft dadurch zu wecken, dass man mehr von den Menschen redet, die sie hervorgebracht haben. Ich habe dies verschiedentlich direkt unternommen – in Büchern wie Aristoteles, Einstein und Co. und Leonardo, Heisenberg und Co. -, und ich versuche es in diesem Band erneut auf indirekte Weise. Bestimmte Fragestellungen oder Denkangebote sind unmittelbar mit den Personen verknüpft, die sie aufgeworfen haben, und diese Verbindung kann genutzt werden, um die Neugierde auf den jeweils verhandelten Gegenstand zu lenken. Es wird natürlich immer schwierig bleiben, genau zu verstehen, was zum Beispiel die rätselhafte Größe namens Entropie bedeutet, mit der sich die Physiker seit dem 19. Jahrhundert herumschlagen. Aber vielleicht steigt die Lust, über das damit Gemeinte nachzudenken, wenn man erfährt, dass die fachlichen Diskussionen sich um ein Teufelchen gedreht haben, das die Naturgesetze verletzen sollte und das erst mehr als hundert Jahre nach seiner Erfindung in den Ruhestand versetzt werden konnte. Das Teufelchen, das können wir nämlich selbst sein, indem wir in das Naturgeschehen eingreifen und dabei lernen, wo unsere Grenzen liegen.
Hinter diesem eher allgemeinen Problem der Vermittlung steckt noch die Frage, wie die jeweils genannten Personen auf das mit ihrem Namen verbundene Thema gekommen sind. Hier müssten sich Vertreter einer Psychologie der Wissenschaft bemühen und äußern, die es leider noch nicht in ausreichender Zahl gibt. Wieso ist Kepler zum Beispiel so sicher, dass Kopernikus etwas Zutreffendes sagt, wenn er die Sonne ruhen und die Erde sich bewegen lässt? Schließlich sagen unsere Sinne – und die Alltagssprache – etwas anderes. Sie kennen sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang, und von Stillstand kann keine Rede sein. Oder wieso bezweifelt der Physiker Erwin Schrödinger die Deutung seiner eigenen Theorie der Atome und erkundet ihre Tragfähigkeit, indem er eine Katze in eine Höllenmaschine sperrt?
Das vorliegende Buch vertraut darauf, Keplers Problem dadurch lösen zu können, dass es nicht nur von alltagsfernen Einsichten der Forschung erzählt, sondern in der Nähe der Menschen beginnt, denen wir sie verdanken. Die Anregung zu dieser Publikation bekam ich von Jörg Sobiella vom Mitteldeutschen Rundfunk, mit dem ich, ausgehend von »Schrödingers Katze«, für das Kulturprogramm »Figaro« eine kleine Sendereihe vorgelegt habe. Sie war eine Kostprobe der hier präsentierten Schlüsselideen großer naturwissenschaftlicher Forscher.
Ernst Peter Fischer
Konstanz, im Sommer 2006
AUF DER ATOMAREN BÜHNE
Schrödingers Katze
»Der Mensch kann auf dem Mond erwachen, aber keine Katze machen.« So hat Rainer Kunze einmal in einem Kinderbuch gereimt, und er wollte damit zwei von uns Menschen anvisierte technisch-wissenschaftliche Sphären vergleichen – die planbare Erfahrung und Erkundung des Weltraums mit der unfassbaren Entstehung und Entwicklung des Lebens. Doch so schön und wichtig sein Satz ist, er stimmt nicht ganz, denn zumindest einem Menschen ist es gelungen, eine Katze zu machen. Sie stammt von dem Physiker Erwin Schrödinger und spukt in unserem Kopf herum. Ihr geistiger Vater hat die Katze 1935 aus dem Sack gelassen und in einen Kasten gesteckt, um sich mit ihrer Hilfe darüber zu wundern, wie merkwürdig die Wirklichkeit geworden war, nachdem die damals neue physikalische Wissenschaft sie beschrieben hatte.
In Schrödingers Katze steckt ein Geheimnis, wie wir noch sehen werden, und deshalb lebt sie, aber sie lebt gefährlich, und zwar gleich doppelt. Sie lebt nicht nur gefährlich in dem Stahlkasten, den Physiker bis heute umschleichen, wenn sie verstehen wollen, ob ihre Theorien die Welt tatsächlich zutreffend beschreiben. Schrödingers Katze lebt aber auch gefährlich in den Köpfen, in denen sie auftaucht, wenn sich deren Träger darum bemühen, die Wirklichkeit so zu erfassen, dass auch die Handlungsmöglichkeiten der Katze dazugehören.
Das Experiment mit Schrödingers Katze.
Die Gefahr im Kasten droht, weil dort ein Giftgas auf den Zufall wartet, der es freisetzt; und die Gefahr in den Köpfen droht, weil Schrödingers Katze eine Theorie der atomaren Natur veranschaulichen soll, die nicht nur im eingeschränkt wissenschaftlichen, sondern selbst im global ökonomischen Bereich extrem erfolgreich ist, von der aber zugleich auch gesagt wird, dass nur derjenige sie wirklich verstanden hat, der dabei wenigstens ein wenig verrückt geworden ist.
Bei Schrödingers Katze handelt es sich um ein Gedankenexperiment. Man stellt sich vor, dass eine Katze in einen Kasten aus Stahl (mit Beobachtungsklappe) eingesperrt wird, in dem zum einen noch ein zerbrechliches Gefäß mit einem Giftgas (Blausäure) steht und in dem sich zum zweiten eine Quelle mit radioaktiven Atomen befindet. Zwar soll die Katze keinen Kontakt mit dem ihr Leben bedrohenden Glasbehälter bekommen können, aber über diesem Gefäß schwebt ein Hammer, der in dem Moment betätigt wird und das tödliche Gift freisetzt, in dem die radioaktiven Atome strahlen. Nun kann die zuständige Physik der Atome zwar genau erklären, wann die Hälfte der radioaktiven Atome ihre Energie freigesetzt hat – sie kann also statistische Auskünfte geben -, sie kann aber nicht vorhersagen, zu genau welchem Zeitpunkt im Kasten eine solche Strahlung auftritt und die Prozesse in Gang setzt, die zum Tod der Katze führen – die Physik kann in einem solchen Fall nur statistische Auskünfte geben.
Wir stellen die Radioaktivität der Atome nun so ein, dass es innerhalb einer Stunde mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einem Zerfall und damit zum Zerschlagen des Gefäßes kommt. Was wissen wir dann nach dieser Stunde über die Katze im Kasten, ohne nachzuschauen? Wir wissen, dass sie mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit lebendig und mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit tot sein wird. Aber was heißt das?
Die Physik, die Schrödinger mit seiner Katze verstehen wollte, handelt natürlich nicht von ausgewachsenen Lebewesen, sondern von Atomen und den dazugehörigen Bauteilen, wie es etwa die Elektronen sind. Nun kann ein Atom nicht tot oder lebendig sein, sich wohl aber in zwei Richtungen orientieren, die wir ›rauf‹ und ›runter‹ nennen wollen. Wir stellen uns jetzt statt der Katze ein Atom im Stahlkasten vor – natürlich ohne Gift, dafür eventuell mit einem Magnetfeld. Wir können alles so einrichten, dass wir von diesem Atom auch nur wissen, dass es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ›rauf‹ und mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ›runter‹ zeigt. Was passiert nun, wenn wir in dem Fall die Beobachtungsklappe öffnen?
Das weiß die Physik genau. Sie sagt (in den Lehrbüchern), dass wir durch unser Messen das Atom festlegen. Unsere Beobachtung bestimmt, ob es ›rauf‹ oder ›runter‹ zeigt. Und das fand Schrödinger unsinnig, denn das würde – übertragen auf seine Katze im geschlossenen Kasten – bedeuten, dass das schnurrende Wesen eine Art verschmiertes Leben führt und halb lebendig und halb tot ist. Und dieser Absurdität folgte eine ungeheure zweite, denn was die Katze wirklich ist, entscheidet sich nicht von innen, sondern erst durch das Nachsehen von außen. Wer die Beobachtungsklappe betätigt, bringt die Katze um – falls er sie tot im Kasten findet (oder er macht sie völlig lebendig, wenn sie weiter herumspringt). Das heißt, Schrödingers Katze lebt wirklich gefährlich, solange jemand vor ihrem Kasten herumschleicht und seine Finger Richtung Beobachtungsklappe streckt. Vielleicht sollten wir das unterbinden und das ganze Konstrukt in aller Stille verschwinden lassen. Oder möchte es doch jemand riskieren, der Katze ins Gesicht zu blicken?
Der Name vor der Katze
Wissenschaftlich gesehen geht es bei Schrödingers Katze um die Physik der Atome, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sehr erfolgreich entwickelt werden konnte. Sie konnte Naturgesetze aufzeigen, mit deren Hilfe es unter anderem möglich wurde, die Grundelemente (Chips) der modernen Computer zu bauen. Die aktuelle Weltwirtschaft basiert zu einem beachtlichen Teil auf Produkten, die ohne die genannte Physik der Atome nicht einmal vorstellbar wären. Was so gut funktioniert, sollte auch entsprechend gut verstanden sein, denkt sich der Laie, um sich durch Schrödingers Katze eines Besseren belehren zu lassen. Ihr Erscheinen führt uns vor Augen, dass wir unserer erfolgreichsten wissenschaftlichen Theorie ziemlich fremd gegenüberstehen und dass etwas mit dem (tiefen philosophischen) Verständnis der Physik nicht stimmt, auf deren mathematischer Oberfläche unsere Wirtschaft floriert!
Das hier im Mittelpunkt stehende Tier ist nach dem österreichischen Physiker Erwin Schrödinger (1887 – 1962) benannt, der 1933 mit dem Nobelpreis für sein Fach ausgezeichnet worden ist und den sein Vaterland einmal auf dem letzten 1000-Schilling-Schein vor der Einführung des Euro abgebildet hat. Schrödingers Ruhm basiert vor allem auf einer grandiosen Leistung, die er in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre vollbrachte, als er mit nach wie vor atemberaubender mathematischer Eleganz Grundgleichungen für das Verhalten von Atomen aufstellte. Diese Gleichungen sind nach ihm benannt und sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass es in der Welt der Wissenschaft keinen Namen gibt, der häufiger ausgesprochen wird. Ununterbrochen werden überall dort, wo sich Physiker betätigen, die Schrödinger-Gleichungen eingesetzt, und stets bekommt die Fachwelt durch sie die Auskünfte, die sie braucht, um das Wechselspiel der materiellen Dinge erfassen und für technische Entwicklungen nutzen zu können.
Was auf den ersten Blick wie ein makelloser Triumph aussieht, bekommt seine ersten dunklen Flecke, wenn man erfährt, dass Schrödingers Interesse an den Atomen durch ein Gefühl geweckt wurde, das er als ekelhaft und abscheulich beschrieben hat. Unser Held fühlte sich tatsächlich angewidert von einer Beschreibung der Atome, die der junge Physiker Werner Heisenberg um 1925 vorgestellt hat und die uns in einem späteren Kapitel erneut begegnen wird (»Heisenbergs Unbestimmtheit«). Heisenberg hatte bei seiner Behandlung der Atome ernst gemacht mit der damals bereits über zwanzig Jahre alten Beobachtung, dass es in der Natur Quantensprünge gibt, wie wir heute mit einem längst populär gewordenen Begriff sagen. Atome können offenbar problemlos von einem Zustand mit hoher Energie in einen Zustand mit geringerer Energie wechseln, ohne irgendetwas oder irgendwo dazwischen zu sein, und wenn sie das tun, strahlen sie noch triumphierend etwas Licht ab. Wir können jetzt sehen, dass sie »gesprungen« sind, ohne zu wissen, wie es ihnen gelungen ist.
Schrödinger verärgerte diese Quantenspringerei über alle Maßen, mit der sich seine Kollegen zufriedengaben, und er setzte im Winter 1925/26 sein ganzes physikalisches und mathematisches Können ein, um die elende Hopserei aus der Wissenschaft zu vertreiben und den Weg zurück zu den Tugenden der klassischen Physik mit ihrem klaren, auf Vorhersehbarkeit angelegten Verständnis der Natur zu finden.
Wer das Auftreten von Schrödingers Katze verstehen will, muss von ihrem Schöpfer nicht nur wissen, was er wissenschaftlich unternommen hat. Es gehört auch zum Gesamtbild von Schrödinger, dass er zunächst eher ein gemütlicher Mensch war, der in den 1920er Jahren von einem Lehrstuhl an einer kleinen Provinzuniversität träumte. Dort wollte er in aller Ruhe seinen physikalischen Pflichten angemessen nachkommen und daneben sehr viel Zeit für die Lektüre philosophischer Texte aufwenden, wobei es ihm damals neben griechischen vor allem indische Schriften angetan hatten. Ein Pfeifchen rauchen, ein Gläschen trinken, ein Büchlein studieren, immer mal wieder eine junge Frau abschleppen – so hätte es ein genügsames, glückliches Leben an der Peripherie der großen Wissenschaft werden können, doch dann kam der Ärger wegen der Quantensprünge, und in höchster Erregung warf Schrödinger Heisenberg den Fehdehandschuh hin.
Schon nach wenigen Monaten intensiven Nachsinnens – erst beim Skilaufen mit einer Freundin in den Ferien und dann weiter zu Hause bei der eigenen Frau – glaubte er, mit seinen Schrödinger-Gleichungen vollkommen triumphiert zu haben. Er hatte eine (mathematische) Form gefunden, mit der sich die Abläufe im Inneren eines Atoms als Bewegung von schwingenden Wellen darstellen ließen. Was Heisenberg als scharfe Quantensprünge über merkwürdige Lücken in der Wirklichkeit hinnehmen musste, über die man nichts wissen konnte, schien Schrödinger in die zugleich rasche und grazile Bewegung einer durchgängigen Saite verwandeln zu können, wie sie etwa bei einer Geige vorkommt, wenn das Streichen des Bogens oder das Greifen der Finger für den Wechsel eines Tons sorgen oder gar eine komplette Melodie zustande bringen.
So dachte Schrödinger jedenfalls, bis ihm seine Kollegen nach und nach klarmachten, dass an dieser Stelle der Wunsch der Vater des Gedankens war. Schrödingers Gleichungen konnten allein deshalb keine real schwingenden Elemente – wie die Saiten einer Geige – darstellen, weil sie in einer völlig fremden Welt definiert waren. Schrödingers Gleichungen handeln tatsächlich nicht von dieser Welt. Sie lassen sich nur als mathematische Vorschriften in mathematischen Räumen verstehen, aus denen durch einen Rechenschritt erst ermittelt werden muss, was sie für die Wirklichkeit der Atome besagen. Der Vater der Katze hatte in und zu seinem großen Verdruss nichts anderes erreicht, als nachzuweisen, dass Heisenberg und seine Anhänger recht hatten. Besonders ärgerlich war zudem, dass Schrödingers Gleichungen dies für Fachleute zugleich viel einfacher und überzeugender nachzuvollziehen gestatteten.
Der Auftritt der Katze
Kein Wunder, dass Schrödinger schmollte. Er dachte nach, ließ das Mathematische sausen und trieb Philosophie – allerdings nicht am Rande der Forschung, wie er ursprünglich vorhatte, sondern in ihrem damaligen Zentrum in Berlin, und 1935 kam dabei Schrödingers Katze heraus, die er selbst als einen »burlesken Fall« bezeichnete. Er steckte sie in eine Stahlkammer mit der skizzierten »Höllenmaschine«, in der zwar nicht alles planbar, aber alles schön miteinander verknüpft ist. Im Grunde versammelt die Katze im Kasten alle Dinge, über die unsere Wissenschaft etwas weiß – ein Atom für die Physik, ein Gas für die Chemie, einen Apparat für die Technik und ein Lebewesen für die Biologie. Es ist eine Welt im Kleinen, und wie es sich gehört, fängt alles mit einem Zufall an – auch die Schwierigkeiten. Sie rühren daher, dass wir zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht wissen, ob das Atom zerfallen ist und die Tötungsmaschinerie in Gang gesetzt hat. Das heißt, wir wissen es nicht, solange wir nicht in die Stahlkammer hineinblicken, und wir wollen das im Augenblick auch so belassen, um zu erkunden, was eigentlich im Detail passiert, wenn wir in den Kasten hineinschauen.
Wenn wir verstehen wollen, was mit der Katze ist, können wir uns nicht am Alltag orientieren. Wir müssen uns – im Sinne von Schrödingers Fragestellung – nach der Physik der Atome und ihren Quantensprüngen richten. Damit sind die kleinsten Einheiten gemeint, die physikalische Objekte miteinander austauschen, wenn sie miteinander in Wechselwirkung treten. Das heißt, wer einen Mitspieler auf der Bühne der atomaren Wirklichkeit beobachtet und dabei notwendigerweise Kontakt mit ihm aufnimmt, tauscht auf jeden Fall ein Quantum mit ihm aus. Ohne Quantum geht es nicht, und weniger kann es nicht sein. Es gibt nichts auf dieser Welt, was kleiner ist, außer dem Nichts selbst (wenn das überhaupt existiert).
Wer ein Atom anschaut, empfängt Licht von ihm, oder wer es anfasst, überträgt ihm Energie, wie man vereinfachend sagen kann. Das beobachtete Atom hat mindestens einen Quantensprung hinter sich und ist also anders als das unbeobachtete, wobei uns dieser zuletzt genannte Tatbestand im Alltag schon wieder vertraut vorkommen will. In dieser Hinsicht sind wir wie Atome. Auch wir agieren unterschiedlich, je nachdem ob uns jemand zuschaut oder nicht.
Doch die atomare Wirklichkeit ist noch ein Stückchen verrückter. Sie setzt dieser Alltagserfahrung in Heisenbergs Auffassung noch eins drauf. Sie behauptet nämlich, dass die Atome überhaupt keine feste Eigenschaft haben, solange sie niemand beachtet. Sie bleiben unbestimmt, bis ein Beobachter diesen Zustand ändert. Ein ungeheurer Gedanke, den nicht nur Schrödinger als idiotisch und realitätsfremd ablehnte. Der überlebensgroße Albert Einstein schlug heftig in dieselbe Kerbe, als er Heisenbergs Auffassung durch die Frage karikierte, ob er tatsächlich meine, der Mond sei nicht am Himmel, wenn niemand hinschaue.
Wir werden uns noch dieser Herausforderung stellen, lassen aber jetzt endlich die Katze auftreten, die ihr wissenschaftliches Leben 1935 begonnen hat, als Schrödinger sie aus dem Sack seiner Gedanken ans Licht ließ, um zu zeigen, wie absurd die neue Wissenschaft mit der Wirklichkeit umgeht. Die Konstruktion mit den radioaktiven Atomen dient dem Zweck, das Element des Zufalls in das Leben einzuführen, das nicht nur in den Atomen, sondern in vielen physikalischen Gesetzmäßigkeiten steckt (und gegen das Schrödinger im Prinzip nichts einzuwenden hatte). Doch das Diabolische der Vorrichtung steckt darin, dass der Zustand von Schrödingers Katze auf diese Weise so unbestimmt wird wie der eines Atoms, mit der höchst unangenehmen Folge, dass es nun nicht das Giftgas, sondern die Beobachtung eines Physiker ist, der die Katze tötet. Ein Atom kann etwa in einem Magnetfeld eine Orientierung annehmen, die durch eine gezielte Messung bestimmt werden kann, und die Katze kann in einem Kasten eine Stellung annehmen (lebendig stehend oder tot liegend), die ihrerseits durch ein genaues Nachschauen festgelegt wird.
Das Geheimnis der Katze
Es wäre Schrödinger heute peinlich, wenn man ihm sagte, dass er seine Berühmtheit außerhalb der wissenschaftlichen Kreise der Erfindung einer tödlich bedrohten Katze verdankt. Und es sollte ihm auch peinlich sein, denn sein Gedankenexperiment enthält einen ziemlich dicken Denkfehler, auch wenn dies der Popularität seiner Höllenmaschine nichts anzuhaben scheint. Was in Schrödingers Kasten unbestimmt ist, solange niemand hinschaut, ist die Situation einer real existierenden Katze (und deren Zustand ist keineswegs verschmiert, sondern eindeutig, auch wenn wir ihn nicht kennen). Was hingegen in den Atomen unbestimmt bleibt, solange niemand hinschaut, ist die Einstellung einer keineswegs real existierenden mathematischen Größe, die nach Schrödingers eigenem Vorschlag durch den griechischen Buchstaben Ψ (Psi) bezeichnet wird. Damit ist zunächst natürlich nur der 23. Buchstabe des entsprechenden Alphabets gemeint, aber es soll nicht unbemerkt bleiben, dass es viele Spekulationen darüber gibt, wieso Schrödinger bei der großen Auswahl ausgerechnet auf Psi gestoßen ist. Die Abkürzung steht inzwischen für »para sensual intelligence«, was außersinnliche Wahrnehmung meint und im Rahmen von parapsychologischer Forschung erkundet wird. Ihre Vertreter stimmen Shakespeare zu, wenn er vermutet, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt, und vielleicht umspielt etwas davon unsere Katze.
Versuchen wir, dies etwas konkreter zu sagen: Unter streng physikalischen Aspekten ist nicht viel anzufangen mit Schrödingers Katze. Im Licht der Lampe namens Wissenschaft steht sie in ihrer vollen Größe bloß dumm und unnötig gefährdet da, und unter diesem Blickwinkel scheint es am besten, wir würden den Kasten in irgendeiner Ecke abstellen (natürlich nachdem die Katze aus ihm befreit und das Gift entsorgt worden ist).
Wer dies nicht tun will, kann sich immerhin Gedanken über den Einfluss einer Beobachtung auf das Beobachtete machen und sich fragen, wo hier die früher ach so heilige Objektivität der Wissenschaft geblieben ist (das wollte auch Einstein mit seinem zitierten Mondsatz wissen, und auf diese Frage werden wir noch stoßen).
Wer aber wissen will, warum Schrödingers Katze sich so hartnäckig in der Literatur hält, wird irgendwann zu dem Ursprung des Unwissens zurückfinden, der das Gedankenexperiment überhaupt erst möglich macht und den wir bislang mehr oder weniger links liegen gelassen haben. Gemeint ist der Zufall, der in den (radioaktiven) Atomen steckt, um deren Verstehen es letztlich geht – schließlich setzt sich alles aus solchen Atomen zusammen. Zwar ist die Wissenschaft angetreten, um die Natur sicher zu erfassen, doch jetzt teilt uns die Physik in ihrer am höchsten entwickelten Form mit, dass wir uns nur mit Wahrscheinlichkeiten zufriedengeben müssen. So liest man es, ohne dass es ganz korrekt wäre. Die Unsicherheit steckt nur dort, wo wir uns befinden. In der Sphäre, in der Schrödinger seine Gleichungen angesiedelt hat, ist alles festgelegt. Dort gibt es keine Zufälligkeiten. Dort wird alles durch Schrödingers Gleichungen (und andere mathematische Gesetze) bestimmt. Das hört auf, wenn ich diese Sphäre verlasse und dort ankomme, wo Schrödingers Katze miaut. Mathematik ist eben nicht mehr sicher, wenn sie sich auf die Wirklichkeit bezieht, wie Einstein betont.
Schrödingers Katze stellt uns also die Frage, wie der Zufall in die Welt kommt, in der wir leben, wo es doch einen Bereich gibt, in dem man – dank Schrödingers Gleichungen – ohne ihn auskommen kann. Wir versuchen bekanntlich alles, um die Welt planbar zu machen. Schrödingers Katze erinnert uns an unsere Grenzen. Darin scheint eines ihrer Geheimnisse zu stecken.
Übrigens – mit Hilfe der Katze lässt sich noch der Hinweis geben, dass wir vielleicht in vielen Dingen, die wir sagen, mehr durch die Sprache als durch unser Denken geleitet werden. Das geht ganz einfach folgendermaßen: Eine Katze hat einen Schwanz, und keine Katze hat zwei Schwänze. Eine Katze und keine Katze macht zusammen eine, und die hat einen plus zwei, also drei Schwänze. Vielleicht sollte man diese Katze mit den drei Schwänzen in die Stahlkammer sperren – dazu müsste man sie aber erst finden.
Plancks Quantensprung
Das Wort Quantensprung ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts so populär geworden, dass man es bedenkenlos im öffentlichen Gespräch benutzen kann, ohne vorwurfsvoll gefragt zu werden, ob man nicht ohne Fremdwörter auskommen könne. Dabei ist Quantensprung ein Fachausdruck aus der Sphäre der Wissenschaft. Er beruht auf einem Vorschlag, den Max Planck (1858 – 1947) zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht hat, um die Farben erklären zu können, die feste Gegenstände annehmen, wenn ihnen immer mehr Hitze zugeführt wird und sie erst rot, dann gelb und zuletzt weiß glühen. Planck zeigte, dass man diesen physikalischen Vorgang nur verstehen kann, wenn die Atome, die das Licht aussenden, ihre Energie dabei nicht als kontinuierlichen Strom aussenden, sondern stückweise – sozusagen in Form von Paketen – auf die Reise schicken. Und sie können solch ein wohldefiniertes Quantum an Energie genau dann freilassen, wenn sie einen Quantensprung machen, wie man heute zwar weiß, wie Planck und seine Kollegen aber erst noch mühsam lernen mussten. Sie hatten zunächst Schwierigkeiten, sich überhaupt erst einmal an den Gedanken zu gewöhnen, dass es diskrete Päckchen in der Natur gibt. Bis dahin hatten sie geglaubt, die Wirklichkeit sei kein lückenloses Ganzes. Dies ist aber nicht der Fall. Die Natur hat etwas Unstetiges – »Quantenhaftes« – an sich, die Atome und das Licht sind quantisiert, wie es im Fachjargon heißt, wobei das ungläubige Staunen am Anfang sich am Ende in ein unfassbares Wundern verwandelt. Denn es ist paradoxerweise gerade der als Quantum bezeichnete und für einen Quantensprung nötige Bruch in der Realität, der aus der Wirklichkeit ein zusammenhängendes Ganzes macht (siehe »Einsteins Spuk«).
Ein erhoffter Quantensprung in der Ökonomie bzw. das Einschalten von Licht kann als durchgehende Linie gezeichnet werden (a); bei echten Quantensprüngen von Atomengeht das nicht (b). Wer sie darstellen will, muss den Stift dazu absetzen. Anders als in Bilanzen tauchen im Naturgeschehen tatsächlich Lücken auf, die wir hinnehmenmüssen. Die Natur macht wirklich Sprünge. Sie ist ganz tief innen ganz anders, als die Menschen seit Jahrtausenden vermutet haben.
Aber alles der Reihe nach: »Quantum« ist ein Wort, das Planck dem Alltagsgebrauch entnommen und für die Physik präzisiert hat. Hingegen ist »Quantensprung« ein Wort, das ursprünglich aus der Physik kommt, inzwischen aber allgemein benutzt wird und wie die Begriffe Energie und Gen fast geräuschlos Eingang in die Umgangssprache gefunden hat. In den drei genannten Fällen ist dies schon deshalb merkwürdig, weil trotz einer beim ersten Hören eingängigen Anschaulichkeit niemand so ganz genau weiß, was mit den Begriffen gemeint ist. Denkt nicht jeder bei Energie an etwas anderes? Und hat nicht jeder bei den Genen seine ganz besonderen Vorstellungen?
Für die Quantensprünge gilt auf jeden Fall: Wenn Wirtschaftsbosse und andere Führungskräfte unserer Gesellschaft davon reden, dann weisen sie neben ihrer Flexibilität auch nach, dass sie nicht ahnen, was mit dem Konzept ursprünglich gemeint war und was sein Verständnis zwar schwierig, aber zugleich auch lohnenswert machte (und macht). Wenn Manager oder andere Macher von Quantensprüngen in der Entwicklung reden, dann meinen sie einen plötzlich eintretenden riesenhaften Sprung nach vorne bzw. nach oben, an dessen Ende das von ihnen geleitete Unternehmen mit großartigen Umsatzsteigerungen prunken kann. Wenn man diesen Geschäftsverlauf als Bilanzlinie zeichnet, könnte sie so aussehen, wie im ersten Teil der Abbildung Quantensprung gezeigt wird. Die Kurve, die wir da sehen, steigt sehr steil an, aber stets so, dass man den Stift nicht absetzen muss, um sie zu zeichnen. Das ist wie beim Einschalten von Licht. Auch da scheint ohne Zeitverzögerung aus Dunkelheit Helligkeit zu werden, aber nur, wenn man nicht genau genug hinschaut. Wer dies tut, wird einen zwar nicht gemächlichen, aber im Detail trotzdem allmählichen Anstieg erkennen. Die Entwicklung bzw. der Übergang mag rasend schnell verlaufen, beide gehen kontinuierlich vonstatten – und am liebsten stetig nach oben oder zum Hellen hin.
Bei einem echten Quantensprung in der Natur geht das nicht mehr. Man muss den Stift absetzen, wenn man den Sprung zeichnen will. Übergänge gehen in der Quantenwelt völlig anders vonstatten als in der Geschäftswelt oder im Wohnzimmer. Quantensprünge taugen also nur bedingt (wenn überhaupt) als Vorbild für ein erträumtes Wirtschaftswachstum, und dafür gibt es noch zwei weitere Gründe. Quantensprünge gehen nämlich zum einen zumeist nach unten in einen Grundzustand, in dem dann alles faul herumliegt und nichts weiter passiert, und sie stellen zum anderen die kleinste Änderung dar, die in der Natur möglich ist. Nur wenn nichts passiert, passiert weniger, und man könnte sich fragen, wie der Quantensprung unter diesen Vorgaben seine Karriere bis in die höchsten Etagen der Wirtschaft machen konnte.
Der Auftritt des Quantums
Die Frage stellt sich ganz allgemein, wie es manche Wörter wie Energie, Potential und Information schaffen, den vermeintlichen Elfenbeinturm der Wissenschaft zu verlassen, um Gesprächsstoff bis in die Kneipen hinein zu liefern (und warum andere wie Entropie, Enzym oder Genom dabei scheitern). Wir wollen trotz ihrer Dringlichkeit nicht versuchen, die Frage hier zu beantworten, sondern uns endlich dem Quantum zuwenden, das in dieser Einzahl aus der lateinischen Sprache stammt, dort eine Menge (wie viel) angibt und im täglichen Leben die Größe erfasst, die einer Sache angemessen ist oder einer Person zusteht – man kann etwa sein Quantum an Süßigkeiten bekommen und konsumieren.
Dieses althergebrachte Wort bekam im Jahr 1900 eine neue und höchst präzise Bedeutung, wobei der Urheber dieser Veränderung nicht ahnen konnte, dass er im Begriff war, eine wissenschaftliche Revolution ohnegleichen anzuzetteln. Am 14. Dezember 1900 erklärte der damals bereits 42-jährige Max Planck – Professor für Theoretische Physik an der Universität Berlin – auf einer Sitzung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, dass es ihm gelungen sei, ein altes Problem der Physik auf eine neue Weise zu klären, und zwar mit dem, was er ganz korrekt als Quantum der Wirkung vorstellte und durch den Buchstaben h bezeichnete, bei dem es bis heute geblieben ist.
Warum Planck seinem Quantum das kleine h zugeordnet hat, wird in der Fachliteratur entweder überhaupt nicht oder mit dem Hinweis erklärt, dass die ersten und letzten drei Buchstaben des Alphabets von der Mathematik besetzt sind und dass die Physik ihre Konstanten gerne um die ebenfalls schon eingesetzten i und j sucht. Hier war das h noch frei, nachdem Planck vorher höchstpersönlich das k in die Gesetze der Physik eingeschleust hatte. Diese Erklärung stimmt zwar, sie wirkt aber für eine so wichtige Größe zu langweilig, und ich denke, dass Planck (unbewusst) mit h nicht einen zufällig freien Buchstaben gefunden hat, sondern einen, der ihm für dieses Problem angemessen schien. Schließlich ist h ziemlich überflüssig, man spricht es kaum aus, und schmerzlich vermissen wird man es in vielen Wörtern nicht. Wenn wir gezwungen würden, einen Buchstaben unseres Alphabets zu opfern, wäre h ein guter Kandidat. Wie wir noch sehen werden, hielt Planck sein Quantum ebenfalls für physikalisch überflüssig, und es kam ihm tatsächlich fast unaussprechlich vor (siehe »Plancks Prinzip«).
Die Farben der schwarzen Körper
Das physikalische Problem, mit dem Planck sich damals beschäftigte, wirkt eher banal für jemanden, der sich zum ersten Mal damit vertraut macht. Es geht um das Licht, das erhitzte Gegenstände ausstrahlen, die in der Physik merkwürdigerweise Körper heißen, obwohl in ihnen ebenso wenig Lebendiges steckt wie in Himmelskörpern.
Wer einem Gegenstand – etwa einem massiven Eisenklotz – unentwegt Wärme zuführt, kann beobachten, wie sich dessen Farbe ändert. Die Physiker arbeiten aus guten Gründen gerne mit schwarzen Körpern, weil sie kein Licht reflektieren und folglich ihr Leuchten allein durch die Hitze bedingt ist. An ihnen verfolgen sie, wie das unbunte Aussehen allmählich aufhört und die Wärme erst zu einer Rot- und dann zu einer Gelbfärbung führt, die im konkreten Material zu einem Weißglühen übergeht.
Die Physiker vor Planck – nicht zuletzt Gustav Kirchhoff, sein Vorgänger in Berlin – hatten mit höchster Genauigkeit gemessen, welches Licht die zunächst schwarzen Körper unter diesen Umständen freisetzten, und sie konnten zeigen, dass deren Strahlung höchste Regelmäßigkeit innewohnte. Die Farben ergaben sich nicht als zufällige Lichteffekte, sie enthüllten vielmehr ein allgemeines Naturgesetz. So etwas lockte Planck. Nur – wie sah das Gesetz aus? Wie konnte man es finden? Mit welchen Messgrößen und welcher Mathematik konnte es formuliert werden?
Natürlich war Planck nicht ohne Konkurrenz auf der Suche nach dem, was in Fachkreisen als Strahlungsgesetz bezeichnet wurde. Es gab eine Menge Vorschläge, die vorherzusagen versuchten, welche Farbe ein schwarzer Körper annimmt, wenn man ihn auf eine bestimmte Temperatur gebracht hat. Genau das sollte das Strahlungsgesetz bzw. die es ausmachende Strahlungsformel können – aus der Temperatur des schwarzen Körpers die Farbe berechnen, die das ausgestrahlte Licht zeigt.
Die Aufgabe klingt nicht so dramatisch, dass man bei ihrer Lösung eine Revolution erwarten würde, aber hinter jedem auch noch so kleinen Problem kann eine tiefe Einsicht lauern, deren Vollzug die Welt mehr verändert als die meisten militärischen Unternehmungen, von denen unsere Geschichtsbücher erzählen. Plancks Lösung der Schwarzkörperstrahlung und seine Einführung von Quantensprüngen ist solch ein Fall, auch wenn dies nicht unmittelbar einsichtig wurde, als er im Dezember 1900 seinen Lösungsvorschlag für ein Strahlungsgesetz vorstellte und den Weg erläuterte, den er dazu gegangen war.
Das Plancksche Strahlungsgesetz handelt von der Energie eines schwarzen Körpers und gibt ihr Spektrum an. Es gibt verschiedene Formen des keineswegs einfachen Gesetzes. Wir notieren hier die Formel, die Physiker als spektrale Energiedichte (bezeichnet als E) kennen. Sie hängt ab von der Frequenz ν des Lichtes, der Temperatur T des schwarzen Körpers und einigen physikalischen Konstanten, die h, k, und c heißen. Mit π ist die Kreiszahl gemeint, und e stellt Eulers Zahl dar (siehe dazu den gleichnamigen Beitrag). Wir interessieren uns nur für die Konstante h, die von Planck stammt und als Quantum der Wirkung bekannt ist. Ihr Wert lautet (in physikalischen Einheiten, die ein Produkt aus Energie und Zeit sind):
Diskret schwingende Atome
Planck hatte sich die alten Lösungsversuche seiner Kollegen angesehen, die alle davon ausgingen, dass Materie aus Atomen besteht, die irgendwie schwingen und auf diese Weise Energie aufnehmen und abgeben können. Die Klassische Physik behandelte Atome wie die schwingenden Saiten eines Klaviers, und dabei tauchte ein scheinbar unlösbares Problem auf. Wer eine Taste des Saiteninstruments anschlägt, setzt nach und nach alle Saiten in Bewegung. Dafür hatte die Physik sogar einen besonderen Lehrsatz formuliert, den man als Gleichverteilungssatz der Energie kannte. Er kommt beim Klavier in der Praxis nicht zum Tragen, da niemand so langsam spielt, bis aus einem einzelnen Ton ein Klangbrei wird. Aber bei den erhitzten Atomen gab es keine Eile. Man konnte die Temperatur eines Körpers festhalten und warten, bis alle Atome angeregt waren – und hier steckte das Problem. Wenn wir das erhitzte Stück Materie mit dem Klavier vergleichen wollen, müssen wir ihm sehr viele Tasten mit sehr vielen Saiten zur Verfügung stellen, die alle bei der Verteilung zu berücksichtigen sind. Allerdings würden die meisten davon unhörbare Töne produzieren, mit der Folge, dass wir nach dem Satz von der Gleichverteilung nichts mehr hören würden. Im analogen Fall des erhitzten schwarzen Körpers sagte die traditionelle Physik voraus, dass dessen Strahlung unsichtbar werden würde, was offensichtlich Unfug war. Die Körper glühten in leuchtenden Farben, und das zu erklären verlangte eine neue Idee, die Planck 1900 in den Sinn kam.
Er wollte unbedingt an der Gleichverteilung festhalten, was bedeutete, dass er zunächst annahm, alle Atome würden gleich schwingen (oszillieren). Danach entschloss er sich aber in einem »Akt der Verzweiflung«, wie er es selbst nannte, die von ihnen dabei freigesetzte Energie »als eine Summe von diskreten, einander gleichen Elementen anzusehen«. Damit fasste er zum ersten Mal das in Worte, was wir heute als Quanten kennen – eben diskrete, einander gleiche Elemente der Natur.
Wie lösten sie das oben beschriebene Problem der unsichtbar werdenden Farben? Solange sich die Energie kontinuierlich verteilen kann, solange hält sie nichts auf, ins Uferlose abzuwandern, um im Sichtbaren zu wenig zurückzulassen, um noch gesehen zu werden. Wenn die Energie aber nur in diskreten Einheiten auftritt und sich auf diese Weise gleichverteilt, dann wird es eine Grenze geben, bis zu der die Energie abfließen kann. Wenn die Tür einer öffentlichen Toilette nur mit einer Ein-Euro-Münze geöffnet werden kann, dann nützen mir alle Cents der Welt in meinem Portemonnaie nichts, auch wenn ich ein höchst dringendes Bedürfnis habe. Ich kann mein Geld nicht loswerden, und der erhitzte Körper kann die ihm gelieferte Energie nicht so loswerden, wie die Physik es vorschreibt. Die Quantennatur der Energie verhindert, dass sie sich beliebig verteilen kann; sie bleibt im Sichtbaren hängen, wie Planck präzise und in höchster Übereinstimmung mit den experimentellen Daten ausrechnen konnte.
Das Ende der Klassischen Physik
So befriedigend dieses Ergebnis war, etwas ärgerte Planck dabei von Anfang an (und das blieb so bis zum Ende seines Lebens). Damit die diskreten Energieelemente es erlaubten, die richtige Strahlungsformel abzuleiten, mussten sie mit der Farbe (Frequenz) des Lichtes verknüpft werden, und zwar ganz einfach und direkt: Jede Energieeinheit des Lichtes musste proportional zu seiner Frequenz sein.
Das Wort »proportional« drückt bekanntlich aus, dass zwei Dinge sehr direkt verknüpft sind – der Weg, den man zurücklegt, ist proportional zu der Zeit, die man unterwegs war (wenn man nicht schlappgemacht oder pausiert hat), und der Geldbetrag, den ich für das Benzin zahlen muss, das ich tanke, ist proportional zu der Menge, die ich abzapfe. Dabei interessieren wir uns sehr für die Faktoren, die das Proportionale ausdrücken. Sie bekommen in den Diskussionen gehaltvolle Namen und spielen eine besondere Rolle. Im ersten Fall ist es unsere Geschwindigkeit, im zweiten Fall ist es der Benzinpreis, und in Plancks Fall ist es das Quantum, das auf diese Weise seinen Weg in die Geschichte der Physik gefunden hat.
Wer in Büchern oder im Internet Auskunft über das Quantum bekommen will, sollte nach dem Quantum der Wirkung suchen, denn genau unter diesem Namen hat Planck es der Öffentlichkeit vorgestellt. Unter »Wirkung« versteht man allerdings nicht das, was angesprochen wird, wenn etwa von der Wirkung einer Kopfschmerztablette die Rede ist. Wirkung ist vielmehr eine präzis definierte Einheit der Physik, und sie entsteht, wenn man Energie und Zeit miteinander multipliziert.
Eine solche Größe – eine Wirkung – musste Planck einführen, um die Energie von Licht mit seiner Frequenz gleichsetzen zu können. Unter der Frequenz eines Ereignisses versteht man die Häufigkeit, mit der es eintritt, und sie wird als Anzahl pro Zeiteinheit angegeben. Um dies mit einem Energiewert gleichsetzen zu können, muss sie mit einer Wirkung – dem Quantum der Wirkung – multipliziert werden.
Solange das nur eine mathematische Vorschrift war, konnte Planck damit leben. Aber diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Sie hielt nur fünf Jahre. Dann gelang es einem damals noch unbekannten Angestellten am Berner Patentamt namens Albert Einstein, den ersten echten Gebrauch von Plancks Quantum zu machen und zu zeigen, dass es nicht nur eine rechnerische Hilfsgröße, sondern eine physikalische Realität ist.
Der im Jahre 1905 gerade 26-jährige Einstein versuchte damals Experimente zu verstehen, bei denen es umgekehrt als bei Plancks schwarzen Körpern zuging. Während Planck wissen wollte, wie Licht aus der Materie herauskommt, wollte Einstein verstehen, wie der umgekehrte Vorgang abläuft und Licht wieder in die Materie hineinkommt. Wer geeignete Strahlen auf einen elektrischen Draht lenkte, konnte dessen Leitfähigkeit erhöhen, und Einstein erkannte, dass Plancks Vorstellung, bei der die Energie von Licht durch seine Frequenz gegeben ist, genau und in jedem Detail erklären konnte, was die Messungen ergeben hatten.
Plancks mathematisches Spielchen wurde jetzt physikalisch ernst, was dem Erfinder des Quantums Sorge bereitete. Er steckte tief in der Tradition seiner großen Wissenschaft, und zu den größten Leistungen der Physik zählten die Einsichten, die ihre Schöpfer gerne als Hauptsätze bezeichneten. Der erste und von Planck nahezu als heilig verehrte Hauptsatz der Physik besagte, dass die Energie der Welt stets erhalten bleibt. Man kann Energie – was immer das ist – weder erzeugen noch vernichten. Sie bleibt unzerstörbar und kann nur ihre Form wechseln – von Bewegungs- in Wärmeenergie oder von elektrischer in magnetische Energie, um nur zwei Beispiele zu nennen, die auch umgekehrt ablaufen können.
Energie ist immer konstant, wie Plancks feste und fast mit religiöser Inbrunst vertretene Überzeugung lautete, und nun sollte sie proportional zu einer Frequenz sein, die sich nur durch ein Zählen von Taktschlägen – tack, tack, tack – messen lässt, ohne dass die Physik wüsste, wie sie dazwischenkommt.
Mit Einsteins Einsicht war 1905 klar, dass Plancks Quantum der Wirkung einen Quantensprung für die Wissenschaft darstellte. Die Natur machte – allen Beschwörungen vergangener Jahrhunderte zum Trotz – doch Sprünge, und wenn auch noch niemand verstehen konnte, wie sich die dabei erkennbare Leerstelle der Welt überbrücken oder ausfüllen ließ, so gab es doch bald eine erste philosophische Beruhigung dank ihrer Hilfe. Wie sich nämlich bald herausstellte, sorgte gerade die Quantennatur der Atome dafür, dass sie nicht so leicht aus der Fassung zu bringen waren. Positiv ausgedrückt – mit Plancks Entdeckung entfiel für Atome und andere Gegebenheiten die Möglichkeit, sich geräuschlos und kaum merklich zu ändern. Sie mussten – im Gegenteil – Quantensprünge vollführen, um an ihrem Zustand etwas zu ändern, und dazu reichte zumeist ihre Energie nicht. Auf diese Weise konnte man plötzlich erklären, warum es überhaupt eine stabile Welt geben konnte. Das Quantum der Wirkung – das Quantenhafte der Natur – verhinderte, dass Atome ins Rutschen kamen und sich in Nichts auflösten. Und selbst nachdem es ihnen gelungen war, sich von irgendwoher den Schwung oder die Energie zu besorgen, die nötig war, um einen Quantensprung zu machen, landeten sie nur in einem neuen Zustand, der von einer noch höheren Quantenmauer umgeben war. Tatsächlich erklären die Quantensprünge vor allem, was es der Natur so schwer macht, sich zu ändern. Es wird zudem nach jedem solchen Fortschritt schwieriger.
Trotzdem ist anzunehmen, dass sich dadurch die Beliebtheit der Quantensprünge für Festreden ebenso wenig ändert wie Plancks Abneigung bzw. Skepsis seiner Entdeckung gegenüber. Sie hat ja selbst dann nicht abgenommen, als man ihn dafür mit dem Nobelpreis für Physik (1918) auszeichnete. Er ist übrigens der erste theoretisch forschende Vertreter seines Fachs, der diese hohe Auszeichnung erhalten hat. Alfred Nobel, der Stifter, wollte nur wissenschaftliche Fortschritte belohnen, die von praktischem Nutzen sind. Bei dem Quantum der Wirkung sah man diese Bedingung nicht erfüllt. Wenn man ihnen gesagt hätte, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Großteil der Weltwirtschaft mit Produkten erwirtschaftet wird, die Menschen nur entwickeln konnten, weil sie Plancks Quantum kennen – sie hätten es nie und nimmer geglaubt.
Heisenbergs Unbestimmtheit