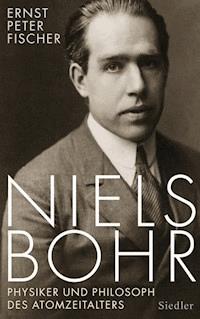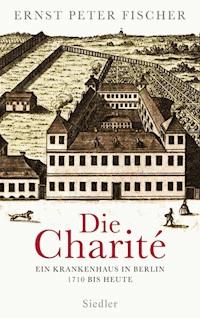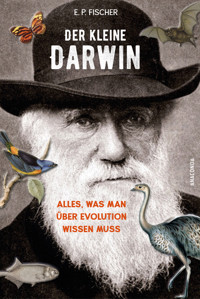4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Alles auf Empfang gestellt Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen – jeder kann die klassischen fünf Sinne aufzählen. Doch wer weiß schon, was in den Zellen passiert, um die gesammelte Information ins Gehirn zu bringen? Wie kommt es, dass dabei Empfindungen entstehen, wir Genuss oder Ekel verspüren? Und was hat es damit auf sich, dass wir Blicke spüren können oder gar für Übersinnliches empfänglich sind? Der renommierte Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer sucht nach dem Sinn der Sinne und durchleuchtet dabei unsere körpereigenen Antennen für die Außenwelt auf charmant-kluge und unterhaltsame Weise. Ein Muss für alle, die sich selbst kennenlernen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2013 F. A.Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: shutterstock-images
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-7766-8176-5
Inhalt
Prolog: Wahrnehmung und Wirklichkeit
Die klassischen Sinne
1. Licht auf dem Weg zum Sehen
2. Lockstoffe in der Nase
3. Vom Geschmack der Speisen
4. Ein großes Organ mit wenigen Haaren
5. Vom schwankenden Luftdruck zum musikalischen Eindruck
Weitere Sinne im Wechselspiel
1. Ein balancierender Apparat im Kopf
2. Das Gespür für den eigenen Körper
3. Von verborgenen Sinnen beim Menschen
Der siebte Sinn
Andere Wahrnehmungen in der Welt – Sinne von Tieren und ihre Besonderheiten
Die Entwicklung der Sinne
Zuletzt: Die Sinne des Einzelnen und der Sinn des Ganzen
Anhang
Literatur
Quellen- und Bildnachweise
Register
Prolog
Wahrnehmung und Wirklichkeit
»Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen; dies beweist die Freude an den Sinneswahrnehmungen (aisthesis), denn diese erfreuen an sich, auch abgesehen von dem Nutzen, und vor allen anderen die Wahrnehmungen mittels der Augen.«
So steht es im ersten Satz der Metaphysik des Aristoteles, und der Philosoph der Antike weist mit diesen Worten auf eine Fähigkeit hin, die in kopflastigen Zeiten mit fernsehenden Zeitgenossen, die zudem mehr in Handys als mit ihrem Gegenüber sprechen, leider eher untergeordnet behandelt wird. Gemeint ist die Qualität der Wahrnehmung, mit der es Menschen und anderen Geschöpfen gelingt, die sie formende und umgebende Wirklichkeit über das Vermögen ihrer Sinne einzufangen und kennenzulernen. Das dazugehörige griechische Original der aisthesis macht deutlich, dass es dabei um die spürbaren und offenkundigen Schönheiten der Dinge geht. Es handelt sich um das Vergnügen, das sich Menschen auf sinnliche Weise am Naturschönen bereiten können, wenn sie sich mit den im Lauf ihres evolutionären Werdens entstandenen Organen dem Wirklichen öffnen, das sie geformt hat. Dabei werden sie unter anderem sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken – und mit diesen sinnlichen und sinnreichen Tätigkeiten die Welt um sich herum und das Leben in ihr genießen.
Der menschliche Wille zum Wissen beginnt mit dem von Aristoteles beschriebenen ästhetischen Vergnügen, das selbst viele die Glotze anstarrende Menschen sicherlich längst erfahren haben. Und es lohnt sich, diesen befriedigenden Zusammenhang im Auge zu behalten, denn wie Leonardo da Vinci in den Jahren der Renaissance seine möglicherweise heute überraschend klingende Überzeugung beschrieben hat: »Mir scheint, es sei jegliches Wissen eitel und voller Irrtümer, das nicht von der Sinneserfahrung, der Mutter aller Gewissheit, zur Welt gebracht wird und nicht im wahrgenommenen Versuch abschließt.«
Tatsächlich – auch wenn viele Philosophen aus aufgeklärten Zeiten eher skeptisch auf das Gewimmel von wahrgenommenen Eindrücken und ästhetischen Erfahrungen meinten blicken zu müssen und sich lieber an streng wirkenden Begriffen orientierten, so gilt doch mit dem Kopf ernst zu nehmen und im Herzen zu bedenken, was der in Italien lebende Dominikaner und Dichter Tommaso Campanella im frühen 17. Jahrhundert notierte, dass nämlich »das Urteil der Sinne – das Wissen durch Wahrnehmung – sicherer ist als jedes andere unserer Erkenntnisvermögen«. Viele Menschen wissen eher durch die Wahrnehmung eines ihnen gegenübersitzenden Artgenossen, ob sie ihm oder ihr Vertrauen schenken können oder besser Vorsicht geboten ist, als durch die Prüfung seiner begrifflichen Verlautbarungen.
Kunst fällt nicht vom Himmel. Sie wird vielmehr von Menschen gemacht, die Künstler genannt werden und als solche bekannt sind. Wissenschaft fällt ebenso wenig vom Himmel und stammt ebenfalls von Menschen, die Forscher genannt werden, die jedoch merkwürdigerweise einen sehr viel geringeren Bekanntheitsgrad haben als ihre artistischen Kollegen. Um dem abzuhelfen, sollen in diesem Buch ab und zu Informationen über Personen zusammengestellt werden, die zum Verständnis der Sinne beigetragen haben und im Text Erwähnung finden. Den Anfang machen zwei Klassiker der europäischen Kultur, nämlich Aristoteles und Leonardo da Vinci.
Aristoteles und Leonardo
Man sollte Aristoteles (384–322 v. Chr.) nicht nur als Philosophen sehen, sondern auch seine biologischen, physikalischen und astronomischen Beiträge zur Kenntnis nehmen. Was das Leben angeht, so sah Aristoteles zum einen eine Einheit in allen Organismen, die er auf einer scala naturae (Stufenleiter der Lebensformen) verbunden sah. Und er stellte sich zum Zweiten vor, dass Leben durch zwei Komponenten zu definieren ist, die er hyle und eidos nannte und die heute als Materie und formbildendes Prinzip verstanden werden können. Was die Sinne angeht, so schlug Aristoteles nicht nur die klassische Fünfzahl vor, er vertraute seinen Sinnen zudem, um so etwas wie den Sinn der Natur – oder zumindest ihre Gesetze – zu erkennen. Leider hat er dabei manchen Bock geschossen und zum Beispiel die Ansicht vertreten, dass das Gehirn den Körper eines Menschen kühlt, während er mit seinem Herzen denkt.
Leonardo da Vinci (1452–1519) war »Maler, Architekt und Bildhauer, Dichter und Komponist, Fechter, Springer und Athlet, Mathematiker, Physiker und Astronom, Kriegsingenieur, Instrumentenmacher und Festarrangeur, erfand Schleusen und Kräne, Mühlenwerke und Bohrmaschinen, Flugapparate und Unterseeboote; und all diese Tätigkeiten hat er nicht als geistreicher Dilettant ausgeübt, sondern mit einer Meisterschaft, als ob jede von ihnen sein einziger Lebensinhalt gewesen wäre« So beschreibt Egon Friedell in seiner »Kulturgeschichte der Neuzeit« das Universalgenie der Renaissance, das als Maler den Vorgang des Sehens berücksichtigen möchte, mit dem ein Beobachter ein Bild betrachtet und dies wie folgt ausgedrückt hat, wie in der Ausstellung nachzulesen, die im Jahre 2000 in Tübingen zu sehen war und die sich Leonardo als »Wissenschaftler, Erfinder, Künstler« widmete:
»Der Künstler muss etwas dem Beschauer überlassen: Wir sind gewohnt, zu ergänzen, was wir nicht sehen, und gerade dieses Ergänzenmüssen erhöht den Eindruck der Lebendigkeit. Wenn der Maler darum die Umrisse nicht ganz fest zieht, wenn er die Formen ein wenig unbestimmt lässt, wenn Licht und Schatten ineinander verschwimmen, dann kann der Eindruck von Trockenheit und Steifheit nicht entstehen.« Vielleicht lohnt mit dieser Kenntnis ein neuer Blick auf die »Mona Lisa« und ihr Lächeln.
In der Tat: Menschen sind primär ästhetische Wesen, wie aus den Zitaten zu lernen ist, und erst recht, wenn sie als Kinder heranwachsen. Sie gelangen zur Welt über die Sinne, deren Ansichten und Informationen Freude bereiten können, und es lohnt sich, diesem sensorischen Zugang zu den Dingen und ihren Qualitäten nachzuspüren und das Tor zu ihm weiter zu öffnen. Er kann das Vergnügen vermehren, das Menschen ihren Sinnen verdanken, die sie offen für die Welt machen.
Über wie viele Sinne kommt die Welt in einen Menschen?
Wer einmal A wie Aristoteles gesagt hat, wenn es um die Bedeutung der Sinne geht, der muss den Philosophen auch ein zweites Mal bemühen, wenn es um die uralte Frage geht, über wie viele Sinne und mit wie vielen und welchen Organen es einem Menschen denn nun gelingt, sich die äußere Welt als inneres Bild oder persönliche Vorstellung anzueignen und einzuverleiben. Der berühmte Grieche hat darauf bekanntlich mit der vielfach zitierten Zahl Fünf geantwortet und sogar gemeint, es ließe sich mit einem Blick auf den menschlichen Körper zeigen, dass es mehr als fünf Sinne nicht geben könne. Schließlich verfügten Menschen nur über eine Handvoll Organe, mit deren Hilfe sie Signale oder Reize aus der sie umgebenden Welt empfangen können – die Augen zum Sehen, die Ohren zum Hören, die Nase zum Riechen, die Zunge zum Schmecken und die Haut zum Fühlen. Die antike Idee einer philosophisch abgesegneten Fünfzahl hat sich nicht nur lange – mindestens bis in meine Schulzeit – in den Bildungsanstalten gehalten, sie ist auch immer wieder einmal grundsätzlich zum übersichtlichen Verständnis der Natur eingesetzt worden. Unter anderem sollte die Sinneszahl helfen, die Vielzahl bei den lebenden Menschen begreiflich zu machen, wie man etwa an einer Bemerkung des deutschen Naturforschers Lorenz Oken ablesen kann, der im 19. Jahrhundert in einer »Naturgeschichte für Schulen« meinte, er kenne zwar nur ein Menschengeschlecht, »aber nach der Entwicklung der Sinnesorgane gibt es fünf Menschenarten: der Hautmensch ist der Schwarze, Afrikaner; der Zungenmensch der Braune, Austrasier; der Nasenmensch der Rothe, Amerikaner; der Ohrenmensch der Gelbe, Asier; der Augenmensch der Weiße, Europäer«, wobei der Leser dann vergeblich auf eine Begründung dieser Zuweisungen wartet.
Wie Aristoteles gibt Oken – wenn auch mit anderer Betonung und in durchschaubarer ärgerlicher Absicht – dem Auge mit seinem Sehvermögen eine besondere Stellung, und er hält die menschlichen Fensterlein zur Natur offenbar für »das höchste Organ, die Blüthe oder vielmehr die Frucht aller organischen Reiche«. Wobei interessanterweise angemerkt werden kann, dass sich der junge Dichter und eigenwillige Naturwissenschaftler Georg Büchner die eben zitierten Ansichten seines Lehrers Oken in seiner Probevorlesung aus dem Jahr 1836 zu eigen macht und sie ausdrücklich als wissenschaftliche Lehre seiner Zeit vorstellt. Wie selbst ein Genie danebentappen kann, wenn es den Begriff vor die Anschauung stellt und damit die Augen vor der Wirklichkeit in der erlebten Welt verschließt.
Als, wie erwähnt, zu meiner Schulzeit in den 1960er-Jahren die Frage nach der Zahl der Sinne gestellt wurde, galt die Fünf immer noch als die richtige Antwort. Für sie gab es eine gute Note, auch wenn jeder längst andere Erfahrungen kannte und niemand Mühe gehabt hätte, sinnerfüllte Begriffe wie Gleichgewichtssinn oder Schmerzsinn zu verstehen, um mit ihnen den antiken Katalog zu erweitern. Wenn eine Sinnesleistung durch die Fähigkeit einer Person definiert wird, auf eintreffende Reize aus der Umwelt zu reagieren, um mit ihrer Hilfe und dank der Vermittlung durch empfindliche Organe relevante Eigenschaften der Umgebung wahrzunehmen, dann gehören ganz sicher die höchst unangenehmen Empfindungen mit dazu, die etwa bei brennenden Schürfwunden oder durch einen verdorbenen Magen auftreten. Darüber hinaus versteht nicht nur jeder Rad- oder Rollerfahrer, dass sein bewegter Körper wissen sollte, wie im Normalfall ein unfallträchtiges Umfallen zu vermeiden ist und das Gleichgewicht gehalten werden kann.
Bevor die Zählung der menschlichen Sinne über die sieben bisher genannten Eigenschaften fortgeführt wird, soll noch einmal ein Blick auf die beliebte antike Fünf geworfen werden, selbst wenn sie inzwischen als überholt gelten kann, wie gleich noch weiter exerziert wird. Es sollte sich trotzdem lohnen, die antike Sinneszahl genauer zu bedenken, denn immerhin hat sie sich mehr als 1000 Jahre lang gehalten und den Menschen zumindest in Europa als Antwort gereicht, wofür sich sicher ein Grund finden lässt. Nur von europäischen Ansichten über Sinne kann in diesem Buch die Rede sein, auch wenn es zahlreiche faszinierende Berichte über ungewöhnliche Wahrnehmungskünste etwa von Polynesiern gibt, die einsam in ihrem Boot auf dem Meer selbst unter grauem Himmel und ohne Sicht der Sonne bestens orientiert bleiben und genau die Richtung anzusteuern in der Lage sind, die sie zu ihrem Ziel führt. Auch können die Songlines hier nicht ausgeführt werden, mit denen australische Aborigines ihre Bewegungen auf langen Märschen durch Töne – bevorzugt eine Melodie – steuern und mit ihrer Hilfe ihr Ziel mit geschlossenen Augen erreichen – also ohne die von Aristoteles bevorzugte Wahrnehmung der sie umgebenden Wirklichkeit.
Was die fünf klassischen Sinne angeht, so war es vielleicht ja so, dass es Aristoteles und seinen Anhängern und Nachfolgern gar nicht darauf ankam, möglichst alle Reize der äußeren Welt zu erfassen und dafür ein rezeptives Organ zu suchen. Viel interessanter schien ihnen vielmehr die sich anschließende Frage zu sein, was aus dem sinnlich Wahrgenommenen der äußeren Welt in den inneren Räumen des Denkens wurde. Und bei deren Inspektion konnte niemand leugnen, dass etwa ein strahlender, sprechender, riechender, fühlbarer und beim Küssen auch zu schmeckender Mensch dort als ein individuelles Ganzes in Erscheinung trat. Es musste also innen einen »Gesamtsinn« oder einen common sense geben, wie heute noch im Englischen benannt wird, was in der philosophischen Literatur ursprünglich als senso comune bezeichnet wurde. Dabei kann noch angemerkt werden, dass die deutsche Sprache merkwürdigerweise aus dem ursprünglichen »Gemein- oder Gemeinschaftssinn« im Lauf der Jahrhunderte einen »gesunden Menschenverstand« gemacht und das »Allgemeine« für das »Gesunde« aufgegeben hat.
Der gesunde Menschenverstand
Der englische common sense hieß auf Deutsch ursprünglich der »gemeine Menschenverstand« – gemeint war so etwas wie eine »allgemeine« Fähigkeit aller Personen beim gedanklichen Erfassen –, und heute benutzt die Muttersprache des Philosophen Immanuel Kant dafür den Ausdruck »gesunder Menschenverstand«. Sie meint damit ein Instrument, mit dem sich Einsichten in die umgebende Wirklichkeit ohne weiteres Nachsinnen und Reflektieren ergeben (ohne zu bemerken, was dabei schiefgehen kann). Viele Personen berufen sich gerne auf ihren gesunden Menschenverstand, wenn sie rasche Entscheidungen treffen müssen, ohne Zeit zum Nachdenken zu haben. Allerdings gilt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oft solche sind, die dem common sense widersprechen, wie man sich einfach klarmachen kann, wenn man an das Licht denkt. Die Physik lehrt, dass Licht sich mit konstanter Geschwindigkeit ausbreitet, unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle. Das Licht einer Taschenlampe etwa breitet sich also nachweisbar mit derselben Geschwindigkeit aus, ob die Lampe in einem fahrenden Zug oder auf einem Bahnhof eingeschaltet wird. Die Alltagserfahrung hingegen besagt, dass Geschwindigkeiten sich addieren und subtrahieren lassen. Der gesunde Menschenverstand kommt da nicht mit. Er sollte sich deswegen nicht grämen, sondern nur bemerken, dass auch ihm Grenzen gesetzt sind.
Wie dem auch sei: Alle unterschiedlichen Sinneseindrücke der Außenwelt werden von einem wahrnehmenden Menschen zu einem gemeinsamen Sinneseindruck in seiner Innenwelt verwoben, so stellte man sich jedenfalls den Vorgang vor, und wer jetzt zu zählen beginnt, wie viele Sinne sich daran beteiligen, wird bei der aristotelischen Fünf landen und mit ihr zufrieden sein. Wer zum Beispiel mit anderen Menschen beim Essen sitzt und sich überlegt, welche Empfindungen und Signale das angenehme Bild, das er von der erfreulichen Szene hat, in seinem Kopf schaffen, der wird mit dem Quintett aus Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten höchst zufrieden und in der Lage sein, mit ihm alle Details zu konstruieren und zu erfassen. Schmerzen, wie sie vielleicht von Pfefferschoten oder einer zu heißen Suppe verursacht werden können, kommen in dem Bild der Szene nur am Rande vor und werden in der Erinnerung gerne ausgeblendet, und das Gleichgewicht hängt vornehmlich vom Alkoholkonsum ab. Doch wenn der erst einmal hoch genug geklettert ist, dann fragt niemand mehr nach der Zahl der Sinne und erst recht nicht, seit wann es mehr als fünf gibt.
Mehr als fünf Sinne
Es gehört zu den besonderen Eigenschaften von – vornehmlich westlich orientierten – Menschen, immer etwas mit Zahlen ausstatten zu wollen. Im frühen 17. Jahrhundert hat zum Beispiel Galileo Galilei verkündet, dass man unterscheiden müsse zwischen den Dingen, die man schon vermessen habe, und den Dingen, die man noch vermessen werde. Aber zuletzt würden alle ihre Maßzahl bekommen, zum Beispiel auch die Temperatur der Hölle und die Breite und Höhe des Tores, das in sie hineinführt. In diesem vornehmlich europäischen Sinne gilt es auch, die genaue Zahl der Sinne zu bestimmen, mit denen Menschen sich zurechtfinden, und die ersten Schritte, die oben unternommen wurden, haben die Fünf überholt und die Sieben erreicht. Das heißt, eigentlich lassen sich schon jetzt ohne Mühe noch mehr Sinne angeben, da das traditionelle Quintett dem größten Organ des Menschen, seiner Haut, nur die Fähigkeit des Fühlens oder Tastens zubilligt. Tatsächlich – und das muss niemandem eigens gesagt werden – spürt die Haut auch, wie warm oder kalt es ist, vor allem, wenn dazu ein unangenehm kräftiger Wind weht, und man könnte und sollte diese Fähigkeit als Temperatursinn bezeichnen, womit in der Zählung erst einmal die Ziffer Acht erreicht wird.
Über die genannten Empfindungsqualitäten hinaus weisen die Experten der Sinne auf eine merkwürdig wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit findende Eigenschaft von Menschen hin, die man als Eigenwahrnehmung bezeichnen könnte und die im Fachjargon Propriozeption heißt. In diesem etwas mühsam zu sprechenden Ausdruck steckt eine Kombination aus den lateinischen Wörtern für »eigen« (proprius) und »aufnehmen« (recipere). Die als Eigenwahrnehmung erfasste Fähigkeit kann sich jede Frau (und jeder Mann auch) leicht spürbar zur Gemüte führen, wenn sie (oder er) sich etwa vorstellt, eine Hand hinter ihren (seinen) Rücken zu halten und sie zu einer Faust zu ballen. Man kann sich alternativ dazu auch in die Situation versetzen, an der Theke einer Bar zu stehen und den linken Fuß etwas anzuheben, ohne ihn sehen zu können. In beiden Fällen weiß der Körper genau und mühelos, was mit beiden Extremitäten geschieht und wo sie sich gerade in welchem Zustand befinden, und diese sinnliche Fähigkeit bekommt eine Person durch ein besonderes Organ vermittelt, das sich im Innenohr befindet und dort eine Art Vorhalle bildet, wie noch ausgeführt wird. Im alten Rom nannte man solche Gebäudeteile Vestibulum, weshalb die Eigenwahrnehmung des Körpers einem Vestibularorgan zugerechnet wird, mit dessen Hilfe Menschen jetzt ein neunter Sinn zur Verfügung steht (insgesamt also Sehsinn, Hörsinn, Geruchssinn, Tastsinn, Geschmackssinn, Gleichgewichtssinn, Schmerzsinn, Temperatursinn, Körpersinn).
Mit ihm wird die Zählung erst einmal abgebrochen, auch wenn manche Autoren es gerne bis zur Zehn oder gar darüber hinaus schaffen und dafür die Wahrnehmung der inneren Organe heranziehen. Man spricht in diesem Fall ausgehend von dem lateinischen Wort für »Eingeweide« – viscera – von den viszeralen Sinnen und meint damit die Empfindungen, die sich als Bauchschmerzen melden oder Menschen als Durst oder Hunger geläufig sind und sie auffordern, etwas dagegen zu unternehmen.
Einige Anmerkungen zum Unsinn
Es ist also eine Menge los im Reich der Sinne (siehe Kasten »Im Reich der Sinne«), und es sieht so aus, als ob derjenige, der nach den Sinnen sucht und ihnen dabei stets neue Vorsilben hinzufügt, auch auf den Gedanken kommen könnte, dass der Unsinn mit dazugehören sollte – natürlich nicht in der direkten Form, die das Fehlen eines sinnvollen Zusammenhangs andeutet. Tatsächlich hat die Einführung der Vorsilbe »un« im 20. Jahrhundert sehr viel Sinnvolles hervorgebracht, etwa dadurch, dass Physiker erst die Unstetigkeit der Natur in Form von Quantensprüngen bemerkt haben und im Anschluss daran die Unbestimmtheit der Gegenstände erfahren und hinnehmen mussten, die auf der atomaren Bühne eine Rolle spielen. Heute gehören Ausdrücke wie Unbeweisbarkeit, Unentscheidbarkeit, Ungenauigkeit und Unvorhersagbarkeit längst zum Standardrepertoire der exakten Naturwissenschaften, die sich so um den Unsinn in dieser eigenwilligen Bedeutung des Wortes verdient gemacht haben. Irgendwie scheinen die Forscher ständig bemüht zu sein, die Grenzen der Sinne zu erweitern, wobei die bekanntesten Beispiele in Form der Teleskope und Mikroskope schon aus dem 17. Jahrhundert stammen. Denen wiederum sind die Augengläser namens Brille vorausgegangen, die es etwa seit dem Jahr 1300 gibt, um den Sehsinn vor allem im Alter zu schärfen, wenn die Organe schwächer werden und ihre Zeitlichkeit spürbar wird. Es gehört zu den menschlichen Bedürfnissen, die Grenzen der von der Natur zur Verfügung gestellten Sinne zu erweitern oder zu überwinden, und dieser Wille bricht sich Bahn, auch wenn es passieren kann, dass dabei nur Unsinn entsteht.
Im Reich der Sinne
Wenn es um Sinne geht, dauert es nicht lange, bis vom Reich der Sinne die Rede ist. Die Sinne verschaffen Menschen tatsächlich ein Reich, in dem sie sich umtun, erfreuen und manchmal auch verlieren können. Im Reich der Sinne meint darüber hinaus etwas Besonderes, nämlich den Titel eines Films, in dem der japanische Regisseur Nagisa Oshima 1976 die Geschichte einer sexuellen Obsession auf die Leinwand brachte. Zwischen dem Besitzer eines Geisha-Hauses und einer dort tätigen Prostituierten entwickelt sich ein grenzenloses Lustbegehren, das beide aus der realen Welt entfernt und in die Welt der Leidenschaft sperrt. Die Lust wird dabei auch durch Schmerz gefördert, was den Mann wünschen lässt, im Liebesakt von der Frau getötet zu werden, was auch geschieht. Als der Film das erste Mal gezeigt wurde, wurde er als Pornographie verurteilt und beschlagnahmt. Heute versucht man, das gezeigte Begehren und die fatale Wirkung einiger Sinne auf das Verhalten von Menschen zu verstehen. Es fällt immer noch schwer. Im Reich der Sinne lebt es sich riskant.
Die klassischen Sinne
Die klassischen Sinne eines Menschen nutzen die klassischen Signale aus, die jede Person tagtäglich aus ihrer Umwelt empfängt und die ihr zur Orientierung dienen und Lust aufs Leben machen – das Licht, der Schall, der Duft, das Essen und die Berührungen, die dank der Haut vermittelt werden. Wer morgens erwacht, spürt vielleicht zunächst noch die wohlige Kuschelwärme der Bettdecke, bevor er oder sie mit den sich behutsam öffnenden Augen das lockende Licht der ersten Sonnenstrahlen wahrnimmt. Anschließend hört sie oder er mit den die ganze Nacht offenen und jetzt aufmerksam lauschenden Ohren ein hoffentlich freundliches »Guten Morgen«, und danach dauert es in vielen Fällen nicht mehr lange, bis zum Beispiel der Kaffeeduft mit seinem Aroma die Zimmer durchströmt und die Nase erreicht, was das Gehirn unmittelbar anspricht und den Sinnesempfänger bald zum Gang an den Frühstückstisch lockt, an dem der Geschmack auf seine Kosten kommt, wenn etwa ein Brot mit Marmelade oder ein Müsli mit Früchten angeboten und angenommen werden, wobei die Nase dadurch mitmacht, dass der Weg der Speise in den Mund nicht an ihr vorbeikommt.
Mit anderen Worten: Kaum wach, öffnen sich die Menschen für eine Welt voller Sinneserlebnisse, auf die viele von ihnen schon warten, und zwar meistens voller Freude. Mit den Sinnen und ihren Organen nehmen Menschen an der sie umgebenden und sie nährenden Welt teil. Sie empfangen die Signale der sie einhüllenden Wirklichkeit mit körpereigenen Bausteinen, die in der Fachwelt Rezeptoren heißen, was seinen sachlichen Klang verliert, sobald dafür Empfänger gesagt wird und man sich daran erinnert, dass Menschen ihren Gästen gerne einen begeisternden Empfang bereiten. In diesem Fall sind es die Signale der äußeren Welt, die als Gäste zu den Menschen kommen, und auf den folgenden Seiten sollen die Wege verfolgt werden, auf denen sie in die Innenräume gelangen, um hier zu dem bewussten Erleben zu werden, an dem Menschen ihre Freude haben. Am Anfang steht dabei – wie es sich gehört, weil Aristoteles dies meint und weil es aus der Schöpfungsgeschichte so bekannt ist – das Licht, das in die Augen gelangt, und zwar merkwürdigerweise dort, wo auf den ersten Blick ein schwarzer Punkt zu sein scheint. Wie wird es hell im Kopf eines Menschen?
1. Licht auf dem Weg zum Sehen
Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt,
Dem Turme geschworen,
gefällt mir die Welt.
Ich blick in die Ferne,
Ich seh in der Näh
Den Mond und die Sterne,
den Wald und das Reh.
So seh ich in allen
Die ewige Zier,
Und wie mir’s gefallen,
Gefall ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei, wie es wolle,
Es war doch so schön.
Lynkeus der Türmer in Goethes Faust, der Tragödie zweiter Teil, Fünfter Akt, »Tiefe Nacht«
Die Fensterlein zur Welt
»Junge, halt die Augen offen« – diesen Rat meiner Mutter, der mich in die Welt hinausführen sollte, habe ich wohl eine gefühlte Million Mal mit auf den Weg bekommen. Und wenn der mahnende Satz in seiner direkten Bedeutung auch jedem bekannt ist und einigen vielleicht schon zu den Ohren herauskommt, so steckt in ihm doch ein Hinweis auf eine eigentümliche Besonderheit des Sehsinns. Sie besteht darin, dass man ihn abstellen und seine Augen tatsächlich schließen und vor ungewünschtem Lichteinfall schützen kann. Man muss dazu nur seine Augenlider zuklappen, und schon werden die menschlichen Fensterlein zur Welt geschlossen, nicht nur, wenn es Nacht wird und ans Schlafen gehen soll, sondern auch manchmal, wenn das Elend der Welt nicht mehr mit anzusehen ist und man sich am liebsten in sich selbst zurückziehen und gelassen meditieren möchte.
Ein Auge weist erstaunlich viele Details auf, von denen einige im Text angesprochen werden. Eher langweilig scheint der Glaskörper zu sein, der dem Sinnesorgan seine kugelige Form gibt. Aber der Name täuscht über eine Besonderheit hinweg, nämlich die, dass alles, was im Leben allgemein und also auch im Auge vorhanden ist, aus Zellen besteht – was im Fall des Glaskörpers heißt, dass er aus durchsichtigen Zellen zusammengesetzt ist. Das Licht tritt durch die Pupille ein, wird durch eine Linse gelenkt, dort gebündelt und auf die Netzhaut weitergeleitet. Diese erledigt mit ihren Zellen und den darin befindlichen Bauteilen (Molekülen) die Aufgabe, aus dem physikalischen Signal der Außenwelt ein elektrisches Signal für die Innenwelt zu schaffen, das den Weg ins Gehirn findet und dort das Sehen ermöglicht, mit dem Menschen die Welt erfahren und an ihr Gefallen finden – wie der Türmer in Goethes Faust.
1 Das menschliche Auge
»Wenn ich an das menschliche Auge denke, bekomme ich Fieber«, hat Charles Darwin einmal gemeint, als er sich die Aufgabe vorstellte, erklären zu müssen, wie das Organ des Sehens mit seinen vielen Teilen im Verlauf der Evolution entstehen konnte. Die gezeigten und im Text erwähnten Strukturen können nicht in einem Schritt entstanden sein, und jede muss einzeln in ihrem Träger für einen Vorteil sorgen. Am wichtigsten sind die Zellen der Netzhaut, in denen die Lichtempfänger sitzen und von der aus der Sehnerv zum Gehirn zieht. Mit der Pupille lässt sich die Menge an Licht regeln, die ins Auge gelangt.
Noch einmal zum Thema Lichtdurchlässigkeit: Es trifft auch für die Linse zu, in der ebenfalls weder Glas noch Kunststoff, sondern Zellen zu finden sind, die im Gegensatz etwa zu Haut- und Haarzellen so angelegt sein müssen, dass sie lichtdurchlässig – also unsichtbar – erscheinen. Die Linsenzellen bekommen diese Eigenschaft durch Proteine (Genprodukte), die aus historischen Gründen »Kristalline« genannt werden. Wenn sie milliardenfach vorhanden sind, ballen sie sich zu Fasern zusammen, und in dieser Form verleihen sie den Linsenzellen die Eigenschaften, die jene am Eingang des Auges benötigen.
Wer mit Leib und Seele Wissenschaftler ist und ein Thema sucht, das für ein Leben und darüber hinaus reicht, könnte allein bei diesen Kristallinen fündig werden, so randständig ihre Aufgabe in dem ganzen Vorgang des Sehens erscheint, da das Licht bislang nur durchgelassen wurde und noch nicht angekommen ist. Wie viele verschiedene Fragen für die Forschung tun sich bereits hier auf:
Auf der Ebene der Physik die Frage, wie das Licht die Fasern aus Kristallin übersehen und ungestört durcheilen kann. (Allgemeiner gefragt: Was zeichnet Strukturen wie Glas aus, die fest und durchsichtig sind?) Auf der Ebene der Chemie die Frage, wie sich die Kristalline so ordnen können, dass Fasern entstehen und den Linsen neben der Transparenz auch die Form verpassen, mit der sie Licht sammeln und fokussieren können. Auf der Ebene der Zellbiologie die Frage, wie Zellen dazu gebracht werden, sich mit Kristallinen zu füllen und andere Proteine loszuwerden. Und auf der Ebene der Molekularbiologie die Frage, wie diese Makromoleküle überhaupt entstehen und angefertigt werden.
Wohlgemerkt: Mit Ohren, Nasen und den anderen Sinnesorganen geht das Abschalten und Abwenden entweder nicht oder nur mit mehr oder weniger mühsamen künstlichen Hilfen wie Ohrenstöpsel oder Nasenklemmen. So zeigt selbst diese natürliche Schließfähigkeit der Augen das Außergewöhnliche des Sehsinns, den in der Antike bereits Aristoteles ausgesondert hat und den die Naturforschung im 19. Jahrhundert immer noch höher als alle anderen sensorischen Fähigkeiten einschätzte. Es muss daher nicht verwundern, dass sich im Lauf der abendländische Geschichte mehr Wissenschaftler um das Sehen und die dazugehörige Verarbeitung der visuellen Reize als um andere Sinnesqualitäten gekümmert haben, was die Frage, womit eine Darstellung der fünf als klassisch zu betrachtenden Sinne des Menschen beginnen sollte, von selbst beantwortet: mit dem Öffnen der Augen und dem damit möglichen Sehen von Licht natürlich. An seinem Beispiel können auch einige allgemein nützliche Konzepte vorgestellt werden, mit denen das sinnliche Vermögen von Menschen im Rahmen der Naturwissenschaften erkundet wird, und mit einem von ihnen wird die Erzählung im folgenden Abschnitt begonnen.
Die Kette der Signale
Wer die Abläufe, die zum sinnlichen Erleben und in diesem ersten Fall zum Sehen führen, verstehen will, ist gut beraten, den Weg des Reizes – an dieser Stelle des Lichts – von dem betrachteten Gegenstand über das Sinnesorgan im Allgemeinen – und zunächst das Auge im Besonderen – ins Gehirn Schritt für Schritt zu verfolgen und die einzelnen Stufen zu betrachten und zu beschreiben. Tatsächlich orientieren sich die Vertreter verschiedener Disziplinen der Wissenschaft bei allen ins Visier genommenen Sinnen an diesem einheitlichen Konzept, zumindest vom Grundsatz her und ohne es explizit zu benennen. Es geht ihnen durchgehend darum, wie sich die Kette der Signale erfassen lässt, die beim Zustandekommen von Sinnesleistungen geschmiedet wird und zuletzt im Gehirn zum Ziel der Wahrnehmung führt (siehe Abbildung 2).
2 Die Kette der Signale beim Sehen
Übrigens – die Gemeinde der an biologischen Prozessen mit Sinncharakter orientierten Wissenschaftler ist deshalb von der Existenz einer Signalkette überzeugt, weil die Forscher beim Funktionieren der Welt viele Kausalitäten mehr oder weniger ununterbrochen am Werk sehen. Sie betrachten es demnach als ihre Aufgabe, die jeweils tätigen und treibenden Ursachen herauszuarbeiten. Es geht insbesondere darum zu erkunden, wie bei diesen Weiterleitungen jeweils Energie übertragen und umgewandelt wird. Natürlich gab und gibt es einige Wissenschaftler, die mit einem Blick auf die merkwürdige Physik der Atome, in der es zufällige Ereignisse ohne konkreten Grund gibt und die demnach einfach so ablaufen, eine andere Hoffnung hegen. Gemeint ist die Erwartung, dass sich auch im Lebendigen solch eine Lücke zeigt, und zwar am besten in der Kette der biologischen Signale auf dem Weg zum Sinn. Solch eine Unterbrechung würde sie und andere dann zu einem Umdenken und einem neuen Verständnis der Natur zwingen. Aber noch funktioniert die Erforschung der Sinne im traditionellen Rahmen mit durchgängiger Kausalität, und noch konnte in der Kette der Signale stets ein Glied an das nächste gereiht werden.
3 Die allgemeine Signalkette bei der Sinneswahrnehmung
Die eben vorgestellte Grundidee einer Abfolge von Ereignissen, bei denen Reize und Informationen erst umgewandelt und dann weitergeleitet werden, kann auf alle Sinnesleistungen angewendet werden, wie sich klarmachen lässt, nachdem man einen ersten Blick auf den zuerst verhandelten Augenblick – den Blick mit den Augen – und seine seit Langem gut analysierte Signalkette gerichtet hat, wie etwas verspielt gesagt werden kann (siehe Abbildung 3).
4 Das Spektrum des sichtbaren Lichts
Physiker zählen Licht zu den elektromagnetischen Wellen, die es mit extrem hohen Frequenzen gibt – als Röntgenstrahlen zum Beispiel – und mit sehr niedrigen – etwa als Radiowellen. Das sichtbare Licht nimmt einen kleinen Spalt in dem gesamten Spektrum ein, es liegt zwischen den ultravioletten und den infraroten Strahlen, von denen die letzteren als Wärme den Sinnen zugänglich werden. Das UV-Licht kann die Haut gut bräunen oder auch verbrennen, wenn man sich davon zu viel gönnt.
5Die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut
In den lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut – genauer in ihrem Außensegment – finden sich Scheibchen, in denen die Sehpigmente versammelt sind. Eine solche fotosensitive Struktur besteht aus einer langen Kette, die sich siebenmal durch ein Haltesystem der Scheibchen zieht, das als Membran bekannt ist. Im Inneren dieser Membran befindet sich die Stelle, an der das Retinal bindet, das mit zur Lichtempfindlichkeit beiträgt, wie im Text beschrieben ist.
Das Konzept der Signalkette erfasst nicht nur die Abläufe der natürlichen Prozesse bei der Sinnesverarbeitung, es zeigt auch, wie die Wissenschaft beim konkreten Arbeiten mit diesem Thema verfährt. Selbst eine Forschergruppe aus vielen Individuen kann in einem einzelnen Experiment nicht den ganzen Vorgang etwa des Schmeckens oder Riechens ins Auge fassen und alles erkunden, was zwischen der Außenwelt und dem Innenerlebnis passiert. Sie muss sich im Laboratorium auf eines der Kettenglieder konzentrieren und beim Sehen zum Beispiel konkret fragen, was schließlich mit der Energie des Lichts passiert, nachdem es von einer Strahlenquelle in ein Auge gelangt und dort aufgenommen worden ist. Wo trifft das Licht genau ein? Wodurch erzielt seine Energie ihre Wirkung? Und wohin wird das empfangene Signal im Anschluss daran geleitet und wie danach weiter damit umgegangen?
6 Fotopigmente
Diese Darstellung einer lichtempfindlichen Struktur in den Augenzellen lässt erkennen, dass die Bereiche des Pigments, die den Lichtempfänger in der Membran verankern, schraubenförmig gewunden sind, was ihnen geeignet Halt gibt. Die Teile des Lichtempfängers, die in eine der beiden möglichen Richtungen über die Membran hinausragen, machen einen eher zufälligen Eindruck, und ihre Anordnung und ihr Aufbau bieten im Detail noch eine Menge Raum für die Forschung.
Die Verarbeitung beim Licht
Wie gesagt: Eine Sinneswahrnehmung beginnt mit einem physikalischen Signal oder einem spürbaren Reiz der Außenwelt, und beim Sehen ist damit das Licht gemeint, das von einem Gegenstand ausgeht und ins Auge fällt. Das Licht wird dabei zumeist durch seine physikalische Beschaffenheit oder seine Energie beschrieben, etwa indem seine Wellenlänge oder Intensität gemessen wird, und die mit diesem Reiz mögliche Sinneserfahrung beginnt, wenn Licht in ein Auge gelangt und dort auf der Netzhaut empfangen wird.
Das heißt, wissenschaftlich gesprochen wird das Licht auf der Augenrückwand absorbiert und seine physikalische Energie mithilfe raffinierter Genprodukte (Biomoleküle) in eine chemische Form umgewandelt. Aber das altmodisch klingende Wort vom Empfang soll auf die fachliche Bezeichnung der Gebilde vorbereiten, mit denen biologische Sinnesorgane physikalische oder chemische Signale erst einfangen und dann weiterleiten. Gemeint ist der Begriff des Rezeptors, der im frühen 20. Jahrhundert geprägt wurde und sich dem lateinischen Wort recipere verdankt, das so viel wie entgegennehmen, aufnehmen oder empfangen meint (siehe Tabelle 1). Bei allen sinnlichen Leistungen des Lebens und seiner Zellen spielen Rezeptoren eine Rolle, die – wie nicht anders zu erwarten – bei aller Einheitlichkeit der Funktion sehr unterschiedlich aufgebaut sein können und von denen einige noch im Detail vorgestellt werden. Rezeptoren für das Licht heißen manchmal auch Pigmente – oder genauer Fotopigmente –, was nach Farben klingt und auch so sein soll. Denn es sind verschiedene Rezeptoren im Auge, mit denen das Sehen von Farben seinen Anfang nimmt und also ermöglicht, dass Rezeptoren als Genprodukte verstanden werden können. Das heißt, es gibt Gene, deren Information den Bau der Rezeptoren ermöglicht, die dann in den Sinnesorganen ihre biologische Arbeit aufnehmen und die Reize festhalten und weiterleiten, mit denen sich Lebewesen die Welt öffnen.
Einige Rezeptoren und ihre Vermittlung
Fotorezeptoren – Sehen von Licht und Farben
Thermorezeptoren – Wahrnehmung der Temperatur
Nozizeptoren – Schmerzempfindung
Propriorezeptoren – Wahrnehmung des eigenen Körpers
Mechanorezeptoren – Reaktionen auf mechanische Reize (Druck)
Die Rezeptoren, die in menschlichen Augen für das Licht zur Verfügung stehen, befinden sich – wie immer in Organismen und ihren Organen – in Zellen, wobei die Sehzellen in der Netzhaut versammelt sind und in zwei Formen vorliegen. Es gibt lichtempfindliche Zellen, die wie Zapfen aussehen und auch so heißen, und es gibt solche, die wie Stäbchen aussehen und ebenfalls so heißen.
Wer fragt, wie sich Zellen erkennen und abgrenzen lassen, wird als Antwort bekommen, dass sie von einer zarten und dynamischen Hülle umgeben sind, die von Fachleuten als Membran bezeichnet wird – ein Wort, das sich zu merken lohnt.
Der Ausdruck leitet sich von dem lateinischen Wort membrana für »Häutchen« ab, mit dem jede Art von Trennschicht bezeichnet wird, wobei das Besondere einer biologischen Membran darin besteht, dass sie die von ihr umhüllte und eingefasste Zelle nicht nur abgrenzt. Vielmehr stecken in einer Membran viele Genprodukte, die es einer Zelle erlauben, mit ihrer Umgebung Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren. Mit anderen Worten, in Membranen von Zellen befinden sich Moleküle, die den gezielten Durchgang von funktionsfähigen Molekülen durch eine Membran erlauben und daher zum Beispiel als Poren oder Kanäle bezeichnet werden. In den Membranen stecken auch die erwähnten Rezeptoren, die auf diese Weise das Äußere der Umwelt mit dem Inneren einer Zelle verbinden, denn sie ragen durch die zarte Zellhülle hindurch und zeigen sich als Ganzes flexibel. Wenn sich außen an ihnen etwas ändert – wenn sie dort etwa ein Lichtsignal empfangen –, dann wirkt sich dieser Einfluss bis in das Zellinnere aus. Das kann man sich wie bei einer Person vorstellen, die sich aus einem Fenster lehnt und sich beim Betrachten einer bestimmten Szene so freut, dass sie mit den Beinen im Zimmer wackelt. Das Signal ist damit von der Straße ins Haus gelangt, was im Fall der Rezeptoren einer Zelle heißt, dass das Signal von außen sich nun im Leben befindet und dort seinen weiteren Weg sucht.
7 Eine Membran und ihre Tore
Die wesentlichen Mitstreiter bei Lichtempfang und Signalumwandlung stecken in einer Membran, die als Doppelschicht gebaut ist. Auf diese Weise lassen sich eine Menge Strukturen unterbringen, die das Licht erst empfangen (Rhodopsin) und dann weiterleiten (Transducin und eine Phosphodiesterase), bevor in einer anderen Membran (rechts) weitere Moleküle in Aktion treten, die als Kanäle geladene Natrium-Atome (Natrium-Ionen Na+) durchlassen können, wenn sie geöffnet sind. Mit zu dem Geschehen an der Membran tragen Signalstoffe wie GMP und cGMP bei. So einfach einem das Sehen fällt, so viel Biochemie ist dafür notwendig.
Die Eigenschaft von Membranen, Genprodukte wie Proteine aufnehmen und auf diese Weise agieren lassen zu können, hat im Lauf der Evolution dazu geführt, dass die biologischen Häutchen nicht nur als äußere Zellhülle eingesetzt worden sind, sondern auch im Inneren der elementaren Einheiten des Lebens Aufgaben zugewiesen bekommen haben. In den genannten Sehzellen eines menschlichen Auges – in den Stäbchen und Zapfen – finden sich Membranen dicht übereinandergestapelt, wobei das Ganze so aussieht, als ob jemand dort eine molekulare Decke gefaltet und verpackt hätte. Dabei bilden sich Membranscheiben heraus, und in denen hat die Evolution die Fotorezeptoren untergebracht, mit deren Hilfe Menschen das im Auge eintreffende Licht erst festhalten und dann immer weiter nach innen in das Gehirn und sein Nervensystem weiterleiten, um es zuletzt dem Bewusstsein als Sehen zugänglich zu machen.
Der molekulare Empfänger des Lichts heißt Rhodopsin, was beim ersten Hören kompliziert klingt, weil das Wort aus zwei Teilen besteht. Die letzten beiden Silben – »opsin« – leiten sich vom griechischen Wort für Sehen ab, das auch zu dem Begriff der Optik geführt hat, der als Teilgebiet der Physik den Umgang mit dem Licht meint, der zum Beispiel Brillen und Fernrohre mit ihren Linsen hervorzubringen erlaubt. Mit Opsin bezeichnet die Wissenschaft den Anteil des Lichtrezeptors, der nach Instruktionen von Genen gebaut wird und damit als ein Protein (Genprodukt) vorliegt. Aus dem Opsin wird das visuell funktionierende Rhodopsin, das früher einmal Sehpurpur hieß, weil es rot aussieht, wenn man es isoliert betrachtet (und was auch den ersten Teil des Fachworts verständlich macht).
8 Cis- und Trans-Retinal