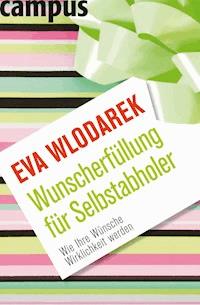8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mangelware Wertschätzung Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit: diese Signale sozialer Akzeptanz erfüllen zentrale Bedürfnisse des Menschen. Wir wollen gesehen werden als die, die wir sind, möchten Anerkennung dafür, was wir getan oder geleistet haben. Doch wenn man sich im Privat- oder Berufsleben umschaut, so zeigt sich schnell ein großes Defizit. Wie also kann es gelingen, mehr positive Aufmerksamkeit zu erhalten? Und umgekehrt auch anderen wertschätzend und dankbar zu begegnen? Denn es geht um Geben und Nehmen. Es ist ein Zeichen von innerer Stärke, Selbstbewusstsein und sozialer Kompetenz, dies in richtiger Weise zu fordern und zu gewähren. Eva Wlodarek bietet eine konkrete Anleitung, wie gute Beziehungen mit sich selbst und anderen entstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eva Wlodarek
Die Kraft der Wertschätzung
Sich selbst und anderen positiv begegnen
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Einführung
Die Bedeutung von sozialer Akzeptanz
Bitte schließen Sie die Augen und erinnern Sie sich so lebhaft wie möglich an eine Situation, in der Sie privat oder beruflich Anerkennung oder Wertschätzung erfahren haben. Vielleicht haben Sie für eine Leistung ein großes Lob bekommen, jemand hat Sie mit warmen Worten empfohlen, eine Freundin hat sich herzlich für Ihre Unterstützung bedankt. Wie haben Sie sich gefühlt? Vermutlich waren Sie stolz, glücklich, gerührt oder tief befriedigt. In jedem Fall dürfte es ein großartiges Gefühl gewesen sein. Tatsächlich befanden Sie sich in einer Art Rausch. Wenn wir – auf welche Weise auch immer – gewürdigt werden, schüttet unser Gehirn körpereigene Opiate aus und reagiert so euphorisch, als ob wir Drogen genommen hätten. Das kommt nicht von ungefähr, denn es handelt sich dabei um eine evolutionsgeschichtlich bedeutsame Erfahrung.
Wenn wir wissen möchten, warum wir auf besondere Zeichen der Akzeptanz durch unsere Umgebung so intensiv reagieren, müssen wir in eine Zeitmaschine steigen. Es geht Millionen Jahre zurück. Wir landen in der afrikanischen Savanne. Dort haben Primaten gerade einen wichtigen evolutionären Sprung zum Menschsein gemacht: Sie haben die Fähigkeit entwickelt, über die Fortpflanzung hinaus soziale Bindungen einzugehen. Das wirkt sich nicht nur auf die Größe ihres Gehirns aus, sondern verschafft ihnen auch einen guten Zusammenhalt bei der Jagd; außerdem gibt es ihnen mehr Sicherheit. Während ein Einzelgänger ständig gefährdet ist, ist es in einer Gruppe leichter, zu überleben. Damit wird es für das Individuum extrem wichtig, von seiner Horde angenommen zu werden.
Zurück in die Gegenwart: Die Forschung sieht in der Frühzeit der Menschheit den Ursprung dafür, dass es sich bei dem Streben nach sozialer Anerkennung um ein evolutionsbiologisch bedingtes grundlegendes Bedürfnis handelt, das uns bis heute genetisch bestimmt. Was für unsere Vorfahren in der Savanne ihre Horde war, ist für uns die soziale Gruppe, in der wir leben, im Privatleben die Familie und der Freundeskreis, im Beruf etwa Vorgesetze, Kollegen oder Kunden. Wir jagen zwar nicht mehr das Mammut, doch von unseren Mitmenschen anerkannt und geschätzt zu werden ist für uns nach wie vor existenziell wichtig. Der amerikanische Philosoph John Dewey vertritt sogar die Ansicht: »Der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein.« Unser seelisches und mentales Überleben hängt davon ab. Im Vergleich zu einem Bedürfnis nach Nahrung können wir von einem ebenso ausgeprägten Hunger nach Anerkennung sprechen.
Dass wir von unseren Mitmenschen angenommen werden, spielt von Geburt an eine große Rolle. Wenn wir als hilflose Wesen den Mutterleib verlassen, ist es für uns überlebenswichtig. Beim Säugling bezieht sich das zunächst vor allem auf seine Körperwahrnehmung. In dieser Phase hat Akzeptanz außer der praktischen Versorgung die Form von liebevollen Blicken, zärtlichen Berührungen und Ansprache.
Wie verheerend es sich auswirkt, wenn sie fehlt, beweist unter anderem ein ungewolltes Experiment: In einem Waisenhaus in Bukarest wurden Säuglinge und Kleinkinder nur mit dem Nötigsten versorgt, Zuwendung bekamen sie jedoch keine. In der Folge blieben sie in ihrer emotionalen, sprachlichen und körperlichen Entwicklung zurück. Sie zeigten Bindungsängste, waren hyperaktiv und hatten einen deutlich verminderten IQ. Wenn die Sinnesorgane ausgereift sind, entstehen im Gehirn komplexe neuronale Netzwerke. Ab etwa dem dritten Lebensjahr begreift sich ein Kind als eigenständiges Wesen. Von seiner Entwicklung her hat es nun die Fähigkeit erworben, die Reaktionen seiner Umwelt einzuordnen. Dadurch erhält das elementare Bedürfnis nach Akzeptanz noch eine weitere Funktion: Es sorgt für Anpassung an die Gruppe. Um die Zuneigung und Anerkennung seiner Umgebung zu gewinnen, muss sich das Kind ihren Vorstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen angleichen. Dazu angeleitet wird es außer durch Strafe auch durch Belohnung, etwa in Form von Lob. Immer wenn ein Kind für sein Verhalten Zuspruch erhält, werden im Gehirn positive Botenstoffe ausgeschüttet, die neuronale Verknüpfungen und synaptische Verschaltungen aktivieren. Auf diese Weise lernt der kleine Mensch nachhaltig, was akzeptabel ist. Je öfter er diese Erfahrungen macht, desto intensiver prägen sie sich ein.
Soziale Akzeptanz ist nicht nur für die kindliche Entwicklung von Bedeutung, sondern ebenso für Erwachsene. Sie vermittelt uns unsere Identität. Die anderen sind für uns wie ein Spiegel, in dem wir uns betrachten und unseren Wert einschätzen können. Wenn wir angenommen werden, wirft uns das ein positives Bild zurück. Obwohl es uns meist nicht bewusst ist, durchdringt der Wunsch, von unserer Umgebung wohlwollend wahrgenommen zu werden, unsere gesamte Kommunikation. Selbst bei kurzen Begegnungen sind nonverbale oder verbale Zeichen der Akzeptanz wichtig. Das kann ein Blick, ein Lächeln oder ein Kopfnicken sein, ein Gruß oder ein freundliches Wort. In der Psychologie spricht man von »Streicheleinheiten«, englisch »strokes«.
Fehlen sie, wirkt sich das auf unsere Stimmung aus, etwa wenn ein Nachbar grußlos an uns vorbeigeht oder uns die Kellnerin im Café hartnäckig ignoriert. Das sind allerdings Peanuts im Vergleich zu größerem Entzug. Wird uns soziale Anerkennung dauerhaft vorenthalten, leiden wir als Erwachsene ebenso wie Kinder. Die Hirnforschung belegt, dass bei isolierten Menschen dieselben Hirnareale aktiviert werden wie bei körperlichem Schmerz. Mobbingopfer zeigen starke Stresssymptome wie Panikattacken, Selbstmordgedanken und Schlaflosigkeit.
Auch als Mittel der Anpassung an eine Gruppe spielt soziale Akzeptanz noch im Erwachsenenalter eine große Rolle. Indem wir für unser Verhalten, unsere Tätigkeit und unsere Eigenschaften Zustimmung erhalten, wissen wir, dass wir uns gemäß den Werten unserer Gruppe auf dem richtigen Weg befinden. Unsere Umgebung versichert uns auf diese Weise: Du gehörst dazu. Du bist für uns wichtig.
Das lässt sich sogar auf die sozialen Medien übertragen. Sean Parker, einer der Weggefährten von Mark Zuckerberg, gab in einem Interview zu, Facebook sei bewusst so konstruiert worden, dass man damit »eine Schwäche der menschlichen Psychologie« ausnutzen könne. Likes und Kommentare führen bei den Nutzern zur Ausschüttung von Glückshormonen, sodass sie immer mehr Zeit mit dem sozialen Netzwerk verbringen.
Sämtliche neurologischen und psychologischen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass die Signale sozialer Akzeptanz mehr sind als nur eine nette Zugabe. Es handelt sich um ein existenzielles Bedürfnis, das erfüllt werden muss. Niemand von uns kann darauf verzichten, wenn wir seelisch gesund, glücklich und leistungsfähig bleiben wollen.
Die Formen sozialer Akzeptanz
Es reicht längst nicht mehr, dass man uns eine haarige Hand auf die Schulter legt und uns mit einem freundlichen Laut in die Horde aufnimmt. Als Homo sapiens haben wir weitaus höhere Ansprüche an die Signale sozialer Akzeptanz. Sie zeigen sich vor allem als Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit. In der Umgangssprache werden diese drei oft gleichwertig benutzt. »Mir fehlt die Wertschätzung«, »Mir fehlt die Anerkennung«, »Ich hätte mehr Dankbarkeit erwartet« – das sagt für uns meist dasselbe aus. Die Vermischung ist verständlich, denn die drei Erscheinungsformen gehen tatsächlich oft ineinander über. Aber es gibt dennoch feine Unterschiede zwischen ihnen. Sich mit denen zu befassen, ist keineswegs Haarspalterei. Sobald es sich nämlich darum dreht, Anerkennung, Wertschätzung oder Dankbarkeit zu bekommen oder sie anderen zu geben, zeigt sich, dass dazu unterschiedliche Strategien notwendig sind. Deshalb ist es sinnvoll, sich die drei hauptsächlichen Ausdrucksformen sozialer Akzeptanz einmal genauer anzuschauen und sie gegeneinander abzugrenzen – auch wenn für den Buchtitel der umfassendste Begriff gewählt wurde.
Bei Anerkennung handelt es sich meist um eine gezielte positive soziale Aufmerksamkeit, die auf ein bestimmtes Projekt Bezug nimmt. Ausgedrückt wird sie vor allem mit verbalem Lob: »Sie haben das so lebendig vorgetragen, ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können«, oder in einem Kompliment: »Die Farbe steht Ihnen ausgezeichnet«, »Das Essen ist köstlich!«. Sie kann auch durch eine Belohnung ausgedrückt werden, vielleicht so: Der Chef schlägt seiner Mitarbeiterin, die intensiv an einem Projekt gearbeitet hat, vor: »Nehmen Sie sich einen Tag frei.« Manchmal erhalten wir Anerkennung auch nur indirekt. Dann steckt sie in den bloßen Fakten und kommt auf diese Weise ebenfalls bei uns an: Der Name des Verkäufers wird in der Monatsstatistik der Firma an erster Stelle genannt. Das Buch der Schriftstellerin steht auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Doktorarbeit wird mit »summa cum laude« bewertet. Für diejenigen, die in sozialen Medien unterwegs sind, besteht die Anerkennung aus möglichst vielen Likes und Kommentaren. Allen Ausdrucksformen der Anerkennung ist gemeinsam, dass sie nur für eine begrenzte Zeit Gültigkeit haben.
Wertschätzung geht über eine aktuelle Resonanz hinaus. Sie ist das Ergebnis einer länger andauernden positiven Erfahrung mit der Einstellung, dem Verhalten und der Leistung einer Person. Grundlage ist etwa eine kontinuierlich gute Leistung oder ein beständig lobenswertes Verhalten. Wertschätzung erhält man nicht von heute auf morgen, sie muss wachsen. Von daher setzt sie Zeit und Engagement voraus. Doch der Einsatz lohnt sich. Wenn man uns wertschätzt, dürfen wir viel erwarten, etwa dass man auf unsere Meinung Wert legt, wir einen guten Ruf haben und man in unserer Abwesenheit positiv über uns spricht.
Dankbarkeit ist die emotionale Wahrnehmung und Rückmeldung dessen, was jemand für andere tut oder bedeutet. Sie kann sowohl Merkmale der Anerkennung als auch der Wertschätzung zeigen. Wenn wir jemandem einen Gefallen getan haben, wird er uns die Anerkennung dafür in Form eines Dankes ausdrücken, mit einem Anruf, einem Blumenstrauß, einem Geschenk. Damit ist es meist abgegolten. Die Wirkung hält kaum länger an als ein Lob. Dankbarkeit auf der Basis von Wertschätzung bezieht sich dagegen auf einen längeren Einsatz und geht tiefer. Etwa wenn sich der Ehemann bei der Silberhochzeitsfeier in einer anrührenden Rede bei seiner Frau für viele Jahre glücklicher Partnerschaft bedankt.
In jedem Fall wird deutlich ein Dank ausgedrückt.
Wie viel Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit brauche ich?
Wir alle wollen wahrgenommen und geschätzt werden, das ist genetisch festgelegt. Unterschiedlich ist aber, in welchem Maß. Was das eigene Bedürfnis betrifft, sind wir oft unsicher, wie ausgeprägt es ist. Meist können wir das nur vage mit »ziemlich groß« oder »eher gering« angeben. Wichtig ist jedoch, genau zu wissen, wie groß unser Wunsch nach positiver Aufmerksamkeit ist. Damit haben wir nämlich einen Ansatz, von dem aus wir uns um Erfüllung bemühen oder eventuell etwas verändern können. Deshalb ist es sinnvoll, mit einem Messinstrument zu erfassen, wie viel Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit wir derzeit tatsächlich brauchen. Möglich wäre das mit einem psychologisch fundierten Test, der etwa solche Fragen enthält: »Wie reagierten Ihre Eltern, wenn Sie in der Schule eine schlechte Note nach Hause brachten?« oder »Wie fühlen Sie sich, wenn Sie kritisiert werden?«. So ein Test wäre jedoch nicht nur sehr umfangreich, sondern für unseren Zweck auch unnötig kompliziert. Stattdessen bietet sich eine Rangskala an, wie sie zum Beispiel zur Einschätzung von Glücksempfinden oder Kundenzufriedenheit eingesetzt wird. Dieses ebenso einfache wie aussagekräftige Instrument lässt sich auch auf den Grad unseres Bedürfnisses nach positiver Rückmeldung durch andere anwenden. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Gebiet wir sie brauchen, ob beruflich oder privat. Es ist auch egal, in welcher Form wir sie haben möchten, sei es als Lob, Einladung oder als Beförderung. Hier geht es einzig und allein darum, wie ausgeprägt generell unser Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit ist. Sicher kann es, ähnlich wie das Glücksgefühl, aufgrund einer aktuellen Situation leicht variieren. Wenn wir uns gerade in einer Hochphase befinden, brauchen wir etwas weniger, geht es uns nicht so gut, benötigen wir etwas mehr, aber im Großen und Ganzen bleibt es über die Jahre doch ziemlich stabil.
Gründe für ein großes Bedürfnis nach positiver Resonanz
Falls wir gegenwärtig besonders viel Anerkennung, Wertschätzung und dankbare Rückmeldung brauchen, liegt der Grund dafür fast immer in Erfahrungen aus unserer Kindheit. Während dieser sensiblen Phase unseres Lebens prägt das Verhalten der Menschen in unserer nächsten Umgebung unser Selbstbild und unser Wertgefühl. Wir nehmen gläubig auf, was uns unsere Bezugspersonen vermitteln. Weil wir dem noch nichts an Erfahrung oder Wissen entgegenzusetzen haben, halten wir die direkten und indirekten Botschaften über uns für die Wahrheit und verinnerlichen sie. Darunter sind auch solche, die sich negativ auswirken und später zu einem erhöhten Bedürfnis nach sozialer Anerkennung führen können. Ein Mangel an Liebe, Verständnis, Unterstützung oder Zuwendung in dieser Zeit wird vielleicht verdrängt, aber niemals vergessen. Er wirkt in unserem Unbewussten weiter, steuert unsere Gefühle und unser Verhalten noch als Erwachsene. Wenn wir also spüren, dass der Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit uns gegenwärtig stärker bestimmt, als uns lieb ist, sollten wir uns zunächst mit möglichen Auslösern in unserer Lebensgeschichte befassen. Indem wir uns die frühen Ursachen bewusst machen, schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass wir ihre heimliche Wirkung entkräften können. Die folgenden problematischen Ausgangssituationen kommen besonders häufig vor, in vielfältigen Variationen. Gewiss sind sie nicht die einzigen möglichen Ursachen. Aber es geht hier auch nicht um eine vollständige Aufzählung, sondern darum, uns dafür zu sensibilisieren, dass ein starkes Verlangen nach Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Dankbarkeit nicht von ungefähr kommt.
Liebe für Leistung
Manche Kinder werden nur beachtet, wenn sie sich mit besonderen Leistungen hervortun – etwa in der Schule Bestnoten erreichen, ein Ass im Sport sind, auffällig gut aussehen oder Wettbewerbe gewinnen. Andernfalls zeigt sich die Umgebung enttäuscht und reagiert gar mit Liebesentzug. In der extrem ehrgeizigen Familie von John F. Kennedy galt die Regel: »Come in first, second place is failure.« Wer nicht als Erster durchs Ziel geht, hat schon versagt. Was dazu führte, dass ein von Schmerzen geplagter, mit Medikamenten vollgepumpter Mann das Präsidentenamt anstrebte und sein Bruder auch nach dem blutigen Attentat alles daransetzte, sein Nachfolger zu werden.
Von Klienten habe ich in meiner Praxis häufig gehört, dass ihre Eltern enttäuscht waren, wenn sie in der Klassenarbeit nur ein »Gut« mit nach Hause brachten. Erwartet wurde selbstverständlich ein »Sehr gut«. Ebba, eine 42-jährige Apothekerin, erinnert sich daran, dass sie nach einer Zwei in der Französischarbeit zur Strafe den ganzen Nachmittag lang Vokabeln lernen musste. Da ist es kaum verwunderlich, wenn ein Kind später selbst seinen Wert an Leistung koppelt und dafür die Zustimmung seiner Umgebung haben möchte.
Übermäßiges Verwöhnen
Ebenfalls kritisch, wenn auch nicht gleich als lieblos durchschaubar, ist es, wenn ein Kind zu sehr verhätschelt wird und man ihm keine Grenzen setzt. Wer so heranwächst, hält sich für den Nabel der Welt und erwartet auch später ständig Zustimmung für das, was er tut. Typisch für diesen Erziehungsstil erscheint mir eine Szene, die ich kürzlich in einem Modegeschäft beobachtete: Eine Mutter probiert ein Kleid an, ihr fünfjähriger Sohn schlägt derweil mit einer metallenen Gürtelschnalle auf den Spiegel ein. Die Verkäuferin weist sehr freundlich darauf hin, dass der Spiegel kaputtgehen könnte. Daraufhin sagt die Mutter empört: »Machen Sie sich lieber Gedanken darüber, dass sich mein Sohn verletzen könnte!«
Ähnlich fatale Folgen kann es haben, wenn Eltern fest von der Grandiosität ihrer Kinder überzeugt sind. Was immer die Kids vorzeigen, wird als großartig gelobt. Haben sie ein nettes Bild gemalt, verrät es gleich künstlerisches Genie, ein durchschnittlicher Schulaufsatz lässt zukünftigen Schriftstellerruhm ahnen. Die kleinen Prinzen und Prinzessinnen verinnerlichen, dass sie klüger, geschickter, talentierter oder hübscher sind als Gleichaltrige in ihrer Umgebung. Man sollte meinen, auf diese Weise würden sie genug Anerkennung bekommen, um später kaum darauf angewiesen zu sein. Doch die traurige Wahrheit ist, dass diese Kinder nicht wirklich gesehen werden und von daher kein realistisches Selbstbild aufbauen können. Als Erwachsene brauchen solche hochgelobten Sprösslinge weiterhin die Bestätigung, etwas Besonderes zu sein, und reagieren oft tödlich beleidigt, wenn nicht jeder fantastisch findet, was sie tun oder sagen.
Emotionaler Missbrauch
Emotional ausgenutzte Kinder können kein Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse entwickeln, aber umso mehr für die ihrer Umgebung. Als Erwachsene tun sie dann meist zu viel für andere, um Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit zu bekommen. Das verursachen Eltern, die überwiegend mit sich selbst beschäftigt sind, etwa weil sie an einer körperlichen oder psychischen Krankheit leiden. Ein sensibles Kind erkennt schnell, dass es sich möglichst pflegeleicht verhalten muss. Oft übernimmt es die Aufgabe, die Eltern zu unterstützen. Wie Britta, eine 29-jährige Illustratorin, deren Mutter unter Depressionen litt. Wenn die kleine Britta aus der Schule kam, schaute sie schon auf dem Weg zum Haus ängstlich, ob die Vorhänge zugezogen waren. Das bedeutete nämlich, dass sich Mama wieder schlecht fühlte. Dann war es Brittas Aufgabe, sie aufzumuntern. Ihre eigenen Gefühle waren unwichtig.
Absolute Zuwendung verlangen auch Eltern, die in puncto Anerkennung selbst ein Defizit haben. Sie benutzen ihren Nachwuchs zur eigenen Bestätigung und verlangen von ihren Kindern, gelobt, umschmeichelt und getröstet zu werden. Die kleine Melanie, heute mit 48 Jahren eine engagierte Ärztin, lernte schon früh, dass die Augen ihrer Mutter aufleuchteten, wenn sie ihre Ärmchen um deren Hals schlang und sagte: »Mami, ich hab dich so lieb!« Nur war das kein Ausdruck eines echten Gefühls, sondern eine eingeforderte Formel. Timo, ein 36-jähriger Sozialpädagoge, musste sich bereits mit fünf Jahren anhören, wie unglücklich seine Mutter über die Affären seines Vaters war. Wenn sie weinte, kletterte er auf ihren Schoß und tröstete sie: »Nicht traurig sein, du hast doch mich.«
Einsame Kindheit
Einsame Kinder brauchen als Erwachsene oft viel soziale Bestätigung, um ihre innere Isolation zu überwinden und die Verbundenheit mit anderen Menschen zu spüren. Ein Kind, dessen Eltern kaum Zeit mit ihm verbringen, zweifelt an seiner Bedeutung. Es bezieht ihre häufige Abwesenheit auf sich und schließt daraus, dass es unwichtig oder nicht liebenswert genug ist. Natürlich hat der Zeitmangel nicht immer freiwillig gewählte Gründe. Oft müssen beide Eltern oder Alleinerziehende arbeiten, um es finanziell über die Runden zu schaffen. Das verstehen Kinder noch am ehesten, weil sie mitbekommen, dass ihre Erziehungsberechtigten selbst darunter leiden und gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen würden. Doch häufig handelt es sich um Paare, die gemeinsam ein Geschäft führen, denen ihre Karriere wichtig ist oder die sich stark sozial engagieren. Um ein Kind als eigenständige Persönlichkeit wahrzunehmen, braucht es aber nun mal Zeit für Zuwendung. Erschöpfte oder desinteressierte Eltern sind dazu kaum in der Lage.
Vor einiger Zeit moderierte ich ein Treffen von inzwischen erwachsenen Pastorenkindern. Sämtliche TeilnehmerInnen berichteten, dass sie immer das Gefühl hatten, nur nebenher zu laufen. An erster Stelle standen die Mitglieder der Kirchengemeinde, für deren Ansprüche immer Zeit war. Eine Pastorentochter erzählte, wie der Heiligabend in ihrer Kindheit verlief. Nach der Christmette fuhr ihr Vater die älteren Besucher persönlich mit seinem Auto nach Hause, oft in weit entfernte Orte. Inzwischen kümmerte sich ihre Mutter liebevoll um die Obdachlosen, die bei ihnen im Wohnzimmer zu Gast waren. Sie selbst saß traurig in ihrem Zimmer. Kinder von Geschäftsleuten berichten von ähnlichen Erfahrungen, bei ihnen hatten die Wünsche der Kunden immer Vorrang. Ebenso haben es diejenigen erlebt, deren Eltern ihre eigene Karriere intensiv verfolgten. Der heute 36-jährige Sohn eines Professoren-Ehepaares erzählte mir, dass er als Kind hauptsächlich von Au-pair-Mädchen betreut wurde.
Übertriebene Anpassung
Bei Kindern von ängstlichen, angepassten Eltern besteht die Gefahr, dass sie als Erwachsene ihrerseits versuchen, möglichst viel Anerkennung über Wohlverhalten zu erreichen. Natürlich achten die meisten Eltern darauf, dass sich ihr Nachwuchs in die Umgebung einfügt. Kritisch wird es jedoch, wenn die Erziehung zu ausgeprägter Konformität führt und das Kind keine Eigenheit mehr zeigen darf. Die Überlegung »Was werden die anderen sagen?« bestimmt dann das gesamte Verhalten der Familie. Dahinter steckt die eigene Angst der Eltern, kritisiert und nicht akzeptiert zu werden. Diese Angst überträgt sich auf ihre Kinder, die dann als Erwachsene oft ihrerseits intensiv Anerkennung durch Übereinstimmung suchen. Wie Corinna, eine 41-jährige Lehrerin. Sie wuchs in einer süddeutschen Kleinstadt auf, in der jeder jeden kannte. Ihren streng katholischen Eltern war das Allerwichtigste, was die Nachbarn und der Herr Pfarrer sagten. Corinna erinnert sich an Sätze wie: »So gehst du mir nicht aus dem Haus, was sollen denn die Leute denken«, »Benimm dich bloß anständig, das fällt sonst auf uns zurück«, »Wehe, wir hören Klagen über dich!«. Noch immer überlegt Corinna sorgfältig, wie ihre Worte auf ihr Gegenüber wirken könnten. Um anerkannt zu werden, redet sie anderen nach dem Mund. Martin, ein 39-jähriger Informatiker, hat Ähnliches erlebt. Seine Eltern führten eine Pension. Martin wurde angehalten, immer freundlich zu sein. Vater und Mutter waren mit ihm zufrieden, wenn sie hörten: »Sie haben aber einen netten Jungen.« Bis heute sucht er Anerkennung, indem er besonders zuvorkommend und umgänglich ist.
Abwertung
Wer als Kind abgewertet und gedemütigt wurde, benötigt später ein hohes Maß an positiver Aufmerksamkeit, um seine permanente Selbstkritik zum Verstummen zu bringen. In meinen Seminaren war ich oft sehr betroffen, was nahestehende Personen mit ihren bösen Urteilen angerichtet hatten. Vor mir saßen wunderbare Menschen, sensibel, empathisch, tüchtig, objektiv erfolgreich – aber nicht ihrem persönlichen Empfinden nach. Sie sahen sich immer noch durch die Brille von Mutter oder Vater, die ihnen seinerzeit vermittelt hatten: Du bist dumm. Du taugst nichts. Du kannst nichts. Aus dir wird nie etwas. Dich wird keiner lieben. Sie hatten das so verinnerlicht, dass sie es in Form einer negativen inneren Stimme nun selbst wiederholten und für die Wahrheit hielten.
Ausgrenzung
Kinder mit einer körperlichen Einschränkung, etwa mit Übergewicht oder einem Sprachfehler, die schwächlich sind, sich nicht gut bewegen können oder Hautprobleme haben, werden oft von Gleichaltrigen gehänselt oder gemobbt. Wer mit seinem Äußeren oder Auftreten nicht der Norm entspricht, erfährt statt Anerkennung Ausgrenzung, Häme und Anfeindungen. Das schmerzt besonders in jungen Jahren, in denen das Selbstbewusstsein noch wenig gefestigt ist. Erwachsene, die als Kind darunter gelitten haben, erinnern sich deutlich an die negativen Reaktionen auf ihr Defizit. Ihr Bedarf an Anerkennung ist oft selbst dann noch groß, wenn die Einschränkung schon längst nicht mehr besteht, etwa der körperliche Makel behoben ist oder sich die äußeren Bedingungen geändert haben. Zumindest liegt in der frühen Verletzung häufig der Antrieb, besonders erfolgreich zu sein. So war es bei Udo, einem 52-jährigen Unternehmer. Als Kind wurde er ständig wegen seiner abstehenden Ohren aufgezogen. »Da kommt Dumbo« war noch einer der netten Scherze. Dumbo ist der kleine Elefant bei Walt Disney, der seine Ohren breit stellen und damit durch die Luft segeln kann. Damals schwor er sich: »Euch werde ich es noch allen zeigen!« Auch Lisa, ein 22-jähriges Model, litt als Teenager unter dem Spott ihrer Mitschüler. Weil sie groß und dünn war, musste sie sich dumme Sprüche anhören: »Ja, ist denn schon Spargelzeit?« oder »Du bist schön wie Schneewittchen – ohne Arsch, ohne Tittchen.« Für sie war es eine große Genugtuung, als zum ersten Mal ihr Foto auf dem Cover einer Modezeitschrift erschien.
Zum Außenseiter kann man auch werden, wenn sich die Familie von der übrigen Umgebung abhebt, etwa durch den Dialekt, die Religion oder Armut. Camilla, eine 64-jährige Buchhändlerin, war als Kind ziemlich isoliert. Ihre Eltern stachen in ihrer Lebensweise von den anderen Kleinstadtbewohnern ab, sie gehörten zu den Anthroposophen. Damals war diese spirituell-esoterische Richtung weitgehend unbekannt und die Toleranz dafür gering. Camilla trug keine normalen Kleider, sondern selbst gestrickte wollene Gewänder. Niemand lud die merkwürdige Camilla zum Kindergeburtstag ein.
Bei solchen Erfahrungen ist es gewiss kein Wunder, dass ausgegrenzte Kinder als Erwachsene einen großen Hunger danach haben, endlich Zeichen der Zugehörigkeit zu bekommen.
Sich selbst auf die Spur kommen
Wir müssen uns auf unsere Vergangenheit einlassen, um zu erforschen, was uns gefehlt hat. Es gibt ein bewährtes Hilfsmittel, mit dem es uns leichter gelingt, uns wieder in diese Zeit zu versetzen: ein Foto, das uns als Kind im Alter zwischen vier und sechs Jahren zeigt. In Psychotherapien habe ich erlebt, wie viele Emotionen beim Betrachten hochkommen können. Die Erinnerungen können sehr schmerzlich sein. Trotzdem sollten wir uns damit befassen, denn das ist die Grundlage für eine positive Veränderung. Wenn wir mit diesem Kind, das wir einmal waren, Kontakt aufnehmen, wird es uns erzählen, worunter es gelitten hat, wo es zu kurz gekommen ist, wo man es überfordert oder missachtet hat. Wenn wir die Ursachen kennen, sind wir nicht mehr unserem Unterbewusstsein ausgeliefert, das uns dazu treibt, immer wieder ein großes Maß an Anerkennung zu verlangen. Wir können aktiv daran arbeiten, die alten Wunden zu schließen, und dadurch mehr Wahlfreiheit in unserem Verhalten gewinnen.