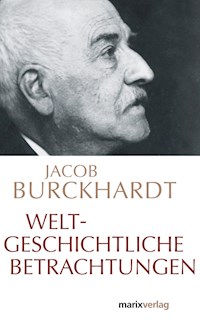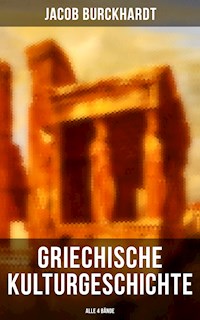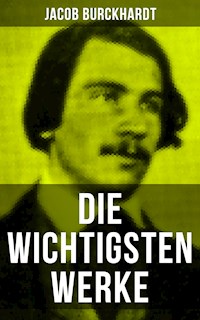Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Burckhardts Werk wurde erstmals 1860 veröffentlicht und ist heute noch von größter Bedeutung für das Verständnis des Strukturwandels von Staat und Kirche im Ausgang des Mittelalters und die damit einhergehende Ausbildung des "modernen", individuellen Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kultur der Renaissance in Italien
Jacob Burckhardt
Inhalt:
Jacob Burckhardt – Biografie und Bibliografie
Die Kultur der Renaissance in Italien
Erster Abschnitt - Der Staat als Kunstwerk
Zweiter Abschnitt Entwicklung des Individuums
Dritter Abschnitt - Die Wiedererweckung des Altertums
Vierter Abschnitt - Die Entdeckung der Welt und des Menschen
Fünfter Abschnitt - Die Geselligkeit und die Feste
Sechster Abschnitt - Sitte und Religion
Die Kultur der Renaissance in Italien, J. Burckhardt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606107
www.jazzybee-verlag.de
Jacob Burckhardt – Biografie und Bibliografie
Erster Abschnitt - Der Staat als Kunstwerk
Im wahren Sinne des Wortes führt diese Schrift den Titel eines blossen Versuches, und der Verfasser ist sich deutlich genug bewusst, dass er mit sehr mässigen Mitteln und Kräften sich einer überaus grossen Aufgabe unterzogen hat. Aber auch wenn er mit stärkerer Zuversicht auf seine Forschung hinblicken könnte, so wäre ihm der Beifall der Kenner kaum sicherer. Die geistigen Umrisse einer Kulturepoche geben vielleicht für jedes Auge ein verschiedenes Bild, und wenn es sich vollends um eine Zivilisation handelt, welche als nächste Mutter der unsrigen noch jetzt fortwirkt, so muss sich das subjektive Urteilen und Empfinden jeden Augenblick beim Darsteller wie beim Leser einmischen. Auf dem weiten Meere, in welches wir uns hinauswagen, sind der möglichen Wege und Richtungen viele, und leicht könnten dieselben Studien, welche für diese Arbeit gemacht wurden, unter den Händen eines andern nicht nur eine ganz andere Benützung und Behandlung erfahren, sondern auch zu wesentlich verschiedenen Schlüssen Anlass geben. Der Gegenstand an sich wäre wichtig genug, um noch viele Bearbeitungen wünschbar zu machen, Forscher der verschiedensten Standpunkte zum Reden aufzufordern. Einstweilen sind wir zufrieden, wenn uns ein geduldiges Gehör gewährt und dieses Buch als ein Ganzes aufgefaßt wird. Es ist die wesentlichste Schwierigkeit der Kulturgeschichte, dass sie ein grosses geistiges Kontinuum in einzelne scheinbar oft willkürliche Kategorien zerlegen muß, um es nur irgendwie zur Darstellung zu bringen. – Der grössten Lücke des Buches gedachten wir einst durch ein besonderes Werk über »Die Kunst der Renaissance« abzuhelfen; ein Vorsatz, welcher nur geringernteils hat ausgeführt werden können .
Der Kampf zwischen den Päpsten sind den Hohenstaufen hinterliess zuletzt Italien in einem politischen Zustande, welcher von dem des übrigen Abendlandes in den wesentlichsten Dingen abwich. Wenn in Frankreich, Spanien, England das Lehnssystem so geartet war, dass es nach Ablauf seiner Lebenszeit dem monarchischen Einheitsstaat in die Arme fallen musste, wenn es in Deutschland wenigstens die Einheit des Reiches äusserlich festhalten half, so hatte Italien sich ihm fast völlig entzogen. Die Kaiser des 14. Jahrhunderts wurden im günstigsten Falle nicht mehr als Oberlehnsherrn, sondern als mögliche Häupter und Verstärkungen schon vorhandener Mächte empfangen und geachtet; das Papsttum aber mit seinen Kreaturen und Stützpunkten war gerade stark genug, jede künftige Einheit zu verhindern, ohne doch selbst eine schaffen zu können . Zwischen den beiden war eine Menge politischer Gestaltungen – Städte und Gewaltherrscher – teils schon vorhanden, teils neu emporgekommen, deren Dasein rein tatsächlicher Art war . In ihnen erscheint der moderne europäische Staatsgeist zum erstenmal frei seinen eigenen Antrieben hingegeben; sie zeigen oft genug die fessellose Selbstsucht in ihren furchtbarsten Zügen, jedes Recht verhöhnend, jede gesunde Bildung im Keim erstickend; aber wo diese Richtung überwunden oder irgendwie aufgewogen wird, da tritt ein neues Lebendiges in die Geschichte: der Staat als berechnete, bewusste Schöpfung, als Kunstwerk. In den Stadtrepubliken wie in den Tyrannenstaaten prägt sich dies Leben hundertfaltig aus und bestimmt ihre innere Gestalt sowohl als ihre Politik nach aussen. Wir begnügen uns mit der Betrachtung des vollständigern, deutlicher ausgesprochenen Typus desselben in den Tyrannenstaaten.
Der innere Zustand der von Gewaltherrschern regierten Territorien hatte ein berühmtes Vorbild an dem Normannenreiche von Unteritalien und Sizilien, wie Kaiser Friedrich II. es umgestaltet hatte . Aufgewachsen unter Verrat und Gefahr in der Nähe von Sarazenen, hatte er sich frühe gewöhnt an eine völlig objektive Beurteilung und Behandlung der Dinge, der erste moderne Mensch auf dem Throne. Dazu kam eine nahe, vertraute Kenntnis von dem Innern der sarazenischen Staaten und ihrer Verwaltung und jener Existenzkrieg mit den Päpsten, welcher beide Parteien nötigte, alle denkbaren Kräfte und Mittel auf den Kampfplatz zu führen. Friedrichs Verordnungen (besonders seit 1231) laufen auf die völlige Zernichtung des Lehnsstaates, auf die Verwandlung des Volkes in eine willenlose, unbewaffnete, im höchsten Grade steuerfähige Masse hinaus. Er zentralisierte die ganze richterliche Gewalt und die Verwaltung in einer bisher für das Abendland unerhörten Weise; kein Amt mehr durfte durch Volkswahl besetzt werden, bei Strafe der Verwüstung des betreffenden Ortes und Degradation der Bürger zu Hörigen. Die Steuern, beruhend auf einem umfassenden Kataster und auf mohammedanischer Routine, wurden beigetrieben mit jener quälerischen und grausamen Art, ohne welche man dem Orientalen freilich kein Geld aus den Händen bringt. Hier ist kein Volk mehr, sondern ein kontrollierbarer Haufe von Untertanen, die z. B. ohne besondere Erlaubnis nicht auswärts heiraten und unbedingt nicht auswärts studieren durften; – die Universität Neapel übte den frühsten bekannten Studienzwang, während der Orient seine Leute wenigstens in diesen Dingen frei liess. Echt mohammedanisch dagegen war es wiederum, dass Friedrich nach dem ganzen Mittelmeer eigenen Handel trieb, viele Gegenstände sich vorbehielt und den Handel der Untertanen hemmte. Die fatimidischen Khalifen mit ihrer Geheimlehre des Unglaubens waren (wenigstens anfangs) tolerant gewesen gegen die Religionen ihrer Untertanen; Friedrich dagegen krönt sein Regierungssystem durch eine Ketzerinquisition, die nur um so schuldvoller erscheint, wenn man annimmt, er habe in den Ketzern die Vertreter freisinnigen städtischen Lebens verfolgt. Als Polizeimannschaft im Innern und als Kern der Armee nach aussen dienten ihm endlich jene aus Sizilien nach Luceria und nach Nocera übergesiedelten Sarazenen, welche gegen allen Jammer taub und gegen den kirchlichen Bann gleichgültig waren. Die Untertanen, der Waffen entwöhnt, liessen später den Sturz Manfreds und die Besitznahme des Anjou leicht und willenlos über sich ergehen; letzterer aber erbte diesen Regierungsmechanismus und benützte ihn weiter.
Neben dem zentralisierenden Kaiser tritt ein Usurpator der eigentümlichsten Art auf: sein Vicarius und Schwiegersohn Ezzelino da Romano. Er repräsentiert kein Regierungs- und Verwaltungssystem, da seine Tätigkeit in lauter Kämpfen um die Herrschaft im östlichen Oberitalien aufging, allein er ist als politisches Vorbild für die Folgezeit nicht minder wichtig als sein kaiserlicher Beschützer. Alle bisherige Eroberung und Usurpation des Mittelalters war entweder auf wirkliche oder vorgegebene Erbschaft und andere Rechte hin oder gegen die Ungläubigen oder Exkommunizierten vollbracht worden. Hier zum erstenmal wird die Gründung eines Thrones versucht durch Massenmord und endlose Scheusslichkeiten, d. h. durch Aufwand aller Mittel mit alleiniger Rücksicht auf den Zweck. Keiner der Spätern hat den Ezzelino an Kolossalität des Verbrechens irgendwie erreicht, auch Cesare Borgia nicht, aber das Beispiel war gegeben, und Ezzelinos Sturz war für die Völker keine Herstellung der Gerechtigkeit und für künftige Frevler keine Warnung.
Umsonst stellte in einer solchen Zeit S. Thomas von Aquino, der geborene Untertan Friedrichs, die Theorie einer konstitutionellen Herrschaft auf, wo der Fürst durch ein von ihm ernanntes Oberhaus und eine vom Volk gewählte Repräsentation unterstützt gedacht wird . Dergleichen verhallte in den Hörsälen, und Friedrich und Ezzelino waren und blieben für Italien die größten politischen Erscheinungen des 13. Jahrhunderts. Ihr Bild, schon halb fabelhaft widergespiegelt, ist der wichtigste Inhalt der »hundert alten Novellen«, deren ursprüngliche Redaktion gewiss noch in dies Jahrhundert fällt . Ezzelino wird hier bereits mit einer scheuen Ehrfurcht geschildert, welche der Niederschlag jedes ganz grossen Eindruckes ist. Eine ganze Literatur, von der Chronik der Augenzeugen bis zur halbmythologischen Tragödie, schloss sich an seine Person an .
Sofort nach dem Sturze der beiden tauchen dann, hauptsächlich aus den Parteikämpfen der Guelfen und Ghibellinen, die einzelnen Tyrannen in großer Anzahl empor, in der Regel als Ghibellinenhäupter, dabei aber unter so verschiedenen Vorgängen und Bedingungen, dass man eine allgemeine zu Grunde liegende Unvermeidlichkeit gar nicht verkennen kann. In betreff der Mittel brauchen sie nur da fortzufahren, wo die Parteien begonnen hatten: mit der Ausrottung oder Vertreibung der Gegner und Zerstörung ihrer Wohnungen.
Die grössern und kleinern Gewaltherrschaften des 14. Jahrhunderts verraten es häufig genug, dass Eindrücke dieser Art nicht verloren waren. Ihre Missetaten schrien laut und die Geschichte hat sie umständlich verzeichnet, aber als ganz auf sich selbst gestellte und danach organisierte Staaten haben sie immerhin ein höheres Interesse.
Die bewusste Berechnung aller Mittel, wovon kein damaliger ausseritalischer Fürst eine Idee hatte, verbunden mit einer innerhalb der Staatsgrenzen fast absoluten Machtvollkommenheit, brachte hier ganz besondere Menschen und Lebensformen hervor . Das Hauptgeheimnis der Herrschaft lag für die weisern Tyrannen darin, dass sie die Steuern möglichst so liessen, wie sie dieselben angetroffen oder am Anfang eingerichtet hatten: eine Grundsteuer, basiert auf einen Kataster; bestimmte Consumosteuern und Zölle auf Ein- und Ausfuhr, wozu noch die Einnahmen von dem Privatvermögen des herrschenden Hauses kamen; die einzige mögliche Steigerung hing ab von der Zunahme des allgemeinen Wohlstandes und Verkehres. Von Anleihen, wie sie in den Städten vorkamen, war hier nicht die Rede; eher erlaubte man sich hier und da einen wohlberechneten Gewaltstreich, vorausgesetzt, dass er den ganzen Zustand unerschüttert liess, wie z. B. die echt sultanische Absetzung und Ausplünderung des obersten Finanzbeamten .
Mit diesen Einkünften suchte man auszureichen, um den kleinen Hof, die Leibwache, die geworbene Mannschaft, die Bauten – und die Spassmacher sowohl als die Leute von Talent zu bezahlen, die zur persönlichen Umgebung des Fürsten gehörten. Die Illegitimität, von dauernden Gefahren umschwebt, vereinsamt den Herrscher; das ehrenvollste Bündnis, welches er nur irgend schliessen kann, ist das mit der höhern geistigen Begabung, ohne Rücksicht auf die Herkunft. Die Liberalität (Miltekeit) der nordischen Fürsten des 13. Jahrhunderts hatte sich auf die Ritter, auf das dienende und singende Adelsvolk beschränkt. Anders der monumental gesinnte, ruhmbegierige italienische Tyrann, der das Talent als solches braucht. Mit dem Dichter oder Gelehrten zusammen fühlt er sich auf einem neuen Boden, ja fast im Besitz einer neuen Legitimität.
Weltbekannt ist in dieser Beziehung der Gewaltherrscher von Verona, Can Grande della Scala, welcher in den ausgezeichneten Verbannten an seinem Hofe ein ganzes Italien beisammen unterhielt. Die Schriftsteller waren dankbar; Petrarca, dessen Besuche an diesen Höfen so strenge Tadler gefunden haben, schilderte das ideale Bild eines Fürsten des 14. Jahrhunderts . Er verlangt von seinem Adressaten – dem Herrn von Padua – vieles und grosses, aber auf eine Weise, als traute er es ihm zu. »Du musst nicht Herr deiner Bürger, sondern Vater des Vaterlandes sein und jene wie deine Kinder lieben , ja wie Glieder deines Leibes. Waffen, Trabanten und Söldner magst du gegen die Feinde wenden – gegen deine Bürger kommst du mit dem blassen Wohlwollen aus; freilich meine ich nur die Bürger, welche das Bestehende lieben, denn wer täglich auf Veränderungen sinnt, der ist ein Rebell und Staatsfeind und gegen solche mag strenge Gerechtigkeit walten!« Im einzelnen folgt nun die echt moderne Fiktion der Staatsallmacht; der Fürst soll für alles sorgen, Kirchen und öffentliche Gebäude herstellen und unterhalten, die Gassenpolizei aufrecht halten , Sümpfe austrocknen, über Wein und Getreide wachen; die Steuern gerecht verteilen, Hülflose und Kranke unterstützen und ausgezeichneten Gelehrten seinen Schutz und Umgang widmen, indem dieselben für seinen Nachruhm sorgen würden.
Aber welches auch die allgemeinen Lichtseiten und die Verdienste einzelner gewesen sein mögen, so erkannte oder ahnte doch schon das 14. Jahrhundert die geringe Dauer, die Garantielosigkeit der meisten dieser Tyrannen. Da aus innern Gründen politische Verfassungen wie diese genau um so viel haltbarer sind, als das Gebiet grösser ist, so waren die mächtigern Gewaltherrschaften stets geneigt, die kleinern zu verschlingen. Welche Hekatombe kleiner Herrscher ist nur allein den Visconti in dieser Zeit geopfert worden! Dieser äussern Gefahr aber entsprach gewiss fast jedesmal eine innere Gärung, und die Rückwirkung dieser Lage auf das Gemüt des Herrschers musste in den meisten Fällen überaus verderblich sein. Die falsche Allmacht, die Aufforderung zum Genuss und zu jeder Art von Selbstsucht von der einen, die Feinde und Verschwörer von der andern Seite machten ihn fast unvermeidlich zum Tyrannen im übeln Sinne. Wäre nur wenigstens den eigenen nächsten Blutsverwandten zu trauen gewesen! Allein wo alles illegitim war, da konnte sich auch kein festes Erbrecht, weder für die Sukzession in der Herrschaft, noch für die Teilung der Güter bilden, und vollends in drohenden Augenblicken schob den unmündigen oder untüchtigen Fürstensohn ein entschlossener Vetter oder Oheim beiseite, im Interesse des Hauses selbst. Auch über Ausschluss oder Anerkennung der Bastarde war beständiger Streit. So kam es, dass eine ganze Anzahl dieser Familien mit unzufriedenen, rachsüchtigen Verwandten heimgesucht waren; ein Verhältnis, das nicht eben selten in offenen Verrat und in wilden Familienmord ausbrach. Andere, als Flüchtlinge auswärts lebend, fassen sich in Geduld und behandeln auch diese Sachlage objektiv, wie z. B. jener Visconti, der am Gardasee Fischnetze auswarf ; der Bote seines Gegners fragte ihn ganz direkt: wann er wieder nach Mailand zurückzukehren gedenke? und erhielt die Antwort: »Nicht eher, als bis die Schandtaten jenes über meine Verbrechen das Uebergewicht erlangt haben werden.« Bisweilen opfern auch die Verwandten den regierenden Herrn der allzusehr beleidigten öffentlichen Moral, um dadurch das Gesamthaus zu retten . Hie und da ruht die Herrschaft noch so auf der Gesamtfamilie, dass das Haupt an deren Beirat gebunden ist; auch in diesem Falle veranlasste die Teilung des Besitzes und des Einflusses leicht den bittersten Hader.
Bei den damaligen florentinischen Autoren begegnet man einem durchgehenden tiefen Hass gegen dieses ganze Wesen. Schon das pomphafte Aufziehen, das Prachtkostüm, wodurch die Gewaltherrscher vielleicht weniger ihrer Eitelkeit Genüge tun als vielmehr Eindruck auf die Phantasie des Volkes machen wollten, erweckt ihren ganzen Sarkasmus. Wehe wenn ihnen gar ein Emporkömmling in die Hände fällt wie der neugebackene Doge Agnello von Pisa (1364), der mit dem goldenen Szepter auszureiten pflegte und sich dann wieder zu Hause am Fenster zeigte »wie man Reliquien zeigt«, auf Teppich und Kissen von Goldstoff gelehnt; kniend musste man ihn bedienen wie einen Papst oder Kaiser . Oefter aber reden diese alten Florentiner in einem erhabenen Ernst. Dante erkennt und benennt vortrefflich das Unadlige, Gemeinverständige der neufürstlichen Hab- und Herrschgier. »Was tönen ihre Posaunen, Schellen, Hörner und Flöten anders als: herbei zu uns, ihr Henker! ihr Raubvögel!« Man malt sich die Burg des Tyrannen hoch und isoliert, voller Kerker und Lauschröhren , als einen Aufenthalt der Bosheit und des Elends. Andere weissagen jedem Unglück, der in Tyrannendienste gehe und bejammern am Ende den Tyrannen selbst, welcher unvermeidlich der Feind aller Guten und Tüchtigen sei, sich auf niemand verlassen dürfe und den Untertanen die Erwartung seines Sturzes auf dem Gesicht lesen könne. »So wie die Tyrannien entstehen, wachsen und sich befestigen, so wächst auch in ihrem Innern verborgen der Stoff mit, welcher ihnen Verwirrung und Untergang bringen muß .« Der tiefste Gegensatz wird nicht deutlich hervorgehoben. Florenz war damals mit der reichsten Entwicklung der Individualitäten beschäftigt, während die Gewaltherrscher keine andere Individualität gelten und gewähren liessen als die ihrige und die ihrer nächsten Diener. War doch die Kontrolle des einzelnen Menschen bis aufs Passwesen herab schon völlig durchgeführt .
Das Unheimliche und Gottverlassene dieser Existenz bekam in den Gedanken der Zeitgenossen noch eine besondere Farbe durch den notorischen Sternglauben und Unglauben mancher Herrscher. Als der letzte Carrara in seinem pestverödeten Padua (1405) die Mauern und Tore nicht mehr besetzen konnte, während die Venezianer die Stadt umzingelten, hörten ihn seine Leibwachen oft des Nachts dem Teufel rufen: er möge ihn töten!
Die vollständigste und belehrendste Ausbildung dieser Tyrannis des 14. Jahrhunderts findet sich wohl unstreitig bei den Visconti in Mailand, von dem Tode des Erzbischofs Giovanni (1354) an. Gleich meldet sich in Bernabò ganz unverkennbar eine Familienähnlichkeit mit den schrecklichsten römischen Imperatoren ; der wichtigste Staatszweck ist die Eberjagd des Fürsten; wer ihm dareingreift, wird martervoll hingerichtet; das zitternde Volk muss ihm 5000 Jagdhunde füttern, unter der schärfsten Verantwortlichkeit für deren Wohlbefinden. Die Steuern werden mit allen denkbaren Zwangsmitteln emporgetrieben, sieben Töchter jede mit 100 000 Goldgulden ausgestattet und ein enormer Schatz gesammelt. Beim Tode seiner Gemahlin (1384) erschien eine Notifikation »an die Untertanen«, sie sollten, wie sonst die Freude, so jetzt das Leid mit ihm teilen und ein Jahr lang Trauer tragen. – Unvergleichlich bezeichnend ist dann der Handstreich, womit ihn sein Neffe Giangaleazzo (1385) in seine Gewalt bekam, eines jener gelungenen Komplotte, bei deren Schilderung noch späten Geschichtschreibern das Herz schlägt . Bei Giangaleazzo tritt der echte Tyrannensinn für das Kolossale gewaltig hervor. Er hat mit Aufwand von 300 000 Goldgulden riesige Dammbauten unternommen, um den Mincio von Mantua, die Brenta von Padua nach Belieben ableiten und diese Städte wehrlos machen zu können , ja es wäre nicht undenkbar, dass er auf eine Trockenlegung der Lagunen von Venedig gesonnen hätte. Er gründete »das wunderbarste aller Klöster«, die Certosa von Pavia, und den Dom von Mailand, »der an Grösse und Pracht alle Kirchen der Christenheit übertrifft«, ja vielleicht ist auch der Palast in Pavia, den schon sein Vater Galeazzo begonnen und den er vollendete, weitaus die herrlichste Fürstenresidenz des damaligen Europas gewesen. Dorthin verlegte er auch seine berühmte Bibliothek und die grosse Sammlung von Reliquien der Heiligen, welchen er eine besondere Art von Glauben widmete. Bei einem Fürsten von dieser Sinnesart wäre es befremdlich, wenn er nicht auch im politischen Gebiet nach den höchsten Kronen gegriffen hätte. König Wenzel machte ihn (1395) zum Herzog; er aber hatte nichts geringeres als das Königtum von Italien oder die Kaiserkrone im Sinne, als er (1402) erkrankte und starb. Seine sämtlichen Staaten sollen ihm einst in einem Jahre ausser der regelmässigen Steuer von 1 200 000 Goldgulden noch weitere 800 000 an ausserordentlichen Subsidien bezahlt haben. Nach seinem Tode ging das Reich, das er durch jede Art von Gewalttaten zusammengebracht, in Stücken, und vorderhand konnten kaum die ältern Bestandteile desselben behauptet werden. Was aus seinen Söhnen Giovan Maria (+ 1412) und Filippo Maria (+ 1447) geworden wäre, wenn sie in einem andern Lande und ohne von ihrem Hause zu wissen, gelebt hätten, wer weiss es? Doch als Erben dieses Geschlechtes erbten sie auch das ungeheure Kapital von Grausamkeit und Feigheit, das sich hier von Generation zu Generation angesammelt hatte.
Giovan Maria ist wiederum durch seine Hunde berühmt, aber nicht mehr durch Jagdhunde, sondern durch Tiere, die zum Zerreissen von Menschen abgerichtet waren und deren Eigennamen uns überliefert sind wie die der Bären Kaiser Valentinians I. Als im Mai 1409 während des noch dauernden Krieges das verhungernde Volk ihm auf der Strasse zurief: Pace! Pace!, liess er seine Söldner einhauen, die 200 Menschen töteten; darauf war bei Galgenstrafe verboten, die Worte Pace und Guerra auszusprechen und selbst die Priester angewiesen, statt dona nobis pacem zu sagen tranquillitatem! Endlich benutzten einige Verschworne den Augenblick, da der Grosscondottiere des wahnsinnigen Herzogs, Facino Cane, todkrank zu Pavia lag, und machten den Giovan Maria bei der Kirche S. Gottardo in Mailand nieder; der sterbende Facino aber liess am selbigen Tage seine Offiziere schwören, dem Erben Filippo Maria zu helfen, und schlug selber noch vor, seine Gemahlin möge sich nach seinem Tode mit diesem vermählen, wie denn auch baldigst geschah; es war Beatrice di Tenda. Von Filippo Maria wird noch weiter zu reden sein.
Und in solchen Zeiten getraute sich Cola Rienzi, auf den hinfälligen Enthusiasmus der verkommenen Stadtbevölkerung von Rom eine neue Herrschaft über Italien zu bauen. Neben Herrschern wie jene ist er von Anfang an ein armer, verlorener Tor.
Die Gewaltherrschaft im 15. Jahrhundert zeigt einen veränderten Charakter. Viele von den kleinen Tyrannen und auch einige von den grössern, wie die Scala und Carrara, sind untergegangen; die mächtigen haben sich arrondiert und innerlich charakteristischer ausgebildet; Neapel erhält durch die neue aragonesische Dynastie eine kräftigere Richtung. Vorzüglich bezeichnend aber ist für dieses Jahrhundert das Streben der Condottieren nach unabhängiger Herrschaft, ja nach Kronen: ein weiterer Schritt auf der Bahn des rein Tatsächlichen und eine hohe Prämie für das Talent wie für die Ruchlosigkeit. Die kleinern Tyrannen, um sich einen Rückhalt zu sichern, gehen jetzt gern in Dienste der größern Staaten und werden Condottieren derselben, was ihnen etwas Geld und auch wohl Straflosigkeit für manche Missetaten verschafft, vielleicht sogar Vergrösserung ihres Gebietes. Im ganzen genommen mussten Grosse und Kleine sich mehr anstrengen, besonnener und berechneter verfahren und sich der gar zu massenhaften Greuel enthalten; sie durften überhaupt nur so viel Böses üben, als nachweisbar zu ihren Zwecken diente – so viel verzieh ihnen auch die Meinung der Unbeteiligten. Von dem Kapital von Pietät, welches den legitimen abendländischen Fürstenhäusern zustatten kam, ist hier keine Spur, höchstens eine Art von hauptstädtischer Popularität; was den Fürsten Italiens wesentlich weiterhelfen muss, ist immer Talent und kühle Berechnung. Ein Charakter wie derjenige Karls des Kühnen, der sich mit wütender Leidenschaft in völlig unpraktische Zwecke hinein verbiss, war den Italienern ein wahres Rätsel. Die Schweizer seien ja lauter Bauern, und wenn man sie auch alle töte, so sei dies ja keine Genugtuung für die burgundischen Magnaten, die im Kampfe umkommen möchten! Besässe auch der Herzog die Schweiz ohne Widerstand, seine Jahreseinkünfte wären deshalb um keine 5000 Dukaten grösser u. s. w. .« Was in Karl Mittelalterliches war, seine ritterlichen Phantasien oder Ideale, dafür hatte Italien längst kein Verständnis mehr. Wenn er aber vollends den Unteranführern Ohrfeigen erteilte und sie dennoch bei sich behielt, wenn er seine Truppen misshandelte, um sie wegen einer Niederlage zu strafen, und dann wieder seine Geheimräte vor den Soldaten blamierte – dann mussten ihn die Diplomaten des Südens verloren geben. Ludwig XI. aber, der in seiner Politik die italienischen Fürsten innerhalb ihrer eigenen Art übertrifft, und der vor allem sich als Bewunderer des Francesco Sforza bekannte, ist im Gebiet der Bildung durch seine vulgäre Natur weit von jenen Herrschern geschieden.
In ganz merkwürdiger Mischung liegt Gutes und Böses in den italienischen Staaten des 15. Jahrhunderts durcheinander. Die Persönlichkeit der Fürsten wird eine so durchgebildete, eine oft so hochbedeutende, für ihre Lage und Aufgabe so charakteristische , dass das sittliche Recht schwer zu seinem Rechte kömmt.
Grund und Boden der Herrschaft sind und bleiben illegitim und ein Fluch haftet daran und will nicht davon weichen. Kaiserliche Gutheissungen und Belehnungen ändern dies nicht, weil das Volk keine Notiz davon nimmt, wenn seine Herrscher sich irgendwo in fernen Landen oder von einem durchreisenden Fremden ein Stück Pergament gekauft haben . Wären die Kaiser etwas nütze gewesen, so hätten sie die Gewaltherrn gar nicht emporkommen lassen – so lautete die Logik des unwissenden Menschenverstandes. Seit dem Römerzuge Karls IV. haben die Kaiser in Italien nur noch den ohne sie entstandenen Gewaltzustand sanktioniert, ohne ihn jedoch im geringsten anders als durch Urkunden garantieren zu können. Karls ganzes Auftreten in Italien ist eine der schmählichsten politischen Komödien; man mag im Matteo Villani nachlesen, wie ihn die Visconti in ihrem Gebiete herum und endlich daraus weg eskortieren, wie er eilt gleich einem Messkaufmann, um nur recht bald für seine Ware (die Privilegien nämlich) Geld zu erhalten, wie kläglich er in Rom auftritt, und wie er endlich, ohne einen Schwertstreich getan zu haben, mit seinem vollen Geldsack wieder über die Alpen zieht . Sigismund kam wenigstens das erstemal (1414) in der guten Absicht, Johann XXIII. zur Teilnahme an seinem Konzil zu bewegen; damals war es, als Kaiser und Papst auf dem hohen Turm von Cremona das Panorama der Lombardie genossen, während ihren Wirt, den Stadttyrannen Gabrino Fondolo, das Gelüste ankam, beide herunterzuwerfen. Das zweitemal erschien Sigismund völlig als Abenteurer; mehr als ein halbes Jahr hindurch sass er in Siena wie in einem Schuldgefängnis und konnte nachher nur mit Not zur Krönung in Rom gelangen. Was soll man vollends von Friedrich III. denken? Seine Besuche in Italien haben den Charakter von Ferien- oder Erholungsreisen auf Unkosten derer, die ihre Rechte von ihm verbrieft haben wollten, oder solcher, denen es schmeichelte, einen Kaiser recht pomphaft zu bewirten. So verhielt es sich mit Alfons von Neapel, der sich den kaiserlichen Besuch 150 000 Goldgulden kosten liess . In Ferrara hat Friedrich bei seiner zweiten Rückkehr von Rom (1469) einen ganzen Tag lang, ohne das Zimmer zu verlassen, lauter Beförderungen, achtzig an der Zahl, ausgespendet; da ernannte er cavalieri, conti, dottori, Notare, und zwar conti mit verschiedenen Schattierungen, als da waren: conte palatino, conte mit dem Recht dottori, ja bis auf fünf dottori zu ernennen, conte mit dem Recht Bastarde zu legitimieren, Notare zu kreieren, unehrliche Notare ehrlich zu erklären usw. Nur verlangte sein Kanzler für die Ausfertigung der betreffenden Urkunden eine Erkenntlichkeit, die man in Ferrara etwas stark fand . Was Herzog Borso dabei dachte, als sein kaiserlicher Gönner dergestalt urkundete und der ganze kleine Hof sich mit Titeln versah, wird nicht gemeldet. Die Humanisten, welche damals das grosse Wort führten, waren je nach den Interessen geteilt. Während die einen den Kaiser mit dem konventionellen Jubel der Dichter des kaiserlichen Roms feiern, weiss Poggio gar nicht mehr, was die Krönung eigentlich sagen solle; bei den Alten sei ja nur ein siegreicher Imperator gekrönt worden, und zwar mit Lorbeer.
Mit Maximilian I. beginnt dann eine neue kaiserliche Politik gegen Italien, in Verbindung mit der allgemeinen Intervention fremder Völker. Der Anfang – die Belehnung des Lodovico Moro mit Beseitigung seines unglücklichen Neffen – war nicht von der Art, welche Segen bringt. Nach der modernen Interventionstheorie darf, wenn Zweie ein Land zerreissen wollen, auch ein Dritter kommen und mithalten, und so konnte auch das Kaisertum sein Stück begehren. Aber von Recht u. dgl. musste man nicht mehr reden. Als Ludwig XII. (1502) in Genua erwartet wurde, als man den grossen Reichsadler von der Fronte des Hauptsaales im Dogenpalast wegtilgte und alles mit Lilien bemalte, frug der Geschichtschreiber Senarega überall herum, was jener bei so vielen Revolutionen stets geschonte Adler eigentlich bedeute und was für Ansprüche das Reich auf Genua habe? Niemand wusste etwas anderes als die alte Rede: Genua sei eine camera imperii. Niemand wusste überhaupt in Italien irgendwelchen sichern Bescheid über solche Fragen. Erst als Karl V. Spanien und das Reich zusammen besass, konnte er mit spanischen Kräften auch kaiserliche Ansprüche durchsetzen. Aber was er so gewann, kam bekanntlich nicht dem Reiche, sondern der spanischen Macht zugute.
Mit der politischen Illegitimität der Dynastien des 15. Jahrhunderts hinwiederum zusammen die Gleichgültigkeit gegen die legitime Geburt, welche den Ausländern, z. B. einem Comines, so sehr auffiel. Sie ging gleichsam mit in den Kauf. Während man im Norden, im Haus Burgund etwa, den Bastarden eigene bestimmt abgegrenzte Apanagen, Bistümer und dergleichen zuwies, während in Portugal eine Bastardlinie sich nur durch die grösste Anstrengung auf dem Throne behauptete, war in Italien kein fürstliches Haus mehr, welches nicht in der Hauptlinie irgendeine unechte Deszendenz gehabt und ruhig geduldet hätte. Die Aragonesen von Neapel waren die Bastardlinie des Hauses, denn Aragon selbst erbte der Bruder des Alfons I. Der grosse Federigo von Urbino war vielleicht überhaupt kein Montefeltro. Als Pius II. zum Kongress von Mantua (1459) reiste, ritten ihm bei der Einholung in Ferrara ihrer acht Bastarde vom Haus Este entgegen , darunter der regierende Herzog Borso selbst und zwei uneheliche Söhne seines ebenfalls unehelichen Bruders und Vorgängers Leonello. Letzterer hatte außerdem eine rechtmäßige Gemahlin gehabt, und zwar eine uneheliche Tochter Alfons I. von Neapel, von einer Afrikanerin . Die Bastarde wurden auch schon deshalb öfter zugelassen, weil die ehelichen Söhne minorenn und die Gefahren dringend waren; es trat eine Art von Seniorat ein, ohne weitere Rücksicht auf echte oder unechte Geburt. Die Zweckmässigkeit, die Geltung des Individuums und seines Talentes sind hier überall mächtiger als die Gesetze und Bräuche des sonstigen Abendlandes. War es doch die Zeit, da die Söhne der Päpste sich Fürstentümer gründeten! Im 16. Jahrhundert unter dem Einfluss der Fremden und der beginnenden Gegenreformation wurde die ganze Angelegenheit strenger angesehen; Varchi findet, die Sukzession der ehelichen Söhne sei »von der Vernunft geboten und von ewigen Zeiten her der Wille des Himmels .« Kardinal Ippolito Medici gründete sein Anrecht auf die Herrschaft über Florenz darauf, dass er aus einer vielleicht rechtmässigen Ehe entsprosst, oder doch wenigstens Sohn einer Adligen und nicht (wie der Herzog Alessandro) einer Dienstmagd sei . Jetzt beginnen auch die morganatischen Gefühlsehen, welche im 15. Jahrhundert aus sittlichen und politischen Gründen kaum einen Sinn gehabt hätten.
Die höchste und meistbewunderte Form der Illegitimität ist aber im 15. Jahrhundert der Condottiere, der sich – welches auch seine Abkunft sei – ein Fürstentum erwirbt. Im Grunde war schon die Besitznahme von Unteritalien durch die Normannen im 11. Jahrhundert nichts anderes gewesen; jetzt aber begannen Projekte dieser Art die Halbinsel in dauernder Unruhe zu erhalten.
Die Festsetzung eines Soldführers als Landesherrn konnte auch ohne Usurpation geschehen, wenn ihn der Brodherr aus Mangel an Geld mit Land und Leuten abfand ; ohnehin bedurfte der Condottiere, selbst wenn er für den Augenblick seine meisten Leute entliess, eines sichern Ortes, wo er Winterquartier halten und die notwendigsten Vorräte bergen konnte. Das erste Beispiel eines so ausgestatteten Bandenführers ist John Hawkwood, welcher von Papst Gregor XI. Bagnacavallo und Cotignola erhielt. Als aber mit Alberigo da Barbiano italienische Heere und Heerführer auf den Schauplatz traten, da kam auch die Gelegenheit viel näher, Fürstentümer zu erwerben, oder wenn der Condottiere schon irgendwo Gewaltherrscher war, das Ererbte zu vergrössern. Das erste grosse Bacchanal dieser soldatischen Herrschbegier wurde gefeiert in dem Herzogtum Mailand nach dem Tode des Giangaleazzo (1402); die Regierung seiner beiden Söhne ( f.) ging hauptsächlich mit der Vertilgung dieser kriegerischen Tyrannen dahin, und der grösste derselben, Facino Cane, wurde samt seiner Witwe, samt einer Reihe von Städten und 400 000 Goldgulden ins Haus geerbt; überdies zog Beatrice di Tenda die Soldaten ihres ersten Gemahls nach sich . Von dieser Zeit an bildete sich dann jenes über alle Massen unmoralische Verhältnis zwischen den Regierungen und ihren Condottieren aus, welches für das 15. Jahrhundert charakteristisch ist. Eine alte Anekdote , von jenen die nirgends und doch überall wahr sind, schildert dasselbe ungefähr so: Einst hatten die Bürger einer Stadt – es soll Siena gemeint sein – einen Feldherrn, der sie von feindlichem Druck befreit hatte; täglich berieten sie, wie er zu belohnen sei und urteilten, keine Belohnung, die in ihren Kräften stände, wäre gross genug, selbst nicht wenn sie ihn zum Herrn der Stadt machten. Endlich erhob sich einer und meinte: Lasst uns ihn umbringen und dann als Stadtheiligen anbeten. Und so sei man mit ihm verfahren ungefähr wie der römische Senat mit Romulus. In der Tat hatten sich die Condottieren vor niemand mehr zu hüten als vor ihren Brodherren; kämpften sie mit Erfolg, so waren sie gefährlich und wurden aus der Welt geschafft wie Roberto Malatesta gleich nach dem Siege, den er für Sixtus IV. erfochten (1482); beim ersten Unglück aber rächte man sich bisweilen an ihnen wie die Venezianer am Carmagnola (1432) . Es zeichnet die Sachlage in moralischer Beziehung, dass die Condottieren oft Weib und Kind als Geiseln geben mussten und dennoch weder Zutrauen genossen noch selber empfanden. Sie hätten Heroen der Entsagung, Charaktere wie Belisar sein müssen, wenn sich der tiefste Hass nicht in ihnen hätte sammeln sollen; nur die vollkommenste innere Güte hätte sie davon abhalten können, absolute Frevler zu werden. Und als solche, voller Hohn gegen das Heilige, voller Grausamkeit und Verrat gegen die Menschen, lernen wir manche von ihnen kennen, fast lauter Leute, denen es nichts ausmachte, im päpstlichen Banne zu sterben. Zugleich aber entwickelt sich in manchen die Persönlichkeit, das Talent, bis zur höchsten Virtuosität und wird auch in diesem Sinne von den Soldaten anerkannt und bewundert; es sind die ersten Armeen der neuern Geschichte, wo der persönliche Kredit des Anführers ohne weitere Nebengedanken die bewegende Kraft ist. Glänzend zeigt sich dies z. B. im Leben des Francesco Sforza ; da ist kein Standesvorurteil, das ihn hätte hindern können, die allerindividuellste Popularität bei jedem einzelnen zu erwerben und in schwierigen Augenblicken gehörig zu benützen; es kam vor, dass die Feinde bei seinem Anblick die Waffen weglegten und mit entblösstem Haupt ihn ehrerbietig grüssten, weil ihn jeder für den gemeinsamen »Vater der Kriegerschaft« hielt. Dieses Geschlecht Sforza gewährt überhaupt das Interesse, dass man die Vorbereitung auf das Fürstentum von Anfang an glaubt durchschimmern zu sehen . Das Fundament dieses Glückes bildete die grosse Fruchtbarkeit der Familie; Francescos bereits hochberühmter Vater Jacopo hatte zwanzig Geschwister, alle rauh erzogen in Cotignola bei Faenza, unter dem Eindruck einer jener endlosen romagnolischen Vendetten zwischen ihnen und dem Hause der Pasolini. Die ganze Wohnung war lauter Arsenal und Wachtstube, auch Mutter und Töchter völlig kriegerisch. Schon im dreizehnten Jahre ritt Jacopo heimlich von dannen, zunächst nach Panicale zum päpstlichen Condottiere Boldrino, demselben, welcher dann noch im Tode seine Schar anführte, indem die Parole von einem fahnenumsteckten Zelte ausgegeben wurde, in welchem der einbalsamierte Leichnam lag – bis sich ein würdiger Nachfolger fand. Jacopo, als er in verschiedenen Diensten allmählich emporkam, zog auch seine Angehörigen nach sich und genoss durch dieselben die nämlichen Vorteile, die einem Fürsten eine zahlreiche Dynastie verleiht. Diese Verwandten sind es, welche die Armee beisammen halten, während er im Castel dell' uovo zu Neapel liegt; seine Schwester nimmt eigenhändig die königlichen Unterhändler gefangen und rettet ihn durch dieses Pfand vom Tode. Es deutet schon auf Absichten von Dauer und Tragweite, dass Jacopo in Geldsachen äusserst zuverlässig war und deshalb auch nach Niederlagen Kredit bei den Bankiers fand; dass er überall die Bauern gegen die Lizenz der Soldaten schützte, und die Zerstörung eroberter Städte nicht liebte; vollends aber, dass er seine ausgezeichnete Konkubine Lucia (die Mutter Francescos) an einen andern verheiratete, um für einen fürstlichen Ehebund verfügbar zu bleiben. Auch die Vermählungen seiner Verwandten unterlagen einem gewissen Plan. Von der Gottlosigkeit und dem wüsten Leben seiner Fachgenossen hielt er sich ferne; die drei Lehren, womit er seinen Francesco in die Welt sandte, lauten: rühre keines andern Weib an; schlage keinen von deinen Leuten oder, wenn es geschehen, schicke ihn weit fort; endlich: reite kein hartmäuliges Pferd und keines, das gerne die Eisen verliert. Vor allem aber besass er die Persönlichkeit, wenn nicht eines grossen Feldherrn, doch eines grossen Soldaten, einen mächtigen, allseitig geübten Körper, ein populäres Bauerngesicht, ein wunderwürdiges Gedächtnis, das alle Soldaten, alle ihre Pferde und ihre Soldverhältnisse von vielen Jahren her kannte und aufbewahrte. Seine Bildung war nur italienisch; alle Musse aber wandte er auf Kenntnis der Geschichte und liess griechische und lateinische Autoren für seinen Gebrauch übersetzen. Francesco, sein noch ruhmvollerer Sohn, hat von Anfang an deutlich nach einer grossen Herrschaft gestrebt und das gewaltige Mailand durch glänzende Heerführung und unbedenklichen Verrat auch erhalten (1447-1450).
Sein Beispiel lockte. Aeneas Sylvius schrieb um diese Zeit: »In unserm veränderungslustigen Italien, wo nichts fest steht und keine alte Herrschaft existiert, können leicht aus Knechten Könige werden.« Einer aber, der sich selber »den Mann der Fortuna« nannte, beschäftigte damals vor allen die Phantasie des ganzen Landes: Giacomo Piccinino, der Sohn des Nicolò. Es war eine offene und brennende Frage: ob auch ihm die Gründung eines Fürstentumes gelingen werde oder nicht? Die grössern Staaten hatten ein einleuchtendes Interesse, es zu verhindern, und auch Francesco Sforza fand, es wäre vorteilhaft, wenn die Reihe der souverän gewordenen Soldführer mit ihm selber abschlösse. Aber die Truppen und Hauptleute, die man gegen Piccinino absandte, als er z. B. Siena hatte für sich nehmen wollen, erkannten ihr eigenes Interesse darin, ihn zu halten: »Wenn es mit ihm zu Ende ginge, dann könnten wir wieder den Acker bauen.« Während sie ihn in Orbetello eingeschlossen hielten, verproviantierten sie ihn zugleich, und er kam auf das ehrenvollste aus der Klemme. Endlich aber entging er seinem Verhängnis doch nicht. Ganz Italien wettete, was geschehen werde, als er (1465) von einem Besuch bei Sforza in Mailand nach Neapel zum König Ferrante reiste. Trotz aller Bürgschaften und hohen Verbindungen liess ihn dieser im Castel nuovo ermorden . Auch die Condottieren, welche ererbte Staaten besassen, fühlten sich doch nie sicher; als Roberto Malatesta und Federigo von Urbino (1482) an Einem Tage, jener in Rom, dieser in Bologna, starben, fand es sich, dass jeder im Sterben dem andern seinen Staat empfehlen liess ! Gegen einen Stand, der sich so vieles erlaubte, schien alles erlaubt. Francesco Sforza war noch ganz jung mit einer reichen calabresischen Erbin, Polissena Ruffa, Gräfin von Montalto, verheiratet worden, welche ihm ein Töchterchen gebar; eine Tante vergiftete die Frau und das Kind und zog die Erbschaft an sich .
Vom Untergang Piccininos an galt das Aufkommen von neuen Condottierenstaaten offenbar als ein nicht mehr zu duldender Skandal; die vier »Großstaaten« Neapel, Mailand, Kirche und Venedig schienen ein System des Gleichgewichtes zu bilden, welches keine jener Störungen mehr vertrug. Im Kirchenstaat, wo es von kleinen Tyrannen wimmelte, die zum Teil Condottieren gewesen oder es noch waren, bemächtigten sich seit Sixtus IV. die Nepoten des Alleinrechtes auf solche Unternehmungen. Aber die Dinge brauchten nur irgendwo ins Schwanken zu geraten, so meldeten sich auch die Condottieren wieder. Unter der kläglichen Regierung Innocenz VIII. war es einmal nahe daran, dass ein früher in burgundischen Diensten gewesener Hauptmann Boccalino sich mitsamt der Stadt Osimo, die er für sich genommen, den Türken übergeben hätte ; man musste froh sein, dass er sich auf Vermittlung des Lorenzo magnifico hin mit Geld abfinden liess und abzog. Im Jahre 1495, bei der Erschütterung aller Dinge infolge des Krieges Karls VIII., versuchte sich ein Condottiere Vidovero von Brescia ; er hatte schon früher die Stadt Cesena durch Mord vieler Edeln und Bürger eingenommen, aber das Kastell hielt sich, und er musste wieder fort; jetzt, begleitet von einer Truppe, die ihm ein anderer böser Bube, Pandolfo Malatesta von Rimini, Sohn des erwähnten Roberto und venezianischer Condottiere, abgetreten, nahm er dem Erzbischof von Ravenna die Stadt Castelnuovo ab. Die Venezianer, welche Grösseres besorgten und ohnehin vom Papst gedrängt wurden, befahlen dem Pandolfo »wohlmeinend«, den guten Freund bei Gelegenheit zu verhaften; es geschah, obwohl »mit Schmerzen«, worauf die Ordre kam, ihn am Galgen sterben zu lassen. Pandolfo hatte die Rücksicht, ihn erst im Gefängnis zu erdrosseln und dann dem Volk zu zeigen. – Das letzte bedeutendere Beispiel solcher Usurpationen ist der berühmte Kastellan von Musso, der bei der Verwirrung im Mailändischen nach der Schlacht bei Pavia (1525) seine Souveränetät am Comersee improvisierte.
Im allgemeinen läßt sich von den Gewaltherrschern des 15. Jahrhunderts sagen, dass die schlimmsten Dinge in den kleinern und kleinsten Herrschaften am meisten sich häuften. Namentlich lagen hier für zahlreiche Familien, deren einzelne Mitglieder alle ranggemäss leben wollten, die Erbstreitigkeiten nahe; Bernardo Varano von Camerino schaffte (1434) zwei Brüder aus der Welt , weil seine Söhne mit deren Erbe ausgestattet sein wollten. Wo ein blosser Stadtherrscher sich auszeichnet durch praktische, gemässigte, unblutige Regierung und Eifer für die Kultur zugleich, da wird es in der Regel ein solcher sein, der zu einem grossen Hause gehört oder von der Politik eines solchen abhängt. Dieser Art war z. B. Alessandro Sforza , Fürst von Pesaro, Bruder des grossen Francesco und Schwiegervater des Federigo von Urbino (+ 1473). Als guter Verwalter, als gerechter und zugänglicher Regent genoss er nach langem Kriegsleben eine ruhige Regierung, sammelte eine herrliche Bibliothek und brachte seine Musse mit gelehrten und frommen Gesprächen zu. Auch Giovanni II. Bentivoglio von Bologna (1462-1506), dessen Politik von der der Este und Sforza bedingt war, lässt sich hieher zählen. Welche blutige Verwilderung dagegen finden wir in den Häusern der Varani von Camerino, der Malatesta von Rimini, der Manfreddi von Faenza, vor allem der Baglioni von Perugia. Ueber die Ereignisse im Hause der letztern gegen Ende des 15. Jahrhunderts sind wir durch ausgezeichnete Geschichtsquellen – die Chroniken des Graziani und des Matarazzo – besonders anschaulich unterrichtet.
Die Baglionen waren eines von jenen Häusern, deren Herrschaft sich nicht zu einem förmlichen Fürstentum durchgebildet hatte, sondern mehr nur in einem städtischen Primat bestand und auf grossem Familienreichtum und tatsächlichem Einfluß auf die Aemterbesetzung beruhte. Innerhalb der Familie wurde einer als Gesamtoberhaupt anerkannt; doch herrschte tiefer, verborgener Hass zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Zweige. Ihnen gegenüber hielt sich eine gegnerische Adelspartei unter Anführung der Familie Oddi; alles ging (um 1487) in Waffen, und alle Häuser der Grossen waren voller Bravi; täglich gab es Gewalttaten; bei Anlaß der Beerdigung eines ermordeten deutschen Studenten stellten sich zwei Kollegien in Waffen gegeneinander auf; ja bisweilen lieferten sich die Bravi verschiedener Häuser Schlachten auf offener Piazza. Vergebens jammerten Kaufleute und Handwerker; die päpstlichen Governatoren und Nepoten schwiegen oder machten sich bald wieder davon. Endlich müssen die Oddi Perugia verlassen, und nun wird die Stadt eine belagerte Feste unter der vollendeten Gewaltherrschaft der Baglionen, welchen auch der Dom als Kaserne dienen muss. Komplotten und Ueberfällen wird mit furchtbarer Rache begegnet; nachdem man (im Jahr 1491) 130 Eingedrungene zusammengehauen und am Staatspalast gehenkt, wurden auf der Piazza 35 Altäre errichtet und drei Tage lang Messen gelesen und Prozessionen gehalten, um den Fluch von der Stätte wegzunehmen. Ein Nepot Innocenz VIII. wurde am hellen Tage auf der Gasse erstochen, einer Alexanders VI., der abgesandt war um zu schlichten, erntete nichts als offenen Hohn. Dafür hatten die beiden Häupter des regierenden Hauses Guido und Ridolfo häufige Unterredungen mit der heiligen wundertätigen Dominikanernonne Suor Colomba von Rieti, welche unter Androhung grossen künftigen Unheils zum Frieden riet, natürlich vergebens. Immerhin macht der Chronist bei diesem Anlass aufmerksam auf die Andacht und Frömmigkeit der bessern Peruginer in diesen Schreckensjahren. Während (1494) Karl VIII. heranzog, führten die Baglionen und die in und um Assisi gelagerten Verbannten einen Krieg von solcher Art, dass im Tal alle Gebäude dem Boden eben, die Felder unbebaut lagen, die Bauern zu kühnen Räubern und Mördern verwilderten, und Hirsche und Wölfe das emporwuchernde Gestrüpp bevölkerten, wo letztere sich an den Leichen der Gefallenen, an »Christenfleisch«, gütlich taten. Als Alexander VI. vor dem von Neapel zurückkehrenden Karl VIII. (1495) nach Umbrien entwich, fiel es ihm in Perugia ein, er könnte sich der Baglionen auf immer entledigen; er schlug dem Guido irgendein Fest, ein Turnier oder etwas dergleichen vor, um sie irgendwo alle beisammen zu haben, aber Guido war der Meinung, »das allerschönste Schauspiel wäre, alle bewaffnete Mannschaft von Perugia beisammen zu sehen«, worauf der Papst seinen Plan fallen liess. Bald darauf machten die Verbannten wieder einen Ueberfall, bei welchem nur der persönlichste Heldenmut der Baglionen den Sieg gewann. Da wehrte sich auf der Piazza der achtzehnjährige Simonetto Baglione mit Wenigen gegen mehrere Hunderte, und stürzte mit mehr als zwanzig Wunden, erhob sich aber wieder, als ihm Astorre Baglione zu Hülfe kam, hoch zu Ross in vergoldeter Eisenrüstung mit einem Falken auf dem Helm: »Dem Mars vergleichbar an Anblick und an Taten sprengte er in das Gewühl.«
Damals war Rafael als zwölfjähriger Knabe in der Lehre bei Pietro Perugino. Vielleicht sind Eindrücke dieser Tage verewigt in den frühen kleinen Bildchen des heil. Georg und des heil. Michael; vielleicht lebt noch etwas davon unvergänglich fort in dem grossen St. Michaelsbilde, und wenn irgendwo Astorre Baglione seine Verklärung gefunden hat, so ist es geschehen in der Gestalt des himmlischen Reiters im Heliodor.
Die Gegner waren teils umgekommen, teils in panischem Schrecken gewichen, und fortan keines solchen Angriffes mehr fähig. Nach einiger Zeit wurde ihnen eine partielle Versöhnung und Rückkehr gewährt. Aber Perugia wurde nicht sicherer noch ruhiger; die innere Zwietracht des herrschenden Hauses brach jetzt in entsetzlichen Taten aus. Gegenüber Guido, Ridolfo und ihren Söhnen Gianpaolo, Simonetto, Astorre, Gismondo, Gentile, Marcantonio u. a. taten sich zwei Grossneffen, Grifone und Carlo Barciglia, zusammen; letzterer zugleich Neffe des Fürsten Varano von Camerino und Schwager eines der früheren Verbannten, Jeronimo dalla Penna. Vergebens bat Simonetto, der schlimme Ahnungen hatte, seinen Oheim kniefällig, diesen Penna töten zu dürfen, Guido versagte es ihm. Das Komplott reifte plötzlich bei der Hochzeit des Astorre mit der Lavinia Colonna, Mitte Sommers 1500. Das Fest nahm seinen Anfang und dauerte einige Tage unter düstern Anzeichen, deren Zunahme bei Matarazzo vorzüglich schön geschildert ist. Der anwesende Varano trieb sie zusammen; in teuflischer Weise wurde dem Grifone die Alleinherrschaft und ein erdichtetes Verhältnis seiner Gemahlin Zenobia mit Gianpaolo vorgespiegelt und endlich jedem Verschworenen sein bestimmtes Opfer zugeteilt. (Die Baglionen hatten lauter geschiedene Wohnungen, meist an der Stelle des jetzigen Kastells.) Von den vorhandenen Bravi bekam jeder fünfzehn Mann mit; der Rest wurde auf Wachen ausgestellt. In der Nacht vom 15. Juli wurden die Türen eingerannt und der Mord an Guido, Astorre, Simonetto und Gismondo vollzogen; die andern konnten entweichen.
Als Astorres Leiche mit der des Simonetto auf der Gasse lag, verglichen ihn die Zuschauer »und besonders die fremden Studenten« mit einem alten Römer; so würdig und gross war der Anblick; in Simonetto fanden sie noch das Trotzigkühne, als hätte ihn selbst der Tod nicht gebändigt. Die Sieger gingen bei den Freunden der Familie herum und wollten sich empfehlen, fanden jedoch alles in Tränen und mit der Abreise auf die Landgüter beschäftigt. Aber die entronnenen Baglionen sammelten draussen Mannschaft und drangen, Gianpaolo an der Spitze, des folgenden Tages in die Stadt, wo andere Anhänger, soeben von Barciglia mit dem Tode bedroht, schleunig zu ihm stiessen; als bei S. Ercolano Grifone in seine Hände fiel, überliess er es seinen Leuten, ihn niederzumachen; Barciglia und Penna aber flüchteten sich nach Camerino zum Hauptanstifter des Unheils, Varano; in einem Augenblick, fast ohne Verlust, war Gianpaolo Herr der Stadt.
Atalanta, Grifones noch schöne und junge Mutter, die sich Tags zuvor samt seiner Gattin Zenobia und zwei Kindern Gianpaolos auf ein Landgut zurückgezogen und den ihr nacheilenden Sohn mehrmals mit ihrem Mutterfluche von sich gewiesen, kam jetzt mit der Schwiegertochter herbei und suchte den sterbenden Sohn. Alles wich vor den beiden Frauen auf die Seite; niemand wollte als der erkannt sein, der den Grifone erstochen hätte, um nicht die Verwünschung der Mutter auf sich zu ziehen. Aber man irrte sich; sie selber beschwor den Sohn, denjenigen zu verzeihen, welche die tödlichen Streiche geführt, und er verschied unter ihren Segnungen. Ehrfurchtsvoll sahen die Leute den beiden Frauen nach, als sie in ihren blutigen Kleidern über den Platz schritten. Diese Atalanta ist es, für welche später Rafael die weltberühmte Grablegung gemalt hat. Damit legte sie ihr eigenes Leid dem höchsten und heiligsten Mutterschmerz zu Füssen.
Der Dom, welcher das meiste von dieser Tragödie in seiner Nähe gesehen, wurde mit Wein abgewaschen und neu geweiht. Noch immer stand von der Hochzeit her der Triumphbogen, bemalt mit den Taten Astorres und mit den Lobversen dessen, der uns dieses alles erzählt, des guten Matarazzo.
Es entstand eine ganz sagenhafte Vorgeschichte der Baglionen, welche nur ein Reflex dieser Greuel ist. Alle von diesem Hause seien von jeher eines bösen Todes gestorben, einst 27 miteinander; schon einmal seien ihre Häuser geschleift und mit den Ziegeln davon die Gassen gepflastert worden u. dgl. Unter Paul III. trat dann die Schleifung ihrer Paläste wirklich ein.
Einstweilen aber scheinen sie gute Vorsätze gefasst, in ihrer eignen Partei Ordnung geschafft und die Beamten gegen die adligen Bösewichter geschützt zu haben. Allein der Fluch brach später doch wieder wie ein nur scheinbar gedämpfter Brand hervor; Gianpaolo wurde unter Leo X. 1520 nach Rom gelockt und enthauptet; der eine seiner Söhne, Orazio, der Perugia nur zeitweise und unter den gewaltsamsten Umständen besass, nämlich als Parteigänger des ebenfalls von den Päpsten bedrohten Herzogs von Urbino, wütete noch einmal im eignen Hause auf das grässlichste. Ein Oheim und drei Vettern wurden ermordet, worauf ihm der Herzog sagen liess, es sei jetzt genug . Sein Bruder Malatesta Baglione ist der florentinische Feldherr, welcher durch den Verrat von 1530 unsterblich geworden, und dessen Sohn Ridolfo ist jener letzte des Hauses, welcher in Perugia durch Ermordung des Legaten und der Beamten im Jahr 1534 eine nur kurze, aber schreckliche Herrschaft übte.
Den Gewaltherrschern von Rimini werden wir noch hie und da begegnen. Frevelmut, Gottlosigkeit, kriegerisches Talent und höhere Bildung sind selten so in einem Menschen vereinigt gewesen wie in Sigismondo Malatesta (+ 1467). Aber wo die Missetaten sich häufen, wie in diesem Hause geschah, da gewinnen sie das Schwergewicht auch über das Talent und ziehen die Tyrannen in den Abgrund. Der schon erwähnte Pandolfo, Sigismondos Enkel, hielt sich nur noch, weil Venedig seinen Condottiere trotz aller Verbrechen nicht wollte fallen lassen; als ihn seine Untertanen (1497) aus hinreichenden Gründen in seiner Burg zu Rimini bombardierten und dann entwischen liessen, führte ein venezianischer Kommissär den mit Brudermord und allen Greueln Befleckten wieder zurück. Nach drei Jahrzehnden waren die Malatesten arme Verbannte. Die Zeit um 1527 war, wie die des Cesare Borgia, eine Epidemie für diese kleinen Dynastien, nur sehr wenige überlebten sie und nicht einmal zu ihrem Glück. In Mirandola, wo kleine Fürsten aus dem Hause Pico herrschten, sass im Jahr 1533 ein armer Gelehrter, Lilio Gregorio Giraldi, der aus der Verwüstung von Rom sich an den gastlichen Herd des hochbejahrten Giovan Francesco Pico (Neffen des berühmten Giovanni) geflüchtet hatte; bei Anlass ihrer Besprechungen über das Grabmal, welches der Fürst für sich bereiten wollte, entstand eine Abhandlung , deren Dedikation vom April jenes Jahres datiert ist. Aber wie wehmütig lautet die Nachschrift: »Im Oktober desselben Jahres ist der unglückliche Fürst durch nächtlichen Mord von seinem Brudersohn des Lebens und der Herrschaft beraubt worden, und ich selber bin in tiefem Elend kaum mit dem Leben davongekommen.«
Eine charakterlose Halbtyrannie, wie sie Pandolfo Petrucci seit den 1490er Jahren in dem von Faktionen zerrissenen Siena ausübte, ist kaum der nähern Betrachtung wert. Unbedeutend und böse, regierte er mit Hülfe eines Professors der Rechte und eines Astrologen und verbreitete hie und da einigen Schrecken durch Mordtaten. Sein Sommervergnügen war, Steinblöcke vom Monte Amiata herunterzurollen, ohne Rücksicht darauf, was und wen sie trafen. Nachdem ihm gelingen musste, was den Schlausten misslang – er entzog sich den Tücken des Cesare Borgia – starb er doch später verlassen und verachtet. Seine Söhne aber hielten sich noch lange mit einer Art von Halbherrschaft.
Von den wichtigern Dynastien sind die Aragonesen gesondert zu betrachten. Das Lehnswesen, welches hier seit der Normannenzeit als Grundherrschaft der Barone fortdauert, färbt schon den Staat eigentümlich, während im übrigen Italien, den südlichen Kirchenstaat und wenige andere Gegenden ausgenommen, fast nur noch einfacher Grundbesitz gilt und der Staat keine Befugnisse mehr erblich werden lässt. Sodann ist der grosse Alfons, welcher seit 1435 Neapel in Besitz genommen (+ 1458), von einer andern Art als seine wirklichen oder vorgeblichen Nachkommen. Glänzend in seinem ganzen Dasein, furchtlos unter seinem Volke, von einer grossartigen Liebenswürdigkeit im Umgang, und selbst wegen seiner späten Leidenschaft für Lucrezia d'Alagna nicht getadelt, sondern bewundert, hatte er die eine üble Eigenschaft der Verschwendung , an welche sich dann die unvermeidlichen Folgen hingen. Frevelhafte Finanzbeamte wurden zuerst allmächtig, bis sie der bankerott gewordene König ihres Vermögens beraubte; ein Kreuzzug wurde gepredigt, um unter diesem Vorwand den Klerus zu besteuern; bei einem grossen Erdbeben in den Abruzzen mußten die Ueberlebenden die Steuer für die Umgekommenen weiter bezahlen. Unter solchen Umständen war Alfons für hohe Gäste der prunkhafteste Wirt seiner Zeit ( ) und froh des unaufhörlichen Spendens an jedermann, auch an Feinde; für literarische Bemühungen hatte er vollends keinen Maßstab mehr, so daß Poggio für die lateinische Uebersetzung von Xenophons Cyropädie fünfhundert Goldstücke erhielt.
Ferrante , der auf ihn kam, galt als sein Bastard von einer spanischen Dame, war aber vielleicht von einem valencianischen Marranen erzeugt. War es nun mehr das Geblüt oder die seine Existenz bedrohenden Komplotte der Barone, was ihn düster und grausam machte, jedenfalls ist er unter den damaligen Fürsten der schrecklichste. Rastlos tätig, als einer der stärksten politischen Köpfe anerkannt, dabei kein Wüstling, richtet er alle seine Kräfte, auch die eines unversöhnlichen Gedächtnisses und einer tiefen Verstellung auf die Zernichtung seiner Gegner. Beleidigt in allen Dingen, worin man einen Fürsten beleidigen kann, indem die Anführer der Barone mit ihm verschwägert und mit allen auswärtigen Feinden verbündet waren, gewöhnte er sich an das Aeusserste als an ein Alltägliches. Für die Beschaffung der Mittel in diesem Kampfe und in seinen auswärtigen Kriegen wurde wieder etwa in jener mohammedanischen Weise gesorgt, die Friedrich II. angewandt hatte: mit Korn und Oel handelte nur die Regierung; den Handel überhaupt hatte Ferrante in den Händen eines Ober- und Grosskaufmanns, Francesco Coppola, zentralisiert, welcher mit ihm den Nutzen teilte und alle Reeder in seinen Dienst nahm; Zwangsanleihen, Hinrichtungen und Konfiskationen, grelle Simonie und Brandschatzung der geistlichen Korporationen beschufen das übrige. Nun überliess sich Ferrante ausser der Jagd, die er rücksichtslos übte, zweierlei Vergnügungen: seine Gegner entweder lebend in wohlverwahrten Kerkern oder tot und einbalsamiert, in der Tracht, die sie bei Lebzeiten trugen , in seiner Nähe zu haben. Er kicherte, wenn er mit seinen Vertrauten von den Gefangenen sprach; aus der Mumienkollektion wurde nicht einmal ein Geheimnis gemacht. Seine Opfer waren fast lauter Männer, deren er sich durch Verrat, ja an seiner königlichen Tafel bemächtigt. Völlig infernal war das Verfahren gegen den im Dienst grau und krank gewordenen Premierminister Antonello Petrucci, von dessen wachsender Todesangst Ferrante immerfort Geschenke annahm, bis endlich ein Anschein von Teilnahme an der letzten Baronenverschwörung den Vorwand gab zu seiner Verhaftung und Hinrichtung, zugleich mit Coppola. Die Art, wie dies alles bei Caracciolo und Porzio dargestellt ist, macht die Haare sträuben. – Von den Söhnen des Königs genoss der ältere, Alfonso Herzog von Calabrien, in den spätem Zeiten eine Art Mitregierung; ein wilder, grausamer Wüstling, der vor dem Vater die grössere Offenheit voraus hatte und sich auch nicht scheute, seine Verachtung gegen die Religion und ihre Bräuche an den Tag zu legen. Die bessern, lebendigen Züge des damaligen Tyrannentums muss man bei diesen Fürsten nicht suchen; was sie von der damaligen Kunst und Bildung an sich nehmen, ist Luxus oder Schein. Schon die echten Spanier treten in Italien fast immer nur entartet auf; vollends aber zeigt der Ausgang dieses Marranenhauses (1494 und 1503) einen augenscheinlichen Mangel an Rasse. Ferrante stirbt vor innerer Sorge und Qual; Alfonso traut seinem eigenen Bruder Federigo, dem einzigen Guten der Familie, Verrat zu und beleidigt ihn auf die unwürdigste Weise; endlich flieht er, der bisher als einer der tüchtigsten Heerführer Italiens gegolten, besinnungslos nach Sizilien und lässt seinen Sohn, den jüngern Ferrante, den Franzosen und dem allgemeinen Verrat zur Beute. Eine Dynastie, welche so regiert hatte wie diese, hätte allermindestens ihr Leben teuer verkaufen müssen, wenn ihre Kinder und Nachkommen eine Restauration hoffen sollten. Aber: jamais homme cruel ne fut hardi, wie Comines bei diesem Anlass etwas einseitig und im ganzen doch richtig sagt.
Echt italienisch im Sinne des 15. Jahrhunderts stellt sich das Fürstentum in den Herzogen von Mailand dar, deren Herrschaft seit Giangaleazzo schon eine völlig ausgebildete absolute Monarchie gewesen ist. Vor allem ist der letzte Visconti, Filippo Maria (1412 bis 1447), eine höchst merkwürdige, glücklicherweise vortrefflich geschilderte Persönlichkeit. Was die Furcht aus einem Menschen von bedeutenden Anlagen in hoher Stellung machen kann, zeigt sich hier, man könnte sagen, mathematisch vollständig; alle Mittel und Zwecke des Staates konzentrieren sich in dem einen der Sicherung seiner Person, nur dass sein grausamer Egoismus doch nicht in Blutdurst überging. Im Kastell von Mailand, das die herrlichsten Gärten, Laubgänge und Tummelplätze mit umfasste, sitzt er: ohne die Stadt in vielen Jahren auch nur zu betreten; seine Ausflüge gehen nach den Landstädten, wo seine prächtigen Schlösser liegen; die Barkenflottille, die ihn, von raschen Pferden gezogen, auf eigens gebauten Kanälen dahinführt, ist für die Handhabung der ganzen Etikette eingerichtet. Wer das Kastell betrat, war hundertfach beobachtet; niemand sollte auch nur am Fenster stehen, damit nicht nach aussen gewinkt würde. Ein künstliches System von Prüfungen erging über die, welche zur persönlichen Umgebung des Fürsten gezogen werden sollten; diesen vertraute er dann die höchsten diplomatischen wie die Lakaiendienste an, denn beides war ja hier gleich ehrenvoll. Und dieser Mann führte lange, schwierige Kriege und hatte beständig grosse politische Dinge unter den Händen, d. h. er musste unaufhörlich Leute mit umfassenden Vollmachten aussenden. Seine Sicherheit lag nun darin, dass keiner von diesen keinem traute, daß die Condottieren durch Spione und die Unterhändler und höhern Beamten durch künstlich genährte Zwietracht, namentlich durch Zusammenkoppelung je eines Guten und eines Bösen, irregemacht und auseinander gehalten wurden. Auch in seinem Innersten ist Filippo Maria bei den entgegengesetzten Polen der Weltanschauung versichert; er glaubt an Gestirne und an blinde Notwendigkeit und betet zugleich zu allen Nothelfern ; er liest alte Autoren und französische Ritterromane. Und zuletzt hat derselbe Mensch, der den Tod nie wollte erwähnen hören und selbst seine sterbenden Günstlinge aus dem Kastell schaffen liess, damit niemand in dieser Burg des Glückes erbleiche, durch Schliessung einer Wunde und Verweigerung des Aderlasses seinen Tod absichtlich beschleunigt und ist mit Anstand und Würde gestorben.
Sein Schwiegersohn und endlicher Erbe, der glückliche Condottiere Francesco Sforza (1450-1466, ) war vielleicht von allen Italienern am meisten der Mann nach dem Herzen des 15. Jahrhunderts. Glänzender als in ihm war der Sieg des Genies und der individuellen Kraft nirgends ausgesprochen, und wer das nicht anzuerkennen geneigt war, durfte doch immerhin den Liebling der Fortuna in ihm verehren. Mailand empfand es offenbar als Ehre, wenigstens einen so berühmten Herrscher zu erhalten; hatte ihn doch bei seinem Eintritt das dichte Volksgedränge zu Pferde in den Dom hineingetragen, ohne dass er absteigen konnte . Hören wir die Bilanz seines Lebens, wie sie Papst Pius II., ein Kenner in solchen Dingen, uns vorrechnet . »Im Jahr 1459, als der Herzog zum Fürstenkongress nach Mantua kam, war er 60 (eher 58) Jahre alt; als Reiter einem Jüngling gleich, hoch und äusserst imposant an Gestalt, von ernsten Zügen, ruhig und leutselig im Reden, fürstlich im ganzen Benehmen, ein Ganzes von leiblicher und geistiger Begabung ohnegleichen in unserer Zeit, im Felde unbesiegt – das war der Mann, der von niedrigem Stande zur Herrschaft über ein Reich emporstieg. Seine Gemahlin war schön und tugendhaft, seine Kinder anmutig wie Engel vom Himmel; er war selten krank; alle seine wesentlichen Wünsche erfüllten sich. Doch hatte auch er einiges Missgeschick; seine Gemahlin tötete ihm aus Eifersucht die Geliebte; seine alten Waffengenossen und Freunde Troilo und Brunoro verliessen ihn und gingen zu König Alfons über; einen andern, Ciarpollone, musste er wegen Verrats henken lassen; von seinem Bruder Alessandro mußte er erleben, dass derselbe einmal die Franzosen gegen ihn aufstiftete; einer seiner Söhne zettelte Ränke gegen ihn und kam in Haft; die Mark Ancona, die er im Krieg erobert, verlor er auch wieder im Krieg. Niemand geniesst ein so ungetrübtes Glück, dass er nicht irgendwo mit Schwankungen zu kämpfen hätte. Der ist glücklich, der wenige Widerwärtigkeiten hat.« Mit dieser negativen Definition des Glückes entlässt der gelehrte Papst seinen Leser. Wenn er hätte in die Zukunft blicken können oder auch nur die Konsequenzen der völlig unbeschränkten Fürstenmacht überhaupt erörtern wollen, so wäre ihm eine durchgehende Wahrnehmung nicht entgangen: die Garantielosigkeit der Familie. Jene engelschönen, überdies sorgfältig und vielseitig gebildeten Kinder unterlagen, als sie Männer wurden, der ganzen Ausartung des schrankenlosen Egoismus. Galeazzo