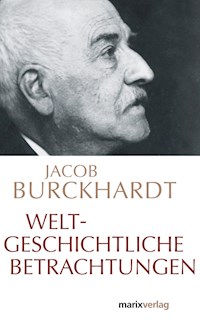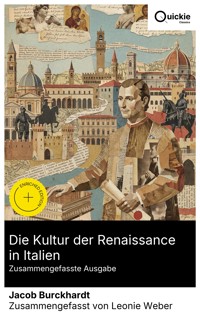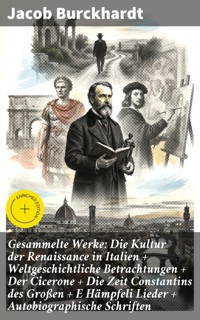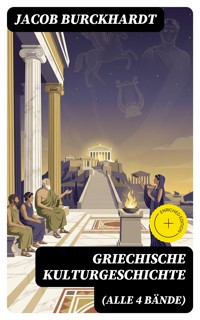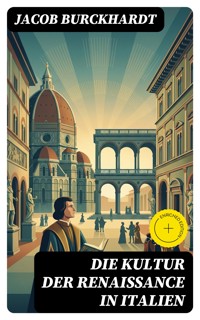Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Burckhardts Werk gehört auch heute noch zu den absoluten Klassikern der Kulturgeschichte und ist ein unerschöpfliches Referenzwerk. Dies ist Band 3 mit folgendem Inhalt: Inhalt: Sechster Abschnitt. Die Bildende Kunst I. Das Erwachen der Kunst II. Die Kunstgattungen III. Die Philosophen und Politiker und die Kunst Siebenter Abschnitt. Poesie und Musik I. Die Urzeit II. Die hexametrische Poesie III. Die Musik IV. Die Poesie ausserhalb des blossen Hexameters Achter Abschnitt. Zur Philosophie, Wissenschaft und Redekunst I. Fördernisse und Hemmung II. Der Bruch mit dem Mythus III. Die Redekunst IV. Die freie Persönlichkeit V. Die wissenschaftliche Forschung VI. Geschichte und Völkerkunde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 844
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Griechische Kulturgeschichte – Dritter Band
Jacob Burckhardt
Inhalt:
Jakob Burckhardt – Biografie und Bibliografie
Griechische Kulturgeschichte – Dritter Band
Sechster Abschnitt. Die Bildende Kunst
I. Das Erwachen der Kunst
II. Die Kunstgattungen
III. Die Philosophen und Politiker und die Kunst
Siebenter Abschnitt. Poesie und Musik
I. Die Urzeit
II. Die hexametrische Poesie
III. Die Musik
IV. Die Poesie ausserhalb des blossen Hexameters
Achter Abschnitt. Zur Philosophie, Wissenschaft und Redekunst
I. Fördernisse und Hemmung
II. Der Bruch mit dem Mythus
III. Die Redekunst
IV. Die freie Persönlichkeit
V. Die wissenschaftliche Forschung
VI. Geschichte und Völkerkunde
Griechische Kulturgeschichte Dritter Band, Jacob Burckhardt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849606299
www.jazzybee-verlag.de
Jakob Burckhardt – Biografie und Bibliografie
Schweizer Kultur- und Kunsthistoriker, geb. 25. Mai 1818 in Basel, gest. daselbst 8. Aug. 1897, studierte auf der Universität seiner Vaterstadt Theologie, deutsche Literatur und Geschichte und setzte diese Studien in Berlin fort. Hier ward er mit Franz Kugler befreundet, für den er später die zweite Auflage seines »Handbuchs der Kunstgeschichte« (Stuttg. 1848) besorgte. In die Heimat zurückgekehrt, wurde B. in der Folge zum Professor der Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität zu Basel ernannt, dann bei der Gründung des Polytechnikums in Zürich in gleicher Eigenschaft an diese Anstalt berufen, kehrte jedoch bald wieder an die Universität seiner Vaterstadt zurück. 1893 trat er in den Ruhestand. B. zeichnet sich als Schriftsteller ebenso durch lichtvolle Darstellung und Feinheit der Auffassung wie durch gründliche Literatur- und Quellenkenntnis aus. Er begann seine Laufbahn mit den Werken: »Die Kunstwerke der belgischen Städte« (Düsseld. 1842); »Jakob von Hochstaden, Erzbischof von Köln« (Bonn 1843) und »Erzbischof Andreas von Krain und die letzte Konzilsversammlung in Basel 1482–1484« (Basel 1852). Ihnen folgten seine Hauptwerke: »Der Cicerone, eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens« (Basel 1855; 8. Aufl. von W. Bode, Leipz. 1901, 2 Tle.), worin in trefflicher Charakteristik die wichtigeren Meisterwerke Italiens aus älterer und neuerer Zeit dargestellt sind; »Die Zeit Konstantins des Großen« (Basel 1853; 3. Aufl., Leipz. 1898); »Die Kultur der Renaissance in Italien« (Basel 1860; 8. Aufl., besorgt von L. Geiger, Leipz. 1902) und die »Geschichte der Renaissance in Italien« (Stuttg. 1867; 3. Aufl., bearbeitet von Holtzinger, 1891). Aus seinem Nachlass erschienen: »Erinnerungen aus Rubens« (Basel 1898); »Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien. Das Altarbild-Das Portrat in der Malerei-Die Sammler« (das. 1898); »Griechische Kulturgeschichte« (hrsg. von Oeri, Berl. 1898–1900, 3 Bde.). Vgl. Trog, Jakob B., biographische Skizze (Basel 1898).
Griechische Kulturgeschichte – Dritter Band
Sechster Abschnitt. Die Bildende Kunst
I. Das Erwachen der Kunst
Im Grunde diejenigen Leistungen der Griechen, worin sie die größte Überlegenheit über die seitherigen Völker und Zeiten geoffenbart, sind ihre Kunst und ihre Poesie. In dieser Anschauung lassen wir uns keinen Augenblick irremachen durch Theorien, wie sie z.B. in Hellwalds Kulturgeschichte laut werden. Wenn hier die künstlerische und poetische Entwicklung der Griechen nicht nur mit der Abwesenheit der (den Sklaven überbundenen) materiellen Arbeit in Verbindung gebracht wird, sondern auch mit der Abwesenheit der wissenschaftlichen Tätigkeit, so dürfte hiegegen doch vor allem eingewandt werden, daß wissenschaftliche Leistungen etwas spezifisch anderes sind als künstlerische, indem, was ein Volk in den Wissenschaften versäumt, gewiß von einem andern Volk oder Jahrhundert nachgeholt wird, während Kunst und Poesie eben nur einmal dasjenige leisten, was gar nie mehr nachgeholt werden kann. Und ferner müßte man, wenn man mit einer solchen Bevorzugung der wissenschaftlichen, resp. materiellen Kultur vor der Kunst Recht behalten wollte, allermindestens beweisen, daß diese Kultur die Völker nicht bloß vorwärts bringe, sondern glücklich mache. Aber von aller Aussicht, diesen Beweis führen zu können, ist man weit entfernt. Schon zur großen Verteidigung des Daseins genügt weder Kunst noch Wissen, sondern es bedarf eines Dritten.
Diese Kunst nun, die mit erstaunlicher Lebenszähigkeit so vieles andere überdauert und bis in die römische Kaiserzeit die herrlichsten Blüten getrieben hat, tritt gleich in den ältesten Fundgegenständen mit einer Fülle von Gattungen und Formen auf, welche auf eine enorm reiche Zukunft deutet. Gerne wüßten wir, welches derjenigen Elemente, aus denen die Nation entstanden ist (Pelasger, Karer, Leleger, Kreter, Phryger), den Funken des Schönen in sich gehabt hat, und welches vorzugsweise bildnerisch und monumental gesinnt war1. Jedenfalls kann schon für die älteste Zeit in Betracht gekommen sein die Vielheit des Daseins, zumal die Menge von Fürsten- und Adelshöfen, welche Mittelpunkte künstlerischer Tätigkeit sein konnten, und ebenso gewiß auch die lokale Unabhängigkeit und Vielartigkeit des Kultus, in welchem allem sich sehr frühe wohl schon der agonale Wettbetrieb geltend gemacht hat. Daneben aber war es schon in der Kinderzeit von Nation und Kultur wichtig, daß eine Sitte und Gewohnheit mannigfachen Bildens entstand, und darum hat lange, bevor das Wie die Bildnerei beschäftigte, das Was die Grundlage aller bildnerischen Übung schaffen müssen. Die Anlässe waren wohl hauptsächlich erstens der Götterdienst mit Verbildlichung der Götter und mit Weihgeschenken figürlicher Art, und sodann das Grab mit den mitgegebenen Bildwerken und Figuren, welche schon frühe ikonisch sein wollten. Erst sekundär kommt dann in Betracht ein monumentaler Wille, der sich für seine Schöpfungen unvergänglicher Stoffe bedient, ohne doch die Existenz einer ganzen dädalischen Kunst in Holz auszuschließen. Und neben diesem allem macht sich als besonderer Trieb die Schmuckliebe geltend, welche sich schon bei Wilden so stark regt und so zierliche, auch im Stoff sehr ausgesuchte Bildungen hervorbringt, bei einiger Kultur dann aber die Macht und den Reichtum sehr ernstlich in ihren Dienst nimmt.
Von dieser ältesten Kunstübung legen nun für uns hauptsächlich die Funde Schliemanns Zeugnis ab. Bei ihnen imponiert vor allem die Masse von Gold. Wir erinnern nur an jenen Becher von Ilion in Gestalt eines eingekappten Nachens, aus dem jedenfalls von beiden Seiten getrunken wurde, Schliemanns depas ampikypellon, und andere ilische Gefäße, und an das überaus viele flachgeschlagene Goldblech, welches sukzessive den in der ältesten Fundschicht von Mykenä, auf der Akropolis bestatteten Toten als Schmuck (Totenapparat) mitgegeben wurde. Wir lassen es auf sich beruhen, wieweit für einzelne Formen der Teppich oder der Holzstil das Prius ist, und ebenso, welche Formen aus "Prägetechnik" abzuleiten sind; das Vorbild der Spiralornamente findet Milchhöfer mit Recht in gerolltem und aufgelötetem Draht2. Für uns ist das Wesentliche, daß der Stil, womit die ersten Bildungen von Tieren (niederen Seetieren usw.) und Menschen gegeben sind, schon ein ganz sicherer ist. Jene lebensgroßen, aus Goldblech getriebenen Masken mit den oft unangenehmen, aber ganz realistisch gegebenen Zügen sind im höchsten Grade bedeutend als die erste individuelle Darstellung des griechischen Menschen. Schon entwickelter aber sind der rennende Greif3 und die Sphinx, und ganz meisterhaft die massiven Goldsachen4: die sog. "Schieber" mit ihren vorzüglichen Kompositionen von Kämpfen und Jagden, die "Ringe" mit ähnlichen Darstellungen und zumal jene große Gemme mit göttlichen Frauengestalten, wofür Milchhöfer die Parallelen in der indischen Kunst nachweist5. Diese Gemmen6 setzten eine höchst entwickelte, schwierige und aufopferungsvolle Technik voraus; denn es wurden dazu nicht nur die weichen Steine (Steatit, Hämatit), sondern in den späteren Exemplaren auch Sarder, Achat, Jaspis, Chalcedon und Bergkristall verwandt.
Neben diesen Schätzen aus Gräbern, welche älter als die mykenischen Schatzhäuser und als das Löwentor sein müssen und auf einen ganz großen künstlerischen Betrieb in allerfrühester Zeit hinweisen, interessieren uns vor allem die an den Brandopferstätten zu Olympia in tiefster schwarzer Erdschicht massenhaft gefundenen Bronze- (auch Terrakotta-) Figürchen von Menschen und Tieren, besonders Pferden. Sie mögen uns als die frühesten nachweisbaren Anatheme der griechischen Kunst begrüßt sein; von ihnen geht eine Reihe weiter bis zu den wundervollen Gruppen des V. und IV. Jahrhunderts. Wenn man dies erwägt, so bekommt man vor einer solchen Übung alle Achtung; einmal hat die Kunst anfangen müssen.
Nehmen wir zu diesem allen nun noch, was von frühesten Architekturen erhalten ist: die Kyklopenmauern, die Thesauren, das Löwentor7, wobei uns der Anfang architektonischer Gliederung auf griechischem Boden entgegentritt, so gewinnen wir einen Einblick in eine mächtige, der dorischen Wanderung vorangegangene Kunsttätigkeit. Aber zugleich sehen wir uns auch vor eine große Lücke gestellt, welche diese Kunst von der späteren trennt und bis zum VII. Jahrhundert reicht, und möchten dringend wissen, wie dieselbe auszufüllen ist.
Eine Spur, woraus das Weiterleben der mykenischen Kunst zu erschließen ist, bietet das Epos bei Homer und Hesiod8 mit der Schilderung der beiden Schilde. Man sieht hier in eine ganze Welt von Darstellungen hinein, und diese sind nicht als Reliefs zu denken, sondern als eingelegte Plattierarbeit aus Metallen verschiedener Farben. Man hat sich z.B. auf dem Schild des Achilles dunkle Trauben, Weinpfähle aus Silber, eine Umzäunung von Zinn, Rinder, abwechselnd von Gold und von Zinn, ein dunkelndes Brachfeld vorzustellen; das alles hat seine Analoga in Mykenä gefunden; besonders in den bronzenen Dolchklingen, worauf in kleinen, höchst delikaten Figuren Jagdszenen in Gold eingelegt sind. Aber daß Kunstwerke aus Metall sich nicht erhalten haben, wo nicht, wie in Ilion und Mykenä, eine besondere Gunst des Zufalls waltete, ist natürlich, und dasselbe gilt, wie Milchhöfer9 richtig bemerkt, von der Holzskulptur, deren Repräsentanten für uns Dädalos und die Dädaliden sind, und von der dem späteren Altertum die Kypseloslade und ähnliche Werke erhalten waren. Die Steinskulptur aber, die freilich schon in Mykenä vorkommt, erhob sich langsam und spät, und so ist man denn, da schließlich nur gebrannte Erde solche Lücken überdauert, für diese ganze Zeit auf die Terrakotten- und Vasenfunde angewiesen, die darum mit Recht der Gegenstand eifrigster Forschung sind.
Für uns aber handelt es sich nun zunächst darum, diejenigen Fördernisse positiver und negativer Art festzustellen, welche die Kunst zu einer so erstaunlichen Blüte gebracht haben, und hier ist nun vor allem der Freiheit dieser Kunst zu gedenken. Freilich blieb dieselbe, nachdem die Poesie die Gestalt der Götter längst mit der höchsten Idealität und Lebendigkeit10 bekleidet hatte, in den Götterbildern noch lange den alten überlieferten Typen treu, und man darf wohl sagen, daß die Anschauung lange schön war, bevor das Bild der Gottheit schön wurde11; dieses wird vielmehr noch Jahrhunderte über Homer hinaus das alte Holzbild (Xoanon)12 geblieben sein. Aber die Kunst war hierzu nicht gezwungen. Während sie bei den Barbaren des Orients, von mächtigen Priesterkasten und dumpfem Volksgeist bedrängt, in wüster Symbolik das Göttliche oder das Religiöse ausdrücken muß, weil es überhaupt um jeden Preis greifbar ausgedrückt werden soll, und also vor Mischung mit Tierformen, wobei der Kopf des Gottes tierisch bleibt (Ägypten), vor Vervielfachung der Glieder (Indien), vor ritualer Umhüllung und Gebärde (Assur) nicht zurückscheuen darf, und dies alles zu einer Zeit, da durch die sonstige Kulturhöhe das Monumentale als solches schon in hohem Grade ausgebildet ist, und während so die größten Mißgeburten gerade im solidesten Stoff und mit relativ hoher Vollendung ins Dasein treten können, gibt es bei den Griechen keinen Priesterstand, d.h. keine dauernde Macht, welche vorzeitig und tyrannisch irgendeine bildliche Auffassung des Göttlichen erzwungen und in dieser Gestalt festgehalten hätte. Und dies ist kein bloßer negativer Glücksfall, sondern die Griechen konnten keinen solchen Klerus haben, wohl aber haben sie eine Polis, welche den Künstler streng bei Verherrlichung des Allgemeingültigen festhält, so daß der Stil ein einheitlicher bleibt, ohne einförmig zu sein.
Es ist um so merkwürdiger, dieser Sache nachzugehen, weil die Griechen das Monströse ursprünglich auch besessen haben. Die homerischen Beinamen der Hera als der Kuhäugigen (boopis) und der Athene als der Eulenäugigen (glaykopis) weisen auf eine uralte Zeit, da die griechischen Götter, wie die ägyptischen, Tierköpfe hatten, und die dämonischen Wesen auf den sog. Inselsteinen zeigen noch die greulichsten Mischformen13; auch der Mythus enthielt Wüstes, wovon die Geburten der Pallas und des Dionysos Reste sind. Aber dieses alles wurde nach Möglichkeit zurückgedrängt. Schon Homer deutete wohl den Beinamen der Athene wie die Späteren14, die von einer blau schimmernden Farbe der Augen (glaykon ton ommaton) sprachen, und die schrecklichen Mischwesen müssen allmählich aus der Volksanschauung geschwunden sein bis auf wenige, wie die Figuren des Perseusmythus, welche man an den Rändern der Welt weiterlebend glaubte. Der Mythus selbst schaffte sie hie und da weg; so haben sich die Harpyien, Dämonen der scheußlichsten Art, bis zur Zeit der Argonauten behauptet; nun aber ist es hohe Zeit, daß die Boreaden mit ihnen aufräumen. Das Verdienst der Aöden wird es sein, daß das Bild der Götter und dämonischen Wesen, wie wir sie aus Homer kennen, schon völlig unverträglich mit den Fratzen jener Inselsteine ist und nicht gleichzeitig mit denselben in den Gedanken der Griechen existiert haben kann. So ist denn die einzige stehengebliebene Gottheit von gemischter Gestalt Pan, an dem noch im XIX. homerischen Hymnus sein Vater Hermes und die andern Götter ihre Seelenfreude haben müssen. Vielleicht war sein Phantasiebild bei starken Hirtenbevölkerungen dergestalt eingewurzelt, daß die große Operation, welche mit den gemischten Typen vorging, ihn nicht mehr zu berühren wagte. Was sonst noch gemischte Gestalt behielt, war wenigstens keine Gottheit mehr, sondern sank zur dämonischen Fabelfigur.
Die Ablösung vom Strengsymbolischen und Monströsen hatte nun aber auch die bildende Kunst zu vollziehen, und sie vollzog sie, so weit auch der Weg war, den z.B. die Gestalt des Eros vom rohen Stein (argos litos)15, dem ältesten Bild des Gottes zu Thespiä, bis zu dem Wunderwerke des Praxiteles zurückzulegen hatte. Solche rohe Steine können in den Heiligtümern lange die Gottheit dargestellt haben, auch als die allgemeine Bilderlust, die ja bei den Griechen früh und reichlich muß vorhanden gewesen sein, göttliche Gestalten mit darzustellen wagte; denn es ist nicht ohne weiteres zu erwarten, daß deshalb sofort auch das Kultbild, wenn auch nur als Xoanon, entstand. Vielmehr ist es denkbar, daß die Kunst sich noch lange Zeit, nachdem das Epos die Schönheit der Götter selbstverständlich gemacht hatte, nicht recht an dieses wagen wollte, mit anderen Worten, daß die rohen Steine aufgestellt wurden, als man sich bereits bewußt war, die Götter müßten eigentlich schön gebildet werden, und dies könne man nicht16.
Aber auch mit dem Monströsen hatte das Kultbild seinen Kampf noch zu bestehen. So wurde Hekate in einer älteren Zeit mit drei Köpfen und sechs Armen, ja mit Köpfen von Roß, Hund und Löwe dargestellt17. Aber schon das Xoanon des Myron auf Ägina gab ihr nur ein Gesicht und einen Leib, und Alkamenes18 bildete in seiner Hekate Epipyrgidia beim Tempel der Nike Apteros zu Athen das frühere Monstrum ins Schöne um, indem er es zuerst in jene drei sich enge berührenden Frauengestalten der Artemis, Selene und Persephone auflöste, von denen die Bronzegruppe des Museo Capitolino vermutlich ein Nachbild ist. Man möchte gerne wissen, auf wessen Rat und Recht hin er dies unternommen hat.
Wo Scheußliches sich hielt, mußte es den Griechen gewaltsam aufgezwungen werden. Als in der Höhle am Berg Elaïon das ältere Holzbild der pferdeköpfigen "schwarzen Demeter" verbrannt war, machten die Phigalier kein neues und unterließen auch die betreffenden Opfer und Feste, bis eine Generation nach den Perserkriegen über das Land Unfruchtbarkeit kam und Pythia sie anwies, die Opfer herzustellen und die Höhle mit göttlichen Ehren zu schmücken. Hierauf erneuerten sie den Kult eifrig und gewannen den Onatas, ihnen um jeden Preis wieder ein Bild zu machen. Er fand wohl eine Abbildung von dem alten Bilde oder eine Tradition darüber vor, das meiste aber soll er "nach Traumgesicht", d.h. ohne Zweifel mit irgendwelcher Milderung gegeben haben19.
Anderes Monströse blieb stehen, wenn keine Zerstörung darüber kam, wie z.B. das Xoanon des dreiäugigen Zeus im Tempel der Athene auf der Larissa zu Argos, welches den Zeus nach der Deutung des Pausanias20 als Herrscher in Himmel, Erde und Meer darstellte. Auch konnte das Verschönern auf Bedenklichkeiten stoßen. So verschönerte einst eine Priesterin im Tempel der Hilaeira und Phöbe zu Sparta an einem der beiden Bilder den Kopf, offenbar im Geschmacke der reifen Kunst21; das andere aber ebenso zu verschönern, verbot ihr ein Traum. Auch an dem gefesselten Ares und an der verhüllten und an den Füßen gefesselten Aphrodite Morpho22, mit denen die Treue des Kriegsglücks und der Frauen symbolisiert war, wird man in Sparta nichts haben ändern dürfen.
Noch manche herbe Symbolik, womit sich die frühere Kunst noch ohne die idealen Mittel, und hier noch dazu in kleiner Darstellung, behelfen mußte, war am Kypseloskasten23 angebracht: Geryones in Gestalt von drei aneinanderhängenden Männern; der Phobos auf Agamemnons Schild, eine wahrscheinlich menschliche Gestalt mit Löwenkopf; die Ker mit Zähnen wie ein wildes Tier und mit krallenförmigen Nägeln; ferner die Häßlichbildung der Allegorie des Bösen in Gestalt der Eris, endlich eine Allegorie mit einer Aktion: Dike als schönes Weib schleppt ein häßliches, die Ungerechtigkeit (Adikia), fort und würgt und schlägt es mit einem Stock24. Auch das üble Thema der aus dem Haupte des Zeus heraufkommenden Athene hat plastisch mehrmals existiert, und es gab ein solches Bildwerk auf der athenischen Akropolis25; aber Phidias am Giebel des Parthenon substituierte einen andern Moment. Und ähnlich überwand die Kunst das Schreckliche: Von dem Heiligtum der Semnen (Erinyen) in Athen sagt Pausanias (1, 28, 6) ausdrücklich: "Weder ihre Bilder haben etwas Furchtbares an sich noch die der übrigen unterirdischen Gottheiten: des Pluton, des Hermes und der Gäa"26. Über die Darstellung eines ästhetisch mißlichen Sachlichen half bisweilen die Leichtigkeit der Personifikation hinweg: schon das uralte Bild des Apollon zu Delos27 stellte den Gott mit dem Bogen in der Rechten dar, in der Linken aber nicht direkt drei Musikinstrumente, sondern die drei Chariten mit Lyra, Flöte und Syrinx.
In der Zeit nach Homer, aus unergründlichen Ursachen in Betreff des Wann? und Weshalb erst? erwachte die Lust an reicherer und großartigerer Verbildlichung der Götter und an der massenhaften Darstellung des Mythus; die Kunst erwachte wie aus einem gesunden Schlaf.
Die verschiedenen Techniken fand sie vor. Die großen alten Kulturstaaten hatten dieselben gewiß längst "erfunden", und ihre Übung kannte man schon von den Geräten her, so daß sie an sich schon früher keine Schwierigkeiten würden dargeboten haben. Da also diese äußere Vorbedingung für künstlerisches Schaffen vorhanden war, brauchten die Griechen nur die Augen zu öffnen und ihre Natur walten zu lassen, welche der Kunst nun auch die stärksten positiven Fördernisse bot.
Wir rechnen hierzu die notorische Schönheit der Rasse, von der im letzten Abschnitte dieses Werkes die Rede sein soll, und die bald und rasch zur Höhe gelangte agonistische Gymnastik, deren Betrachtung ihnen das anatomische Studium ersetzte, ferner die entschiedene Vereinfachung und Schönheit ihrer Tracht, welche dem Leibe folgt.
Zumal aber kommt hier endlich die große zentrale Eigenschaft dieser Nation, die sich nur umschreiben läßt, tatsächlich im höchsten Grade zum Vorschein: die Verbindung von Freiheit und Maßhalten, welche allein Lebendig-Ideales schaffen konnte, jener sofortige Respekt der Kunst nicht bloß vor Göttern und Menschen, sondern vor sich selber, das Festhalten und Steigern jedes Gewonnenen; es ist jene so vielgepriesene Sophrosyne, die sich in der besseren Zeit des Staatslebens als Gehorsam bei starker individueller Entwicklung darstellt, und die sich leider im Staate nur gar so häufig vermissen ließ. Hier aber liefert für sie besonders auch nachträglich den stärksten Lebensbeweis die lange Dauer der Kunsthöhe: es folgt nicht wie auf Rafael und Michelangelo ein sofortiger Manierismus mit mühsamen Herstellungen der Kunst durch Eklektiker und Naturalisten.
Ohne knechtische Vorschrift, durch freie Aneignung pflanzt sich die Kunst von einem Geschlechte zum andern fort. Schon im Mythus spiegelt sie sich – anders als im Orient – als eine Sache großer Individuen. Wir treffen hier zuerst Geschlechter: Kyklopen, Daktylen, Telchinen; dann vom Gott Hephästos an die Heroen der Kunst: Dädalos, Trophonios, Agamedes. Schon frühe tauchen weiterhin historische Künstlernamen mit Traditionen von Schülerschaft auf, und endlich finden sich berühmte, ganz freie, über viele Städte verteilte Künstler und ihre Schulen. So setzt sich die mythische Freiheit und Vielheit der Ursprünge fort; gerade aber, weil nicht ein Künstler und seine Schule die ganze Kunst nach sich zieht, ist die Kunst vor dem genial Hingeworfenen bewahrt. Das Subjektive darf sich nicht vordrängen; wir konstatieren bei den Griechen eine gänzliche Abwesenheit der Sensation, des Willkürlichen, des forciert Individuellen, des Geniestreichs. Auch auf die Kunst wurde der allgemeine griechische Begriff von der hohen Bedeutung der Erziehung (paideysis), gleichviel ob mit völligem Recht, angewandt28.
Man wird nun ewig fragen: Wie entstand diese reine Blüte menschlicher Bildung? Wie behauptete sich diese Freiheit im Gesetzlichen und diese Gesetzlichkeit im Freien?
Die anfängliche Beschränkung der Darstellung auf das Tempelbild oder Kultbild würde das Phänomen nicht erklären29; denn Andacht ohne Schönheitssinn schützt nicht vor dem Fratzenhaften und jedenfalls nicht vor dem Plumpen und Unschönen. Entscheidend wird eher sein, daß die Kunst sich zur Belebung ihrer Gestalten erst aufmachte, als die Poesie ihre Aufgabe schon vollbracht hatte. Die Sehnsucht nach dem lebendig Bewegten regte sich schon frühe; für sie zeugen die goldenen und silbernen Hunde des Hephästos vor dem Palaste des Alkinoos30 und der den Schild des Herakles umschwebende Perseus bei Hesiod31. Aber die Gestalten der Götter waren im poetischen und populären Bewußtsein schon zur höchsten Phantasieschönheit durchgebildet, ehe die Kunst an ihre Arbeit ging32. Das Stammeln blieb ihr in dieser Beziehung gänzlich erspart. Und nun gab diese Poesie zugleich auch das Beispiel einer hohen Gesetzmäßigkeit, eines Stils. Der Betrieb des Epos allein schon, wie er vor und seit Homer sich darstellte, war eine Schule für die Kunst: schon hier konnte sie lernen, daß man nicht von einer Gattungsform abzugehen habe, bevor derselben alles mögliche Leben abgewonnen sei. Und schon existierte die ältere Chorlyrik und lehrte ebendasselbe.
Theologie und Priestertum haben nichts zur Kunst zu sagen gehabt, deshalb, weil sie (im Sinne der orientalischen Nationen) nicht vorhanden waren. Was aber der Tempel resp. die Polis wesentlich zum Gedeihen der Kunst beitrug, war der monumentale Wille. Es waren höchste Aufgaben richtig gestellt, das Materielle ernst und kostbar, der Aufwand für Zeit und Ort groß, soweit wir überhaupt schließen können.
Die hieratische Einwirkung beschränkte sich offenbar darauf, daß erstens jeder Tempel nichts Geringeres, Unbelebteres haben wollte als der andere und somit ein Wetteifer bestand, durch den eine rasche Ausgleichung innerhalb der einzelnen Gegenden der griechischen Nationalität bewirkt wurde, – daß aber ferner auch jeder Tempel an demjenigen Grade ernster Göttlichkeit seiner Bildwerke festhalten wollte, der anderswo erreicht war, wodurch doch ein heilsames Retardieren in die Kunstentwicklung kam. War dann die Gottheit in irgendeiner Auffassung mit Eifer und Glanz verehrt worden, so ging man gewiß nicht gerne zu rasch davon ab. Auch hier also geschah die Entwicklung im Sinne der Sophrosyne. Aber von einer Knechtschaft unter einem Tempelstil, wie bei den orientalischen Völkern, die einer völlig vorschriftlichen Kunst anheimgefallen waren, war, wie gesagt, gewiß keine Rede, wenigstens seitdem die Kunst das Xoanon verlassen hatte.
Gewiß aber hat bei den Griechen die Kunst schon sehr frühe unabhängig von den Forderungen der Religion und der Prachtliebe der Mächtigen um des bloßen Gefallens willen geschaffen. Sie entsprach dem enormen quantitativen Kunstbedürfnis der Nation, dem Verbildlichungsbedürfnis, das wir von den frühesten erhaltenen Vasen bis auf die anathematischen Gruppen der Blüte und Nachblüte verfolgen und bis zum pergamenischen Fries, wo die Skulptur eigentlich die Architektur völlig überwältigt.
Und nun können wir noch eine allerstärkste äußerliche Triebkraft benennen: es ist dies die Anwendung des Wettkampfes (Agon) auf die Kunst. Dieser äußert sich als Wetteifer der Aristokratien, Tyrannien, reichen Kolonien, das Schönste oder Prachtvollste bei sich daheim zu besitzen; als Wetteifer der Staaten und einzelnen, an die panhellenischen Weihestätten womöglich das Herrlichste zu stiften; als Agon von Tempel gegen Tempel, wovon soeben die Rede war, und in den wahrhaft agonalen Arbeiten der Künstler nebeneinander, wenn auch nicht (wie z.B. im Drama geschah) in Konkurrenz33 und ohne daß dabei eine Überhetzung, ein Treibjagen auf lauter neue Auffassung stattgehabt hätte. Und dazu kommt noch als eine Hauptsache, daß die Kunst schon von Anbeginn das Gymnastisch-Agonale, von dem so vieles zu lernen war, in vollem Schwunge antraf, es studieren und von da aus Götter und Menschen darstellen konnte.
Allein der gewaltige innere Bildtrieb, der allen Geist in Formen auszudrücken gezwungen ist und der die griechische Kunst beseelt vom Chryselephantinbild bis zur kleinsten Tonfigurine und Antefixe, bleibt uns hier wie für alle großen Kunstzeiten ein Mysterium. Er trat auf, als das Epos ungefähr sein Tagewerk getan hatte.
1. Die Skulptur
Für die Skulptur stellt sich vor allem als Fördernis im Vergleich mit den Heiligtümern anderer Nationen und Religionen der griechische Tempel in seiner Eigenschaft als Haus und Träger der Bilderwelt ein34. Das schönste denkbare Zusammenwirken von Architektur und Skulptur zeigen die Giebelgruppen. Gern wüßten wir, wie lange am Tempelgiebel Malerei und Relief mit der Freiskulptur konkurriert haben. Als diese siegreich war und als erlauchtes Thema den Hauptmythus des betreffenden Heiligtums darstellen durfte, da schuf sie im Ägineten-, im Parthenongiebel usw. jene Wunderwerke der Komposition und der Lichtwirkung, in denen sie die beiden Hälften in schön aufgehobener Symmetrie sich das Gleichgewicht halten und, unter sich gleichwertig, nach einem herrschenden Mittelpunkt ansteigen ließ. Und dazu kamen, als Teile der Tempelarchitektur, noch der äußere und der innere Fries, die der Grieche nach ihrem plastischen Bilderschmuck Figurenträger (zoporoi) nannte, es kamen dazu die Metopen und die Akroterien, die, wenn bei den Griechen auch noch maßvoll gehalten, doch mit Palmetten, Greifen und andern Göttertieren, Niken oder Moiren ausgestattet sind.
Die Vorhalle und die übrigen Hallen waren mit Anathemen im weitesten Sinne oft ganz angefüllt, von der Freigruppe bis zur bloßen erbeuteten Waffe, besonders dem Schilde. Hier standen Statuen der Tempelgottheit selbst, ihrer Nebengottheiten, ihrer Priester und Priesterinnen, auch der Stifter und der Heroen des Ortes, außerdem aber auch Throne, Klinen, Leuchter, Tische, Dreifüße, Altäre, Urkundenstelen und Andenken aller Art.
Auch im Innern, dem durch eine Dachöffnung wird haben Licht zugeführt werden können, da die Öffnung der Tempelpforten für die Beleuchtung nicht würde genügt haben, befand sich eine Menge von Anathemen. Es waren Statuen der mitwohnenden Götter (teoi synnaoi), bisweilen der ganzen mythischen oder allegorischen Verwandtschaft der Tempelgottheit, die gemeinsam oder allmählich hingestiftet waren, besonders aber solche dieser Tempelgottheit selbst aus verschiedenen Zeiten, vom Xoanon abwärts, und unter ihren verschiedenen Beinamen (epiklhseis)35, wodurch die Kunst den Vorteil hatte, eine und dieselbe Göttergestalt in verschiedenen Auffassungen darstellen zu können; auch Bildnisstatuen fehlten nicht. Die Hauptsache aber war das Tempelbild, das sich auf einem gleichfalls oft reich geschmückten Piedestal (batron), meist frei umgehbar und nur selten an die Tempelwand angelehnt, erhob. Diese freie und isolierte Aufstellung des Hauptbildes, das man weder durch eine Nische mit der Architektur des Tempel in Verbindung brachte, noch als Relief aus derselben hervortreten ließ, ist für die Entwicklung der griechischen Kunst von hohem Wert. Mit ihr gehörte die Hauptaufgabe der Freiskulptur. Man halte damit zusammen, wie die ägyptische Skulptur wesentlich am Bau klebt; selbst wo die Statuen getrennt von Wänden und Pfeilern sitzen, fühlt man doch, daß sie noch dazu gehören, und ohnehin ist ihre Stellung noch so, daß sie wie Bauteile wirken. Auch die christliche Freiskulptur hat sich mühsam vom Altarschrein und von den Bauteilen (Portalen usw.) losarbeiten müssen. Bei den Griechen dagegen ist die Verbindung der Skulptur mit dem Bau, auch wo sie vorkommt, eine gutwillige. Mehrmals ist das Kultbild von zwei begleitenden Gottheiten umgeben – besonders Praxiteles liebte die Trinitäten, – so daß Demeter mit Kore und Iakchos, Apoll mit Artemis und Leto, Zeus mit Hera und Athene, Athene mit Asklepios und Hygieia dargestellt war36 – zu geschweigen der in kleinem Maßstab beigegebenen Figuren des Bildhauers, der Tempeldienerinnen, siegreicher Feldherren usw. zu Füßen des Hauptbildes, was alles natürlich je nach Größe und Stoff des Bildes sehr verschieden war.
In der Umgebung des Tempels standen im Freien der oft sehr reich mit Reliefs geschmückte Brandopferaltar und die übrigen Altäre, und überhaupt war der ganze Tempelhof (peribolos) mit seinen Propyläen, Stoen, Nebengebäuden, Nebentempeln verwandter Gottheiten und der Tempelgottheit mit speziellen Beinamen37 eine Stätte für weitere Kunstwerke aller Art. Hier waren Gemäldehallen, sog. Leschen – auch in den Tempeln befanden sich übrigens hingestiftete Tafelbilder –, mythische Gräber, Statuen – selbst reihen-und alleenweise – von Göttern, Heroen, Helden, Staatsmännern, berühmten Frauen, Wettsiegern, auch Tierbilder und Gruppen auf Lang- oder Halbkreispiedestal, dies alles im Maßstab gleichfalls sehr verschieden, und dann etwa noch ein Koloß der Tempelgottheit, wie die Promachos der athenischen Akropolis, – und dazwischen sah man heilige Pflanzen, Quellen und Tempeltiere, die sich frei ergingen.
Verließ man das große Heiligtum, um in die Stadt hinunterzugehen, so fand man auch hier überall kleinere Tempel (oikhmata, sacella) und geschlossene Bezirke (temenh) von Heroen; die Hauptstätte der Skulptur und Malerei aber war die Agora mit den sie rings umgebenden oder in ihrer Nähe befindlichen Stoen, welche oft wieder der Zugang zu Tempeln und anderen öffentlichen Gebäuden waren. Voll von Skulpturen waren auch Theater, Stadien und Gymnasien, und vor der Stadt kamen die Gräberstraßen mit ihren Monumenten vom Cippus (sthlh) an mit der Palmette, welche gleichsam die Bekränzung des Grabes mit Blumen monumental verewigte, bis zum reichen Grabrelief und zum zierlichen Sacellum. Götterbilder befanden sich in den Quellenheiligtümern und Grotten, und heilige Haine mit einem Tempel als Zentrum waren oft reich mit Statuen angefüllt38; von dem Reichtum an Skulpturen vollends, der an den großen Agonalstätten mit ihren Athletenstatuen, Tethrippen, Siegergruppen usw. vorhanden war, machen wir uns kaum einen Begriff. Es war "ein zweites Volk" in Erz und Marmor da39, und es ist, als hätte diese Kunst unendlich vieles hervorbringen müssen, damit noch beim Anblick der Reste die Nachwelt über den Reichtum der Nation und über den ernsten monumentalen Willen staune, den sie mit diesem Aufwande verband.
Für das Phänomen nun, daß in dieser Kunst der ideale Stil verhältnismäßig leicht die Oberhand gewann, wollen wir zwar nicht die innersten Gründe definieren, einige äußere Fördernisse aber sind hier zu betrachten. Vor allem war sie eine religiöse und somit, wie jede religiöse Kunst, auch z.B. die ägyptische, eine dem vollen Realismus abgewandte, mindestens auf das Konstante angewiesene. Ihre nächste Aufgabe war die Götterbildung. Diese war sehr früh möglich, insofern sie in der Phantasie des Volkes schon vorhanden war. Am frühsten ist sie vielleicht in den Inselsteinen und ähnlichen Gebilden jener ältesten Kunst nachweisbar, wo die einzelnen göttlichen Wesen noch mit Tierteilen auftreten; aber auch sonst war das Bedürfnis nach Verbildlichung der Götter gewiß früh allgemein, und dazu war der Drang nach ihrer Vergegenwärtigung vorhanden, welche zugleich eine Huldigung an sie war. Ihren allerersten Ausgang aber mag die Übung der Götterbildung in uralter Zeit beim häuslichen Herde genommen haben. Hier hatte man zuerst die Toten begraben und verehrt und daneben vielleicht von Anfang an die Herdflamme (estia); als Konsequenz des Polytheismus mochten sich dann allmählich, je nach dem Bedürfnis der Anrufung und der Erinnerung an geleistete Hilfe, auch als Erbschaft von Verwandten, eine Anzahl kleiner Götterfiguren an dieser Stelle zusammenfinden. Außerdem aber war auch das Grab ein Ort, wohin Götterfigurinen – allerdings neben Genrefiguren, Tierbildnissen usw. – gestiftet wurden.
Freilich ist es nun sehr merkwürdig, daß der griechische Mythus, wenn wir vom Palladion, den dädalischen und wenigen andern Götterbildungen absehen, von dem vielen vorhandenen Bildwerk gar keinen Gebrauch macht, so wie auch vom Tempel, als deutlichem baulichen Lokal nicht oft die Rede ist. Homer in dem vermutlich doch schon bilderreichen IX. Jahrhundert spricht von keinem Bild; die Götter selber erscheinen bei ihm noch. Aber unabhängig von allem Mythus scheint die Sitte des Bilderstiftens im Volke bestanden zu haben, und nun ist wichtig und entscheidend, daß das Anathem seiner Natur nach auf beständige Wiederholung der Bilder einer und derselben Gottheit hindrängte, von der man Hilfe wünschte oder genoß, und dies vom kleinsten Tierbildchen des Armen an bis zu den Stiftungen reicher Poleis. Indem sich nun in den Tempeln und ringsum durch beständiges Hinstiften eine Masse von Bildern der betreffenden Tempelgottheit aufsammelte40, mußte sich notwendig eine Verschönerung und Veredelung des Typus derselben ergeben. Bei dem in allen griechischen Dingen wirksamen Agon war auch hier der Wettstreit eine gegebene Sache, zumal unter den frühen und mächtigen Tyrannien; auch das vielleicht rasche Steigen des Maßstabes bis ins Kolossale und daneben die naive Vorliebe für kostbare Stoffe wird uns bei den großen und reichen Stiftungen nicht wundern dürfen.
Für die Entwicklung der Idealformen aber war es weiterhin entscheidend, daß das Banner nicht die Malerei, sondern die Skulptur führte, welche genötigt ist, alles innerhalb der einen menschlichen Gestalt abzuschließen und sich fast rein auf die Form zu beschränken. Der einzige und natürliche Ausdruck des Geistes ist hier der menschliche Leib, und nun bewähren denn auch die Griechen ein rastloses und endlos reiches Bemühen, alles Geistige: Götter, Menschen, abstrakte Eigenschaften, Örtlichkeiten, Naturereignisse usw., in tausend menschlichen Bildungen darzustellen.
Nicht in der Skulptur allein freilich, sondern in jeder Gattung und von jeher41 mußte die Darstellung, damit das Geistige als solches spreche, vom bloß Zufälligen, von der gemeinen Wirklichkeit, welche jenes Leben nur verhüllt, individuell gebrochen zur Erscheinung bringt, absehen und die hundert Nebensachen, welche es überwuchern, weglassen. Die Skulptur aber insbesondere ist als solche zu weit größerer Vereinfachung der Form genötigt als die Malerei. In dieser ist die Illusion erlaubt, ja sie kann ein hohes Wirkungsmittel sein, in der Skulptur dagegen niemals. Hier macht sich vielmehr alle genaue und peinliche Verfolgung des körperlichen Details, z.B. etwa eine völlig naturalistische Bemalung, störend und widrig, und in diesem Sinne ist die Skulptur die wesentlich idealistische Kunst, während die Malerei durch Licht und Hintergrund und Fülle der Beziehungen eine ganz andere Gesamtrechnung hat; Rembrandt kann bei durchgehender Häßlichkeit der Formen einen idealen Gesamteindruck machen.
Bei all diesem Streben nach Abstreifung des Nebensächlichen wäre nun doch unter andern Umständen vielleicht nur eine ziemlich tote Verallgemeinerung der Form erreicht worden; allein hiervor wurden die Griechen durch andere Faktoren geschützt. Vor allem muß der Wunsch, sich die Götter zu vergegenwärtigen, ganz anderer Art gewesen sein als in dem knechtischen Orient, und zwar vor allem viel freier von allem Müssen. Besonders stark wirkte hier der Umstand, daß die Poesie schon vorher so mächtig auf die Herrlichkeit der Erscheinung der Götter hingewiesen hatte; auch wären diese, wie die Aöden sie schauten, schon bei weitem vielartiger gewesen als die orientalischen, selbst wenn sie nicht schöner gewesen wären, und in ihrem Gefolge kamen noch alle halbgöttlichen Wesen, die Allegorien, die dienenden Gottheiten (teoi propoloi) und alle Gestalten der heroischen Welt. Man mochte es vielleicht einmal kaum mehr erwarten können; eine unendlich reiche und herrliche Welt drängte sich hier ins Dasein.
Da man ferner vom Wüst-Symbolischen frei und rein auf die Menschengestalt angewiesen war, konnte man von Anfang an fest auf die Natur bauen und tat es auch, wie gerade die frühesten erhaltenen Reste durch ihren anatomischen Naturalismus lehren. Die Götter sind ideale Menschen42. Von höchster Bedeutung war es hier für die Kunst, daß sich die Ausbildung der Göttertypen in ihr erst vollzog, nachdem sich in der religiösen und poetischen Anschauung die ganze Einzelbedeutung der Götter längst zu Individualitäten ausgeglichen hatte und die frühere Naturbedeutung und sonstige ursprüngliche Bedeutung bis auf einen leisen Nachklang verschwunden war. Die Kunst konnte hier völlig frei schaffen und beschränkte und vereinfachte Trachten und Attribute immer mehr, ließ aber dafür den Charakter walten. Hier ist der Leib alles; was dagegen z.B. die Ägis der Pallas eigentlich ist, das begehrt die Skulptur kaum selber zu wissen, geschweige uns zu sagen.
Außer in der Einzelform aber suchte man die Wahrheit noch anderswo, nämlich in der Lebendigkeit in Haltung und Gebärde, und auch in dieser war man nicht durch heilige, traditionelle Gesten gehemmt, wie die Künstler des Orients. Diese mit allen Mitteln erstrebte Lebensfähigkeit geht der Idealität voraus, als gründlicher Bruch mit dem Konventionellen. Zuerst äußert sie sich in der Bewegung der Arme und Füße, welche früh anders als bei den Orientalen ist, und hier wird das entscheidende Faktum nicht sowohl die Darstellung des Geschehenden durch einen Erzähler sein – denn diesen Vorteil hätten die Orientalen auch haben können –, sondern das frühe Athletenbilden. Bei diesem war man auf die Form, weil und wie sie lebendig ist, angewiesen, und diese Übung – ein Unikum in der ganzen alten Welt – muß der Starrheit auch der alten Göttertypen ein Ende gemacht haben43.
Höchst bezeichnend ist hier, daß der Kopf am längsten konventionell und, nach unsern Begriffen, unschön und unlieblich bleibt44. Während schon die ganze Gestalt der höchsten Vollendung und in ihrer Vielheit dem größten Reichtum und der schönsten Komposition nahe ist, behauptet sich in ihm noch ein gutes Stück Typus und dabei das starre Lächeln, welches bei den Vorgängern offenbar als Andeutung des Lebens als solchen passiert hatte.
Zu der oben erwähnten Beschränkung der Attribute und Trachten gehört auch die Zurückdeutung der Götter in ein jugendliches Alter, die schon früher und in sehr bezeichnender Weise versucht wurde. So sah Pausanias45 schon von Ageladas (um 500 v. Chr.) einen ehernen Zeus als Knaben und einen ebenfalls noch bartlosen Herakles, und Herklisken als Anatheme in Olympia gab es offenbar schon aus guter Zeit46.
Hervorzuheben ist auch, daß das Nebeneinander einer Menge von Statuen einer und derselben Gottheit47, das wir oben (S. 16 f.) als so wichtig für die Veredelung der Götterbildungen erkannt haben, bei den Griechen nicht etwa wie bei den Ägyptern zur Identität führte48, sondern dazu, daß dieselbe Gottheit entsprechend den verschiedenen Stiftungen in verschiedener Größe, verschiedenem Stoffe und einer ganzen Fülle von Stellungen, Gebärden, Bekleidungen, Altersstufen vorhanden war. Zu Typen wurden eine Anzahl dieser Gedanken erst in der Folge, indem sie vorzugsweise nachgeahmt und durch die Römer uns überliefert wurden. Und darunter herrschten nicht notwendig die schönsten vor, sondern diejenigen, welche in Marmor am ehesten zu erreichen waren49. Von der so viel freieren Komposition in Erz, Gold-Elfenbein, Akrolith haben wir bei weitem unbestimmtere Kunde, und Kopien höchstens in kleiner Bronze und auf Münzen.
Die wichtigste positive Quelle des Idealen aber bleibt es, daß man, um das Geistige als solches vollkommen geben zu können, die sinnliche Erscheinung mit größter Begeisterung als eine lebendige erfaßte und studierte. Die genaueste Ergründung der Körperformen verbindet sich mit einem immer sichereren Bewußtsein von dem, was die Schönheit des Anblickes ruhender und bewegter Gestalten ausmachen kann; man wurde aller Elemente des äußern Lebens mächtig, um das geistige Leben ganz frei geben zu können. Dahin gehört es, daß man das Schöne aus vielen einzelnen Individuen zusammensuchte50. Aber aus dem bloßen Durchschnitt oder Kanon wäre es noch nicht erwachsen, wenn nicht zu alledem das absolut Exzeptionelle hinzugekommen wäre: jener mächtige innere Zug zum Schönen, der uns ewig ein Mysterium bleiben wird.
Fördernd für die Annahme der idealen Kunst durch das Volk mag mittelbar die allgemeine Erhebung der Nation im V. Jahrhundert und hie und da auch das Pathos beim Ersatz für die im Perserkrieg untergegangenen Götterbilder mitgewirkt haben. Die Religion tat jedenfalls das wenigste dabei; der Zeus des Phidias und die andern großen Gebilde sind schon in einer relativ ungläubigen Zeit entstanden, als Anaxagoras lehrte. Die Hauptsache aber war, daß die damaligen großen Meister eine Überzeugung für ihre Neugestaltung der Götterwelt zu erregen, den Willen von Bevölkerungen dafür zu erwecken vermochten. Dies kann einem Phidias und Polyklet nur durch das Vorweisen von Modellen und von fertigen Arbeiten gelungen sein, die man mit den von der Perserverwüstung verschont gebliebenen Werken der älteren Kunst, welche dem bisherigen Bewußtsein genügt hatten, einer gewiß stattlichen Hera in Argos und einem Zeusbilde in Olympia usw. vergleichen konnte. Man konnte diese ältern Bilder nun offenbar nicht mehr schön finden, und nachdem man bisher das Kolossale gehabt, erkannte man jetzt das Große.
Dazu gehörte aber noch eine Nation, die sich nicht auf Altgeheiligtes kaprizierte, vielmehr das neugeborene Schöne nicht nur anzuerkennen, sondern tatsächlich anzunehmen imstande war.
Und diese Nation durfte es nun auch mit Staunen erleben, wie ihre Künstler immer höhere Kräfte entwickelten in der Verwirklichung der Götter, und wie die Götter immer schöner wurden. Und mit und durch die Griechen erlebten es seither alle andern Kulturvölker; die Griechengötter sind hinfort schön für alles darzustellende Göttliche und Erhabene aller Religionen, und die griechischen Götterideale sind daher ein welthistorisches Faktum.
Und nun bildete sich nicht ein ägyptisches System, sondern ein freier Usus von gewissen Formen, die uns als griechische Idealformen erscheinen, und wir stehen vor der bedeutenden Tatsache, daß bei völliger kirchlicher Freiheit ein Konsensus in Sachen des Idealen möglich war, nicht als religiöse Schranke, sondern positiv als Wille nach einem bestimmten Schönen.
Diese Idealformen aber sind nicht sowohl die allgemein wahren oder häufigen, als die allgemein ausdrucksfähigen für das geistige und sinnliche Leben, und deshalb sind sie, obwohl unter sich unendlich verschieden, die allgemein schönen.
Von einer Reihe feiner und ausgedehnter physiognomischer Beobachtungen und einer daraus abgeleiteten systematischen Lehre mit praktischem Zwecke, welche hier mitwirkten, gibt uns Aristoteles51 in den Physiognomika einen Begriff. In dieser Schrift wird alles: das Dauernde wie das Augenblickliche, Charakter und Leidenschaft, mit herbeigezogen, und Formen wie Farben, der Konsistenzgrad (die Weiche und Härte) der Haare wie des Fleisches gedeutet, unter beständigem Blick auf die bekannteren Tiergattungen, wo der Charakter, über den man im reinen zu sein glaubte, konstant ist, und das Individuelle nicht in Betracht kommt52. Kopf und Gesicht werden ganz besonders genau behandelt; für das geringste Überschreiten der normalen Form, das geringste Zuviel oder Zuwenig, wird sogleich ein Tier namhaft gemacht. Man lernt da eine Zeit und ein Volk kennen, welche ihrem Ursprunge noch näher waren, als wir jetzt sind. Zweitausend Jahre eines mehr oder weniger zivilisierten Lebens, große Mischungen der Völker und andere Ursachen mehr haben es mit sich gebracht, daß Knochenbau, Hautfarbe, Haarwuchs und Fleischkonstitution in ihrer verschiedenen Ausbildung mit dem Charakter des Individuums gar nichts mehr zu tun haben; die Physiognomik hat sich auf ein viel engeres Gebiet zurückgezogen, und auch hier wird zuletzt ein unwillkürlicher erster Eindruck mehr bedeuten als irgendeine systematische Betrachtung. Aristoteles aber konnte noch das ganze Äußere als Ausdruck des Innern in Anspruch nehmen.53
So ergibt sich beispielsweise die Behandlung des Gesichts aus dem Zusammenwirken von plastischen Notwendigkeiten, resp. Wünschbarkeiten mit dieser physiognomischen Überzeugung, während es zweifelhaft bleiben mag, wieweit dieses Gesicht wirklich in der Natur vorkam. Vor allem ist die Maske, im Verhältnis zum Ganzen betrachtet, größer als in unserm Typus. Klarheit, Ruhe, Leidenschaftslosigkeit, Intelligenz und Wille sprechen schon aus dem weiten Hervorragen der runden Stirn und des NasenrückensA1 (ris eyteia, tetragonos), der mit ihr in gerader Linie zusammen Ein Stück und Eine Lichtmasse bildet, über den Rest des Gesichtes54. Die Stirn55 mit ihrem scharfen unteren Superziliarbogen ist relativ niedrig; eine hohe Stirn würde bei der ohnehin großen Maske eine ganz andere Schädelform, besonders ein größeres Okziput nach sich ziehen, und die Griechen verschmähten die mandelförmigen Köpfe, die von der Stirnspitze bis zum Okziput gehen, wie sie Canova hat. Das Profil des Gesichtes gehört mit dem Profil des ganzen Kopfes in einer ganz anderen Weise zusammen als in unserm Typus. Die Augen sind tiefliegend und weit vortretend, besonders der innere Augenwinkel liegt tief; der Bulbus ist so gewölbt, daß er auch im Profil stark wirkt; das obere Augenlid scharf umrissen; Augapfel und Augstern waren in der älteren Kunst farbig, später wurde der Schatten eher plastisch hervorgebracht, und für den Ausdruck des Schmachtenden (ygron) diente noch eine spezielle Bildung der Augenlider. Auch der Mund ist tiefwinklig und für die Profilansicht weit vortretend, seine Öffnung sanft, die Oberlippe kurz (xeilh lepta), die Lippenbildung im Ganzen zeigt bei den Göttern starke Verschiedenheiten. Das Kinn ist rund und großartig, selten mit einem Grübchen versehen, das Ohr ist schön und fein.
Das Haar zeigt die verschiedensten Formen, von der alten assyrisierenden Art an bis zur höchsten Freiheit und Vielgestaltigkeit und der wunderbarsten Wirkung. Kraus ist es bei den Epheben, struppig bei unedleren Satyrn und Barbaren, freiwallend und aufs schönste gesammelt zeigen es die Aphroditen von der knidischen an, herabwallend hat es Hera, oft ist es feingewellt, oft in einen Krobylos zusammengefaßt, wie bei Eros, Apollon, der kapitolinischen Venus, in besonders reicher Fülle haben es Zeus und die Wassergötter; Diademe und Kränze von Blättern, Blumen, Trauben usw. schmücken es oft aufs zierlichste. Auch der Bart zeigt die ganze Entwicklung von der assyrisierenden Regelmäßigkeit an bis zur freien Großartigkeit des Zeusbartes. Weder gepflegtes noch ungepflegtes Haar nimmt sich in der Wirklichkeit je so aus. Überhaupt gehen die Alten mit den Formen sehr frei um, ohne daß doch deren höchster Lebensfähigkeit der geringste Eintrag geschieht.
Dasselbe läßt sich vom Leibe sagen, für den die verschiedenen Epochen ihren verschiedenen Kanon vom Derben bis ins Schlanke gehabt haben: alle Formen werden mit ähnlicher idealer Freiheit gehandhabt wie die des Kopfes und sind dabei doch völlig lebendig und von völliger Wahrheit.
Scheinbar spielend leicht ist die Abstufung von den Göttern zu den Satyrn und von diesen zu den Athleten durchgeführt. Von den Athleten wird später die Rede sein; mit der Satyrnwelt aber bildete sich eine Schönheit und Idealität zweiter Klasse aus, eine Welt des sinnlich Heitern, bis ins Mänadische, und dazu kam gleich auch ihr Gegenstück, die mehr ins Düstere gehende Welt der Seewesen. Und dies geschah erst im IV. Jahrhundert, als mit Skopas und Praxiteles die große Schlußredaktion der göttlichen Gestalten erfolgte. Die Kunst hatte allmählich eine völlige Untrüglichkeit in der Ausbildung von leiblichen Typen gewonnen.
Hier möge auch der Freiheit in der Darstellung der Personifikationen, der sog. Allegorien56 gedacht sein, mit der z.B. ein Skopas die Gruppe des Eros, Pothos und Himeros bildete. Noch weiter aber ging die künstlerische Freiheit in der Formenmischung: es entstanden die geflügelten Wesen (Eros, Nike usw.), die hier unendlich viel schöner sind als bei den Asiaten, ferner die Kentauren, Pane, Tritone, Greife. Diese Wesen stehen vollkommen lebensberechtigt vor uns; mit so harmloser Schönheit und Unbefangenheit setzen die menschlichen und die tierischen Formen aneinander an. Und eine andere, noch viel vollendetere Mischung, nämlich die völlige Verschmelzung von zwei Charakteren in eins zeigen die Amazonenstatuen, in denen die Aufgabe, männliche Kraft im weiblichen Leib darzustellen, aufs wunderbarste gelöst ist.
Dazu beachte man den Ausdruck des Momentanen in den Zügen des Kopfes, in Stellung und Bewegung der ganzen Gestalt – oft nur leise sprechend und dabei doch von höchster Wahrheit und Schönheit; man merke auch auf den Schimmer von Trauer in den schönsten Götterköpfen (denn die Götter sind ewig, aber doch nicht Herrn des Schicksals): Nie hat man das Gefühl der Motivjagd, des Präsentierens von Attituden um ihrer optischen Wohlgefälligkeit willen. Diese Gestalten sind um den Beschauer im höchsten Grade unbekümmert; abgesehen vom eigentlichen Kultbilde glauben sie sich alle ungesehen und unbelauscht. Wie bei der höchsten Kunst doch eine völlige Naivität bestehen kann, lehrt ein Blick auf die Giebelstatuen des Parthenon.
Die Gewandung ist "das tausendfache Echo der Gestalt" (Goethe)57. Frühe wurde auf alle Stoffpracht im Sinne der assyrischen Kunst verzichtet58; man hat es mit den vereinfachten Stücken der ohnehin einfachen männlichen oder weiblichen Tracht zu tun59, die äußerst frei nach dem Bedürfnis der schönen Erscheinung und der Verdeutlichung der Bewegung gestaltet wird, so daß oft der Gang des Gewandes bis in seine Enden gar nicht nachzurechnen ist. Der verschiedene Stoff ist oft vom Schwersten bis ins Feine vollkommen und doch ohne Raffinement in der Behandlung des Materials ausgedrückt, bei einzelnem aber (z.B. den Gewändern der Amazonen oder der parthenonischen Frauen) läßt sich, so gut wie von einer Idealität des Ganges und der Komposition, auch von einer besonderen Idealität des Stoffes sprechen, der so im Handel nie und nirgends zu haben gewesen wäre und aus einer höheren Ordnung der Dinge zu stammen scheint. An dem Gewande ist wenig Schneiderarbeit, nichts Genähtes oder Geknöpftes; es sind quadratische oder runde (oder in Form von Libellenflügeln gefertigte?) Tuchstücke, welche erst zum Gewande werden, wenn man sie anzieht. Dasselbe ist etwas Getragenes, das den Leib nicht parodiert, kein Futteral für ihn, wie die Röhren und Säcke, in welchen wir gehen; vielmehr drückt es in den aufliegenden glatten Teilen wie in den tiefen Schatten rein nur die Gestalt und ihre Bewegungen aus. Wie es heißt, wurde seine Dicke gar nicht gerechnet; man nahm an den glatten Stellen den Kontur des Leibes selbst; es erscheint deshalb gleich schwer, aber die Form des Leibes bleibt.
Ganz besonders ist an die Fülle von weiblichen Gewandstatuen zu erinnern, mögen es Tempelbilder von Göttinnen oder Darstellungen von Musen, von Priesterinnen usw. sein. Hier entfaltet sich ein Übereinander und in der schönen Folge der Gewänder, in dem bisweilen vorkommenden Durchscheinen des untern durch das obere, in der Halbverschleierung des Hauptes durch ein übergezogenes Gewand, in der manchmal doppelten Gürtung und in der Emporfassung des zu langen Chitons zum faltenreichen Kolpos ein wahrhaft wunderbarer Reichtum der herrlichsten Motive.
Die Bewaffnung der Götter ist oft, z.B. beim Ares-Achill des Louvre, auf den bloßen Helm beschränkt. Die Kunst stellt das Unorganische nicht gerne dar und rechnet darauf, auch mit einer bloßen Andeutung verstanden zu werden.
Vor allem aber durfte diese Kunst es sich zutrauen, das Nackte zur Herrschaft zu bringen. Aphrodite hatte in der früheren Dichtung ihren Gürtel und ihre von Chariten und Horen gefertigten Gewänder, welche in allen Frühlingsblumen gefärbt waren60 – jetzt verließ sich die Kunst auf die reine Gestalt allein. – Auch das frühere prachtbeladene Stirndiadem (stepanh) bleibt nun weg.
Bei aller Freiheit aber bewahrt die Kunst die größte Zurückhaltung gegenüber aller phantastischen Willkür. Diese bleibt völlig abwesend, und kein einziger Ausfall in das Genial-Wüste findet statt. Nachdem jene Schlußredaktion der Göttertypen im IV. Jahrhundert geschehen war, wurde das einmal errungene Treffliche in den Motiven und Typen wiederholt und festgehalten, nicht nur weil es höchst vorzüglich war, sondern weil man kaum mehr anders konnte. Die Kunst verzichtet auf materielles Neuschaffen, empfindet aber dafür das Vorhandene stets neu und hierin wird die Genialität erkannt, und auch hier ist für die Griechen, wie bei der Übereinstimmung in den Formen (vgl. S. 21 f.), der freiwillige Consensus bezeichnend; Ähnliches werden wir auch bei den Formen der Poesie kennenlernen.
Neben der Darstellung des Idealen entwickelt sich nun auch die des Individuellen. Auch diese war im Orient längst bekannt. Wie unendlich vieles Porträtmäßige findet sich nicht als kaum vortretendes Relief aus den Wänden von Ninive und Persepolis herausgemeißelt! Und dann haben wir die ägyptische Kunst mit ihren teils freien, teils angelehnten sitzenden und stehenden Königsbildern, ihren Grabstelen mit fast freier Rundskulptur und Werken, wie der ägyptische Schreiber im Louvre. Hier sucht und erreicht die Kunst oft das Scharfindividuelle61. Aber die ägyptischen Könige sind nur Könige, nicht Krieger, Redner usw., ihnen genügt eine ruhige, götterähnliche Stellung und Bildung, und die Privatleute oder etwa auch Beamten eines gewissen Ranges62 werden dargestellt, weil sie wohlhabend oder amtlich respektiert genug gewesen und hernach gestorben sind. Nirgends aber auf der Welt ist die Darstellung des Individuellen so entstanden wie bei den Griechen. Hier ist nämlich das Entscheidende für die Porträtbildung, daß sie mit dem Athletenbilden beginnt, mit der ersten Siegerstatue, die zu Olympia schon 558 v. Chr. aufgestellt wurde. Das Wesentliche dabei ist, daß das Individuelle hier nicht mit der Ähnlichkeit der Gesichtszüge, sondern mit der Verewigung der ganzen Gestalt in irgendeiner charakteristischen Bewegung, vielleicht im Momente des Sieges, zur Welt kommt. So wurde das Athletenbilden zum zentralen Faktum erstens für das Bilden des Individuellen überhaupt und zweitens für die Belebung des Idealen; denn ohne die stärkste Einwirkung dieser Studien auch auf das Götterbilden wären z.B. Hermes, die Dioskuren, Apoll, Dionysos in ihrer späteren Bildung so wenig denkbar als die weitere, nicht athletische Porträtbildung. Das Athletenbilden macht die ganze Kunst nicht bloß des lebendigsten Charakterisierens fähig, sondern überhaupt zu allen Aufgaben gelenk; auch die Amazone ist die ideale Athletin. Am Ende aber wurde die Athletenstatue selbst aus einem Denkmal zum freien Objekt der Kunst, und wir bewundern in der späteren, bloß um der Schönheit willen erfolgten Ausbildung und Wiederholung bestimmter Athletentypen, z.B. im Diskobol, den Athleten als solchen in seinen schönsten Erscheinungsweisen. Und dabei haben wir des Umstandes noch nicht Erwähnung getan, daß, nachdem die ältesten Athletenstatuen aus Zypressenholz waren gebildet worden, der kausale Zusammenhang, der zwischen dem Athletenbilden und dem Erzgusse bestand, eine der allerwichtigsten Techniken aufs mächtigste förderte.
Was die übrigen Porträtstatuen betrifft, so weiß man jetzt, daß schon frühe Statuen, welche irgendwie – wenn auch nicht eigentlich ikonisch – den Verstorbenen darstellten, an oder in Gräbern aufgestellt wurden. Am Grabe wird auch das Ikonische am ehesten begonnen haben. Wann aber hat zuerst eine Polis Ehrenstatuen für Krieger, Staatsmänner, Redner und Dichter dekretiert? Auch hier hat das Griechentum das Höchste erreicht. In der ganzen Kunstgeschichte gibt es keine Porträtstatue wie der lateranensische Sophokles. Prächtigere Statuen wird man aussinnen können, aber etwas von diesem vollendenten Einklange kommt nicht mehr vor.
Nur mit einem Worte möge schließlich hier auch der Genrefiguren, der Kinder usw. und der Tierbildungen Erwähnung getan werden, welche für sich wieder eine neue Welt der künstlerischen Darstellung ausmachen.
Und nun die plastische Darstellung des Vielen, die Komposition. Auch hier ist der Orient vorangegangen; aber Ägypten und Assur fehlt der Mythus und seine schöne Vielgestaltigkeit; stattdessen finden wir an Wänden, Pfeilern und selbst Säulen lauter Königschronik und Ritualien, d.h. es herrscht lauter Erzählen müssen, die Künstler sind an sachliche Vollständigkeit und ewige Wiederholung gebunden, und das Relief, das seinem Stil nach eigentlich ganz Teppich ist, fließt mit der Architektur zusammen und läuft wie eine Schrift oder wie ein Ornament darüber hin.
Den Griechen dagegen kommt hier, wie bei den einzelnen Gestalten, vor allem die große Vorarbeit zugute, welche die Poesie erledigt hatte. Daß bei den dargestellten Kämpfen nicht gottgleiche Sieger gegen Gestalten der Nacht streiten, sondern daß die Kämpfer, wer sie auch sein mögen, der Kunst als gleichberechtigt gelten, daß es hier ein pro und contra gibt, hat seinen Vorgang in der homerischen Schilderung. Wenn wir z.B. in der Ilias (IV, 457 ff.) lesen63, wie Achäer A den Troer B tötet, Achäer C die Leiche an sich reißen will, um sie zu plündern, Troer D sich an dessen Hüfte, wie er sich bückt, eine ungeschützte Stelle ersieht und ihn durchbohrt und endlich ein mächtiger Kampf um die Gruppe entsteht, so erweckt dies beinahe den Anschein, als hätte der Dichter bezweckt, der späteren Kunst64 eines des Sujets, die wir an ihr gewohnt sind, zu überliefern; werden doch auch bei ihr Hellenen und Troer, Lapithen und Kentauren, Helden und Amazonen, Götter und Giganten mit derselben Liebe dargestellt. Und nun hat die Kunst für diese Darstellungen auch Formen geschaffen, wie sie der Orient nicht kannte. Bestand schon frühe zwischen den figurenreichen Kampfesdarstellungen und dem fortlaufenden Relief (und schon dem bloß gemalten Friese) ein höchst segensreiches Verhältnis, so entwickelte sich nun das Relief auf allen seinen Stufen, bis zum Kampf aller Kämpfe, dem zwischen Göttern und Giganten auf dem Altare zu Pergamum; vor allem aber entstand, wovon der Orient keine Ahnung hatte, die Giebelgruppe und die Freigruppe aus mehreren Figuren (Farnesischer Stier, Laokoon usw.). Und dabei fühlte man sich von jedem ritualen Zwange frei und gestattete sich ruhig, etwa auch bloß andeutungsweise zu verfahren, indem man z.B. neben den Niobiden Apoll und Artemis wegließ, weil der Zuschauer sie ja von selbst schon ergänzte.
Und der Darstellungstrieb beschränkte sich nicht auf die Kampfszenen. Auch aus Homer ließen sich Darstellungen aus dem zartern Gebiete entnehmen; denken wir z.B. an die Gruppe, welche (II. VI, 370-498) Hektor, Andromache, Astyanax und die Dienerin bilden, oder daran, wie (I, 500 ff). Thetis sich zu Zeus setzt, mit der Linken seine Knie umfaßt und ihm mit der Rechten unter das Kinn rührt. Überhaupt aber schreit der ganze Götter- und Heroenmythus nach Verbildlichung, und eine ganze Welt von fertigen Szenen, zum Teil der höchsten Schönheit, ward gewiß schon frühe bildlich geschaut. Und dazu kommen noch die Gattungen idealer Wesen, welche Pluralbegriffe sind, die reihenweise dargestellt wurden, die Nereiden (Harpagosdenkmal), Danaiden (Tempel des Apollo Palatinus) usw.
Auch abgesehen vom Mythus aber ist die Kunst schon sehr frühe, und zwar laut Homer selbst, auf die Darstellung eines vielgestaltigen Lebendigen eingegangen und ist dabei (wie in den Gräbern von Beni Hassan) auf das Genrebild geraten. Wir erinnern hier wieder an den Schild Achills (I1. XVIII, 478-608), welcher lauter genrehafte Darstellungen enthält, während auf dem hesiodischen Schilde des Herakles solche mit mythischen wechseln.
Und endlich wagten die Griechen in großen Freigruppen außer dem Mythischen auch das Allegorisch-Politische, indem sie historische Individuen mit ihren allegorisch personifizierten Poleis oder mit den dieselben vertretenden Heroen zusammen darstellten oder, wie es Lysander in seinem kolossalen delphischen Weihgeschenke65 hielt, die Sieger mit den siegverleihenden Göttern zusammenbrachten, und dazu kommen noch die agonalen Gruppen, zumal der Sieger auf seinem Viergespann, und die gewaltigen rein historischen: das Granicusmonument Alexanders und zwei von den vier großen Gruppen des Attalidenmonuments in Athen66.
So strömen der Kunst von allen Seiten Gegenstände für die Massenerzählung zu, und die Volkstümlichkeit derselben ergibt sich schon aus deren frühem Vorkommen in kleinem Maßstabe. Die im VIII. Jahrhundert schon geschaffene Lade des Kypselos war mit erzählenden Darstellungen in lauter kleinen Figuren bedeckt, und wahrscheinlich waren auch die vielfigurigen Freigruppen aus sehr alter Zeit klein, welche Pausanias besonders in Delphi und dann auch an andern Weihestätten sah. Ihre Parallele aber hat die Vielskulptur in der Wandmalerei, und für uns spricht die Volkstümlichkeit des Vielen hauptsächlich aus der Vasenmalerei und der Übung, Umrisse auf Erz zu gravieren. Nach den Schöpfungen dieser Techniken hat dann wieder das Ausland, zumal Etrurien, mit besonderer Begierde gegriffen.
Neben der Darstellung der Götter selbst meldet sich bei allen polytheistischen und monumentalen Völkern sehr früh auch die Verewigung des einzelnen Kultaktes. Die Frömmigkeit des handelnden Königs, Priesters oder Volkes wird damit den Menschen und den Göttern anschaulich gemacht, den letzteren namentlich wohl, damit sie derselben eingedenk seien; der Mensch ist dem Gott in jeglichem Sinne am nächsten im Augenblicke und im Habitus des Kultus. So bilden denn, wie bereits gesagt, Ritualien schon in Ägypten und Assur eine der Hauptaufgaben der Vielskulptur. Aber auch hiebei hatten die Griechen große Vorteile. Zwar eines konnte in der Darstellung nicht in Betracht kommen: daß nämlich der Priester bei ihnen bisweilen in der Tracht des Gottes selbst auftrat67; denn in der Kunst mußte er vom Gott natürlich unterschieden werden. Dagegen ist es von höchster Bedeutung, daß sie nicht opfernde Despoten und nicht Priesterscharen, sondern einzelne, manchmal nur jährige Priester und Priesterinnen hatten, die oft nach Jugend und Schönheit gewählt und nie durch wüst-symbolische Tracht entstellt waren, und daß ferner die Erweiterung ihres Kultus durch Aufzüge (pompai), Chöre und dergl. die Sache von lauter auserlesenen Individuen war. Überhaupt stellte sich dieser Kultus der Kunst nicht als Knechtschaft und wüstes Tun, sondern als Freude zur Verfügung; auch aus dem Orgiastischen wählte die dionysische Skulptur das Schöne.
Wie aus dem eigentlichen Opfer ein Anathem dieser Art werden konnte, berichtet jene sehr eigentümliche Geschichte, die Pausanias68 von den argivischen Orneaten erzählt. Diese ersetzten ein allzu lästiges, im Kriege mit Sikyon getanes Gelübde, wonach sie dem Apollo täglich hätten Opfer und Prozessionen darbringen sollen, durch eine nach Delphi gestiftete eherne Darstellung69 von beidem. Pausanias erkennt hierin freilich nur einen klugen Kniff (sopisma); allein es handelt sich um eine tiefere, echt griechische Voraussetzung: ein täglicher Vorgang wird abgeschlossen und aus einem zeitlichen zu einem ewigen gemacht durch eine ideale, monumentale, ein für allemal geltende Darstellung70.
Groß war der Reichtum an Statuen von Priestern und Priesterinnen; noch von den jetzt vorhandenen Gewandstatuen mögen viele dahin gehören. Mochte das Tempelbild ein ungenießbares Xoanon sein, – die Reihe von solchen Statuen konnte alles gut machen. So war es vielleicht im Tempel der Eumeniden, in dem achäischen Kerynea71. Die Figuren derselben waren "nicht groß", vielleicht häßliche Puppen, aber am Eingange fanden sich weibliche Marmorstatuen, welche Kunstwert hatten, und die Einwohner erklärten sie für Priesterinnen der Göttinnen.
Wie frühe wurden wohl Festchöre in Reihen von Statuen verewigt? Die Agrigentiner nach einem Siege über die Libyer-Phönizier von Motye stifteten aus der Beute nach Olympia die ehernen Knaben, welche die "Hände vorhalten" und dargestellt sind, wie sie zu dem Gott beten72. Sie standen auf der Mauer der Altis und galten als Werke des Kalamis, – am ehesten werden sie eine Verewigung des Festchores gewesen sein, der zur Begleitung des Dankopfers nach Olympia gesandt war. Auch die Messenier von Messina stifteten nach Olympia die ehernen Bilder des in der Meerenge umgekommenen Knabenchors nebst Chordirigenten und Flötenbläser73.
Die höchsten Leistungen dieser Art haben wir auf der athenischen Akropolis zu suchen. Hier sind der Panathenäenzug des Parthenon, und an der Ballustrade des Nike-Apteros-Tempels die Niken, welche den Opferstier führen und die, welche das Siegeszeichen rüsten. Dies ist die höchste ideale Umdeutung einer Kultushandlung, die höchste Verklärung des Kultus überhaupt74.