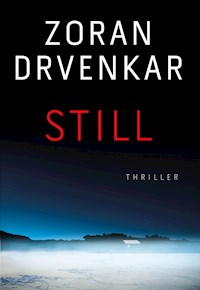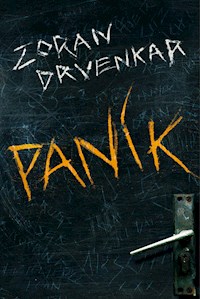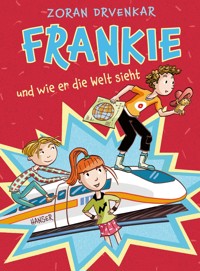11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Kurzhosengang-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Kurzhosengang ist zurück
Eine Geschichte aus den verschollenen Archiven der Zeit. Ein Abenteuer, das unter den Teppich gekehrt werden sollte. Nichts ist, wie es scheint, alles ist, wie es sein sollte.
Nach dem tragischen Tod der Brüder Karamasow macht sich ein Notar auf den Weg nach Okkerville, um das Testament der Brüder zu verlesen. Sein Besuch hat Auswirkungen, die eine ganze Stadt in Tiefschlaf versetzen und unsere Helden in ihr nächstes Abenteuer katapultieren.
Pack deinen Rucksack und komm mit auf eine Reise, auf der sich die Grenzen von Raum und Zeit auflösen werden. Sei bereit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als ein Ganzes zu sehen. Und was du auch tust, habe Vertrauen, denn Snickers, Island, Rudolpho und Zement sind an deiner Seite und denken keine Sekunde daran, dich aus den Augen zu verlieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2018 Zoran Drvenkar
© 2018 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlagillustration und -konzeption: Martin Baltscheit
Umschlagfertigstellung: Init GmbH
CK ∙ Herstellung: UK
Satz: Corinna Bernburg
ISBN 978-3-641-23014-2V003www.drvenkar.de
www.cbj-verlag.de
Für Rudolpho, Snickers, Island & Zement,weil ihr mein Leben größer machtund in der Sinnlosigkeitimmer einen Sinn findet
Liebe Leser,
es ist mal wieder so weit. Das vierte Buch über die Kurzhosengang liegt in euren Händen und eigentlich ist es ein Buch, das es nicht wirklich gibt. Yves und ich hätten diese Geschichte beinahe verpasst. Ein Zufall hat uns davor bewahrt, ohne diesen Zufall wäre dieses Abenteuer der Kurzhosengang durch die Ritzen der Zeit gerutscht und für immer verschwunden.
Wir danken Zements Mutter, dass sie sich verquatscht hat. Ohne sie wären wir noch immer vollkommen ahnungslos.
Nachdem Yves und ich Die Kurzhosengang & das Totem von Okkerville abgeschlossen hatten, reisten wir in den hohen Norden von Kanada, um das Buch mit der Kurzhosengang zu feiern. Es wurde viel gegessen und getrunken, es wurde geredet und gelacht, und wir verbrachten so viele Stunden vor dem Kamin, dass wir braun wurden. Drei Tage lang haben wir die Jungs und das Leben bejubelt, ehe wir unsere Sachen packten und uns von Zements Ma zum Zug fahren ließen.
„Das war ja mal wieder was“, sagte Yves, als wir auf dem Bahnsteig standen. „Ich werde das viele Reden und Lachen vermissen.“
„Ihr seid jederzeit willkommen“, sagte Zements Ma.
Wir stampften mit den Füßen und sahen den Zug näher kommen. Es schneite, in der Ferne bellte ein Hund, es war ein guter Tag, um nach Hause zu fahren. Und wie wir da so standen und warteten, sagte ich, was ich schon die ganze Zeit über sagen wollte:
„Ich bin sehr froh, dass die Jungs ihr letztes Abenteuer mit heiler Haut überlebt haben. Für dich als Mutter muss das ja ein Albtraum gewesen sein.“
Zements Ma winkte ab.
„Es war ein Albtraum“, stimmte sie mir zu, „aber die Zeit davor war viel schlimmer.“
„Welche Zeit davor?“, fragten Yves und ich gleichzeitig.
Zements Ma sah uns an, als würden wir mit beiden Füßen auf der Leitung stehen. Dann sprach sie betont und langsam, damit wir auch Zeit hatten, von der Leitung runterzusteigen:
„Die Zeit davor, als die Jungs in Russland waren.“
„Die Jungs waren was ?!“, riefen wir im Chor.
Zements Ma griff sich an den Mund, als könnte sie die Worte zurückschieben. Doch wir hatten deutlich gehört, was sie gesagt hatte.
Die Zeit davor, als die Jungs in Russland waren.
Ich sah Yves an, Yves sah mich an, der Zug fuhr ein und hielt schnaufend, Leute stiegen aus, Leute stiegen ein, wir nahmen unser Gepäck und kehrten zum Auto zurück. Und da saßen wir dann stur und eigen auf dem Rücksitz, während Zements Ma verwundert auf der Fahrerseite stand und durch das Fenster zu uns reinschaute.
„Ihr bleibt?“, fragte sie.
„Wir bleiben“, sagte Yves.
„Was sollen wir sonst tun?“, fragte ich.
Darauf hatte Zements Ma keine Antwort. Jetzt mal ehrlich, was sollten wir sonst tun? Die Kurzhosengang hatte einen Abstecher nach Russland gemacht, ohne es uns gegenüber mit einem Wort zu erwähnen. Wir mochten Bescheidenheit, doch was das hier war, wussten wir noch nicht, aber eines war sicher – wir würden es herausfinden.
„Habt ihr den Zug verpasst?“, fragte Island, als wir wieder in das Wohnzimmer traten.
Die Kurzhosengang lag auf dem Boden vor dem Kamin und las Comics. Sie schaute kurz zu uns auf, dann vertiefte sie sich wieder in ihre Comics und tat, als wäre es ganz normal, dass wir nicht im Zug saßen.
„Oder vermisst ihr uns etwa schon?“, fragte Rudolpho und blätterte eine Seite um.
Snickers seufzte.
„Es gibt ja wohl nichts Besseres, als ein gutes Comic zweimal zu lesen“, stellte er fest.
„Oder dreimal“, sagte Island.
„Oder viermal“, sagte Zement und blickte auf und grinste Yves und mich plötzlich an.
Sein Grinsen verriet ihn.
Ich zeigte auf Zement, wie man auf einen Zauberer zeigt, dessen Trick man durchschaut hat.
„Du weißt ganz genau, warum wir zurückgekommen sind, oder?“
Zement antwortete so behäbig, dass mein Herz dreimal schlug, bevor er das Wort beendet hatte.
„Vielleicht“, sagte er.
„Vielleicht?“, wiederholte Yves und dann platzte es aus ihm heraus: „Ihr seid doch wahr und wirklich in Russland gewesen, ohne uns davon zu erzählen!?“
Jetzt hatten wir ihre Aufmerksamkeit. Die Kurzhosengang wechselte einen kurzen Blick.
„Oh“, sagten sie alle vier und dieses Mal hinkte Zement keine Sekunde hinterher.
Fünf Minuten später saßen Yves und ich mit einem Becher Kakao in den Händen vor dem Kaminfeuer und die Kurzhosengang packte ihre Geschichte aus.
Und wir hörten zu.
Und wir hörten zu.
Bis nach Mitternacht rührten wir uns nicht von der Stelle. Kurz vor ein Uhr schloss die Kurzhosengang ihre Geschichte ab und sagte, das wäre es gewesen und mehr gäbe es nicht zu erzählen.
Wir waren müde und erschöpft, wir waren aber auch nervös und aufgeregt. Ihr kennt uns. Yves und ich sind zwei einfache Schriftsteller, wir sind keine Matadore, die mit einer Horde von Stieren in die Arena steigen und danach ein Schnitzel essen. Wir haben zarte Nerven. Die Kurzhosengang hat keine Rücksicht auf unsere Nerven genommen.
„Puh“, machte Yves.
„Ich bin so was von kaputt“, sagte ich.
Danach haben wir im Wohnzimmer auf dem Sofa geschlafen und uns am nächsten Morgen nach dem Frühstück ein zweites Mal verabschiedet. Zements Ma brachte uns erneut zum Bahnhof und dieses Mal stiegen wir in den Zug. Als wir zu Hause ankamen, haben wir erst mal einen Monat lang Urlaub gemacht, so gerädert fühlten wir uns. Wir sind jeden Tag durch den Schnee gewandert, am Abend saßen wir in der Sauna und redeten kaum, denn nach einer Geschichte wie dieser gab es wenig zu sagen. Wir mussten unsere Gedanken klären.
Und noch ein Monat und noch ein Monat und noch ein Monat vergingen.
Ein Vierteljahr lang tobte dieses beinahe verpasste Abenteuer der Kurzhosengang wie ein Tornado durch unsere Köpfe und pustete jeden Gedanken um, der sich ihm in den Weg stellte.
Nach dem Vierteljahr machten wir uns an die Recherche.
Wir stiegen in einen Flieger nach Moskau und futterten dort löffelweise Kaviar, Gulasch und pochierte Wachteleier. Wir reisten mit dem Zug und dann mit einem klapprigen Mietwagen tiefer ins Land hinein und verirrten uns in der sibirischen Steppe. Wir lernten ein Yak zu melken und tranken mit einem nomadischen Stamm Tee, auf dem gelb glänzende Fettaugen schwammen. Auf uns wurde geschossen, gespuckt, und zweimal versuchte man uns zu verheiraten. Wir ließen uns nicht beirren. Zwischendurch haben wir hier und da Postkarten aus dem Schnee geklaubt. So kam alles zusammen wie ein Puzzlespiel. Ihr wisst, Recherche ist alles. Auch wenn wir zwei nette Kerle sind, kann man uns nicht alles erzählen. Wir zweifeln, wir hinterfragen und geben uns Mühe, immer freundlich zu sein.
So fanden wir fast alle Antworten auf unsere Fragen. Danach sind wir nach Hause zurückgekehrt und haben das vierte Buch über die Kurzhosengang geschrieben.
Und jetzt liegt es in euren Händen.
Viel Spaß mit den Jungs.
Die folgende Geschichte findet statt zwischen dem zweiten Buch über die KurzhosengangDie Rückkehr der Kurzhosengang und dem dritten Buch Die Kurzhosengang & das Totem von Okkverille.
SNICKERS
Die Standuhr tickte und tickte. Es klang, als wäre die Zeit ein Blinder, der sich mit einem Stock in den neuen Tag hineintastet. Es war zehn Uhr früh, die schlimmste Woche unseres Lebens lag hinter uns, und wir ahnten nicht, dass es noch schlimmer werden würde. Alles wirkte so unschuldig da draußen – Schneeflocken fielen träge auf unsere Stadt herab und ein paar Autos fuhren im Schritttempo um den Mulberry Circle herum, während sich der Tag anfühlte, als wäre er in Watte gepackt.
Und die Kurzhosengang saß in einem stickigen Büro und wartete.
Es gibt ja Warten und Warten. Das hier war die finstere Seite des Wartens. Wo man nichts tun kann und die Zeit mit schlurfenden Schritten an einem vorbeitickt. Da werden zehn Minuten zu zehn Stunden zu zehn Jahren. Ganz besonders, wenn man auch noch auf unbequemen Klappstühlen sitzt.
Ich gähnte.
Island gähnte.
Rudolpho gähnte.
Zement schlief schon längst.
„Ich wünschte, unsere Schule wäre schon fertig gebaut“, sagte Rudolpho.
„Nein, wünschst du dir nicht“, widersprach ihm Island.
„Wünsch ich mir doch, denn dann könnte ich in unserem neuen Klassenzimmer sitzen und meinen Kopf auf den Tisch legen und einfach wegratzen. Es wäre auf jeden Fall bequemer, als hier zu warten.“
„Mach es doch wie Zement“, sagte ich.
Unser Kumpel saß vollkommen entspannt auf dem Klappstuhl und hatte die Augen geschlossen. Er brauchte keinen Tisch, er brauchte kein Bett, er war die Entspannung pur. Nur der Buddha in Lei Toos Bakery war so lässig, was aber in seiner Natur lag, denn er war gerade mal dreißig Zentimeter groß und aus grünem Jade gehauen.
„Zement hat es gut“, sagte Rudolpho und seufzte.
„Zement hat es immer gut“, stimmte ich ihm zu.
Island hatte plötzlich einen Geistesblitz.
„Stellt euch vor, sie bauen die Schule nie wieder auf, das wäre doch was, dann würden die Lehrer streiken und wir müssten sie nicht mehr zu Hause besuchen, dann könnten wir auch streiken und den ganzen Tag einfach nur wir sein, ohne dass uns jemand fragt, wie groß der Ontariosee ist oder wie der erste Bürgermeister von Ottawa hieß.“
„Das ist doch Quatsch“, sagte ich und klang dabei wie ein Opa, der kurz vor dem neunzigsten Geburtstag steht. „Jede Stadt braucht eine Schule.“
Island beugte sich an Rudolpho vorbei.
„Gratuliere, du klingst wie ein Opa, der kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag steht.“
„Genau das habe ich auch gedacht“, sagte ich und schüttelte ihm die Hand.
Wir hatten keine Schule mehr, weil unsere Schule Anfang Januar von einem Orkan davongetragen worden war. Jetzt hatten wir Ende Februar und wurden bei unseren Lehrern zu Hause unterrichtet, während auf dem Hügel eine neue Schule gebaut wurde. Am schlimmsten war es, wenn wir zu Sportlehrer Kniescheibe mussten. Er erwartete uns vor seinem Haus in einem knallgelben Trainingsanzug und ließ uns im kniehohen Schnee Bahnen durch Okkerville laufen. Dabei schaute er kritisch auf seine Stoppuhr, und wann immer uns die Puste ausging, brüllte er uns zu:
„WAS TUT IHR? GLAUBT IHR, EIN MANN WIRD EIN MANN, INDEM ER NICHT TRAINIERT?! IHR SEID JA EINE BELEIDIGUNG FÜR GANZ KANADA! SO WERDET IHR NIE WAHRE EISHOCKEYSPIELER, SO WERDET IHR PFEIFEN! SEID IHR ETWA SCHON PFEIFEN?!“
Heute hatte niemand Unterricht, und in unserer kleinen Stadt lag die gesamte Arbeit still, weil es ein Trauertag war. Punkt acht Uhr früh hatten wir uns in der Kirche eingefunden, um die Brüder Karamasow zu verabschieden. Kein Schüler und kein Lehrer, kein Bewohner von Okkerville hatte gefehlt. Es gab kaum jemanden, der Alexei und Iwan nicht gemocht hat. Siebzig Jahre lang hatten sie jeden Tag die Flügeltüren ihres Kinos aufgeschlossen und Tickets, Popcorn und Limo verkauft. Sie haben ausgewählte Filme vorgeführt, nach den Vorstellungen das Popcorn vom Boden aufgefegt und die Limo-Flaschen eingesammelt, ehe sie die Flügeltüren wieder verschlossen. Die Brüder Karamasow waren für die Stadt so wichtig gewesen wie die Luft zum Atmen.
Und plötzlich gab es sie nicht mehr.
Zements Vater hielt die Abschiedsrede für die Brüder Karamasow. Die Frauen schnäuzten sich in ihre Taschentücher und die Männer blickten betreten auf den Boden und scharrten mit den Füßen, als würden sie nach Gold suchen. Die Kurzhosengang trat einer nach dem anderen an die Urnen. Wir flüsterten ein paar Worte, die nur die Brüder hören sollten, danach standen wir mit den anderen vor der Kirche herum und hatten die Hände in den Hosentaschen vergraben. Es wurde geredet und erinnert, und als keiner mehr was zu sagen hatte, verabschiedeten sich alle voneinander, und die Kurzhosengang fuhr auf ihren Rädern zum Rathaus, wo sie jetzt vollkommen übermüdet in einem muffigen Büro saß und wartete.
Leider hatten wir nicht das Glück, allein zu sein.
In Okkerville gibt es zwei Bäckereien, vier Haus- und zwei Zahnärzte, wir haben sechs Malermeister, zwei Dachdecker und drei Schuhmacher. Dann gibt es noch an die zwanzig Leute, die arbeitslos sind und Schnee schippen, wann immer man sie anruft.
Wir haben also von allem reichlich, aber wir haben nur einen Anwalt.
Marten G. Morten war ein paar Minuten vor uns angekommen und saß auf dem einzigen Ledersessel, der so bequem aussah, dass wir uns am liebsten darauf zusammengerollt hätten. Alle paar Sekunden schlug der Anwalt seine Beine übereinander und atmete laut aus. Marten G. Morten war groß und breit und klang wie ein alter Kühlschrank, der zu viel Strom verbraucht. Er stöhnte unentwegt. Neben Marten G. Morten zu sitzen, war also kein sehr großer Spaß. Sein Motto lautete: „Eine Stadt, ein Anwalt, ein Urteil.“ Die Leute waren froh, wenn sie ihm aus dem Weg gehen konnten. Niemand lud den Anwalt zum Kaffee ein, niemand fragte ihn auf der Straße nach der Uhrzeit. Nein, Marten G. Morten ging man aus dem Weg, weil er jedem seine Visitenkarte in die Hand drückte und andauernd vor Gericht gehen wollte.
Und er jammerte eine Menge.
„Jungs, das ist doch die reinste Folter!“
Marten G. Morten bewegte seinen Hintern von links nach rechts, als würde er auf glühenden Kohlen sitzen. Der Ledersessel knarzte, der Holzboden knarrte, Marten G. Morten sagte:
„Dieser Sessel ist ja wohl aus Stahlwolle gemacht!“
Und er sagte: „So unbequem habe ich ja noch nie gesessen!“
Und er sagte: „Meine Bandscheiben schmerzen, als würde ein Schimpanse darauf Polka tanzen!“
„Wir können ja tauschen“, bot ich an.
Die Kurzhosengang saß auf Klappstühlen, die sich bedrohlich nach links neigten, sodass wir uns alle vier in Schräglage befanden. Nur ein Idiot hätte mit uns getauscht.
„Ich bin doch kein Idiot“, sagte Marten G. Morten und tätschelte die Armlehnen, als wäre der Ledersessel plötzlich sein bester Freund. „Da habt ihr aber Pech gehabt, dass ich vor euch hier war, was?“
Wir hatten wirklich Pech gehabt, deswegen sparten wir uns eine Antwort. Island gähnte, Rudolpho gähnte, Zement schlief weiter, und ich schaute aus dem Fenster und überlegte, wann wieder alles normal sein würde in unserer kleinen Stadt. Hätte mir an dem Tag jemand gesagt, dass wir uns in ein paar Monaten schon auf die Suche nach dem legendären Totem machen würden, ich denke, ich hätte der Zukunft lächelnd entgegengeschaut und sogar ein wenig gewinkt. So aber war ich grimmig, denn ich vermisste die Brüder Karamasow und hatte das Gefühl, selbst ein alter müder Mann zu sein, der sich im Körper eines elfjährigen Jungen versteckt. Als hätte die Sonne meine Gedanken gehört, lugte sie durch den Schneevorhang und grinste mich an. Aber es war kein gutes Grinsen, denn durch das schmutzige Fensterglas blieb die Sonne nur ein matter Fleck am Himmel. In ganz Okkerville gab es zu der Zeit kaum ein sauberes Fenster, sie waren alle von klebrigem Ruß verdreckt. Nicht nur haben wir in diesem Jahr unsere Schule an einen Orkan verloren, es gab seit Neuestem auch keine Bibliothek, keine Polizeistation und auch keine Videothek mehr. Selbst die Feuerwehr war bis auf den Grundstein niedergebrannt.
Das Schlimmste aber war für uns das Verschwinden des Kinos.
Das Kino ging mitsamt den Brüdern Karamasow in Flammen auf, dabei kamen Alexei und Iwan aber nicht ums Leben. Sie starben kurz vor Schluss der letzten Vorführung. Ich weiß noch, wie ich mich mitten im Film umdrehte und nach hinten sah. Die Brüder saßen nebeneinander in der letzten Reihe und grinsten mich an. Alexei hob den Daumen und Iwan machte eine wedelnde Geste, ich sollte den Film weiterschauen. Während der Endtitel müssen ihre Herzen aufgehört haben zu schlagen. Ein wenig war es, als hätten sie gewusst, dass ihr Kino bald abbrennen würde. Zement meinte dazu, das wäre die beste Art, sich von dieser Welt zu verabschieden – Seite an Seite mit seinem besten Freund, während ein guter Film läuft.
Kneift mal die Augen zu und stellt euch vor, was für ein Chaos hier vor einer Woche geherrscht hat: Es gab in jener Nacht fünf Explosionen in fünf Häusern, die daraufhin so schnell in Flammen aufgingen, dass niemand etwas dagegen unternehmen konnte. Die Flammen sprangen von einem Gebäude zum anderen, und die Leute rannten wie kopflose Hühner herum und wussten sich nicht zu helfen. Als uns dann die Feuerwehr aus Farris zu Hilfe kam, war es fast schon zu spät.
Wenn ihr jetzt die Augen wieder öffnet und von oben auf Okkerville runterschaut, könnt ihr sehen, dass unsere Hauptstraße an einen grinsenden Mund erinnert, der fünf Zähne verloren hat. Fünf ist dabei die Zauberzahl, denn dieses Feuer brach nur aus, weil fünf bekloppte Jungen sich selbst fünf Denkmäler setzen wollten.
„Die PauliGang sollte für immer im Knast bleiben“, sagte Island.
„Die PauliGang sollte auswandern“, sagte Rudolpho.
Ich schüttelte den Kopf, denn ich glaubte nicht, dass wir die Paulis so schnell loswerden würden. Zement erwachte aus seinem Nickerchen, seufzte einmal laut und sagte, ohne die Augen zu öffnen:
„Langsam werde ich müde vom Warten.“
„Mach doch einfach die Augen zu“, schlug Rudolpho vor.
Wir kicherten, Zement kicherte so sehr, dass er beinahe vom Stuhl fiel. Marten G. Morten kicherte nicht, sondern streckte die Beine aus und gab ein Ächzen von sich, als wäre er in den letzten Minuten um achtzig Zentimeter geschrumpft. Das Ächzen begann in seinem Mund und endete in seinen Schuhen. Dann wollte er wissen, wo denn der Kaffee blieb. Und dann rief er uns zu: „Seht mich nicht so überrascht an!“
Keiner von uns hatte ihn angesehen.
Marten G. Morten pochte auf die Armlehnen.
„Wisst ihr, ich habe Besseres zu tun, als hier zu sitzen und zu warten. Ein Anwalt von meinem Kaliber ruht nie. Nie und niemals! Die Ungerechtigkeit der Welt lauert überall. Selbst in einem Fingernagel. Außerdem ist dieser– – –“
„Du bist doch hier, weil du hier sein willst“, unterbrach ihn Island. „Du bist nicht hier, weil du hier sein musst.“
Marten G. Morten glaubte, sich verhört zu haben. Island quasselt zwar viel und gerne, aber seine Sätze haben immer einen besonderen Unterton, der wie der Schlag einer Glocke nachhallt, selbst wenn Island nicht mehr spricht. Wenn ich was sage, ist es nüchtern und klar, denn ich will immer auf den Punkt kommen und lieber weniger als zu viel sagen. Rudolpho dagegen umrankt seine Worte mit Blumen und so viel Freundlichkeit, dass man darin baden will. Und Zement macht alles anders. Was er sagt, ist in Stein gemeißelt, vorausgesetzt man ist geduldig und wartet ab, dass er zu Ende spricht.
„Lasst euch mal eins gesagt sein“, regte sich Marten G. Morten auf, „ihr Jungs braucht einen Anwalt. Vielleicht geht es um Millionen!“
Wir schüttelten den Kopf. Es ging nicht um Millionen.
Marten G. Morten winkte ab.
„Jeder braucht einen Anwalt. So ist das nun mal, so wird es immer sein, denn so ist das Leben.“
Und da kam endlich der Notar herein.
Wenn sich eine Maus in einen Menschen verwandelt, wenn sie dann einen Anzug findet, der ihr passt, und ein Toupet, das immer wieder verrutscht, dann hat man einen Notar. Wenn man dann noch ein wenig vom Pech verfolgt wird und der Notar auf der Reise Zugwind abbekommen hat, dann hat man einen erkälteten Notar, der furchtbar mies gelaunt ist und es sehr bereut, nach Okkerville gereist zu sein. Und so hörte sich der erste Satz aus seinem Mund an:
„Was für ein Kaff!“
Der zweite Satz war auch nicht besser:
„Was für ein Drecksloch!“
Marten G. Morten hüstelte, als wollte er dem Notar widersprechen, hielt dann aber doch den Mund. Der Kurzhosengang fiel auch keine gute Verteidigung für ihre Stadt ein, denn Okkerville war wirklich nicht der Ort, an dem man Urlaub machen wollte. Die Leute warfen ihre Mülltüten einfach auf die Straße und scherten sich nicht darum, wo ihr Dreck landete. Sie meckerten viel und taten nichts, damit es der Stadt besser ging. Die Häuser hatten Risse und der Anstrich von den Fassaden blätterte ab, als wäre es unentwegt Herbst für Farben. Wenn es schneite, schneite es richtig und zu viel. Dasselbe galt für den Regen. Er füllte jede Ritze, und Schlaglöcher taten sich auf und waren tief wie Brunnen. Ein Fluch schien über Okkerville zu liegen. So gesehen konnte ich die Abneigung des Notars gut verstehen – unsere Stadt war ein Schandfleck und ein gutes Jahrhundert davon entfernt, der schönste Ort Kanadas zu sein.
„Fangen wir an“, sagte der Notar und setzte sich hinter den Schreibtisch. Er hätte lieber stehen bleiben sollen. Kaum hatte er sich gesetzt, verschwand er mit einem Ruck aus unserem Blickfeld und wir sahen nur noch die obere Hälfte seines Toupets. Wer auch immer vorher auf diesem Stuhl gesessen hatte, er saß gerne niedrig.
„Sehr witzig“, knurrte der Notar und begann den Stuhl hochzukurbeln, ohne dabei aufzustehen.
Eine Minute später konnten wir ihm wieder in die Augen sehen. Sein Gesicht war vom Kurbeln rot angelaufen und ein milchiger Tropfen hing an seiner Nasenspitze. Nicht nur Okkerville hatte ein Problem mit ihrem Aussehen, auch der Notar war ein gutes Jahrhundert davon entfernt, der schönste Mann Kanadas zu sein.
Wir lächelten aufmunternd, der Notar lächelte nicht zurück.
„Meine Zeit ist begrenzt“, sagte er und blickte auf seine Uhr. „Mein Zug geht in exakt zwanzig Minuten, und ich will ihn auf keinen Fall verpassen. Mein Name ist Samuel Porter, und wir sparen uns alle Beileidsbekundungen und den ganzen Unsinn und beginnen mit der Testamentsverlesung.“
Marten G. Morten hüstelte erneut, dieses Mal aber fand er seine Stimme.
„Machen Sie mal langsamer“, sagte er.
„Langsamer?“
Der Notar schaute sich um, als wäre er in der falschen Stadt aus dem Zug gestiegen.
„Wieso sollte ich Zeit verschwenden?“, fragte er.
„Weil das hier ein Trauerfall ist.“
„Und?“
„Ein Trauerfall von höchster Tiefe!“
„Mein lieber Mann“, gab der Notar zurück, „höchste Tiefe ist ein Widerspruch. Und was kümmert mich das? Ich bin der Notar und nicht der Bestatter.“
Wir erwarteten, dass Marten G. Morten aufspringen und sich mal so richtig empören würde. Doch er blieb sitzen, denn er war ein sehr behutsamer Anwalt.
„Fahren Sie fort“, bat er und senkte den Blick.
„Gut“, sagte der Notar, „ich sehe, wir verstehen uns.“
Er klappte seinen Aktenkoffer auf und entnahm ihm einen dünnen Hefter. Er las unsere Namen vor und fragte, ob wir anwesend seien. Wir nickten, wir waren anwesend. Der Notar sah Marten G. Morten an.
„Und wer sind Sie, bitteschön?“
Marten G. Morten reichte ihm seine Visitenkarte.
Der Notar warf einen Blick auf die Karte, nahm sie aber nicht.
Marten G. Morten steckte die Karte wieder ein.
„Wozu brauchen die Jungs einen Anwalt?“, fragte der Notar.
Marten G. Morten lachte, als hätte der Notar einen Witz gemacht.
„Wozu brauchen die Jungs einen Anwalt?“, wiederholte der Notar im gleichen Tonfall.
Marten G. Morten hörte auf zu lachen und machte ein ernstes Gesicht.
„Weil jeder einen Anwalt braucht“, antwortete er. „Das ist doch selbstverständlich.“
Der Notar wandte sich an uns.
„Wollt ihr, dass er mit dabei ist?“
Wir sahen Marten G. Morten an, Marten G. Morten gab uns sein bestes Lächeln, sodass seine Zähne aufblitzten wie eine Reihe strahlend weißer Soldaten, die nur darauf warteten, dass ihnen jemand querkam.
„Er muß nicht dabei sein“, beschloss Rudolpho.
„Nee“, stimmte ihm Island zu, „wir brauchen ihn nicht wirklich.“
Ich wollte auch was sagen, aber Marten G. Morten schaute so entsetzt, dass ich mir sicher war, wenn ich jetzt auch noch den Mund aufmachte, würden ihm die Augen rausploppen. Nein, Marten G. Morten musste nicht mehr hören. Er sprang auf und murmelte irgendwas von verzogenen Gören, die eines Tages um seine Hilfe betteln würden, dann zog er sich umständlich seinen Mantel an und stürmte aus dem Büro. Wir hörten seine hämmernden Schritte durch den Flur des Rathauses hallen, dann war es wieder still, und der Notar fragte, ob alle Bewohner in Okkerville so unfreundlich wären.
„Nur die Anwälte“, antwortete ich, „und davon haben wir nicht so viele.“
Der Notar nahm das mit einem Nicken zur Kenntnis und setzte sich eine Brille auf.
„Dann wollen wir mal beginnen“, sagte er. „Ich verlese jetzt das Testament der Brüder Karamasow, ehemalige Cinematographen, geboren 1902 in Sankt Petersburg, Russland, verstorben 2000 in Okkerville, Kanada. Bis zu ihrem Ableben waren sie als Kinobesitzer und Filmvorführer tätig und blablabla.“
„Was?!“, rutschte es Rudolpho heraus.
„Steht da wirklich blablabla?!“, fragte ich.
Der Notar sah uns über seine Brillengläser hinweg an, als wären wir nicht ganz richtig im Kopf, dann beugte er sich erneut über das Testament und ratterte den Text herunter, als würde das Papier jede Sekunde in Flammen aufgehen:
Liebe Kurzhosengang,
es ist der 11. Januar 2000 und wir nehmen Abschied von euch. Wir können spüren, dass wir nicht mehr lange leben werden. Aus diesem Grund setzen wir dieses Testament hier und heute auf, damit es keine Unstimmigkeiten gibt und niemand versucht, sich das Erbe unter den Nagel zu reißen.
Kaum jemand hat unser Kino so oft besucht wie ihr. Eure Köpfe in der 7. Reihe zu sehen, ist für uns immer eine Herzensfreude gewesen. Ihr seid mit unseren Filmen aufgewachsen, und es mag euch sicher überraschen, aber wir möchten euch allein dieses Erbe in die Hände legen.
Es wird euch eine Menge Mut abverlangen, denn ein Erbe ist mehr als nur ein Geschenk von jemandem, der nicht mehr lebt.
Ein Erbe ist die Bitte, ein Licht am Brennen zu halten.
Rudolpho, gebrauche deine Sehnsucht, denn nur Sehnsucht durchdringt Zeit und Raum. Sie wird dein Schlüssel sein. Island, sorge dich nicht zu sehr, alles findet seinen Weg, und selbst wenn es ausweglos erscheint, wirst du Klarheit haben. Snickers, scheu dich nicht zu versagen, und scheu dich nicht, alles infrage zu stellen. Die Antworten sind immer da, die Fragen müssen nur richtig gestellt werden. Und dann du, lieber Zement, was wäre ohne dich aus uns geworden? Vertraue auf deine Ruhe und verzeih uns, dass wir dich angelogen haben, aber es ging nichts anders.
Wir sahen Zement an.
„Was seht ihr mich an?“, fragte er.
„Womit haben sie dich angelogen?“, fragte ich.
„Wer?“
„Mensch, Zement, die Brüder!“
„Ach, die Brüder. Keine Ahnung.“
„Aber was haben sie dir erzählt?“
„Dies und das.“
„Geht es nicht genauer?“
„Ihr wisst doch, sie haben gerne viel geredet.“
„Denk doch mal nach!“, drängelten wir.
„Mh. Ich denk ja nach, aber da ist nichts.“
Der Notar schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
„Jungs, macht das später in Ruhe unter euch aus“, sagte er und las weiter:
Wenn der vor euch sitzende Notar seine Arbeit richtig gemacht hat, dann ist es jetzt auf die Minute genau 10 Uhr 25 …
Der Notar sah auf die Uhr über der Zimmertür. Es war 10 Uhr, 24 Minuten und 48 Sekunden. Wir hätten beinahe applaudiert. Der Notar wartete die zwölf Sekunden ab, dann las er weiter, als hätte er nie eine Pause gemacht:
… und euch bleiben noch fünf Minuten, dann müsst ihr bereit sein. Wir wissen, es geht alles recht schnell. Alles Weitere wird euch Kira erklären.
Kommen wir zu unserem letzten Wunsch. Wir möchten …
„Moment mal“, unterbrach Rudolpho den Notar, „wer ist Kira?“
„Woher soll ich das wissen?“, fragte der Notar zurück.
„Und was genau passiert in fünf Minuten?“, fragte ich.
„Jungs, ich bin nur der Notar.“
„Kira klingt nett“, sagte Rudolpho und schaute zur Tür, als würde er erwarten, dass die nette Kira hereinkäme. „Kira klingt wie jemand, der– – –“
„RUHE!“
Der Notar hatte so laut gebrüllt, dass sein Toupet ein wenig nach vorne verrutscht war.
„Ich dachte, ich hätte mich vorhin verständlich ausgedrückt, was das beschränkte Zeitfenster meines Besuches angeht, oder habe ich das nicht?“
Er hatte, wir murmelten eine Entschuldigung, der Notar tippte auf das Papier vor sich.
„Wir haben nur noch ein paar Sätze und die Zeit läuft. Darf ich? Bitte?“
Wir schluckten unsere Fragen runter und nickten. Der Notar las weiter:
Kommen wir zu unserem letzten Wunsch: Wir möchten, dass ihr unsere Asche über den Dächern unserer Geburtsstadt verstreut. Denn dort begann alles, dort soll es auch für uns enden. Und jetzt hoffen wir, dass ihr eine gute Reise habt und euch der Mut nie verlässt. Wir wären gerne da gewesen, um euch bis zum Schluss zu beschützen, aber die Zeit ist uns in die Quere gekommen. Es tut uns leid, dass wir so schnell müde wurden vom Leben.
Wir winken euch aus der Ferne.
Euer
Iwan & Alexei
Der Notar senkte das Testament, seine Arbeit war getan. Ich sah zu Island, der sah zu Rudolpho, der sah zu Zement, woraufhin Zement den Notar anschaute, als hätte er ihn eben erst bemerkt.
„He, wartet mal“, sagte er. „Wieso wurde ich bitteschön angelogen?“
ZEMENT
In der Okkerville News erschien zwei Tage vor der Beerdigung ein Nachruf auf die Brüder Karamasow. In dem Nachruf stand, sie wären 1902 in Sankt Petersburg geboren und hätten 1929 Russland verlassen. Da stand, sie reisten mit dem Schiff nach Amerika, aber anstatt in New York auf Ellis Island anzulegen, ging das Schiff an der Küste von Neufundland vor Anker. Die Brüder dachten, sie wären in Amerika. Sie gingen an Land, und kaum hatten sie festen Boden unter den Füßen, wurden sie ausgeraubt. Es war ein mieser Anfang für ein neues Leben. Ohne einen Cent in der Tasche reisten sie quer durch Kanada und erreichten die Stadt Pembroke, wo sie gleich nach ihrer Ankunft festgenommen wurden, weil dem Sheriff ihre Gesichter nicht gefielen. Da das Gefängnis in Pembroke zu der Zeit überfüllt war, verlegte man die Brüder in die nahe liegendste Stadt, und das war unser Okkerville. Damals stand auf dem Hügel noch ein Gefängnis, das erst Jahrzehnte später zu unserer Schule umgebaut wurde. Die Brüder blieben nicht lange hinter Gittern. Schon nach einem Monat brachen sie aus und verschanzten sich unerkannt in unserer kleinen Stadt, wo sie ein Kino eröffneten. Sie nannten sich von da an die Brüder Karamasow. Alexei und Iwan waren zwar ihre richtigen Vornamen, aber den Nachnamen Karamasow hatten sie sich aus einem Roman von Fjodor Dostojewski ausgeliehen. Keiner von uns wusste, wie sie wirklich hießen.
Am Ende des Zeitungsartikels stand, dass die Informationen über das Leben der Brüder aus einer sicheren Quelle stammten.
Ich war die sichere Quelle.
Aber ich selbst habe die Geschichte nicht von den Brüdern gehört.
Nein, ihre Geister haben mir alles erzählt.
Warte mal, sagen jetzt sicher einige von euch, ich bin neu hier und kenne die Kurzhosengang nicht so gut, und es scheint, dass das zwar alles nette Kerle sind, aber wieso spricht der Dicke da jetzt plötzlich mit Geistern?
Mit drei Jahren habe ich entdeckt, dass ich Geister sehen und mit ihnen reden kann. Mit Geistern rede ich aber nur in Gedanken, denn es würde verrückt aussehen, wenn ich immer laut vor mich hin quasseln würde. Wann immer ich einem Geist begegne und mit ihm plaudere, rutsche ich ein wenig aus der Zeit, was mich ausgesprochen langsam erscheinen lässt.
Ich bin langsam, aber so langsam nun auch nicht.
Meine Jungs wissen das, fast jeder weiß das, nachdem die Kurzhosengang in einer Talkshow aufgetreten ist und ich dieses Geheimnis ausgeplaudert habe. Aber ich kann nicht nur Geister sehen, ich sehe auch, ob jemand bald stirbt, weil sich dann sein Geist im Voraus zeigt. Ihr könnt euch also denken, wie traurig ich war, als ich den Geistern der Brüder das erste Mal vor zwei Wochen begegnet bin. Sie waren sehr gesprächig und erzählten mir die gesamte Lebensgeschichte der Brüder.
Und ich Blödmann habe ihnen jedes Wort geglaubt.
Jetzt saß ich zwei Stunden nach der Beerdigung der Brüder mit meinen Jungs hier im Rathaus und hörte kaum, was der Notar uns vorlas, weil ich unentwegt darüber nachdenken musste, dass ich angelogen worden war. Mich verwirrt so was ganz schön. Ich glaube, es verwirrt jeden, wenn er angelogen wird und erst später erfährt, dass er angelogen wurde. Da wundert man sich, was denn jetzt die Lüge war.
Ich schaute nach links.
Wieso habt ihr mich angelogen? fragte ich den Geist von Iwan, der es sich auf einem der Aktenschränke bequem gemacht hatte und mit den Füßen wippte.
Frag nicht mich, sagte er und zupfte an seinem Schnurrbart, frag Alexei.
Der Geist von Alexei stand auf der anderen Zimmerseite und starrte aus dem Fenster, als hätte er noch nie Schnee gesehen. Der Moment der Wahrheit war ihm ganz schön peinlich. Seine Schultern verrieten ihn. Sie waren hochgezogen und erinnerten an eine schmale Mauer, die nur dafür gebaut wurde, dass keiner Fragen stellte.
Für alle anderen im Raum waren die Geister der Brüder unsichtbar. Geister zeigen sich nur, wenn sie Lust dazu haben, denn es kostet sie viel Kraft. Das ist auch ganz gut so, denn sonst wären die Bewohner von Okkerville garantiert schreiend davongerannt, weil eine Menge Geister in unserer Stadt herumirrten.
Uns macht Lügen keinen Spaß, sagte der Geist von Alexei und wandte sich mir zu, aber in diesem Fall musste es sein.
Aber wieso?
Weil die Brüder es wollten.
Wieso wollten sie bitteschön, dass ihr mich anlügt?!
Achtung, sagte der Geist von Iwan, der Notar beobachtet dich.
Es stimmte, der Notar beobachtete mich, als würde mein Kopf jede Sekunde explodieren. Ich lächelte ihn an, er lächelte nicht zurück.
„Was ist mit dem Dicken los?“, fragte er meine Kumpels, als würde ich nicht direkt vor ihm sitzen. „Wieso schaut er von links nach rechts? Hat er einen Anfall?“
„Zement, hör mal auf so rumzugucken“, sagte Rudolpho.
Ich hielt den Kopf still und bereute es sehr, den Geistern der Brüder erlaubt zu haben, zur Testamentsverlesung mitzukommen. Die ganze Beerdigung über hatten sie mich genervt und gemeckert, dass die Rede von meinem Vater viel zu kurz sei und es viel bessere Dinge über die Brüder zu sagen gab. Nimm uns doch noch mit zur Testamentsverlesung, hatten sie mich gebeten. Danach verschwinden wir für immer, hatten sie versprochen. Ich wusste, ihnen war langweilig, und es gibt ja wohl nichts Nervigeres als Geister, die sich langweilen.
„Mehr gibt es nicht zu sagen“, schloss der Notar die Testamentsverlesung und nahm seine Brille ab. „Meine Arbeit ist getan und meine Zeit wirklich knapp. Ich werde jetzt …“
Er sah auf die Uhr über der Tür und erblasste.
„Ich habe mich verquasselt!“, rief er und wurde plötzlich so fahrig, dass wir zurückschreckten.
Von draußen erklang ein Geräusch, das an das aufgeregte Flattern eines Vogels erinnerte. Ein gewaltiger Schatten bewegte sich über das Rathaus hinweg und verschwand. Der Notar war kreidebleich.
„Müssen wir denn nichts unterschreiben?“, fragte Snickers.
„Dafür ist keine Zeit mehr“, antwortete der Notar und packte seine Sachen zusammen. Er ließ das Testament liegen und stürmte aus dem Zimmer, als wäre ihm ein Grizzly auf den Fersen. Wir hörten seine Schritte durch das Rathaus hallen, dann erklang von draußen ein Krachen, dem ein zweites Krachen folgte. Ein Autoalarm plärrte los und verstummte wieder. Danach wurde es so still, dass ich das Gefühl hatte, durch das geschlossene Fenster den Schneefall zu hören.
„Ganz schön still da draußen“, sagte Rudolpho.
„Ganz schön gruselig“, sagte Island.
„Wollen wir mal schauen?“, fragte Snickers.
Die Kurzhosengang rannte aus dem Büro, nur einer von ihnen rannte nicht wirklich, sondern blieb stehen. Ich war noch nicht fertig mit den Geistern der Brüder. Sie waren mir eine richtige Antwort schuldig. Wieso sollten die Brüder nicht gewollt haben, dass ich die Wahrheit über ihre Vergangenheit erfuhr? Das machte überhaupt keinen Sinn und sollte für mich auch weiterhin keinen Sinn machen, denn wohin ich auch schaute, die Geister der Brüder waren verschwunden.
„Feiglinge!“, rief ich einmal laut und folgte meinen Jungs nach draußen.
Ihr werdet gleich verstehen, warum wir den zwei Schriftstellern diese Geschichte nie erzählt haben. Die Niagarafälle hochzuschwimmen, wäre einfacher gewesen.
Victor und Yves sind zwei wirklich nette Kerle, aber wir wollten sie nicht überfordern. Und außerdem wollten wir nicht als vollkommen verrückt dastehen. Meine Mutter hat uns die Geschichte sofort geglaubt, weil sie uns alles glaubt. Niemandem sonst haben wir davon erzählt und hätten auf keinen Fall gedacht, dass uns die Schriftsteller erwischen würden. Aber so sind Schriftsteller nun mal – sie bekommen alles mit, auch wenn man es nur leise flüstert, spitzen sie ihre Ohren, und keine Geschichte entgeht ihnen.