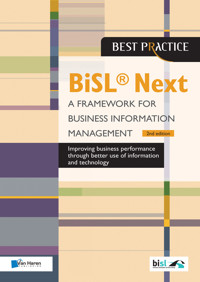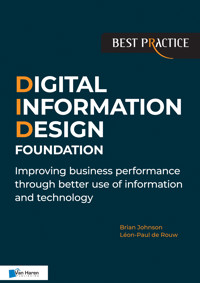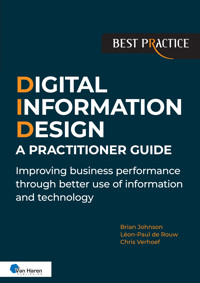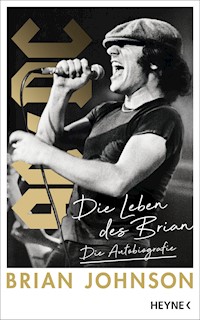
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit über 40 Jahren ist Brian Johnson Sänger von AC/DC, der erfolgreichsten Hard-Rock-Band aller Zeiten. Erstmals erzählt er jetzt sein Leben – eine der unterhaltsamsten Geschichten der Rock’n‘Roll-Geschichte überhaupt.
Brian wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Norden Englands auf – und schon früh stand für ihn fest: Er will Rocksänger werden. Über ein Jahrzehnt lang versuchte sich Brian Johnson später mit verschiedenen Bands einen Namen zu machen, doch der große Erfolg schien unerreichbar. Erst mit 31 Jahren – nach scheinbar gescheiterter Karriere, gescheiterter Ehe und einigen Gelegenheitsjobs – kam seine große Chance: Er wurde von AC/DC, schon damals eine der größten Rockbands der Welt, zum Vorsingen nach London eingeladen. Die Band steckte nach dem überraschenden Tod ihres Frontmanns in einer tiefen Krise und war auf Anhieb begeistert von dem ungekünstelten Mann aus dem Norden. Er bekam den Job! Es folgte eine einmalige Erfolgsgeschichte: Das erste gemeinsame Album »Back in Black« wurde zum meistverkauften Rockalbum aller Zeiten, zahllose ausverkaufte Tourneen schlossen sich an und die Fangemeinde wuchs immens. AC/DC – und Brian Johnson – haben Kultstatus.
Das abrupte Ende dieses Höhenfluges kam für Brian im Jahr 2016. Während einer Amerika-Tour verschlechterte sich sein Hörvermögen schlagartig, und er stand vor der Wahl: Entweder er hört sofort auf oder er riskiert einen kompletten Hörverlust. Das hätte für Brian Johnson beinah den Abschied aus der Welt der Musik bedeutet. Doch 2020 gelang ihm mit dem Erfolgsalbum »Power Up« die triumphale Rückkehr zur Band.
Eine Achterbahnfahrt durch das außergewöhnliche Leben eines Mannes, der bei allem Welterfolg seinen Wurzeln immer treu geblieben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Seit über 40 Jahren ist Brian Johnson Sänger von AC/DC, der erfolgreichsten Hard-Rock-Band aller Zeiten. Erstmals erzählt er jetzt von seinem Leben.
Brian wuchs in bescheidenen Verhältnissen in einer nordenglischen Arbeiterstadt auf – und schon früh stand für ihn fest: Er will Rocksänger werden. Über ein Jahrzehnt lang versuchte er sich mit verschiedenen Bands einen Namen zu machen, doch der große Erfolg schien unerreichbar. Erst mit 31 Jahren – als er sich nach scheinbar schon gescheiterter Karriere mit diversen Gelegenheitsjobs über Wasser hielt – kam seine große Chance: Er wurde von AC/DC zum Vorsingen nach London eingeladen – schon damals eine der größten Rockbands der Welt. Die Band steckte nach dem Tod ihres Frontmanns Bon Scott in einer tiefen Krise und war auf Anhieb begeistert von Brian Johnson. Er bekam den Job!
Was folgte, ist eine einmalige Erfolgsgeschichte: Das erste gemeinsame Album Back in Black wurde zum meistverkauften Rockalbum aller Zeiten, zahllose ausverkaufte Tourneen schlossen sich an, und die Fangemeinde wuchs immens. AC/DC – und Brian Johnson – haben Kultstatus.
Das abrupte Ende dieses Höhenfluges kam für Brian im Jahr 2016. Während einer Amerika-Tour verschlechterte sich sein Hörvermögen schlagartig. Das hätte für Brian Johnson beinah den Abschied aus der Welt der Musik bedeutet. Doch 2020 gelang ihm mit dem Erfolgsalbum Power Up die triumphale Rückkehr zur Band.
Eine der unterhaltsamsten Geschichten aus der Welt des Rock’n’Roll!
Über den Autor
Brian Johnson ist Leadsänger von AC/DC, einer der erfolgreichsten Rock-Bands der Welt. Nachdem er 1980 zur Band stieß, feierte die Gruppe um Angus und Malcolm Young ihre größten Erfolge mit Alben wie Back in Black, For Those About to Rock, Razor’s Edge, Black Ice und Power Up. Brian Johnson lebt in Sarasota, Florida.
BRIAN JOHNSON
DIE LEBENDES BRIAN
Die Autobiografie
Aus dem Englischen von Daniel Müller und Sven Scheer
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Lives of Brianbei Michael Joseph, an imprint of Penguin. Penguin is part of the Penguin Random House group of companies.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © Brian Johnson, 2022
© der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwickies
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von Doug Griffin/Toronto Star via Getty Images
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-28973-7V002
www.heyne.de
Für meine Urururenkel, die ich nie kennenlernen werde. Es ist schön, zu wissen, dass wir auf diese Weise miteinander verbunden sind. Ich wünsche euch das Allerbeste im Leben, wer auch immer ihr seid.
In Liebe, euer Urururgroßvater Brian Johnson
Inhalt
Vorwort
Prolog
TEILEINS
1Alan und Esther
2Brianuk
3A-Wop Bop A-Loo Bop
4Klein, aber gemein
5Ein hartes Geschäft
6Lehrjahre
7Eine kleine Rockmusik
8Um ein Haar
TEILZWEI
9Ups
10Ein erbärmliches Stück Scheiße
11Geordie Boy
12Wardour Street
13Highway ins Nichts
14Blinder Passagier
15Gerichtsvollzieher-Blues
16Ein Zeichen von oben
TEILDREI
17Lobley Hill
18Überlegene Saugkraft
19Der Tag des Grand National
20Abschiede
21Willkommen im Paradies
22Rollender Donner
23Back from Black
24Zielgerade
Epilog
Rock’n’Roll-Stammbaum
Dank
Bildnachweis
Register
Bildteil
Vorwort
Erfahrung ist das, was man kriegt, wenn man nicht das bekommt, was man eigentlich will.
In diesem Buch schildere ich, was passierte, als ich nicht das bekam, was ich wollte, aber trotzdem unbeirrt an meinen Traum glaubte und nie aufgab. Natürlich spielte auch Glück eine Rolle – dennoch bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man so ziemlich alles erreichen kann, wenn man es nur wirklich will und nicht bloß rumsitzt und wartet.
Manch einer wird die Ereignisse, von denen ich auf den folgenden Seiten berichte, anders in Erinnerung haben. Immerhin sind seit der Entstehung von Back in Black mehr als vierzig Jahre vergangen – und ein halbes Jahrhundert seit den glorreichen Tagen meiner ersten Band Geordie. Dies ist lediglich meine Version der Geschichte.
Ich möchte Angus, Malcolm, Cliff und Phil dafür danken, dass sie das Risiko eingegangen sind und mir in der schwierigsten Situation, in die eine Band geraten kann, eine zweite Chance auf eine Karriere als Musiker eröffnet haben. Malcolm, mein Freund, falls es so etwas wie ein Jenseits gibt, werde ich dir und Bon ein Bier ausgeben, wenn wir uns dort wiedersehen.
B. J. – London, 2022
Prolog
Ich hatte in meinem Leben schon einige harte Schläge eingesteckt. Aber dieses Mal war es anders.
Ohne ein handfestes Wunder, das spürte ich, würde ich mich nicht wieder berappeln und zurück auf die Beine kommen.
Die ersten Hinweise darauf, dass ich in Schwierigkeiten steckte, gab es in Edmonton, Kanada.
Ende September 2015 waren wir mit AC/DC bei der Halbzeit unserer Rock or Bust World Tour angekommen und spielten im Commonwealth Stadium, der größten Open-Air-Arena des Landes, die mit mehr als sechzigtausend Menschen bis auf den letzten Platz gefüllt war. Es war bitterkalt, und vor der Bühne schüttete es wie aus Kübeln.
Angus plagte bereits heftiges Fieber, und ich spürte, dass es mich ebenfalls erwischt hatte.
Den Leuten machte das Wetter anscheinend nicht das Geringste aus. Kanadier eben. Aber gut, sie waren auch in diese Klamotten eingepackt, die man nur nördlich der US-Grenze kriegt und die einen vor tosenden Schneestürmen genauso schützen wie vor schlecht gelaunten Eisbären.
Wir dagegen hatten nur unsere übliche Bühnenkluft an. Ich ein schwarzes T-Shirt und Jeans. Angus seine Schuluniform, bestehend aus einem dünnen weißen Hemd und kurzen Hosen. Immerhin war es auf der Bühne trocken, und die Scheinwerfer spendeten ein wenig Wärme, aber um den Fans nahe zu sein, trieb es Angus und mich wie immer raus auf den Laufsteg. Den größten Teil der Show verbrachten wir dort draußen. Nach ein paar Songs waren wir von dem vielen Rumrennen derart ins Schwitzen gekommen, dass es uns einen Dreck scherte, ob wir bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bis auf die Knochen nass wurden.
Zwei Stunden, neunzehn Songs und einige Zugaben später verließen wir die Bühne. Ein super Gig. Der Sound auf der Bühne war perfekt gewesen. Die Fans hatten geschrien, gejubelt, mitgesungen. Angus hatte wie ein Besessener gespielt. Doch uns blieb keine Zeit, das alles noch ein wenig zu genießen – das nächste Konzert wartete schon. Also verabschiedeten wir uns und stiegen in die Kleinbusse, die uns direkt zum Flughafen brachten.
Als wir in den Jet nach Vancouver kletterten, verflüchtigte sich das Adrenalin vom Konzert allmählich, und der Körper begann seinen Tribut zu fordern.
Ich zitterte ununterbrochen.
Mir kam der Gedanke, dass es für jemanden, der in einer Woche seinen achtundsechzigsten Geburtstag feiern würde, vielleicht nicht die beste Idee gewesen war, so viel Zeit im eiskalten Regen zu verbringen.
Andererseits ging es Angus auch nicht viel besser, dabei war er noch ein junger Hüpfer von gerade mal sechzig Lenzen.
Eine Tournee ist immer anstrengend, beruhigte ich mich, unabhängig vom Alter. Ein gelegentlicher grippaler Infekt zwischen den Konzerten gehört einfach dazu.
Ich bestellte ein großes Glas Whisky, und der Alkohol tat seine Dienste, während Angus sich wie üblich einen Becher heißen Tee genehmigte. Ehe wir uns versahen, waren wir in Vancouver gelandet und auf dem Weg ins Hotel.
Aber irgendetwas stimmte nicht.
Mit meinen Ohren.
Sie waren nicht wieder aufgeploppt.
Ich probierte die bewährten Tricks, gähnte, schluckte, schnäuzte mich bei zugehaltener Nase. Nichts half. Schließlich gab ich auf. Sie würden über Nacht schon wieder von allein aufgehen.
Doch als ich am nächsten Morgen aufwachte … Verdammte Scheiße. Ich fühlte mich, als würde mein Kopf in einer Bärenfellmütze stecken.
Ich konnte sogar noch schlechter hören als am Abend zuvor.
Beim Frühstück brachte ich es nicht über mich, den anderen davon zu erzählen. Wenn du der Sänger einer Band bist, verlassen sich Musiker, Crew, Management, Techniker, Stagehands, Plattenfirma und insbesondere Hunderttausende Fans darauf, dass du auf die Bühne gehst und deinen Job machst.
Irgendwann würden meine Ohren schon wieder aufgehen, beschwichtigte ich mich abermals.
Das hatten sie schließlich immer getan.
Als wir am Abend die Bühne des BC Place betraten – diesmal ein überdachtes Stadion –, hatte Angus anscheinend das Schlimmste überstanden. Ich dagegen schlug mich immer noch mit meinem Leiden herum.
Und so kam es zur Katastrophe.
Nach ungefähr zwei Dritteln des Auftritts konnte ich die Gitarren nicht mehr klar hören und hatte Probleme, die richtigen Töne zu treffen. Ich kam mir vor, als wäre ich mit dem Auto in eine Nebelwand gefahren – von einem Moment auf den anderen waren alle Orientierungspunkte weg. Es war das Furchtbarste, was ich als Sänger je erlebt hatte. Noch beängstigender wurde es durch die Tatsache, dass noch einige Songs vor uns lagen – und das vor Zehntausenden zahlenden Fans. Aber irgendwie schaffte ich es bis zum Ende, und falls irgendwem etwas aufgefallen war, verkniff er sich eine Bemerkung.
Auf dieser Etappe der Tour standen nur noch zwei Konzerte an – im AT&T Park in San Francisco und im Dodger Stadium in Los Angeles –, also redete ich mir ein, dass ich durchhalten könne. Und dass meine Ohren irgendwann wieder funktionieren würden. Alles andere erschien mir schlicht unvorstellbar.
Aber bei beiden Konzerten passierte es wieder. Nach zwei Dritteln der Show fing ich an zu schwimmen und fand die Tonart der Songs nicht mehr. Doch fast noch schlimmer: Nach den Konzerten konnte ich den Gesprächen in der Garderobe und später im Restaurant nicht folgen. Ich lächelte, nickte hin und wieder und tat einfach so, als wäre alles in Ordnung.
Doch insgeheim erfasste mich Panik.
Seit Angus mit seinem Bruder Malcolm im Jahr 1973 AC/DC gegründet hatte – zunächst mit Dave Evans als Sänger, dann mit dem großen Bon Scott und schließlich mit meiner Wenigkeit –, kannte die Band immer nur ein Motto: alles oder nichts.
Man denke etwa an unsere riesigen Lautsprechertürme. Viele Bands verwenden Attrappen, um diesen aggressiven, Furcht einflößenden Look zu erzielen. Nicht AC/DC. Bei AC/DC hörst du, was du siehst – und was du hörst, ist die lauteste Band der Welt.
Dann ist da Angus.
Die Intensität, die dieser Kerl auf die Bühne bringt, die unbändige Energie, mit der er mehr als zwei Stunden lang über die Bretter tobt, ist fast schon beängstigend. Er kann nicht eine Sekunde lang auch nur einen Gang runterschalten. Wenn er nach einem Konzert in die Garderobe kommt, ist er völlig ausgelaugt und muss erst mal ein paar Züge aus der Sauerstoffflasche nehmen.
Abseits der Bühne ist Angus ein netter, sanftmütiger Kerl von knapp einem Meter sechzig. Aber bei einem Konzert geht etwas mit ihm vor. Er wird ein anderer. Wenn er vor der Show pinkeln geht, ist er noch Angus. Doch wenn er dann zurück ist und am Bühnenrand wartet, ist er nicht mehr ansprechbar. Ihm in die Augen schauen und kurz noch eine gute Show wünschen? Vergiss es!
Es gibt ihn dann einfach nicht mehr. Dr. Jekyll hat sich in Mr. Hyde verwandelt.
Und dann legt er los, in seiner Schuljungenkluft, mit der Gibson um den Hals, streckt der Menge die Faust entgegen, und fünfzig-, sechzig- oder sogar hunderttausend Fans drehen komplett durch. Ohne dass er auch nur eine Note gespielt hätte. Nur wegen der Pose. Und seines wilden Blicks. Wer sonst kann das? Vielleicht früher mal Elvis Presley oder Freddie Mercury. Doch jetzt schafft das nur noch Angus. Und wie der Kerl sich bewegt! Die Hüften. Die Beine. Einfach alles. Mit seinem Chuck-Berry-Move macht er sogar Chuck Berry Konkurrenz. Wenn man das auf der Bühne aus nächster Nähe miterlebt, haut es einen aus den Socken.
Natürlich hatte Angus fast während der gesamten Geschichte von AC/DC einen kongenialen Widerpart in der Band – Malcolm. Sämtliche Young-Kinder – die in Glasgow zur Welt kamen, doch zu Beginn der 1960er-Jahre mit ihren Eltern nach Sydney in Australien auswanderten – waren musikalisch. Ein weiterer Bruder, George, war als Mitglied von The Easybeats einer der bekanntesten australischen Popstars und schrieb mit »Friday on My Mind« sogar einen der größten Songs aller Zeiten.
Malcolm konnte es in puncto Intensität locker mit seinem jüngeren Bruder aufnehmen. Allerdings suchte er nie das Rampenlicht. Er stürmte immer nur kurz zum Mikrofon, um seinen Gesangspart abzuliefern, danach zog er sich wieder zu seinem Boxenturm zurück und blieb im Hintergrund. Aber man sollte sich nicht täuschen – Malcolm war das Herz der Band.
In den unzähligen gemeinsamen Jahren auf Tour mit Malcolm habe ich miterlebt, dass irgendwann so ziemlich jeder große Gitarrist zu ihm kam und wissen wollte, wie er den dicken Saiten auf seiner abgewetzten Gretsch mit den zwei ausgebauten Pickups diesen Sound entlockte.
»Ich hau einfach fest drauf«, erklärte er mit einem Achselzucken, als wäre das keine große Sache.
Malcolm verfügte außerdem über die unheimliche Fähigkeit, gleichzeitig die Bewegungen aller Bandmitglieder im Blick zu behalten, ihrem Spiel zu lauschen und die Reaktion des Publikums zu studieren, um nach der Show die Art von Feedback zu liefern, die man vielleicht nicht unbedingt gern hörte, die aber dem Konzert am nächsten Abend zugutekam. Ich habe nie einen anderen Musiker kennengelernt, der einen solchen Respekt bei Bandkollegen und Crew genossen hätte.
Aber selbst eine Alles-oder-nichts-Band wie AC/DC muss sich manchmal den Rückschlägen und Tragödien beugen, die das Leben on the road unvermeidlich mit sich bringt.
Ein Jahr vor der Rock or Bust World Tour musste Malcolm die Band verlassen, um sich wegen Demenz behandeln zu lassen. Er hatte schon seit der Black Ice Tour 2010 unter Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen gelitten. Also zog er sich zurück, und sein Neffe Stevie übernahm für ihn.
Es war der größte Schock für die Band seit dem Tod von Bon fünfunddreißig Jahre zuvor.
Aber es sollte nicht der einzige Schock bleiben. Der Meister am Bass, Cliff Williams – bei AC/DC als Junge aus Essex das Gegenstück zu mir als Geordie-Boy1 und seit 1977 Mitglied der Band – gab bekannt, dass Rock or Bust seine letzte Tournee sein würde. Außerdem musste Phil Rudd aussteigen, weil er in Neuseeland mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, sodass Chris Slade – der bereits auf The Razors Edge gespielt hatte – die Drums übernahm.
Und dann – nun, da war noch ich.
Es ist seltsam, etwas zu meiner eigenen Rolle bei AC/DC zu sagen – geschweige denn zu meiner eigenen Stimme. Man muss schon ein entfesseltes Tier sein, um diese Noten in »Back in Black«, »Thunderstruck« und »For Those About to Rock« zu treffen. Vor einer Show fühle ich mich, als würde ich bei den Olympischen Spielen im Startblock zum 100-Meter-Sprint hocken. Ich weiß in diesem Moment, dass ich alles geben muss, um diese Art von Kraft, Wut und Energie in meinen Gesang zu legen und in jedem einzelnen Song aufrechtzuerhalten. Es ist, als würde man mit aufgesetztem Bajonett singen.
Aber ohne etwas zu hören?
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass nach fünfunddreißig Jahren in der Band vielleicht auch mein Ende nahte.
Im Anschluss an die drei Gigs, bei denen ich die Gitarren nicht hatte hören können, lag ein freier Oktober vor uns. Ich hoffte, dass das reichen würde, um Körper und Ohren eine Pause zu gönnen und sie wieder auf Vordermann zu bringen.
Aber zurück im heimischen Sarasota, Florida, wurde mir immer klarer, dass etwas nicht stimmte, und zwar ganz und gar nicht. Meine Ohren waren bereits seit sechs Wochen dicht.
Ich musste mir Hilfe suchen.
Der Startschuss zur nächsten Tour-Etappe sollte in Sydney fallen. Zufällig wusste ich, dass dort einer der besten HNO-Ärzte der Welt praktizierte: Dr. Chang. Ich beriet mich mit unserem Tourmanager Tim Brockman und beschloss, zehn Tage früher loszufliegen, um meine Ohren gründlich durchchecken zu lassen. Zudem wusste ich, dass Malcolm wegen seiner Demenz in der Nähe behandelt wurde, und hoffte, ihn besuchen zu können.
Es war eine riesengroße Erleichterung, Dr. Chang zu treffen und endlich jemandem erzählen zu können, was los war. Aber dieses Gefühl währte nicht lange. Nach der Untersuchung und einigen Tests wurde er todernst und erklärte, er müsse mich operieren.
»Nach der Tour?«, fragte ich.
»Nein, jetzt sofort«, erwiderte er.
Dr. Chang erklärte mir, dass sich bei der fiebrigen Erkältung in Edmonton Flüssigkeit in meinen Ohren angesammelt habe. Durch den Flug nach Vancouver sei es dann zu einer Schwellung gekommen, sodass die Flüssigkeit eingeschlossen worden sei. Deshalb seien meine Ohren nicht aufgegangen. Und weil ich die Tour fortgesetzt hatte, statt mich behandeln zu lassen, war die Flüssigkeit kristallisiert und würde nun immer größeren Schaden anrichten, je länger sie im Ohr blieb. Sie musste sofort entfernt werden.
»Wird nach der Operation alles wieder gut?«, fragte ich.
»Das weiß ich nicht«, antwortete Dr. Chang. »Aber auf jeden Fall sollten wir es versuchen, damit es nicht noch schlimmer wird.«
»Aber in zehn Tagen habe ich einen Gig …«
»Wir werden alles tun, damit es Ihnen bis dahin besser geht.«
»Noch etwas, Dr. Chang«, sagte ich, mittlerweile ziemlich nervös. »Wie holen Sie die Kristalle heraus?«
»Sind Sie sicher, dass Sie das wissen wollen?«
»Ähm, ja …?«
»Mit einem Meißel.«
Er machte nicht den Eindruck, als würde er scherzen.
1Anm. d. Ü.: Als Geordies werden die Bewohner von Newcastle und Umgebung bezeichnet.
1
Alan und Esther
Der Soundtrack meiner frühen Kindheit bestand aus dem Rattern der Nähmaschine meiner Mutter und dem anschließenden dumpfen Schluchzen, wenn sie sich Nacht für Nacht in den Schlaf weinte.
Meine Mama war Italienerin – ihr Mädchenname lautete Esther Maria Victoria Octavia De Luca. Nach dem Krieg war sie meinem Vater in den Nordosten Englands gefolgt, ohne eine Vorstellung davon zu haben, dass es dort vollkommen anders sein würde als in ihrer Heimatstadt Frascati vor den Toren Roms.
Ich kann nur ahnen, wie schwer ums Herz der Ärmsten geworden sein muss, als sie zum ersten Mal nach Gateshead kam, auf der Südseite des Flusses Tyne gegenüber von Newcastle gelegen. Genauer: nach Dunston, den Stadtteil, aus dem mein Vater stammte. Die Fabriken und Kohlegruben. Die Reihenhauszeilen an den steilen Hängen der Scotswood Road. Die rußgeschwärzten Männer, die von der Arbeit nach Hause trotteten. All die zerbombten Häuser. Der ständige Wind und Regen.
Als wäre das alles nicht schon schlimm genug gewesen, blieben Lebensmittel noch volle neun Jahre, nachdem wir den Krieg »gewonnen« hatten, rationiert. Die britische Angewohnheit, das Essen so lange zu kochen, bis auch das letzte Atom zerfallen war und nur ein grauer Schleim übrig blieb, machte es außerdem völlig ungenießbar.
Aber Hut ab vor meinem Vater – er hatte in der Durham Light Infantry gedient, zuerst in Nordafrika und dann in Italien, wo er meiner Mutter über den Weg gelaufen war –, dass er überhaupt so eine wunderschöne junge Frau aus gutem Hause überzeugen konnte, ihn in seine Heimat zu begleiten.
Noch beeindruckender war dieser Coup deswegen, weil meine Mutter damals mit einem stattlichen, gut aussehenden italienischen Zahnarzt verlobt war, der wahrscheinlich auf einen klangvollen Namen wie Alessandro oder Giovanni hörte, während mein Vater ein einfacher Geordie-Sergeant namens Alan von nicht mal einem Meter sechzig war. Doch die geheime Trumpfkarte meines alten Herrn war seine Stimme. Volltönend und gebieterisch brachte sie einen noch aus tausend Metern Entfernung dazu, strammzustehen und sich dabei vor Angst in die Hosen zu machen. Selbst wenn er nur irgendetwas brummte, was er oft tat, brachte er es irgendwie fertig, dass die Worte laut und furchterregend klangen. Das Geheimnis seines Erfolgs bei meiner Mutter: Er lernte ihre Heimatsprache und versprach ihr, auch in England Italienisch mit ihr zu reden. Dieses Versprechen hielt er tatsächlich für den Rest seines Lebens. Wir Kinder lauschten ihnen und verstanden nicht, warum sonst niemand so redete. Dass in der Schule Englisch gesprochen wurde, war für uns verwirrend.
Mein Vater hatte sich 1939, kurz vor der allgemeinen Mobilmachung, zum Militär gemeldet, um der Maloche in den Kohlegruben zu entkommen. Doch dann marschierte Hitler in Polen ein, Großbritannien erklärte Deutschland den Krieg, und ehe er sich versah, wurde der damalige Gefreite Johnson nach Nordafrika verlegt, um als Angehöriger der Wüstenratten zu kämpfen. Wie jeder Geschichtsinteressierte wissen dürfte, war das Deutsche Afrikakorps in Hinblick auf die Kampfkraft zu Kriegsbeginn den Briten weit überlegen. Insofern grenzt es an ein Wunder, dass mein alter Herr zwei blutige Jahre in der tunesischen Wüste überlebte. Aber er hat nicht einfach nur überlebt, sondern stieg sogar zum Sergeant auf. Zugegeben, große Konkurrenz gab es bei den Beförderungen nicht, da die meisten Anwärter bereits vorher fielen.
Auch mein Vater wäre beinahe nicht heil zurückgekehrt.
Am brenzligsten wurde es für ihn, als er in einem Lastwagen saß, der vor die 20-mm-Fliegerabwehrkanone eines deutschen Halbkettenfahrzeugs fuhr. Rund zwei Sekunden nach Sichtkontakt wurden der Lastwagen und alle, die sich noch darin befanden, zu Staub und Asche verwandelt. Mein Vater und ein paar seiner Kameraden hatten es aber vorher gerade noch geschafft, rauszuspringen und sich in einer nahen Höhle in Sicherheit zu bringen. Die Deutschen richteten ihre Kanone auf das Versteck und feuerten weiter, bis ihnen langweilig wurde. Als der Beschuss endlich aufhörte, hatte mein Vater als Einziger in dem Unterschlupf überlebt. Als er wieder rauskroch, war er überzeugt, dass die Deutschen ihn beobachteten. Doch sie ließen ihn laufen. Wahrscheinlich hatten sie einfach keine Lust, sich mit einem traumatisierten Kriegsgefangenen abzuplagen, der sich kaum auf den Beinen halten konnte.
Das hieß allerdings nicht, dass er in Sicherheit war. Mühselig schlug er sich mehrere Kilometer bis zur nächsten alliierten Stellung durch, wo der britische Wachposten in Panik geriet und das Feuer eröffnete. Doch glücklicherweise verfügte mein Vater über eine noch durchschlagendere Waffe: seine Stimme. »Ich bin britischer Sergeant, du Idiot!«, brüllte er. »Und du musst mich nach der Losung fragen!«
Eine verlegene Pause entstand, gefolgt von einem Hüsteln. »Äh … Entschuldigung, Sarge. Wie lautet die Losung?«
»Weiß ich nicht mehr! Lass mich einfach rein!«
Schließlich gelangten mein Vater und seine Einheit nach Sizilien – was ihnen eine Einladung zur knapp fünfmonatigen Schlacht von Anzio eintrug. Es war ein Riesenschlamassel, bei dem Zehntausende Männer getötet oder verwundet wurden und das Zögern des US-Befehlshabers Major General John Lucas dazu führte, dass mein Vater und seine Kameraden am Strand von Nettuno festsaßen, nachdem sie mit den britischen Truppen nur wenige Kilometer entfernt gelandet waren.2 Aber auch dies überlebte Sergeant Johnson, um später davon zu berichten.
Als alles vorbei war, hatte mein Vater so viel Blutvergießen und Elend gesehen, dass er zum eingefleischten Atheisten wurde. Allerdings behielt er das für sich, als er nach Rom kam und ihm aufging, dass die Stadt voller wunderschöner junger katholischer Frauen war, die nur darauf warteten, im Sturm erobert zu werden.
Die Leben meiner Eltern vor dem Krieg hätten unterschiedlicher nicht sein können.
Die De Lucas waren wohlhabend und besaßen ausgezeichnete Verbindungen. Auf Fotos aus den 1930er-Jahren sehen sie so sorglos, glücklich und braun gebrannt aus wie Filmstars. Im Nordosten von England gab es Menschen wie sie einfach nicht.
Von meiner Mutter und ihren Schwestern wurde erwartet, dass sie eine gute Partie landeten, und genau das taten sie auch. Eine meiner italienischen Tanten ehelichte den Besitzer einer Fliesenfabrik. Eine andere heiratete in eine Familie ein, die bis heute eine Pharmazie- und Drogeriehandelskette besitzt. Und einer meiner Cousins auf der De-Luca-Seite, Giacomo Christofanelli, gehörte lange dem italienischen Parlament an.
»Liebe auf den ersten Blick«, so beschrieb meine Mutter die Begegnung mit meinem Vater im Nachkriegs-Rom. Er habe ausgesehen wie der US-amerikanische Filmstar George Raft, der in den 1930er-Jahren im ersten Scarface-Film und später dann in Manche mögen’s heiß mitgespielt hatte. Sicher, Sergeant Johnson gehörte zu den eher klein geratenen Vertretern seiner Spezies, aber da sie selbst von eher zierlicher Gestalt war, störte sie das nicht.
Manchmal wünsche ich mir, ich hätte die Version meines Vaters kennenlernen dürfen, in die sich meine Mutter verliebte – ein freundlicher, witziger Mann, für den alles wie geschmiert lief. Der Krieg war nicht nur vorbei, sondern gewonnen, und in Dunston erwartete ihn ein »home for heroes«. Doch diese Seite von ihm haben wir Kinder nie zu sehen bekommen.
Als Rom an die Alliierten fiel, war es für das britische Militär eine Horrorvorstellung, dass die Soldaten weiblichen Feindkontakt haben könnten, vor allem mit Katholikinnen. Die Armeeführung unternahm alles, um Liebeleien zu unterbinden. Die siegreichen britischen Soldaten sollten den Mädchen in der Heimat vorbehalten bleiben. Aber mein Vater war ein gewitztes Kerlchen. Ihm war klar, dass man ihm keine Steine in den Weg legen konnte, wenn er selbst zum Katholizismus übertrat. Zudem ging er davon aus, dass er damit seine Chancen bei der Familie meiner Mutter verbessern könnte, die außer sich war über die Auflösung ihrer Verlobung mit dem gut aussehenden Zahnarzt.
Doch kaum hatte mein Vater den Kater nach der Feier seiner Heimkehr überstanden, musste er erkennen, dass es für Sergeant Johnson keine Verwendung mehr gab. Ich meine, er hatte nicht viel mehr drauf, als Deutsche abzuknallen – und von denen gab es nach dem Krieg in Dunston nicht gerade viele. Die Amerikaner warfen zwar für den Wiederaufbau Europas die Gelddruckmaschinen an, doch Großbritannien quetschten sie wegen seiner Schulden aus. Für die heimkehrenden Soldaten wie meinen Vater – der eine Ehrenmedaille per Post bekam und aus dem Dienst entlassen wurde – fühlte es sich eher so an, als hätten wir den Krieg verloren, nicht gewonnen. Alles war zerbombt und kaputt. Es gab kein Geld für gar nichts. Der erste britische Autobahnabschnitt wurde nicht vor 1958 eröffnet und damit später als in fast allen anderen europäischen Ländern. Die einzige Arbeit, die mein Vater fand, war eine Stelle in der Gießerei Smith Patterson in Blaydon in der Grafschaft Durham, wo alle möglichen Metallgussteile hergestellt wurden, von Kanaldeckeln bis zu Eisenbahnschienen. Seine Aufgabe war es, die Öfen von innen zu reinigen – eine derart widerliche Arbeit, dass er sich manchmal wünschte, er wäre wieder in der Wüste und würde von Nazis beschossen.
Die Gießerei stellte ihm noch nicht mal einen Overall, Handschuhe oder eine Schutzbrille. Wie alle anderen Arbeiter trug er einfach seine normale Straßenkleidung und band sich ein Taschentuch vors Gesicht. Für den armen Kerl muss das eine Qual gewesen sein, denn als ehemaliger Sergeant legte er großen Wert auf eine tadellose Erscheinung.
Meine Ma war bereits bei ihrer Abfahrt aus Italien schwanger mit mir. Am 5. Oktober 1947 schließlich machte meine Geburt die beiden zu Mutter und Vater. Ein Jahr darauf kam mein Bruder Maurice zur Welt, ein weiteres Jahr später mein jüngster Bruder Victor. Als letztes der Johnson-Kinder wurde fünf Jahre nach mir meine kleine Schwester Julie geboren.
Einen Kredit aufzunehmen, kam für meinen Vater wegen seines mickrigen Lohns nicht infrage, und die Wartezeit für eine Sozialwohnung betrug zehn Jahre. Daher mussten er und meine Mutter bei seinen Eltern in der Oak Avenue 1 in Dunston einziehen, wo bereits diverse andere Familienmitglieder lebten. Eins davon war mein unverheirateter Onkel Norman, ein Widerling, der so breit wie hoch war und sich gern beim Abendessen mit der Gabel in verschiedenen Körperöffnungen herumkratzte. Daneben gehörten auch meine Tante Ethel und ihre Tochter Annette zum Haushalt, beide so zäh wie ausgelatschte Lederstiefel, außerdem Tante Ethels reizender Ehemann, ein schottischer Bergmann, den ich als »Onkel Shughie« kennenlernte. Selbstverständlich hieß er nicht wirklich Shughie – es klang nur so aus Tante Ethels Mund. Dann war da noch mein Onkel Billy mit seinem Menjoubärtchen, der penibel auf seine Kleidung achtete und einen Vorkriegs-Vauxhall fuhr.
Nach der Geburt von mir und meinen drei Geschwistern war es ein siebzehnköpfiger Haushalt – oder wie es die Nachbarn ausdrückten: »Eine verdammte Schande!«
Meine Mutter konnte damals so gut wie kein Englisch, aber selbst als sie immer mehr Brocken aufschnappte, sprach sie es zu Hause beinahe nie. Das Italienisch meines Vaters wiederum wurde durch einen schweren Geordie-Akzent verunstaltet. Wenn meine Mutter ihn nicht verstand, wiederholte er das Gesagte einfach noch mal, nur lauter. Beides stieß bei den anderen Johnsons im Haus nicht gerade auf Gegenliebe, nicht zuletzt, weil sie eben noch im Krieg mit Italien gewesen waren und Ausländer hassten. Sogar mein seliger Großvater bezeichnete seine eigenen Enkelkinder insgeheim als »italienische Schweine«.
Man darf nicht vergessen: Das war das Dunston der 1940er-Jahre. Abgesehen von den französischen Zwiebelverkäufern mit ihren Baskenmützen und Gauloises gab es kaum Ausländer. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich als kleines Kind nicht einen einzigen Schwarzen oder Asiaten zu Gesicht bekommen – und da es sich um eine solch geschlossene Gesellschaft handelte, schlug Außenseitern ziemliches Misstrauen entgegen. Selbst Leute aus Sunderland wurden beschimpft. Schotten galten de facto als Außerirdische. Wahrscheinlich weigerte ich mich deshalb, als Kind Italienisch zu lernen. Ich wollte nicht auffallen, sondern einfach nur dazugehören.
Am schlimmsten hackte Tante Ethel auf uns »Ausländern« herum. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen dreht sich um den Tag, an dem Tante Ethel mich im Alter von vier Jahren zur Post mitnahm, ein Fußmarsch von gut einem Kilometer. Obwohl es Winter war und schneite, hatte sie mir weder Socken noch Schuhe angezogen. »Ihr Scheißausländer braucht das nicht«, schnaubte sie.
Als wir bei der Post ankamen, glich ich einem Eiswürfel in Kindergestalt. Die ältere Dame hinter dem Schalter bekam beinahe einen Herzinfarkt, als ihr Blick auf mich fiel. »Was denken Sie sich eigentlich?!«, schrie sie Tante Ethel an. Aber die erklärte nur: »Das ist schon in Ordnung so, ist ja praktisch ein Ausländer, der Kleine.« Die ältere Dame schnappte sich ein Handtuch und wickelte es mir um die Füße, während ihr Mann im Laden nebenan einen Lutscher für mich holte. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Ich weiß nur noch, dass die Dame vom Postamt Tante Ethel anschnauzte: »Sie sind ein dummes, dummes Weibsstück – der Kleine wird sich noch den Tod holen!«
Die Vorstellung, wie allein sich meine Mutter nach dem Krieg gefühlt haben muss, lässt mich noch heute erschaudern. Die Frauen aus unserer Straße – die mir als Kind uralt vorkamen, auch wenn sie vermutlich erst in ihren Zwanzigern oder Dreißigern waren – trafen sich jeden Tag an der Ecke, mit ihren Kopftüchern und Einkaufstaschen, und tratschten dort stundenlang. Doch meine Mutter verstand kaum Englisch und noch weniger den breiten Geordie-Akzent. Im Lauf der Jahre erkannten die Nachbarn jedoch, welch liebenswertes, freundliches und großzügiges Wesen sie hatte. Sie war stets fröhlich und lächelte immer, verschenkte selbst gekochtes Essen und besserte die Kleidung der Leute aus. Und die Herzlichkeit, mit der sie ihnen »Allo!« zurief, wirkte einfach ansteckend.
Doch in den ersten Jahren bewahrte nur die Nähmaschine meine Mutter davor, durchzudrehen. Zuerst hatte sie ein fußbetriebenes Tischgerät, dann eine kleine elektrische Singer. Sie saß den ganzen Tag bis tief in die Nacht daran – und sie war wirklich eine unglaubliche Schneiderin. Schließlich baute sie sich sogar ein kleines Geschäft auf, indem sie für sämtliche Bräute der Gegend Hochzeitskleider nähte. Ganz zu schweigen von den Bühnenoutfits für einen gewissen jungen Kerl, als dieser eine Karriere als Sänger einschlug …
Meine Mutter liebte es außerdem zu stricken. Sie strickte einfach alles. Schlupfmützen. Fäustlinge. Teewärmer. Pullover. Einmal kamen die Johnsons auf die Idee, einen Tag am Meer zu verbringen – wobei es sich bei dem Meer um die Nordsee handelte, die nur ein winziges bisschen wärmer ist als die Arktische See. Aus dem Anlass strickte sie für mich und meine Brüder Badehosen, weil wir uns keine richtigen leisten konnten. Sie waren dunkelblau und wurden von alten Schlüpfergummis oben gehalten. Ich sollte wohl hinzufügen, dass wir noch nie einen Fuß ins Meer gesetzt hatten und keiner von uns schwimmen konnte – trotzdem wünschten wir uns nichts sehnlicher, als die neuen Hosen überzustreifen und herumzuplanschen.
Unsere Vorfreude auf das Meer verflog allerdings schnell, als wir uns dem Wasser näherten. »Rein mit euch, Jungs!«, brüllte mein Vater und gab uns einen Schubs. Das Wasser war so kalt, dass uns fast das Herz stehen blieb.
Nach höchstens fünfzehn Minuten erklärte mein Vater uns zu hoffnungslosen Fällen und machte sich von dannen. In eben jenem Moment wurde uns klar, warum man niemals jemanden in Strickbadekleidung sah. Wolle kann ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen, wie ein Schwamm, und wird dann bleischwer.3 Die Folge: Mit einem Mal konnten alle unsere kleinen Pimmel sehen. Mit puterroten Köpfen rannten wir zurück an den Strand, Hände vor den Kronjuwelen, Hinterteil entblößt, während die vollgesogenen Badehosen uns in den Kniekehlen hingen.
Das Gateshead meiner frühen Kindheit war grau und schmuddelig. Im Krieg konnte man im deutschen Propagandaradio hören, wie sich »Lord Haw-Haw«, so der verächtliche Spitzname der Briten für den Sprecher, über uns lustig machte: »Wir sollten über Gateshead keine Bomben abwerfen, sondern Seife!« Natürlich machte das alle so wütend, dass die Arbeiter in der Vickers-Fabrik die Panzer in doppelter Geschwindigkeit zusammenschraubten. Aber die traurige Wahrheit war, dass bei jedem in Gateshead eine »Hochwassermarke« auf der Haut den Kragenrand markierte.
Das Essen trug nicht gerade dazu bei, das Leben erträglicher zu machen. Besonders für meine arme Mutter war es eine Qual, da sie an frische Melonen, geräuchertes Fleisch, knuspriges Brot, Olivenöl und Parmesan gewöhnt war. Alles wurde stundenlang gekocht, außer Leber – diese wurde gebraten, bis sie steinhart war und als Wurfgeschoss Straßenlaternen und Fensterscheiben zertrümmern konnte. Meistens saß meine Mutter nur am Tisch und schluchzte: »Ich kann das nicht essen!« Und sie konnte ja auch nicht einfach selbst irgendwelche italienischen Gerichte zaubern. Für eine Flasche Olivenöl musste man im Dunston der Nachkriegszeit in die Apotheke gehen. Die einzige Tomatensoße, die es gab, war Ketchup. Knoblauch war vermutlich illegal. Selbst Speck – ein italienisches Grundnahrungsmittel – war auf acht Scheiben pro Woche und vier pro Einkauf rationiert.
Was dem Appetit meiner Mutter auch nicht gerade auf die Sprünge half, war die Tatsache, dass mein Großvater regelmäßig mit Pfeife im Mund am Tisch hockte und über die verdammten Itaker in seinem Haus schimpfte, während er die Zeitung vom Vortag in Streifen schnitt, damit wir sie als Klopapier benutzen konnten.
Als wäre das alles nicht schon genug gewesen, stellten sich bei meinem Vater Spätfolgen seiner Soldatenzeit ein. In jener Höhle in Tunesien hatte er neben Unmengen an Staub und Rauch auch toxische Dämpfe und winzige Granatsplitter eingeatmet. Im Grunde war er vergiftet worden und plagte sich nun mit chronischen Magenschmerzen herum. Äußerlich ging es ihm gut – die einzige sichtbare Verletzung war eine Narbe am Daumen. Aber seinem Magen ging es immer schlechter, bis er schließlich keine Nahrung mehr bei sich behielt. An diesem Punkt konnte selbst ein halsstarriger Mann wie er nicht mehr so tun, als sei alles in Ordnung.
Ich erfuhr von der Sache erst, als ich eines Morgens aufstand und er nicht da war. »Brian, Junge, dein Vater … Er musste in die Ospitale«, erklärte mir meine Mutter mit bebender Stimme.
Einige Tage darauf besuchten wir ihn in einem Sanatorium, das in einem wunderschönen alten Herrenhaus unweit von Ryton, gleich neben dem Tyneside Golf Club, untergebracht war. Einen solch prachtvollen Ort hatte ich noch nie gesehen. Bei unserer Ankunft saß mein Vater in einem Sessel und vertrieb sich die Zeit mit Handarbeiten, da er sich vor Schmerzen nicht bewegen konnte. Ich dachte: Wow, das ist also jetzt sein Zuhause? Er hat es echt zu was gebracht …
Dann ließ ich den Blick schweifen und sah Männer mit Kopfverbänden, Glasaugen und fehlenden Gliedmaßen. Einige humpelten auf Beinprothesen des nationalen Gesundheitsdienstes NHS herum, die seinerzeit noch aus Holz waren und schrecklich knarzten. Ich begriff, dass es sich um eine Art Krankenhaus handelte, aber ich brachte es nicht mit dem Krieg in Verbindung. Wir waren damals vollkommen ahnungslos. In der Schule riefen wir »Unser war der Sieg, 1944 im Krieg!«, zu Hause verschlangen wir Eagle-Comics über gut aussehende britische Soldaten mit dicken Muskeln und Namen wie »Schläger Smith«, die Nazis abknallten. Für meinen kindlichen Verstand gab es also keinerlei Veranlassung, den Krieg mit diesen stinknormalen Männern in Verbindung zu bringen, die sich auf irgendeine Weise schreckliche Verletzungen zugezogen hatten.
Mein Vater kehrte mehrmals für längere Aufenthalte in das Sanatorium zurück, immer wenn er wieder mal am Magen operiert worden war. Meine Mutter besuchte ihn dann täglich mit dem Bus, was bedeutete, dass Tante Ethel auf uns aufpassen musste. Sie behandelte uns wie Kriegsgefangene – was wir in ihren Augen auch waren. Irgendwann begannen sich bei uns zu Hause die wunderschön bestickten Tischdecken zu stapeln, die mein Vater angefertigt hatte. Zu einer anderen Zeit und an einem anderen Ort hätten er und meine Mutter zusammen einen Laden aufmachen und sich eine goldene Nase verdienen können. Aber nicht zu jener Zeit. Jedes Mal, wenn mein Vater aus dem prächtigen Sanatorium entlassen wurde, kehrte er sofort wieder zu seinem Job zurück.
Eine Zeit lang arbeitete er in London. Er fuhr mit dem Zug hin, blieb eine ganze Woche dort und kam nur am Wochenende nach Hause. Einmal durften mein Bruder Maurice und ich ihn begleiten. Es war die aufregendste Reise unseres jungen Lebens – dabei führte mein Vater gar kein besonders spannendes Leben in London. Ich weiß noch, wie wir in King’s Cross aus dem Zug stiegen und auf einen Taxistand zusteuerten. Mein Herz schlug wie verrückt bei der Vorstellung, mit einem der schwarzen Taxis zu fahren. Aber als wir bei dem Stand ankamen, trottete mein Vater einfach weiter … zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite.
Für meine Mutter war es nicht leicht, den Kontakt mit ihrer Familie in Frascati aufrechtzuerhalten. Doch als sie ihrer Nichte auf einer Postkarte schilderte, wie hart das Leben im Nordosten war, schrieben ihre Schwestern zurück und erkundigten sich nach ihrer Telefonnummer. Alle De Lucas hatten einen Telefonanschluss zu Hause. Meine Mutter hingegen musste ihnen die Nummer der Telefonzelle in unserer Straße schicken und ihnen erklären, dass sie dort an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit anrufen sollten. Für das Gespräch versammelten sich dann alle ihre Schwestern um einen Apparat. Sie waren so froh, einander endlich wiederzuhören – viele Tränen und »ti voglio bene« –, dass dem ersten Anruf noch viele weitere folgten, von denen jedoch keiner länger als exakt drei Minuten dauerte, damals das Maximum für Auslandsgespräche in einer Telefonzelle.
Als meinen Tanten in Italien klar wurde, wie schwierig die Situation meiner Mutter tatsächlich war, wollten sie ihr unbedingt helfen. Genau wie meine Mutter hatten sie sich ausgemalt, dass ein britischer Sergeant in einem Landhaus wie aus einem viktorianischen Liebesroman leben würde – sorgfältig getrimmter Rasen und üppiger Blumengarten inklusive –, nicht in einer Sozialwohnung in Dunston.
Und so schickten sie uns alles, was wir ihrer Ansicht nach brauchen könnten. Ein wundervolles neues Topf- und Pfannenset. Einen Nerzmantel, der einer Großtante gehört hatte. Schals und Blusen. In ihren Oberschichtsköpfen waren das alles lebensnotwendige Dinge. Doch mit ihren Päckchen machten sie alles oft nur noch schlimmer.
Die Hälfte davon wurde vom britischen Zoll aufgerissen, wobei der Großteil des Inhalts »verloren« ging. Und was es bis nach Dunston schaffte, wurde zumeist von Onkel Norman oder Onkel Colin abgefangen und zum Pfandleiher getragen. So wie die beiden es sahen, hatte meine Ma nichts von dem Zeug gekauft, und sie brauchten das Geld ohnehin dringender als meine Mutter die teuren Geschenke aus Italien. Eigentlich gab es also keinen Grund für sie, sich zu beklagen.
Jedes Mal, wenn das passierte, wollte meine Mutter gar nicht mehr aufhören zu weinen. Aber es ging immer weiter so, Woche für Woche, Monat für Monat.
Und es stürmte ununterbrochen, und der Regen fiel und fiel.
Und das Essen wurde nicht besser.
Und es war immer bitterkalt.
Und mein Vater verdiente kaum genug, um seinen Anteil an der Miete aufzubringen. Von einer eigenen Wohnung ganz zu schweigen.
Eines Tages dann reichte es meiner Mutter.
Ich hockte im Wohnzimmer und spielte mit meinen Holzklötzen, als ich mitbekam, wie meine Eltern sich im anderen Zimmer wegen irgendetwas stritten. Ein bisschen lauter als sonst, aber immer noch im gewohnten Rahmen. Plötzlich packte mich meine Mutter, zog mir einen Mantel über und schob mich aus dem Zimmer.
»Wohin willst du?!«, brüllte mein Vater sie in seinem Geordie-Italienisch an. Ich verstand die Worte zwar nicht, aber das war bei meinem Vater auch nicht nötig. Die Lautstärke genügte.
»Hier ist es schrecklich!«, schrie sie unter Tränen zurück. »Ich gehe nach Hause. Deine Familie ist …«
Ihr fiel kein Wort ein, dass schlimm genug war.
»Komm schon, Esther«, schnaubte mein Vater. »Du gehst nirgendwo hin.«
»Ich gehe!«
»Nein, machst du nicht.«
»Es ist schrecklich hier. Schrecklich! Ich gehe zurück nach Hause!«
Und das war’s. Sie stürmte auf die Straße und zerrte mich hinter sich her. Ich glaube nicht, dass sie es geplant hatte. Es geschah vollkommen spontan. Immerhin hatte sie genug Geld bei sich, für den Fall der Fälle musste sie also irgendwo ein Geheimversteck gehabt haben.
Bevor mein Vater uns einholen konnte, waren wir in einem Bus verschwunden, der kurz darauf am Hauptbahnhof von Newcastle hielt. Die dramatische Atmosphäre dieses Ortes war für mich als Kind schlicht überwältigend. Damals fuhren noch ausschließlich Dampfzüge, die so laut schnauften, pafften und pfiffen, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. Dazu kamen die hallenden Lautsprecherdurchsagen, die Ausrufe des Evening Chronicle-Verkäufers, die Menschenmassen auf den Bahnsteigen und die uniformierten Gepäckträger, die voll beladene Rollwagen hinter sich herzogen und lauthals fluchten, wenn ein Koffer runterfiel und sich der Inhalt auf den Boden ergoss.
Dazwischen irrte meine arme Mutter umher und zerrte mich in alle möglichen Richtungen, während ich sie immer wieder fragte, was eigentlich los war. Langsam bekam ich Angst. Mit tränenüberströmtem Gesicht studierte sie den riesigen Aushang mit den Abfahrtszeiten – der etwa zwei Meter hoch und so breit wie ein Doppeldeckerbus war – und suchte nach einer Verbindung zur Victoria Station in London. Von dort ging der Zug zur Fähre, mit Verbindung zum Pariser Gare du Nord auf französischer Seite. Dort wollte sie dann in einen Zug nach Rom umsteigen.
Schließlich wurde sie fündig und stürmte mit mir im Schlepptau los. Doch genau in dem Moment ertönte hinter uns dieses unverkennbare Brüllen, gegen das selbst die Lokomotive des Flying Scotsman unter Volldampf nichts hätte ausrichten können. Alle blieben wie angewurzelt stehen und starrten verdattert in unsere Richtung.
»Esther!!!«
Mein Vater stand wie ein Häufchen Elend auf dem Bahnsteig.
Er wusste, was er verbrochen hatte. Was er seiner wunderschönen italienischen Frau versprochen und nicht gehalten hatte.
Gewiss bemerkte meine Mutter den Kummer und den Schmerz in seinen Augen. Und gewiss wusste sie, dass er alles tat, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen, und sich dabei zu Tode schuftete.
»Bitte, Esther«, sagte er sanft, und sie begann zu schluchzen, wie ich noch nie jemanden schluchzen gesehen hatte. »Du darfst nicht gehen. Wir werden eine Wohnung nur für uns finden. Ich rufe bei der Stadtverwaltung an. Alles wird besser werden.«
Ich glaube nicht, dass sie es ihm abkaufte.
Aber es genügte, damit sie zurückkehrte.
2Winston Churchill sagte im Nachhinein über die Landung: »Ich hatte gehofft, wir würden eine Wildkatze ans Ufer schleudern, aber wir bekamen nur einen gestrandeten Walfisch.«
3Nach dieser Erkenntnis ging ich davon aus, dass meine Mutter die Badehosen wegwerfen würde. Doch nein, in unserem Haus wurde nie etwas weggeworfen. Vielmehr beglückte sie uns im Winter mit verdächtig vertraut aussehenden dunkelblauen Wollmützen, die nach Salzwasser dufteten.
2
Brianuk
»Verrätst du mir deinen Namen?«
Brrrraaaagghhhhn.«
»Wie war das, Honey?«
»Brrrraaaaaaaaagghhhhhhhhn.«
»Du heißt also Brian?«
»Jhhrrr … rragghggh.«
»Okay, Brian, mein armer Spatz, anscheinend geht es dir gar nicht gut. Verrätst du mir, wo du wohnst?«
»B-b-b-buh-eeee … d-d-d …«
»Beech Drive? Ah, dann bist du einer von Esther Johnsons Jungs?«
»Jhhrrr … rragghggh.«
»Okay, Brian, ich werde jetzt versuchen, dir hochzuhelfen, denn du musst unbedingt nach Hause zu deiner Mutter.«
Diese Szene ereignete sich an einem Wintertag Mitte der 1950er-Jahre in Dunston, ein paar Jahre nach dem Fluchtversuch meiner Mutter. Inzwischen lebten wir im Beech Drive in einer gemeindeeigenen Doppelhaushälfte, nur zehn Minuten zu Fuß vom Haus meiner Großeltern in der Oak Avenue entfernt. Zunächst hatten wir in der Nummer 106 gewohnt, einem Haus mit drei Zimmern. Doch schließlich hatte mein Vater sein Versprechen gegenüber meiner Mutter vollständig eingelöst und die Stadtverwaltung davon überzeugt, uns die Nummer 1 mit einem zusätzlichen Zimmer nach hinten raus zu geben. Für eine sechsköpfige Familie war das immer noch viel zu klein. Meine beiden Brüder und ich mussten uns sogar eine Doppelmatratze teilen. Aber mit elf Johnsons weniger als bei meinen Großeltern kam es mir vor wie der Buckingham Palace.
Wir waren kaum eingezogen, da erkrankte ich so heftig, dass ich von Glück sprechen konnte, mich davon wieder zu erholen. Zu allem Überfluss war ich auch noch selbst schuld.
Alles begann mit einem Film namens Nanuk, der Eskimo, den ich auf unserem brandneuen Schwarz-Weiß-Fernseher gesehen hatte. Im Internet kann man diese Stummfilmdokumentation aus den 1920er-Jahren nach wie vor finden. Damals muss er in der BBC gelaufen sein, denn mit unserer Dachantenne konnten wir keine anderen Sender empfangen. (Im Nordosten von England gab es erst sechs Jahre nach dem Krieg überhaupt Fernsehen.)
Normalerweise war ich nicht scharf auf die Glotze, denn das Programm bestand ausschließlich aus Gartensendungen, Kirchenorgelkonzerten und, wenn man Glück hatte, Wiederholungen von irgendwelchen Gregory-Peck-Filmen und Micky-Maus-Cartoons. Langweiliger, furchtbarer Kram, den ich mir für kein Geld der Welt angesehen hätte, wenn ich genauso gut draußen mit meinen Freunden spielen konnte. Aber Nanuk, der Eskimo war anders. Der Film war packend. Der Hauptdarsteller war ein Inuk namens Nanuk, der in der kanadischen Arktis lebte. Man sah, wie er ein Iglu baute, Robben jagte, ihren Speck aß und mit einem Eisbären kämpfte – und all das tat er bei minus zwanzig Grad, während ein Schneesturm tobte und das Eis unter seinen Füßen Risse bekam. Er trug die ganze Zeit ein großes Jagdmesser bei sich und hatte eine kleine Familie: eine wundervolle Inuk-Frau und ein süßes Inuk-Baby mit winziger Pelzmütze auf dem Kopf. Da in Dunston gerade Winter war und Schnee lag, ging meine Fantasie mit mir durch.
Nach dem Film rannte ich nach draußen in den Schnee. Ich wollte ein Iglu bauen und zwar genauso eins wie das von Nanuk. Gesagt, getan. Die Schneehütte war fantastisch. Rund eineinhalb Meter im Durchmesser und genauso hoch, mit einer kleinen Öffnung vorne zum Rein- und Rauskrabbeln.
Nur gibt es leider ein Problem, wenn man als Kind spätnachmittags etwas so Aufregendes macht: Wenn man schließlich im Bett liegt, ist man hellwach, da man immer nur an das tolle Abenteuer denken kann. Auch noch lange nachdem alle anderen eingeschlafen sind. Genau so erging es mir – und daher beschloss ich mitten in der Nacht, dass es nicht schaden könnte, draußen im Dunkeln mein Werk noch einmal kurz zu bewundern. Ich streifte mir einen Pullover über den Schlafanzug, holte die Taschenlampe meines Vaters und schlich mich durch die Hintertür raus. Als ich in meinen Iglu kroch, war ich nicht länger Brian Johnson im Garten unseres Hauses in Dunston, sondern der Brianuk des Nordostens, der sich bei einem Festmahl mit Speck-Pie von einem anstrengenden Tag auf der Robbenjagd erholte. Schließlich gähnte ich, wie Nanuk gegähnt hätte, ein Riesenfehler, denn plötzlich merkte ich, wie erschöpft ich war. Mir fielen die Augen zu.
Als mein Vater einige Stunden später aufstand, um zur Arbeit zu gehen – normalerweise verließ er das Haus morgens um halb sieben –, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Im Haus war es kalt wie am Nordpol, die Hintertür stand offen, und Schnee wehte herein. Er warf einen Blick in das Zimmer von uns Jungs und bemerkte, dass ein Junior fehlte.
Glücklicherweise hatten mich die Geräusche aus dem Haus im Iglu aufgeweckt, und ich schlüpfte nach drinnen, während mein Vater gerade die Treppe herunterkam. Er dachte, ich sei einfach früh aufgestanden, und hatte keine Ahnung, dass ich fast die ganze Nacht draußen gewesen war.
»Du Dummkopf, du holst dir noch den Tod!«, brummte er. »Und jetzt zieh dich an.«
Damit war mein kleines Abenteuer anscheinend beendet.
Doch als ich mich später in der Schule mit meinen Schreibübungen abmühte, geschah etwas Schreckliches. Ich begann zu tropfen wie ein schmelzender Eisblock. Die Flüssigkeit lief aufs Arbeitsblatt und ins Tintenfass, bis meine Lehrerin Mrs. Patterson zu mir kam und schimpfte: »Brian Johnson! Was ist das für ein Geschmiere? Du fängst sofort noch mal von vorne an!«
Mir war so schwummerig zumute, dass ich keine Antwort herausbrachte.
»Aufwachen!«, blaffte sie und zwickte mich ins Ohr. »Du hast das Blatt versaut! Was ist los mit dir? Du gehst jetzt sofort nach Hause. Ist deine Mutter da?«
Ich presste ein Ja hervor, was ihr genügte, um mich in Wind und Schnee hinauszujagen.
Von der Lehrerin nach Hause geschickt zu werden, würde mir eine kräftige Tracht Prügel mit dem Gürtel einbringen, das ahnte ich. Aber ich fühlte mich so elend, dass ich in diesem Moment nicht einmal daran denken konnte. Auf meinem Weg von der Schule zurück zum Beech Drive wurde ich immer langsamer und langsamer … bis meine Beine schließlich ganz ihren Dienst einstellten. Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging. Normalerweise rannte ich überall hin, aber jetzt konnte ich mich kaum noch auf den Beinen halten. Schließlich hockte ich mich einfach auf den Bürgersteig und rollte mich zusammen. Der Brianuk des Nordostens war bereit, vor seinen Schöpfer zu treten.
Dann vernahm ich plötzlich die freundliche Stimme einer älteren Dame.
»Verrätst du mir deinen Namen?«
»Brrrraaaagghhhhn.«
»Wie war das, Honey?«
»Brrrraaaaaaaaagghhhhhhhhn.«
»Du heißt also Brian?«
Zu jener Zeit hatten wir noch immer kein Telefon, ganz zu schweigen von einem Auto. Nachdem die barmherzige Samariterin von Dunston mich zu Hause abgeliefert hatte, musste meine Mutter mich allein am Ofen zurücklassen, um zur nächsten Telefonzelle zu eilen und unseren Hausarzt anzurufen, den guten alten Dr. Fairbairn. Er sagte, dass er umgehend käme, er müsse nur erst noch zu Mittag essen und sich dann um die Patienten in seiner Praxis kümmern. Aber in spätestens fünf Stunden wäre er dann so weit.
Nachmittags gegen fünf tauchte er schließlich auf. Inzwischen war ich schweißgebadet, während mir zugleich eiskalt war und ich kaum noch Luft bekam. Dr. Fairbairns Diagnose lautete, dass ich »ernsthaft krank« sei. Er drehte mich auf den Bauch und gab mir eine Spritze in den Po, die meinen Zustand stabilisieren sollte. Er blieb bis weit nach Mitternacht bei mir, was im ganzen Ort noch nie vorgekommen war. Ich erinnere mich, dass er sagte: »Du musst jetzt ein tapferer Soldat sein, okay, Brian?« Dann gab er mir eine weitere Spritze. Anschließend fragte er mich, ob ich Autos mochte.
Nun, ich mochte Autos nicht einfach nur. Ich war ein waschechter Autonarr, wie mein Vater immer wieder sagte. Dabei waren die damals eher rar gesät. In unserer Straße stand nur ein einziges, ein Morris Minor, der dem Chef meines Vaters gehörte. Ich konnte den Wagen stundenlang anschauen und träumte oft davon, mit ihm herumzufahren. Irgendwann hatte mein Vater es satt, dass ich ständig nach neuen Objekten der Bewunderung suchte, also erkundigte er sich in der Werkstatt um die Ecke nach einem Lenkrad. Die einzige Bedingung war, dass es nicht von einem deutschen Auto stammen durfte. Er bekam eins für einen Sixpence, der mir vom Taschengeld abgezogen wurde, nahm einen langen Stock, schob ihn durch den Kopfteil unseres Betts, befestigte das Lenkrad daran und arrangierte die Kissen zu einem Fahrersitz. Ich habe bestimmt fünfzigtausend Kilometer in diesem Bett zurückgelegt.
»Ja, ich mag Autos«, gestand ich Dr. Fairbairn mit zittriger Stimme.
»Freut mich zu hören«, erwiderte er strahlend. »Denn weißt du, ich habe mir gerade einen neuen Rover gekauft. Und wenn du stark bleibst und wieder gesund wirst, nehme ich dich mal mit auf eine Spritztour.«
Hinter ihm standen meine Eltern. Sie schauten mich an und hielten sich an den Händen – was mir eine Heidenangst einjagte, weil sie das sonst nie taten. Insbesondere den Gesichtsausdruck meines Vaters hatte ich noch nie bei ihm gesehen. Er zeigte, nun … vermutlich Liebe. Und Angst. Zwei Gefühlsregungen, die ein Kerl wie er für gewöhnlich nicht offenbarte. Außerdem entdeckte ich eine merkwürdige Form von Resignation in seinem Blick. Für die Generation meines Vaters war es nichts Ungewöhnliches, ein oder zwei Kinder durch Grippe oder Tuberkulose zu verlieren – manchmal sogar durch eine simple Rachenentzündung. Es war, als würde er denken: »Okay, da geht also der Erste dahin.«
Allerdings hätte meinem Vater klar sein müssen, dass ein Rover zu jener Zeit nicht weit von einem Rolls-Royce entfernt war. Er hatte verchromte Anzeigen, ein hölzernes Armaturenbrett und sogar ein eingebautes Radio. Außerdem hatte er so viel Power, dass er in weniger als zwanzig Sekunden von null auf hundert beschleunigte – und es bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von über hundertdreißig Sachen brachte!
Es verstand sich also von selbst, dass ich nicht einfach sterben und mir eine solche Gelegenheit entgehen lassen würde.
Abgesehen von meiner Nahtoderfahrung im Iglu stellte das Leben im Beech Drive eine enorme Verbesserung gegenüber der Oak Avenue dar. Ich weiß noch, wie ich wenige Tage nach unserem Umzug in die Nummer 106 nach dem Aufstehen überall Fahnen sah. Auf den Straßen standen Tische und Stühle mit jeder Menge Essen und Getränken, und alle feierten eine riesige Party, weil wir eine neue Königin hatten. Selbstverständlich pisste es beinahe den ganzen Tag, aber davon ließ sich niemand stören. Sogar ein Schwein wurde geschlachtet und im Dunston Park gegrillt. Und als Krönung des Ganzen bekam jeder einen Becher geschenkt. Es lässt sich nicht in Worte fassen, was für ein unglaubliches Gefühl das in einer Zeit des rationierten Specks war. Ich dachte nur: Große Güte, wenn jeder in der Straße einen Becher geschenkt bekommt, dann ist hier buchstäblich alles möglich!
Ich sollte wohl anmerken, dass die Siedlung am Beech Drive damals gerade erst fertiggestellt worden war, als Kirsche auf der Torte des sozialen Wohnungsbaus im Nordosten. Alles war neu und modern, vom frischen roten Asphalt bis zu den farbenfrohen Haustüren. Die Leute dort waren unglaublich stolz, besonders die Mütter und Ehefrauen. Jeder Hauseingang war picobello in Schuss. Jede Gardine porentief rein. Und in jedem Wohnzimmer gab es eine Anrichte, einen Sekretär und einen Kamin, der so blitzblank war, dass man daraus hätte essen können. Viele Mütter schützten sogar ihre Sofas mit Plastikschonern.
Allerdings wurde die Straße noch von Gaslaternen beleuchtet, die jeden Abend von einem Mann mit einer langen Stange angezündet wurden. Und es gab nach wie vor einen Lumpensammler, dessen kleiner Wagen von einem traurigen Gaul mit Luftballons am Zaumzeug gezogen wurde. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich erfuhr, dass man einen Penny oder einen Luftballon bekam, wenn man dem Lumpensammler einen alten Pullover oder ein Bettlaken brachte. Ich dachte nur: Warum hat mir das bis jetzt niemand gesagt? Aber dann bekam meine Mutter Wind von meinem Treiben und jagte dem Lumpensammler hinterher, um ein Paar alte Socken meines Vaters zurückzuholen.
Wir hatten unglaublich viel Spaß damals. Ohne Autos, ohne Verkehr und ohne Bildschirme oder Videospiele, nach denen wir süchtig werden konnten, genossen wir eine Art von Freiheit, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Jeder hatte ein Auge auf den Nachwuchs der anderen. Wegen der winzigen Häuser lebten wir als Kinder praktisch im Freien, erfanden unsere eigenen Spiele und bildeten kleine Banden. Im Beech Drive gab es die Top Gang und die Bottom Gang, je nachdem, in welchem Teil der Siedlung man wohnte. Innerhalb der Top Gang gab es die Großen (mich und meine Freunde) und die Kleinen (unsere jüngeren Brüder). Maurice gehörte lustigerweise zu den Kleinen, obwohl er größer war als ich.
Auch die Schule – erst die Dunston-Hill-Vorschule, dann die Grundschule – war im Grunde gar nicht so übel.
Die Großen nahmen die Kleinen jeden Tag mit hin und wieder zurück. Wir alle trugen kurze Hosen, egal ob es regnete, nieselte, hagelte, graupelte oder schneite. Ich würde noch hinzufügen »oder die Sonne schien«, aber die Tage, an denen ich als Kind in Dunston die Sonne sah, kann ich an einer Hand abzählen.
Einer der Gründe, weshalb ich so gern zur Vorschule ging, war das Klassenzimmer, das mit Wippe und kleinem Karussell ausgestattet war. Früher oder später musste sich immer jemand übergeben, sodass Mr. Graham, der Hausmeister, die ganze Zeit mit Wischmopp und Eimer auf seinen Einsatz wartete.
Wenn die Zeit zum Spielen vorbei war, händigte Mrs. Patterson jedem von uns eine kleine Tafel und ein Stück Kreide aus, damit wir das ABC üben konnten. Wir hatten auch Musikunterricht, die Mädchen bekamen Blockflöten, die Jungs Triangeln oder Tamburine.
Damit begann meine lebenslange Liebe zur Musik. Für mich gab es einfach nichts Schöneres, als meine Triangel zu bearbeiten. Ich hätte das stundenlang machen können. Außerdem sangen wir, von Mrs. Patterson am Klavier begleitet, schreckliches Zeug wie »Underneath the Spreading Chestnut Tree«. Aber das war mir egal. Solange ich meine Triangel anschlagen durfte, sang ich alles, was Mrs. Patterson von mir verlangte.
Am besten war ich in Englisch. Ich liebte es zu schreiben und bekam für meine Geschichten und Aufsätze immer Bestnoten – und wenn ich mit einem goldenen Stern ausgezeichnet wurde, nahm ich das Heft mit nach Hause, um es meiner Mutter und meinem Vater zu zeigen.
Aber das eigentliche Leben begann erst nach Schulschluss.
Jeden Abend, es mochte noch so sehr schütten, legten wir vier Pullover als Torpfosten auf die Straße und spielten mitten auf der Fahrbahn Fußball. Wenn es schneite, verwandelte sich die Straße in eine Kriegszone, in der wir uns stundenlange Schneeballschlachten lieferten.