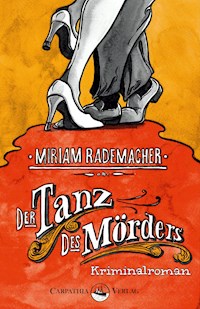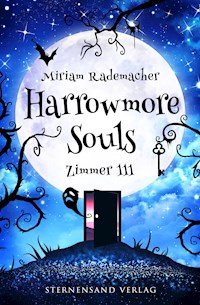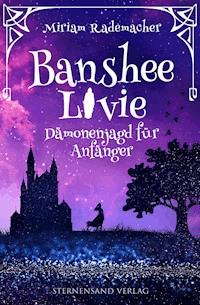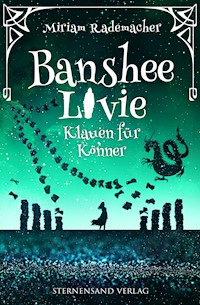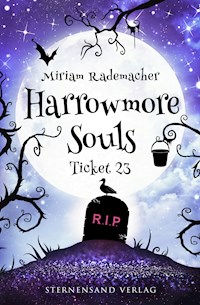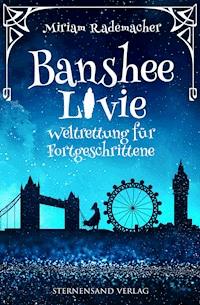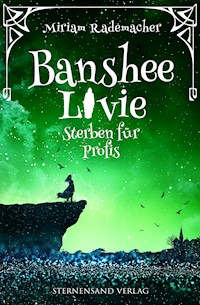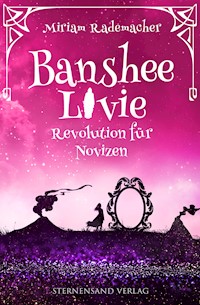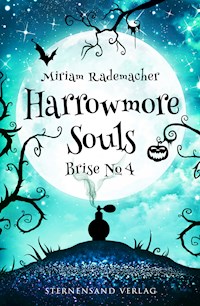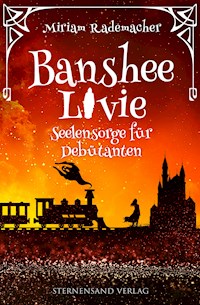2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alea Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 3
- Sprache: Deutsch
Caroline Gründig, die Tochter des Dorfarztes, kann es kaum fassen: Ihre Großmutter Theda hat ihr einen Bauernhof vermacht. Das Mädchen zögert nicht lange und stürzt sich in ihre neue Aufgabe. Doch bald geschehen seltsame Dinge auf dem abgelegenen Gehört und Caroline weiß nicht, wem sie noch trauen kann. Sind die Menschen, die sie liebt, ihr wirklich alle freundlich gesinnt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die letzte
Feuertaufe
Von Miriam Rademacher
Auflage 1 │ Dezember 2020
© 2020 Alea Libris Verlag, 72827 Wannweil
Satz: Michaela Harich
Cover: Viktoria Lubomski
Lektorat: Franziska Fezer
ISBN 9783945814772
Alle Rechte vorbehalten
Bilder: Creatopic/stock.adobe.com, Rawpixel.com/stock.adobe.com
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Kapitel 1
Es war ein typischer Sonntagvormittag in meinem Leben. Ich saß nur eine Kirchenbank schräg hinter meiner Mutter und konnte trotz des Dämmerlichts sehen, wie diese ihre Lippen bewegte. Sie sprach ein lautloses Gebet, wie sie es oft tat, wenn sie sich während der Messe unbeobachtet glaubte.
Und auch ohne den genauen Wortlaut zu kennen, wusste ich nur zu gut, was gerade im Kopf meiner Mutter vor sich ging. Es war nämlich immerzu dasselbe.
Liesbeth Gründig dankte dem Herrgott für ihre fünf gesunden Kinder, ihren liebevollen Mann Albert, und ein wunderschönes Heim. Dann bedankte sie sich noch dafür, dass Theda, ihre Mutter und somit meine Großmutter noch lebte, und Großvater Milan nicht hatte leiden müssen, als er vor fast drei Jahren im Schlaf verstorben war.
Ungefähr jetzt war meine Mutter mit ihrer langweiligen Litanei am letzten Punkt angelangt. Das erkannte ich daran, dass ihre Lippen meinen Namen formten: Caroline. Natürlich dankte sie dem Herrgott ebenfalls für ihre Erstgeborene. Auch wenn niemand wusste, was Gott sich dabei gedacht hatte, als er ein so wenig ansprechendes und launisches Mädchen wie mich erschaffen hatte. Doch Gottes Pläne wurden von meiner Mutter nicht infrage gestellt, also hatte auch ich eine Daseinsberechtigung, das war gewiss. Nur hätte ich manchmal gern gewusst, welche. Und sie vermutlich auch.
Ich saß wie immer eingezwängt zwischen meinen jüngeren Geschwistern und dankte Gott für gar nichts. Ich hätte mehr Grund gehabt, mich ausführlich über mein Leben zu beschweren, angefangen bei den vielen Pflichten, die mir als ältestem Kind auferlegt wurden, bis hin zur Perspektivlosigkeit meines Daseins. Doch das hatte ich schon vor Jahren aufgegeben. Und auch wenn ich es niemals zugeben würde, so zweifelte ich sogar daran, dass es Gott überhaupt gab. Aber das war ein Satz, der in Gegenwart meiner Mutter nicht ausgesprochen werden durfte. Mein Vater war diesbezüglich toleranter, was man schon daran erkennen konnte, dass er nicht hier bei uns in der Kirche saß, wo sich an jedem Sonntagmorgen das ganze Dorf versammelte. Er als Arzt nahm sich das Recht heraus, auch am Tag des Herrn noch Hausbesuche bei seinen Patienten zu machen. Meiner Meinung nach handelte es sich dabei um einen vorgeschobenen Grund. Mein Vater langweilte sich in der Kirche einfach genauso sehr wie ich und hielt nicht viel von Frömmigkeit. Trotzdem hätte er auch mir verboten, weiterhin Kant zu lesen, wenn ich meine Zweifel an einer höheren Macht öffentlich gemacht hätte. Das wollte ich nicht riskieren.
Obwohl … das kleine Teufelchen in mir, dass mich seit meinem ersten Tag auf Erden begleitete und mir immerzu Unsinn einflüsterte, begann sich wieder zu regen.
Ich warf dem Pfarrer einen schrägen Blick zu, der wieder einmal ganz und gar in seinem lateinischen Gebet aufging. Und für einen kurzen Moment malte ich mir aus, wie es wäre, jetzt einfach aufzustehen und laut nachzufragen, was er denn da eigentlich gerade erzählte und ob eine verständliche Messe nicht mehr Wirkung auf uns arme Sünder hätte als eine Flut unverständlicher Worte. Die Ohnmacht meiner Mutter und der Applaus meiner Großtante Hilda wären mir gewiss gewesen.
Verstohlen drehte ich den Kopf und sah mich nach Hilda um. Da saß sie. Gleich neben Theda, meiner Großmutter, und hielt ihre Hand. Seit Großvater Milans Tod war Großmutter nicht mehr dieselbe. Ohne Hilda hätte sie mit ihren 55 Jahren schon längst aufgegeben, den Hof der Familie Sandrini, der jetzt ihr allein gehörte, ebenfalls und sich selbst noch dazu. Ihr Haar war grau und das Gesicht alt geworden. Das ewige Schwarz, in das sie sich kleidete, tat sein Übriges, um die einst so lebensbejahende Theda in einen Schatten ihrer selbst zu verwandeln.
Großtante Hilda war aus anderem Holz geschnitzt. Eine Frau, die als Kind mit dem Zigeunerwagen durch das ganze Land gereist war, warf nichts so schnell aus der Bahn. Ich bewunderte sie für das aufregende Leben, das sie geführt hatte, obwohl sie mir nur selten davon erzählte und das meist mit traurigem Unterton. Neidisch blickte ich auf Hildas schlanke, hochgewachsene Figur, die zur Empörung aller Dorfbewohner mal wieder in Männerkleidung steckte. Ihr kräftiges dunkles Haar, das sie nie unter einer Haube verbarg und ihr ebenmäßiges Gesicht taten ihr Übriges, um sie zu einer Frau zu machen, nach der sich die Leute umschauten, wenn sie vorüberging. Die Jahre hatten meiner Großtante nichts anhaben können. Dabei war Hilda jetzt genau doppelt so alt wie ich. Doch Jugend allein, das hatte ich bereits begriffen, bedeutete gar nichts, wenn man nicht auch hübsch war. Hilda, mit 36 Jahren noch immer unverheiratet, konnte sich der Aufmerksamkeit aller Männer gewiss sein, wohin sie auch ging. Ich, gerade einmal achtzehn Jahre alt, konnte mich hingegen darauf verlassen, dass jeder, der mir ins Gesicht blickte, sein plötzliches Interesse für den Fußboden oder dem Himmel über mir entdeckte.
»Träumst du?« Der spitze Ellenbogen meiner jüngeren Schwester Getrud traf mich in die Seite.
Fast reflexartig stieß ich ihr nun ebenfalls kräftig zwischen die Rippen und flüsterte: »Und wenn? Was geht es dich an?«
Doch da traf mich schon der strafende Blick meiner Mutter, die sich zu uns herumgedreht hatte. Mutter hatte über die Jahre eine wirklich bemerkenswerte Fähigkeit entwickelt, all ihre Kinder mit nur einem Blick zur Ordnung zu rufen. Und der funktionierte heute so gut wie an jedem anderen Tag, auch bei mir. Ich schlug die Augen nieder. Wenn diese grässliche Messe doch nur schon vorbei wäre. Wenn ich nur bereits die allwöchentliche Tortur auf dem Kirchhof hinter mir hätte. Wenn ich doch nur weglaufen könnte, irgendwohin in ein fremdes Land! Vorzugsweise in eines, in welchem nur blinde Menschen lebten. Ob es so etwas gab? Ich würde meinen Vater fragen müssen, der wusste so ziemlich alles.
Den Rest der Messe verbrachte ich in dumpfem Brüten und als die Glocken endlich zu läuten begannen, gehörte ich zu den ersten, die vielleicht ein wenig zu schnell durch das hölzerne Portal ins Freie stürmten.
»Caroline Gründig!«, schallte es da auch schon über den Dorfplatz.
Ich war nicht schnell genug gewesen. Dabei konnte ich unser Haus von hier schon sehen. Nur ein paar Schritte weiter und ich wäre ihnen allen entkommen.
»Du wirst ja wohl nicht davoneilen, ohne deiner Großmutter einen guten Tag zu wünschen!« Ausgerechnet Hilda, einer der wenigen Menschen, die genau wussten, wie sehr ich den Spießrutenlauf am Sonntag nach der Kirche verabscheute, hatte mich aufgehalten. Das war mehr als Pech. Das roch nach Verschwörung.
Missmutig machte ich kehrt und gesellte mich zu meiner zusammengesunken wirkenden Großmutter und ihrer Schwägerin. »Einen frohen Sonntag, liebe Großmutter«, leierte ich meinen Text herab und verpfuschte sogar einen Knicks, während ich den Blick auf eine Regenpfütze zu meinen Füßen heftete.
Doch da fühlte ich schon Hildas Hand unter meinem Kinn, die meinen gesenkten Kopf unaufhaltsam in die Höhe drückte.
»Ich bin noch genau so hässlich wie gestern, Hilda«, protestierte ich und versuchte, dem forschenden Blick ihrer Augen auszuweichen.
»Stimmt.« Sie ließ mein Kinn los. »Die teure Salbe aus Österreich bringt also keine Besserung?«
»Gar keine«, gestand ich. »Es war trotzdem nett von Onkel Clemens, sie mir zu schicken.«
Bei der Nennung dieses Namens leuchtete das Gesicht meiner ergrauten Großmutter kurz auf. »Ist es nicht nett von Clemens, so an dich zu denken? Und dabei seid ihr euch noch nie begegnet. Nun, er ist eben ein erfolgreicher Mann, da führt ihn sein Weg nicht zurück in das Dorf seiner Kindertage.«
Sie hatte sich nie besondere Mühe gegeben, zu verbergen, dass mein Onkel Clemens ihr Lieblingskind gewesen war. Leider wohnte er jetzt irgendwo in der Nähe von Wien, war Kirchenmusiker geworden und lebte anscheinend nicht schlecht davon. Die nutzlose Creme, die er mir zugesandt und für die ich einen langen Dankesbrief hatte schreiben müssen, hatte ihn angeblich ein kleines Vermögen gekostet. Inzwischen lag der Tiegel mitsamt seinem nutzlosen Inhalt ganz unten in meiner Kommode vergraben. Das Zeug roch leider auch noch fürchterlich.
»Lass dich nicht hängen, Caroline.« Hildas Stimme klang forsch. »Halt dich gerade, nimm das Kinn hoch und die Schultern zurück. Du bist nicht weniger wert als alle anderen hier. Zeig ihnen, dass du stark und selbstbewusst bist. Eine echte Sandrini eben.«
»Sicher, Tante Hilda. Nur bin ich tatsächlich eine Gründig, falls du es vergessen hast.« Ich richtete mich ihr zuliebe ein wenig auf und sah zu meiner großen Erleichterung meine beste Freundin Adelheid durch das Kirchenportal treten. Das war die Gelegenheit. »Adelheid hat bestimmt aufregende Neuigkeiten. Ich muss zu ihr gehen!«, rief ich mit gespielter Begeisterung.
Meine Großmutter nestelte an dem schwarzen Kragen ihres ebenso schwarzen Witwenkleides und entließ mich mit einem gnädigen Blick, der Hildas schien mir eher spöttisch. Darauf gab ich gar nichts. Adelheid war mein Ausweg aus diesem allwöchentlichen Albtraum, dem ich entkommen musste, bevor sich noch weitere Verwandte und Bekannte hinzugesellten. Glücklicherweise akzeptierten die Alten, dass wir, die Jugend, immerzu schwatzen mussten. Und wann, wenn nicht am Sonntag nach der Kirche, hatten wir schon Gelegenheit dazu?
Adelheid Baltus war so blond, dass ihr Haar in der Sonne leuchtete und so herzensgut, dass sogar ich in ihrer Gesellschaft umgänglicher wurde. Sie war meine beste und einzige Freundin und so gut wie verheiratet mit Goswin Herkt. Goswin, ebenso blond wie Adelheid, war der zweitgeborene Sohn eines Bauern, dessen Gehöft außerhalb des Dorfes auf einer Anhöhe lag. Ein schöner Besitz, den Goswin nicht erben würde, da er einen älteren Bruder hatte. So etwas nannte man Pech, und Goswin hatte meines Erachtens noch Glück, dass sein Vater für ihn keine kirchliche Laufbahn ins Auge gefasst hatte. Nein, wie es aussah, würde Goswin beim Dorfschmied in die Lehre gehen, und das war niemand anderes als Adelheids Vater.
Ich hatte mich kaum bei Adelheid untergehakt, als ich sie auch schon in Richtung meines Elternhauses zog. »Komm, bring mich fort von hier. Und unterwegs erzählst du mir, wie es um dich und Goswin steht. Hat er dich schon gefragt?«, flüsterte ich ihr zu.
Adelheid stolperte dank meines stürmischen Auftritts, fing sich aber wieder und sah mich vorwurfsvoll an. »Caroline Gründig, was ist denn das für ein Benehmen? Nach dem Kirchgang grüßt man einander, plaudert ein bisschen und zerrt nicht die beste Freundin vom Kirchhof, um sie auszufragen.« Da erschien urplötzlich ein nachsichtiges Lächeln auf ihrem Gesicht. »Zudem geht es dir doch gar nicht um mich. Du bist nur mal wieder auf der Flucht vor dem Mitleid der alten Weiber.«
»Ich kann es eben nicht ertragen«, entfuhr es mir. »Wie sie mich ansehen. Und all die netten Ratschläge, einer seltsamer als der andere. Letzte Woche haben sie mir allen Ernstes empfohlen, mein Gesicht mit Kuhfladen abzureiben. Und das hört niemals auf!«
»Doch, wenn du erst verheiratet bist und eine eigene Familie hast, wird es aufhören«, behauptete Adelheid.
»Also niemals.« Ich senkte gewohnheitsmäßig den Kopf und zerrte sie schneller mit mir, denn ich hatte bemerkt, dass meine Mutter auf uns zuhielt. »So etwas wie mich heiratet man nicht. Ich werde mein Leben lang auf die Freundlichkeit anderer angewiesen sein. Das einzige, was mich vor noch mehr Selbstmitleid bewahren kann, ist mein Verstand, aber der zählt nicht. Wusstest du, dass Wilhelm Herschel in diesem Jahr bereits mehrere unbekannte Galaxien entdeckt hat? Dabei ist 1786 noch nicht einmal zur Hälfte vorbei. Und ich sitze zuhause herum und schäle Kartoffeln. Während unser Universum immer größer und größer wird.«
»Es wird nicht größer, wir erfahren nur mehr über Dinge, die sowieso schon das sind«, erinnerte mich Adelheid. »Caroline, es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du bist verrückt wenn du glaubst, eines Tages arbeiten zu dürfen wie ein Mann. Noch dazu wie ein Gelehrter. Das ist für uns einfach nicht vorgesehen, glaub mir.« Sie seufzte. »Deine Mutter hat schon Recht, wenn sie sagt, dass dein Vater dich viel zu viel lesen lässt. Du kommst nur auf dumme Gedanken.«
Ich öffnete den Mund und dachte aber kurz nach, bevor ich meiner Freundschaft mit Adelheid irreparablen Schaden zufügte. Also schwieg ich und wandte mich um, um erneut nach meiner Mutter Ausschau zu halten. Diese hatte die Verfolgung aufgeben müssen, weil sie von einer jungen Frau aus der Nachbarschaft abgefangen worden war, die ganz offensichtlich ein Kind erwartete. Auch wenn sie es zu verbergen suchte, ich erkannte Babybäuche auf den ersten Blick. Schließlich hatte ich fünf jüngere Geschwister. Vermutlich wurde meine Mutter soeben um Rat gebeten. Als mehrfache Mutter und Frau des Arztes galt ihre Meinung im Dorf viel.
Die Gelegenheit nutzend, gelang mir samt meiner Freundin die Flucht, und schon einen Augenblick später öffnete ich für Adelheid unser niedriges Gartentor. »Lass uns auf der Bank zwischen den Blumenbeeten in der Sommersonne sitzen«, schlug ich vor. »Dort kannst du mir von Goswin erzählen.«
»Aber nur kurz.« Adelheid rückte den Kragen ihres besten Kleides zurecht. »Das Sonntagsessen muss pünktlich aufgetragen werden, sonst schimpft der Vater. Und meine Mutter verlässt sich auf meine Hilfe.«
Doch für die Dauer der nächsten halben Stunde vergaßen wir all unsere Verpflichtungen und ich ließ Adelheid erzählen. Von Goswins blondem Haar, seinem freundlichen Lächeln und seiner stillen und zurückhaltenden Art. Letzteres verwirrte mich immer aufs Neue, sobald sie es erwähnte. Den Goswin Herkt, den ich noch aus Kindertagen kannte, hätte man damals nur schwerlich zurückhaltend nennen können. In meinen Erinnerungen, die sich in den endlosen Sommern meiner Kindheit abspielten, war Goswin ein lebhafter Junge, der immer zu Streichen aufgelegt war. Aber wir veränderten uns ja alle, warum nicht auch er? Ich hatte eines Tages begriffen, wie wichtig es war, hübsch zu sein, und Goswin würde gelernt haben, dass es wenig einbrachte, der zweite Sohn eines reichen Bauern zu sein. Die Lektionen des Lebens veränderten einen Menschen eben.
»Wenn er im Herbst seine Lehre bei Vater beginnt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir heiraten. Papa möchte Goswin gern als seinen Nachfolger in der Schmiede behalten, er hat ja keinen männlichen Nachkommen. Also werden Goswin und ich ein Brautpaar sein, noch bevor wir in diesem Jahr die Weihnachtslieder singen.« Adelheid lächelte verlegen und sah mich an. »Ich denke, es wird sich gut anfühlen, verheiratet zu sein. Was glaubst du?«
»Keine Ahnung.« Ich zuckte mit den Schultern. »Und da kaum Chancen bestehen, dass ich diese Erfahrung jemals machen werde, ich aber entsetzlich neugierig auf alles bin, wäre es nett, wenn du mir von deinen Erlebnissen in der Ehe erzählen würdest.«
Adelheid lief dunkelrot an und sprang von der Bank. »Caroline Gründig, über solche Dinge redet eine Frau doch nicht.«
»Das hoffe ich aber doch«, widersprach ich düster. »Wenn ich es schon nicht selbst erlebe, dann hätte ich die Berichte doch wenigstens gern aus zweiter Hand.«
Das Klappern des Gartentors und laute Rufe ließen Adelheids Gesichtsfarbe von rot zu weiß wechseln. »Ich habe die Zeit vergessen. Man sucht schon nach mir.«
Ein rascher letzter Gruß und schon lief sie durch die Beerensträucher und Blumenbeete davon. Ich blieb zurück. Und nachdem ich noch eine Weile den Bienen beim Honigsammeln zugesehen hatte, sah ich ein, dass es auch für mich höchste Zeit war, mich im Haus blicken zu lassen und meinen Pflichten nachzukommen.
Mit hängenden Schultern durchquerte ich den Garten und betrat das Haus durch die Vordertür. An der Garderobe band ich die Schleife auf und nahm das Häubchen ab. Für einen Moment fiel mein Blick in den Wandspiegel, der gleich neben Vaters Mänteln hing. Und ich sah mein verunstaltetes Gesicht. Die erdbeerroten, aufgeworfenen Male, die sich von meiner Wange über das linke Auge bis hoch zur Stirn zogen und mein Gesicht nun schon seit meiner Geburt entstellten.
Ich hatte die Landkarten in Vaters Folianten studiert. Das Mal in meinem Gesicht glich in seiner Form ganz eindeutig dem südamerikanischen Kontinent. Und auch wenn es mir keinerlei körperliche Schmerzen bereitete, so fraß es doch an meiner Seele und das seit nunmehr achtzehn Jahren.
»Caroline, wo bleibst du denn?« Meine Mutter erschien in der Diele, auf der linken Hüfte die kleine Flora, am Rockzipfel den immerhin schon fünfjährigen Bernd. Irgendwo in einem der hinteren Zimmer des Arzthauses stritten sich Gertrud und Clara wie die Kesselflicker und in seiner Wiege brüllte der kleine Carl. »Ich brauche deine Hilfe, sonst wird das Essen nie rechtzeitig fertig. Hast du vielleicht deinen Vater irgendwo gesehen?«