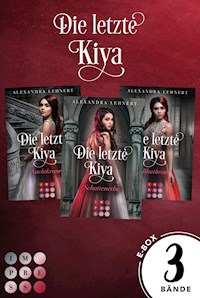
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
**Royal Vampires – Bist du bereit für das Erbe der Nacht?** Als Lilya auf der Ranch ihrer Eltern den attraktiven Dimitri trifft, ahnt sie nicht, dass der mysteriöse Fremde Kronprinz eines uralten Vampirgeschlechts ist. Schon seit Jahrzehnten sucht er nach ihr – der verschollenen Thronerbin eines anderen Königshauses. Gemeinsam betreten sie eine royale Welt, in der sich die Vampirrassen untereinander bekriegen und jeder nach der Krone der Nacht dürstet. Lilya muss sich schon bald fragen, ob die Gefühle, die sie mit Dimitri verbinden, stark genug sind, damit sie ihr wahres Erbe antreten kann … Eine ganz besondere Vampirgeschichte In der dramatisch-düsteren Vampir-Reihe entführt Alexandra Lehnert ihre Leser in das außergewöhnliche Leben der royalen Vampire. Eine großartige Fantasy-Trilogie mit der perfekten Mischung aus Spannung und atemberaubender Liebesgeschichte. Leserstimmen: »Suchtgefahr!! Absolut grandios« »Eine Geschichte mit Gänsehautfeeling« »Vampire mal anders« //Dies ist die Gesamtausgabe der dramatisch-düsteren Vampir-Reihe »Die letzte Kiya«. Sie enthält alle Romane der Fantasy-Liebesgeschichte: -- Die letzte Kiya 1: Schattenerbe -- Die letzte Kiya 2: Nachtkrone -- Die letzte Kiya 3: Blutthron// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2021 Text © Alexandra Lehnert, 2019, 2020 Lektorat: Dietlind Koch, Wencke Woitzik Coverbild: shutterstock.com / © Daria_Cherry / © Wlad74 / © Zabotnova Inna / © Naz-3D Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60613-3 www.carlsen.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Alexandra Lehnert
Die letzte Kiya 1: Schattenerbe
**Royal Vampires – Bist du bereit für das Erbe der Nacht?**Lilya trifft auf der Ranch ihrer Eltern einen Gast, dessen gefährliche und unnahbare Ausstrahlung all ihre Alarmglocken läuten lässt. Ihr Gefühl trügt sie nicht: Dimitri ist der Kronprinz eines uralten Vampirgeschlechts und schon seit Jahrzehnten auf der Suche nach ihr – der Thronerbin eines anderen Königshauses. Sie ist die Einzige, die ihm helfen kann, die Ordnung der verfeindeten Vampirrassen wiederherzustellen. Aber in dieser Welt gibt es strenge Regeln und ihre verbotene Liebe zu Dimitri zwingt Lilya dazu, mehr zu opfern, als sie bereit ist …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Alexandra Lehnert, geboren im April 1995 im wunderschönen Franken, entdeckte ihre Leidenschaft fürs Lesen und Schreiben bereits in ihrer Kindheit. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten abgeschlossen, merkte jedoch schnell, dass sie in dem Bürojob nicht glücklich werden würde. Die heute 24-Jährige macht nun eine Ausbildung zur Erzieherin und taucht in ihrer Freizeit am liebsten in fremde Welten ein.
Für Kristina,
I
TEXAS
1. Kapitel
Dimitri
»Braucht Ihr noch etwas, Hoheit?« Sarahs leise Stimme drang an mein Ohr.
»Momentan nicht«, grummelte ich, ohne den Blick von dem Jahresbericht vor mir zu lösen. Ich blätterte auf die nächste Seite und untersuchte die Fotos und Namen der abgebildeten Schüler. Erst nach einer Weile fiel mir auf, dass Sarah immer noch auf dem Boden kniete.
»Was ist?«, fragte ich genervt, als sie keine Anstalten machte, das Zimmer zu verlassen.
»Ich … ich weiß, es steht mir nicht frei, darüber zu reden, aber …«
»Dann solltest du es auch nicht tun«, unterbrach ich sie barsch.
Sie zuckte erschrocken zusammen, den Blick immer noch auf den Fußboden geheftet.
»Natürlich … aber … aber wir sind jetzt seit fast zwei Jahren unterwegs … Ich wollte nur wissen, ob ersichtlich ist, wann wir zurückkehren.«
Ich klappte das Heft zu und legte es auf dem Couchtisch ab.
»Ach, hast du etwa Heimweh? Gefällt es dir nicht, mit uns unterwegs zu sein? Du solltest dich glücklich schätzen, uns auf der Reise begleiten zu dürfen.«
»Das tue ich auch«, sagte sie schnell. »Ich habe mir nur Sorgen um meine Familie gemacht. Sie wissen nicht, ob sie mich jemals wiedersehen.«
»Warum solltest du dir Sorgen machen? Hast du etwa Grund zu der Annahme, dass ihnen zu Hause etwas passieren könnte?« Ich wusste, wem aus ihrer Familie die Sorge galt. Ich selbst war mir nicht sicher, ob ihr Bruder noch leben würde, wenn wir zurückkehrten.
»Mein Bruder hat morgen Geburtstag. Ich dachte … nun ja, vielleicht wäre es möglich, in Erfahrung zu bringen, ob es ihnen allen gut geht.« Nervös wickelte sie sich eine dunkelblonde Haarsträhne um den Finger.
»Verstehe. Und wenn dem nicht so ist? Du nützt uns nichts, wenn du nur Trübsal bläst, falls du erfährst, dass dein Bruder schlussendlich doch in seinen Tod gerannt ist.« Offensichtlich trafen meine Worte sie hart, denn sie zuckte zusammen.
»Das werde ich nicht. Bitte«, flehte sie mit brüchiger Stimme.
»Betteln nützt dir auch nichts!« Ich lehnte mich nach vorn und setzte ein eiskaltes Grinsen auf. »Sieh mich an«, wies ich sie an. Widerwillig hob sie den Kopf und ihr Blick aus grünen Augen begegnete meinem. Die Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben und Tränen glitzerten in ihren Augen. »Wenn du noch einmal deine Grenzen überschreitest, wird dich deine Familie tatsächlich niemals wiedersehen. Hast du das verstanden?«
Sie keuchte und sah zu Boden. »Selbstverständlich. Bitte verzeiht mir, Hoheit.«
»Was bist du?«, fragte ich abschätzig.
»Nur eine wertlose Sklavin, Hoheit.«
»Und was bin ich?«
»Ein ehrenwerter Prinz, Hoheit«, antwortete sie ehrfürchtig, dennoch entging mir der unterschwellige Hass in ihrer gepressten Stimme nicht.
»Sehr richtig. Vergiss das nie wieder.« Ich schlug das Heft erneut auf. »Du kannst jetzt gehen.«
»Danke, Hoheit.« Hastig stand sie auf, verbeugte sich und eilte aus dem Zimmer. Ich blickte ihr noch einen Moment hinterher, dann wollte ich mich wieder an die Arbeit machen, wurde aber erneut unterbrochen, als mein Begleiter Sascha die Hotelsuite betrat.
»Na, was Hilfreiches gefunden?«, fragte er.
»Natürlich nicht.« Genervt warf ich die Hefte in den Mülleimer neben der Couch. Sascha holte sie jedoch kopfschüttelnd wieder heraus.
»Dimitri, ich hatte doch gesagt, dass wir sie nicht einfach wegschmeißen. Wie sieht das denn aus, wenn wir in jedem Hotelzimmer einen Haufen Jahresberichte der umliegenden Schulen und Universitäten zurücklassen?«
»Als ob sich irgendein Mensch dafür interessiert, was wir wegschmeißen!«
»Trotzdem müssen wir uns nicht auffällig verhalten. Gerade du benimmst dich manchmal wie ein kranker Massenmörder, der an einer Schule Amok laufen will und sich schon mal seine Opfer aussucht«, bemerkte er vorwurfsvoll.
Ich grinste breit. »Bin ich das denn nicht?«
Statt einer Antwort verdrehte Sascha nur die Augen und packte die Hefte in eine Tüte, um sie später nach und nach irgendwo wegzuschmeißen. Meistens bewunderte ich ihn für diese Gründlichkeit, doch manchmal übertrieb er auch. Trotzdem hatte er recht damit, dass wir aufpassen mussten, welche Spuren wir hinterließen. Nicht wegen der Menschen, sondern vielmehr wegen unserer eigenen Rasse.
»Also können wir aufbrechen? Die ersten Vorlesungen beginnen bald«, stellte ich mit einem Blick aufs Handydisplay fest und stand auf.
»Klar …« Saschas nicht vorhandene Begeisterung war deutlich herauszuhören. Bei mir sah es nicht viel besser aus, aber die Aussicht, aus diesem öden Hotelzimmer zu kommen, hob meine Laune ein wenig. Zumindest für den Augenblick.
»Bloß nicht so stürmisch, Mann.« Ich verpasste Sascha einen freundschaftlichen Boxhieb auf den Oberarm und holte meine Jacke.
***
»Darf ich einem von Ihnen noch etwas bringen?«
Genervt schüttelte ich den Kopf und warf dem Kellner einen eiskalten Blick zu, der ihn schnell wieder verschwinden ließ.
»Der arme Kerl hat dir nichts getan, Dimitri. Lass deine Wut nicht an ihm aus.«
Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Gegenüber. Sascha schaute mich missbilligend an.
»Tut mir leid, dass wir nicht alle immer so gut drauf sein können wie du«, antwortete ich gereizt.
Sascha verdrehte die Augen. Das tat er auffallend häufig in meiner Gegenwart. »Du solltest aufhören, deine ganze Energie auf diese Suche zu verschwenden. Das verdirbt dir nur dauerhaft die Laune. Du wirst ihn nicht finden.«
Es war klar, dass er wieder auf diesem Thema herumritt, nachdem wir heute in der Universität keine Hinweise entdeckt hatten.
»Ich habe es dir schon tausend Mal gesagt. Lass das meine Sorge sein.« Gedankenverloren drehte ich das leere Glas vor mir hin und her. Mir war nicht nach einer Diskussion zumute. Texas war der letzte Bundesstaat, dann hatten wir auch die gesamten USA abgesucht. Anschließend würden wir weiter nach Mexiko reisen und Südamerika durchkämmen. Meine Hoffnung schwand von Tag zu Tag mehr, aber die Suche abzubrechen war keine Option. Fast fünfzehn Jahre lang hatte ich nichts anderes getan, als vermeintlich sinnlos durch die Welt zu reisen. Wie würde mein Volk reagieren, wenn ich mit leeren Händen zurückkäme? Diese Schmach wollte ich nicht erleben, dafür war mein Stolz viel zu groß. Eher würde ich mit der Suche immer wieder von vorn beginnen.
Sascha gab jedoch nicht nach. »Das Ganze bringt nichts. Anisyas Kind kann überall auf der Welt sein. Sie starb vor fast zwanzig Jahren. Wenn es tatsächlich stimmt, dass sie etwas mit einem Menschen hatte und ein Sohn aus dieser Verbindung entstanden ist, wird sie gut dafür gesorgt haben, dass ihn niemand finden kann. Das Kind müsste mittlerweile neunzehn oder zwanzig Jahre alt sein. Genau wissen wir es nicht. Das heißt, wir müssen alle Unis absuchen. Vorausgesetzt, dass er aufs College oder eine Universität geht. Und da Jugendliche häufig zum Studieren in eine andere Stadt ziehen, könnten wir mit unserer Suche gleich von vorn anfangen oder wir kontrollieren wie bisher die vergangenen Highschool-Jahrgänge. Wie willst du ihn überhaupt erkennen, wenn du ihn siehst? Wenn er zur Hälfte ein Mensch ist, könnte die Gefahr durchaus bestehen, dass keine typischen Merkmale der Kiye zu erkennen sind. Das Kind könnte im tiefsten Urwald aufwachsen oder in einer Großstadt. Findest du nicht, es ist an der Zeit, aufzugeben und sich um Wichtigeres zu kümmern?«
Ich fixierte einen Punkt an der Wand und vermied es, Sascha anzusehen. Er zählte alle Probleme auf, die mir jeden Tag durch den Kopf gingen, und das brachte meine Laune wirklich auf den Tiefpunkt.
»Ich weiß das alles. Aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich den letzten Nachfahren ihrer Familie finden. Ich lasse nicht zu, dass Valentins Spione vor mir erfolgreich sind.«
»Bitte, Prinz Dimitri …« Er senkte die Stimme und sah mich über den Tisch hinweg eindringlich an. »Denk darüber nach, welche Pflichten du deinem Volk gegenüber hast. Du reist seit Jahren durch die Welt auf der Suche nach jemandem, dessen Existenz noch nicht einmal bewiesen ist. Wir können Valentin auch auf andere Art und Weise besiegen. Das Rätsel wird sich auf lange Sicht von allein lösen. Anisyas Sohn wird immerhin in den nächsten Jahren erwachen. Irgendwann wird er auftauchen, wenn es ihn tatsächlich gibt.«
»So lange will ich aber nicht warten!«, antwortete ich gereizt. Ich wusste, dass ich mich wie ein trotziges Kind anhören musste, das sein Spielzeug nicht bekam. Nur waren Ausraster von Kindern nicht so tödlich wie meine.
»Dimitri, du weißt, dass ich dir überallhin folgen werde. Wenn du es möchtest, reise ich auch die nächsten Jahrhunderte an deiner Seite durch die Welt. Ich werde mit dir jede Stadt und jedes Dorf überprüfen, das habe ich dir immerhin geschworen, aber ich mache mir langsam Sorgen um dich. Gib dich bitte nicht selbst auf. Du bist unser Prinz, unser rechtmäßiger König. Egal, wie die Sache hier ausgeht, wir brauchen dich.« Er sah mich eindringlich an. »Es ist deine Aufgabe, Valentin zu stürzen. Lauf nicht vor der Verantwortung davon, nur weil du damals versagt hast.«
Saschas letzte Worte brachten mein Blut endgültig zum Kochen.
»Ich habe nicht versagt!«, brüllte ich und sprang vom Stuhl auf. Die anderen Gäste blickten neugierig in unsere Richtung, wie in Erwartung eines Spektakels. Einen Moment lang war ich versucht, ihnen genau das zu geben. Eine Schlägerei, eine Randale. Einfach mal wieder Dampf ablassen. Das hatte ich schon viel zu lang nicht mehr getan. Ich wüsste zu gerne, wie der beherrschte Sascha reagieren würde, wenn ich mich auf ihn stürzte. Aber es war vermutlich unklug, noch mehr Aufsehen zu erregen. Sonst würden die Leute anfangen, ihre Handys auszupacken und zu filmen. Ich wollte lieber nicht an die Konsequenzen denken, wenn mein Volk im Internet eine Schlägerei von mir und meinem Gefährten fände. Valentin zumindest würde sich köstlich amüsieren. Und alle Zeugen im Restaurant gleich mit zu erledigen war vielleicht auch zu viel des Guten. Also riss ich mich zusammen und stürmte wortlos aus dem Lokal.
***
An der frischen Luft beruhigte ich mich langsam wieder. Die kleine Kneipe lag in einer ruhigen Seitenstraße, somit begegnete mir niemand, während ich über den Gehweg schlenderte. Sascha war mir inzwischen hinterhergeeilt. Ich spürte, dass er mir mit ein paar Metern Abstand folgte.
Auch wenn ich sauer auf ihn war, ließ er mich doch niemals allein. Er war der beste Freund, den ich hatte. Vielleicht sogar der einzige. Doch das würde ich niemals zugeben. Alle anderen, mit denen ich Kontakt hatte, arbeiteten lediglich für mich. Nur ungern baute ich eine Beziehung zu Fremden auf. Ich war ein Einzelgänger. Insgeheim sah ich Sascha nicht als Untergebenen, sondern tatsächlich als Freund an. Ich war mir aber sicher, dass er es wusste, auch wenn ich es nicht sagte. Schließlich gestattete ich ihm Bemerkungen wie die von eben, ohne ihn umzubringen.
Seufzend blieb ich stehen und gab Sascha ein Zeichen, dass er zu mir aufschließen durfte. Er stellte sich neben mich und hielt respektvoll den Kopf gesenkt. Bevor er sich entschuldigen würde, kam ich ihm zuvor.
»Tut mir leid, Sascha. Du hast nur Tatsachen genannt, ich hätte deshalb nicht laut werden dürfen.«
Überrascht sah er auf. »Wieso glaubst du, mir eine Entschuldigung schuldig zu sein?« Seine Augen, die den gleichen Braunton wie meine hatten, musterten mich fragend. Für Außenstehende wirkten wir vermutlich wie Brüder. Die gleichen dunkelbraunen Augen und Haare, die ähnliche Statur – groß und muskulös. In unserem Volk, den Djiye, sahen wir uns alle ähnlich. Theoretisch waren wir auch eine große Familie. Trotzdem gab es zwischen uns genug Unterschiede, zum Beispiel in den Gesichtszügen, die man erkennen konnte, wenn man genau hinsah. Die meisten Menschen machten sich nur nicht die Mühe, auf Details zu achten. Wie bei Europäern, für die alle Asiaten gleich aussahen.
»Ich weiß, dass ich das nicht bin. Aber ich wünsche mir von dir Ehrlichkeit, dann sollte ich nicht so reagieren, wenn ich sie höre.«
Ein Lächeln huschte über Saschas Gesicht. »Danke. Das bedeutet mir viel. Aber wie du sicher weißt, nehme ich dir deine Ausraster nicht übel. Ich bin froh, dass ich nicht an deiner Stelle stehe und so viel Verantwortung trage. Da sei dir deine schlechte Laune verziehen.«
Dankbar klopfte ich ihm auf die Schulter und nickte knapp. »Ich verstehe.«
Ich wollte noch etwas sagen, da bog eine Gruppe Jugendlicher in die Gasse ein. Vier Jungs und zwei Mädchen, die aussahen, als wären sie auf dem Weg von einer wilden Party zur nächsten. Normalerweise würde ich der Gruppe keine weitere Beachtung schenken, doch einer der Jungs weckte mein Interesse.
Sie blieben etwa zwanzig Meter von uns entfernt stehen und die anderen Jungen und Mädchen unterhielten sich lautstark, ohne auch nur einen Blick in unsere Richtung zu werfen. Der eine Kerl jedoch sah mir direkt in die Augen. Ich bemerkte sofort, dass er kein normaler Teenager sein konnte. Er war ein unerweckter Djiyo, der vermutlich unter den Menschen aufwuchs. Seinem Blick nach zu urteilen erkannte er mich auch. Abschätzig musterte er mich von oben bis unten, bevor sein Blick wieder an meinem Gesicht haften blieb.
Wut kochte in mir hoch. Ich hasste es, wie schlecht meine eigene Rasse von mir dachte. Ich war sein Kronprinz, er hatte sich mir gegenüber gefälligst respektvoll zu verhalten. Zornig ballte ich die Hände zu Fäusten und machte einen Schritt auf ihn zu. Ich würde diesem Wicht eine Lektion erteilen.
Sascha schien meine Absicht erraten zu haben, denn er griff nach meinem Arm und zog mich zurück. Diese kleine Geste reichte wie immer, um mich zurück auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Schnaubend warf ich dem Jungen noch einen finsteren Blick zu, befreite mich aus Saschas Griff und marschierte in die entgegengesetzte Richtung.
Zwei Straßen weiter, wo wir unsere Mietwagen geparkt hatten, blieben wir schließlich stehen.
»Welch unangenehme Begegnung«, meinte Sascha und lehnte sich an seinen weißen Chrysler. »Hoffentlich macht es nicht die Runde, dass wir hier sind.«
»Mhh«, grummelte ich. »Ich hasse dich dafür, dass du mich immer zwingst, das Richtige zu tun. Ich hätte diesen Wicht auseinandernehmen sollen.«
»Nein, hättest du nicht – und das weißt du genau. Die Leute haben ohnehin schon ein schlechtes Bild von dir. Verschlimmere es nicht, indem du wehrlose Kinder verprügelst.«
»Pah, wehrlose Kinder! Respektlose und unerzogene Bälger sind das. Sind die Eltern etwa nicht mehr in der Lage, ihren Kindern Manieren beizubringen? Oder ist das der Einfluss der Menschen, unter dem viele von ihnen aufwachsen?«
»Zeiten ändern sich nun mal. Er war jung und hat mit seinen Freunden Party gemacht. Du konntest den Alkohol doch ebenfalls riechen. Diese Phase der Rebellion hattest du auch. Wären wir ihm allein begegnet, wäre er sicher vor lauter Angst vor dir auf die Knie gesunken.«
Bei dem Gedanken musste ich schmunzeln. Tatsächlich fühlten sie sich in einer Gruppe – selbst wenn sie nur aus Menschen bestand – ziemlich sicher, wohingegen einzelne Djiye nicht schnell genug das Weite suchen konnten. Hin und wieder begegneten wir während der Reise auch Siye. Vor allem bei unseren Recherchen in den Universitäten. Im Gegensatz zu meiner Rasse hatten sie das Wort »Respekt« offensichtlich noch nicht verlernt. Keiner von ihnen würde sich mir gegenüber jemals unangemessen verhalten.
»Nun gut, für heute sparen wir uns die Maßregelung.« Nach einer kurzen Pause wechselte ich das Thema, um mich abzulenken. »Also, wie sieht der Plan für die nächsten Tage aus? Die Schulen und Universitäten hier in Dallas haben wir alle überprüft. Welche kommen als Nächstes dran?«
»Ich habe eine Liste mit den Schulen in der umliegenden Gegend erstellt. Da nächste Woche Ferien sind, wird es jedoch wenig Sinn machen, sie zu besuchen«, erklärte Sascha.
»Oh, verdammt.« Stöhnend legte ich den Kopf in den Nacken. »Du hast recht, es ist Spring Break. Das hatte ich ganz vergessen.«
Sascha lachte. »Ach komm, so schlimm ist das doch nicht. Das heißt, es gibt eine Menge Partys. Vielleicht sollten wir uns einfach unter das Volk mischen. Dort können wir genauso nach Anisyas Sohn Ausschau halten. Und außerdem würde dir ein bisschen Spaß sicher nicht schaden.« Er zwinkerte vergnügt, doch ich verdrehte nur stöhnend die Augen.
»Und dabei noch mehr Typen wie dem von eben begegnen? Da bräuchte ich aber sehr viel Alkohol, damit es kein Blutbad gibt. Aber meinetwegen, ich habe ja schließlich einen Aufpasser dabei.« Ich warf ihm ein breites Grinsen zu. »Seit wann freut sich mein Siyo eigentlich über Partys?«
»Oh, fang nicht wieder damit an«, meinte er vorwurfsvoll, konnte sich ein kleines Lächeln aber nicht verkneifen.
Ich hob beschwichtigend die Hände. »Sorry, aber es fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Abgesehen von den optischen Merkmalen der Djiye haben wir irgendwie keine Gemeinsamkeiten. Ich glaube immer noch, dass deine Eltern Siye sind.« Sascha war ein sehr guter Krieger, doch aufgrund seines Charakters verspottete ich ihn oft, dass er ein Kind der Siye wäre, denn diese Rasse zeichnete sich anders als die Djiye durch Sanftmut und Vernunft aus.
»Jaja, mach dich nur lustig. Sei froh, dass die charakterlichen Eigenschaften bei mir nicht so ausgeprägt sind, ansonsten hättest du wirklich niemanden, der auf dich aufpasst.«
»Wohl wahr.« Amüsiert schüttelte ich den Kopf. »Also zurück zu ernsteren Themen. Wir sollten morgen noch mal zum Flugplatz fahren, unser restliches Zeug holen und Bescheid geben, dass wir länger bleiben. Bei der Gelegenheit können wir auch die Befragung erledigen.«
»Natürlich. Fahren wir jetzt zurück zum Hotel?«
Ich schüttelte den Kopf. »Fahr du ruhig schon. Ich will noch ein bisschen den Kopf frei bekommen.«
Sascha musterte mich skeptisch, hielt sich aber mit einem Kommentar zurück. »Verstehe.« Er verbeugte sich leicht und stieg in den Wagen. Ich hob eine Hand zum Abschied, nahm aber nicht meinen schwarzen Ford Mustang, sondern ging zu Fuß weiter Richtung Innenstadt.
2. Kapitel
Lilya
Ich werde verfolgt. Jede Faser meines Körpers drängt mich zur Flucht, doch ich bin zu langsam, um meine Verfolger abzuschütteln.
Seit Tagen bin ich auf den Beinen. Ich muss mich endlich ausruhen und wieder zu Kräften kommen. Keuchend bleibe ich an einer dunklen Straßenkreuzung stehen und schaue mich um. Die Monster verstecken sich. Treiben mich vor sich her, wie das Raubtier seine Beute.
Dabei sollte ich das Raubtier sein. Diese Monster sind dumm und schwach, doch sie können mir in meinem momentanen Zustand sehr gefährlich werden. Vor allem, wenn sie in der Gruppe angreifen.
Mir bleibt keine Zeit mehr zu Atem zu kommen, denn ich bemerke, wie sie mich umzingeln. Ein Dutzend dieser widerlichen Kreaturen schleicht langsam auf mich zu. Allein werde ich sie niemals besiegen können. Panisch lege ich eine Hand auf meinen gewölbten Bauch. Ich darf jetzt nicht sterben!
Ich fauche wütend und starre in ihre toten ausdruckslosen Augen. Ein Wimpernschlag vergeht, dann greifen sie an.
»Hey, Miss, wachen Sie auf!«
Erschrocken öffnete ich die Augen und blickte in das Gesicht einer hübschen Stewardess, die mich am Arm gepackt hatte.
»Was ist los?«, fragte ich ein wenig desorientiert.
»Sie haben offensichtlich schlecht geträumt. Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Sie hielt mir ein Glas Wasser hin und lächelte. Dankbar nahm ich es entgegen und trank einen Schluck.
»Ja, danke, alles okay.« Ich rieb mir verschlafen die Augen. Verdammt, es war schon wieder passiert. Ich hatte nur kurz die Augen zumachen wollen und war wohl eingenickt.
Die Stewardess nickte und ging wieder. Die anderen Passagiere in meiner Nähe warfen mir jedoch noch eine Weile seltsame Blicke zu.
So viel Aufmerksamkeit hatte nicht einmal der ältere Mann zwei Reihen vor mir erhalten, der vorher lauthals geschnarcht hatte, oder die durchgehend schreienden Babys in den hintersten Reihen. Hatte ich geschrien, im Schlaf geredet oder sogar um mich geschlagen? Ich wusste es nicht und würde mich hüten, meine Sitznachbarn danach zu fragen. Das war wirklich zu peinlich. Mit hochrotem Kopf versank ich tief im Sitz. Ich konnte nirgendwo mehr in Ruhe schlafen. Seit einigen Monaten plagten mich diese schrecklichen Albträume und langsam machte ich mir wirklich Sorgen deswegen.
Als kurze Zeit später die Anschnallzeichen aufleuchteten und eine Durchsage erklang, war der Albtraum vor meinem inneren Auge schon fast verblasst und ich konnte mich wieder entspannen. Auch die anderen Passagiere hatten ihr Interesse an mir verloren. Bald bin ich zu Hause, dachte ich freudig und sah aus dem Fenster, während wir in den Landeanflug gingen. Die Spitzen der Hochhäuser von Dallas verschwanden aus meinem Blickfeld, als wir genau auf sie zusteuerten. Sehnsüchtig bewunderte ich die umliegende Landschaft der Großstadt. Meine Heimat. Ich kannte die Umgebung in- und auswendig, immerhin hatte ich sie Tausende Male erkundet, sowohl auf dem Rücken meiner Pferde als auch aus der Luft mit meinen Flugzeugen.
***
Ungeduldig trat ich von einem Fuß auf den anderen. Dutzende Urlauber tummelten sich auf dem Flughafengelände von Dallas. Es war Freitagabend und nächste Woche Spring Break. Viele flogen in die Ferien oder nach Hause, so wie ich. Gedankenverloren betrachtete ich, wie Menschenmassen aus dem Gebäude hetzten und sich die einen auf den Weg zu einem Taxi oder Bus machten, während die anderen von Verwandten oder Freunden abgeholt wurden. Ein Empfangskomitee mit bunten Ballons und Willkommensschildern lief an mir vorbei. Auf mich wartete niemand. Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Immer wieder zog ich mein Handy aus der Hosentasche und warf einen Blick aufs Display. Bereits Viertel nach acht. Er kam zu spät.
Seufzend zog ich meinen roten Trolley zu der nächsten Bank und durchwühlte meine Handtasche nach etwas Süßem. Nachdem ich eine Tüte Bonbons gefunden hatte, stellte ich mich auf eine längere Wartezeit ein. Da hatte der Flug bereits zwanzig Minuten Verspätung gehabt und trotzdem kam er zu spät. Das war ungewöhnlich. Normalweise musste ich mich beeilen aus dem Gebäude zu kommen, weil er bereits viel zu früh da war.
Dass er sich heute ein wenig verspäten könnte, hatte er vorhin aber noch geschrieben. Ansonsten hätte ich mir jetzt ziemliche Sorgen gemacht.
Weitere zehn Minuten vergingen, dann erblickte ich zwischen den ankommenden Autos endlich den dunklen Jeep meines Vaters. Er parkte den Wagen am Straßenrand, stieg aus und winkte mir zu. Als ich am Wagen ankam, ließ ich den Koffer stehen und warf mich in die Arme meines Vaters.
»Daaad! Ich freue mich so dich zu sehen.«
»Oh, Lilya, mein kleines Mädchen. Es ist schön, dass du wieder hier bist.« Er drückte mich an sich und ich hatte das Gefühl, dass er mich auch nie wieder loslassen wollte. »Tut mir wirklich leid für die Verspätung«, entschuldigte er sich, verriet aber den Grund dafür nicht. »Na, wie war der Flug?«, fragte er stattdessen, nachdem er mich wieder losgelassen und sich meinen Koffer geschnappt hatte.
»Sehr ruhig«, antwortete ich schulterzuckend und verschwieg die Strapazen der Reise.
»Ich glaube, du willst wieder hier einziehen, kann das sein?«, meinte er schmunzelnd, als er dabei war, meinen schweren Koffer auf die Ladefläche zu hieven.
»Man weiß nie, was man braucht.« In der Hinsicht war ich auch nur ein ganz normales Mädchen. Allerdings hatte ich viele Bücher eingepackt, nachdem ich mir vorgenommen hatte, die nächste Woche über zu lernen. Das hatte mir zumindest meine Freundin Rachel geraten. Es sollte mich von anderen Dingen, vor allem von jeglichen Gedanken an meinen Ex-Freund, ablenken.
Ich ließ mich auf dem Beifahrersitz nieder und mein Vater fädelte sich wieder in den Verkehr ein. Bis zu unserer Ranch stand uns noch eine neunzigminütige Autofahrt bevor.
»Ist schön, wieder hier zu sein«, meinte ich, als die weite Landschaft von Texas an uns vorbeizog.
»Vor allem die angenehmeren Temperaturen hast du vermisst, was?« Er warf einen Blick auf meine dicke Winterjacke, die ich direkt auf den Rücksitz geworfen hatte.
»O ja. In New York ist das Wetter aktuell wieder eine Katastrophe.« Nachts sank die Temperatur immer noch unter den Gefrierpunkt. Allein bei dem Gedanken daran fröstelte ich. Ein Blick auf die Temperaturanzeige des Jeeps verriet mir, dass wir hier bereits siebzehn Grad erreicht hatten, was mir deutlich lieber war als das nasskalte Wetter an meinem zweiten Wohnort. Ich hatte meine Heimat wirklich sehr vermisst. Zuletzt war ich an Weihnachten hier gewesen, was definitiv zu lange her war. Nicht nur wegen des Wetters.
»Und gibt’s was Neues auf der Ranch, Dad?«
»Nein, alles beim Alten. Es war sehr ruhig ohne dich.« Er zwinkerte mir zu.
»Du hast mir auch gefehlt«, antwortete ich schmunzelnd. »Und Mom und Malyk«, fügte ich leise hinzu. Wehmütig dachte ich daran, dass ich sie erst in einigen Wochen wiedersehen würde. Ich hatte vor ein paar Tagen erfahren, dass sie beide über Spring Break nicht ebenfalls nach Texas kommen würden, sondern in Europa blieben.
Wir hielten an einer Kreuzung und mein Vater warf mir einen vielsagenden Blick zu. »Ich vermisse deine Mutter und deinen Bruder auch. Aber bei unserem Australienurlaub werden sie beide dabei sein. Wir haben also etwas, worauf wir uns freuen können.« Dass er sich genauso freute, bezweifelte ich stark, sagte allerdings nichts dazu.
»Ja, ich weiß. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht.« Ich freute mich nicht nur, den Rest meiner Familie wiedersehen zu können, sondern auch endlich mal die USA zu verlassen. Bisher hatten wir unsere Urlaube nicht weit weg von zu Hause verbracht. Dabei war mein Vater beruflich auf der ganzen Welt unterwegs, meine Mutter leitete inzwischen ein Hotel in Deutschland und mein Bruder besuchte seit Jahren ein Internat in der Schweiz. Nur ich hatte das Gefühl, irgendwie hier festzusitzen, was sich aber zumindest deutlich gebessert hatte, nachdem mein Dad mir nach der Highschool erlaubt hatte, in New York zu studieren.
»Hast du denn schon Pläne für die Reise?«, unterbrach er meine Gedanken.
»Nicht direkt. Ich will einfach alles sehen und machen. Vom Surfen bis zu einer Tour durchs Outback.«
»Klingt gut. Mal sehen, was Malyk alles plant.«
Ich musste bei dem Gedanken an meinen jüngeren Bruder lächeln. Er interessierte sich seit einigen Jahren für nichts anderes mehr als verschiedenste Kampfsportarten. Die Pubertät schien er irgendwie ausgelassen zu haben. Sein scheinbar mangelndes Interesse an Frauen war einer der Punkte, mit dem ich ihn gerne aufzog, und wenn ich sagte, dass wir auf ein Outing von ihm warten würden, verdrehte er nur genervt die Augen und beschwerte sich, dass es auch noch Wichtigeres als Beziehungen gab.
»Wird Mom eigentlich auch nach dem Urlaub mit nach Texas oder wieder zurück nach Europa fliegen?«, fragte ich und begab mich damit auf gefährliches Terrain. Die Ehe meiner Eltern war ein schwieriges Thema, doch ich war schließlich schon lange kein Kind mehr, dem man etwas vormachen musste.
Dad stöhnte. »Nach Europa, denke ich. Aber das werden wir noch sehen. Sie hat dort zu viel Verantwortung, die sie nicht einfach abgeben kann.«
Ich verstand die Problematik. Meine Mutter hatte das Hotel von ihren Eltern geerbt und wollte es nicht einfach verkaufen. Und mein Dad führte nach wie vor die Ranch, auch wenn er seit einiger Zeit wieder seinen alten Beruf als Pilot verfolgte, weshalb sein Bruder mehr und mehr die Arbeit auf der Ranch übernahm. Doch ich wusste, dass es sicher eine Lösung geben würde, wenn meine Eltern noch eine intakte Beziehung führten.
»Dad, wieso sprichst du mit mir nicht ehrlich über Mom?«
»Was meinst du?«, fragte er und tat ahnungslos.
»Na, was ist da los? Ihr müsst vor Malyk und mir nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Wir sind keine kleinen Kinder mehr und blöd auch nicht. Glaubst du wirklich, wir wüssten nicht, dass da nichts mehr läuft?«
Er legte die Stirn in Falten und blickte einige Zeit stumm auf die Straße, bevor er antwortete. »Weißt du, es ist komplizierter, als du vielleicht denkst. Deine Mutter und ich, wir hängen sehr aneinander, doch wir haben uns weiterentwickelt. Sie war doch erst fünfzehn, als sie mit dir schwanger wurde. Seitdem ist so viel passiert. Sie liebt dich und deinen Bruder über alles, doch ich schätze, sie braucht einfach mal diesen Abstand. Wir haben beide viel um die Ohren, da läuft nicht immer alles rund.«
Nachdenklich lehnte ich die Stirn gegen die kühle Scheibe und beobachtete den Sonnenuntergang in der Ferne. Auch wenn es logisch klang, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass hinter seinen Worten noch viel mehr steckte, als er verraten wollte …
***
»Anisya?« Jurij, einer meiner vertrautesten Wächter, tritt zu mir auf die Lichtung. Ich erkenne ihn trotz der Dunkelheit der wolkenverhangenen Nacht.
»Die Männer sind zurück und wir haben Euch gesucht, um mit Euch zu sprechen.«
Ein weiterer Djiyo erscheint zwischen den Bäumen. Seinen Namen kenne ich allerdings nicht. Respektvoll hält er den Kopf gesenkt. Ich weiß, dass er schlechte Nachrichten bringt, ehe er die Worte aussprechen kann.
»Eure Hoheit, es tut mir sehr leid, Euch das mitteilen zu müssen, aber Euer Mann Yaris ist tot!«
»Nein, nein, nein!«
»Lilya! Lya, wach auf!«
Die Stimme meines Vaters drang in mein Bewusstsein und riss mich aus dem Traum. Die Dunkelheit verschwand, stattdessen musste ich gegen helles Licht anblinzeln. Seine dunklen Augen waren das Erste, was ich erkennen konnte. Er hatte sich über mich gebeugt und rüttelte mich noch immer an den Schultern. Auf seinem Gesicht zeigte sich Besorgnis und er wirkte erschöpft. Als er merkte, dass ich wach war, ließ er mich los.
»Alles in Ordnung. Es ist vorbei«, sagte er erleichtert.
Ich blinzelte erneut und sah mich vorsichtig um. Ich lag verschwitzt und keuchend im Bett. Mein Vater trat einen Schritt zurück, sodass ich mich aufrichten konnte. Ich hob eine Hand und rieb mir den schmerzenden Nacken.
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Du hast im Schlaf geschrien«, sagte er seufzend. »Mal wieder. Ich dachte, es hätte aufgehört?« Mit ernster Miene sah er zu mir herunter. Der Albtraum. Natürlich, was auch sonst? Wieso hatte ich nicht daran gedacht, ihn vorzuwarnen? Als ich ihm am Telefon verschwiegen hatte, dass die Albträume auch nach Silvester weitergegangen waren, hatte ich eigentlich angenommen, dass sie bis Spring Break nicht mehr relevant sein würden. Selbst nach dem Flug gestern hatte ich es noch verheimlicht. Bis auf die anderen Passagiere hatte ich seit Wochen niemanden mit meinem nächtlichen Geschrei gestört. In New York gab es keinen mehr, den ich aus dem Schlaf reißen konnte.
»Wie spät ist es?«, fragte ich gähnend und ignorierte seine Frage.
Auf der Stirn meines Vaters bildeten sich Falten. »Halb fünf.«
Na ja, das war ja noch annehmbar. Bei den letzten Malen hatte ich meine Familie immer bereits um drei Uhr früh durch mein Geschrei geweckt.
»Dann werde ich jetzt aufstehen.« Ich machte Anstalten, aus dem Bett zu steigen, doch er hielt mich davon ab. »Du solltest lieber versuchen weiterzuschlafen. Du musst ausgeschlafen sein, wenn du nachher noch lernen und auf der Ranch helfen willst.«
»Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch schlafen kann. Ich werde ein Bad nehmen, um mich zu entspannen. Vielleicht kann ich danach wieder ins Bett.« Ich stand auf, gab ihm einen Kuss auf die Wange und lief aus dem Zimmer. An der Tür blieb ich noch einmal stehen und drehte mich zu ihm um. »Ich finde, du solltest wieder ins Bett gehen. Du siehst ziemlich müde aus. Ich komm schon allein klar.«
Er schaute mich bestürzt an. Ihm schien noch etwas auf dem Herzen zu liegen. Ich wartete darauf, dass er es aussprach, aber dann nickte er und ging in sein Schlafzimmer zurück, wobei ich ihm noch ein »Gute Nacht« hinterherrief.
***
Im Bad ließ ich Wasser in die Badewanne, putzte mir die Zähne und betrachtete mich prüfend im Spiegel. Die schlaflosen Nächte hatten ihre Spuren hinterlassen. Man könnte meinen, ich wäre um Jahre gealtert. Nun, zumindest war ich dieser Auffassung. Ich wirkte blasser, als ich es ohnehin schon war. Seitdem ich so viel Zeit in New York verbrachte, hatte ich noch mal deutlich an Farbe verloren. Meine sonst so gesunden schwarzen Haare sahen strohig aus, ich hatte Zahnschmerzen und fühlte mich ziemlich schlapp. Die Träume hatten mich ausgelaugt. Es hieß, man verarbeite in ihnen seine Erlebnisse, aber ich konnte keine Veränderung in meinem Leben benennen, die solche schlimmen Albträume ausgelöst haben könnte. Zugegeben, die letzten Monate waren nicht ganz stressfrei verlaufen, da ich viel für die Uni lernen musste und erst mit einer Beziehungskrise und nun einer Trennung zu kämpfen hatte, allerdings waren das meiner Meinung nach keine Gründe für die schlaflosen Nächte.
Obwohl ich mich an keinen der Träume erinnerte, war ich mir ziemlich sicher, dass es verschiedene Arten von Albträumen waren. Nach manchen hatte ich einfach nur Angst, bei anderen das Gefühl, etwas oder jemanden verloren zu haben. Ich wünschte, ich wüsste, was es mit diesen Träumen auf sich hatte und wie ich sie loswerden konnte. Endlich mal wieder durchzuschlafen wäre wunderbar. Müde gähnte ich und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Nach einem weiteren skeptischen Blick in den Spiegel zog ich mich schließlich aus und stieg in die heiße Wanne.
***
»Vielleicht sollte ich hierbleiben. Ich mache mir Sorgen um dich.«
Mein Vater stand mit gepackten Koffern im Flur und beäugte mich misstrauisch. Ich hatte die Augenringe überschminkt und fühlte mich trotz der unruhigen Nacht mittlerweile wieder erstaunlich fit. Er schien es mir allerdings nicht so richtig abzukaufen. Bereits beim Frühstück hatte er mich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Nachdem er mir außerdem gebeichtet hatte, dass er kurzfristig für einen Kollegen einspringen und deshalb den nächsten Flieger nach Los Angeles nehmen musste, rechnete er sicher damit, dass ich wütend oder enttäuscht war. Doch das war ich nicht, auch wenn ich mich auf die paar Tage Auszeit bei meiner Familie gefreut hatte. Jetzt war halt niemand von ihnen mehr da.
»Es ist in Ordnung, Dad. Ich weiß, wie sehr du deine Arbeit liebst. Außerdem hast du für mich und Malyk schon genug aufgegeben. Du solltest deinen Kollegen nicht absagen, nur weil deine erwachsene Tochter ein paar Albträume hat.«
»Ich weiß, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Du hast mir nicht erzählt, dass es auch nach deinem letzten Besuch noch weitergegangen ist. Das quält dich jetzt seit Monaten. Und jetzt lass ich dich auch noch allein hier. Das ist nicht sehr fürsorglich von mir. Versprich mir, mich sofort anzurufen, wenn es schlimmer wird.« Nervös fuhr er sich mit einer Hand durch die dunkelbraunen Haare.
»Mach ich, Dad. Auch wenn du bis zu meiner Abreise nächstes Wochenende nicht zurück sein solltest, sehen wir uns doch trotzdem in ein paar Wochen wieder. Bis zu unserem Urlaub sind diese Albträume bestimmt längst Geschichte.«
Seine braunen Augen musterten mich durchdringend. Warum auch immer, aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht daran glaubte. Gerade als ich ihn fragen wollte, was ihn so bedrückte, lächelte er mich an und strich mit der Hand über meine schwarzen Locken.
»Hoffentlich. Vielleicht solltest du dir mal eine Auszeit gönnen. Du hast so viel zu tun, dass dir das irgendwann über den Kopf wachsen könnte. Die Arbeit auf der Ranch, das Reiten, das Fliegen, das Cheerleading und dein Studium. Versuch mal, ein wenig kürzerzutreten.«
Ich nickte, wusste jedoch, dass ich seinen Rat nicht beherzigen würde. Ich liebte all diese Dinge und wollte nichts davon aufgeben.
»Ich versuche es. Auf Wiedersehen, Dad.« Ich umarmte ihn und gab ihm zum Abschied einen Kuss auf die Wange.
»Mach’s gut, meine Große. Pass auf dich auf«, sagte er und löste sich von mir. Ein letztes Mal musterte er mich besorgt und lief schließlich zu seinem Taxi. Ich winkte ihm hinterher und spürte eine tiefe Leere in mir, als der Wagen aus meinem Sichtfeld verschwand. Ich fühlte mich schrecklich allein. In New York war das ein beinah alltägliches Gefühl. Umgeben von Millionen fremder Menschen kam ich mir oft einsam und verloren vor, auch wenn ich dort viele Freunde hatte. Für andere hatte mein Leben den Anschein, perfekt zu sein, doch das war es nicht. Etwas Entscheidendes fehlte und ein Teil davon war eben mit dem Taxi davongefahren.
Nun war meine komplette Familie ausgeflogen. Meine Mutter und mein Bruder waren dieses Jahr noch überhaupt nicht in den USA gewesen und mein Onkel und meine Tante waren vor ein paar Tagen abgereist, um ihren Sohn in Chicago zu besuchen. Somit würde ich die nächste Woche mit unseren Angestellten und den Feriengästen allein sein, bevor sie zurückkämen und ich wieder nach New York zur Uni musste. Zu Beginn der Semesterferien in drei Monaten würde ich dann mit Dad endlich nach Australien fliegen und dort meine Mutter und Malyk treffen.
Für einen Moment blieb ich an der Tür stehen und schaute in die Ferne. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass mein Vater mir etwas verheimlichte. Seitdem ich ihm von den eigenartigen Träumen erzählt hatte, verhielt er sich anders. Ich wusste nur nicht, wieso.
3. Kapitel
Dimitri
»Sarah!«, brüllte ich, sobald die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war. Der Abend war mal wieder nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich war wütend auf alles und jeden und irgendjemand musste dafür büßen. Und jetzt war der perfekte Zeitpunkt, weil Sascha mich nicht maßregeln konnte, da er in seinem Hotelzimmer am Ende des Ganges schlief. Es gab nicht viele, an denen ich meine Wut auslassen konnte, ohne dass ich Aufsehen erregte.
»Hoheit?«
Ich hatte sie offensichtlich aus dem Schlaf gerissen. Sie lag mit verstrubbelten Haaren auf der Couch. Dennoch starrte sie mich mit wachem Blick an. Sie war auf der Hut, immerhin wusste sie zur Genüge, was passierte, wenn ich schlecht gelaunt war. Ängstlich drückte sie die Decke an die Brust.
»Hoheit, Ihr habt getrunken«, stellte sie fest.
Mit wenigen Schritten hatte ich die Suite durchquert und entriss ihr die Decke. »Das weiß ich auch, ohne dass du es mir sagst.« Nachdem Sascha zurück ins Hotel gefahren war, war ich noch in einer Bar gewesen und hatte mich durch das ganze Sortiment getrunken. Mit jedem Drink waren die Frustration und Wut gestiegen. Meine jetzige Stimmung war der Grund, warum ich mit Alkohol vorsichtig sein musste.
Ich packte Sarahs Arm und zerrte sie auf die Beine. Panisch schrie sie auf. »Was habt Ihr vor?«
Ohne zu antworten, schleifte ich sie hinter mir her und warf sie auf mein Bett. Sie starrte mich mit offenem Mund an. So verängstigt hatte ich sie noch nie erlebt. Die Antwort auf ihre Frage erübrigte sich wohl.
Auch wenn Sarah bereits so lange an unserer Seite lebte, hatte ich nie derlei Absichten gehegt. Sie war eine Sklavin, normalerweise war es unter meiner Würde, Hand an eine von ihnen zu legen. Zudem mangelte es mir nie an Angeboten. Hübsche Frauen standen Schlange bei mir. Und dabei sortierte ich die billigen Damen sogar gleich aus. Ich wusste, wie ich jede rumkriegen konnte.
Doch bei Sarah war das anders. Sie sah nicht mein gutes Aussehen oder meinen Charme. Sie wusste, was ich war. Wusste, dass ich nicht nur in dem Körper eines Monsters steckte, sondern tatsächlich eins war. Sie hasste mich vermutlich mehr, als ich die Menschen verabscheute. Das war wohl auch kein Wunder, immerhin lebte ihre Familie seit Generationen in Kanada unter der Tyrannei der Vampyre.
Ich beugte mich zu ihr herab und stützte die Hände links und rechts neben ihrem Kopf ab.
»Hast du Angst?«, flüsterte ich schmunzelnd. Ich wusste, dass meine Augen nun rot leuchteten. Das war aber üblicherweise nicht die einzige äußerliche Veränderung, die sich gerade bei mir einstellte. Sarah starrte stumm auf meine Fangzähne und zitterte am ganzen Körper.
Ich beugte mich zu ihr hinunter und sie kniff die Augen zusammen. Kurz atmete ich den Duft ihres Shampoos ein, bevor ich die Fänge in ihrem Hals versenkte und gierig ihr Blut trank. Ein leises Wimmern verließ ihre Lippen. Als ich genug hatte, leckte ich kurz über die Einstiche an ihrem Hals, damit mein Bett nicht mit Blut besudelt wurde. Es hörte auf zu bluten und ich lehnte mich zurück.
Bisher war nichts passiert, was Sarah nicht kannte, doch heute Nacht hatte ich mehr mit ihr vor.
Nachdenklich musterte ich das Mädchen unter mir. Auch wenn sie nur ein Mensch, eine Sklavin, war, war sie keinesfalls unansehnlich. Sie war so klein und zierlich, dass sie bei einem Schlag von mir auseinanderbrechen würde. Ihre dunkelblonden Haare lagen wie ein Fächer um ihren Kopf. Tatsächlich könnte sie bis auf den etwas zu dunklen Ton fast als eine Siya durchgehen. Alle Siye hatten blonde Haare und grüne Augen und besaßen ein engelhaftes Aussehen.
Sarah trug eine kurze graue Jogginghose und ein schwarzes Top. Sobald wir mit ihr rausgingen, ließen wir sie sich rausputzen, immerhin mussten wir uns mit ihr sehen lassen können. Vor allem die blauen Flecken, die sie fast immer hatte, mussten bedeckt werden. Jetzt waren sie für mich aber deutlich sichtbar.
Während ich in ihre grünen Augen starrte, musste ich an unsere Abreise von vor zwei Jahren denken. Angeblich hatten wir spontan entschieden, wer mit uns aufbrechen sollte. In Wahrheit hatte ich persönliche Gründe gehabt. Die Wahl war auf die damals erst fünfzehnjährige Sarah gefallen. Ihr großer Bruder hatte deswegen ein Riesentheater gemacht. Genauso wie sie fragte ich mich, ob er wohl noch lebte. Er hatte großes Talent darin, sich mit den Djiye anzulegen. Wenn er sehen könnte, was ich im Begriff war zu tun, würde seine Reaktion darauf genügen, um ihn lebenslang einzusperren oder letztendlich doch umzubringen.
»Wie hieß er gleich noch mal? Liam?«, überlegte ich laut.
Sarah erwachte aus ihrer Schockstarre. »Was ist mit ihm?«, krächzte sie.
»Er würde dich jetzt vor mir beschützen wollen … Damals hat er uns angefleht, ihn an deiner Stelle mitzunehmen. Doch wir wissen ja, dass man ihn niemals unbeaufsichtigt lassen sollte, nicht?«
Tränen stiegen in ihre Augen und sie vermied es, mich anzusehen. Gedankenverloren strich ich über das Tattoo an ihrem rechten Handgelenk. Eine Lilie, deren drei Blätter von einer Krone umschlossen wurden. Das Wappen der Kiye. Das Symbol dafür, dass sie für immer uns Vampyren gehörte.
»Wie es wohl wäre, wenn jeder Mensch es tragen würde …?«, murmelte ich. Der Alkohol schien mir wirklich zu Kopf gestiegen zu sein. Nun philosophierte ich schon vor mich hin.
Ich schüttelte den Kopf und verdrängte alle ausschweifenden Gedanken.
»So, wo waren wir stehen geblieben?« Ich setzte ein breites Grinsen auf und zog ihr das Top aus, während sie mit bebender Unterlippe zu mir aufsah. Bei jedem anderen hätte dieser herzzerreißende Blick vielleicht Mitleid ausgelöst, doch solche Gefühle kannte ich schon lange nicht mehr.
Mein Herz war von einem unglaublichen Hass auf die Welt zerfressen. Ich war ein Monster, genauso wie Valentin. Ich behandelte sogar Sascha immer schlechter, für die Menschen hatte ich da erst recht kein Mitleid übrig.
»Sagtest du nicht, dein Bruder hat heute Geburtstag?«
Sarah riss entsetzt die Augen auf. »Ich, ich … Ja, schon, aber …«
»Gut.« Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und wählte Boris’ Nummer. »Das wird doch sicher eine große Überraschung. Hast du dir so etwas nicht gewünscht?«
In ihrem Gesicht las ich keine Freude, sondern blanke Angst. Sie traute mir nicht. Zu Recht.
Boris ging bereits nach dem ersten Klingeln ran, obwohl es bei ihnen in Kanada noch mitten in der Nacht war. Allerdings lebte ein Großteil der Vampyre dort nicht nach dem menschlichen Rhythmus, sondern schlief tagsüber. »Was kann ich für Euch tun, Eure Hoheit?«, meldete er sich mit rauer Stimme.
Ich erklärte ihm kurz, dass er Sarahs Bruder ans Telefon holen sollte. Er fragte nicht nach, sondern machte sich direkt auf die Suche nach ihm. Obwohl Boris vom Schloss aus erst in das angrenzende Dorf der Sklaven laufen musste, dauerte es nur wenige Minuten, bis ich im Hintergrund eine kurze Diskussion hörte, das Handy weitergereicht wurde und schließlich Liams verschlafene Stimme ertönte. »Hallo?«
»Hallo Liam, hier ist jemand, den du sicher gerne sprechen möchtest.« Ich schaltete den Lautsprecher an und legte das Handy auf dem Nachttisch ab.
»Sarah?«, tönte Liams Stimme zaghaft durch den Raum.
»Oh, Liam«, schluchzte Sarah.
»Was haben sie dir angetan?«, fragte er leise.
»Nichts. Mir geht es gut«, antwortete sie viel zu rasch.
»Du lügst.«
»Bitte Liam, es ist alles okay. Ich vermisse euch nur so sehr. Und ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Bruderherz.«
»Ich weiß, dass er zuhört.« Er machte eine kurze Pause. »Wehe, ihr bringt sie nicht bald unversehrt wieder zurück.«
»Soll das eine Drohung sein?« Ich schmunzelte. Aus dem Munde eines Menschen waren das nur leere Worte.
»Nein, das ist eine Warnung«, meinte er ernst.
Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. Sarah war wie erstarrt. Ich setzte mich auf die Bettkante und zog sie auf meinen Schoß. Sie wehrte sich nicht und gab keinen Mucks von sich. Einerseits, weil es ohnehin nichts gebracht hätte, und andererseits, damit Liam nichts davon mitbekam. Sie wusste, worauf ich hinauswollte.
»Hättest du gerne ein Foto? Von mir und deiner Schwester? Vielleicht blutleer?«
Sarah schnappte entsetzt nach Luft, als ich es ihm schickte.
»Gefällt dir, was du siehst?«
»Lass sie sofort los!«, brüllte Liam ins Telefon.
»Und wenn nicht?« Ich vergrub das Gesicht in ihrer Halsbeuge, während ihre Arme schlaff herabfielen, und schickte ihm ein zweites Bild.
»Wenn du es wagst, ihr auch nur ein Haar zu krümmen, werde ich dich töten!«
»Soso, dann bin ich mal auf unser nächstes Treffen gespannt.« Ich grinste breit, fuhr mir über die Fänge und sagte: »Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr … Ich muss mich, nun ja – endgültig! – um deine Schwester … kümmern. Und zum Geburtstag alles Gute.«
»Neeein! Bitte!«, schrie Liam, als ich auflegte.
Doch es war zu spät.
Einen Moment lang bäumte Sarah sich noch auf, als ich endlich die Fangzähne aus ihrer Halsbeuge zog. Ihr Körper erschlaffte langsam in meinen Armen und ich ließ sie achtlos zu Boden fallen.
***
»Ist das dein Ernst? Warum hast du das getan?« Sascha warf einen Blick auf das fast blutleere Mädchen zu meinen Füßen und sah mich verächtlich an. Mit diesem Anblick hatte er vermutlich nicht gerechnet, als ich ihn angewiesen hatte, in mein Zimmer zu kommen.
»Was ist dein Problem? Sie ist unsere Sklavin, ich kann mit ihr machen, was ich möchte. Das solltest du respektieren«, sagte ich gelangweilt und verschränkte die Arme vor der Brust. Ich würde mich von Sascha nicht ausschimpfen lassen wie ein unartiges Kind.
»Genau, das ist natürlich ein Grund, sie halb leer zu trinken, wenn du schlechte Laune hast.« Er kniete sich neben Sarah auf den Holzboden und strich ihr die dunkelblonden Haare aus dem Gesicht. »War es beabsichtigt, dass sie noch lebt?«
Statt einer Antwort zuckte ich nur mit den Schultern.
»Du kannst sie entsorgen, ich will sie nicht mehr sehen.«
»Wie bitte?« Sascha sah entsetzt zu mir auf.
»Was denn? Den Blutsverlust überlebt sie ohnehin nicht.«
»Das ist doch nicht sicher. Bitte, wenn du erlaubst, würde ich sie gerne versorgen lassen.«
Ich hob überrascht die Augenbrauen. »Was willst du mit ihr machen? Ins nächste Krankenhaus fahren?«
»Nein, natürlich nicht. Ich rufe eine Siya an, die in der Nähe wohnen müsste.«
Schnaubend gab ich mich geschlagen. »Meinetwegen, tu, was du nicht lassen kannst.«
»Danke«, sagte Sascha leise und holte eine Decke, in die er Sarah wickelte.
»Was Anastasija wohl dazu sagen würde, dass du dich so sehr um das Wohl der jungen Sklavin sorgst?«
Sascha lud das bewusstlose Mädchen auf seine Arme und ging nicht auf meinen Kommentar ein. »Ich kümmere mich um sie und komme danach wieder zu dir«, teilte er mir mit.
Ich nickte nur, woraufhin er die Suite verließ und ich mich auf mein Bett fallen ließ.
***
»Mary hat getan, was sie konnte. Sie meint, Sarah wird es schaffen«, verkündete Sascha, als er am Morgen zurück war.
»Glückwunsch zu deiner gelungenen Rettungsaktion.«
»Wenn du nicht gewollt hättest, dass ich sie rette, hättest du sie gleich getötet«, sagte er und setzte sich zu mir an den Frühstückstisch.
»So?« Ich hob den Blick von der Lokalzeitung und sah Sascha fragend an.
»Ja«, meinte er schlicht und schenkte sich eine halbe Tasse Kaffee ein. Koffein war einer der Bestandteile, die wir nicht in größerer Menge zu uns nehmen konnten oder vielmehr sollten, weil es bei uns viel stärker wirkte. Genauso wie Alkohol. Ein weiterer Punkt, auf den Sascha mehr achtete als ich.
»Hast du dich eigentlich schon um Ersatz gekümmert?«
»Nein, ich dachte, das muss nicht sofort mitten in der Nacht sein.«
»Verstehe. Eigentlich können wir es uns auch sparen, jemanden aus dem Dorf herschicken zu lassen«, überlegte ich.
»Wie meinst du das?« Sascha sah mich verständnislos an.
»Ist es nicht völlig egal, wen wir nehmen? Da draußen laufen doch genug Menschen herum, die uns mit Blut versorgen können …«
Sascha stellte seine Tasse lauter als nötig auf dem Tisch ab.
»Jetzt redest du wie Valentin, ist dir das eigentlich klar?« Der vorwurfsvolle Ton seiner Stimme entging mir nicht.
»Vielleicht sind wir uns nicht so unähnlich, wie du glaubst.«
»In eurem Inneren seid ihr komplett verschieden, auch wenn ihr ein paar Gemeinsamkeiten habt.«
Ich wusste, dass Sascha wirklich so dachte, doch ich selbst glaubte nicht mehr daran. Nachdem mir von meinem eigenen Bruder alles genommen worden war, was mir je etwas bedeutet hatte, hatte ich kein Problem mehr damit, anderen ebenfalls alles zu nehmen. Vorhin hatte ich einem jungen Mädchen beinahe das Leben genommen. Einfach so, ohne Grund, weil ich schlecht gelaunt war. Und zu allem Überfluss hatte ich ihren Bruder daran teilhaben lassen. Nachdem mein Gehirn jetzt wieder funktionierte, hatte auch ich bemerkt, wie krank das war, und ich hatte beinahe so etwas wie ein schlechtes Gewissen bekommen. Insgeheim war ich also froh, dass sie überlebt hatte.
»Ach wirklich? Und warum habe ich mir vor ein paar Stunden vorgestellt, wie es wäre, wenn alle Menschen versklavt wären? Ist das nicht Valentins Philosophie?«
Sascha seufzte. »Ist es, doch die Mittel sind andere. Egal, was du tust, du würdest nie in seinem Ausmaß töten. Deshalb hast du es auch nicht beendet und Sarah am Leben gelassen. Du benimmst dich wie ein Riesenarschloch, aber Valentin dagegen ist wahnsinnig.«
»Wenn du das sagst, muss es ja stimmen.« Ich stand auf. Das Gespräch war für mich beendet. Doch bevor ich ihm den Rücken kehrte, fiel mir ein, dass wir immer noch eine Sklavin zu wenig hatten. »Kümmere dich um Ersatz.«
»Was immer mein Prinz wünscht. Doch wenn ich dir noch einen Rat geben darf …« Er warf mir einen ernsten Blick zu.
Ich hob die Augenbrauen und sah ihn fragend an.
»Ein versuchter Mord reicht für heute!«
Ich verdrehte die Augen und verließ die Suite. Weg von dem Ort, der die verdrängten Schuldgefühle in mir wecken könnte.
***
Nachdem ich ziellos durch die Stadt gestreift war, setzte ich mich auf eine Parkbank und beobachtete die Passanten. Haufenweise betrunkene Leute liefen vorbei, die nach einer durchzechten Partynacht auf dem Heimweg waren. Was für eine primitive Rasse die Menschen waren! Und doch war ich nicht besser. Ich hörte, wie ein Kerl sich hinter einem Busch neuen Stoff von seinem Dealer besorgte. Der Geruch der Drogen brannte mir schmerzhaft in der Nase. Und das alles an einem sonnigen Vormittag, während bereits Mütter ihre Kinderwagen durch den Park schoben.
Ich fragte mich, was nach dem Anruf und den Fotos nun in Kanada los war. Boris hatte Liam sicher eingesperrt. Liam wusste, dass ich regelmäßig das Blut seiner Schwester trank, dafür war ein Sklave schließlich da, doch diesmal hatte er guten Grund anzunehmen, dass es zu viel gewesen war und ich sie möglicherweise sogar getötet hatte. Er würde es nicht gut verkraften. Auch wenn Sarah überlebt hatte, würde sie nicht so schnell nach Kanada zurückkehren oder uns weiterhin begleiten, weil sie zu schwach war, nachdem sie beinahe gestorben war. Das war mir ehrlich gesagt auch lieber. Nach letzter Nacht wollte ich sie am besten nie wiedersehen. Sie war wie ein lebendiger Beweis dafür, was für ein Monster ich doch war. Was Liam glauben würde, war mir dagegen egal. Das war eine gerechte Strafe für diesen Idioten und mir konnte er ohnehin nichts anhaben.
Mein Blick fiel auf eine Gruppe Jungs, die Passanten aggressiv anpöbelten. Vielleicht sollte ich als Entschädigung mal etwas Gutes tun und den vier Halbstarken Manieren beibringen. Allerdings war dies nicht meine Aufgabe. Ich war nicht der Retter der Schwachen und Unterdrückten. Ganz im Gegenteil.
Es stimmte, vieles wäre einfacher, wenn wir sie alle unter Kontrolle hätten. Doch Sascha hatte recht, ich teilte nicht alle Ansichten von Valentin. Und um seine Pläne zu vereiteln, musste ich diesen Kiyo finden.
Stöhnend stand ich auf und lief in Richtung des Lokals, in dem wir gestern Abend gewesen waren. Ich würde meinen Wagen holen und allein zum Flugplatz fahren. Sascha hatte jetzt mit Sicherheit keinen Kopf dafür. Ich musste mich zusammenreißen und weiterarbeiten. Entweder suchte ich gründlich oder gar nicht. Solche Ausraster wie heute Nacht konnte ich mir nicht mehr erlauben, ansonsten würde Sascha noch die Geduld mit mir verlieren. Und meinen einzigen Freund und treuesten Weggefährten zu vergraulen stand nicht sehr weit oben auf meiner Prioritätenliste.
Eine junge Joggerin lief an mir vorbei und knallte beinahe gegen einen Baum, weil sie sich den Hals nach mir verrenkte. Wenn du wüsstest …, dachte ich amüsiert und tat so, als hätte ich nichts bemerkt. Ihre Oberflächlichkeit würde sie heute nicht das Leben kosten. Was hatte Sascha gesagt? Ach ja. Ein Mordversuch reicht für heute! Mal sehen, wie lange ich das beherzigen konnte.
***
Der kleine Flugplatz lag südwestlich von Dallas und es dauerte keine halbe Stunde, bis ich meinen Wagen auf den Parkplatz lenkte. Als ich ausstieg, startete gerade eine Piper, die ein doppelsitziges Segelflugzeug, eine ASK 21, schleppte. Ganz typisch für einen Samstag mit schönem Wetter war viel los, wodurch ich nicht besonders auffiel. Vermutlich herrschte Schulungsbetrieb. Interessiert schlenderte ich über den Platz und schaute ein wenig zu.
Für unsere Cessna 172SN hatten wir übergangsweise einen Hallenplatz angemietet. Gestartet waren wir mit ihr von Kanada aus, der einstigen Königsresidenz der Kiye, um die USA schneller zu durchqueren. Wir landeten auf jedem Flugplatz und erkundeten die Gegend mit dem Auto. Vor einigen Jahren war mir nämlich eine Theorie in den Sinn gekommen, dass unser gesuchter Nachfahre sich ebenfalls auf einem Flugplatz aufhalten könnte. Fliegen bedeutete für uns Vampyre eine unglaubliche Freiheit und war inzwischen fast eine Notwendigkeit, zumindest wenn man in den Schlössern in Kanada, Sibirien und Norwegen lebte und unabhängig sein wollte. Möglicherweise hatten die Leute, bei denen er aufgewachsen war, darauf geachtet, dass er dieses Hobby ausführte. Es könnte natürlich auch sein, dass er gerade deshalb an keinem Flugplatz zu finden wäre. Vielleicht war es einfach zu auffällig. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Immerhin hatten wir sonst keine Anhaltspunkte.
Während ich in den Himmel starrte und die kreisenden Flugzeuge beobachtete, wurde ich von einem blonden Kerl namens Steven, ich schätzte ihn auf Anfang zwanzig, in eine Unterhaltung verwickelt.
Ich kam immer schnell ins Gespräch mit anderen Piloten. Egal wo ich auf der Welt unterwegs war.
Als Sascha und ich Anfang der Woche hier gelandet waren, war nur eine Person da gewesen, die sich um die Unterbringung unseres Fliegers kümmerte. Groß umgesehen hatte ich mich zu dem Zeitpunkt nicht, weshalb ich mich nun bereitwillig von Steven herumführen ließ. Außerdem könnte ich ihn anschließend noch befragen. Er war neugierig, wo ich schon überall geflogen war. Ich erzählte von meinen Touren durch die halbe Welt und fügte hinzu, dass ich bis auf einen Teil von Texas bereits die gesamten USA aus der Luft erkundet hatte.
»Wahnsinn, du bist ja ganz schön viel herumgekommen für dein Alter. Wenn ich das Geld hätte, würde ich auch die Welt mit einem Flieger erkunden«, schwärmte er. Es war unverkennbar, dass er mich beneidete. Auf mein Leben brauchst du nicht neidisch zu sein, dachte ich verbittert. Ich vermisste die Normalität in meinem Dasein. Menschen brauchten sich um nichts Sorgen zu machen, lebten egoistisch vor sich hin – etwas, wovon man als königlicher Vampyr nur träumen konnte.
Steven führte mich in die Halle und fing an, von sich zu erzählen. Von seinen bisherigen Flügen, seinem Studium und seiner ach so tollen Freundin. Amüsiert tat ich so, als lauschte ich seinen Geschichten und betrachtete beiläufig die verschiedenen Maschinen. Ein Segelflugzeug, das ganz in der Ecke stand, stach mir sofort ins Auge. Ein rot-weiß lackierter Doppelsitzer. Eine MDM-1 Fox. Interessiert lief ich hin, um mir den Flieger aus der Nähe anzusehen. »Wow, ihr besitzt eine Fox?«
Steven unterbrach seinen Redeschwall und folgte mir. »Geiles Teil, oder? Leider im Privatbesitz, aber ich durfte schon mitfliegen. Du auch?«
»Ich hatte in Europa die Möglichkeit, das Baby selbst zu steuern.«
»Wow, das Schätzchen hier darf leider nur von einer Person geflogen werden.«
Ich strich mit der Hand über die glatte Oberfläche und spürte ein Kribbeln im Bauch. Ich flog leidenschaftlich gerne, auch wenn es in letzter Zeit nur noch ein Mittel war, um von A nach B zu kommen. Dabei gab es für mich nichts Schöneres als den Kunstflug. Und dieses Flugzeug war zu nichts anderem gebaut worden.
»Kann man es nicht chartern?«, fragte ich.
Steven schaute mich mit großen Augen an und fing an zu lachen. »Machst du Witze? Mag ja sein, dass du sehr viel Flugerfahrung und noch mehr Kohle hast, aber selbst dich würde sie keins ihrer Flugzeuge fliegen lassen.«
»Sie? Das Teil gehört wirklich einer Frau?«, fragte ich überrascht. Es gab nicht viele Frauen, die das Fliegen für sich entdeckt hatten.
»Nun, mit einundzwanzig ist sie wohl eher noch eine junge Dame als eine richtige Frau. Ihr Dad ist Berufspilot und hat es ihr geschenkt. Genauso wie den Ventus cM und die Cessna.« Er deutete auf die zwei teuren Flugzeuge daneben. Der Neid stand ihm auch diesmal deutlich ins Gesicht geschrieben.
»Nettes Geschenk«, meinte ich schmunzelnd.
Steven verdrehte die Augen. »Allerdings. Trotzdem ist sie kein bisschen eingebildet. Glaub mir, jeder Kerl hier hätte sie gern als Freundin. Ich meine, eine Frau, die unser Hobby teilt? Besser geht es doch nicht. Ich würde sie auch ohne zu zögern heiraten, aber sie hat sich ausgerechnet einen Spinner geangelt, der nur Football im Kopf hat.«
Ich musste mir ein Lachen verkneifen und verdrehte nun selbst die Augen, was er durch die dunklen Gläser meiner Sonnenbrille nicht sehen konnte. Nur gut, dass seine Freundin es nicht gehört hatte.
Ich folgte Steven ins Clubheim, während er weiter auf mich einredete. Langsam wurde mir der Typ wirklich lästig. Aber ich wollte ihn ja noch etwas fragen, auch wenn es vermutlich ohnehin zwecklos war.
Wir setzten uns in eine Ecke und er spendierte mir eine Cola aus dem Automaten.
»Sag mal«, unterbrach ich ihn irgendwann. »Habt ihr im Verein viele Jugendliche im Alter von circa neunzehn oder zwanzig Jahren?«
Er überlegte kurz und antwortete dann. »Ich glaube fünf. Bin mir aber bei allen nicht sicher mit dem Alter. Wieso?«
»Mhh. Ich suche jemanden«, erwiderte ich nach einer kurzen Pause. »Den Sohn einer Freundin.«
»Aha, und wie heißt er? Vielleicht kenne ich ihn.«





























