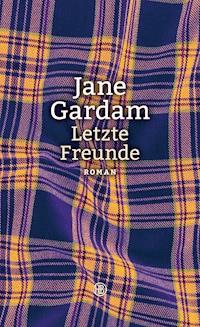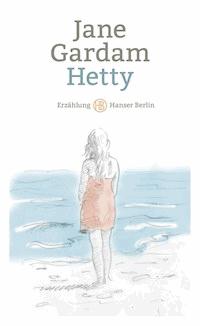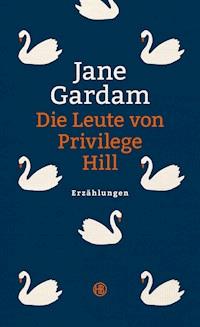
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass Jane Gardam hinreißende Romane schreibt, ist bekannt. Nun ist ein weiterer Schatz zu heben: Gardams Erzählungen, für die sie berühmt ist und mit Alice Munro und Katherine Mansfield verglichen wird. Hetty, die Familienmutter, die bei der Begegnung mit ihrem ehemaligen Liebhaber in einen somnambulen Zustand gerät. Annie, die Schriftstellerin, die sich gegen Neugier und Gier entscheidet und ein Geheimnis dem Meer übergibt. Der verstummte chinesische Junge, der in England einen vom Himmel gestürzten Schwan rettet und plötzlich zur Sprache zurückfindet. Sie alle berühren uns und entwickeln ein Eigenleben, das über die Geschichten hinausgeht – in jeder dieser Erzählungen steckt die Verheißung eines Romans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Hetty, die Familienmutter, die bei der Begegnung mit ihrem ehemaligen Liebhaber in einen somnambulen Zustand gerät. Annie, die Schriftstellerin, die sich gegen Neugier und Gier entscheidet und ein Geheimnis dem Meer übergibt. Der verstummte chinesische Junge, der einen vom Himmel gestürzten Schwan rettet und plötzlich zur Sprache zurückfindet. Sie alle berühren uns und entwickeln ein Eigenleben, das über den Kosmos der Geschichten hinausgeht. Liegt ein Reiz der Romane von Jane Gardam in der Kunst der Verknappung, der perfekt getimten Episode, so steckt in jeder dieser Erzählungen die Verheißung eines Romans.
Jane Gardam ist eine beglückend gute Erzählerin.
Hanser Berlin E-Book
Jane Gardam
Die Leute von Privilege Hill
Erzählungen
Aus dem Englischen von Isabel Bogdan
Hanser Berlin
Für Richard Beswick
Inhalt
Hetty, schlafend
Lunch mit Ruth Sykes
Die geheimen Briefe
Ein schauriger Ort
Letzte Ehre
Der Schweinefahrer
Jeder ein stolzer Reiter
Steinbäume
Ein unbekanntes Kind
Die Rettung
Die Dixiemädchen
Schlangestehen
Telegonie
I In ein dunkles Haus gehen
II Signor Settimo
III Die scharfen Früchte von Cremona
Der Junge, der zum Fahrrad wurde
Seelenverwandte
Die Leute von Privilege Hill
Hetty, schlafend
Als sie den langgestreckten Rücken des großen Mannes bemerkte, schwindelte ihr kurz, und sie dachte: »Sieht aus wie Henekers Rücken.« Dann drehte er sich um, und sie stellte fest, dass es Heneker war.
Er stand auf einem blassen Sandstreifen am Meer und blickte in das kalte Wasser hinab, still wie immer, friedvoll, unverkennbar.
»Wie kann das sein?«, dachte sie. »So ein Unsinn! Er kann es ja gar nicht sein.«
Sie faltete weiter T-Shirts und Jeans, sammelte herumfliegende Sandalen ein, machte zwei ordentliche Stapel mit jeweils einem Handtuch zuoberst, für die Kinder, wenn sie aus dem Wasser kamen. Sie zog die Strickjacke aus, fuhr sich mit den Händen durchs Haar, hielt das Gesicht für einen Moment in die Sonne und sah dann noch einmal hin.
Sie sah ihre beiden Kinder mit trommelnden Füßen über den harten, weißen Sand rennen, an dem Mann vorbei ins Meer planschen und sich quiekend in die Gischt werfen. Dann betrachtete sie wieder den Mann.
Lange, braune Beine, langer, brauner Rücken. Er beobachtete die Bewegungen des Wassers und die darin spielenden Kinder mit der Konzentration eines Malers. Er war zwanzig, dreißig Meter entfernt, aber das träge Lächeln war unverkennbar, die Anerkennung der Wunder der Welt, als er die Augen verengte und Linien und Ebenen und Schatten aufnahm.
Also doch Heneker. Zehn Jahre älter, aber eindeutig niemand anderes als Heneker.
Er drehte sich um, kam den Strand hoch, ließ sich neben sie fallen und sagte: »Hallo.« Er trug eine schwarze Badehose und hatte einen Bart. »Komisch«, dachte sie. »Ich muss über Bärte im Meer immer lachen, aber er sieht ganz gut aus. Er sah immer gut aus, egal, wo er war.«
»Hallo«, sagte sie.
Er hatte sie nicht beim Namen genannt. Vielleicht hatte er ihn vergessen. Er hatte die Leute meistens nicht beim Namen genannt. Er war immer vorsichtig gewesen. Außer bei seiner Arbeit.
»Hallo, Hetty«, sagte er. »Lange her.«
»Komischer Ort«, sagte sie. Er lächelte und wandte den Blick nicht von ihrem Gesicht ab. »Um sich wiederzutreffen«, sagte sie. »Ziemlich weit weg von Earl’s Court. Connemara.«
»Urlaub«, sagte er sanft und ließ Sand durch seine Finger rinnen. Wieder schlingerte ihr Herz, als sie seine Finger sah. »Ich kenne jeden Nagel«, dachte sie. »Jede Linie darin, jeden Halbmond. Oh Gott!«
Aus dem Meer ertönte Gequieke, und er sah über seine gebräunte Schulter zu den Kindern. »Deine?«, fragte er.
»Ja.« Sie plapperte drauflos. »Sie sind acht und vier. Andy und Sophie. Wir sind für vierzehn Tage hier. Wir haben ein Haus gemietet.«
»Und ihr Papa?«
»Kommt nach. Eigentlich sollte er mit uns zusammen herkommen, aber dann gab es irgendeine Krise, und wir sind schon mal vorgefahren. Wir hatten das Haus ja schon gebucht. The Pin.«
»The Pin? Das Haus von Lord Dings? Ballinhead?«
»Ja. Das ist ein Fischerhaus …«
»Ich weiß.« Er drehte sich auf den Bauch, griff nach ihren nackten Füßen und hielt sie fest. »Hetty«, sagte er und betrachtete ihre Zehen genau. »Wunderschöne Füße«, sagte er. »Schon immer. Einmal habe ich deine Füße gemalt. Dann hast du Kohle geheiratet?«
»Nein«, sagte sie. »Als wir geheiratet haben, war noch keine Kohle da. Er ist schlau. Und gut. In seinem Job. Hervorragend, wenn du es genau wissen willst.«
»Hohes Tier?«
»Nein, Quatsch. Ich war Malerin, hätte ich ein hohes Tier geheiratet?«
»Wenn du die Gelegenheit hattest, wärst du ja blöd gewesen, es nicht zu tun. Colonel und Lady Hohestier, V.C., X.Y.Z. und sonstige Orden. Bist du Lady Hohestier? Du siehst ein bisschen so aus, mit deiner weißen, weißen Haut.«
»Red nicht so einen Unsinn.«
Er hielt ihre Füße fest und legte die Stirn darauf. »Lord und Lady Hohestier und ihre kleinen Kröten.«
»Halt den Mund!« (Das kann doch wohl nicht wahr sein! Wir sind gestern erst angekommen. Wir sind seit zehn Minuten hier! Heneker!) Sie versuchte, ihre Füße zu befreien, und kicherte. »Das kitzelt«, sagte sie. »Atme mich nicht so an!«
Er ließ ihre Füße los und sagte: »Was ist er denn?«
»Banker.«
»Himmel!«
»Kennst du irgendwelche Banker? Auf dem internationalen Parkett?«
»Gott sei Dank nicht. ›Internationales Parkett‹. Kennst du noch irgendwelche Maler?«
»Nein«, sagte sie.
»Malst du selbst noch?«
Nach einer langen Pause sagte sie nein.
Er lag jetzt flach auf dem Rücken im Sand, hatte die Arme weit ausgebreitet und die Augen geschlossen. Sein bärtiges, sanftes Gesicht, die schmale Nase und der friedliche Ausdruck wirkten wie gemeißelt. Sie dachte: »Er ist so schön, man müsste ihn mit Edelsteinen besetzen. Und so durchtrieben wie eh und je. Herrje, ich liebe ihn.« Sie stand auf, stopfte die beiden Kleiderstapel mit Schwung in die Strandtasche, nahm Strickjacke, Buch und Handtücher in die Hand und ging den Strand hinunter zum Wasser. »Ich gehe!«, rief sie den Kindern zu. »Ich gehe schon mal zum Auto. Macht nicht mehr so lange, ihr Süßen! Zehn Minuten.«
»Aber wir sind doch gerade erst ins Wasser gegangen! Wir wollten den ganzen Vormittag drinbleiben!«
»Es ist windig.«
»Aber es ist so schön!«
»Nein, es ist kalt. Ich gehe aus dem Wind.«
»Es bewegt sich nicht mal das kleinste Lüftchen«, rief Andy. »Kein Stück. Du spinnst. Es ist knallheiß!«
»Ich setze mich ins Auto.« Damit stapfte sie, ohne sich noch einmal umzudrehen, allein den Strand hinauf und setzte sich beim Auto in das harte Gras zwischen weggeworfenen Picknickmüll, wo sie von roten Ameisen gebissen wurde und laute, wilde Hunde aus den Fischerhütten kamen und endlos bellend um Futter bettelten, während sie so tat, als würde sie lesen.
An diesem Abend in The Pin badete sie Sophie gerade in Wasser, das wie Guinness in der edlen alten Guinness-fleckigen Badewanne schäumte, als ein Geräusch wie donnernde Hufe die Badezimmerdecke erzittern ließ. Das Wasser aus dem Hahn tröpfelte nur noch, und dann kam gar nichts mehr.
»Was ist das denn?«, fragte Hetty und setzte sich auf die Fersen. »Sechzig Pfund die Woche! Sechzig Pfund die Woche! Das Telefon geht nicht, der Strom flackert, der fiese Torf … und jetzt das.«
»Was ist denn jetzt los?« Andy kam hereingestürmt.
»Keine Ahnung. Bestimmt der Boiler oder so. Er ist sicher leer.«
»Aber das Wasser ist knallheiß.«
»Ja, aber es kommt keins mehr. Wahrscheinlich ist der Tank leer. Das Wasser kommt aus dem modderigen Ding im Boden, das wir gestern gesehen haben. Kam mir schon ziemlich leer vor.«
»Vor allem ziemlich schmutzig«, sagte Andy. »Genau wie die Badewanne.«
»Nein, das ist wundervolles, braunes Wasser«, sagte sie. »Aber, oje!«
»Das explodiert gleich«, sagte Andy. »Soll ich den Hauptschalter ausmachen? Ist vielleicht sicherer.«
»Nein. Moment. Lass mich nachdenken.«
»Über der Küchentür. Dieses riesige, schwere Ding.«
»Nein. Jetzt sei doch mal still. Und lass mich nachdenken. Da ist doch eine Kneipe. Vielleicht gehen wir zur Kneipe und finden da jemanden.«
»Es ist schon jemand da.«
»In der Kneipe?«
»Nein, hier.«
»Hier?«
»Ja. In der Eingangshalle. Der Mann vom Strand. Er spielt mit unserer Knete. Ich frag ihn mal.«
Hetty hatte Sophie in ein Handtuch gewickelt, setzte sich mit ihr auf einen Rattanstuhl am Badezimmerfenster und sah Andy und Heneker nachdenklich nebeneinander herlaufen, Hand in Hand durch den verwilderten Garten zum Wassertank.
Das Bollern unter dem Dach hielt allerdings an.
Als sie mit Sophie die Treppe herunterkam, saß Heneker an dem großen Tapeziertisch in der Eingangshalle und knetete einen Dinosaurier. Ohne aufzusehen, sagte er: »Da schien alles in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich ist ein Rohr verstopft.«
Sie setzte sich mit Sophie ans andere Ende des Tischs, und das Bollern wurde weniger, dann noch weniger und verschwand schließlich ganz. Ein herrliches Tröpfeln in den Boiler setzte ein.
Heneker sagte: »Irische Klempner.« Sophie knabberte an einem Keks, glitt dabei zu ihm und betrachtete seine Finger, und Andy, der jetzt ebenfalls gebadet hatte – sicherheitshalber einfach in Sophies Wasser –, kam wieder herunter, lehnte sich an Heneker und schaute zu, wie aus Knetgummi ein dickes Stachelschwein auf Elefantenbeinen entstand, mit einem Brustpanzer und einem Nashorn-Horn auf der Nase. Sophie trat näher heran und sah es ganz verliebt an.
»Kann ich das haben?«, fragte Andy.
»Einer kann es haben«, sagte Heneker. Er stellte es mitten auf den Tisch, die Nase in einen Topf Fuchsien gesteckt.
»Es hat Durst«, sagte Sophie. »Das arme Schwein.«
»Das ist doch kein Schwein. Das ist ein – was ist das, Heneker?«
»Ein Sumpfstreuner.«
»Was ist das?«
»Es streunt durch den Sumpf. Es patscht durch das Moor. Es bollert unterm Dach …« Die Kinder quiekten vor Vergnügen.
»Also dann«, sagte Hetty. »Ab ins Bett.«
Heneker machte ein brüllendes, donnerndes Geräusch. Sie klammerten sich an ihn. »Ab ins Bett«, sagte Hetty und bemerkte, dass sie nach Surrey klang. »Es reicht. Ihr seid ja total überdreht. Ab ins Bett.«
»Och, bitte …«
»Nein. Wenn Daddy hier wäre …«
»Ist er aber nicht. Können wir noch aufbleiben?«
»Ab mit euch«, sagte Heneker. »Schnell, bevor der Patscher euch kriegt.«
Sie flohen, Sophie blieb in der Biegung der Treppe noch einmal stehen, winzig und reizend in ihrem geblümten Nachthemd. »Du gehst doch nicht weg? Du kommst morgen wieder?«
»Ja«, sagte Heneker.
Hetty brachte Kaffee ins Wohnzimmer, wo Heneker in einem der beiden gemütlichen, schäbigen Sessel saß und ins zerfallende Torffeuer schaute. Durch vier hohe Fenster fiel silbrig schwarzes Dämmerlicht auf das Chintz-Sofa und Lord Dings’ Regale mit Büchern über Fischerei und Vögel. Draußen erstreckten sich lange, hügelige Streifen Land Richtung Amerika. Keinerlei Geräusch, kein Licht, das sich auf der Straße bewegte. Es fühlte sich an, als wäre das Ferienhaus von meilenweitem Schweigen und Dunkelheit umgeben, die uralten Berge im Landesinneren bildeten eine lange Barrikade gegen die restliche Welt.
Henekers Gesicht lag im Schatten, als er sich im Sessel zurücksetzte. Sie stellte den Kaffee auf einem Hocker zwischen ihnen ab und lehnte sich ebenfalls in ihrem Sessel zurück. Lange sprachen sie kein Wort.
»So hätte es sein können«, sagte er schließlich. Ihr Herz begann zu hämmern, und sie hielt sich an ihrem Sessel fest. (Das ist Heneker. Heneker, an den ich jeden einzelnen Tag gedacht habe.)
»Nein«, sagte sie.
Er sagte: »Doch. Oh Gott.«
»Du hast mich nie gefragt«, sagte sie. »Kein einziges Mal.«
»Du weißt ja, warum.«
»Ich weiß nicht, warum.«
»Ach, Hetty.«
»Ich weiß nicht, warum. Ich wusste nie, warum. Ich konnte dich nicht fragen. Das ganze Jahr über. Dieses Zimmer … das Bett aus Tauen. Das Dach das reinste Gewächshaus, und dieser Vorhang in der Ecke.«
»Wo unsere Kleider waren.«
»Unsere Kleider lagen in Haufen herum. Deine jedenfalls.«
»Ich habe deine Kleider geliebt. Immer sauber und ordentlich. Und so klein. Alle Knöpfe waren echte Knöpfe mit richtigen Knopflöchern.«
»Ich habe deine immer aufgesammelt«, sagte sie. »Wie bei der Weinlese. Hier eine Socke, da ein Hemd, ein Schuh auf der Lampe.«
»Auf der Lampe?«
»Ja. Um das Licht zu dimmen. Ganz schön gefährlich.«
»Und stinkig.«
Sie lachte.
»Weiter«, sagte er.
»Was?«
»Lachen«, sagte er. »Das hatte ich ganz vergessen.«
»Und jetzt bist du berühmt«, sagte sie und sah zu ihm auf. Er hatte sich erhoben, stand da in seiner gesamten Länge und legte jetzt, an den hohen Kamin gelehnt, die Stirn auf den Unterarm und sah in das graue Feuer hinunter. »Heneker Mann.«
»What a piece of work is Mann. Hast du …?«
»Ja. Ich war in allen.«
»Ausstellungen«, sagte er. »Weiß Gott, was die wirklich bringen. Damals habe ich bessere Sachen gemacht.«
»Nein«, sagte sie. »Du bist jetzt sehr viel besser.« (Er sagt immer noch Dinge, nur damit man ihm widerspricht. Er weiß genau, dass ich ihm widerspreche. Er weiß, dass ich weiß, dass man ihm widersprechen muss. Unsere Gedanken bewegen sich völlig im Gleichtakt. Schon immer. Wir sitzen hier wie ein altes Ehepaar … Und es ist zehn Jahre her. Er ist natürlich immer noch genauso durchtrieben. Ich nehme an, er ist verheiratet. Ob er …)
»Sie ist Malerin«, sagte er zum Feuer.
Hetty sagte nichts.
»Sie ist Malerin, Lady Hohestier, einfach Malerin.«
»Natürlich. Musste sie wohl sein.«
»Nein. Das weißt du doch. Du wusstest es das ganze Jahr über.«
»Wusste ich nicht. Ich war ja selbst Malerin.«
»Nein. Du hast meine Kleider aufgehoben. Und den Schuh von der Lampe genommen.«
»Gute Maler sind oft ordentlich. Sogar meistens. Du hast doch bestimmt Romane über Maler gelesen, Heneker.«
»Nein«, sagte er. »Nicht so ordentlich wie du. Deine Ordentlichkeit wurde ja immer größer. Sie wurde gefährlich. Sie war im Weg.«
»Nicht oft«, sagte sie. »Du warst im Laufe der Zeit immer weniger da und hast es gar nicht gesehen. Ich habe um nichts und niemanden herumgeräumt. Du warst immer weg. Es wurde immer später. Immer öfter.«
»Du hättest stattdessen malen sollen. Wenn du gemalt hättest, statt dir Sorgen zu machen und aufzuräumen …« Er wandte sich um und starrte durch das Fenster auf das gigantische Meer hinaus. »Gott, habe ich dich vermisst.«
Eins der Kinder rief von oben, und in derselben Sekunde war sie schon aufgesprungen und aus dem Zimmer verschwunden. Sophie lag da wie ein Engel, das Gesicht im Mondlicht, aber Andy warf sich unter der Decke hin und her und fuchtelte mit einem Arm in der Luft herum. »Ein Stachel!«, schrie er. »Mach es tot!«
»Ist gut«, sagte sie. »Schhhh. Wach mal kurz auf.«
»Das Tier!«, heulte er. »Hau es!«
»Du hast geträumt«, sagte sie. »Du schläfst. Du schläfst und denkst an den Wassertank.«
»Huh«, machte er, rollte sich zu einer Kugel zusammen und schlief wieder ein. Sie stand da, betrachtete sich im Spiegel oben an der Treppe und strich sich eine Haarsträhne zurück. »Einunddreißig«, dachte sie. »Ehrlich, das denkt man doch nicht.« Sie war herrlich glücklich und ging wieder ins Wohnzimmer. Aber Heneker war nicht mehr da.
»Immerhin warst du es, die Schluss gemacht hat«, sagte er.
»Nein.« Sie faltete Kleidung. Die Kinder spielten, planschten und riefen: »Heneker! Guck mal! Krabben, Heneker!«
»Gleich«, sagte er. Er saß auf einem Stein und hatte sich sein Handtuch um den Hals gelegt. Sie saß etwas unterhalb im Sand, sein nacktes braunes Bein vom Knie bis zum Knöchel neben ihrer Schulter. Sie stopfte Andys Socken in seine Sandalen. Auch dieser neue Tag war glühend, es war immer noch un-irisch heiß.
»Wahnsinnsschnitt«, sagte er.
»Was, damals? Na ja, jedenfalls ein glatter Schnitt.«
»Nein, dein Haarschnitt. Dein Haar, wie es sich lockt und schimmert.«
»Ach, Heneker.« (Wie kommt es, dass es sich genauso gut anfühlt, wenn er einen nicht berührt, wie bei anderen Männern, wenn sie einen berühren? Noch besser sogar.) »Ich dachte, du konntest meine Haare nie leiden.«
»Das habe ich nie gesagt. Ich fand sie nur … zu symmetrisch, damals. Zu nett. Jetzt ist es besser.«
»Am Ende war es nicht mehr zu nett.«
»Das stimmt«, sagte Heneker. »Wie gesagt, du warst es, die mich verlassen hat.«
Er glitt von dem Felsen und setzte sich neben sie. »Und die geheiratet hat«, sagte er und legte den Kopf an den Stein, auf dem er gesessen hatte, »ungefähr zehn Minuten später. Weiß Gott, was das sollte, ich wusste von nichts. Den Nächstbesten. Stand sogar in der Times. Hochzeit in Schottland mit den ganzen verwitterten Witwen, und ich war nicht eingeladen.«
»Wohl kaum.«
»Kommt das Wort Witwe daher? Von verwittern? Müsste man mal nachschlagen. Wirst du auch verwitwen? Dann heirate ich dich.«
»Du bist gemein.« Sie wollte aufstehen.
»HALT.«
Die lange, braune Hand, zehn Jahre älter, aber so vertraut wie ihre eigene, schloss sich endlich um ihre. »Halt. Geh nicht.«
»Warum zum Teufel sollte ich nicht?«
»Geh nicht. Mit deiner weißen, weißen Haut.«
»Wenn ich verwittert bin …«
»Ach, Het. Hör doch auf.«
Sie saßen am fast leeren Strand. Ein paar Dubliner setzten ein ganzes Stück weiter weg ein Boot zusammen. Ein, zwei weitere Leute waren da. Zwei Fischer stapften nach getaner Arbeit den Strand hinauf, mit einer schweren Plastiktüte voller Fisch, der die Tüte blutrot färbte. Sie trugen alterslose Kleidung und hatten uralte Gesichter. Ohne die Plastiktüte hätten sie auch Geister sein können. Sie gingen an Sophie und Andy vorbei, die eine Sandburg bauten, Sophie klopfte mit einer rosa Schaufel den normannischen Wachturm fest. Ihre Unterarme schimmerten golden.
»Wunderschöner Tag«, sagte der ältere Fischer, als sie vorbeigingen. »Sie haben wunderschöne Kinder.« Der jüngere sah Hetty an. Sie gingen den Strand hinauf.
»Ich liebe dich so sehr«, sagte Heneker.
Sie versuchte, ihre Hand aus seinem fester werdenden Griff zu ziehen.
»Und was hast du dann gemacht?«, fragte sie schließlich.
Er lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück.
»Geheiratet, nehme ich an.«
»Nimmst du an? Das musst du doch wissen. Die Frau, die … doch nicht die, mit der du damals …«
»Nein«, sagte er und setzte sich auf. »Nicht die.«
»Also eine Malerin.«
»Ja. Eine verdammt gute Malerin, falls es dich interessiert.«
Andy kam dazu und warf seine Krabben hin. Sophie rutschte auf etwas Glitschigem aus und weinte. Trost. Taschentücher. Kleider. Nach Hause zum Mittagessen und Mittagsschlaf; Heneker ging in das Pub, in dem er untergekommen war.
»Kommst du nachher wieder und knetest uns Tiere, Heneker?«
»Na gut, Andy. Halb acht.«
»Ich war angeblich auch eine verdammt gute Malerin.« Wieder stellte sie das Kaffeetablett zwischen sie, versuchte, das Feuer zu schüren, und zog die Vorhänge noch weiter zurück, damit man das abendliche Meer besser sehen konnte. »Bis ich dich kennengelernt habe.«
»Das meinte ich.«
»Du hast es kaputtgemacht.« Sie schenkte Kaffee in große Becher. »Das ist alles. Du hast mir nicht gutgetan. Du hast keiner Frau gutgetan.«
»Hast du auch braunen Zucker?«, fragte er.
»Nein.«
»Ich hätte gedacht, Lord Dings hätte braunen Zucker für Kaffee da, Lady Hohestier. Lady Großesgeld.«
»Lebensmittel sind im Mietpreis nicht enthalten. Die kaufe ich selbst ein. Beziehungsweise Charles. Hier im Dorf bekommt man keinen Rohrohrzucker …« Sie konnte nicht weitersprechen.
»Liebes«, sagte er, kam zu ihr und nahm ihre Hände. »Liebes, bitte, nicht. Nicht weinen. Was auch immer …«
»Du bist dermaßen grausam. Du warst schon immer so grausam.«
»Aber ich bin ehrlich«, sagte er und drückte ihr die Hände so fest, dass es weh tat. »Das war ich immer. Und zu niemandem sonst. Nicht so ehrlich wie zu dir.«
»Na, schönen Dank auch.«
»Ach, Het. Sei nicht genauso grausam. Gott, du warst schon immer noch grausamer. Und das weißt du auch. Du hast immer da getroffen, wo es richtig weh tat. Weil du genau wusstest … Wo willst du denn hin?«
Er holte sie ein, als sie die Eingangshalle erreichte, am Fuß der Treppe, wo das Geländer in einer mächtigen Schnecke endete, groß genug, um ein Telefon dort zu platzieren. Es war ein altmodisches Telefon mit Hörrohr und einem sehr alten, braunen Textilkabel. »Het«, sagte er und hielt sie fest. Das Telefon kippelte, und er fing es auf. »Wahnsinn«, sagte er und betrachtete es. »Gott, ist das hübsch. Wie eine schwarze Narzisse. Funktioniert es noch?«
Sie rannte die Treppe hinauf und ließ ihn mit dem Telefon am Herzen stehen. »Dann gehe ich wohl wieder ins Pub.« Sie antwortete, indem sie ihre Schlafzimmertür schloss. Dann hörte sie ihn die unkrautbewachsene Einfahrt hinuntergehen, zwischen den riesigen Rhabarberstauden und den wild wuchernden Fuchsien hindurch zu den großen, halb verfallenen Torpfosten. Ein-, zweimal hörte sie ihn stehen bleiben. Mit grausamer, köstlicher Freude stellte sie sich vor, wie er sich zu dem dunklen Haus umdrehte, ihr Schlafzimmerfenster ebenso dunkel wie der ganze Rest.
»Nicht bewegen.«
Sie legte sich einen Arm über die Stirn und lugte darunter hervor. Er zeichnete. »Mach die Augen wieder zu. Und nimm den Arm wieder runter, Het.«
Nach einer Weile sagte sie: »Kann ich sie wieder aufmachen? Ich will sehen, ob die Kinder … ich bin eingeschlafen.«
»Es geht ihnen gut«, sagte er. »Ich sehe sie. Sie fangen Krabben in einer Pfütze. Ich habe sie auch gezeichnet.«
»Wie lange bist du denn schon hier?«
»Ungefähr eine Stunde. Du hast tief und fest geschlafen. Die roten Ameisen sind munter über dich marschiert.«
»Das glaube ich dir nicht.«
»Die Fischer haben sich das auch ganz genau angeguckt.«
»Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen.«
»Du bist zu früh ins Bett gegangen, Hetty mit der weißen, weißen Haut. Du hast dich nie verbrennen lassen. Hier.« Er warf ihr die Zeichnung zu. »Hetty, schlafend.«
»Das ist … wirklich schön.«
»Und hier sind die Kinder.« Sophies runde, feste Wangen, die geschwungenen Wimpern, an ihrem Handgelenk immer noch die Falte wie bei einem Baby.
Andys schmaler Kopf, der klare Blick; eine weitere Zeichnung von seinem Hinterkopf, die herzzerreißende Locke, noch aus Babytagen, die sich in die Kuhle in seinem Nacken schmiegte.
»Hast du Kinder, Heneker?«
»Nein.«
Er stand auf und lief Richtung Meer, und Sophie und Andy sahen das, sprangen auf und folgten ihm. Andy zeigte ihm irgendetwas in einer Pfütze, Sophie streckte die Arme aus, um auf den Arm genommen zu werden. Heneker untersuchte mit einer Hand das Ding aus der Pfütze und hob mit dem anderen Arm Sophie hoch und setzte sie sich auf die Schultern, und so standen sie zu dritt zusammen da, von der Sonne beschienen, friedlich.
»Morgen«, sagte Heneker, als er zur Mittagszeit ihre Sandwiches aß – der Tag war zu schön, um nach Hause zu gehen, zu schön, als dass die Kinder ihn mit einem Mittagsschlaf hätten verplempern wollen –, »morgen fahren wir zur Show nach Clifden und gucken uns die Ponys an. Mit dem Bus!«
»Warum denn mit dem Bus?«, fragte sie.
»Um mal ein paar Menschen zu sehen.«
»Zeichnest du die Leute im Bus?«, fragte Andy.
»Mal sehen.«
Aber das tat er nicht.
Sie saßen in einer Reihe zu beiden Seiten des Mittelgangs, Hetty mit Andy und Heneker mit Sophie, die schon bald auf seinen Schoß kletterte, lauschten den Gesprächen der anderen Fahrgäste und betrachteten das Meer und das Moor und die vorbeiziehenden Connemara Mountains, violett und elegant hinter dem tiefgelben Stechginster und den dahingeworfenen weißen Steinen. In Clifden sahen sie sich die Stände an und streichelten die Ponys und kauften Dinge und aßen Dinge und tranken Dinge und mischten sich unter das reizende Volk. Heneker, in verwaschenen blauen Jeans, mit dem gebräunten Gesicht, seine Gestalt schlaksig wie die eines Cowboys, die beiden Kinder im Schlepptau, zog die Blicke auf sich. Hetty trug das Picknick in einem großen, runden Korb, den sie zwischen den Angelsachen im Haus gefunden hatte, sie hatte Sandalen an den Füßen und ein Tuch um den Kopf und trug ein verblichenes rotes Kleid, das sie vor Jahren in Florenz gekauft hatte, ging leichtfüßig neben ihnen her und hatte das Gefühl, man könnte sie auch für eine Zigeunerin halten. Glücklich und erschöpft nahmen sie um fünf Uhr den Bus nach Hause, Sophie schlief in Henekers Armen fest ein, Andy rutschte neben ihn. Hetty stellte den Korb auf den leeren Platz neben sich und hielt sich gegen die tiefstehende Sonne schützend die Hand vor die Augen wie eine Landarbeiterin.
Als der Bus am Pub hielt, trug Heneker Sophie vorsichtig hinaus und setzte sie auf den Rücksitz von Hettys Auto. Andy stolperte hinter ihr hinein, dann steckte er den Kopf zum Fenster hinaus.
»Kommst du noch mit, Heneker?«
»Nein. Im Pub gibt es jetzt Abendessen.«
»Mummy könnte dir doch bei uns was mitkochen.«
»Nein, dann sind sie im Pub böse, wenn ich nicht komme. Sie haben es bestimmt schon fertig.«
»Warum sollten sie? Du kannst es ja trotzdem bezahlen. Komm doch mit zu uns und bleib da! Wir haben jede Menge Zimmer. Du könntest neben Mummy schlafen.«
Seine klare Stimme trug weit über den Parkplatz des Pubs, und ein paar Leute, die gerade vom Strand zurückkehrten, wirkten amüsiert. Ein Mädchen – die Kellnerin oder Barmaid, die an der Tür zur Bar gelehnt hatte – verschwand türenknallend.
»Das kann ich nicht machen.« Heneker tippte Andy auf die Nase. »Ihr müsst los. Es war ein langer Tag.«
Hetty ließ den Motor an. Er kam zu ihr herum und sagte: »Ich schaue später noch mal vorbei.«
Der Satz endete mit einem Fragezeichen, sollte aber klingen wie eine Feststellung. Sie sah ihn nicht an, sondern konzentrierte sich auf die Gangschaltung und sagte: »Okay«, dann fuhr sie durchs Tor hinaus und den Hügel hinauf.
Als die Kinder gegessen hatten und im Bett waren, ganz benommen und rosig von der Sonne, badete sie und zog sich um, probierte erst ein Teil an, dann das nächste, und entschied sich schließlich für einen langen Morgenmantel aus Baumwolle. Sie steckte sich das Haar hoch, das sich sofort wieder löste. Ziemlich erfolgreich. Sie stromerte barfuß in die Küche, auf der Suche nach etwas zu essen, aber nichts machte ihr Appetit. Sie nahm eine Tomate aus dem Kühlschrank, aß sie im Stehen und starrte durch das Küchenfenster auf den ungemähten Rasen und die hochgewachsenen Nachtkerzen, die gegen das Fenster schlugen. Sie deckte das Kaffeetablett.
Dann ging sie ins Wohnzimmer und bemühte sich halbherzig um das erlöschende Feuer. Hinter der Landzunge ging lodernd die Sonne unter und ließ den Raum in vollem Glanz erstrahlen. Eine silbrig torfige Staubschicht lag auf den alten Möbeln, eine große Vase mit Blumen und Blattgrün, die sie gestern zusammengestellt hatte, schimmerte rosarot. »Wie im Traum«, dachte sie. Sie ging im gesamten Haus umher und in den Garten, schritt auf nackten Sohlen alles ab, entdeckte einen überwucherten Fischteich, linste in längst verlassene Stallungen, wo Bäume durch das Dach wuchsen, und scheuchte drei magere Schafe unter einer alten Aufsteighilfe auf. Sie ging den langen Weg zur Haustür zurück und sah eine Weile aufs Meer hinaus und ausdrücklich nicht zur Straße.
Dann ging sie hinein und setzte den Kessel auf. Und nahm ihn wieder vom Herd. Sie ging oben nach den Kindern sehen, und als sie wieder herunterkam, sah sie schließlich doch ungeniert die lange, leere Einfahrt hinunter. Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück, setzte sich in den Sessel und betrachtete den schwarzen Torf im Feuer. Die Sonne war jetzt weg, und es war kalt im Zimmer. Es war halb elf.
Er kam nicht.
Beim Einschlafen sah sie plötzlich Charles’ aufmerksames und besonnenes Gesicht vor sich. Sie dachte: »Charles hat mich immer bis zur Haustür gebracht.«
»Hetty, schlafend.«
Sie zuckte so heftig zusammen, dass ihr geradezu übel wurde, und setzte sich kerzengerade auf. Ihr gegenüber im anderen Sessel saß Heneker. Er lachte. »Hetty, tief und fest schlafend.«
»Wo warst du? Wo bin ich?«, jammerte sie. »Heneker – es ist mitten in der Nacht. Wo warst du?« Es war zehn Jahre vorher. Aber wo war das Glasdach, der Geruch von Earl’s Court? »Wo warst du? Ich war ganz allein.« Sie sah sich um. Es war jetzt. Irland. Das teure, gemietete Haus. Kinder. Charles irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Charles …
»Die Kinder«, sagte sie. »Ich muss nach den Kindern sehen. Die Türen sind sperrangelweit offen, es hätte ja jeder reinkommen können.«
»Es war nur ich, der reingekommen ist.«
»Aber jeder andere hätte es auch gekonnt. Die I.R.A. …«
»Sei nicht albern, Het.«
»Du hattest kein Recht, hier einfach reinzuspazieren.«
»Du hast gesagt, ich soll noch kommen.«
»Es ist mitten in der Nacht.«
»Ich wurde aufgehalten. Es ist ein langer Fußmarsch hierher.«
»So spät warst du noch nie.« Sie hörte ihre Stimme, hoch, anklagend. Oh Gott! Wie eine Ehefrau. Wie damals. Exakt genauso.
Müde stand sie auf. »Ich muss nach den Kindern sehen, Heneker.« Langsam ging sie weg.
Aber auf der Treppe blieb sie stehen. Nach einer Weile seufzte sie, drehte sich um und setzte sich hin, den Kopf ans Treppengeländer gelehnt. In der Eingangshalle standen alle Türen offen, durch die offene Haustür zur Rechten fiel das Mondlicht herein, und der schwere, betäubende Duft der Nachtblüten aus dem Garten erfüllte den ganzen Raum. Sie schloss die Augen.
»Het.« Er stand am Fuß der Treppe neben dem alten Telefon. »Het.« Er hob den Arm. »Ach, meine geliebte Het.«
Sie zog sich hoch und ging widerstandslos zu ihm hinunter, bis sie zwei Stufen über ihm stand und auf Augenhöhe war.
»Schlaf mit mir, Hetty«, sagte er, und sie sagte: »Natürlich.«
Auf dem Treppenpfosten klingelte das Telefon.
»Das kann nicht sein! Das klingelt doch nicht!«
»Na ja, tut es wohl.«
»Kann nicht sein. Hat es noch nie. Das ist ja schrecklich!« Sie hielt sich die Ohren zu.
»Du gehst wohl besser ran.«
»Ich kann nicht! Ich kann nicht!«, schrie sie.
»Also, ich kann wohl kaum rangehen, oder? Verdammt noch mal, jetzt mach, dass das aufhört.« Er ging zur offenen Haustür.
Sie sah ihn unentwegt an, nahm den schweren Hörer ab und hörte ein lautes Knacken, dann die Stimme einer schläf-rigen Telefonistin, mehr Knacken, und dann aus den Untiefen des Äthers Charles.
»Hester? Hester? Wo zum Teufel …? Gottverlassen …«
»Hier bin ich«, sagte sie. »Ja? Charles?«
»… sofort komme.«
»Wann kommst du?«
»Ich bin …«, lautes Knacken, »endlich bei euch.«
»Ich habe dich nicht verstanden. Wann? Wann kommst du? Wann bist du hier?« Das Knacken wurde lauter, schmerzte in den Ohren, dann hörte es auf. Es war still.
»Er … Er … Charles. Er ist unterwegs.«
»Wo ist er jetzt?«
»Keine Ahnung. Vielleicht in Clifden.«
»Nachts um zwölf? Dann ist er nicht vor morgen hier, falls er den Bus nimmt.«
»Vielleicht ist er auch schon in Ballynish.«
»Blödsinn. Wieso sollte er anrufen, wenn er schon in Ballynish ist? Er ist bestimmt noch in Dublin. Oder wahrscheinlicher noch in London. Ruft aus dem Hilton an. Wo er mit seinen Kunden zecht.«
»Nein. Nein, du kennst Charles nicht. Ich bin sicher, dass er schon fast hier ist.«
Er nahm das Telefon, warf es zu Boden und packte sie an den Handgelenken. »Het. Schlaf mit mir.«
»Ich kann nicht. Ich kann nicht.«
»Gut.« Er ging wieder zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal zu ihr um. Hinter seinem Kopf lag das schillernde Meer. »Es gab nie jemanden außer dir, Het«, sagte er.
»HESTER!« Charles’ angenehme Stimme in der Eingangshalle. Das Geräusch fallen gelassenen Gepäcks, irische Stimmen aus dem Taxi. Das halbe Dorf war zum Helfen gekommen, und bei der Gelegenheit wurden auch gleich die Neuigkeiten ausgetauscht. »Was für eine Reise! Was für ein entlegener Ort!« Quietscher von Sophie und Andy. »Daddy! Oh, Angeln! Hast du an meine orange Tasche gedacht? Hier gibt es Krabben, riesige! Hummer. Wir waren bei der Ponyshow!«
Sie beobachtete sie von der Treppe aus, sie sprangen ungestüm herum wie die Welpen, daneben standen der Taxifahrer, der Assistent des Taxifahrers und der Großvater des Taxifahrers.
»Hester. Gott sei Dank. Die verdammte Geschichte ist vorbei. Komm her, gib mir einen Kuss!« Die Dienstboten wurden entlohnt.
»Wie geht’s dir, Liebes? Ich kann dich gar nicht sehen, gibt es hier kein Licht? Und was bollert denn da so? Himmel, was für ein Telefon, hab ich dich auf dem Ding erreicht?«
»Das Licht kommt und geht«, sagte sie. »Das Bollern auch.«
»Das kriege ich schon wieder hin«, sagte er. »Der Strom kommt bestimmt aus einem Generator, da kümmere ich mich gleich drum. Es ist ganz schön kalt hier drin.«
»Wir kriegen den Torf nicht an«, sagte Andy.
»Aber Torf ist super, ihr unpraktischen Wesen! Ich mache es uns gleich warm. Wo ist denn das Wohnzimmer? Im Moment drehen wir besser den Absperrhahn zu, wir gehen aus zum Abendessen.«
»Geht nicht, es gibt nur das Pub. Da muss man reservieren.« (Was ist denn mit meiner Stimme?)
»Hab ich.«
»Aber die Läden hier machen kein … fast nie«, sagte sie.
»Ich habe unterwegs beim Pub angehalten, bin reingegangen und habe reserviert. Na komm. Zieh den Kindern die Nachthemden aus, wir gehen Hummer essen.«
»Charles … ich kann nicht ins Pub gehen. Ich bin total fertig. Hundemüde. Ich habe die ganze letzte Nacht auf dich gewartet. Und wir waren den ganzen Tag hier und haben gewartet. Es ist schon nach acht.«
»Die ganze Nacht? Du hast doch nicht gestern Nacht mit mir gerechnet? Ich habe doch erst um Mitternacht angerufen. Da war ich noch in London.«
»Ach ja«, sagte er, als er sie alle den Hügel hinunterfuhr. »Die Bartletts sind auch im Pub.«
»Die Bartletts? Von zu Hause? Aus Denham Place? Oh nein!«
»Doch. Bist du heiser? Sie haben gesagt, sie haben dich gestern gesehen. Mit einem schönen Mann.«
»Ich hab sie gar nicht bemerkt.«
»Ich aber«, sagte Andy. »Als wir Heneker am Pub abgesetzt haben.«
»Kinder sind wirklich komisch«, sagte sie im Pub zu Cathie Bartlett. »Andy hat dich gestern gesehen, aber kein Wort gesagt.«
»Du warst wie in Trance.« Cathie Bartlett sah sie vorsichtig an. Charles lachte laut über irgendetwas, das Bartlett ge-sagt hatte. Sie waren allein im Speiseraum des Pubs. Ein Kind der Bartletts war vom Fernsehzimmer hereingekommen und auf den Schoß seiner Mutter gezogen worden. (Jeder Schoß ist sein Schoß. Jedes Kind ist sein Kind. Ach, Heneker. Ach, Heneker.)
»Berühmter Mann«, sagte Bartlett. »Großer Künstler. Hat hier einen ziemlichen Wirbel verursacht.«
»Ach so, Heneker Mann!«, sagte Charles. »Um den geht es. Eine alte Flamme von Hester, was?«
»Ja«, sagte Hester. (Ich bin so weit weg.) »Ich habe an der Slade bei ihm studiert. Vor hundert Jahren.« (Was soll ich bloß tun?)
»Und jetzt ist er weg?«, fragte Charles.
»Ja. Heute Morgen verschwunden. Die Barmaid ist auch weg, glaube ich. Alle sind in Aufruhr deswegen. Na ja – er war jede Nacht mit ihr zusammen.«
»Noel!«, sagte Cathie.
»Stimmt doch. Sie war ungefähr in deinem Alter. Und die Dielen hier knarzen. Wir haben kein Auge zugetan, Cathie und ich, die ganze Woche nicht.«
»Man kann ihr das allerdings nicht verübeln«, sagte Cathie. »Wundervoller Mann. Dir kann ich es ja sagen, Hester«, sie steckte sich geübt über dem Kopf ihres Kindes eine Zigarette an, »ich war grün vor Neid, als ich dich mit ihm am Strand gesehen habe. Pass bloß auf sie auf, Charles.«
»Keine Sorge«, sagte Charles.
Sie standen auf und gingen.
In Lord Dings’ Wohnzimmer brannte das Torffeuer hell und leuchtend. Charles brachte das Tablett herein und stellte es auf den Hocker, dann zog er die Vorhänge zu. Er sagte: »Ich habe die Kinder ins Bett gebracht. Und ich musste Tee machen. Ich habe keinen braunen Zucker gefunden.«
»Den habe ich vergessen.«
»Macht nichts. Tee hält uns immerhin nicht wach. Was ist das denn? ›Hetty, schlafend‹.«
»Gib her.«
»Nein, lass es mich doch erst mal angucken. Das ist wundervoll. So schön.«
»Das ist meins. Charles, gib es her. Gib her. Gib es her!«
»Nein«, sagte er. Er hielt die Zeichnung unter eine Lampe. »›Hetty, schlafend‹.« Er setzte sich die Brille auf.
»Gib her. Gib her. Gib her!«
»›Hetty, schlafend‹«, sagte er. »Wie traurig.«
Er legte die Zeichnung ganz vorsichtig auf Lord Dings’ Schreibtisch. Dann schenkte er ihr Tee ein und sagte: »Wach bald auf, süße Hetty.«
Lunch mit Ruth Sykes
Gestern Nacht hat sie wieder geweint, das hat es mir heute Morgen leichter gemacht.
Ich sagte: »Heute gehe ich mit Ruth Sykes mittagessen, Liebes.«
»Mmmm«, machte sie, schwarzen Kaffee in einer Hand, Toast in der anderen, und schaute auf die Morgenzeitung hinunter, die sie auf dem Küchentisch ausgebreitet hatte – sie setzt sich zum Frühstück nie hin.
»Du kommst zurecht, Liebes?«
»Mmmm.«
»Wegen Mittagessen meine ich. Nach der Sprechstunde. Ich stell dir was in den Ofen. Musst du nur rausnehmen.«
»Was?«
»Dein Mittagessen. Nach der Sprechstunde. Und den Hausbesuchen. Steht im Ofen.«
Sie sah mich durch ihre große Brille an – was für eine große, schöne Tochter. Wie kann so eine große Frau aus mir herausgekommen sein? Ich bin doch so klein. Jack war auch klein. Und niemand von uns war irgendetwas Besonderes. Schon gar nicht etwas so Schlaues wie Arzt, in keiner unserer Familien. Komisch – ich sehe sie an, meine Tochter, meine Rosalind, und kann nicht fassen, dass sie das Baby ist, das ich damals bekommen habe: das dicke, kleine, runde, warme, strahlende Ding, das seine Fäustchen aus dem Kinderwagen ins Licht streckte und die sich sanft bewegenden Blätter der Birke betrachtete wie ein träges Kätzchen. Und jetzt ist sie so mutig und tapfer und stark – schnelles Auto, Arzttasche auf der Rückbank, Stethoskop, weißer Kittel. So schnell am Telefon. Ach, es ist immer so schön, sie telefonieren zu hören! »Ja? Wann war das? Gut – tun Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin.« Wie viele Leben sie wohl rettet! Sie ist eine wundervolle Ärztin.
Aber dieses Weinen ist schrecklich. Letzte Nacht war es wirklich schlimm.
»Warum bist du nicht da, Mutter?« (Wirft einen Blick auf den Telegraph. Geht näher ran.)
Sie lässt sich nie gehen, nicht mal, wenn sie glücklich ist. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie so richtig überwältigt erlebt habe, war, als die Zusage aus Oxford kam. Damals hat sie nur das Telegramm geöffnet, »Ach du lieber Himmel« gesagt und sich einen kompletten Becher Kaffee über die Schuluniform gekippt – und auf den sauberen Boden.
»Ich gehe mit Ruth Sykes mittagessen.«
Sie trank ihren Kaffee aus. »Tschüss«, sagte sie. »Viel Spaß. Dann sehen wir uns zum Abendessen – ach nein, das habe ich ganz vergessen. Da bin ich noch im Krankenhaus.«
»Wie lange denn, Liebes?«
»Gott, keine Ahnung. Zehn? Elf?«
»Ist gut.«
Ohne sie fehlt der Straße, dem Vorgarten und dem ganzen Haus etwas. Der Morgen hat keine Kraft mehr.
Ich ging wieder in die Küche und räumte das Frühstück weg.
Fahre ich wirklich? Traue ich mich?
Ich wusch ab und stand dann lange da und betrachtete den Geschirrschrank, bevor ich die Sachen wegräumte. Ich ging nach oben und zog mein dunkelblaues Wollkostüm und die guten Schuhe und Strümpfe an und betrachtete mein Gesicht im Spiegel.
Es ist ein ziemlich dummes Gesicht. Wie ein nicht sehr intelligenter Vogel. Angeblich haben Vögel ja intelligente Gesichter, aber ich weiß nicht. Meins ist ein Vogelgesicht, aber nicht das eines besonders schlauen Vogels. Eher drittklassig. Ein verschüchtertes, unsicheres Gesicht. Bereit, sich zum Affen machen zu lassen. Zum Affen aus einem Vogel. Rosalind sorgt immer dafür, dass ich mir wie ein Affe vorkomme. Als sie ein Baby war, war das noch nicht so. Damals hat sie noch nach Teilen von mir gegriffen – meinem Ohr oder meinem Kinn, und sich daran festgehalten und gelacht und gelacht. Eigentlich schade …
Egal, ich sehe besser aus als Ruth Sykes. Wenn ich mit Ruth Sykes zusammen bin, bin ich auch kein Affe. Ich bin total entspannt. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, und sie war nicht im Entferntesten so schlau wie ich, wobei ich überhaupt nichts Besonderes war. Ich wünschte, ich würde mit Ruth Sykes mittagessen gehen.
Würde ich aber nicht. Das habe ich vor zwei Wochen beschlossen, und ich verliere jetzt nicht die Nerven. Auf keinen Fall. Nicht bei all dem Geheule.
Ich fuhr nach London, zu Michael.
Es ging nicht gleich los mit dem Weinen, als Michael seine Besuche einstellte. Am Anfang war sie ganz gefasst und ruhig und normal, sogar ziemlich nett zu mir. Einmal hat sie mich sogar gefragt, ob ich mit ihr ins Theater gehe, und ich habe uns Karten für den Rosenkavalier besorgt – nur hier bei uns vor Ort. Das ist überhaupt nicht meine Lieblingsoper, und ich nehme an, sie fand es fürchterlich, aber wir saßen zwei Stunden lang ganz friedlich nebeneinander.
»Hat Michael heute Abend zu tun?« Da hatte ich es noch nicht gemerkt.
»Das nehme ich an«, sagte sie.
Sie hat sich allerdings nicht zu Hause verkrochen, überhaupt nicht. Und sie erwähnte ihn nie. Sie war mehrere Wochen lang wirklich nett zu mir – manchmal hat sie sich zu mir gesetzt und ein bisschen mit mir ferngesehen, und einmal hat sie mir sogar ein Kompliment für mein Kleid gemacht. Einmal hat sie mich angesehen, als wollte sie etwas sagen, und ich habe einfach gewartet, ich hatte so eine Angst, das Falsche zu tun. Ich rede nämlich immer zu viel. Ich mache mich schnell lächerlich mit meiner Art zu sprechen, wenn ich erst mal loslege.
Aber sie sagte nichts, und alles, was ich ein oder zwei Tage später sagte, war, dass Michael in letzter Zeit gar nicht mehr angerufen habe und ob sie im Sommer wieder zusammen in Urlaub fahren würden. Sie stand einfach auf und knallte die Tür hinter sich zu.
In der Nacht hörte ich sie weinen – schreckliche, lange Schluchzer. Ich wachte davon auf und wusste erst gar nicht, was das war – wie gruselige Sägegeräusche im Sekundentakt. Ich ging auf den Flur hinaus, und es schien von oben zu kommen, wo sie schläft, und ich bin hinaufgerannt und stand vor ihrer Tür.
Schreckliche Schluchzer.
Na ja, ich habe mich natürlich nicht getraut hineinzugehen.
Ich ging wieder hinunter und bei offener Tür zurück ins Bett und lauschte – zitternd, mit weit offenen Augen. Und versuchte, mir ihr Gesicht vorzustellen, sonst so weich und selbstbewusst, jetzt im Dunkeln verzerrt, der Mund verzogen, aus dem diese grässlichen Geräusche kamen.
Aber beim Frühstück war sie wie immer – Kaffeetasse in einer Hand, Toast in der anderen, schielte sie auf die Zeitung hinunter. Vielleicht hatten sich über ihrer Nase zwei Falten gebildet, die ineinanderliefen, das war alles.
»Setz dich doch, Liebes. Du verdirbst dir ja die Augen.«
Sie antwortete nicht. Ich stand in einer plötzlichen Anwandlung auf, ging um den Tisch, legte ihr den Arm um die Taille – sie ist so viel größer als ich – und sagte: »Schatz, kannst du dich nicht für einen Moment hinsetzen?«
Sie sagte: »Du meine Güte, Mutter«, und entzog sich mir.
Ich sagte: »Du verdirbst dir die Augen.«
»Gibt es irgendeinen Tag im Jahr«, fragte sie, »an dem du das nicht sagst?«
»Meinst du«, sagte sie, »du könntest wenigstens ein einziges Mal irgendetwas Selbstgedachtes von dir geben?«
Eine Zeitlang hörte ich sie nicht mehr weinen, aber vor drei Wochen fing es wieder an. In der ersten Woche hat sie jede Nacht geweint. Ich bin jedes Mal aufgestanden. Erst bin ich in meinem Zimmer herumgelaufen und habe mit Dingen gepoltert. Dann bin ich in den Flur gegangen und habe das Licht an- und ausgemacht. Einmal habe ich die Toilettenspülung betätigt. Aber das Weinen ging weiter. Am Ende – wie letzte Nacht – bin ich dazu übergegangen, mich vor ihrem Zimmer auf die Treppe zu setzen. Das hat natürlich nicht geholfen, aber es war alles, was ich tun konnte, also tat ich es. Ich habe mich in mein Federbett eingewickelt und saß einfach da und betete, dass sie aufhören würde. Manchmal redete ich mir ein, sie würde herauskommen und »Oh, Mutter!« sagen, und dann würde ich sie in den Arm nehmen und drücken und sagen »Ach, Rosalind, was ist denn passiert? Sag mir doch, was los ist. Was ist mit ihm?«
Aber sie kam nie heraus.
Am Ende hörte das Weinen immer auf – längere Pausen zwischen den Schluchzern, und wenn die bescheuerten Vögel langsam wach wurden, wurde sie endlich still. Lustig. Als sie ein Baby war, war das die Zeit, zu der sie aufwachte. Mit anderthalb Jahren hat sie mich wirklich genervt, da musste ich hart bleiben. Ich bin zu ihr reingegangen, und dann stand sie in ihrem Bettchen, die Windeln um die Knöchel, das Nachthemd ganz verknittert, das Gesicht rosig.
»So, Rosalind. Leg dich wieder hin. Es ist zu früh, Liebes. Es ist erst fünf. Der Tag hat noch gar nicht angefangen.«
»Aber die Vögel! Zwitschern schon!«, sagte sie. Oh, sie war so süß! »Die Vögel zwitschern schon.« Da war sie noch nicht mal zwei! Und noch in Windeln! Die Geschichte erzähle ich heute noch, muss ich gestehen. Das sollte ich nicht tun, denn sie hasst es. Sie funkelt mich dann an und stampft hinaus, oder, noch schlimmer, sie tötet mich mit einem eiskalten Blick. »Wie oft Ruth Sykes die Geschichte wohl schon gehört hat«, sagt sie.
Ich weiß, ich bin eine Idiotin.
Jedenfalls hat unser Arzt mich vor zwei Wochen für eine Idiotin gehalten, als ich bei ihm war und gesagt habe, ich habs am Herzen und möchte zum Kardiologen. »So, so, Mrs Thessally«, sagte er. »Soll ich das entscheiden? Was sagt denn ihre Tochter?«
»Ich habe es ihr nicht erzählt«, sagte ich. »Ich möchte nicht, dass sie das weiß. Aber ich bin mir sicher, und ich möchte zu einem Spezialisten. Ich möchte zu Dr. Michael Kerr.«
»Das ist nicht der Arzt, zu dem ich normalerweise überweise. Und überhaupt untersuche ich Sie jetzt erst mal, ob es überhaupt notwendig ist.«
Er untersuchte mich und sagte, er freue sich, mir mitteilen zu können, dass ich keinen Kardiologen brauche. »Vollkommen normales Herz, soweit ich das sehen kann. Sehr gut für Ihr Alter. Wie alt sind Sie? Fünfzig? Zweiundfünfzig? Keinerlei Anzeichen für Probleme.«
Aber ich ließ nicht locker. Ich lasse gern mal nicht locker, wenn ich nicht gerade mit Rosalind zusammen bin. Dann spreche ich kaum.
»Wissen Sie – ich kann Sie nicht gut in die Harley Street schicken, wenn Ihnen überhaupt nichts fehlt«, sagte er.
»Meine Tochter sagt, drei Viertel der Leute, die zu ihr kommen, haben rein gar nichts. Es ist nur in ihren Köpfen. Und das hier ist mein Kopf«, sagte ich. »Und ich kriege es da nicht raus.«
»Schlafen Sie nicht gut?«, fragte er.
»Nein.« (Das stimmte zumindest.)
»Essen?«
»Nicht viel.«
»Belastet Sie etwas?«, fragte er, legte die Fingerspitzen aneinander und sah mich über sie hinweg an wie in einer Krankenkassenwerbung. Was um alles in der Welt würde es nützen, es ihm zu erzählen?
»Mein Herz«, sagte ich schließlich. »Ich weiß, dass das idiotisch ist.« Ich habe große blaue Augen. Tatsächlich ist es so, wenn ich den Leuten mit weit offenen Augen ins Gesicht sehe und dabei ganz ehrlich an das denke, was ich gerade gesagt habe, dann lächeln sie oft, als hätte ich ihnen etwas Gutes getan. So wie der Arzt jetzt.
»Nun gut«, sagte er und löste die Fingerspitzen voneinander. »Ich überweise Sie an Doctor Michael Kerr und mache einen Termin für Sie aus.«
Die Überweisung hatte ich jetzt in der Handtasche, und diese Handtasche hielt ich in der U-Bahn, mit der ich bis Oxford Circus fuhr, sorgsam fest. Ich trug einen Hut und gute Handschuhe und Perlenohrstecker, allerdings nur von Woolworth. Auf dem Weg zu Michaels Praxisklinik war ich die Ruhe selbst, und ein oder zwei Leute – einer davon ein großer, schwarzer Mann mit einem bezaubernden Lächeln – bemerkten mich, und ich lächelte sie ebenfalls an, vor allem den Schwarzen, der sehr freundlich aussah.
Aber in der Praxis fühlte ich mich nicht mehr so gut. An der Rezeption war eine schreckliche Frau. »Zu Dr. Kerr?«, sagte sie und sah mich an, als hätte jemand so Unbedeutendes wie ich kein Recht, Michael zu sehen. »Sind Sie privat?«
»Nein. Also, nicht wirklich«, sagte ich. »Aber heute.«
»Tut mir leid, das verstehe ich nicht.«
»Ich bin gesetzlich versichert, aber ich fand es nicht richtig, Dr. Kerr auf Kassenkosten zu besuchen, denn mein Arzt meint, ich habe nichts. Deshalb bestehe ich darauf, selbst zu zahlen.«
Ihre sauber nachgezogenen Augenbrauen schossen in die Höhe. »Verstehe«, sagte sie (noch eine Verrückte). »Setzen Sie sich doch bitte noch kurz hier vorne hin.«
Sie nahm meinen Brief entgegen, öffnete ihn, strich ihn glatt, hängte ihn an eine Pinnwand und las ihn. Durfte sie das? Musste ich Rosalind mal fragen.
Aber das hier war etwas, was ich Rosalind nicht fragen konnte. Das hier war privat. Rosalind würde es nie erfahren. Ich war heute eindeutig privat.
Die Sprechstundenhilfe sah mich jetzt genauer an, und ihr Blick bekam so ein Funkeln, und ich versuchte, nicht hinzusehen. Ich betrachtete die beiden Türen mit den Aufschriften MALES und FEMALES. Sie waren frisch gestrichen, man erkannte noch, wo LADIES und GENTLEMEN gestanden hatte. MALES und FEMALES sah irgendwie schrecklich aus. Wie im Zoo.
Ich hatte schon immer Angst vor Arztpraxen und Krankenhäusern, aber das weiß Rosalind natürlich nicht. Ich starrte die Aushänge an den Wänden an und dachte: »Deswegen also«, wobei ich selbst keine Ahnung hatte, was ich damit meinte.
»Bitte hier entlang, Mrs Thessally.« Eine nette, krausköpfige Schwester, so mollig wie Rosalind als Baby, brachte mich in ein Wartezimmer, und eine Minute später kam eine blitzsaubere, dünne chinesische Schwester aus einer Tür, hielt sie auf und sagte: »Bitte, Mrs Thessally.«
Ich versuchte aufzustehen, war aber bewegungsunfähig.
»Hier entlang, Mrs Thessally.«
Ich blieb sitzen.
Sie kam zu mir und sagte: »Kommen Sie bitte mit, Mrs Thessally. Dr. Kerr beißt nicht.« Sie lachte und zeigte ihre hübschen, kleinen Zähne.
Und dann saß ich da, vor einem Tisch von der Größe eines Tennisplatzes, und dahinter saß Michael, der immer mit uns zu Abend gegessen hatte und der mir durchs Küchenfenster Grimassen geschnitten hatte, bevor er zur Hintertür hereinkam, sodass mir vor Schreck die Teekanne aus der Hand geglitten war. Er hatte im Garten Unkraut gejätet, auf die Uhr gesehen und gesagt: »Wo bleibt die Frau denn? Warum arbeitet Ihre Tochter so viel? Warum kommt sie nicht Tennis spielen?« Michael hatte mehr als zwei Jahre lang zu unserem Leben gehört.
Im weißen Kittel wirkte er älter, strenger und sogar größer. Er trug eine Brille – das war neu –, und er las meinen Arztbrief mit demselben niedergeschlagenen Gesichtsausdruck, den Rosalind neuerdings hat.
»Also dann«, sagte er. »Mrs – er?«
Ich saß da.
»Mrs Thessally!«, sagte er.
Und ich saß da und betrachtete meine Hände in den guten Handschuhen. Ich sah ihn nicht mehr an. Ich wusste alles, was ich hatte wissen wollen. Ich wusste es dank seiner entsetzten, am Ende hochgehenden Stimme. »Mrs Thessally.«
Und da auf dem Tisch lag der Brief von meinem Hausarzt, dass mir gar nichts fehlte, ich aber darauf bestanden hätte, ihn zu sehen, und nur ihn.
In dem Moment wurde mir klar, wie gründlich ich es vergeigt hatte. Und wie immer bei Rosalind – und wie noch nie bei dem lieben Michael – war ich unfähig zu sprechen.
Ein Arzthelferinnenwesen kam herein und sagte: »Tut mir leid, Herr Doktor, könnten Sie die hier bitte kurz unterschreiben?« Und das tat er dann. Sie ging wieder hinaus. Er schob den Aschenbecher und andere Dinge auf dem Tennisplatz herum und räusperte sich. Ich hörte das leise Ticken der kleinen, goldenen Uhr auf dem Regal hinter ihm – eins von Rosalinds Geburtstagsgeschenken.
Wieder wurde die Tür aufgerissen, und jemand rief: »Oh, Entschuldigung – kann ich Sie mal kurz sprechen?«, und ein junger, sorglos wirkender Medizinalassistent in Kittel und fliegendem Stethoskop kam herein. »Mrs Arnold geht es ja wirklich gut.«
Michael sagte: »Oh ja.«
»Wunderbar. Ich denke, wir können sie heute entlassen.«
»Das würden Sie nicht denken, wenn Sie sie heute Nacht gesehen hätten. Sie ist kollabiert.«
»Was?«
»Ja. Wir waren zwei Stunden bei ihr.«
»Oh Gott. Das hat mir niemand gesagt!«
»Dann ist es ja gut, dass Sie mich noch konsultiert haben, nicht wahr? Ich hoffe, Sie haben es ihr noch nicht gesagt?«
»Was?«
»Dass sie heute nach Hause kann.«
»Nein. Nein.«
»Sie braucht noch ziemlich viel Pflege.«
Der Medizinalassistent verschwand, und die Tür ging zu.
Michael stand auf, ging ans Fenster und sah hinaus. Ich stand ebenfalls auf.
»Dann gehe ich wohl besser«, sagte ich. Er sagte nichts. Ich ging zur Tür und musste mich einfach noch mal zu ihm umdrehen, und da stand die vertraute Gestalt, so gottgleich und allmächtig durch diese Umgebung, überlebensgroß, so anders, als wenn er durch meinen Rittersporn kroch und Schneckenkorn ausbrachte und meine abwesende, zu viel arbeitende, sich nicht für Tennis interessierende Tochter verfluchte. Wie hatte ich es nur wagen können!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: