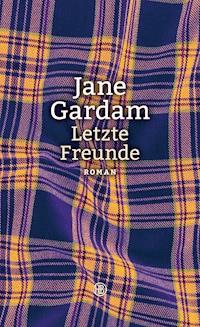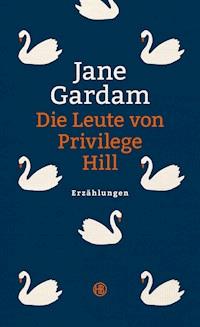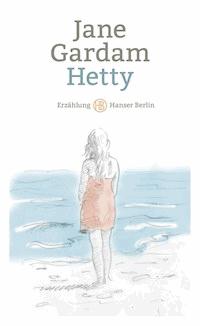Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterhaft erzählt die Bestseller-Autorin Jane Gardam von den Geheimnissen und Scheinheiligkeiten, ohne die wir im Leben nicht auskommen. Ein flirrender Sommerroman an der englischen Küste.
Es ist Sommer, und Margaret ist acht und schwer genervt: Der frischgeborene Bruder ist hässlich und schreit, die Mutter hat sich in ein träge stillendes Wesen verwandelt, der Vater predigt gegen die Verderbtheit der Welt.
Einmal in der Woche kann Margaret der Langeweile zu Hause entfliehen: Mittwoch ist Ausflugstag mit Lydia, dem neuen Hausmädchen, die mit ihrer selbstbewussten Körperlichkeit und handfesten Sprache in diese Familie platzt und als einzige Erwachsene wirklich zu wissen scheint, was sie will ─ Spaß. Ihre Anwesenheit eröffnet nicht nur Margaret eine neue Welt, sie bringt das bigotte familiäre System aus dem Gleichgewicht, und am Ende dieses Sommers wird nichts mehr so sein, wie es schien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Meisterhaft erzählt die Bestseller-Autorin Jane Gardam von den Geheimnissen und Scheinheiligkeiten, ohne die wir im Leben nicht auskommen. Ein flirrender Sommerroman an der englischen Küste.Es ist Sommer, und Margaret ist acht und schwer genervt: Der frischgeborene Bruder ist hässlich und schreit, die Mutter hat sich in ein träge stillendes Wesen verwandelt, der Vater predigt gegen die Verderbtheit der Welt. Einmal in der Woche kann Margaret der Langeweile zu Hause entfliehen: Mittwoch ist Ausflugstag mit Lydia, dem neuen Hausmädchen, die mit ihrer selbstbewussten Körperlichkeit und handfesten Sprache in diese Familie platzt und als einzige Erwachsene wirklich zu wissen scheint, was sie will ─ Spaß. Ihre Anwesenheit eröffnet nicht nur Margaret eine neue Welt, sie bringt das bigotte familiäre System aus dem Gleichgewicht, und am Ende dieses Sommers wird nichts mehr so sein, wie es schien.
Jane Gardam
Mädchen auf den Felsen
Roman
Aus dem Englischen von Isabel Bogdan
Hanser Berlin
1
Weil jetzt das Baby da war, sollte Margaret, die acht Jahre alt war, besondere Aufmerksamkeit bekommen. Also würde sie mittwochnachmittags mit Lydia, dem Hausmädchen, etwas unternehmen. Worauf auch immer Lydia Lust hatte. Solange Margarets Mutter wusste, wohin sie gingen, natürlich.
Am ersten Mittwoch sagte Lydia, sie habe an einen Ausflug mit der Eisenbahn gedacht. Vielleicht nach Eastkirk — ein schöner Spaziergang auf der Strandpromenade und durch den Wald. Margarets Mutter sagte, Eastkirk koste Geld und der Sand sei hier zu Hause viel schöner, aber Lydia sagte, Margaret würde den Wald sicher mögen.
Also wurden Teekuchen gebuttert und in Papier eingeschlagen, und Lydia und Margaret nahmen den Zug bis Saltbeach, stiegen dort um in den Bummelzug nach Eastkirk und fuhren dann langsam und schwankend in einem staubigen Waggon weiter, in dem man die Rollos unten festknöpfen konnte und ein steifer Lederriemen, der sich bog wie eine Zunge, als Türgriff diente. Die Sitzbezüge waren schwarz mit roten Vögeln drauf, grob und hart. Über den langen, schmalen Sitzbänken hing rechts und links eines fleckigen Spiegels jeweils ein Bild. Eins zeigte Bexhill, das andere Bournemouth. Verschlafene, behagliche Oberschicht-Orte, ausgesprochen fremd. Der Zug hielt auf dem Weg nach Eastkirk einmal an, und durch das offene Fenster hörte man unter der Klippe schwach und in langen Zügen das Meer atmen, denn die Gleise verliefen direkt am Ufer entlang. Auf dem Bahnsteig standen Möwen, oder sie flogen dicht darüber hinweg, auf derselben Höhe wie die Klippen und die hübschen Geranien des Stationsvorstehers.
Margaret liebte Lydia — oder jedenfalls liebte sie Lydias Anblick, verschlafen und sonnig wie im Film, mit einem riesigen blonden Haarschopf. An diesem ersten Mittwoch trug Lydia ein Kleid aus königsblauem Satin mit roten und gelben Blumen, einen dazu passenden Bolero, hohe Absätze und schimmernde Seidenstrümpfe in der Farbe von reifem Getreide. Sie rauchte eine Zigarette und hielt sie zwischen den leuchtend roten Lippen. Als sie sie herausnahm, hatte die Zigarette ein Muster feiner, roter Linien, die am Ende fächerartig zusammenliefen. Lydias Schenkel unter dem Seidenkleid waren kräftig und schwer, sie breiteten sich weich auf dem schwarz-roten Sitzpolster aus.
Die Sonne brannte durch das Waggonfenster. Es war ein bemerkenswerter Sommer, so heiß wie in Bexhill oder den Ländern der Bibel. Lydia zerrte am Rollo, fixierte es erst an dem einen kleinen Haken, dann am anderen, dann zog sie es vollends hinunter und drückte den Knopf in das kleine Messingloch. Aber durch die anderen Fenster fiel die Sonne ihr immer noch in den Schoß.
Am Bahnhof von Eastkirk war es ruhig. Sie stiegen aus und gingen am Fahrkartenverkäufer vorbei, und der Zug stand so still, als würde er sich nie wieder bewegen. Dann stieß er einen langen, erleichterten Seufzer aus und kam langsam wieder in Gang, Schritt für Schritt, Richtung Cullercoats und Whitley Bay.
Margaret war ein stilles Kind, und Lydia war eine stille Frau. Sie nahmen sich bei der Hand und gingen schweigend zur Promenade. Es waren Sommerferien, junge Männer standen in kleinen Grüppchen herum und aßen Eis. Lydia und Margaret setzten sich auf eine grüne Bank hoch über dem Meer. Boote hüpften auf und ab. An der Pier war etwas los.
»Holla!«, sagte einer der Männer. Lydia beachtete ihn nicht, sondern kaufte Eis.
»Was heißt holla?«, fragte Margaret.
Lydia leckte ihr Eis.
»Holla, holla«, sagte Margaret, baumelte auf der Bank mit den Beinen und bewunderte ihre weißen Söckchen und die geknöpften Schuhe. Andere Kinder rannten in Sandalen und Shorts herum, aber Margaret war adrett, mit einer Haarspange kurz über dem Ohr und einem Baumwollkleid, das im Rücken und vorne gesmokt war. »Man sieht es vor allem von hinten«, sagte ihre Mutter immer. »Ein nettes Kind erkennt man von hinten!« Zwischen Margaret und den Kindern mit schmucklosem Rücken klaffte ein Abgrund.
Sie gingen die Promenade hinunter, Lydia walzte munter voran, ein bisschen wie der Zug. Sie wurde immerzu angesehen, und Margaret sah dabei zu, wie sie angesehen wurde. Sie schaute zu der massigen Lydia auf. »Du bist ein richtiger Hingucker«, hatte ihre Mutter leise gesagt, als Lydia für den Ausflug herausgeputzt die Treppe heruntergekommen war — fort war das kaffeefarbene Kleid des Hausmädchens samt Haube und Schürze in cremefarbenem Musselin, die schwarzen Schuhe und Strümpfe. Margaret war sehr stolz, neben der majestätischen und selbstbewussten Lydia herzugehen.
Als sie am Wald ankamen, wurde Lydia ein bisschen lockerer. Der Weg führte steil in den Wald hinab, wo der Fluss ins Meer mündete, und Lydia kam mit ihren Absätzen ins Stolpern. »Herrjeee!«, rief sie. »Ach du meine Güte!« Margaret hüpfte und tänzelte vor ihr her. Der Wald wurde dunkler und dichter, und die Sonne stand hoch am Himmel und sprenkelte die Erde nur noch hier und da unter den Bäumen. Es waren nur wenig Leute unterwegs, bis sie auf einer Terrasse über einem hübschen Konzertpavillon landeten, in dem uniformierte Männer laut und unbekümmert sehr schöne Musik spielten. Um den Konzertpavillon herum saßen Leute auf Liegestühlen, manche hatten sich zum Schutz vor der Sonne Zeitungen über das Gesicht gelegt, aber die meisten, Männer wie Frauen, trugen Hüte. Die Männer Panamahüte, wie Margarets Schulhut, nur ohne das Gummiband unter dem Kinn, die Frauen, wenn sie alt waren, elegante Strohhüte mit breiten Bändern, und wenn sie jung waren krempenlose Kapotthütchen aus Stoff. Lydia wollte sich ebenfalls hinsetzen, aber Margaret sagte, sie würde gern weitergehen, also sagte Lydia, na gut, und sie gingen unter den Bäumen weiter, bis es still wurde und die Musik nicht mehr zu hören war. Lydia stolperte über eine Wurzel und rief wieder: »Herrjeee!«, und lachte.
»Zieh die doch aus«, sagte Margaret.
»Und mach mir die Strümpfe kaputt?«
»Zieh die doch auch aus.«
Lydia ließ sich schwerfällig auf dem Waldboden nieder und zog sich langsam die hochhackigen Schuhe aus, dann streckte sie sich und schob den Rock hoch, um die Strümpfe von den Strapsen zu lösen; drei an jedem Bein, vorne, seitlich und hinten. Sie rollte sich die Strümpfe vom Bein und wackelte mit den Zehen. Die Strümpfe stopfte sie sich vorne in das himmelblaue Kleid. »Nimm du mal meine Schuhe«, sagte sie, »und hilf mir auf.« Margaret zog, und Lydia stand auf. »Aaaach, Gott, mein Korsett. Ich würd mir so gern das Korsett ausziehen.«
»Mach doch«, sagte Margaret. »Man kann den ganzen Weg runtergucken, und da ist niemand zwischen den Bäumen.«
Aber Lydia war unsicher, und sie gingen zusammen ein gutes Stück weiter, bis sie zu einem gewundenen Nebenweg kamen, der zur Flussmündung hinunterführte. Den nahmen sie — es war jetzt sehr dunkel im Wald, wenn man bedachte, wie hell es obendrüber war —, und sie begegneten niemandem. Sie kamen an ein trockenes Flussbett, über das eine rustikale Brücke führte. Auf ihrer Seite war ein Tor an der Brücke und ein weißes Schild: »Privat«. Auf der anderen Seite der Brücke lag eine weitläufige, runde Rasenfläche, und darüber breitete sich die Krone eines großen Baumes aus. Die Wurzeln dieses Baumes waren wie Finger, dazwischen lagen dreieckige, schwarze Höhlen.
»Du könntest dein Korsett ausziehen und es zwischen den Wurzeln verstecken«, sagte Margaret.
»Hör auf«, lachte Lydia. Sie lehnte sich an das Tor und betrachtete das weiche Gras und den würdevollen Baum, durch dessen Blätterdach die Sonne fiel. »Ist das nicht hübsch?«, fragte sie.
»Komm«, sagte Margaret und schob Lydia voran, sodass das Tor aufging, und dann mussten sie wieder kichern und überquerten die Brücke. Während Lydia ihr Korsett auszog, musste Margaret sich hinter den Baum stellen. »Kannst kommen«, rief Lydia nach einer Minute, und Margaret kam zurück und sah Lydia das riesige, schweinchenrosa Ding aus Stäbchen und Lochstickerei und Spitze zusammenrollen.
»Schon besser«, sagte Lydia und verknotete die Bänder, um das Ding zusammenzuhalten. Margaret nahm das Bündel und betastete es, während Lydia sich mit beiden Händen den blauen Seidenrücken kratzte und dann über beide Hüften nach vorne. »Stopf’s unter den Baum.« Wieder lachte sie und warf den Kopf in den Nacken. »Das ist ja riesig!«, sagte Margaret. Es war auch schwer und warm und sehr feucht, aber das sagte sie nicht. Sie steckte das Ding schnell unter eine Wurzel.
»Herrlich«, sagte Lydia und legte sich hin. »Großartig.«
»Was machen wir jetzt?«
»Keine Ahnung. Nichts. Ich schwitz.«
»Kann ich auf den Baum klettern?«
»Mach dein Kleid nicht schmutzig.«
»Ich ziehe es aus.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Darum.«
»Hast du doch auch!«
»Ich bin mein eigener Chef.« Lydia kannte die Grenzen für Margaret.
»Das ist unfair. Dann stopfe ich es mir einfach in den Schlüpfer.«
»Gut, mach das.«
Lydia fielen die Augen zu. Wie eine große, runde Blume, dachte Margaret und kletterte in den Bergahorn. Ein großer Blumennachtisch. Ein großer Nachtisch auf einem Teller. Ein dicker, klebriger Nachtisch, saftig wie Apfelkuchen. Dick und heiß und matschig wie ein Federbettpudding, dachte sie, als sie so auf die korsettlos ausgebreitet daliegende Lydia hinuntersah. Ich könnte auf sie springen. Patschen und platschen.
Aber in der Baumkrone streckte sie den Kopf hinaus an die frische Luft. Ein leichter Wind ging. Die dünneren Zweige schwankten, die Finger der Blätter waren hier oben feiner und grüner. Die Musik der Band wehte leise aus der Ferne herüber. Die Baumkrone schwankte.
Margaret wollte lachen und weinen. Sie nahm die beiden obersten Verzweigungen in die Hände wie die Zügel eines Pferdes oder wie eine Wünschelrute, und mit den Blättern um den Hals wie ein Kragen sang sie sehr geräuschvoll ein Lied über ein Baby, das fiel, fiel, fiel. Tief und tot, tot und tief, auf den Kopf, Baby tot, bis ihr eigener Kopf brennend heiß war und ein Fuß in dem Knöpfschuh etwas abrutschte und sie in schlotternde Angst verfiel und sich mit den Füßen hinunterzutasten begann, hinunter, bis die Äste sich zu beruhigenden Balken verdickten, dann zu Elefantenbeinen und dann — mit einem Bums, als sie im Gras landete — gar nicht mehr wichtig waren.
»Ich war ganz oben!«, rief sie. »Ich war noch weiter als ganz oben!« Sie spürte ihre heiße, seidige Haarkrone und sah sich nach Lydia um. Aber Lydia war nicht da.
»Lydia?«, rief sie. »Lydia?«
Es herrschte fast vollkommene Stille im Wald. Da war das trockene Flussbett, die rustikale Brücke, das plattgedrückte, sonnengesprenkelte Gras, wo Lydia gelegen hatte. Margaret sah schnell zwischen den Wurzeln nach dem Korsett, das noch da war.
Aber Lydia war nicht da.
»Sie wird im Gebüsch sein«, dachte Margaret. »Lydia!«
Es knisterte und raschelte ein wenig, vielleicht waren es Feldmäuse oder Frösche, aber keine Lydia. Margaret ging auf die Brücke und trat mit ihren vorn abgerundeten Schuhen ein bisschen dagegen. Sie stieg auf die mittlere Sprosse des Brückengeländers und ließ sich drüberhängen. Dann schlüpfte sie unter die Brücke. Dann patschte sie im Matsch herum, der ein Fluss sein sollte, und sah sich dies und das genauer an.
»Lydia«, rief sie dringlicher, nachdem sie die Uferböschung wieder hinaufgeklettert war. »Lydia?«
Ein Stückchen hinter dem grünen, poolartigen Rasenstück unter dem Baum lag eine baumbestandene Böschung, sehr steil und nach oben zur Sonne hin ausgedünnt, und Margaret hatte es jetzt sehr eilig, diese Böschung hinaufzuklettern. »Lydia!«, schrie sie. »Wo bist du, Lydia?« Am oberen Ende der Böschung übermannte sie die Angst, ihre Hände wurden schwer und ihre Knie wacklig. Ihr schossen Tränen in die Augen. »Lydia!«
Sie stürzte zwischen den Bäumen hervor und ins weite, offene Sonnenlicht hinaus. Es herrschte vollkommene Stille, keine Menschenseele war zu sehen, nur die weite, ebene Parklandschaft im Nachmittagsschlaf. Darin standen viele riesige Bäume, dunkelgolden und so unbewegt wie Scherenschnitte. Dahinter in der Ferne ein großes, gelbes Haus. Seine Augen beobachteten sie. Sie starrte zurück.
Dann hörte sie aus der Ferne von unten Lydia rufen.
»Margaret? Wo warst du denn? Ich habe dich aus den Augen verloren.«
Sie drehte sich um und flog geradezu den Abhang hinunter. Lydia stand auf der anderen Seite der Brücke.
»Ich hab dich verloren!«, schrie Margaret. »Du warst weg. Ich hasse dich!«
»Ich war nur mal im Gebüsch«, sagte Lydia. »Zeit, nach Hause zu fahren. Ich habe mir da die Hände gewaschen.«
»Warum hast du das nicht auf dieser Seite gemacht?«
»Keine Lust.«
»Ich hab mich verirrt.«
»Weit wärste ja nicht gekommen«, sagte Lydia.
Nachdem sie sich wieder in ihr Korsett gezwängt hatte, aßen sie die Teekuchen aus der Papiertüte, gingen durch den Wald zurück und kamen wieder bei der Band vorbei. Im Zug fragte Lydia: »Wo warst du denn eigentlich?«
»Nirgends«, sagte Margaret. »Wenn ich mir das Kleid in den Schlüpfer stecke, kann ich dann ins Gepäcknetz?«
Über Lydia schaukelnd wie ein Seemann fragte sie: »Können wir das nächste Woche wieder machen?«
»Meinetwegen«, sagte Lydia. »Wenn du willst.«
2
Mrs Marsh, Margarets Mutter, stillte zu einer Zeit, in der es eigentlich nicht en vogue war, mit Begeisterung. Sie hatte auch keinen Kurzhaarschnitt und nicht auf ihre Taille geachtet. Sie war eine große, geschmeidige, immer noch junge Frau, die viel für Gott übrighatte, für Nächstenliebe und ganz besonders viel für Babys. Stunde um Stunde saß sie breitbeinig in ihrem Schlafzimmer, in einem gut geschnittenen, aber geradezu antiken Rock, das gewellte braune Haar fiel ihr unordentlich ums Gesicht.
Manchmal hatte sie Mehl im Gesicht, denn sie sah selten in den Spiegel und kochte gern. Wenn sie das Baby stillte, schaute sie ihm mit einem tiefsinnigen, sanften Ausdruck unentwegt ins Gesicht. Wenn Margaret ins Zimmer kam, hob sie den Kopf und blickte sie lange und verständnisvoll an.
»Machst du einen Ausflug, Liebes?«
»Nein.«
»Ich dachte, es ist Mittwoch?«
»Ist es auch. Das ist aber erst heute Nachmittag.«
»Was?«
»Der Ausflug.«
Mrs Marsh, die mit den Tageszeiten durcheinandergekommen war, löste sich von dem Baby, setzte sich auf und fuhrwerkte mit einem Tuch herum. Sie legte sich das Baby an die Schulter, wo eine riesige Windel lag und lang an ihr hinunterhing, damit das Baby darauf spucken konnte. Sie massierte ihm den Rücken, der wie der Rücken einer ofenfertigen Ente wirkte. Der lose sitzende Kopf und die verdrehten Augen des Babys kullerten auf ihrer Schulter herum, der runde Mund war leicht geöffnet, feucht und rot. Es schien wie durch einen Schleier Margaret ansehen zu wollen, die hinter ihrer Mutter mit den Dingen auf der Kommode herumspielte. Sie betrachtete es mit einem realistischen Blick. Das Baby ließ unter der Massage in einer langen Explosion Luft aus dem Mund, und blasse Milch rann heraus und lief ihm übers Kinn.
»Wie eklig«, sagte Margaret.
»Gut gemacht, mein Herzchen«, sagte Mrs Marsh. Sie hob das Baby vor sich in die Luft, die Hände in seinen Achselhöhlen, und ließ es da hängen wie Kuchenteig. »Was hast du gesagt, Schatz? Heute ist doch dein großer Tag mit Lydia, oder?«
»Heute Nachmittag«, sagte Margaret und ließ die Flasche mit den Koliktropfen für das Baby fallen, sodass sie auf den cremefarben gesprenkelten Fliesen vor dem Kamin in tausend Stücke zersprang. Glassplitter flogen in sämtliche Richtungen, und das Baby zuckte erst zusammen, als hätte man ihm einen Elektroschock verpasst, und fing dann an zu weinen wie ein Lämmchen. »Mäh, mäh, mäh!«, schrie es, scharlachrot im Gesicht und bald am ganzen Glatzkopf lila, seine Augen guckten in unterschiedliche Richtungen.
Mrs Marsh regte sich nicht auf, obwohl sie ebenso zusammengezuckt war wie ihr Sohn. Margaret sah ihr an, dass sie beschlossen hatte, lieber verständnisvoll zu sein als genervt. »Na, na«, sagte sie. Sie legte sich das Baby auf die windellose Schulter und zog Margaret an die andere. »Macht nichts, Liebes. War ein Versehen.«
Margaret entwand sich ihr — ihre Mutter roch nach Milch und Babypuder — und zog eine Grimasse. »Sieht aus wie ein Schwein«, sagte sie.
Mrs Marsh sah noch verständnisvoller drein.
»Schatz, du weißt doch, wie lieb wir dich haben. Er ist auch dein Baby, genauso wie unseres. Guck mal — halt ihn mal. Du bist so ein großes Mädchen. Er wird dich auch furchtbar liebhaben.«
»Und was soll daran so toll sein?«
»Toll?«
»Daran. Wieso soll ich es toll finden, wenn er mich liebhat? Ich brauche ihn nicht.«
»Er wird dich brauchen!«
»Nein, wird er nicht. Wenn ich nicht da wäre, wüsste er überhaupt nichts von mir.«
»Aber du bist ja da.«
»Ich bin nicht für ihn da. Ich bin auch ohne mich zurechtgekommen. Als ich geboren wurde, war niemand für mich da, und mir ging’s gut damit.«
Mrs Marsh versuchte, diesen empirischen Beleg zu verdauen, und wickelte das Baby eng in ein Tuch, die Arme über der Brust gefaltet, und legte es mit dem Gesicht nach unten zwischen die Organdy-Volants der Wiege.
Es blickte nicht mal hoch. Es sah mehr denn je aus wie eine frisch gefüllte und dressierte Ente vor dem Braten.
»Das kann doch nicht gut sein, so zusammengeschnürt«, sagte Margaret, und Mrs Marsh freute sich über dieses Anzeichen möglicher Sorge. »Doch, das ist es, Liebes. Steht bei Truby King. Sie fühlen sich gern sicher.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich sicher fühlt, wenn man so verschnürt ist.«
»Nicht verschnürt, Schatz. Nur gut eingepackt. Babys kommen von einem sehr warmen Ort«, sagte sie verschämt, aber emanzipiert. »Behütet in einem kleinen Nest im Bauch ihrer Mamas.«
»Kleines Nest würde ich es jetzt nicht nennen«, sagte Margaret. »Es war riesig. Und hat sich überall so ausgebeult. Am Ende konnte man es sogar sehen. Als kurz vor dem einen Sonntag ein paar von den Saints hier waren, musste ich mich beinahe übergeben. Du hättest dich schämen sollen. So riesig.«
»Wofür denn schämen?«, fragte Mrs Marsh betont munter. Sie hatte während der Schwangerschaft in der Bücherei heimlich ein bisschen Freud gelesen, außerdem Truby King. »Wofür denn schämen? Das ist ganz natürlich. So sind wir alle auf die Welt gekommen, Liebes.«
»Leider.«
»Ach, Margaret, das ist doch Quatsch.«
»Ohne Menschen wäre es besser.«
»Ohne Menschen gäbe es keine Liebe, Schatz. Gott hat uns erschaffen, damit Liebe in der Welt ist. Äh, erster Brief des Johannes, vier … äh … zwölf, oder? Nein, erster Johannesbrief, vier, vierzehn, aber …«
»Na und? Die Welt war doch vorher auch in Ordnung. Wenn wir nicht da wären, würden wir auch nichts verpassen. Eis und Feuer und Schnee und Gletscher, und dann Pflanzen. Reicht doch, sollte man meinen. Vielleicht noch Dinosaurier. Wenn ich Gott wäre, hätte ich bei den Dinosauriern Schluss gemacht. Ich wäre mit alldem zufrieden gewesen.«
Mrs Marsh sagte sehr vorsichtig: »Margaret, ich denke, du solltest nicht über Dinosaurier sprechen. Du weißt ja, was Vater davon hält. Ich nehme an, das kommt aus der Schule.«
»Nein. Es ist einfach die Wahrheit. Sie haben Knochen gefunden. Vater versteht ni…«
»Vater weiß natürlich, dass es Dinosaurier gab. Aber du weißt schon, dass wir hier an die Genesis glauben, oder? Das weißt du doch schon lange. Gerade du, Margaret, mit deinem guten Gedächtnis. Die meisten Leute tun das heutzutage nicht mehr, sie glauben an eine sehr altmodische Vorstellung, die schon vor Jahren von Leuten, über die dein Vater alles weiß, widerlegt wurde. Die meisten Menschen glauben an Mythen — du weißt doch, was Mythen sind? —, die von Charles Darwin erfunden wurden, dass wir aus Fischen und Affen und so was entstanden sind. Ist das nicht albern? In diesem Haus glauben wir, dass Gott uns, so wie wir sind, in die Welt gesetzt hat, Adam und Eva im Garten Eden, damit wir all das Schöne miteinander teilen können, das Gott gemacht hat.«
»Zu freundlich«, sagte Margaret. »Aber …«
»Genau!« Mrs Marsh wirkte jetzt hocherfreut, wo sie beim Thema Dinosaurier noch unsicher gewirkt hatte. »Genau. Freundlich.«
»Unnötig«, sagte Margaret. »Gott und die Welt, das hätte doch gereicht. Wie ich, bevor das Baby kam.«
»Margaret, ich weiß, dass dir das nicht so klar ist, aber das ist Blasphemie.«
»Was ist Blasphemie?«
»Aber du hörst doch jede Woche in der Primal Hall, was Blasphemie ist!«
»Ist es das, was Vater immer redet? Ich dachte, was Vater redet, ist …«
»Margaret! Blasphemie ist, den Namen Gottes eitel im Munde zu führen.«
»Eitel. Eitel ist eine Menge.«
»Nein. Es bedeutet leichtfertig. Du nennst den Namen Gottes leichtfertig.«
»Besser als zu schwer.«
»Gott«, sagte Mrs Marsh mit errötenden Wangen und knöpfte ihr Kleid zu, nachdem sie ein massiges Mieder darunter zurechtgerückt und sich dann wieder ausbalanciert hatte, »hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen.« Sie betrachtete das verschnürte Baby, dessen roter Kopf sich, mit dem Gesicht nach unten, auf der Bettunterlage hob und senkte wie eine schiefe Orange, als würde es verzweifelt zu fliehen versuchen. Es gab auf, ließ den Kopf in Erstickungsgefahrposition fallen, und dann gab es eine weitere Explosion, gefolgt von einem langen, flüssigen Knattern weiter unten in der Wiege. Und einem Geruch. »Oje«, sagte Mrs Marsh zufrieden, »jetzt muss ich mit einer frischen Windel wieder von vorn anfangen. Reichst du mir mal den Eimer, Liebes?«
»Sein Ebenbild«, sagte Margaret und beobachtete das fürchterliche Auswickeln. »Wenn Gott aussieht wie wir … was soll das Ganze dann?«
»Du musst«, sagte Mrs Marsh streng, »mit deinem Vater sprechen.«
3
Sie gingen zur Eisdiele, setzten sich dann aber nicht wie am Mittwoch zuvor auf die Bank mit Blick aufs Meer. Sie leckten ihr Eis im Gehen, an den Hollas und den Pfiffen vorbei, bis zum Drehkreuz in den Wald und dann langsam — denn es war noch heißer als in der Woche zuvor — den Waldweg hinunter. Lydia sagte, sie würde es schon irgendwie bis zum Konzertpavillon schaffen, bevor sie sich die Schuhe auszog, und als sie die darüberliegende Terrasse erreicht hatten, setzten sie sich auf den Rasen, aßen ihr Eis auf und blickten hinunter. Um die Rasenfläche vor dem Pavillon waren Blumenbeete in der Form von Herzen und Rauten angelegt, als wären sie von riesigen Plätzchenformen aus dem Rasen ausgestochen worden. Jede dieser Formen war mit einem Muster aus künstlich wirkenden Blumen bepflanzt, erst eine Raute oder ein Herz aus ledrigen Büscheln in der Farbe von Rotkohl, dann eine Reihe gelb-grüner Sukkulenten, dann blaues Männertreu und in der Mitte triumphierende, knallrote Geranien. Zwischen den Beeten und dem Pavillon standen kreisförmig angeordnet grüne und weiße Liegestühle. Im Pavillon spielte die Band, selbstbewusst und laut.
»Komm, wir gehen runter«, sagte Lydia, und sie gingen hin und setzten sich auf zwei Liegestühle, für die sie für einen Penny Tickets kaufen mussten. Lydia lehnte sich zurück und betrachtete die Musiker, die auf sie aufmerksam wurden.
Nach einer Weile sagte sie zu Margaret: »Willste mal was Lustiges sehen?« Sie holte eine Orange aus der Papiertüte, pellte sie und warf die Schalen neben ihre Füße. Sie teilte die Orange in Schnitze, schob sich einen nach dem anderen langsam in den Mund und ließ dabei einen bestimmten Musiker nicht aus den Augen. Nach kurzer Zeit schoss Wasser aus seiner Posaune. Margaret lachte laut los, und Lydia stupste sie an und krümmte sich still in ihrem Stuhl vor Lachen. »Das hamwer in Bishop immer gemacht«, sagte sie, »wie wir jung waren. Bei Umzügen.«
»Gab es viele Umzüge in Bishop?«
»Klar. Guck!« Sie richtete ihre Aufmerksamkeit jetzt auf einen anderen Musiker, einen Tubaspieler, der schon ganz verschwitzt und leuchtend rosarot im Gesicht war. Es sah aus, als würde der Kragen seiner steifen blauen Uniformjacke ihn erwürgen. Er schwitzte sogar aus den Augen, sie traten unter den Lidern hervor wie Broschen. Er wirkte verängstigt. »Warte«, sagte Lydia und lutschte an einem Orangenstück.
Schon kam die Spucke geflogen, und ein sonderbar dunkler Ton brach in die Melodie ein, sodass der Dirigent, der natürlich mit dem Rücken zum Publikum stand, wild in Richtung des Tubaspielers zu fuchteln anfing. Margaret und Lydia brachen, nicht sonderlich unauffällig, vor Lachen zusammen, ihre Stühle kippten um, und ein Angestellter kam und bat sie zu gehen.
»Wir ham zwei Pence bezahlt«, sagte Lydia mit Lachtränen in den Augen. Aus den umliegenden Liegestühlen wurde »psst« gemacht, Zeitungen wurden von Gesichtern genommen, Hüte drehten sich zu ihnen. »Apfelsinen sind ja wohl nicht verboten, oder?« Sie hatte Spaß.
»Aber Müll ist verboten«, sagte der Mann und zeigte auf die Schalen.
Lydia hob sie auf und drückte sie ihm in die Hand. »’tschuldigung«, sagte sie, zog die Schultern hoch und senkte den Blick. Auf ihren Lidern schimmerte Vaseline. Sie lächelte den Mann von unten herauf an und schob sich noch ein Stück Orange in den Mund. »Jetzt gehen Sie bitte«, sagte der Mann völlig verstört. »Mir geht’s hier gut«, sagte Lydia, streckte sich aus und schlug die Füße übereinander. Margaret sagte: »Lass uns gehen, Lydia.«
»Nein. Ich lege hier gerade mal die Füße hoch. Wir haben zwei Pence bezahlt.«
»Lass uns gehen.«
»Na gut«, sagte Lydia, stets bemüht. »Tschüss, mein Hübscher. Hilf mir mal auf.« Der Angestellte guckte streng und sah sich um, als er ihr den Arm reichte. Lydia zwinkerte dem Tubaspieler zu, und es folgten zwei sehr unglückliche Fehler in der Melodie, als sie und Margaret Hand in Hand in den Wald gingen.
An der privaten Brücke hielten sie kurz inne, und Lydia sagte, sie würde jetzt ihr Korsett ausziehen und sich ausruhen. Dann stießen sie dankbar das Tor auf, als kämen sie nach Hause.
»Ich kletter wieder auf den Baum«, sagte Margaret.
»Bring dich nicht um.«
»Verschwinde nicht.«
Margaret kletterte immer höher. Ziemlich weit oben hielt sie inne und versuchte, in eine andere Richtung weiterzuklettern, sodass sie von ganz oben das Haus würde sehen können, aber es bot sich keine Route an. Sie versuchte es mit einer recht dünnen Astgabel, die in eine gute Höhe in Richtung der Uferböschung reichte, dort, wo sie hinaufgeklettert war, als sie nach Lydia gesucht hatte. Aber als sie endlich den Kopf ins Freie stecken konnte, sah sie nur die Bäume am Ufer, die noch ein bisschen höher waren als der große Bergahorn. Es war immer noch etwas im Weg; über die Schulter konnte sie die Baumwipfel sehen, die sich am Fluss entlang bis zum Musikpavillon und zum Meer erstreckten, und den Himmel über sich. Sie rutschte ab, fiel durch ein paar dünnere Zweige und landete glücklicherweise auf einem dickeren Ast. Von unten hörte sie Lydia rufen, und dann eine andere Stimme, die eines Mannes. »Alles in Ordnung! Nichts passiert«, rief sie, setzte sich aber erst mal rittlings auf den Ast, holte tief Luft und betrachtete eine ganze Weile die lila und weiße Schürfwunde an ihrem Arm. Langsam bildeten sich leuchtend rote Blasen, und dann blutete es ordentlich. »Ich blute ein bisschen. Aber geht schon!«, rief sie, weil es unten still blieb. Sie fühlte sich ein bisschen missachtet, weil keine Antwort kam.
Lydia stand auf der Brücke, eine Hüfte ans Geländer gelehnt, sie lächelte, und ihr gegenüber, über das kleine Tor gebeugt, stand ein Mann und lächelte ebenfalls. Er trug einen billigen dunklen Anzug, wirkte aber wie jemand, der nach draußen gehörte. Er hatte ein hungriges, alterndes Drinnen-Gesicht, aber grobe Hände. Er schien hier irgendeine Art von Autorität zu haben, und er lächelte vielsagend, als er sie spielen ließ. Margaret spürte diese Widersprüche und eine Abneigung.
»Lydia!«
Lydia drehte sich nicht um, sondern warf den Kopf in den Nacken und sah den Mann an. »Also, hier können Sie nicht bleiben«, sagte er. »Ich habe Sie letzte Woche schon gesehen.«
»Warum nicht?«, fragte Lydia. Sie betrachtete den Mann genau, von oben bis unten, als wäre er selbst interessanter als seine Antwort.
»Können Sie nicht lesen?« Er ging durch das Tor und klopfte an das Schild, das daran hing. »Privat.« Margaret plumpste geräuschvoll aus dem Baum, aber die beiden nahmen keine Notiz.
»Ich blute!«, rief sie.
»Ach, kommen Sie«, sagte Lydia, betrachtete ihre kirschroten Fingernägel und lehnte sich noch weiter nach hinten. Margaret hoffte, das Geländer würde halten. Lydias massiger Rücken sah ohne das Korsett sehr stark aus. Sie trug wieder das blaue Satinkleid. Ihre Beine wirkten darunter wie lange, dicke Flaschen. Ihre Füße waren breit und die großen Zehen gelblich und quadratisch. Aber dennoch sah sie irgendwie hinreißend aus. »Kommen Sie«, sagte sie zu dem Mann. »Ist so schön hier. Warum nicht?«
»Privatgelände.«
»Lydia!«
Sie beachteten sie immer noch nicht. »Ihre Schwester?«, fragte der Mann, ließ den Blick aber nicht von Lydia.
»Nee. Ich bin das Hausmädchen. Wir machen ’n Ausflug.«
»Lauer Job, hm?«
»Seitdem das Baby da ist. Sind ja Ferien. Dann hat die Mutter mal Pause. Nachmittags ist eh nicht viel zu tun.«
»Dann ist das Ihr freier Nachmittag?«
»Wohl kaum. So blöd bin ich auch nicht.«
»Wann ist denn Ihr freier Nachmittag?«
»Geht Sie nichts an.« Aber sie lachte und stieß sich vom Brückengeländer ab und ging langsam vor ihm her zu Margaret und dem Baum. Sie spielte mit einem Blatt herum.
»Dann ist es eine gute Anstellung?«
»Nicht schlecht.« Sie richtete ihre Aufmerksamkeit schließlich doch noch auf Margaret. »Gehst du ins Wasser?«
»Nein. Ich blute. Ich bin abgerutscht.«
»Sie geben Ihnen gut zu tun, nehm ich an? Köchin und so?«
»Nee, nur und so. Sie kocht selbst.«
»Kocht selbst? Keine Klasse?«
Lydia legte sich unter dem Baum auf die Seite wie eine sanfte Hügelkette. »Komm her, Margaret«, sagte sie. »Zeig mal dein Arm.«
»Dann sind das keine feinen Leute, wo Sie arbeiten?«, fragte er.
»Das ist ja nicht nichts«, sagte Lydia und strich über die Schürfwunde. »Komm her, ich küss es dir weg.« Sie zog Margarets Arm an sich und küsste langsam die Innenseite. Margaret zog den Arm zurück und rieb sich mit der Hand darüber. »Das brauchst du doch nicht zu küssen«, sagte sie. Der Mann zückte eine Schachtel Goldflakes, bot Lydia eine an und nahm sich selbst eine. »Magst du es nicht, wenn sie dich küsst?«, fragte er, ohne den Blick von Lydia zu nehmen. Margaret antwortete nicht, sondern ging den Hang hinter dem Baum hinauf in Richtung der Sonne und des Hauses. »Hey. Komm zurück!«, sagte der Mann. »Wo willst du denn hin?«
»Spazieren gehen.«
»Du kannst da nicht hoch«, sagte der Mann. »Habe ich doch gesagt. Das ist privat.«
»Was ist das denn hier?«, fragte Lydia. »Ein Park oder so?«
»Genau«, sagte er. Er wandte sich wieder zu Margaret, die jetzt ziemlich weit oben stand. »Hast du mich nicht gehört? Komm runter!«
»Komm zurück«, sagte Lydia.
Dann wandten sie sich wieder einander zu — der Mann saß auf einem Baumstamm und rauchte in kurzen, schnellen Zügen, während Lydia träge den Rauch ihrer Zigarette gegen das Sonnenlicht betrachtete, das durch den Bergahorn fiel. »Ist das nicht hübsch?«, sagte sie. »Gucken Sie mal. Wie ein hauchdünner Schal.«
Margaret setzte sich zwischen die Bäume. »Kann ich da hochgehen, Lydia?« Niemand antwortete. Der Mann fragte: »Wie heißen Sie?«
»Lydia«, sagte Lydia und betrachtete den Rauch.
»Ich geh da hoch!«, rief Margaret und bekam immer noch keine Antwort, also ging sie wieder hinauf, und als die beiden schon ein ganzes Stück unter ihr waren, drehte sie sich um und rief noch einmal: »Ich gehe! Ich geh da hoch. Obwohl es privat ist.«
Die beiden Gestalten waren sehr still unter dem Baum und drehten sich nicht um. Als Margaret die Rasenfläche und den Sonnenschein erreichte, hörte sie Lydias langes, träges Lachen.