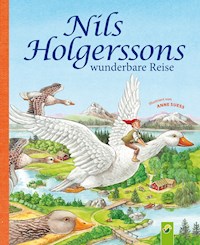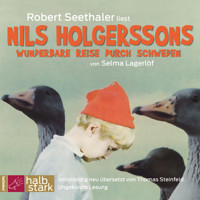Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Selma Lagerlöfs erfolgreiche Trilogie in einem Band. Aufgrund seiner Tapferkeit bekam Bengt Löwensköld vom König einst das Rittergut Hedeby sowie einen kostbaren Ringe geschenkt. Dieser Ring weckt immer wieder aufs Neue die Habgier der Menschen und spielt damit eine schicksalshafte Rolle in der Geschichte der Familie. Noch Generationen später scheinen die Löwenskölds und alle Menschen in ihrer Umgebung unter dem Fluch des Ringes zu leiden. Liebe, Selbstsucht und Intrigen prägen das Schicksal der Familie über mehr als ein Jahrhundert hinweg.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1076
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Die Löwenskölds
Romantrilogie
Der Ring des GeneralsCharlotte LöwensköldAnna, das Mädchen aus Dalarne
Deutsch von Marie Franzosund Pauline Klaiber-Gottschau
Saga
Der Ring des Generals
Erstes Kapitel
Wohl weiß ich, daß es schon in früheren Zeiten viele Leute gegeben hat, die nicht wußten, was Gruseln heißt. Auch habe ich von einer ganzen Menge Leute gehört, denen es Spaß machte, über hauchdünnes Eis zu wandern, und die kein größeres Vergnügen kannten, als durchgängerische Pferde zu lenken. Ja, es hat sogar den oder jenen gegeben, der nicht davor zurückschreckte, mit dem Fahnenjunker Ahlegård Karten zu spielen, obgleich man wohl wußte, welche merkwürdigen Kunststücke er mit den Karten machte, so daß er immer gewinnen mußte. Ich kenne überdies einige unerschrockene Gesellen, die sich nicht davor fürchteten, am Freitag eine Reise anzutreten oder sich an einen Mittagstisch zu setzen, der für dreizehn Personen gedeckt war. Aber ich wüßte doch gern, ob einer von diesen allen den Mut gehabt hätte, sich den schrecklichen Ring an den Finger zu stecken, der dem alten General Löwensköld auf Hedeby gehört hatte.
Es war derselbe alte General, der den Löwenskölds Haus und Hof, Namen und Adel verschafft hatte; und solange noch irgendeins von ihnen auf Hedeby wohnte, hing sein Bildnis in dem großen Salon des oberen Stockwerks am Pfeiler zwischen den Fenstern. Es war ein großes Gemälde, das vom Fußboden bis zur Decke reichte, und beim ersten Blick darauf meinte man, es sei Karl XII. in höchsteigener Person, der da im blauen Rock, große Sämischlederhandschuhe an den Händen, die Beine in den ungeheuren Stulpstiefeln fest auf den schachbrettartigen Boden gestellt, vor einem stand. Wenn man aber näher trat, da sah man allerdings, daß es ein Mann von ganz anderem Schlag war.
Ein großes, grobes Bauerngesicht stand über dem Rockkragen. Der Mann auf dem Gemälde schien dazu geboren zu sein, sein Leben lang hinter dem Pflug herzugehn. Bei all seiner Häßlichkeit sah er aber doch wie ein kluger, zuverlässiger, prächtiger Mensch aus. Wenn er in unserer Zeit das Licht der Welt erblickt hätte, wäre er mindestens Schöffe oder Bürgermeister geworden, ja wer weiß, ob er nicht gar in den Reichstag gewählt worden wäre. Da er aber in den Tagen des großen Heldenkönigs gelebt hatte, so war er als armer Soldat in den Krieg gezogen, als der berühmte General Löwensköld zurückgekehrt und hatte von der Krone zum Lohn für seine Heldentaten das Rittergut Hedeby in dem Kirchspiel Bro bekommen. Immerhin, je länger man das Bild betrachtete, desto mehr versöhnte man sich mit seinem Aussehn. Man meinte dann zu verstehen, daß die Krieger, die unter König Karls Befehl gestanden und ihm eine Furche durch Polen und Rußland gepflügt hatten, so gewesen sein mußten. Nicht nur Abenteurer und Hofkavaliere hatten sich ihm angeschlossen, sondern gerade auch solche einfachen ernsten Männer, wie dieser hier auf dem Gemälde, hatten ihn geliebt und in ihm einen König gesehen, für den es wohl wert war, zu leben und zu sterben.
Wenn man das Konterfei des alten Generals betrachtete, war stets einer von den Löwenskölds bei der Hand, einen darauf aufmerksam zu machen, daß es durchaus kein Zeichen der Eitelkeit von dem General gewesen sei, wenn er den Handschuh von der linken Hand so weit abgestreift hatte, daß der große Siegelring, den er am Zeigefinger trug, auf dem Bilde zu sehen war. Diesen Ring hatte er vom König erhalten – für ihn gab es nur einen König –, und der Ring war mit auf das Gemälde gekommen, um zu zeigen, daß Bengt Löwensköld seinem Herrn treu war. Er hatte ja viele bittre Schmähreden über den Herrscher hören müssen; man hatte sich sogar erfrecht, zu behaupten, der König habe durch Unverstand und Übermut das Reich bis an den Rand des Untergangs gebracht; der General aber hielt jedenfalls unbedingt an ihm fest. Denn König Karl war ein Mann, wie die Welt noch nie einen gesehen hatte. Und wer je in seiner Nähe hatte leben dürfen, dem war vollkommen klargeworden, daß es schönere und höhere Dinge gibt, für die man kämpfen kann, als Ehre und Erfolg in dieser Welt.
Genauso, wie Bengt Löwensköld den Königsring auf dem Bild hatte haben wollen, hatte er auch im Grabe noch bei ihm sein sollen. Aber auch dabei war keine Eitelkeit im Spiel gewesen. Es war nicht seine Absicht, damit zu prahlen, daß er den Ring eines großen Königs am Finger trug, wenn er vor Gott den Vater und die Erzengel hinträte; aber er hoffte vielleicht auf etwas andres: Wenn er da in den Saal einginge, wo Karl XII. mit allen seinen »Haudegen« um sich her versammelt war, würde der Ring ein Erkennungszeichen sein, und er dürfte auch nach seinem Tode in der Nähe des Mannes weilen, dem er sein Leben lang gedient und den er so hoch verehrt hatte.
Als der Sarg des Generals in die gemauerte Grabkammer gestellt wurde, die er sich auf dem Broer Kirchhof hatte herrichten lassen, steckte der Königsring noch an dem Zeigefinger seiner linken Hand. Unter den Anwesenden waren freilich viele, die es bedauerten, daß ein solches Kleinod einem toten Mann ins Grab folgen sollte; denn der Ring des Generals war fast so bekannt und berühmt wie der General selbst. Man erzählte, der Ring umfasse so viel Gold, daß es zum Ankauf eines Hofgutes reichen würde, und der rote Karneol, in den der Namenszug des Königs eingraviert war, sei auch nicht weniger wert. Man rechnete es den Söhnen hoch an, daß sie sich dem Wunsche des Vaters nicht widersetzt, sondern ihn das kostbare Stück hatten behalten lassen.
Wenn nun der Ring des Generals in Wirklichkeit so aussah, wie er auf dem Gemälde dargestellt war, dann war er ein häßliches, plumpes Ding, das heutzutage kaum irgend jemand am Finger tragen möchte; aber es ist sicher nicht daran zu zweifeln, daß er vor zweihundert Jahren ungeheuer hochgeschätzt wurde. Seht, man muß daran denken, wie es damals war: Mit nur ganz wenig Ausnahmen hatten alle Schmucksachen und alle Gefäße aus edlem Metall der Krone abgeliefert werden müssen; man hatte gegen Goertzens Taler und den Staatsbankrott zu kämpfen gehabt, und für sehr viele Menschen war Gold etwas gewesen, von dem sie reden hörten, das sie selbst aber niemals gesehen hatten. Und so kam es, daß die Leute den goldnen Ring nicht vergessen konnten, der zu niemandes Nutz und Frommen unter einen Sargdeckel gelegt worden war. Man hielt es fast für ein Unrecht, daß er dort lag. Der Ring hätte ja in fremden Ländern für teures Geld verkauft werden können und hätte dann vielen, die nichts zu brechen und zu beißen hatten als Häcksel und Baumrinde, ihr tägliches Brot geschafft.
Obgleich nun freilich viele gewünscht haben mochten, das kostbare Kleinod zu besitzen, war doch niemand darunter gewesen, der im Ernst daran gedacht hätte, es sich anzueignen. Der Ring lag in dem zugeschraubten Sarg in einem wieder vermauerten Grabkeller unter schweren Steinplatten, unerreichbar selbst für den kecksten Dieb, und man meinte, so müsse es bleiben bis an das Ende aller Tage.
Zweites Kapitel
Im Monat März des Jahres 1741 war der Generalmajor Bengt Löwensköld im Herrn entschlafen, und einige Monate später starb an der roten Ruhr ein kleines Töchterchen des Rittmeisters Gören Löwensköld, der als ältester Sohn des Generals nun auf Hedeby seinen Sitz hatte. An einem Sonntag gleich nach dem Gottesdienst wurde das Kind begraben, und alle Kirchenbesucher begleiteten den Leichenzug zu dem Löwensköldschen Grabe, wo die zwei gewaltigen Grabplatten schräg hochgestellt waren, und die Wölbung darunter war von einem Maurer aufgerissen worden, damit man den Sarg des kleinen Kindes neben den des Großvaters stellen könnte.
Während die Leute um das Grab versammelt waren und die Grabrede anhörten, konnte es wohl sein, daß der eine oder andere von ihnen mit Bedauern an den Königsring dachte, der hier, in einem Grabe verborgen, zu niemandes Nutz und Frommen lag. Es gab vielleicht auch einen oder den anderen, der seinem Nachbar zuflüsterte, jetzt wäre es vielleicht nicht ganz unmöglich, zu dem Ring zu kommen, da ja das Grab wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Tag wieder zugemauert würde.
Unter den vielen, die an dem Grabe standen, war auch ein Bauer vom Mellomhof in Olsby, namens Bård Bårdsson. Er war durchaus keiner von denen, die sich des Ringes wegen hätten graue Haare wachsen lassen. Im Gegenteil! Wann immer jemand mit ihm von dem Ring gesprochen hatte, war seine Antwort stets gewesen: er habe einen recht schönen Hof und brauche den General nicht zu beneiden, selbst wenn dieser einen Scheffel Gold mit in seinen Sarg genommen hätte.
Als nun Bård Bårdsson da auf dem Kirchhof stand, stieg wie bei so vielen andern der Gedanke in ihm auf, wie merkwürdig es doch sei, daß das Grab geöffnet worden war. Er freute sich aber nicht darüber, sondern wurde ängstlich: »Der Rittmeister muß es wohl schon heute nachmittag wieder instand setzen lassen«, dachte er. »Es gibt viele, die es auf diesen Ring abgesehen haben.«
Dies war zwar etwas, was ihn gar nichts anging; aber woher es nun auch kommen mochte – der Gedanke, es könnte gefährlich sein, wenn das Grab über Nacht offen bliebe, beherrschte ihn immer mehr. Man stand im August, die Nächte waren dunkel, und wenn das Grab nicht schon heute abend geschlossen würde, dann könnte sich ein Dieb hineinschleichen und sich den Schatz aneignen.
Bård Bårdsson wurde schließlich von so großer Angst erfaßt, daß er sich schon überlegte, ob er nicht zu dem Rittmeister hingehen und ihn warnen sollte; aber er wußte ja, daß ihn die Leute für einfältig hielten, und so wollte er sich nicht zum Gespött machen. »Du hast freilich in dieser Sache ganz recht«, dachte er, »wenn du dich aber allzu geschäftig darin zeigst, wirst du nur ausgelacht. Der Rittmeister ist ein sehr kluger Mann und hat sicherlich schon dafür gesorgt, daß das Loch wieder zugemauert wird.«
Er war ganz in diese Gedanken versunken und merkte deshalb gar nicht, daß das Begräbnis zu Ende war, sondern blieb an dem Grab stehen und wäre wohl noch länger stehengeblieben, wenn nicht seine Frau herbeigekommen wäre und ihn am Ärmel gezupft hätte.
»Was hast du denn?« fragte sie. »Du starrst ja immerzu auf einen einzigen Fleck wie die Katze vor dem Mauseloch.«
Der Bauer zuckte zusammen, schlug die Augen auf, und siehe, er und seine Frau ganz allein waren noch auf dem Kirchhof. »Ach, es ist nichts«, antwortete er. »Es ging mir nur ein Gedanke im Kopf herum, und ich fragte mich ...«
Er hätte seiner Frau gern gesagt, was ihm durch den Kopf ging, aber er wußte ja, wie viel klüger sie war als er. Sie hätte seine Grübeleien für höchst überflüssig erklärt und gesagt: ob das Grab zugemacht oder offen bleiben würde, sei einzig und allein Sache des Rittmeisters Löwensköld und gehe sonst niemand etwas an.
Sie machten sich nun auf den Heimweg, und als Bård Bårdsson dem Kirchhof den Rücken gekehrt hatte, hätte er ja auch den Gedanken an das Grab los sein müssen; aber es war nicht so. Seine Frau redete von dem Begräbnis: von dem Sarg und den Trägern, von dem Trauergeleit und von der Grabrede, und er fügte ab und zu ein anderes Wort ein, um sie nicht merken zu lassen, wie wenig er davon wußte und gehört hatte; doch klang ihm gar bald die Stimme seiner Frau nur noch wie aus weiter Ferne. Sein Gehirn arbeitete an seinen Gedanken von vorher unablässig weiter. »Siehst du, heut ist es Sonntag«, dachte er, »und vielleicht will der Maurer an einem Ruhetag nicht zumachen. Aber dann könnte der Rittmeister dem Totengräber ja einen Taler geben und ihn die Nacht über an dem Grabe wachen lassen. Ach, wenn er doch nur auf diesen Gedanken käme!«
Auf einmal fing er an, laut vor sich hinzureden: »Ich hätte jedenfalls zum Rittmeister gehen sollen. Es hätte mir einerlei sein sollen, ob die Leute über mich lachten.«
Er hatte ganz vergessen, daß seine Frau neben ihm ging; aber er kam wieder zu sich, als sie plötzlich stehenblieb und ihn anstarrte.
»Es ist nichts«, sagte er, »mir geht nur der Gedanke von vorhin immer noch im Kopf herum.«
Darauf gingen sie zusammen weiter, und bald erreichten sie ihre eigene Wohnung.
Hier hoffte er, die unruhigen Gedanken loszuwerden, und das wäre wohl auch so gewesen, wenn er sich an irgendeine Arbeit hätte machen können; aber nun war es ja Sonntag. Als die Leute auf dem Mellomhof zu Mittag gegessen hatten, ging jeder seine eignen Wege. Bård Bårdsson blieb allein in der Stube sitzen, und sofort überfielen ihn die Grübeleien aufs neue. Nach einer Weile stand er von der Bank auf, ging hinaus und machte das Pferd bereit, in der Absicht, nach Hedeby zu reiten und mit dem Rittmeister zu reden. »Sonst wird der Ring doch noch heute nacht gestohlen«, dachte er.
Er kam aber doch nicht dazu, seinen Vorsatz auszuführen; dazu war er zu schüchtern. Dafür machte er sich nach dem Nachbarhof auf den Weg, um mit dem Bauer dort von seiner Unruhe zu reden. Er traf ihn nicht allein an, und wieder war er zu schüchtern zu einer Aussprache, und so kehrte er unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurück.
Sobald die Sonne untergegangen war, legte er sich zu Bett und nahm sich vor, bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Aber der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Die Unruhe plagte ihn von neuem. Er drehte und wälzte sich im Bett hin und her.
Dadurch konnte seine Frau natürlich auch nicht schlafen, und nach einer guten Weile wollte sie wissen, warum er denn so unruhig sei.
»Es ist nichts«, antwortete er in seiner gewohnten Weise. »Es geht mir eben immer etwas im Kopf herum ...«
»Ja, das hast du heute schon mehrere Male gesagt«, entgegnete seine Frau; »aber ich meine, du solltest mir nun doch sagen, was es ist, das dich so beunruhigt. Du hast doch wohl nicht so gefährliche Dinge im Kopf, daß du sie mir nicht sagen könntest.«
Als Bård seine Frau so sprechen hörte, bildete er sich ein, er würde vielleicht schlafen können, wenn er ihrer Aufforderung nachkäme.
»Ach, ich überlege mir nur, ob das Grab des Generals wieder zugemauert worden ist«, sagte er, »oder ob es die ganze Nacht offensteht.«
Seine Frau begann zu lachen und erwiderte: »Gerade daran habe ich auch gedacht, und ich glaube, jedem der Leute, die mit in der Kirche waren, wird es wohl ebenso ergangen sein. Aber von so etwas wirst du dich doch nicht um den Schlaf bringen lassen?«
Bård war froh, daß seine Frau die Sache so leicht nahm. Er fühlte sich nun ruhiger und glaubte, er werde jetzt schlafen können.
Aber kaum hatte er sich wieder zurechtgelegt, als die Unruhe ihn von neuem überfiel. Von allen Seiten, von allen Häusern her sah er Schatten herangeschlichen kommen, die alle von derselben Absicht erfüllt waren: alle lenkten sie ihre Schritte nach dem Kirchhof mit dem offenen Grab.
Bård versuchte stillzuliegen, damit seine Frau schlafen könne; aber der Kopf schmerzte ihn, und der Schweiß brach ihm aus allen Poren. Er konnte es nicht lassen, sich unaufhörlich hin und her zu drehen.
Schließlich verlor die Frau die Geduld und sagte halb im Scherz: »Lieber Mann, ich glaube wirklich, es wäre klüger, du gingest auf den Kirchhof und sähest nach, wie es sich mit dem Grabe verhält, statt daß du dich hier im Bett von einer Seite auf die andere wirfst und keinen Schlaf finden kannst.«
Sie hatte kaum ausgesprochen, als der Mann auch schon aus dem Bett sprang und sich anzuziehen begann. Jawohl, seine Frau hatte ganz recht. Von Olsby bis zur Kirche von Bro brauchte man nur eine halbe Stunde. In einer Stunde konnte er wieder zurück sein, und dann würde er gewiß die ganze Nacht schlafen können. Doch kaum war er zur Tür hinaus, als die Frau sich sagte, es müßte für ihren Mann doch recht unheimlich sein, wenn er mutterseelenallein auf den Kirchhof ginge, und so sprang auch sie rasch heraus und zog ihre Kleider an.
Sie holte den Mann auf dem Hügel vor Olsby ein. Bård fing zu lachen an, als er sie kommen hörte.
»Kommst du mir nach, um zu sehen, ob ich nicht am Ende den Ring des Generals stehle?« sagte er.
»Ach, du meine Güte!« rief seine Frau. »An so etwas denkst du nicht, das weiß ich wohl. Ich habe mich nur aufgemacht, dir beizustehen, falls dir Kirchhofsgespenster zu schaffen machen sollten.«
Mit rüstigen Schritten wanderten sie dahin. Die Nacht war indessen hereingebrochen, und alles war bis auf einen schmalen Lichtstreifen am westlichen Himmel in tiefes Dunkel gehüllt; doch kannten die beiden den Weg ja genau. Sie unterhielten sich miteinander und waren guter Dinge; denn sie gingen ja nur auf den Kirchhof, um zu sehen, ob das Grab offen stände, damit Bård nicht mehr die ganze Nacht darüber nachgrübeln müßte.
»Mir kommt es ganz unglaublich vor, daß die drüben auf Hedeby den Ring nicht wieder eingemauert haben sollten – so tollkühn werden sie sicher nicht sein«, sagte Bård.
»Darüber werden wir ja nun bald Klarheit haben«, versetzte seine Frau. »Und wenn mich nicht alles täuscht, so ist das, was wir jetzt neben uns haben, die Kirchhofmauer.«
Der Mann blieb stehen. Er wunderte sich, wie fröhlich die Stimme seiner Frau klang. Es konnte doch wohl nicht möglich sein, daß sie bei dieser Wanderung eine andere Absicht haben sollte als er.
»Ehe wir in den Kirchhof hineingehen«, sagte Bård, »sollten wir uns darüber einigen, was wir tun wollen, falls wir das Grab offen finden.«
»Ob es nun zugemacht oder offen ist – ich wüßte nicht, was wir anders zu tun hätten, als wieder heimzugehen und uns ins Bett zu legen.«
»Ja, natürlich! Da hast du ganz recht«, erwiderte Bård und setzte sich wieder in Gang.
»Das Kirchhoftor wird wohl um diese Zeit nicht offenstehen, das kann man nicht erwarten«, sagte Bård gleich darauf.
»Das ist es sicher nicht«, erwiderte die Frau. »Wir müssen über die Mauer klettern, wenn wir den General besuchen und sehen wollen, wie es ihm geht.«
Der Mann wunderte sich wieder. Er hörte ein leichtes Gerassel von niederfallenden Steinchen, und gleich darauf sah er, wie die Gestalt seiner Frau vor dem hellen Streifen im Westen sichtbar wurde. Sie stand schon oben auf der Mauer, was übrigens kein Kunststück war, denn die Mauer war nur ein paar Fuß hoch; aber es war eben doch merkwürdig, wie eifrig sie sich zeigte, und daß sie nun sogar vor ihm die Mauer erstiegen hatte.
»Sieh hier! Nimm meine Hand, dann werde ich dir heraufhelfen«, sagte sie.
Gleich darauf hatten sie die Mauer hinter sich und gingen nun still und vorsichtig zwischen den kleinen Grabhügeln weiter.
Einmal strauchelte Bård über so ein Hügelchen und wäre fast gestürzt. Es war ihm beinah, als hätte ihm jemand ein Bein gestellt. Er erschrak heftig und zitterte an allen Gliedern, und dann sagte er ganz laut, damit alle Toten hörten, wie rechtschaffen er war: »Hier möchte ich nicht gehen, wenn ich in unrechter Absicht gekommen wäre.«
»Nein, wahrhaftig nicht«, erwiderte seine Frau. »Da hast du sehr recht. Aber weißt du, dort drüben ist schon das Grab.«
Ganz richtig, er konnte die schräg gestellten Grabplatten vom dunklen Nachthimmel undeutlich unterscheiden.
Gleich darauf waren sie am Grab selbst, und siehe da, es war offen. Das Loch in der Wölbung war noch nicht wieder zugemauert.
»Dies kommt mir sehr nachlässig vor«, sagte Bård. »Es ist ja fast wie eigens dazu eingerichtet, alle, die wissen, welch ein Schatz da drunten verborgen liegt, in die größte Versuchung zu führen.«
»Sie verlassen sich wohl darauf, daß sich niemand getraut, einem Toten etwas zuleide zu tun«, sagte die Frau.
»Es ist ja auch kein Spaß, sich in so eine Grabkammer hinunterzuwagen«, versetzte der Mann. »Hinunterzuspringen wäre zwar nicht schwer, aber dann säße man wohl da unten wie der Fuchs in der Falle.«
»Ich habe heute vormittag gesehen, daß sie eine kleine Leiter in das Grab gestellt hatten«, sagte die Frau. »Aber die müssen sie doch wenigstens weggenommen haben.«
»Da will ich doch gleich nachsehen«, sagte Bård und tastete sich zu dem offenen Grab hin. »Nein, denk dir nur!« rief er. »Das übersteigt doch alle Grenzen. Die Leiter steht noch da!«
»Das ist wirklich sehr fahrlässig«, sagte die Frau. »Aber weißt du, ich glaube, es ist nicht von großer Bedeutung, ob auch die Leiter stehengeblieben ist, denn der da drunten in der Tiefe kann das, was ihm gehört, schon verteidigen.«
»Wenn ich das nur gewiß wüßte«, sagte der Mann. »Vielleicht sollte ich doch wenigstens die Leiter wegstellen.«
»Ich glaube, wir sollten hier am Grab lieber gar nichts verändern«, meinte die Frau. »Es ist am besten, wenn der Totengräber morgen das Grab genauso vorfindet, wie er es verlassen hat.«
Sie standen eine Weile still vor dem Grab und starrten unentschlossen und ratlos in das schwarze Loch hinunter. Eigentlich hätten sie jetzt heimgehen sollen; aber irgend etwas Geheimes, etwas, was keiner von ihnen auszusprechen wagte, hielt sie zurück.
»Ja, natürlich könnte ich die Leiter stehen lassen«, sagte Bård schließlich, »wenn ich nur ganz sicher wüßte, daß der General die Macht hat, die Diebe festzuhalten.«
»Du kannst ja ins Grab hinuntersteigen, dann wirst du schon sehen, wieviel Macht er hat«, erwiderte seine Frau.
Es war, als hätte Bård nur auf diese Worte seiner Frau gewartet. Im nächsten Augenblick war er bei der Leiter und drunten in dem Grabgewölbe.
Kaum aber stand er auf dem steinernen Boden der Grabkammer, als er auch schon ein Knacken der Leiter hörte und merkte, daß seine Frau ihm nachkam.
»So, du kommst mir auch hierher nach«, sagte er.
»Ich habe es nicht gewagt, dich mit dem Toten hier unten allein zu lassen.«
»Ach, ich glaub’ gar nicht, daß er so gefährlich ist«, erwiderte er. »Ich spüre keine kalte Hand, die mir das Leben auspressen will.«
»Siehst du, er will uns wohl nichts zuleide tun«, sagte seine Frau. »Er weiß, wir denken nicht daran, den Ring zu stehlen; etwas andres wäre es freilich, wenn wir nur zum Scherz versuchen würden, den Sargdeckel abzuschrauben.«
Sofort tappte der Mann zum Sarg des Generals hin und tastete den Rand des Deckels ab. Er fand eine Schraube, die oben im Kopf ein kleines Kreuz hatte.
»Alles ist hier förmlich für einen Dieb wie zurechtgelegt«, sagte er, indem er begann, die Sargschrauben vorsichtig aufzudrehen.
»Spürst du nichts?« fragte seine Frau. »Merkst du nicht, ob sich unter dem Sargdeckel etwas bewegt?«
»Hier ist es still wie in einem Grab«, antwortete der Mann.
»Er glaubt wohl nicht, daß wir im Sinn haben, ihm das zu nehmen, was ihm sein teuerstes Gut ist«, sagte die Frau. »Etwas anderes wäre es, wenn wir den Sargdeckel abheben würden.«
»Ja, aber dabei mußt du mir helfen«, sagte der Mann. Sie hoben den Deckel in die Höhe, und jetzt war es ihnen nicht mehr möglich, ihrer Sehnsucht nach dem Schatz Einhalt zu gebieten. Sie lösten den Ring von der welken Hand, legten den Deckel wieder zurück, und ohne ein weiteres Wort schlichen sie aus dem Grab hinaus. Als sie dann über den Kirchhof zurückgingen, nahmen sie sich bei der Hand, und erst als sie über die niedere Steinmauer geklettert waren und auf dem Weg standen, wagten sie wieder zu sprechen.
»Jetzt fange ich an zu glauben«, sagte die Frau, »daß er es so haben wollte. Er hat wohl begriffen, daß es unrecht von einem Toten ist, ein solches Kleinod für sich zu behalten, und deshalb hat er es uns gutwillig gegeben.«
Der Mann brach in lautes Gelächter aus. »Ja, du bist gut«, sagte er. »Nein, das kannst du mir nicht weismachen, daß er es uns gutwillig gelassen habe. Er hatte eben nicht die Macht, uns daran zu hindern.«
»Weißt du«, sagte seine Frau, »heute nacht bist du wirklich sehr tapfer gewesen. Es gibt gewiß nicht viele, die sich in das Grab zum General hinuntergewagt hätten.«
»Ich habe nicht das Gefühl, daß ich etwas Unrechtes getan hätte«, sagte der Mann. »Von einem Lebenden habe ich nie auch nur einen Taler genommen; aber was könnte es schaden, einem Toten das zu nehmen, was er nicht mehr braucht?«
Während sie so dahingingen, fühlten sie sich stolz und wohlgemut. Sie wunderten sich darüber, weil offenbar außer ihnen niemand auf diesen Gedanken gekommen war, und Bård sagte, er wolle, sobald sich nur eine Gelegenheit dazu biete, nach Norwegen fahren und den Ring dort verkaufen. Er meinte, er werde so viel Geld dafür bekommen, daß sie sich niemals mehr des Geldes wegen Sorgen zu machen brauchten.
»Aber«, sagte die Frau und blieb plötzlich stehen. »Was sehe ich denn? Bricht denn der Tag schon an? Es sieht dort im Osten so hell aus.«
»Nein, das kann noch nicht die Sonne sein«, entgegnete Bård. »Es muß irgendwo brennen, und es sieht aus, als sei es in der Olsbyer Gegend. Wenn es nicht ...«
Ein lauter Schreckensruf seiner Frau unterbrach ihn. »Bei uns brennt es!« schrie sie. »Der Mellomhof brennt! Der General hat ihn angezündet!«
Am Montagmorgen kam der Totengräber in größter Eile nach Hedeby, das ja ganz in der Nähe der Kirche liegt, um zu melden, daß sowohl er als auch der Maurer, der das Grab wieder zumauern wollte, der Ansicht seien, daß der Deckel auf dem Sarg des Generals schief liege und die Schilder und Sterne, die ihn schmückten, verschoben seien.
Augenblicklich wurde eine Untersuchung vorgenommen. Jawohl, man sah gleich, in der Grabkammer herrschte allerlei Unordnung. Die Schrauben des Sarges waren gelockert, und als man den Deckel aufhob, sah man auf den ersten Blick, was geschehen war. Der Königsring war nicht mehr an seinem Platz auf dem linken Zeigefinger des Generals.
Drittes Kapitel
Ich denke an Karl XII. und suche mir klarzumachen, wie man ihn liebte und fürchtete.
Denn ich weiß, einmal in den letzten Jahren seines Lebens kam er mitten unterm Gottesdienst in die Kirche zu Karlstadt.
Er war allein und unerwartet in die Stadt geritten, und da er wußte, daß eben Gottesdienst war, ließ er das Pferd vor der Kirchentür stehen und ging wie jeder andere den breiten Weg durch die Vorhalle in die Kirche hinein.
Sobald er eingetreten war, sah er jedoch den Prediger schon auf der Kanzel, und um ihn nicht zu stören, blieb er ruhig stehen. Er suchte sich nicht einmal einen Platz in einer Bank, sondern lehnte sich mit dem Rücken an den Türpfosten und hörte zu.
Obgleich er aber so unbemerkt hereingekommen war und sich unter dem Dunkel der Empore ganz ruhig verhielt, erkannte ihn doch jemand, der in der hintersten Bank saß. Es war vielleicht ein alter Soldat, der in den Feldzügen Arm und Bein verloren hatte und von Poltawa heimgeschickt worden war; der sagte sich nun, dieser Mann mit dem hinaufgekämmten Haar und der Hakennase müsse der König sein. Und in dem Augenblick, als er ihn erkannte, stand er von seinem Sitz auf. Die Nachbarn in der Bank werden sich wohl gewundert haben, warum er aufgestanden war, und da flüsterte er ihnen zu, der König sei in der Kirche. Und siehe, unwillkürlich standen nun alle in der Bank auch auf, wie es so Sitte war, wenn Gottes eigne Worte vom Altar oder von der Kanzel verlesen wurden.
Danach verbreitete sich die Neuigkeit von Bank zu Bank, und alle Menschen, ob jung oder alt, reich oder arm, der Schwache wie der Gesunde, alle miteinander erhoben sich.
Dies geschah, wie gesagt, in einem der letzten Lebensjahre des Königs Karl, als die Sorgen und Mißerfolge schon angefangen hatten und es vielleicht in der ganzen Kirche nicht einen Menschen gab, der nicht durch des Königs Schuld lieber Anverwandter beraubt worden war und sein Vermögen eingebüßt hatte. Und wenn einer zufällig für sich selbst nichts zu beklagen hatte, so brauchte er ja nur daran zu denken, wie verarmt das ganze Land war, wie viele eroberte Landesteile verlorengegangen waren und wie das ganze Reich von Feinden umzingelt war.
Aber doch, aber doch! Man brauchte nur jemand flüstern zu hören, daß der Mann, den man wieder und wieder verflucht hatte, hier drinnen im Gotteshaus stand, und schon erhob man sich von seinem Sitz.
Und man blieb auch stehen. Niemand dachte daran, sich wieder zu setzen. Das konnte man nicht. Der König stand dort an der Kirchentür, und solange er stand, mußten die anderen auch stehen. Wenn sich jemand gesetzt hätte, wäre das ja Mißachtung gegen den König gewesen.
Die Predigt würde vielleicht lange dauern; aber das müßte man eben ertragen. Man wollte den, der dort unten an der Kirchentür stand, nicht im Stich lassen. Er war ja eigentlich ein Soldatenkönig, und er war es gewöhnt, daß seine Soldaten gern für ihn in den Tod gingen. In der Kirche hier war er aber von einfachen Bürgern und Handwerkern umgeben, von gewöhnlichen schwedischen Männern und Frauen, die nie auf ein »Stillgestanden!« gehört hatten. Und doch brauchte sich der König nur unter ihnen zu zeigen, und sie waren sofort in seiner Gewalt. Sie wären mit ihm gegangen, wohin er nur immer wollte, sie hätten ihm gegeben, was er sich nur wünschte, sie glaubten an ihn, sie beteten ihn an. In der ganzen Kirche dankten alle Gott für den Wundermann, der Schwedens König war. Wie gesagt, ich versuchte mich da hineinzudenken, um zu verstehen, wie die Liebe zu König Karl die Seele eines Menschen ganz ausfüllen konnte, wie sie sich in einem strengen alten Herzen so festsetzen konnte, daß alle Menschen erwarteten, die Liebe werde auch noch nach dem Tode fortbestehen. –
Wahrlich, nachdem es entdeckt worden war, daß jemand den Ring des Generals gestohlen hatte, verwunderte man sich im Kirchspiel Bro am meisten darüber, daß jemand den Mut zu dieser Tat hatte aufbringen können. Man glaubte, liebende Frauen, die mit dem Verlobungsring am Finger begraben worden waren, hätten die Diebe ohne Gefahr plündern können. Oder wenn eine Mutter mit einer Locke von dem Haar ihres Kindes zwischen ihren Händen im Todesschlummer gelegen hätte, dann hätte man sie ihr ohne Furcht entreißen können, oder wenn ein Pfarrer mit der Bibel als Kopfkissen in den Sarg gebettet worden wäre, dann hätte man sie wohl ohne Folgen für den Frevler rauben können. Aber den Ring König Karls XII. von dem Finger des toten Generals auf Hedeby zu rauben, das war ein Unterfangen – wie das ein von einem Weibe Geborener hatte wagen können, das konnte man durchaus nicht begreifen.
Natürlich wurden Nachforschungen angestellt; aber sie führten nicht zur Entdeckung der Schuldigen. Der Dieb war im Dunkel der Nacht gekommen und gegangen, ohne eine Spur zu hinterlassen, die einen Fingerzeig hätte geben können.
Und hierüber wunderte man sich wiederum. Man hatte ja von Verstorbenen gehört, die Nacht für Nacht umgegangen waren, den Täter eines viel geringeren Verbrechens anzugeben.
Als man aber schließlich hörte, der General überlasse den Ring keineswegs seinem Schicksal, sondern er kämpfe um seine Wiedergewinnung mit derselben grimmigen Unbarmherzigkeit, die er an den Tag gelegt hätte, wenn ihm der Ring zu seinen Lebzeiten gestohlen worden wäre, da zeigte sich deswegen kein Mensch überrascht oder bestürzt. Niemand hegte irgendeinen Zweifel daran, denn das war es ja gerade, was man erwartet hatte.
Viertes Kapitel
Als der Ring des Generals schon mehrere Jahre verschwunden war, wurde der Propst von Bro eines Tages zu einem armen Bauern, namens Bård Bårdsson, auf die Olsbyalm gerufen, der im Sterben lag und vor seinem Tode noch mit dem Herrn Propst selber sprechen wollte. Der Propst war ein älterer Mann, und als er hörte, es handle sich um den Besuch bei einem Kranken, der meilenweit weg in einem pfadlosen Wald wohnte, schlug er vor, an seiner Stelle den Hilfsgeistlichen zu schicken; aber die Tochter des Sterbenden, die mit dem Ansuchen gekommen war, sagte sehr bestimmt, es müsse der Herr Propst selbst sein oder gar keiner. Der Vater ließe sagen, er habe etwas mitzuteilen, das nur der Herr Propst erfahren dürfe.
Als der Propst dies hörte, begann er in seinen Erinnerungen nachzuforschen. Bård Bårdsson war stets ein rechtschaffener Mann gewesen, zwar etwas einfältig, aber deshalb brauchte er sich doch auf seinem Sterbebett nicht zu ängstigen. Ja, nach Menschenweise gesehen, könnte der Propst sagen, er sei einer von denen, die eine Forderung an Gott zu stellen hätten. Während der letzten sieben Jahre war er von allen erdenklichen Leiden und Unglücksfällen heimgesucht worden. Sein Hof war ihm abgebrannt, das Vieh an Krankheiten eingegangen oder von wilden Tieren zerrissen worden, der Frost hatte seine Felder verheert, und er war zuletzt so arm wie Hiob geworden.
Schließlich war seine Frau über all das Unglück so verzweifelt gewesen, daß sie ins Wasser ging, und Bård selbst war auf eine Alm gezogen, die jetzt noch sein einziger Besitz war. Seit damals hatte weder er selbst sich in der Kirche blicken lassen noch seine Kinder. Im Pfarrhaus hatte man oft über das alles geredet und sich gefragt, ob die Leute wohl noch im Kirchspiel wohnten.
»Wenn ich deinen Vater recht kenne«, sagte der Propst, »hat er kein so schweres Verbrechen begangen, daß er es nicht dem Hilfsgeistlichen anvertrauen könnte.« Und dabei sah er Bård Bårdssons Tochter mit wohlwollendem Lächeln an.
Sie war ein vierzehnjähriges Mädel, aber groß und stark für ihr Alter. Ihr Gesicht war breit und hatte grobe Züge. Sie sah ein wenig einfältig aus wie der Vater auch, aber kindliche Unschuld und Aufrichtigkeit erhellten das Gesicht.
»Der hochwürdige Herr Propst hat doch wohl nicht Angst vor dem Starken Bengt und getraut sich deshalb nicht, zu uns zu kommen?« fragte sie.
»Was sagst du da, Kind?« entgegnete der Propst. »Wer ist denn dieser Starke Bengt, von dem du sprichst?«
»Ach, er ist es ja, der allein schuld daran ist, daß uns alles schiefgeht«, antwortete das Mädchen.
»Ach so«, versetzte der Propst, »ach so, es gibt also einen, der der Starke Bengt heißt?«
»Weiß denn der Herr Propst nicht, daß er den Mellomhof angezündet hat?«
»Nein, das hab ich noch nie gehört«, antwortete der Propst.
Zugleich aber stand er von seinem Stuhl auf und legte das Kirchenbuch und einen kleinen hölzernen Abendmahlskelch bereit, den er bei seinen Krankenbesuchen im Kirchspiel mitzunehmen pflegte.
»Er ist es auch gewesen, der meine Mutter ins Wasser gejagt hat.«
»Das war allerdings das Schlimmste von allem«, sagte der Propst. »Und lebt dieser Starke Bengt noch? Hast du ihn gesehen?«
»Nein, ich habe ihn nicht gesehen«, antwortete das Kind, »aber gewiß lebt er. Seinetwegen haben wir in den Wald und in die Einöde hinaufziehen müssen. Dort haben wir seither Ruhe vor ihm gehabt, bis zur vergangenen Woche; da hat Vater sich in den Fuß gehackt.«
»Und du meinst also, auch daran wäre der Starke Bengt schuld?« fragte der Propst mit der ruhigsten Stimme, während er zugleich die Tür öffnete und seinem Knecht zurief, er solle das Pferd satteln.
»Vater sagte, der Starke Bengt müsse die Axt verhext haben, sonst hätte er sich sicher nicht in den Fuß gehackt. Es war auch gar keine gefährliche Wunde; aber heute sagte der Vater, jetzt sei der kalte Brand in den Fuß gekommen. Er sagte, nun müsse er sterben, denn der Starke Bengt habe ihm jetzt den Garaus gemacht, und deshalb schickte er mich hierher in die Propstei, um den Herrn Propst zu bitten, er möchte selbst kommen, sobald es ihm nur möglich wäre.«
»Und ich werde auch kommen«, sagte der Propst. Er hatte, während er mit dem Mädchen sprach, den Reitermantel angezogen und den Hut aufgesetzt. »Ich kann aber durchaus nicht verstehen, warum dieser Starke Bengt deinem Vater so viel Böses antun sollte. Bård muß ihm wohl einmal etwas zuleid getan haben.«
»Ja, das leugnet Vater auch gar nicht«, erwiderte das Kind. »Aber er hat weder mir noch meinem Bruder je gesagt, worum es sich eigentlich handelt. Und ich glaube, das ist es, worüber er jetzt mit dem ehrwürdigen Herrn Propst reden will.«
»Ja, wenn es so ist«, sagte der Propst, »dann können wir nicht rasch genug zu ihm kommen.« Er hatte jetzt die Reithandschuhe angezogen und verließ mit dem Mädchen das Zimmer, um sich aufs Pferd zu setzen.
Während des ganzen Rittes zu der Alm hinauf sprach der Propst kaum ein Wort. Er dachte nur immerfort über das Merkwürdige nach, das ihm dieses Kind erzählt hatte. Er selbst war in seinem Leben nur mit einem Manne zusammengetroffen, den die Leute den Starken Bengt nannten. Aber es konnte ja sein, daß das Mädchen gar nicht von ihm, sondern von einem ganz andern Menschen gesprochen hatte.
Als er die Alm erreicht hatte, kam ihm ein junger Bursche entgegen. Es war Ingilbert, Bård Bårdssons Sohn. Er war ein paar Jahre älter als seine Schwester, hoch gewachsen wie sie und ihr auch in den Gesichtszügen ähnlich; aber er hatte tieferliegende Augen und sah nicht so freimütig und gutmütig aus wie sie.
»Das war eine weite Reise für den Herrn Propst«, sagte er, während er diesem vom Pferd half.
»O ja«, entgegnete der alte Mann, »aber es ist rascher gegangen, als ich gedacht hatte.«
»Eigentlich hätte ich den Herrn Propst holen sollen«, sagte Ingilbert; »ich bin aber noch spät am Abend beim Fischen draußen gewesen. Erst als ich vor kurzem heimkam, erfuhr ich, daß in Vaters Fuß der Brand ausgebrochen ist, und daß er nach dem Herrn Propst geschickt hat.«
»Märta hat ihre Sache so gut wie ein Mann gemacht«, sagte der Propst. »Alles ist gutgegangen. Aber wie steht es nun mit eurem Vater?«
»Er ist recht elend, aber bei klarem Bewußtsein, und er freute sich, als ich ihm sagte, daß der Herr Propst schon am Waldrand zu sehen sei.«
Der Propst ging nun zu Bård hinein, und die Geschwister setzten sich auf zwei breite Steinblöcke vor der Hütte und warteten. Sie fühlten sich feierlich gestimmt und redeten von ihrem Vater, der nun sterben würde. Sie sagten, er habe sich immer nur als gütiger Vater gezeigt. Aber glücklich sei er seit dem Tage, an dem der Mellomhof abbrannte, nie mehr gewesen, und so sei es wohl am besten, wenn er nun aus diesem Leben scheiden dürfe.
Da sagte die Schwester auf einmal, der Vater müsse doch etwas gehabt haben, was sein Gewissen schwer belaste.
»Er!« rief der Bruder. »Was sollte ihn denn bedrückt haben? Hat er denn gesagt, es sei da etwas, worüber er mit dem Propst vor seinem Tode noch reden wollte? Ich dachte, er hätte ihn nur rufen lassen, um das heilige Abendmahl zu empfangen.«
»Als er mich heute morgen fortschickte, sagte er, ich solle den Propst bitten, zu ihm zu kommen. Der Herr Propst sei der einzige Mensch auf dieser Welt, dem er seine große und schwere Sünde anvertrauen könnte.«
Ingilbert überlegte einen Augenblick, dann sagte er: »Das klingt ja sehr sonderbar. Ich möchte wissen, ob es nicht etwas sein kann, was er sich hier in der Einsamkeit eingebildet hat. Es ist gewiß damit, wie mit all dem andern, das er von dem Starken Bengt zu erzählen pflegt. Ich halte das alles nur für Einbildungen.«
»Gerade über den Starken Bengt wollte er mit dem Propst sprechen«, warf das Mädchen ein.
»Dann kannst du Gift darauf nehmen, daß alles miteinander Grillen sind«, erwiderte Ingilbert.
Damit stand er auf und trat an eine kleine Luke in der Wand der Almhütte, die offenstand, damit etwas Licht in die fensterlose Wohnstätte eindringe. Das Bett des Kranken stand ganz nah dabei, und so konnte Ingilbert alles, was der Vater sagte, verstehen; und der Sohn lauschte den Worten des Vaters ohne die geringsten Gewissensbisse. Vielleicht hatte er nicht einmal gehört, daß es unrecht sei, eine Beichte mit anzuhören. Jedenfalls hätte der Vater keine gefährlichen Geheimnisse zu enthüllen, davon war er fest überzeugt.
Nachdem Ingilbert eine Weile an der Luke gestanden hatte, ging er wieder zu seiner Schwester hin.
»Was habe ich gesagt?« begann er. »Der Vater erzählt gerade dem Propst, er und Mutter hätten dem alten General Löwensköld den Königsring gestohlen.«
»Ach, Gott erbarme sich!« rief die Schwester. »Sollen wir dem Propst nicht sagen, daß das eine Lüge ist und nur etwas, was er sich andichtet?«
»Jetzt können wir nichts tun«, versetzte Ingilbert. »Jetzt muß man ihn reden lassen, was er will. Wir können ja nachher mit dem Propst sprechen.«
Danach schlich er wieder an die Luke hin, um zu horchen. Und es dauerte lange, bis er aufs neue zu der Schwester trat.
»Jetzt sagt er, in derselben Nacht, da er und Mutter drunten in dem Grabe gewesen seien und den Ring gestohlen hätten, sei der Mellomhof abgebrannt. Und er glaubt, der General sei es gewesen, der das Haus angezündet hat.«
»Ach, das ist nur so eine Grille, das merkt man gleich«, sagte die Schwester. »Uns hat er ja gewiß Hunderte von Malen gesagt, der Starke Bengt habe den Mellomhof angezündet.«
Ingilbert stand schon wieder an seinem Horchposten, ehe sie ausgesprochen hatte. Er blieb lange dort stehen und horchte, und als er dann wieder zu der Schwester trat, war er beinahe aschgrau im Gesicht.
»Er sagt, der General sei es, der ihm all das Unglück geschickt habe, um ihn zu zwingen, den Ring zurückzugeben. Er sagt, Mutter habe Angst bekommen und gewollt, daß sie nach Hedeby gehen und dem Rittmeister den Ring zurückgeben sollten. Vater hätte ihr auch nur zu gern gehorcht, aber er habe es nicht gewagt, weil er meinte, sie würden dann alle beide gehängt werden, wenn sie mit dem Bekenntnis herausgerückt wären, daß sie einen Diebstahl an einem Toten verübt hatten. Und dann habe es Mutter nicht mehr aushalten können, und so sei sie hingegangen und habe sich ertränkt.«
Jetzt wurde auch die Schwester vor Entsetzen aschgrau im Gesicht.
»Aber«, sagte sie, »Vater hat doch immer gesagt, es sei ...«
»Ja, gewiß, gerade jetzt hat er dem Propst erklärt, er habe es nie gewagt, mit irgendeinem Menschen darüber zu sprechen, wer es gewesen wäre, der all das Unglück über ihn verhängt hätte. Nur zu uns Kindern, die nichts davon verstünden, habe er gesagt, es verfolge ihn einer, der der Starke Bengt genannt werde. Er sagte, die Bauersleute hätten den General immer den Starken Bengt genannt.«
Märta Bårdstochter sank auf dem Steinblock ganz in sich zusammen.
»Aber dann ist es ja wahr«, flüsterte sie so leise, wie wenn dies ihr letzter Atemzug wäre.
Sie sah sich nach allen Seiten um. Die Sennhütte stand am Ufer eines Waldweihers, und ringsum erhoben sich düstere bewaldete Bergrücken. Weit und breit war keine menschliche Behausung zu sehen, und es gab niemand, zu dem sie sich hätte flüchten können. Hier herrschte die große, undurchdringliche Einsamkeit.
Und es war ihr, als stünde dort im Dunkel unter den Bäumen der Tote auf der Lauer, neues Unglück über sie zu bringen.
Sie war noch ein solches Kind, daß sie die Schande und die Schmach, die die Eltern auf sich geladen hatten, gar nicht recht begreifen konnte; es war ihr, als würden sie alle von einem Gespenst verfolgt, einem unversöhnlichen allmächtigen Wesen aus dem Reich der Toten. Sie erwartete, dieses Gespenst vielleicht schon im nächsten Augenblick vor sich auftauchen zu sehen, und sie bekam solche Angst, daß ihre Zähne aufeinanderschlugen.
Sie dachte an den Vater, der nun seit sieben Jahren mit derselben Angst in der Seele herumgegangen war. Jetzt war sie vierzehn Jahre alt, und als der Mellomhof abbrannte, war sie sieben gewesen. Der Vater hatte also die ganze Zeit gewußt, daß der Tote auf der Jagd nach ihm gewesen war.
Nun durfte er sterben, und das war gut für ihn.
Ingilbert war wieder an der Luke gewesen, jetzt kam er aufs neue zu ihr zurück.
»Du glaubst es aber doch wohl nicht, Ingilbert?« fragte sie mit einem letzten Versuch, die Angst zu verscheuchen.
Aber siehe, Ingilberts Hände zitterten, und seine Augen waren starr vor Schrecken.
»Was soll ich glauben?« flüsterte Ingilbert. »Vater sagte, er habe mehrere Male nach Norwegen reisen wollen, um den Ring zu verkaufen; aber er habe nie fortkommen können. Das eine Mal wurde er krank, und das andere Mal brach das Pferd ein Bein, gerade als er vom Hof wegreiten wollte.«
»Was sagt der Propst?« fragte das Mädchen.
»Er fragte den Vater, warum er denn den Ring all die Jahre behalten habe, wenn es doch mit so großer Gefahr verknüpft gewesen sei, ihn zu besitzen. Vater aber antwortete, er habe geglaubt, der Rittmeister würde ihn hängen lassen, wenn er ihm seine Tat eingestände. Er habe keine Wahl gehabt, sondern sei gezwungen gewesen, den Ring zu behalten. Jetzt sei er aber am Sterben, und nun wolle er den Ring dem Propst übergeben, damit man ihn dem General in das Grab lege, wir Kinder aber von dem Fluch befreit würden und wieder ins Dorf hinunter ziehen könnten.«
»Ich bin froh, daß der Propst da ist«, sagte das Mädchen. »Was soll ich nur tun, wenn er wieder fort ist? Ich habe so große Angst. Mir ist, als stehe der General dort drüben unter den Fichten. Bedenke, er ist jeden Tag hier umhergegangen und hat uns bewacht! Und Vater hat ihn vielleicht gesehen.«
»Ich glaube auch, daß Vater ihn gesehen hat«, sagte Ingilbert.
Und wieder trat er an die Luke, um zu horchen. Als er zurückkam, hatte er einen andern Ausdruck in den Augen.
»Ich habe den Ring gesehen«, sagte er. »Vater hat ihn dem Propst übergeben. Er schimmert wie eine Feuerflamme. Er war rot und golden, und er leuchtete geradezu. Der Propst betrachtete ihn und sagte, er erkenne ihn wieder; es sei der Ring des Generals. Geh an die Luke hin, da kannst du ihn sehen.«
»Eher möchte ich eine Kreuzotter in meine Hand nehmen als diesen Ring sehen!« rief das Mädchen. »Du meinst doch nicht im Ernst, es sei schön, ihn anzusehen?«
Ingilbert schaute weg.
»Ich weiß, er hat uns zugrunde gerichtet«, sagte er; »aber er gefiel mir doch recht gut.«
Gerade als er dies sagte, ertönte die Stimme des Propstes stark und laut zu den beiden Geschwistern heraus. Bis jetzt hatte er immer den Kranken sprechen lassen. Jetzt war er an der Reihe.
Es war klar, der Propst konnte natürlich nicht auf all die wilden Reden von der Verfolgung durch einen Toten eingehen. Er versuchte, dem Bauern zu zeigen, daß es die Strafe Gottes war, die ihn treffen mußte, weil er das gräßliche Verbrechen begangen hatte, einen Toten zu bestehlen. Der Propst wollte durchaus nicht einräumen, der General habe die Macht gehabt, Feuersbrünste oder Krankheit über Menschen und Vieh zu verhängen. Nein, die Unglücksfälle, die Bård getroffen hätten, seien von Gott verhängt worden, um Bård noch bei Lebzeiten zur Reue und zur Rückgabe des gestohlenen Guts zu zwingen, damit seine Sünde ihm vergeben werde und er eines seligen Todes sterben könnte.
Der alte Bård Bårdsson lag ruhig da und hörte die Worte des Propstes an, ohne eine Einwendung zu machen. Zu überzeugen vermochten sie ihn aber wohl nicht. Er hatte zu viel Schreckliches erlebt, als daß er hätte glauben können, dies alles habe ihm Gott geschickt.
Und die jungen Menschenkinder draußen, die vor Gespensterfurcht und Geisterspuk zitterten, lebten nun wieder auf.
»Hörst du?« sagte Ingilbert und packte die Schwester heftig am Arm. »Der Propst sagt, es ist nicht der General gewesen.«
»Ja«, antwortete die Schwester. Sie saß mit gefalteten Händen da und sog jedes Wort, das der Propst sagte, tief in ihre Seele ein.
Ingilbert stand auf. Er atmete heftig und richtete sich gerade auf. Nun war er von seiner Angst befreit. Er sah wie ein andrer Mensch aus.
Eilig ging er auf die Haustür zu und trat ein.
»Was willst du?« fragte der Propst.
»Ich will ein paar Worte mit Vater reden.«
»Geh hinaus! Jetzt rede ich mit deinem Vater«, sagte der Propst streng.
Er wendete sich wieder Bård Bårdsson zu und redete bald recht streng, bald mild und erbarmungsvoll mit ihm.
Ingilbert setzte sich, die Hände vors Gesicht geschlagen, wieder auf den Steinblock. Aber eine große Unruhe hatte sich seiner bemächtigt. Er ging aufs neue in die Hütte hinein und wurde abermals fortgewiesen.
Als alles vorbei war, war es Ingilbert, der dem Propst den Weg durch den Wald zeigen sollte. Am Anfang ging alles gut, nach einer Weile aber kamen sie an ein mit Balken überbrücktes Moor. Der Propst konnte sich nicht erinnern, beim Herkommen über ein solches gekommen zu sein, und er fragte Ingilbert, ob er ihn nicht irreführe; dieser gab zur Antwort, es sei eine große Abkürzung, wenn sie den Weg über das Moor nähmen.
Der Propst sah Ingilbert scharf an. Er hatte zu bemerken gemeint, daß der Sohn wie sein Vater vom Golddurst besessen sei. Ingilbert war ja einmal ums andere in die Hütte hereingekommen, als wolle er es verhindern, daß der Vater den Ring weggebe.
»Du, Ingilbert, das ist ein schmaler, gefährlicher Weg«, sagte er. »Ich fürchte, das Pferd wird auf den glatten Stämmen ausgleiten.«
»Ich werde das Pferd führen, dann braucht der ehrwürdige Herr Propst keine Angst zu haben«, sagte Ingilbert, und damit griff er auch schon nach den Zügeln des Pferdes.
Als sie mitten auf dem Moor waren mit nichts als lockerem Schlamm und Moos nach allen Seiten, fing aber Ingilbert an, das Pferd zurückzutreiben. Es sah aus, als wollte er es von dem schmalen Steg abdrängen.
Das Pferd bäumte sich, und der Propst, der sich nur schwer im Sattel halten konnte, rief seinem Begleiter zu, er solle doch um Gottes willen die Zügel loslassen.
Ingilbert aber schien nichts zu hören, und der Propst sah, wie er mit düsterem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen mit dem Pferd kämpfte, um es in den bebenden Sumpf hineinzutreiben. Es war der sichere Tod für den Reiter und das Pferd.
Da steckte der Propst die Hand in die Tasche und zog einen kleinen Beutel aus Ziegenleder heraus. Den schleuderte er Ingilbert mitten ins Gesicht.
Dieser ließ die Zügel los, um den Beutel aufzufangen; dadurch wurde das Pferd frei und raste erschrocken über die Brücke weiter. Ingilbert aber blieb stehen und machte keinen Versuch, ihm zu folgen.
Fünftes Kapitel
Nach einem solchen Erlebnis ist es nicht verwunderlich, daß der Propst ein wenig wirr im Kopf war, und daß es Abend wurde, bis er den Weg ins Dorf hinunter fand. Ebensowenig ist es merkwürdig, daß er nicht auf der Olsbystraße, die der beste und kürzeste Weg war, aus dem Walde herauskam, sondern viel zu weit nach Süden abgebogen war und sich nun gerade am Ausgang des Waldes, dem Gutshof Hedeby gegenüber, befand.
Während er drinnen im Waldesdunkel umhergeritten war, hatte er gedacht, das erste, was er tun müsse, falls er glücklich nach Hause komme, sei, den Vogt herbeizurufen und ihn zu bitten, mit ihm in den Wald zu gehen, um Ingilbert den Ring wieder abzunehmen. Als er nun aber an Hedeby vorbeiritt, überlegte er einen Augenblick, ob er nicht da hineinreiten und dem Rittmeister Löwensköld mitteilen sollte, wer es gewesen war, der sich erdreistet hatte, in das Grab hinunterzusteigen und den Königsring zu stehlen.
Man könnte ja meinen, eine so natürliche Sache verlange keine lange Überlegung; aber der Propst zweifelte doch etwas, weil zwischen seinem Vater und dem Rittmeister einst nicht das beste Einvernehmen geherrscht hatte. Der Rittmeister war in ebenso hohem Grad ein Mann des Friedens, wie sein Vater ein Mann des Krieges gewesen war. Der Rittmeister hatte sich gleich nach dem mit den Russen geschlossenen Frieden aus dem Kriegsdienst abgemeldet und von da an seine Kraft dafür eingesetzt, dem Wohlstand des Landes wieder aufzuhelfen, der während der Kriegsjahre heruntergekommen war. Er war ein Gegner von Alleinherrschaft und Kriegsruhm, ja, er pflegte über Karl XII. selbst sowie auch über manches andere, was der alte Vater hochstellte, tadelnde Reden zu führen. Außerdem war der Sohn ein eifriger Teilnehmer im Reichstagskrieg gewesen, aber eben immer als Anhänger der Friedenspartei. Jawohl, er und der Vater hatten genug Grund zum Streiten gehabt.
Als der Ring des Generals vor sieben Jahren gestohlen worden war, hatten der Propst und viele andere mit ihm gemeint, der Rittmeister lasse es sich nicht besonders angelegen sein, ihn wieder zu erlangen. Und das war der Grund, warum der Propst nun bei sich selbst dachte: »Es hat keinen Wert, wenn ich mir die Mühe mache, hier auf Hedeby vom Pferd zu steigen. Der Rittmeister fragt nicht danach, ob es der Vater Bård Bårdsson oder Ingilbert ist, der den Ring am Finger trägt. Es ist am besten, ich rede gleich mit dem Lehnsmann Carelius über den Diebstahl.«
Gerade aber, als der Propst noch weiter überlegte, sah er, wie das Gittertor, das die Einfahrt nach Hedeby abschloß, ganz sacht aufging und weit offenstehen blieb.
Das sah recht merkwürdig aus; aber es gibt ja viele Gittertüren, die in dieser Weise von selbst aufgehen, wenn sie nicht ordentlich zugemacht worden sind, und der Propst dachte nicht weiter über diese Sache nach. Immerhin aber hielt er es für ein Zeichen, daß er in Hedeby einkehren sollte.
Der Rittmeister nahm ihn freundlich auf, ja fast besser, als es bei ihm der Brauch war.
»Es ist schön, daß du bei mir eingekehrt bist, verehrter Freund«, sagte er. »Ich habe mich danach gesehnt, dich zu sprechen, und habe heute schon mehrere Male in die Propstei hinübergehen wollen, um dir etwas ganz Merkwürdiges mitzuteilen.«
»Da wärest du, Freund Löwensköld, vergeblich gekommen«, entgegnete der Propst. »Schon in aller Frühe wurde ich zu einem Sterbenden auf die Olsbyalm gerufen und komme von da eben erst zurück. Das ist ein abenteuerlicher Tag für mich alten Mann gewesen.«
»Dasselbe kann ich auch sagen, obgleich ich kaum von meinem Sessel aufgestanden bin. Ich kann dir versichern, geschätzter Freund, obgleich ich bald ein Fünfziger bin und in den harten Kriegsfahrten sowie auch später noch allerhand mitgemacht habe, so ist mir doch nie etwas Merkwürdigeres widerfahren als das, was ich heute erlebt habe.«
»Wenn es so ist, dann will ich das Wort jetzt dir überlassen, Freund Löwensköld«, sagte Propst. »Auch ich habe dir eine ganz sonderbare Geschichte zu erzählen. Doch will ich nicht behaupten, es sei das Merkwürdigste, was mir je widerfahren ist.«
»Na ja«, sagte der Rittmeister. »Es ist ja möglich, daß du gar nichts Wunderbares an meiner Geschichte findest. Gerade deshalb wollte ich mich mit dir darüber aussprechen. – Du hast doch wohl schon von Gathenhielm reden hören?«
»Von dem schrecklichen Seeräuber und gewissenlosen Kaperkapitän, der von König Karl zum Admiral ernannt wurde? Wer hätte von dem nicht reden hören?«
»Heute mittag«, fuhr der Rittmeister fort, »kamen wir auf die alte Zeit zu sprechen. Meine Söhne und der Hauslehrer fragten mich darüber aus, wie es damals war, denn von so etwas will die Jugend immer gern reden hören. Aber nach all den schweren, harten Jahren, die wir nach König Karls Tod hier in Schweden haben durchmachen müssen, wo wir durch den Krieg und den Geldmangel großen Mangel an allem litten, danach, mein lieber Freund, nein, danach fragen sie nie. Bei Gott im Himmel droben, sollte man nicht meinen, sie rechneten für gar nichts, was es heißt, niedergebrannte Städte wieder aufzubauen, Eisenwerke und Fabriken anzulegen, Wälder zu roden und neue fruchtbare Äcker zu schaffen! Ich glaube, meine Söhne schämen sich meiner und meiner Zeitgenossen, weil wir aufhörten, mit Kriegsheeren auszuziehen und fremde Länder zu verwüsten. Sie scheinen zu glauben, wir seien schlechtere Männer als unsere Väter, und die alte schwedische Kraft sei von uns gewichen.«
»Da hast du ganz recht, Freund Löwensköld«, sagte der Propst. »Diese Vorliebe der Jugend für das Kriegshandwerk ist tief bedauerlich.«
»Nun, ich gab also dem Wunsche nach«, fuhr der Rittmeister fort, »und da sie etwas von einem großen Kriegshelden hören wollten, erzählte ich ihnen von Gathenhielm und seinem grausamen Verfahren gegen Kaufleute und friedliche Reisende, weil ich dachte, ich würde dadurch Entsetzen und Abscheu bei ihnen hervorrufen. Und als mir dies auch gelang, bat ich sie, nun auch zu bedenken, daß dieser Gathenhielm ein echter Sohn der Kriegszeit gewesen ist, und fragte sie, ob sie wohl wünschten, die Erde von solchen Teufelsbraten bevölkert zu sehen?
Ehe jedoch meine Söhne mir auf diese Frage Antwort gegeben hatten, ergriff der Hauslehrer das Wort und bat mich, ihm zu erlauben, nun auch eine Geschichte von Gathenhielm zu erzählen. Und da er sagte, diese Geschichte bestätige nur, was ich schon vorher von Gathenhielms Wildheit und Raserei gesagt habe, gab ich die Erlaubnis.
Und dann begann er zu erzählen: Nachdem Gathenhielm in jungen Jahren gestorben und seine Leiche in der Kirche zu Onsala in einem Marmorsarkophag, den er dem König von Dänemark geraubt hatte, beigesetzt worden war, stellte sich in der Kirche ein so fürchterlicher Geisterspuk ein, daß es die Onsalaer Kirchspielbewohner nicht mehr aushalten konnten. Sie wußten sich schließlich keinen andern Rat, als die Leiche aus dem Sarkophag herauszunehmen und sie auf einer öden Schäre draußen im Meer zu beerdigen. In der Kirche hatte man nun allerdings Frieden, die Fischer aber, die auf ihren Fahrten in der Nähe von Gathenhielms neuer Ruhestätte vorbeikamen, erzählten, man höre von dort her immer Lärm und Getöse, und der Schaum der Wogen spritze über die öde Schäre jederzeit hoch empor. Die Fischer meinten, alle die Seeleute und Krämer, die Gathenhielm von den gekaperten Schiffen einst über Bord hatte werfen lassen, würden jetzt aus ihren nassen Gräbern emporsteigen, ihn zu quälen und zu peinigen, und sie hüteten sich sehr davor, in dieser Richtung zu fahren. In einer finsteren Nacht war aber doch einer von ihnen in die Nähe dieser gefährlichen Stelle geraten. Da fühlte er sich von einem Wirbelwind erfaßt, der Schaum peitschte ihm ins Gesicht, und eine stöhnende Stimme rief ihm zu: ›Geh nach Gata in Onsala und sag meiner Frau, sie soll mir sieben Bündel Haselruten und zwei Wacholderknüppel schicken!‹«
Der Propst hatte bisher ruhig und geduldig diese Geschichte angehört; als er aber merkte, daß sein Nachbar nur eine gewöhnliche Spukgeschichte zu berichten hatte, konnte er eine Bewegung der Ungeduld kaum unterdrücken.
Der Rittmeister beachtete es indes gar nicht, sondern fuhr ruhig fort: »Du wirst verstehen, daß gar nichts andres in Frage kommen konnte, als dem Befehl Folge zu leisten. Und Gathenhielms Frau, nun, sie gehorchte ebenfalls. Die zähesten Haselruten und die derbsten Wacholderknüppel wurden herbeigeschafft, und ein Knecht von Onsala ruderte mit ihnen hinaus nach der Schäre.«
Jetzt aber machte der Propst einen so deutlichen Versuch, den Rittmeister zu unterbrechen, daß dieser es nicht mehr unbeachtet lassen konnte.
»Ja, ich weiß, was du denkst, verehrter Freund. Ich machte mir auch dieselben Gedanken, als ich heute mittag diese Geschichte hörte, aber, bitte, höre mir bis zum Schluß zu. Ich habe also sagen wollen, das müsse ein beherzter und seinem Hausherrn sehr gehorsamer Mann gewesen sein, sonst hätte er es wohl kaum gewagt, diesen Auftrag auszuführen. Nun, als er in die Nähe des Begräbnisplatzes kam, da schlugen die Wogen hoch darüber weg, wie wenn ein regelrechter Sturm herrschte, und Lärm und Waffengeklirr ertönte weit umher. Der Knecht ruderte aber doch so nah wie möglich heran, und es gelang ihm, die beiden Wacholderknüppel und die Haselrutenbündel auf die Schäre zu werfen. Darauf aber entfernte er sich mit hurtigen Ruderschlägen von dem Ort des Grauens.«
»Mein verehrter Freund ...«, begann der Propst.
Der Rittmeister aber ließ sich nicht unterbrechen: »Schon in kurzem Abstand aber ließ er die Ruder ruhen, um zu sehen, ob sich nicht etwas Merkwürdiges begeben würde. Und er brauchte nicht vergebens zu warten. Denn auf einmal stieg der Gischt himmelhoch über der Schäre empor, das Getöse wurde wie das Donnern einer Feldschlacht, und grausige Jammerrufe ertönten über das Meer hin. Eine ganze Weile ging es, jedoch mit abnehmender Heftigkeit, so weiter, und schließlich hörten die Wogen ganz auf, gegen Gathenhielms Grab anzustürmen. Und bald lag die Schäre ruhig und still da, wie alle die andern Schären auch. Der Knecht tauchte die Ruder nun wieder ein, um den Heimweg anzutreten; doch in demselben Augenblick hörte er eine höhnische, triumphierende Stimme, die ihm zurief: ›Geh nach Gata in Onsala und bestelle meiner Frau, daß Lasse Gathenhielm im Tode wie einst im Leben über seine Feinde siegt.‹«
Der Propst hatte jetzt mit gesenktem Kopf zugehört.
»Als der Hauslehrer dies letzte erzählte«, fuhr der Rittmeister fort, »merkte ich wohl, daß meine Söhne mit dem Schurken Gathenhielm Mitleid empfanden und gern von seinem Übermut erzählen hörten. Deshalb erklärte ich, diese Geschichte schiene mir sehr gut aneinandergehängt zu sein, sei aber kaum etwas andres als Lüge und Dichtung. ›Denn‹, sagte ich, ›wenn ein so wilder Seeräuber wie Gathenhielm die Kraft gehabt hätte, sich auch noch nach seinem Tode zu verteidigen – wie ließe es sich dann erklären, warum mein Vater, der ein ebensolcher Haudegen wie Gathenhielm, aber dabei ein guter und redlicher Mensch war, einen Dieb in sein Grab hineindringen und sich das Liebste, das er besaß, rauben ließ, ohne die Macht zu haben, die Untat zu verhindern und später den Schuldigen in irgendeiner Weise zu verfolgen oder zu beunruhigen.‹«
Bei diesen Worten stand der Propst mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit auf und sagte: »Das ist auch ganz meine Meinung.«